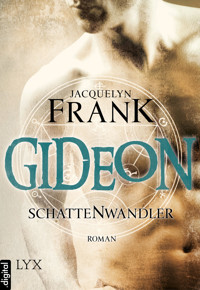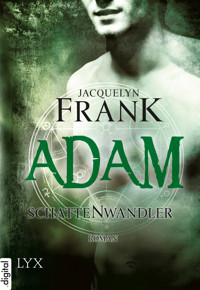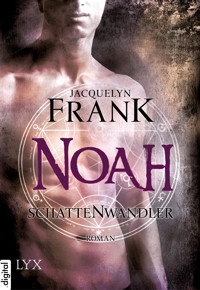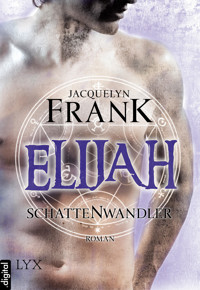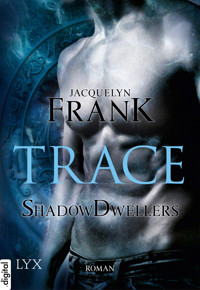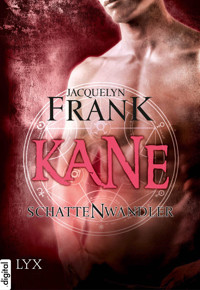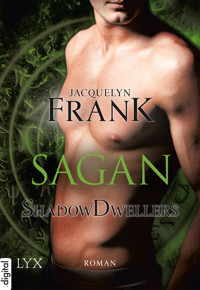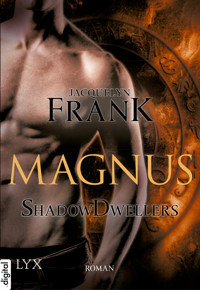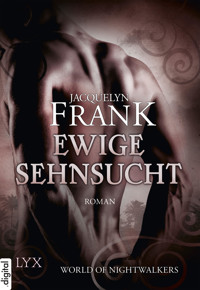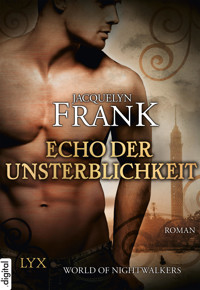3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Hocherotisch und zutiefst romantisch! Seit Monaten wird Amara von einer geheimen Organisation gefangen gehalten und perfiden Experimenten unterzogen. Als sie glaubt, es nicht länger ertragen zu können, trifft sie auf den Polizisten Nick, der genau wie sie als Versuchsobjekt verschleppt wurde. Gemeinsam werden sie in einen Raum gesperrt und sich selbst überlassen. Trotz der widrigen Umstände fühlen sie sich auf unwiderstehliche Weise zueinander hingezogen, und sie begreifen, dass sie nur gemeinsam eine Chance haben, ihren Peinigern zu entkommen. (ca. 150 Buchseiten)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 176
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Inhalt
Titel
Zu diesem Buch
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Epilog
Die Autorin
Die Romane von Jacquelyn Frank bei LYX
Impressum
JACQUELYN FRANK
Das Phoenix-Projekt
Ins Deutsche übertragen
von Barbara Först
Zu diesem Buch
Seit Monaten wird Amara von einer geheimen Organisation gefangen gehalten und perfiden Experimenten unterzogen. Sie weiß nicht, was mit ihr gemacht wird und auch nicht warum. Als sie glaubt, es nicht länger ertragen zu können, trifft sie auf den Polizisten Nick, der genau wie sie als Versuchsobjekt verschleppt wurde. Trotz der widrigen Umstände fühlen sie sich auf unwiderstehliche Weise zueinander hingezogen. Die Leidenschaft, die sie beide schon bald nicht mehr bezähmen können, ist anders als alles, was sie bisher empfunden haben. Schon bald merken Amara und Nick, dass ihre Vereinigung etwas in ihnen verändert hat. Tief in ihrem Innern erwächst eine ungeahnte neue Kraft, und sie begreifen, dass sie nur gemeinsam eine Chance haben, ihren Peinigern zu entkommen.
1
Amara konnte die Stellen, die schmerzten, schon gar nicht mehr zählen.
Wie üblich.
Sie schlug die Augen auf und hoffte in dem kurzen Augenblick zwischen Schlafen und Wachen auf das Wunder, sich wieder in ihrer trostlosen Kammer im Arbeitshaus zu befinden. Nie hätte sie geglaubt, dass sie sich nach der Zeit zurückzusehnen würde, als sie schwer schuften musste, nur um das Privileg einer dunklen, fensterlosen Zelle zu haben. Die schmale, graue Matratze war gerade breit genug für eine Person gewesen, die Zelle lang genug für das Bett und einen Nachttisch und eine kleine Kommode daneben. Das Licht und der digitale Wecker waren stets zur Schlafenszeit ausgegangen und hatten Amara eine Stunde vor Schichtbeginn geweckt. Es war mühsam und beengt gewesen, besser jedoch als die Alternativen: zu verhungern oder nachts von Straßengangs vergewaltigt zu werden, weil man kein sicheres Dach über dem Kopf hatte.
Es war auf jeden Fall besser gewesen als das hier.
Amara öffnete die Augen und starrte in schmerzend grelles Deckenlicht, auf blendend weiße Wände.
Sofort verursachte die gleißende Helligkeit ihr Kopfschmerzen. Blinzelnd versuchte sie, ihre brennenden Augen an die Umgebung zu gewöhnen.
Wie jeden Morgen öffnete sich die Tür, kaum dass sie aufgewacht war, und Raul betrat das Zimmer.
»Guten Morgen«, begrüßte er sie zunächst mit falscher Höflichkeit, dann widmete er sich der üblichen Routine und zapfte mehrere Röhrchen Blut aus dem Dauerkatheter in ihrem Arm. Als Nächstes prüfte er die Vitalfunktionen ihres Körpers, während Amara steif und ergeben dalag.
Nicht, dass sie eine Wahl gehabt hätte.
Nicht mehr.
»Wie fühlen Sie sich, Amara?«
»Wund. Müde. Gereizt.« Sie setzte ein freundliches Lächeln auf, das eine himmelschreiende Lüge war. »Und ich hab Kopfweh.«
Raul machte wie üblich: »Hm-hm.« Nie gab er vor, Mitleid mit ihr zu haben, und offensichtlich empfand er auch keins. Es hat wahrscheinlich keinen Sinn, nett zu mir zu sein, dachte Amara. Soweit sie wusste, war sie nur eine von unzähligen Laborratten, und die Mitarbeiter taten besser daran, keinerlei Gefühle für sie zu entwickeln.
Besonders, da das sogenannte Phoenix-Projekt angeblich eine Sterblichkeitsrate von 90 Prozent hatte.
»Sagen Sie mal, Raul«, begann sie im Konversationston und setzte sich im Bett auf, stark behindert von den vielen Elektroden, die jede Nacht auf ihrem Schädel befestigt wurden. Die meisten Frauen hatten sich die Haare streichholzkurz geschnitten oder sogar komplett abrasiert, damit sie nicht verklebten, aber Amara wollte das nicht. Sie hatten ihr schon genug geraubt, sie würde ihnen nicht auch noch ihr langes, platinblondes Haar opfern. Außerdem hatte sie genug Zeit, um es jeden Tag zu waschen und den Klebstoff zu entfernen. Und welche Rolle spielte es schon, wenn ihr Haar dünner wurde, weil sie sich jeden Tag etliche Strähnen ausriss? Es war immer noch lang und gehörte immer noch ihr. »Was kommt denn heute dran? Arzneimitteltests? Drogen? Darauf fahr ich ja am meisten ab, solange ich keine Halluzinationen kriege. Die letzten waren wirklich scheußlich. Oder spleißen wir Gene? Vielleicht … ooohh, sagen Sie’s nicht! Strahlentherapie? Nicht? Nun kommen Sie schon … nicht mal ein klitzekleiner Hinweis?«
»Haben Sie Ihre Periode?«, erkundigte sich Raul, gründlich und gelangweilt wie stets, selbst angesichts von Fragen, die er niemals beantworten würde – wie sie beide sehr wohl wussten.
»Nee. Möglicherweise aber PMS. Bin immerhin gereizt, sagte ich das schon?«
»Mit Ihren Implantaten alles in Ordnung?«
Er wollte wissen, ob sie eines verloren hatte. Amara hatte eine sehr empfindliche Haut, und von Zeit zu Zeit stieß ihr Körper die Implantate ab, spie sie sozusagen trotzig aus, als wollte er sagen: Nehmt das, ihr Scheißkerle!
Amara liebte ihren Körper.
Da sie wusste, dass Raul es sich trotz seiner höflichen Frage nicht nehmen lassen würde, selber nachzusehen, zeigte sie ihm ihre Unterarme und Waden, in die Peilsender und Infusionsgeräte implantiert waren. Bei einem Fluchtversuch wäre ihr eine tödliche Dosis injiziert worden. Und wenn sie randalierte, erhielt sie Tranquilizer. Außerdem gab es Mittel, von denen einem speiübel wurde: als Strafe für Ungehorsam dem Personal gegenüber, das ständig Tests und Begutachtungen durchzuführen hatte.
Zum Glück zählte es nicht als Renitenz, sich wie ein Klugscheißer zu verhalten. Sonst hätte Amara die gesamten letzten drei Monate in der Einrichtung kotzend verbracht.
»Heute ist der große Tag.«
Nach diesem etwas merkwürdigen Abschiedssatz verließ Raul das Zimmer. Amara starrte ihm mit offenem Mund nach.
Heute ist der große Tag? Was zum Teufel sollte denn das bedeuten? Eiskalte Furcht erfüllte sie von Kopf bis Fuß. Sie schlang die Arme um sich und eilte in die winzige Nasszelle, die zu ihrem Zimmer gehörte. Dies war der einzige Vorzug gegenüber dem Arbeitshaus. Ein eigenes Bad. Wahrscheinlich nur, damit man noch mehr Körperfunktionen kontrollieren und ihr Verhalten beobachten konnte, wenn sie sich allein wähnte. Amara hatte schnell herausbekommen, dass sie sowohl im Zimmer wie auch im Bad von Kameras überwacht wurde. Jedes Mal, wenn sie auf die verdammte Toilette musste, hätte sie denen ein Schauspiel bieten können, aber sie würden sie bestimmt nicht beim Onanieren erwischen. Perverse Wichser. Was zum Teufel ging es die Wissenschaft an, wie eine Frau pinkelte?
Großer Tag heute.
Neunzig Prozent Sterblichkeitsrate.
Amara bezweifelte, dass es ein guter Tag werden würde.
Doch das war hier ohnehin nie der Fall.
2
»Er ist neu«, verkündete Mina mit einem affektierten Schnurren, das wie der wohlige Laut einer Katze klang. Sie beugte sich auf ihrem Stuhl vor und starrte den Mann unverhohlen an. Er trug die gleichen grauen Jogginghosen und T-Shirts wie alle, doch selbst Amara musste zugeben, dass er sich von den anderen unterschied. Doch das lag vermutlich daran, dass er mindestens einen Kopf größer war. »Wow. Guck dir nur mal seine Schultern an. Kein Wunder, dass sie ihn gekrallt haben. Das ist doch mal ein Prachtstück.«
Okay, gab Amara widerwillig zu, da hat sie wohl recht. Der Typ war so massiv wie ein Panzer, aber das würde nicht lange vorhalten, denn die langweiligen Tage, die man mit Kartenspielen oder öden Spaziergängen an der Umzäunung herumbrachte, taugten kaum zu einem aktiven Lifestyle. Die Muskeln seiner breiten Schultern würden verkümmern, das stramme Sixpack würde verschwinden. Es wäre wirklich eine Schande, wenn er diese prachtvollen Oberschenkel verlöre, die Baumstämmen glichen, und den knackigen Hintern, denn im Augenblick sah er noch zum Anbeißen aus.
Amara gestattete sich ein Grinsen und betrachtete den Dunkelhaarigen, der unruhig auf und ab lief. Das Schöne an Jogginghosen war, dass sie sich so eng an gewisse männliche Körperteile schmiegten. Unter dem weichen Stoff konnte sie seinen kräftigen Schwanz erkennen. Als ihr bewusst wurde, wohin sie starrte, kicherte Amara peinlich berührt und schaute schnell woanders hin.
»Er wirkt ganz schön nervös«, sagte sie zu ihren Gefährtinnen. Und tatsächlich sah man die mahlende Bewegung seines Kiefers. Seine Fäuste waren geballt. Er sah aus, als würde er am liebsten jemanden in die Fresse schlagen.
»Ich wette, dass ich ihn runterholen könnte«, kicherte Mina. »Ich würd schon für seine Entspannung sorgen. Müsste bloß ein paarmal kräftig lutschen, und schon würde er kommen.«
»Mina!«, schalt Amara. Sie rutschte verlegen auf ihrem Stuhl herum und lachte über die Kühnheit ihrer Freundin, versuchte die Bilder zu verdrängen, die ihr ungebeten in den Kopf kamen. »Hast du eigentlich nur Sex und Blowjobs im Kopf?«
»Also bitte, denkst du bei seinem Anblick etwa nicht daran? Gib’s doch zu! Er strotzt ja förmlich vor Testosteron. Sie haben ihn in den Gemeinschaftsraum gelassen, also ist er lange genug hier, um Bescheid zu wissen, aber es gefällt ihm nicht. Andererseits ist er noch relativ frisch und nicht so apathisch wie die anderen. Schau ihn doch an: Lauert in der Ecke wie ein eingesperrter Jaguar.« Mina grinste wissend. »Er ist ein wildes Tier.«
»Noch. Bald wird er wie die anderen sein.« Amara seufzte. Sie knabberte nervös an ihrer Unterlippe, als ihr Rauls rätselhafte Bemerkung wieder einfiel. Heute ist der große Tag. Was sollte das heißen? Mein Gott, was hatten sie jetzt wieder vor? Welche von ihnen würde nicht mehr zurückkehren? Mina, Rachael und Devona waren fast so etwas wie Freundinnen geworden, obwohl Amara versucht hatte, sich von allen fernzuhalten. Am Anfang, als sie alle neu und komplett ahnungslos waren, hatten sich rasch Notfreundschaften gebildet. Aber nachdem Julie eines Tages vor ihren Augen tot zusammengebrochen war – Resultat der neuen Droge, die sie an ihr testeten –, hatte Amara begriffen, dass es nichts brachte, sich näher auf jemanden einzulassen. Doch trotz ihrer guten Vorsätze war zwischen den vier Frauen, die bis jetzt überlebt hatten, ein Zusammenhalt entstanden, zunächst als eine Art Kaffeeklatsch, dann als Frühstücksklatsch, und inzwischen gluckten sie den ganzen Tag zusammen.
Freunde waren hier eine Notwendigkeit. Weder soziale noch psychologische Merkmale hatten die Auswahl der menschlichen Versuchskaninchen bestimmt, und so waren auch einige Kranke, Psychos und Spinner darunter. Obwohl die Kameraüberwachung lückenlos war, schritt das Personal selten ein, wenn eine Frau belästigt oder gar vergewaltigt wurde. Man gestattete den Männern, sich in einen Aggressionsrausch hineinzusteigern, und beobachtete dann in aller Seelenruhe die Folgen. Amara glaubte, dass es sich um eine morbide Faszination handelte sowie um Tests von Psychodrogen. Zu diesem Schluss war sie gekommen, nachdem sie im Ruheraum beobachtet hatte, wie Spencer Holbrook, ein unglaublich netter, schüchterner Junge, wie eine Bestie über ein wehrloses Mädchen hergefallen war. Er hatte sich in sie gebohrt wie ein brünstiges Tier und sich buchstäblich zu Tode gefickt. Nach sechs Orgasmen in ungefähr sechs Minuten war er einem Herz- oder Schlaganfall erlegen.
Danach waren die Security-Leute in aller Seelenruhe in den Raum geschlendert und hatten alles aufgewischt, und von den Leichen oder Opfern hatte man nie wieder etwas gehört oder gesehen. Amara wusste nicht, was schlimmer war – das Ereignis selbst, oder die Tatsache, dass keiner Anstalten gemacht hatte zu helfen – ganze sechs Minuten lang. Doch nach drei Monaten eines Lebens in ständiger Bedrohung war den Probanden kaum noch Zorn oder Widerstand verblieben, und die nackte Angst um das eigene Überleben hatte die Oberhand gewonnen.
Kurz hatte Amara erwogen, ihren Freundinnen von Rauls Bemerkung zu erzählen, aber es konnte gut sein, dass »der große Tag« nur ein psychologischer Trick war. Sie konnte sich ja vor Angst in die Hosen machen, aber ihre Freundinnen würde sie nicht hineinziehen. Was auch immer geschehen sollte, würde geschehen, es war zwecklos, wenn man vorher Bescheid wusste. In Trink- oder Hungerstreik zu treten ist die reinste Zeitverschwendung, wenn deine Zeit abgelaufen ist. Im Grunde waren sie alle nichts weiter als stetiger Nachschub an Versuchstieren. Wie Kaninchen, Affen und Ratten wurden sie in einer sauberen, sterilen Umgebung gehalten, bis ein Wissenschaftler Verwendung für sie hatte. Dann wurden sie getestet, gespritzt und wieder in ihre Zelle geschickt … oder man hörte nie wieder etwas von ihnen.
Amara hatte das Gefühl, dass nun der Zeitpunkt ihrer Verwendung gekommen war. Und richtig, kaum hatte sie ihre leere Kaffeetasse hingestellt, als Raul auch schon in Begleitung zweier bulliger Krankenwärter erschien und sich vielsagend hinter ihr aufbaute. Mina kniff zornig die Augen zusammen und ballte die Fäuste auf dem Tisch. Doch etwas zu tun lag nicht in ihrer Macht. Amara war froh, dass die Frauen keinen Streit anfingen. Sie wollte nicht, dass sie ihretwegen zu leiden hatten. Schon bald würden auch sie an die Reihe kommen.
Sie stand auf, trat gehorsam zwischen die beiden Krankenwärter und folgte Raul. Im Gemeinschaftsraum entspann sich ein Handgemenge, als der Neue ebenfalls ausgewählt und hinausgebracht wurde. Sie stießen ihn brutal vorwärts und hielten die Fernbedienungen griffbereit, mit denen sie seine Disziplinierungsimplantate aktivieren konnten. Amara schaute seine Arme an, sie wollte sehen, wie alt seine OP-Narben waren. Die Einschnitte waren kaum mehr sichtbar, was bedeutete, dass er sich schon länger gegen seine Gefangenschaft wehrte. Sie war froh, dass er schließlich nachgegeben hatte. Sonst hätten sie ihn getötet und die Kosten einfach abgeschrieben.
Wieder erhielt der Mann einen Stoß. Die Krankenwärter genossen es offenbar, dass sie einen derart starken Mann herumschubsen konnten. Manche waren eben so. Es gab auch nette. Die meisten aber waren wie Raul.
Der Stoß ließ den Turm eisenharter Muskeln auf Amara prallen, sie verlor den Halt und stürzte mit dem Gesicht voran auf den blank polierten Boden. Bevor sie überhaupt merkte, dass sie sich Knie, Ellbogen und Kinn aufgeschürft hatte, spürte sie seine großen Hände. Dann wurde sie an einen unglaublich warmen Körper gedrückt. So viel Wärme hatte sie nicht mehr gespürt, seit sie aus ihrem Bett im Arbeitshaus entführt worden und in dieses Kühlhaus gebracht worden war, wo die Kälte jegliches Wachstum von Keimen verhinderte.
»Alles in Ordnung? Tut mir leid, aber diese beiden Schwachköpfe haben mich geschubst.«
Amara schaute in meergrüne Augen mit besorgtem Ausdruck und verspürte den lächerlichen Drang loszuheulen. Zu schade, wenn auch diese Augen eines Tages jegliches Mitgefühl verlören, so wie es allen hier erging. Der Mann lächelte sogar ein wenig, was ihn noch anziehender machte, und schob ihr die Haare aus dem Gesicht.
»Sie haben noch Ihr Haar.« Amara spürte, dass er es nicht zu laut sagen wollte. »Es ist schön, eine hübsche Frau mit langem Haar zu sehen. Ist schon ’ne Weile her.«
»Danke«, sagte Amara, weil ihr nichts Besseres einfiel. »Ich habe aber schon viele verloren.«
Sein Lächeln erlosch, und er nickte kurz. Dann spürten sie die Füße der Krankenwärter in den Rippen.
»Alles okay? Können Sie aufstehen?«, erkundigte er sich.
»Klar.«
Sie standen gleichzeitig auf. Der Mann hielt sie immer noch in seinen Armen, so eng, dass ihre Nippel sich durch die dünne Baumwolle des T-Shirts an seine Brust drückten. Da ihr keinerlei Unterwäsche zugestanden worden war – die war hier nicht erlaubt –, kam Amara sich geradezu nackt vor. Wahrscheinlich lag es daran, dass sie seit langer Zeit nur noch aus medizinischen Gründen angefasst worden war. Während die meergrünen Augen des Mannes über ihren Körper glitten, spürte sie, dass sein Blick durchaus nichts Medizinisches an sich hatte.
»Bewegt euch!«, bellten die Wärter barsch.
Sie bewegten sich. Manche der Wärter waren schießwütig, und weder Amara noch er wollten sich drei Tage lang die Eingeweide aus dem Leib kotzen oder Elektroschocks versetzt bekommen. Amara spürte, wie der Arm des Mannes zu ihrer Taille hinunterglitt.
»Hoffe, es stört Sie nicht«, sagte er gedämpft. »Erspare mir vermutlich ein paar derbe Schubser, wenn ich mich nah bei Ihnen halte. Die gehen mir allmählich heftig auf den Zeiger, und ich stehe kurz davor, mir die große Kotzeritis einzuhandeln. Wäre es allerdings wert, wenn ich dafür ein paar Kiefer brechen dürfte.«
»Seien Sie bloß vorsichtig«, erwiderte Amara ebenso leise. »Die zögern nicht, Sie zu töten, wenn Sie Ärger machen.«
»Ja.« Der Mann verzog das Gesicht. »Hab ich mir schon gedacht. Ich werd einfach nur hin und wieder Ärger machen.« Und er warf ihr ein keckes Grinsen zu. Sein etwas zu langer Militärhaarschnitt und sein kantiges Kinn ließen ihn aussehen wie einen, der hart im Nehmen war, aber dieses entwaffnende Lächeln, das bis zu seinen Augen reichte, verlieh ihm das schelmische Aussehen eines Knaben. »Und – wo haben die Sie hergeholt?«
Amara wollte eigentlich keine Gefangenengeschichten austauschen, aber während sie den grellweißen Korridor entlanggetrieben wurden, brauchte sie etwas, um ihre aufgepeitschten Nerven zu beruhigen.
»Aus dem Arbeitshaus in Reeceville. Die haben eine ganze Gruppe von uns aus den Betten entführt. Und Sie?«
»Ich bin Cop. Ein Bundescop. Irgendwie bin ich diesem Betrieb wohl zu nahe gekommen«, gestand er mit drolliger Miene. Dann verzog er das Gesicht. »Tut mir leid.«
»Was tut Ihnen leid?«, fragte Amara überrascht.
»Dass ich meinen Job nicht richtig gemacht habe. Ich kann nur hoffen, dass meine Kollegen wissen, an welchem Fall ich dran war. Hab allein gearbeitet und bin zu schnell zu weit vorgeprescht. Bevor ich meinen Bericht abgeben konnte, bin ich erwischt worden. Sollte wahrscheinlich froh sein, dass ich noch lebe.«
»Das kann sich hier schnell ändern«, flüsterte Amara traurig.
Er verstärkte seinen Griff um ihre Taille, wahrscheinlich um sie zu trösten. Dieser Mann war ein völlig Fremder, und es gab keinen Grund, ihm zu vertrauen, aber dieser freundlichen Geste in einem Umfeld völliger Kälte konnte Amara kaum widerstehen. Sie rieb sich den aufgeschürften Ellbogen und drückte sich enger an seinen warmen Körper.
»Sie frieren ja«, stellte er stirnrunzelnd fest.
»Ständig. Hab mich schon dran gewöhnt«, erwiderte sie achselzuckend.
»Ich hingegen bin ein richtiger Ofen, wenn Ihnen also kalt ist, können Sie sich jederzeit bei mir wärmen.«
Amara warf ihm einen Blick zu, und er stöhnte auf, als ihm klar wurde, wie das klang. Sie konnte nicht anders, als über seine zerknirschte Miene zu lachen.
»Ich habe damit nur sagen wollen …«
»Ich weiß, wie Sie’s gemeint haben. Und danke. Das war sehr nett.«
»Wie heißen Sie?«
»Amara«, erwiderte sie leise. Als sie die Türen des Labors vor sich sah, schmiegte sie sich wieder an ihn, suchte Schutz bei seiner Kraft.
»Und wie heißen Sie?« Sie versuchte, keine Panik in ihrer Stimme durchklingen zu lassen, und wusste gleichzeitig, dass es ihr jämmerlich misslang.
»Nick. Nick Gregory.«
»Nick«, wiederholte sie. Sie blieb kurz stehen und sah ihm in die Augen, legte ihre Hand auf seine, die immer noch auf ihrer Taille lag. »Nick«, sagte sie zärtlich und aufrichtig, »ich bedaure, dich kennengelernt zu haben.«
Er verstand sogleich, was sie meinte.
»Ja.« Er schaute auf die Türen des Labors, die mit einem pneumatischen Zischen aufglitten. »Ich auch, Amara.«
3
Als Nick erwachte, hatte er das Gefühl, sich aus einem zähen Morast befreien zu müssen. Es war beinahe unmöglich, sich zu bewegen oder zu atmen. Sämtliche Muskeln schmerzten, als hätte er es reichlich übertrieben und sechs Runden Zirkeltraining absolviert. Selbst seine Eingeweide taten bei der geringsten Bewegung weh.
Das Letzte, an das er sich erinnerte, war eine hübsche, kleine Blondine mit einem verlorenen Ausdruck in ihren kupferfarbenen Augen. Es war überdeutlich, dass sie längst alle Hoffnung aufgegeben hatte. Aber dennoch hatte sie in jenen letzten Augenblicken, bevor man sie getrennt und auf Labortische geschnallt hatte, Angst und Widerstand gezeigt. Zum abertausendsten Mal warf Nick sich vor, ein verantwortungsloser Schwachkopf zu sein. Er hätte vorsichtiger sein müssen. Er hätte Meldung erstatten müssen. Sein Vorgesetzter meckerte ständig über seine »Cowboymanieren« und hatte ihn gewarnt, dass sie ihm eines schönen Tages noch zum Verhängnis werden würden. Nun, jetzt war dieser schöne Tag da. Und es war ein schmerzhafter Tag, denn es fühlte sich so an, als wäre er von einer verdammten Explosion erwischt worden.
Nick versuchte, die Augen aufzumachen. Es fühlte sich an, als säße eine Ladung Rollsplitt unter seinen Lidern. Auch sein Mund war furchtbar trocken. Er überlegte, was sie wohl mit ihm angestellt hatten. Da er sich so vorkam, als hätte er ein paar zünftige Runden mit dem Boxweltmeister im Schwergewicht hinter sich, konnte es nichts Erfreuliches sein. Zu allem Überfluss hatten sie einen miesen Trick angewandt, um ihn zu fesseln: Einer der beiden Krankenwärter hatte Amaras Brüste kurz angetatscht und ihn damit abgelenkt. Es hatte Nick schier umgebracht, wie sie den Kopf abwandte, sich auf die Lippen biss und die Augen schloss, als könnte sie sich der Situation mit schierer Willenskraft entziehen.
Noch ein Fehler, den er seiner langen Liste von Versäumnissen hinzufügen konnte. Er hätte nicht zeigen dürfen, wie sehr sie ihm gefiel – nicht, solange die Aufpasser noch dabei waren und ihm demonstrieren konnten, wer hier das Sagen hatte. Er hatte von Anfang an wie verrückt gegen sie gekämpft, hatte einen Monat lang Hiebe ausgeteilt und Ärger gemacht, bis sie ihm schließlich ein Ultimatum gestellt hatten: Gib nach oder stirb.
Nachdem Nick begriffen hatte, dass hier mehr als sein eigenes Leben auf dem Spiel stand, wenn sie ihn töteten, bevor er sämtliche Möglichkeiten zur Flucht erkundet hatte, hatte er schließlich nachgegeben. Nun begann er sich zu fragen, ob das eine gute Idee gewesen war.
Der Seelenklempner im Dezernat hatte gesagt, er leide unter einem »Heldenkomplex«, der ihm eines Tages den Tod bringen werde oder gar Schlimmeres.
Wie es aussah, war das hier das Schlimmere.
Nick öffnete die Augen einen winzigen Spalt … und machte sie schleunigst wieder zu. Verdammt. Alles hier war so weiß, dass es in den Augen wehtat: Monitore, Computer, Flaschen, Sonden – einfach alles. Nicht weiß waren einzig und allein die kleinen Laborratten in ihren grauen Monturen, die wie aufgescheuchte Hunde umherwieselten.