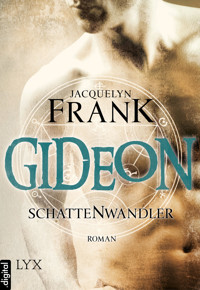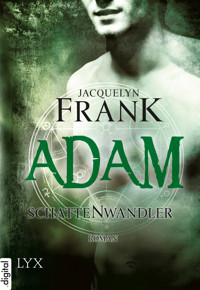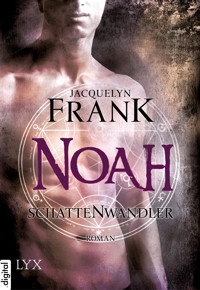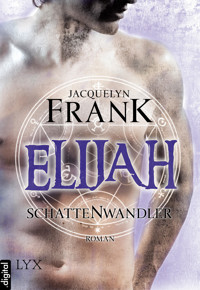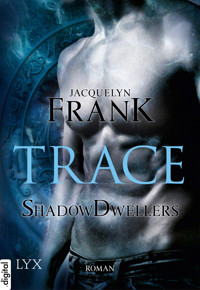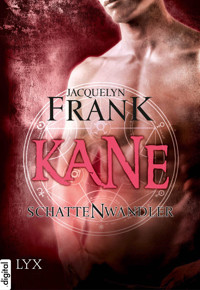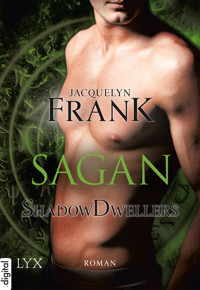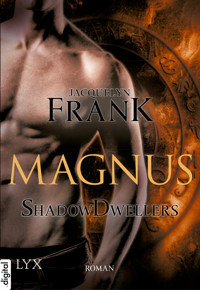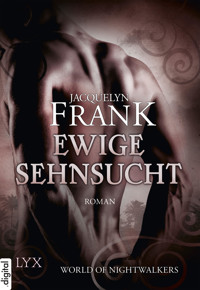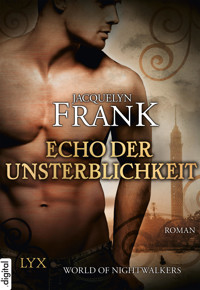9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: World-of-Nightwalkers-Reihe
- Sprache: Deutsch
Als Katrina Haynes einen verletzten Mann im Schnee findet, nimmt sie sich seiner an und pflegt ihn wieder gesund. Doch sie ahnt nicht, dass Ahnvil in Wahrheit ein Gargoyle ist -- ein übernatürliches Geschöpf, das sich in Stein verwandeln kann. Und Ahnvil besitzt mächtige Feinde, die es nun auch auf Katrina abgesehen haben. Während die beiden verzweifelt versuchen zu überleben, stellt Katrina schon bald fest, dass Ahnvil keinesfalls ein Herz aus Stein besitzt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 453
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Inhalt
Titel
Zu diesem Buch
Widmung
Die verlorene Schriftrolle der Völker
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Die Autorin
Die Romane von Jacquelyn Frank bei LYX
Impressum
JACQUELYN FRANK
World of Nightwalkers
Grenzenloses Verlangen
Roman
Ins Deutsche übertragen
von Beate Bauer
Zu diesem Buch
Als Katrina Haynes einen verletzten Mann im Schnee findet, kann sie kaum glauben, was sie sieht. Die Haut des halb nackten Fremden ist zu einer Hälfte grau und hart wie Stein und wird erst unter ihrer Berührung wieder zu Fleisch. Kat nimmt den blutenden Mann bei sich auf und pflegt ihn gesund. Dabei muss sie schnell feststellen, dass Ahnvil mit seinem breiten schottischen Akzent und seinem muskulösen Körper eine Leidenschaft in ihr entfacht, der sie nicht widerstehen kann, so düster und gefährlich die Welt, aus der er stammt, auch sein mag. Denn Ahnvil ist ein Gargoyle, ein übernatürliches Geschöpf, das sich in Stein verwandeln kann, und er hat mächtige Feinde, die es nun auch auf Katrina abgesehen haben …
Für Alisha und Mitchell.
Möge eure gemeinsame Zukunft glücklich werden.
Die verlorene Schriftrolle der Völker
… und so wird es in künftigen Zeiten geschehen, dass die Nationen der Schattenwandler auseinandergerissen und einander fremd werden. Durch Ungemach und Vorsatz werden diese zwölf Nationen zu unterschiedlichen Zielen kommen und füreinander mit der Zeit in Vergessenheit geraten. In der Zukunft werden diese Nationen Mühen und Kämpfe zu bestehen haben wie noch nie zuvor, und nur indem sie wieder zusammenfinden, können sie darauf hoffen, dem Bösen entgegenzutreten, das sie heimgesucht hatte. Doch sie sind füreinander verloren und werden das auch bleiben, bis ein großer Feind besiegt wird … und ein neuer wiederaufersteht …
1
Vor ungefähr dreihundert Jahren
Sein Name war ihm genommen worden.
Vor vielen Jahren, als er verschmolzen worden war, hatten sie ihm alles geraubt, was ihn ausgemacht hatte, und ihn mit nichts zurückgelassen … nackt und schutzlos, sogar ohne einen Namen. Vom Moment der Wiedergeburt als das Ding, das er jetzt war, war er alles Mögliche genannt worden. Sklave. Idiot. Dummkopf. Diese Worte waren jetzt seine Namen. Was denkst du, Dummkopf? Reich mir das Wasser, Sklave. Weißt du, was du da tust, du Idiot!!?
Aber nun nicht mehr. Heute Nacht würde er frei sein, auf die eine oder andere Weise, und er würde nicht vor dem Preis zurückschrecken, den es zu zahlen galt, um die Freiheit zu erlangen. Egal ob es Flucht oder Tod bedeutete.
Er musste nur den Stein an sich bringen. Das war alles. Nur ein kleines Stück Stein, das genau seit dem Moment mit ihm verbunden war, als man ihn zu diesem furchtbaren Leben gezwungen hatte. Ein kleiner Stein machte für ihn den Unterschied zwischen Leben und Tod aus. Freiheit oder Auslöschung. Andere Möglichkeiten gab es nicht. Er konnte nicht länger einen anderen Daseinszustand ertragen.
Doch die Aufgabe war schwerer, als es schien. Sein Meister wachte eifersüchtig über den Stein wie auch über die der anderen Sklaven. Er spürte einen Anflug von schlechtem Gewissen, die anderen zurückzulassen, die sich weiterhin mit ihrem versklavten Zustand abfinden müssten, doch er konnte sich weder um sie kümmern noch sie um Hilfe bitten. Er würde kein anderes Leben außer seinem riskieren. Wichtiger noch, er wusste nicht, ob er sich überhaupt darauf verlassen konnte, nicht von einem der anderen verraten zu werden.
Ja, es war in gewisser Weise egoistisch, gestand er sich ein, doch er hatte keine andere Wahl, als egoistisch zu sein. Diese verrückte Tat war ausschließlich sein Ding.
Alles, was er brauchte, war ein kleiner Stein.
Er wartete, bis nur noch er und sein Herr im Raum waren. Er stand lässig herum und versuchte, nicht den Eindruck zu erwecken, als würde er irgendetwas im Schilde führen, das auch nur im Entferntesten als rebellisch angesehen werden könnte.
Sein Herr war ein dunkler und mächtiger Mann. Er stand sehr weit oben in der Befehlskette, und er war vielbeschäftigt und auf den Krieg konzentriert, den er gegen seine Feinde führte. Doch er war nicht allmächtig. Er war zwar talentiert genug, zahlreiche Sklaven wie ihn zu erschaffen, doch sein Herr war selbst einer Herrin Rechenschaft schuldig.
Er war ihr stets zu Diensten und übertrug seinen Sklaven in ihrem Auftrag unzählige Aufgaben, die mal harmlos, mal schrecklich waren. Und obwohl sein Herr es gewesen war, der ihn versklavt hatte, war es diese Herrin, auf die er seine ohnmächtige Wut als Gefangener richtete. Oh, sie waren gleichermaßen verantwortlich für die einzelnen Sklaven, die sie schufen, doch die Herrin seines Herrn war der kranke Geist, der die schrecklichen Aufgaben, die ihm sein Herr übertrug, ersann.
Und egal wie verwerflich die Aufgaben waren, solange sein Herr im Besitz des Steins war, blieb ihm nichts anderes übrig, als sich zu fügen. Und so hatte er schreckliche Dinge getan. Dinge, die er manchmal sehr genossen hatte, auch wenn er gewusst hatte, wie finster die Ziele seines Herrn womöglich waren. Er hatte Dinge gestohlen. Er hatte Überfallkommandos gegen die Feinde seines Herrn angeführt.
Er hatte kaltblütig gemordet.
Und in der Nacht, als ihm bewusst geworden war, dass er langsam Gefallen an diesen schrecklichen Taten fand, hatte er erkannt, wie unmoralisch er selbst geworden war. Er konnte seinen Herrn nur bis zu einem gewissen Grad dafür verantwortlich machen. Doch hatte er weit mehr als die ihm übertragenen Pflichten erfüllt, und er hatte Gefallen daran gefunden. Er war von einem versklavten Wesen, das seinen Besitzer verachtete, zu einem ehrlichen und loyalen Diener geworden, der stolz darauf war, wie er die finsteren, abscheulichen Taten vollendete.
Er war zu einem abstoßenden Abbild seines Herrn geworden. Er musste für seine Taten so viel Buße tun, dass er die Freiheit wahrscheinlich gar nicht verdiente. Doch auf die Freiheit zu verzichten würde bedeuten, anderen nur noch mehr Schaden zuzufügen. Es würde ihn nur noch tiefer ins Verderben stürzen, und das konnte er nicht ertragen.
Doch es war genau diese Loyalität gegenüber seinem Herrn, die diesen nachlässig werden ließ, weshalb er seinem besten und loyalsten Sklaven die Steine unbeaufsichtigt überließ. Doch wenn er scheiterte, würde er jedes Vertrauen verlieren und würde von grausamer Folter bis zum Tod alles erleiden. Er hatte aus nächster Nähe den Zorn seines Meisters wüten sehen. Verdammt, er selbst war oft das Instrument gewesen, durch das sein Meister seine Vergeltung an denjenigen geübt hatte, die ihm in die Quere gekommen waren. Er wusste, wie einfallsreich der Mann beim Töten sein konnte.
Der Raum war leer, doch das hatte nichts zu bedeuten. Er ging langsam und zielstrebig auf den Kasten mit den Steinen zu. Es war ein schlichter Schmuckkasten mit blauer Samtverkleidung und aus auf Hochglanz poliertem Holz. Er war sechseckig, und in den Deckel war ein weiteres Sechseck aus geschliffenem Glas eingelassen. Das Glas in der Mitte war wie eine Lilie gestaltet. Hätte man das Glas gefärbt, wäre es eine schwarze Lilie gewesen. Schwarze Lilien waren das Kennzeichen seines Herrn. Manchmal wurde er angewiesen, am Kampfort eine Lilie auf den Boden zu zeichnen; er hatte das Kennzeichen seines Herrn hinterlassen – ob bei etwas so Brutalem wie einem Rachemord oder etwas so Harmlosem wie einem Altar.
Es war kein kitschiges Zeichen wie in Filmen oder im Fernsehen – eine Art zu sagen: »Ich war hier!« oder »Fürchte meinen Zorn!«. Die schwarze Lilie war ein Schlüsselsymbol für Tod, einen Tod, den sein Herr zielstrebig und zornig verfolgte. Nicht den Tod derjenigen um ihn herum, sondern seinen eigenen.
Denn sein Herr war ein mächtiger Unsterblicher, dazu verdammt, das Leben immer wieder aufs Neue zu leben, wobei er sich an das Leiden des vorhergehenden Lebens erinnerte. Nicht vielen war das bewusst, doch als rechte Hand seines Herrn konnte er kaum übersehen, wie sehr sein Herr sich nach einem endgültigen Tod sehnte.
Er zögerte einen Moment, bevor er den Kasten berührte. Er wusste, dass er verzaubert war, dass er augenblicklich Alarm auslösen und mit einem abwehrenden, schmerzhaften Zauber explodieren würde. Durch das Glas hindurch konnte er die kleine Sammlung bunter Steine sehen, die von grau wie Granit bis zu wunderschönen Rottönen und sämtlichen Abstufungen dazwischen reichten. Er wusste, dass seiner der zimtfarbene Stein war, der knapp in seine Hand passte. Er war glasklar und so geschliffen, dass er wie ein Rubin schimmerte, nur ohne die dunkle, blutähnliche Färbung. Er passte perfekt zu seinen Augen. Er war, was er war. Ein Stein. Ein geschützter Stein. Sein Energiestein. Ein Stein, an den er den Rest seines Lebens gebunden wäre. Er war an dem Tag, an dem er geformt worden war, seiner Hülle entnommen worden, und jetzt … und jetzt war er sein Sklave. Immer wenn er schlief, musste dies in Kontakt mit dem Stein geschehen. Wenn er das nicht tat, wären die Folgen katastrophal. Für längere Zeit von dem Stein getrennt zu sein würde bedeuten, ewiges Leben zu riskieren.
Er ballte die Faust und verwandelte damit sein Fleisch und seine Haut in Stein … einen dunkelgrauen Stein. Mit einem sorgfältig kontrollierten Stoß rammte er die Faust in das Glas. Er war stark genug, um alles in dem Kasten zu Staub zu zermalmen, wenn er nicht vorsichtig war, und das würde nicht nur sein Ende bedeuten, sondern auch das all derjenigen, die mit den anderen Steinen verbunden waren.
Der ausgelöste Zauber war schrecklich schmerzhaft. Er wütete gegen ihn und trieb ihn von dem Gegenstand weg, den er so dringend brauchte. Er warf sich dagegen, doch die Kraft drängte ihn immer weiter zurück.
Nein! Nein! Ich darf nicht scheitern!
Er musste es schaffen, und zwar rasch. Der Alarm, der aus dem Raum hinausschallte, würde in kürzester Zeit andere herbeirufen. Unter Aufbietung seiner letzten Kräfte warf er sich ein letztes Mal nach vorn, griff nach dem Energiestein und schloss seine Hand darum.
Der Kasten fiel zu Boden, und die anderen Steine verstreuten sich in alle Richtungen. Doch er achtete nicht darauf. Er überließ sich der Abwehr des Zaubers, der ihn gewaltsam aus dem Raum stieß. Er stieß mit zwei Dienern zusammen, die wegen des Alarms angerannt kamen. Ein Dritter hob eine Waffe, eine Pistole, und schoss ihm in die Brust, direkt über seinem schlagenden Herzen und unter dem Mal, das ihn für immer zeichnen würde. Seine versteinerte Haut fing einen Großteil des Aufpralls der Kugel ab, doch er spürte und sah, dass ein Stück herausgerissen wurde. Der Schmerz war stechend und heftig, doch er schenkte ihm keine Aufmerksamkeit. Er hatte sich schon schlechter gefühlt. Im Moment konzentrierte er sich darauf, den Akolythen zu packen, ihn etwas näher heranzuziehen und ihm die Faust mit dem Stein darin auf den Schädel zu schlagen. Der Mann sackte zusammen, und er ließ ihn wie einen Müllsack fallen. Wie stets ließ er keine Gewissensbisse zu. Das hob er sich für später auf. Im Augenblick musste er kämpfen, für seine Freiheit und das Recht, Buße zu tun – für die neuen Sünden, die er begehen würde, wie auch für die alten.
Er schüttelte den Gedanken ab und machte sich auf den Weg hinaus, in eine kalte und erstaunlich klare Nacht, und er spreizte die Flügel und erhob sich mit drei gleichmäßigen Schlägen in die Lüfte.
Er wusste, dass sie ihm auf den Fersen waren, doch er wusste auch, dass er frei war.
Frei.
Und niemand würde ihm das je wieder nehmen.
2
Gegenwart
Gefangen.
Angekettet. Wie ein Tier. Wie … wie ein Tier auf dem Weg zur Schlachtbank. In der Erwartung jener, die ihn verschlingen würden.
Ahnvil hätte am liebsten geschrien, doch er gönnte seinen Kidnappern die Genugtuung nicht. Er bewegte sich und vernahm augenblicklich das Geräusch von Ketten, die über den Zementboden seines Gefängnisses schleiften. Er war an den Fußknöcheln und Handgelenken gefesselt und obendrein hinter Gitter geworfen worden. Sein Gefängnis war irgendeine Art von Keller, der sich, wie er spüren konnte, vollständig unter der Erde befand.
Der Klang von Stimmen drang an sein Ohr, und er spitzte die Ohren. Er trat so weit nach vorn, wie seine Fesseln es ihm erlaubten, und begann auf und ab zu gehen, so als wäre er aufgebracht. Das war es, was sie von ihm erwarteten. Das Gefühl von Überlegenheit, das ihnen dieses angebliche Wissen gab, ließ sie nachlässig werden und würde ihm, wie er hoffte, einen Vorteil verschaffen.
»Ich muss dir das hier zeigen«, sagte der Templer in leicht gedämpftem Tonfall zu seinem Begleiter. Er bezweifelte wohl, dass sie überhaupt jemand hören konnte, doch ihre Heimlichtuerei war vielsagend, und er würde sehr gut aufpassen … während er den gegenteiligen Eindruck erweckte. Vielleicht würde er endlich herausfinden, warum sie ihn in Ketten gelegt hatten und gefangen hielten, anstatt ihn einfach zu töten und somit ihren Feinden, die auf seine Stärke und Fähigkeiten angewiesen waren, einen empfindlichen Schlag zu verpassen. Doch es gab auch die Möglichkeit, dass sie die Zeit für sich arbeiten ließen …
»Worum geht es?«, fragte der andere Templer, ein kleiner Mann mit beginnender Glatze. Im Ernst jetzt?, dachte Ahnvil spöttisch. Von allen menschlichen Wesen, die er sich für seine Wiedergeburt hätte aussuchen können, hatte er sich ausgerechnet für diesen hier entschieden? Das zeigte, dass manche Körperwandler einfach schlauer und stärker und besser waren als andere.
Ein Körperwandler war ein Wesen, das zwei Seelen beherbergte. Die eine war die eines Menschen, der auf natürliche Weise geboren worden war. Die andere Seele war die eines alten Ägypters, eines mächtigen Mannes oder einer ebensolchen Frau, die im Körper des Menschen wiedergeboren werden konnte. Nur dass diese Körperwandler, die Templer, nicht zum Teilen bereit waren. Sie unterdrückten die unbekannte menschliche Seele … so, wie sie ihn einst ebenfalls unterdrückt hatten.
Die Körperwandler, die er kannte, jene, denen er einst ergeben gewesen war, die Politik – sie alle waren anders. Sie kümmerten sich um ihren menschlichen Wirt, verschmolzen mit ihm, respektierten ihn und teilten ihr Leben mit ihm in Harmonie. So wie es sein sollte.
Und weil die Körperwandler sich einfach aussuchen konnten, in wem sie wiedergeboren werden wollten, kam es ihm lächerlich vor, dass sich dieser hier ein körperlich so unterentwickeltes Exemplar ausgesucht hatte.
Als sie in die Nähe der Gefängniszelle kamen, konnte er seinen Geiselnehmer sehen: groß und attraktiv, wenn auch etwas älter, mit grau meliertem Haar und einem tiefen Grübchen in der linken Wange. Dieser hatte anscheinend nach ästhetischen Kriterien entschieden.
»Du liebe Güte! Wo hast du das denn her?«, fragte Glatzkopf überrascht, als er den Gefangenen im Käfig erblickte.
»Nicht das«, sagte Grübchen. »Ich werde dir verraten, warum ich das im Handumdrehen gefangen genommen habe.«
»Oh. Na schön, was ist es denn?«
Grübchen trat an die Schublade eines Arbeitstisches, in dem alle möglichen Dinge verwahrt wurden, einschließlich der Bestandteile der Zauberformeln, mit welchen die Templer arbeiteten. Es waren dunkle, böse Kräfte, mit denen man nicht fahrlässig sein durfte. Die gleichen dunklen Kräfte, die ihn erschaffen hatten.
Grübchen nahm eine Stahlkiste aus der Schublade und öffnete sie, wobei das leichte Zittern seiner Finger genau verriet, wie sehr ihn der Inhalt der Box erregte. Er griff hinein und nahm eine Halskette heraus, deren Anhänger hell funkelte, als von oben Licht auf ihn fiel.
»Was ist das?«, fragte Glatzkopf und riss sie seinem Begleiter aus der Hand. Grübchen nahm sie ihm augenblicklich wieder weg und hielt sie voller Ehrfurcht in den Händen.
»Man nennt es Adomas Amulett«, hauchte er leise.
»Wirklich?« Glatzkopf sprach jetzt ebenfalls in dem ehrfürchtigen Ton von Grübchen. »Was kann es, Panahasi?«
»Ich habe keine Ahnung«, sagte Panahasi.
Glatzkopf blickte entrüstet und ungeduldig. »Wenn du nicht weißt, was man damit machen kann, was ist dann so besonders daran?«
»Das Besondere daran ist, dass ich es unter Kamenwatis Besitztümern gefunden habe, bevor seine Sachen weggeschafft wurden!«
Ihrem Gefangenen klangen bei dem vertrauten Namen die Ohren. Kamenwati war der mächtigste Tempelpriester, den es je gegeben hatte. Er war die rechte Hand der mächtigsten Priesterin, Odjit, gewesen.
Bis Kamen zur anderen Seite übergelaufen war. Zu Ahnvils Seite.
Absurd, wenn man bedachte, dass er Ahnvils Schöpfer war. Sein vormaliger Herr.
Glatzkopf reagierte entsprechend. »Ohhh! Und was macht es abgesehen davon so besonders?«
»Nun, anscheinend hat Kamen es genauestens recherchiert. Er ist an seinem Schreibtisch Band für Band durchgegangen. Doch das Einzige, was er bis jetzt gefunden hat, ist dieser Abschnitt.« Panahasi entnahm der Kiste ein kleines Buch und schlug es auf einer markierten Seite auf. Ahnvil zuckte zusammen, als er es sah, und fragte sich, weshalb das Buch in Panahasis Händen nicht einfach zerfiel, so alt wie es war. Doch keiner der beiden Templer schien es überhaupt zu bemerken. Sie waren zu beschäftigt damit, die Früchte eines anderen ernten zu wollen, von jemandem, der weit weg war und es viel mehr verdient hätte … was sogar Ahnvil zugeben musste, trotz seiner Gründe, Kamen zu hassen.
»Hier steht: ›Der Sklave, der aus den unsterblichen Schattenwandlern hervorgeht, wird die Kräfte darin freisetzen. Derjenige, der Adomas Amulett nutzbar macht, wird über solche Kräfte verfügen, dass er selbst einen Gott zum Weinen bringen kann.‹«
»Liebe Güte«, hauchte Glatzkopf, als er schließlich die Bedeutung dessen, was sein Freund in Händen hielt, erfasste. »Oh!«, sagte er plötzlich erregt. »Dafür ist der Gargoyle also.« Er blickte hinüber zu ihrem Gefangenen.
»Ja. Und er ist nicht nur irgendein versklavter Gargoyle, er ist Kamens Schöpfung. Ich dachte, falls ein Sklave so mächtig sein kann, die Kräfte des Amuletts zu aktivieren, dann müsste es einer der Sklaven von Kamen oder Odjit sein. Und weil ich von keinen lebenden Gargoyles weiß, die Odjit hat, muss dieser hier genügen.«
»Was tun wir also als Nächstes?«, wollte Glatzkopf wissen und rieb sich eifrig die Hände.
»Wir tun gar nichts. Ich werde versuchen, den Gargoyle dazu zu bringen, dem Amulett seine Kräfte zu entlocken.«
»Und wie willst du das bewerkstelligen?«, schnaubte Glatzkopf, dem es überhaupt nicht gefiel, von den möglichen Vorteilen nichts abzubekommen, auch wenn er nichts dafür getan hatte. So wie sein Freund sie ebenfalls nicht verdiente, abgesehen davon, dass er ein Dieb war. »Wenn du ihm zu nahe kommst, reißt er dir den Kopf ab. Freiwillig tut er einem bestimmt keinen Gefallen.«
»Ich weiß«, sagte Panahasi mit einem Stirnrunzeln, als sie beide zu ihm hinüberblickten. Er schenkte ihnen das erwartete böse Lächeln angesichts ihrer Pläne.
»Lass dir lieber schnell etwas einfallen. Du hast nur ein paar Tage, bevor er nicht mehr zu gebrauchen ist.«
»Ich weiß«, zischte Panahasi scharf. »Keine Sorge, mir fällt schon etwas ein. Kamenwati ist nicht der einzige Priester mit Macht, weißt du. Schließlich ist es mir gelungen, den Gargoyle in einen Hinterhalt zu locken und ihn mir zu schnappen«, plusterte sich Panahasi auf. Doch weder für seinen Freund noch für seinen Gefangenen klang das aufrichtig. Wahrscheinlich nicht einmal für Panahasi selbst.
»Egal«, sagte Panahasi, als sein Begleiter noch immer zweifelnd dreinschaute. Er legte das Amulett gemeinsam mit dem Buch in die Kiste zurück und stellte diese auf den Tisch. Dabei knallte der Deckel der Kiste zu. »Ich kümmere mich später darum. Ich wollte lediglich wissen, ob du mitmachen willst. Aber wenn du nur darüber urteilen willst …«
»Nein! Ich werde nicht urteilen«, sagte Glatzkopf eifrig und hob feierlich eine Hand. »Ich schwöre es.«
»Gut«, sagte Panahasi, den der neuerliche Respekt seines Freundes zu besänftigen schien. Oder das, was wie Respekt aussah. Es war eher wahrscheinlich, dass er sich das Amulett bei der erstbesten Gelegenheit unter den Nagel reißen würde. So raffgierig und illoyal waren diese Templer nun mal.
An der Tür war ein Geräusch zu hören, und Ahnvils Wärterin kam mit irgendwelchen Gegenständen schwerfällig hereingepoltert. Sie war nicht seine Geiselnehmerin. Nur seine Aufseherin. Wie immer näherte sie sich ihm vorsichtig, und man konnte ihr die Angst am Gesicht ablesen. Es war klug von ihr, beklommen zu sein. Er hatte es ihr nicht leicht gemacht. Sie hatte ihn nicht wirklich verletzt, doch sie hatte auch nichts für ihn getan, außer ihm zu essen zu geben und seine Zelle zu säubern. Er stand auf und ballte die Fäuste, und seine gesamte Haltung ließ seinen Körper noch massiger erscheinen, als er sowieso schon war.
»Ist es Tag?«, fragte er, denn die Zeit verging unendlich langsam für ihn, wenn er von den Launen der Sonne abgeschnitten war.
»Nein. Es ist bereits dunkel«, antwortete sie freundlich. Sie war ein unscheinbares, kleines Ding, sowohl was ihr Aussehen als auch ihre Gestalt betraf. Und sie war schüchtern und unsicher, vor allem wenn sie sich seinem Käfig näherte.
Sie war winzig klein und so schmal und dünn, dass er sie mit einem Hieb hätte töten können. Sie ging zu dem Hebel an der gegenüberliegenden Wand, und ihr gesamter Körper war verkrampft angesichts dessen, was bevorstand. Sie zog an dem Hebel, und quietschend begannen die Ketten in der Wand zu verschwinden. Sie wurden aufgerollt und zogen seinen schweren, angespannten Körper zu der dicken rückwärtigen Steinmauer seiner Gefängniszelle. Er blickte sie hasserfüllt an, und sie drehte sich weg und versteckte das Gesicht hinter ihrem herabfallenden Haar.
Er knurrte, als er freiwillig zurücktrat, weil es sowieso nicht zu vermeiden war, doch zumindest handelte es sich um eine freie Entscheidung, eine Wahl, so klein und sinnlos sie auch sein mochte.
»Was ist heute mein Fraß, Wärterin?«, fragte er sie. Dass er sie Wärterin nannte, ließ sie zusammenzucken. Doch sie beide wussten, dass das nicht stimmte. Nicht sie hatte ihn hierhergebracht, und nicht sie hielt ihn noch immer gefangen.
Sie ging zurück zum Eingang, um das Tablett zu holen, das sie in Händen gehalten hatte, als sie gekommen war, und ging nun mit einem unbehaglichen Gefühl, das er bereits aus der Entfernung spüren konnte, mit kleinen Schritten auf ihn zu. Sie hatte solche Angst vor ihm, dass die Sachen auf dem Tablett klapperten, weil ihre Hände zitterten, wahrscheinlich sogar ihr gesamter Körper bebte. Als sie die vergitterte Tür erreichte, zögerte sie. Sie hatte allen Grund, ihn zu fürchten. Trotz seiner Fesseln besaß er noch immer ungeheure Kräfte. Und zweifellos spürte sie den Hass ihr gegenüber, der von ihm ausging. Sie hätte dumm sein müssen, um davon nicht eingeschüchtert zu sein.
»Mendato dirivitus day-o septoma«, sagte sie schließlich und schloss die schwere Tür mit dem Zauberspruch auf. Sie machte sich keine Sorgen darüber, dass er ihn mitbekam, denn seine Spezies konnte keinen Zauber wirken. Magie hatte seine Spezies zum Leben erweckt.
Sie drehte sich zur Seite und stieß die Tür mit dem Fuß auf. Dann betrat sie rasch die Zelle. Er nahm an, weil sie das Ganze hinter sich bringen wollte, und je weniger Zeit sie in seiner Zelle verbrachte, desto besser war es für sie.
Sie hatte keine Ahnung, dachte er bedrohlich. Wenn er sie in die Finger bekäme, würde er ihr ihren gemeinen Templerhals in Sekundenschnelle umdrehen. Sie und ihre Spezies hatten ihm die eine Sache genommen, die eine Sache, die ihm vor allem anderen etwas bedeutet hatte, und sie würden dafür bezahlen.
Sie hatten ihm die Freiheit genommen.
Es machte ihn wahnsinnig, eingesperrt zu sein. Obwohl es eine völlig andere Art von Gefangenschaft war als diejenige, für die er erschaffen worden war, war das hier viel schlimmer. Wahrscheinlich weil es diesmal seine eigene Dummheit gewesen war, die ihn erneut in Schwierigkeiten gebracht hatte.
Er war hinter einem anderen Stück Templerabschaum her gewesen, war ihm in eine Kneipe gefolgt, wo er sich von einem hübschen Mädchen, einem Köder, hatte ablenken lassen, die sich gut gelaunt mit ihm unterhalten hatte, als dieser Mistkerl von Templer hinter ihm aufgetaucht war und … Nun, so genau erinnerte er sich nicht an das, was als Nächstes geschehen war, doch der Kopf hatte ihm wehgetan, und er hatte offensichtlich das Bewusstsein verloren.
Sie stellte das Tablett in Reichweite auf den Boden … besser gesagt, in Reichweite, wenn seine Ketten gelockert waren. Sie stand auf und strich sich das seidige, volle Haar zurück. Trotz seines Hasses auf die Templer musste er eins zugeben. Gott war großzügig gewesen, was ihr Haar betraf.
Ahnvil knurrte leise und bedrohlich, woraufhin sie erschrocken zusammenzuckte und rasch in Richtung Tür zurückwich. Er war jetzt seit zwei Tagen hier gefangen, und die Zeit wurde knapp. Er musste handeln, sonst würde er den Wahnsinn oder, schlimmer noch, ewiges Leben riskieren. Ewiges Leben schürte bei seiner Spezies die größte und umfassendste Angst von allem. Wahnsinn konnte mit Zeit und der richtigen Anleitung geheilt werden, aber ewiges Leben … das bedeutete, für alle Zeiten in Stein gefangen zu sein.
»Bevor du gehst«, sagte er hastig und räusperte sich, um sich den Zorn nicht anmerken zu lassen, »sag mir, warum ich hier festgehalten werde. Ich weiß nichts Wichtiges, und ohne meinen Energiestein könnt ihr mich nicht versklaven. Das Ganze birgt lediglich das Risiko von ewigem Leben. Das ergibt keinen Sinn! Ich bin nur die Wache eines unbedeutenden Körperwandlers der Politik«, log er, »ich schwöre, ich weiß überhaupt nichts!« Seine Verzweiflung war ihm anzuhören, und sein starker schottischer Akzent wurde nur noch stärker, und er verfluchte sich dafür.
Sie verschränkte ihre Hände und knetete sie aufgeregt.
»Ich weiß es nicht«, sagte sie, und die Besorgnis in ihren Augen verriet ihm, dass sie ehrlich war.
Besorgnis wegen mir?, fragte er sich. Wohl kaum, dachte er einen Augenblick später. Sie war eine Templerin. Die schlimmste Sorte Körperwandler. Diejenige, die ihrem Wirt sein gesamtes altes Leben und seine Individualität raubte. Die Sorte, die ein anderes Wesen versklavte. Die Sorte, die böse Magie benutzte, um ihren Willen durchzusetzen. Sie war eine Schlange. Vielleicht im Gesamtzusammenhang nicht ganz so gefährlich, doch trotzdem eine Schlange, und ihr Gift wäre genauso tödlich … auch wenn es nur in kleinen Dosen verabreicht wurde. Er bewegte sich, prüfte seine Fesseln zum tausendsten Mal, und das Brennen seiner wunden Haut spiegelte es wider. Er hatte sich früher schon von Stein in Haut verwandelt, als er sich mit allen Mitteln zu befreien versucht hatte. Jeder Versuch, so halbherzig er auch sein mochte, erinnerte ihn daran, dass die Uhr tickte, und damit auch seine Gesundheit schwand. Egal wie stark er war, je länger er von seinem Energiestein getrennt war, desto schwächer würde er. Je länger er von seinem Stein entfernt war, desto mehr würde sein Realitätsbezug nachlassen und damit auch … sein Verstand. Und je länger er ohne den Stein wäre, desto stärker würden die Schübe hin zu einem ewigen Existieren. Ewiges Existieren. Sich in Stein verwandeln und unfähig sein, sich wieder zurückzuverwandeln. Gefangen im eigenen Gefängnis aus Stein. Keine Möglichkeit, davon geheilt zu werden, keine Möglichkeit, zurückzukommen. Und diese Templer rechneten mit seiner Angst davor. Sie brauchten ihn nicht zu foltern. Sie brauchten nur abzuwarten und die Zeit für sich arbeiten zu lassen.
»Stell dir vor, wie frustrierend das für mich ist«, sagte er und hielt mit seiner Verzweiflung nicht hinter dem Berg, um an die schwachen Anflüge von Menschlichkeit zu appellieren, die er hin und wieder in ihr sah. Vielleicht war ihr Wirt nicht völlig unterworfen, dachte er noch verzweifelter. Vielleicht kämpfte ja ein richtiger Mensch mit ihr.
Vielleicht konnte er das zu seinem Vorteil nutzen.
»Wie du bin ich nur der Diener eines Herrn. Ich weiß nichts. Ich bin nicht viel mehr als ein Hund, der apportiert.« Er knurrte. »Ich habe um meine Freiheit gekämpft, nur um mich als Sklave wiederzufinden«, log er. Ziemlich überzeugend, wie er fand. Er seufzte schwer. »Aber man wird es mir nicht glauben. Nicht einmal, wenn ich mich in ein unsterbliches Wesen verwandle.« Er erschauerte bei der Vorstellung und musste das Gefühl nicht vortäuschen.
»Tut mir leid«, sagte sie, und er glaubte ihr beinahe. »Es gibt nichts, was ich tun könnte.«
Sie wandte sich um und verließ hastig die Zelle.
»Warte. Wie ist dein Name? Damit ich weiß, wie ich meinen einzigen Freund, den ich hier anscheinend habe, nennen soll.« Da beugte sie sich in seine Richtung und betrachtete ihn aufmerksam, während sie sich eine Strähne hinters Ohr schob.
»Jan Li«, sagte sie, und er wusste sofort, dass es, nach den asiatischen Zügen zu urteilen, der Name ihres Körperwirts war. Das war ungewöhnlich. Normalerweise nahmen Templer den Namen ihres Wirts nicht an. Je weniger sie an den Gast in ihrem Innern dachten, desto froher schienen sie zu sein.
»Jan Li. Danke, Jan Li, dass du mit mir sprichst. Mein Name ist Ahnvil.« Wahrscheinlich wusste sie das bereits, doch er nannte ihr seinen Namen, um an ihre menschliche Seite zu appellieren. Es würde den anständigen Teil in ihr ansprechen … sofern sie einen hatte. Ihm kam der Gedanke, dass sie vielleicht genauso unehrlich war wie er und die Unschuldige mimte, um ihm mit ihrer Weiblichkeit und Hilflosigkeit die Informationen zu entlocken, die sie von ihm haben wollten. Doch das Risiko war es wert. Was hatte er sonst für eine Wahl?
Jan Li verschloss erneut seinen Käfig und rüttelte anschließend an dem Metall, um sich zu vergewissern, dass er auch verschlossen war. Dann trat sie zur Winde und lockerte seine Ketten. Vielleicht … war es Einbildung, aber hatte sie diese nicht ein wenig mehr gelockert als zuvor? Er schüttelte den Kopf und versuchte, sich in seiner Realitätswahrnehmung von der Sache nicht aus dem Konzept bringen zu lassen. Das würde noch früh genug geschehen. Doch er bemerkte, dass sie noch immer zu ihm hinübersah. Sogar als sie den Raum verließ, blickte sie ihn über die Schulter hinweg noch einmal an.
Dann ließ sie ihn allein.
Allein, um zu warten.
Fünf Stunden später tauchte sie wieder auf, die Einzige, die seine Einsamkeit unterbrach, und es wurde immer schwieriger für ihn, die tickende Uhr zu überhören, die sie absichtlich in seinem Sichtfeld platziert hatten.
Sie trug allerdings ein weiteres Tablett und ging auf den Käfig zu, um es gegen das leere zu seinen Füßen auszutauschen. Erst als sie sich dem Schloss zuwandte, wurde ihm bewusst, dass sie seine lockeren Ketten nicht angezogen hatte. Bedeutete das etwa, dass sie ihm langsam vertraute? Dass ihre Wachsamkeit nachließ?
Sie stellte das Tablett auf den Tisch und richtete ihre dunklen Augen auf ihn.
»Du hast höchstens fünf Minuten, bevor sie merken, dass du weg bist. Ich habe eine List angewandt, mit der ich den Wachmann aus seiner Station gelockt habe. Es gibt eine Kamera, die dich beobachtet.«
»Das habe ich mir gedacht«, sagte er atemlos vor Ungläubigkeit.
»Ich bitte dich nur darum, dass du mich mitnimmst. Ich kann diesen Leuten nicht allein entkommen. Ich bitte dich, mir deinen Schutz zu gewähren. Wahrscheinlich bin ich nicht sehr stark und von keinem besonderen Nutzen für dich, und du hast nur den Überraschungseffekt und mein Wissen über das Gebäude.«
»Einverstanden. Das genügt«, sagte er zu ihr.
Daraufhin verschwendete sie keine Zeit mehr und betrat den Käfig, wobei er bemerkte, dass sie einen Schlüssel zwischen ihren zitternden Fingern hielt. Mit blitzartiger Geschwindigkeit schloss sie seine Handfesseln auf, was ihn nach ihrem ganzen Gerede über ihre Schwäche beeindruckte. Ihm kam der Gedanke, dass das Ganze eine Falle sein könnte, ein Versuch, Hoffnung in ihm zu wecken, um sie dann zunichtezumachen. Eine Möglichkeit, seinen mentalen Stress noch zu vergrößern, um ihn ihrem Willen zu unterwerfen, doch welche andere Option hatte er? Auf einmal waren seine Hände von den Fesseln befreit, was bedeutete, dass er seine Flügel spreizen konnte.
Nachdem er sich befreit hatte, hastete sie aus dem Raum, und er musste sich beeilen. Allerdings … er blieb stehen und blickte zurück zu dem Arbeitstisch … zu der Metallkiste. Aus einem Impuls heraus griff er danach, öffnete sie und schnappte sich das Amulett. Dann rannte er hinaus.
Sie befanden sich im Kellergeschoss, wie er vermutet hatte. Doch war es höchstens das erste, weil sie schon nach zwei Treppenabsätzen frische Luft atmeten. Er hörte lautes Geschrei und sah, wie Leute über einen Hof, der wie ein alter Gefängnishof aussah, vor ihnen davonrannten. Er war rundherum eingezäunt und hatte Stacheldraht auf dem oberen Rand, doch sah er, wie geschossen und dabei ein Loch in den Zaun und den Boden gerissen wurde. Eine Ablenkung, stellte er fest, als er sich zu ihr umdrehte. Doch er befand sich im Freien, und mehr brauchte er nicht. Er veränderte augenblicklich seine Gestalt, wurde von seiner steinernen Hülle umgeben, und seine Flügel stülpten sich aus seinem Rücken. Er packte sie und drückte sie an sich, während er sich mit den Beinen kraftvoll vom Boden abstieß, sich in die Luft erhob und versicherte, dass sie vor allem geschützt war, das womöglich von unten geflogen kam. Doch am meisten Sorge machte ihm die Tatsache, dass er diese Last trug – im Gegensatz zu den anderen Wasserspeiern, die man ihm hinterherschicken würde.
3
»Es ist kein sinnloses, hässliches Denkmal aus Metall. Es ist ein hässliches Denkmal aus Metall, das es uns ermöglicht, störungsfrei zu telefonieren.«
Dieses Minimum an Logik löste eine Schimpftirade über die Übel der modernen Technik am anderen Ende der Leitung aus, und Katrina Haynes rollte die Augen gen Himmel, als würde ihr das helfen, mit ihrer Mutter klarzukommen, für die Logik etwas Fließendes war. Der hässliche Mobilfunkmast, den man gerade auf dem Nachbargrundstück ihrer Mutter oben auf dem Berg installiert hatte, war ein Schandfleck und völlig unnötig, behauptete sie, die an ihrem Smartphone klebte, dessen Funktionen sie kaum kannte. Für ihre Mutter musste es stets das Beste sein, egal, ob sie es richtig nutzen konnte oder nicht.
Katrinas Smartphone war ein Geschenk ihrer Mutter zu Weihnachten gewesen; ansonsten würde sie sich noch immer mit ihrem geliebten aufklappbaren Handy begnügen. Obwohl sie zugeben musste, dass sie süchtig nach Angry Birds war. Sie hatte verschiedene Spielvarianten davon.
»Dann musst du dich wohl damit begnügen, Mutter, vom Berg hinunterzuschauen und nicht nach oben, wo der Mobilfunkmast steht. Ist es nicht auch das, was eine Aussicht ausmacht? Dass man auf die Landschaft hinabblickt?«
Sie stieß einen scharfen Pfiff aus und blickte ihre eigene Auffahrt entlang, wo Karma verschwunden war. Sie seufzte tief, und es bildete sich eine Atemwolke vor ihrem Mund. Die Luft war kalt, so wie sie es mochte, und als sie ihre eigene Aussicht betrachtete, ein atemberaubender Blick ins Tal und auf die kleine Stadt Stone Gorge, Washington, wo sie lebte, dachte sie, dass sie wahrscheinlich ebenfalls verärgert gewesen wäre, wenn ihr jemand in irgendeiner Richtung die Aussicht verbaut hätte.
»Mama, Karma ist schon wieder verschwunden. Ich ruf dich später noch mal an.«
»Dieser Hund«, sagte ihre Mutter tadelnd. Sie mochte den stürmischen Neufundländer nicht. Ihre Mutter sagte, dass er sie mehr an einen Schwarzbären als an einen Hund erinnere, und so nah der Wildnis, wo Bären häufig hinkamen, um die Vogelfutterhäuschen ihrer Mutter zu plündern, konnte Katrina die Sorge verstehen. Obwohl Karma ein sanftes, freundliches und sabberndes Bündel war, das keiner Fliege etwas zuleide tun konnte, ganz zu schweigen von Vogelhäuschen.
Kat verabschiedete sich und legte auf, bevor sie die abschüssige Auffahrt hinabging und dabei nach ihrem Hund pfiff. Als sie um eine der zahlreichen Kurven kam, traf sie den Hund dabei an, wie er in einem der Blätterhaufen wühlte, die vom letzten Herbst übrig waren. Karmas großer Körper versperrte ihr den Blick auf etwas, das er gefunden hatte. Aus Angst, der Hund könnte mit einem Stinktier ankommen, ging Kat eilig auf ihn zu.
»Karma, komm da raus!«, befahl sie streng.
Und da sah sie es. Ihn. Es. Sie vermochte es nicht genau zu sagen und stand wie angewurzelt da, und vor lauter Angst pochte ihr Herz auf einmal wild. Er war wahrscheinlich der größte Mensch, den sie je gesehen hatte, und in dem eher wilden Bergland, wo sie lebte, hatte das etwas zu bedeuten. Er war beinahe doppelt so groß wie der riesige Hund, der an ihm herumschnüffelte. Doch das Erschreckendste an ihm war nicht, dass er halb nackt im Schneematsch lag, sondern dass seine Haut zu einer Hälfte grau und hart wie Stein und zur anderen Hälfte dunkel war, vielleicht tief gebräunt oder dunkelhäutig, und dass sein Körper ziemlich muskulös war. Er lag auf dem Bauch und schien tot zu sein.
Auf einmal stöhnte er, was bewies, dass er am Leben war, und rollte sich auf den Rücken, und ihre Furcht löste sich in nichts auf, als sie eine große Menge leuchtend rotes Blut sah. Sie stürzte vor und stieß den Hund beiseite, als sie sich auf die Knie fallen ließ und die Hände nach ihm ausstreckte. Sie packte ihn bei den Schultern; an einer Schulter berührte sie eiskalte Haut, die andere war hart wie Stein. Aber das konnte nicht sein, dachte sie in einem Winkel ihres Hirns. Haut verwandelte sich nicht einfach in Stein. Vielleicht war es eine Verbrennung oder irgendeine andere Art von Verletzung … Doch die Verwandlung von Haut zu Stein geschah unter ihrer Berührung, und plötzlich wurde auch die andere Schulter zu Stein und diese unter ihrer zitternden Hand zu Fleisch, was jeden Erklärungsversuch zunichtemachte.
Doch unter der Verwandlung schoss auf einmal Blut über seine Bauchmuskeln; es tropfte in den Schnee, der bereits voller schmelzender roter Flecken war.
»Nicht … bewegen«, sagte sie und tastete nach ihrem Telefon. »Ich rufe Hilfe.«
»Nein!« Er packte sie an ihrem Mantel, und sie fühlte sich unter dem Griff seiner Faust zerbrechlich, als er sie nach vorn riss. »Du siehst, was ich bin. Ich kann es kontrollieren. Der Schmerz … Sie würden erkennen, was ich bin.« Dann blickte er hinauf in die morgendliche Dämmerung. Sie und ihre Mutter telefonierten immer unglaublich früh, zwischendurch bei einer Tasse Tee oder Kaffee und darüber hinaus am Abend, um beim Klang der Stimme der anderen das Ende des Tages einzuläuten. »Ich brauche ein schützendes Dach. Bitte. Ich kann nicht hier draußen im Tageslicht bleiben.«
Katrina saß starr und unentschlossen dort auf den Knien, während der nasse Schnee durch ihre Körperwärme schmolz und durch ihre Jeans drang. Ein weiterer Schwall hellrotes Blut rüttelte sie schließlich auf.
»Das ist verrückt, das ist verrückt«, flüsterte sie, gehetzt vor Aufregung. »Okay«, sagte sie schließlich lauter, sodass er sie hören konnte. »Ich bringe Sie hinein. Aber … das bedeutet nicht, dass ich nicht jemanden rufen werde. Wenn Sie versuchen sollten, mir etwas zu tun … wird mein Hund Sie angreifen.«
»Oh«, sagte er und verzog seine gemeißelten Lippen zu einem spöttischen Lächeln, »der Hund, der gerade fröhlich mein Gesicht abgeleckt hat?«
Mist. Verdammt, Karma, dachte sie wütend.
»N-Na ja … ich werde um Hilfe schreien.«
»Danke für die Warnung. Sobald wir drin sind, werde ich Ihnen das Genick brechen, um Sie zum Schweigen zu bringen.« Sie stöhnte, als er ihr noch ein spöttisches Lächeln schenkte. »Erzähl’n Sie dem Bösewicht nicht, was Sie vorhaben, wenn Sie nicht wissen, wozu er in der Lage ist. Ich werde Ihnen nicht wehtun. Ich brauche Ihre Hilfe. Und zwar schnell. Ich werde mit jeder Sekunde schwächer, und Sie werden mich hier nicht wegbewegen können, wenn ich bewusstlos bin. Sie sind viel zu klein dafür.«
Er erwähnte ihre kleine Statur, als wäre es ein unverzeihlicher Mangel, und das brachte sie in Rage. Die Leute hatten sie ihr Leben lang wie ein kleines, zerbrechliches Ding behandelt, und das ärgerte sie. Sie war klein, daran bestand kein Zweifel, doch sie konnte, wenn nötig, einen Schlag einstecken. Und nach seinem Hinweis, ihre Pläne doch lieber für sich zu behalten, biss sie sich auf die Lippen, um bloß nichts zu sagen.
Stattdessen half sie ihm auf. Es war offensichtlich alles, was sie tun konnte, damit er auf die Füße kam, und sie erkannte, wie schwer verletzt er war. Nur konnte sie wegen des ganzen Bluts die Wunde nicht erkennen. Trotz seiner Besorgnis über ihre mangelnde Körpergröße stützte er sich schwer auf sie, was den extremen Größenunterschied nur noch unterstrich. Als sie sich die Auffahrt hinaufschleppten, begann sie daran zu zweifeln, dass sie ihn in Sicherheit bringen könnte. Ihre Muskeln begannen unter der Anstrengung des Anstiegs mit diesem schweren Gewicht auf ihr in dem Moment spürbar zu brennen, als das Haus zwischen den Pinien in Sicht kam.
»Wie weit …«
Noch, wollte er wissen. Das Blut, das er verlor, tränkte die linke Hälfte ihrer Kleidung, und sie wusste, warum er nicht sprechen konnte. Er musste seine gesamten Kräfte aufbieten, um sich auf den Beinen zu halten.
»Nicht mehr weit. Wir sind gleich da. Nicht mehr sehr weit. Sie schaffen das«, ermunterte sie ihn. Es schien ihm Kraft zu verleihen, und er verlagerte sein Gewicht weg von ihr und drängte sie beide vorwärts. Vor dem Haus stolperte er allerdings und ging zu Boden, wobei er den steinernen Fußweg mit Blut befleckte. »Kommen Sie«, sagte sie und hatte Angst, dass er nicht weitergehen konnte und dass sie, wie er gesagt hatte, nicht stark genug war, ihn hineinzubringen.
Sie blickte hinauf zum Himmel, doch es wurde nicht heller, weil dicke Schneewolken ihn bedeckten. Schlimmer noch war, dass der Wind auffrischte und einen heftigen Blizzard ankündigte.
Doch das Unwetter war noch weit weg und somit ihre geringste Sorge. Bis auf die Tatsache, dass sie ein Sturm von allem abschneiden könnte und sie ihm hilflos ausgeliefert wäre …
Doch momentan war er derjenige, der ihr hilflos ausgeliefert war, und das trieb sie an.
»Hoch!«, befahl sie ihm und zerrte an seinem Arm, den er um ihre Schultern gelegt hatte. »Stehen Sie auf. Nur noch ein bisschen. Es wird langsam hell«, warnte sie ihn, ohne zu wissen, warum ihm das Probleme bereiten sollte. Vielleicht war es der aufziehende Sturm, der ihm Sorgen machte. Und das zu Recht. Washington war bekannt für seine heftigen Schneestürme. Vor allem in dieser Höhe.
Sie zog ihn hoch, und er konnte sich mit letzter Kraft auf den Beinen halten. Sie stolperten zur Tür, und während sie sein schweres Gewicht abstützte, hantierte sie mühsam mit dem Türknauf. Schließlich gab er nach, und sie taumelten hinein.
»Irgendwas Dunkles. Ohne Licht. Geschützt.« Er brachte die Worte nur stoßweise und heiser vor Schmerz heraus. Und sie war weit davon entfernt, mit ihm zu streiten.
»Ich kenne das Gefühl«, murmelte sie.
Sie ging zum nächsten Schlafzimmer, ihrem eigenen Schlafzimmer. Alle anderen Zimmer befanden sich im ersten Stock, und sie wusste, dass Treppensteigen für sie beide nicht infrage kam. Selbst ohne sein Gewicht hätte sie es mit ihren brennenden Beinmuskeln kaum hinaufgeschafft.
»Das war’s«, sagte sie ächzend, »ich setze mal meinen dicken Hintern in Bewegung und stell mich aufs Laufband. Im Frühjahr wird’s besser … Nur ein paar Wanderungen die Berge rauf und runter, oder?«
Nach vielem Ächzen und Stöhnen, und nachdem sie ein paarmal gegen die Wand gestoßen waren, hatten sie es ins Schlafzimmer geschafft und waren gemeinsam aufs Bett gefallen, wobei sie unter seinem Gewicht fast keine Luft bekam. Sie versuchte ihn wegzuschieben, doch er war kaum bei Bewusstsein, und sie bemerkte, dass sich die seltsame Steinhülle um seinen Körper wieder verwandelte … falls das überhaupt möglich war. Teufel, das musste es sein. Sie sah es schließlich mit ihren eigenen Augen. Spürte es auf ihrer Haut. Bevor er sich vollständig in Stein verwandelt haben würde und sie unter einer zehn Tonnen schweren Statue eingeklemmt wäre, versuchte sie ihn mit letzter Kraft von sich herunterzuschieben. Doch egal wie sehr sie auch schob und drückte, gelang es ihr nur mit seiner Hilfe, ihn herunterzurollen.
Mühsam richtete sie sich auf, stellte sich neben das Bett und rang nach Luft. Verdammt, dachte sie, als sie ihn groß und blutend auf dem Bett liegen sah, sie liebte diese Steppdecke, aus der sie das Blut nie wieder herausbekommen würde.
Weil sie ihn für bewusstlos hielt, berührte sie mit einem Finger die wie Stein aussehende Haut auf seinem Arm. Sie konnte es nicht glauben, doch es war wirklich Stein! Ein rauer Stein, wie von einer ungeschliffenen Statue. Wie zum Teufel war das möglich? Es konnte nicht sein … aber es war so. Sie konnte es unter ihren Fingerspitzen spüren.
»Kein Tageslicht. Bitte«, sagte er unvermittelt. Sie erschrak. »Bei Tageslicht können Sie nichts für mich tun, und ich werde sterben. Ich schwöre Ihnen, ich werde sterben.«
Sie nickte hastig und tätschelte ihm ungeschickt die kräftigen Schultern. »Keine Sorge. Ich habe bereits die Fensterläden geschlossen.« Und ein Feuer im Kamin gemacht, das sowohl das Schlafzimmer als auch das Wohnzimmer heizte und dessen warmes Licht über ihnen flackerte. Das und die Nachttischlampe waren genug.
Da atmete er lang und seufzend aus, während seine letzten Kräfte schwanden, und plötzlich fiel ihr wieder ein, was das ganze Blut bedeutete, und sie vergaß ihre verhunzten Kleider und Decken. Sie rannte ins Badezimmer und zerrte das ganze Verbandszeug heraus, das sie im Laufe der Jahre hier und da verstaut hatte … nur für den Notfall. Und der war jetzt eingetreten. Sie fand eine Schüssel, füllte sie mit Gaze, Jod und Nahtmaterial. Sie wusch – reichlich verspätet – ihre Hände und zog ein Paar purpurfarbener Nitrilhandschuhe an, obwohl sie bereits voller Blut war. Mit sauberen Händen und den rutschfesten Handschuhen konnte sie besser arbeiten.
Sie eilte zum Bett zurück, trat neben ihn und machte beide Nachttischlampen an. Als sie ihn umdrehte, stellte sie fest, dass die Steinhaut verschwunden war. Er bestand vollständig aus Fleisch und Blut. Aus irgendeinem Grund tröstete sie das ein wenig. Doch die Vorstellung, dass sich das jeden Augenblick wieder ändern konnte, machte ihr zu schaffen. Plötzlich spürte sie das Telefon in ihrer Gesäßtasche. Sie sollte Hilfe rufen, trotz seines Protests. Er war sofort eingeschlafen, und er könnte nichts dagegen tun, so schwach, wie er war. Doch war sie von seinen Kräften, die er trotz seiner Schwäche entwickeln konnte, überrascht, und selbst wenn sie um Hilfe rief, konnte es zwischen dreißig Minuten und einer Stunde dauern, bis es jemand zu ihr auf den Berg schaffte. Das war das Einzige, das sie bei einem so abgelegenen Wohnort gefürchtet hatte. Sie hatte sich solche Dinge vorgestellt, böse Männer, die in ihr Haus stürmten, wo sie ihnen allein und hilflos ausgesetzt wäre.
Doch nichts an ihm weckte bei ihr den Eindruck, dass er an sich böse war. Immerhin hatte er sie darauf hingewiesen, was er mit ihr anstellen könnte … und sie hatte daraus geschlossen, dass er nichts dergleichen tun würde.
Sie beschloss, das Telefon in ihrer Tasche zu lassen, selbst als sie sich schalt, dumm zu sein und es irgendwann zu bereuen. Doch die Heilerin in ihr drängte sich in den Vordergrund, und sie griff nach der Gaze und begann die Wunde zu reinigen. Sie stöhnte, als sie den Bereich schließlich gesäubert hatte und das Ausmaß der Verletzung erkannte. Es war eine tiefe Schnittwunde an der Seite, als hätte ihn jemand mit einem Schwert getroffen und versucht, ihn in zwei Teile zu schneiden. Ebenfalls an der Seite und am Bein hatte er schwere Brandwunden, an den meisten Stellen mindestens dritten Grades.
Wieder spürte sie das Telefon in ihrer Gesäßtasche.
»Tu’s nicht«, krächzte er, als könnte er ihre Gedanken lesen.
»Nein, das werde ich nicht«, beruhigte sie ihn. »Aber Sie sind schwer verletzt. Sie müssen ins Krankenhaus.«
Sein Mund wurde zu einem Strich, und er öffnete flatternd die Lider. Zum ersten Mal bemerkte sie den Goldtopas seiner Augen. Sie waren wunderschön, dachte sie ziemlich ehrfürchtig, wie auch alles andere an ihm. Er hatte das schwärzeste Haar, das sie je gesehen hatte. Nicht blauschwarz … nicht dunkelbraun … sondern tiefschwarz. Es war leicht gelockt, wie es auf seinen Hals fiel. Er besaß eine Adlernase, wie gemeißelte Wangen und breite Wangenknochen. Sein Mund war voll, wie der einer Frau, nur unverkennbar männlich. Sie stellte sich ein breites Lächeln auf einem so großen Mund vor. Ein umwerfendes Lächeln, dessen war sie sich sicher. Er war weder hübsch noch jungenhaft und trotzdem ausgesprochen attraktiv.
Doch es blieb keine Zeit, den Anblick länger zu genießen. Sie musste erneut die Wunde reinigen und griff dann nach dem Nahtmaterial. Wegen der Tiefe der Wunde sorgte sie sich um die Verschmutzung durch heruntergefallenes Laub und durch das, was die Wunde ursprünglich verursacht hatte. Zuerst wusch sie diese mit einer Salzlösung, bis sie sicher war, dass es keine Rückstände mehr gab, dann verteilte sie Jod aus der Flasche darauf und betete, dass alles gut ging.
»Das wird wehtun. Ich habe nichts, um den Bereich zu betäuben.« Den Bereich? Verdammt, es war beinahe ein chirurgischer Eingriff, ihn wieder zusammenzuflicken.
»Tun Sie’s«, krächzte er. Und zu seinem Glück wurde er ohnmächtig. Sie spürte es in seinem gesamten Körper, beinahe wie das Entweichen der Luft bei einem plötzlichen Tod. Besorgt prüfte sie, ob er noch atmete. Ja, wenn auch sehr flach. Sie richtete ihre Aufmerksamkeit auf seine Wunde, fädelte den Faden ein und machte sich an die Arbeit.
4
Nachdem Kat ihre ärztliche Erstversorgung beendet hatte, musste sie duschen, um das Blut abzuwaschen, und sich umziehen. Nachdem das erledigt war, wusch sie ihren Patienten. Die Wunde war sauber und ordentlich genäht, wo man sie hatte nähen können, doch die versengte Jeans klebte noch an seinem Körper, und es war kein einfaches Unterfangen, sie ihm auszuziehen.
Sie besaß eine chirurgische Schere, die ziemlich breit und dazu gedacht war, dicken Stoff zu durchschneiden. Auf der linken Seite hatte sie die Jeans bereits aufgeschnitten und von der Wunde gelöst, also schob sie die Schere jetzt unter die Jeans auf seiner rechten Seite und zerschnitt langsam den dicken Jeansstoff. Es war ziemlich mühsam, und ihre Hände brannten, als sie den Knöchelsaum erreichte. Sie wusste nicht, ob der Stoff besonders fest war oder ob es am abfallenden Adrenalinspiegel lag, doch ihre Hände zitterten wie verrückt, weshalb sie zwischendurch ein paarmal innehalten musste, aus Angst, ihn womöglich zu schneiden. Er durfte wirklich nicht noch mehr Blut verlieren. Seine Lippen waren ganz bleich, seine Haut gräulich, doch zumindest nicht deswegen, weil er wieder zu Stein geworden war. Nach einem so großen Blutverlust würde vielleicht jeder so aussehen. Er war nach wie vor bewusstlos, und obwohl ihm das im Moment große Schmerzen ersparte, machte ihn das natürlich deutlich schwerer.
Sie packte die Jeans unten am Saum, stemmte die Füße gegen die Holzdielen und zog an dem aufgeschnittenen Jeansstoff unter seinem Körper.
Jetzt hatte sie einen nackten Gott in ihrem Bett. Sie hatte nicht wirklich auf ihn geachtet, solange er in echter Gefahr gewesen war, doch jetzt betrachtete sie ihn eingehend von Kopf bis Fuß und versuchte mit der Vorstellung klarzukommen, dass ein menschliches Wesen so groß und so schön sein konnte.
Moment. Woher willst du wissen, dass er überhaupt ein Mensch ist?, fragte sie sich. Doch als sie ihn jetzt anblickte, nachdem sie Hand an ihn gelegt und ihre Finger in seinen Wunden gehabt hatte, fragte sie sich, ob das, was sie zuvor gesehen hatte, nur eine Täuschung aufgrund des dämmrigen Lichts gewesen war. Aber nein, sie schüttelte den Kopf. Das Licht war eine Sache, doch hatte sie den rauen Stein unter ihren Fingern gefühlt, das Gewicht auf ihrem Körper gespürt. Der Verstand sagte ihr laut und deutlich, dass es im Grunde unmöglich war, dass sie nicht gesehen und gespürt hatte, was sie zu sehen und zu spüren geglaubt hatte.
Unmöglich. Die gesamte Situation war unmöglich. Sie nahm ihr Handy und überlegte zum hundertsten Mal, ihre Mutter anzurufen.
Sie schob das Telefon wieder in die Hosentasche und zupfte behutsam die Reste der Jeans aus seinen Brandwunden, die sie sorgsam reinigte, bis sie frisch bluteten und von Rückständen und verbranntem Fleisch völlig frei waren.
Nachdem sie das blutige Durcheinander wieder aufgeräumt und sich vergewissert hatte, dass er vollständig gesäubert und versorgt war, ging sie in die Küche und bereitete sich eine Tasse heißen Java-Nirvana-Kaffee zu. Um diese Uhrzeit trank sie normalerweise keinen Kaffee, doch sie ging davon aus, dass sie ihn brauchen würde, wenn sie sich in den nächsten Stunden um ihren Patienten kümmern wollte.
Sie malte sich aus, wie sie sich den Kaffee spritzen würde, sich eine Kanüle legen und ihn direkt in ihren Blutkreislauf pumpen würde, wie es sich jeder anständige Junkie wünschte, aber leider ging das trotz ihres medizinischen Sachverstands nur über den Magen.
Apropos medizinischer Sachverstand, sie war froh, dass sie ihn noch hatte. Es war fünf Jahre her, dass sie als Krankenschwester in einer von Manhattans belebtesten Notaufnahmen gearbeitet hatte. Wie bei jeder Tätigkeit konnte man aus der Übung kommen. Und obwohl sie nicht behaupten konnte, auf dem neuesten Stand zu sein, war sie froh über ihre Kenntnisse.
Sie schob weitere Grübeleien über ihre Fähigkeiten und wo sie diese zuletzt angewendet hatte, beiseite. Es waren Gespenster, die zu leicht aufzuscheuchen waren.
»Fünf Jahre. Du bist eine völlige Anfängerin«, sprach sie leise zu sich selbst und beruhigte sich mit diesem Mantra. Manchmal funktionierte es. Wie jetzt, aber wahrscheinlich nur, weil sie noch Wichtigeres zu tun hatte.
Und kaum hatte sie diese Überlegung angestellt, kam auch schon der nackte Koloss den Flur entlanggestolpert, taumelte wie ein Betrunkener hin und her, während das Fieber in seinen Augen brannte.
»Ist es dunkel draußen?«, krächzte er. Als sie nicht schnell genug antwortete, packte er sie und schleuderte sie mit einem kräftigen Rums gegen die Wand. Während ihrer Tätigkeit in einer städtischen Notaufnahme hatte sie das Hunderte von Malen erlebt, wie Patienten aufwachten und desorientiert und aggressiv waren. Doch es gab weder Krankenpfleger noch Wachleute, um ihn zu beruhigen. Nur sie. Sie ganz allein. »Antworte!«
»Nein! Es ist Tag, und Sie müssen zurück ins Bett, bevor die Nähte noch aufgehen!« Alles an ihm wirkte übermenschlich. Er war noch immer aufgebracht, und alles an ihm verströmte eine rohe Kraft.
Ganz zu schweigen von seiner Nacktheit. Ein Zustand, der ihm überhaupt nicht bewusst zu sein schien. Als ehemalige Notfallkrankenschwester sollte sie ebenfalls nicht darauf achten, doch es war wie der Elefant im Zimmer. Elefant in verschiedener Hinsicht. Nichts an diesem Mann war klein. Seine Frau, sofern er eine hatte, musste körperlich genauso massiv sein wie er. Kat konnte sich nicht vorstellen, der Partner von jemandem zu sein, der so groß war. Endlich einmal war sie froh, sagen zu können, dass sie viel zu klein war, um diesen speziellen Berg zu besteigen.
Sie redete ihm mit leiser Stimme gut zu. »Kommen Sie«, sagte sie sanft, während sie ihm mit der Hand beruhigend über einen seiner Unterarme strich, mit denen er sie an die Wand presste. »Sie schaden sich nur selbst.«
Er schnaubte. »Es gibt sehr wenig, was mir schaden kann.«
Doch sie konnte sehen, dass er sich nur mit Mühe aufrecht hielt, während sein muskulöser Körper erst nur leicht und dann immer stärker zitterte. »Bitte legen Sie sich ins Bett und ruhen Sie sich aus. Bei dem aufziehenden Sturm können Sie sowieso nirgendwohin.«
Er knurrte und schüttelte sie. »Biete mir noch einmal das Bett an, Mädchen, und du legst dich mit hinein.« Er beugte sich tief über sie, und seine Nase berührte ihre Schläfe, als er wie der Hund an ihr schnüffelte. »Du riechst ziemlich verführerisch, aber so klein, wie du bist, würde ich es an deiner Stelle nicht riskieren. Ich werde kein bequemer Liebhaber sein.« Seine Stimme senkte sich um eine Oktave. »Ich liebe es, mein Mädchen zu packen, sie fest an mich zu ziehen und an ihr zu schnuppern und zu lecken, bevor ich überhaupt daran denke, es ihr zu bis zu ihrer totalen Erschöpfung zu besorgen … aber vielleicht gefällt es dir ja, auf diese Weise genommen zu werden.«
Oh ja, bitte!, schrie plötzlich ein Teil von ihr. Halt. Nein!, wurde sie von ihrem besonnenen Teil gewarnt. Sie schüttelte das kurze Verlangen ab, das seine sinnlichen Gedanken und die unverhofften Tagträume in ihr geweckt hatten. Nichts davon wird geschehen, ermahnte sie sich.
Kurz bevor er seine Hand über ihren Brustkorb gleiten ließ und ihre Brust mit der Handfläche und den Fingern vollständig umschloss.
Sie stöhnte, packte seine Hand und stieß sie weg.