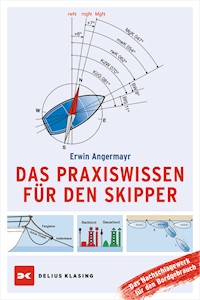
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Delius Klasing
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Das Nachschlagewerk für den Bordgebrauch: Hier wird von der richtigen Segeltechnik über ein korrektes Anlegemanöver unter Motor, sicheres Ankern, Navigationsverfahren, Wetter, Seesprechfunk und Hilfe bei Notfällen in komprimierter Form alles dargestellt, was ein Skipper wissen muss und ihm von Nutzen ist. Der Anhang mit Seefahrtslexikon in Deutsch – Englisch und Englisch – Deutsch sowie einer ausführlichen Erläuterung der wichtigsten nautischen Begriffe machen dieses Praxisbuch zu einer kleinen "Seemannschaft".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 419
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Erwin Angermayr
DAS PRAXISWISSEN FÜR DEN SKIPPER
Delius Klasing Verlag
Die Verantwortung für die Sicherheit des Schiffes und seiner Crew sowie für alle Maßnahmen und Entscheidungen, die am Schiff getroffen werden, liegt ausschließlich beim Skipper. Autor und Verlag übernehmen keinerlei Haftung für Schäden, die aus der Anwendung des Buchinhaltes oder eines Teiles entstehen bzw. begünstigt werden. Schadenersatzansprüche sind generell ausgeschlossen.
11., aktualisierte Auflage 2023
© Delius Klasing Verlag GmbH, Bielefeld
Folgende Ausgaben dieses Werkes sind verfügbar:
ISBN 978-3-667-12591-0 (Print)
ISBN 978-3-667-12743-3 (Epub)
Lektorat: Felix Wagner
Umschlaggestaltung: Gabriele Engel
Datenkonvertierung E-Book: Bookwire - Gesellschaft zum Vertrieb digitaler Medien mbH
Alle Rechte vorbehalten! Ohne ausdrückliche Erlaubnis des Verlages darf das Werk weder komplett noch teilweise vervielfältigt oder an Dritte weitergegeben werden.
www.delius-klasing.de
VORWORT
Neben meinen eigenen Erfahrungen und Erkenntnissen als Skipper und in der Seefahrts-Ausbildung tragen auch die Anregungen und Erfahrungen interessierter Leser zur inhaltlichen Verbesserung des Buches bei. Mein ausdrücklicher Dank gilt allen die sich mit dem Buch kritisch auseinandersetzen. Sie tragen wesentlich dazu bei, die inhaltliche Qualität des Buches laufend zu verbessern und es den aktuellen Entwicklungen anzupassen.
Der Leitgedanke des Buches, dem Skipper sachliche Unterstützung in komprimierter Form auch für die nicht alltäglichen Situationen während eines Törns anzubieten, wurde beibehalten. Muster-Funkgespräche und zahlreiche Tabellen unterstützen den Skipper bei seiner verantwortungsvollen Aufgabe. Neben den aktuellen Seekarten, Leuchtfeuerverzeichnis, Gezeitenunterlagen und Funkverzeichnis sowie Hafen- oder Törnführer sollte Das Praxiswissen für den Skipper an Bord immer griffbereit sein.
Praktische Formblätter sind auf www.skipper.co.at zum Download erhältlich. Dort findet sich auch die Skriptenreihe Seefahrtsausbildung: Basiswissen (Binnensegeln), Fahrtbereich 2, Fahrtbereich 3 und Fahrtbereich 4 (samt umfangreicher Aufarbeitung der Astronavigation), jeweils mit zahlreichen Übungsbeispielen. Tipps und Anregungen erreichen mich unter [email protected].
In diesem Sinne wünsche ich allen Seglerkollegen
Mast- und Schotbruch und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel!
Skipper Erwin
INHALT
1 TÖRNVORBEREITUNG
1.1 VORBEREITUNG ZU HAUSE
1.2 CREW-VERTRAG
1.3 PACKLISTE
1.4 SKIPPERS VERANTWORTUNG
1.5 SKIPPER-VERSICHERUNG
1.6 SCHIFFSÜBERNAHME
1.7 CREW-EINWEISUNG
2 JACHTTECHNIK
2.1 RUMPF
2.2 RIGG
2.2.1 Mast und stehendes Gut
2.2.2 Laufendes Gut
2.2.3 Segel
2.2.4 Jachttypen
2.3 MOTOR
2.3.1 Funktionsprinzip
2.3.2 Kraftstoffsystem
2.3.3 Luftzufuhr
2.3.4 Kühlsystem
2.3.5 Auspuffsystem
2.3.6 Schmierung
2.3.7 Einhebelschaltung
2.3.8 Motorelektrik
2.3.9 Dieselverbrauch
2.3.10 Motorkontrollen
2.3.11 Motordefekte und deren Behebung
2.4 STEUERUNG
2.5 ELEKTRISCHE ANLAGE
2.5.1 Batterie
2.5.2 Landstrom
2.5.3 Schalttafel
2.5.4 Kabelnetz, Verbraucher
2.6 GASANLAGE
2.7 WASSERVERSORGUNG
2.8 ABWASSERSYSTEM
2.9 BEIBOOT, AUSSENBORDER
3 RECHT UND GESETZ
3.1 GRUNDSÄTZE DER GUTEN SEEMANNSCHAFT
3.2 KOLLISIONSVERHÜTUNGSREGELN KVR
3.2.1 Allgemeines
3.2.2 Ausweich- und Fahrregeln
3.2.3 Lichter und Signalkörper
3.2.4 Signalkörper
3.2.5 Lichterführung
3.2.6 Schallsignale
3.3 SEENOTSIGNALE
3.4 SEEZEICHEN
3.4.1 Betonnungssystem
3.4.2 Lateralsystem
3.4.3 Mitte-Fahrwasser-Zeichen, abzweigendes / einmündendes Fahrwasser
3.4.4 Kardinalsystem
3.4.5 Einzelgefahr-Zeichen
3.4.6 Sonderzeichen
3.4.7 Wrack-Kennzeichnungsboje
4 SEEMANNSCHAFT
4.1 FLAGGENFÜHRUNG
4.1.1 Flaggengebräuche
4.2 Spezielle Aufgaben des Skippers
4.2.1 Einklarieren/Ausklarieren
4.2.2 Hilfeleistung bei Kollision
4.2.3 Logbuch
4.2.4 Wachplan
4.2.5 Signalflaggen, Morsezeichen
4.3 SEEMÄNNISCHE ARBEITEN
4.3.1 Tauwerk
4.3.2 Takling
4.3.3 Seemännische Knoten
4.3.4 Taljen
4.3.5 Festmachen am Liegeplatz
4.3.6 Arbeiten mit einer Winsch
5 SEGELN
5.1 SEGEL SETZEN UND BERGEN
5.1.1 Setzen der Segel
5.1.2 Bergen der Segel
5.2 SEGEL REFFEN
5.2.1 Vorsegel reffen
5.2.2 Großsegel reffen
5.3 SEGELTRIMM
5.3.1 Grundlegende Einstellung
5.3.2 Trimmeinrichtungen
5.3.3 Masttrimm, Vorstagspannung, Wanten
5.3.4 Vorsegeltrimm
5.3.5 Falten im Segel
5.4 SEGELN BEI LEICHTEN WINDEN
5.5 SPINNAKER
5.5.1 Spinnakerausrüstung
5.5.2 Spinnaker setzen
5.5.3 Spinnakersegeln
5.6 SEGELMANÖVER
5.6.1 Beidrehen, Beiliegen
5.6.2 Wende
5.6.3 Halse
5.7 KURS ZUM WIND
6 MANÖVER UNTER MASCHINE
6.1 FAHRTMANÖVER
6.1.1 Vorausfahrt
6.1.2 Achterausfahrt
6.1.3 Drehen auf engem Raum
6.2 ANLEGEMANÖVER
6.2.1 Anlegen längsseits
6.2.2 Anlegen über Heck (römisch-katholisch)
6.2.3 Anlegen mit dem Bug
6.2.4 Anlegen Dalbenbox
6.3 ABLEGEMANÖVER
6.3.1 Ablegen längsseits
6.3.2 Ablegen unter Heck
6.3.3 Ablegen Dalbenbox
6.3.4 Bugstrahlruder
6.4 HAFENMANÖVER KATAMARAN
6.4.1 Drehen am Teller
6.4.2 Anlegen längsseits
6.4.3 Ablegen längsseits
6.4.4 An- und Ablegen über Heck
7 ANKERN
7.1 ANKERGESCHIRR
7.1.1 Anker
7.1.2 Ankerkette, Ankerleine
7.1.3 Ankerwinsch
7.1.4 Kettenklaue
7.1.5 Ankerboje
7.2 ANKERPLATZ
7.3 ANKERMANÖVER
7.4 ERHÖHUNG DER HALTEKRAFT DES ANKERS
7.4.1 Kette stecken
7.4.2 Ankergewicht
7.4.3 Ankern mit zweitem Anker im Strom (vermuren)
7.4.4 Verkatten
7.4.5 Vermuren
7.5 BESONDERE ANKERMANÖVER
7.6 SICHERUNG AM ANKERPLATZ
7.7 ANKERN MIT KATAMARAN
7.8 FESTMACHEN AN DER BOJE
8 NAVIGATION
8.1 ERDE UND SEEKARTE
8.1.1 Koordinatensystem der Erde
8.1.2 Nautische Längeneinheiten
8.1.3 Seekarte
8.2 KURSBESTIMMUNG
8.2.1 Magnetkompasskurs MgK, missweisender Kurs mwK
8.2.2 Rechtweisender Kurs rwK
8.2.3 Kurs durchs Wasser KdW
8.2.4 Kurs über Grund KüG
8.2.5 Kursverwandlung
8.3 STANDORTBESTIMMUNG
8.3.1 Grundlagen der Standortbestimmung
8.3.2 Peilungen
8.3.3 Höhenwinkelmessung
8.3.4 Verfahren zur Standortbestimmung
8.4 NAVIGATIONSAUFGABEN
8.4.1 Weg/Zeit-Rechnung
8.4.2 Kontrolle der Ablenkungstabelle
8.4.3 Erstellen einer Ablenkungstabelle
8.4.4 Besteckversetzung BV
8.4.5 Stromrichtung und -geschwindigkeit aus der Besteckversetzung
8.4.6 Gefahrenstandlinie
8.4.7 Wende
8.4.8 Treffpunktermittlung
8.5 LEUCHTFEUER
8.5.1 Leuchtfeuerverzeichnis LFV
8.5.2 Kennung und Wiederkehr
8.5.3 Besondere Leuchtfeuer
8.5.4 Tragweite, Nenntragweite, Sichtweite
8.5.5 Entfernung von der Kimm EK
8.5.6 Feuer in der Kimm
8.5.7 Eingeschränkte Tragweite
8.6 GEZEITEN
8.6.1 Grundlagen
8.6.2 Auswirkungen
8.6.3 Anomalien
8.6.4 Begriffe
8.6.5 Springverspätung
8.6.6 Tidenkurve
8.6.7 Gezeitenströme
8.6.8 Tidenkalender (Gezeitenkalender)
8.6.9 Zwölftelregel
8.6.10 Gezeitentafeln
8.6.11 Wassertiefe
9 ELEKTRONIK
9.1 GLOBAL POSITIONING SYSTEM GPS
9.1.1 Systemgrundlagen
9.1.2 Systemgenauigkeit
9.1.3 GPS-Empfänger
9.1.4 Grundeinstellungen
9.1.5 Informationsausgabe
9.1.6 Wegpunktnavigation
9.1.7 Elektronische Seekarten
9.1.8 Navigationssoftware
9.2 RADAR
9.2.1 Funktionsprinzip
9.2.2 Grundlagen
9.2.3 Radarantenne
9.2.4 Radarmonitor
9.2.5 Bildschirmdarstellung
9.2.6 Bedienung
9.2.7 Störeinflüsse, Fehlerechos
9.2.8 Erweiterte Funktionen
9.2.9 Anwendung und Einsatzmöglichkeiten
9.2.10 Radarreflektoren
9.2.11 Radareinsatz gemäß KVR
9.2.12 Plotverfahren
10 SEEFUNK
10.1 Funkanlage
10.2 Global Maritime Distress and Safety System GMDSS
10.2.1 Systemkomponenten
10.3 BETRIEBSABWICKLUNG
10.3.1 Funkerregeln
10.3.2 Funkverkehrsregeln
10.3.3 Hörwache, Funkwache
10.3.4 Rangordnung im Funkverkehr
10.3.5 Routineverkehr
10.3.6 Sicherheitsverkehr
10.3.7 Dringlichkeitsverkehr
10.3.8 Gebietsruf
10.3.9 Polling, Position Request
10.3.10 Seenotverkehr
10.4 ANHANG SEEFUNK
10.4.1 Q-Gruppen
10.4.2 INTERCO
10.4.3 Internationales Buchstabieralphabet
10.5 AIS (Automatic Identification System)
11 WETTER
11.1 URSACHEN FÜR DAS WETTER
11.2 GRUNDLAGEN
11.3 WIND
11.3.1 Windtabelle
11.3.2 Entstehung des Windes
11.3.3 Windregeln
11.3.4 Windvorhersage
11.3.5 Winderscheinungen im Küstenbereich
11.4 SEEGANG
11.5 NEBEL, DUNST
11.6 WOLKEN
11.7 GLOBALES WETTERSYSTEM
11.8 HOCH UND TIEF
11.8.1 Tief
11.8.2 Fronten
11.8.3 Hoch
11.9 MITTELMEER-WETTER
11.9.1 Mittelmeerwinde
11.9.2 Wetterregeln Mittelmeer
11.10 GEWITTER
11.11 LUFTDRUCKENTWICKLUNG
11.12 WETTERPROGNOSE DURCH BEOBACHTUNG
11.13 WETTERINFORMATIONEN
11.13.1 Informationsquellen
11.13.2 Seewetterbericht
11.13.3 Wetterkarten
12 SICHERHEIT, NOTFÄLLE, MEDIZIN AN BORD
12.1 STARKWIND, STURM
12.1.1 Vorbereitung
12.1.2 Dem Sturm ausweichen
12.1.3 Den Sturm abwettern
12.2 POB – PERSON ÜBER BORD (MOB – Man Overboard)
12.2.1 Sofortmaßnahmen
12.2.2 MOB-Manöver
12.2.3 POB-Systeme
12.2.4 Bergung
12.2.5 SAR-Suchverfahren
12.3 SCHÄDEN AM SCHIFF
12.3.1 Bruch am laufenden Gut
12.3.2 Bruch am stehenden Gut
12.3.3 Bruch des Masts
12.3.4 Bruch des Ruders
12.3.5 Schraube unklar
12.4 FEUER AN BORD
12.5 FESTKOMMEN AUF GRUND
12.6 Abschleppen
12.6.1 Schlepphilfe anfordern
12.6.2 Freischleppen von Legerwall
12.6.3 Anbringen einer Schleppleine
12.6.4 Hilfeleistung, Bergung
12.7 LECKBEKÄMPFUNG
12.8 AUFGABE DES SCHIFFS
12.8.1 Abbergen von Schiffbrüchigen
12.8.2 Aussteigen in Beiboot oder Rettungsinsel
12.9 MEDIZIN AN BORD
12.9.1 Erste Hilfe
12.9.2 Seekrankheit
12.9.3 Hitzeschäden
12.9.4 Ertrinken und Unterkühlung
12.9.5 Unterkühlung
12.9.6 Akute Erkrankungen
12.9.7 Bordapotheke
13 ANHANG
13.1 KARTENEINTRAGUNGEN
13.2 NAUTISCHE MASSEINHEITEN
13.3 ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS
13.4 VOKABELN UND PHRASEN
13.4.1 Deutsch – Englisch
13.4.2 Englisch – Deutsch
13.5 KOMMANDOSPRACHE
13.6 NAUTISCHE BEGRIFFE
13.7 NAUTISCHE LITERATUR
13.8 REGISTER
Bildnachweis:
Seite 164: GPS-Empfänger, Raymarine
Seite 170, 171: Radarantennen, Raymarine
Seite 190: Funkgerät ICOM, Point Electronics
Seite 193: EPIRB © ACR Electronics Europe GmbH
Seite 194: Handfunkgerät ICOM, Point Electronics
Seite 194: SART © ACR Electronics Europe GmbH
1TÖRNVORBEREITUNG
1.1 VORBEREITUNG ZU HAUSE
Ein erfolgreicher Segeltörn beginnt nicht mit dem ersten Ablegen, sondern bereits mit einer sorgfältigen Vorbereitung zu Hause.
❒Auswahl der Crew-Mitglieder
Ein Segeltörn stellt besondere Anforderungen an die Teilnehmer. Die ungewohnten Bedingungen und Tätigkeiten an Bord, das Zusammenleben in einer Gruppe auf beengtem Raum, unterschiedliche Erwartungen an die gemeinsame Zeit an Bord usw. erfordern bestimmte physische und psychische Voraussetzungen der künftigen Crew-Mitglieder. Ein weiteres Auswahlkriterium sind nautisches Können und Erfahrung. Der Co-Skipper als Ersatz für den Skipper, wenn dieser ausfällt, ist zu bestimmen.
🛆 Chronische Erkrankungen bzw. Medikamentationen der Crew-Mitglieder erfragen!
❒Segelrevier
Bei der Wahl des Segelreviers geht es um die nautischen Bedingungen im Seegebiet zur fraglichen Zeit wie Gezeiten, Wind und Wetter, die Infrastruktur an der Küste, in Häfen, Marinas und Ankerbuchten. Im Zeitalter der Kommunikation kann sich der Skipper diese Informationen bereits zu Hause via Internet besorgen.
❒Routenplanung
Die Routenplanung muss auf die Versorgungs- und Reparaturmöglichkeiten, Distanzen zwischen (möglichen) Liegeplätzen, erwartete Wetterbedingungen usw. abgestimmt werden. Die Länge der geplanten Etappen auf Anzahl, Belastbarkeit und nautische Erfahrung der Crew-Mitglieder abstimmen. Der sommerliche Badetörn mit kurzen Segeletappen wird dem erfahrenen Skipper keine größeren Probleme bereiten, auch wenn die Crew über wenig nautische Praxis verfügt. Bei einem Törn mit längeren Tagesetappen und Nachtfahrten wird der Skipper aber auf die Hilfe kompetenter (erfahrener) Crew-Mitglieder angewiesen sein.
Soll öfter an Bord gekocht oder an Land gegessen werden? Soll Zeit für Aktivitäten an Land eingeplant werden?
🛆Crew informieren, dass Routenplan witterungsbedingt ggf. geändert werden muss!
❒Schiff und Charter
Bei der Auswahl der Jacht ist neben der Anzahl der Kojen die Größe (Länge) der Jacht zu bedenken. Die größere Jacht bietet mehr Komfort im Seegang, beim Manövrieren in der Marina und in engen Häfen ist jedoch eine kleinere Jacht von Vorteil.
Die meisten Charter-Anbieter sind Agenturen, die im Namen und auf Rechnung des Vercharterers den Charter-Vertrag nur vermitteln. Der eigentliche Vertragspartner ist der Vercharterer (im Ausland), was erhebliche Konsequenzen haben kann.
Für die im Voraus geleistete Anzahlung sollte man auf eine Absicherung bestehen, da die Anzahlung im Fall der Insolvenz von Agentur oder Vercharterer verloren sein kann. Nur ein speziell auf das Chartergeschäft abgestimmter Sicherungsschein (z.B. YACHTPOOL) deckt dieses Risiko ab.
❒Nautische Unterlagen
Auch auf Charterschiffen ist letztlich der Skipper dafür verantwortlich, dass die für das Fahrtgebiet relevanten nautischen Unterlagen (Seekarten, Leuchtfeuerverzeichnis usw.) in aktueller Fassung an Bord sind. Eigene Unterlagen bieten den Vorteil, dass man sich bereits zu Hause damit vertraut machen kann. Fehlende Unterlagen sind bei der Schiffsübergabe nachzufordern.
❒Verproviantierung
An den europäischen Küsten ist die Versorgung vor Ort meist ohne große Einschränkungen möglich, jedenfalls in den Charter-Basen. In exotischeren Revieren muss sich die Crew im Vorfeld über Einkaufsmöglichkeiten informieren und ggf. eigene Nahrungsmittel mitbringen (Achtung: Zollbestimmungen).
1.2 CREW-VERTRAG
Der Crew-Vertrag soll die Rechtsbeziehung zwischen Skipper und Crew regeln. Die Haftung für Personen- und Sachschäden auch aus grober Fahrlässigkeit kann nur bei einem für den jeweiligen Törn und die besonderen Umstände individuell gestalteten Vertrag ausgeschlossen werden – nicht bei „Musterverträgen“.
A) (Charter-)Törn
Übernahme/Übergabe der Jacht: Datum, Uhrzeit, AusgangshafenFahrtgebiet:
B) Vertragsgrundlage
Grundlage für den Crew-Vertrag ist die Durchführung des o. g. Segeltörns, der ausschließlich einer gemeinsamen Urlaubsreise dient. Der Chartervertrag als wesentliche Grundlage für die Durchführung des Segeltörns ist den Unterzeichnern bekannt.
Die Teilnahme an o. g. Segeltörn erfolgt für alle Crew-Mitglieder auf eigenes Risiko. Diese erklären, für sich selbst voll verantwortlich zu sein und alle für die persönliche Sicherheit erforderlichen Maßnahmen zu treffen. Dazu gehören u.a. das Tragen von Rettungswesten und Safetybelts. Die Crew-Mitglieder erklären, dass sie schwimmen können.
Jedes Crew-Mitglied verpflichtet sich, alle für die Schiffsführung erforderlichen Anweisungen des Skippers unverzüglich zu befolgen. Der Skipper ist von Ereignissen oder Umständen, welche die Sicherheit von Personen oder Sachen gefährden, sofort zu unterrichten.
C)Schiffsführung
Der Schiffsführer wird im Folgenden als Skipper bezeichnet. Sollte der Skipper ausfallen oder verhindert sein, übernimmt der Co-Skipper die Schiffsführung.
Skipper: Name, Adresse, Telefon, E-Mail, Fahrtberechtigung
Co-Skipper: Name, Adresse, Telefon, E-Mail, Fahrtberechtigung
Der Skipper führt am Beginn des Törns eine Sicherheits- und Crew-Einweisung durch und dokumentiert dies im Logbuch. Die seemännischen Rechte und Pflichten des Skippers haben Vorrang vor den Vereinbarungen dieses Crew-Vertrags. Der Skipper übernimmt (ausschließlich) die Aufgaben der Schiffsführung und die seefahrerische Betreuung der Crew unentgeltlich.
Der Skipper trägt aufgrund seiner Funktion nach außen hin die Verantwortung für das Schiff und die Crew. Er ist deshalb gegenüber den übrigen Crew-Mitgliedern weisungsberechtigt.
D) Kosten
An den Törnkosten ist der Skipper wie die übrigen Crew-Mitglieder beteiligt/nicht beteiligt.
Charterpreis inkl. Steuern, Haftpflicht/Kasko
€ ________
Kosten der Anreise
€ ________
Hafen- und Liegegebühren
lt. Bordkasse
Kosten für Fahrterlaubnis (Permit)
lt. Bordkasse
Kraft- und Betriebsstoffe
lt. Bordkasse
Bordverpflegung, Verpflegung an Land
lt. Bordkasse
Törnspezifische Versicherungen
(Kautions-, Skipper-Haftpflicht-, Skipper-Unfall-Versicherung)
It. Bordkasse
Kaution (wenn nicht versichert) wird gemeinsam hinterlegt.
Die für diesen Törn anfallenden Kosten werden von den Crew-Mitgliedern anteilig getragen. Über die oben angeführten Kosten hinaus ggf. auch die Kosten, die aus der Nichterfüllung des Charter-Vertrags entstehen, Kosten aus Schadensfällen und Kautionsverlust (soweit nicht durch eine Versicherung gedeckt) oder wenn der Schaden durch ein Crew-Mitglied nicht vorsätzlich verursacht wurde. Für vorsätzlich verursachte Schäden haftet der Verursacher allein.
Die vor Törnbeginn anfallenden Kosten sind so rechtzeitig einzuzahlen, dass die hinsichtlich des Charter-Vertrages (ggf. Flugbuchung) vereinbarten Zahlungen termingerecht erfolgen können. Die sonstigen Törnkosten sind im Vorhinein in die Bordkasse einzuzahlen.
E) Haftungsausschluss
Soweit Personen und/oder Sachschäden nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurden, schließen die Crew-Mitglieder jegliche Haftung des Skippers und untereinander aus. Kommt während des Törns eine außenstehende, nicht der Crew angehörige Person zu Schaden oder wird fremdes Eigentum beschädigt, ist die Crew grundsätzlich Gesamtschuldner.
F) Rücktritt
Der Rücktritt vom oder der vorzeitige Abbruch des Törns durch einen oder mehrere Teilnehmer befreit diese(n) nicht von seiner (ihrer) anteiligen Zahlungsverpflichtung des Charterpreises (ggf. Flugpreis). Es liegt im alleinigen Ermessen des Skippers, ggf. eine Ersatzperson zu akzeptieren. Der Abschluss einer Charter-Rücktrittsversicherung wird dringend empfohlen, liegt jedoch im Ermessen des Einzelnen.
G) Schlussbestimmung
Sollten einzelne Punkte dieses Vertrages ungültig sein, bleibt der übrige Vertrag wirksam. Die Unterzeichner werden sich um eine Vereinbarung bemühen, die dem Zweck der ursprünglichen Vereinbarung am nächsten kommt.
Abweichungen oder Änderungen von diesem Vertrag bedürfen der Schriftform. Mündliche Nebenabsprachen wurden keine getroffen.
Haftungsausschlüsse Dritter (Ehefrau, Kinder) sind durch einen Crew-Vertrag nicht möglich. Ebenso ein Haftungsausschluss für Schäden aus grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz gegenüber dem Schiffseigentümer. Skipper und Crew haften ihm gegenüber außerhalb des Crew-Vertrags.
1.3 PACKLISTE
Die Packliste ist als Leitfaden ohne Anspruch auf Vollständigkeit zu verstehen. Sie ist auf die persönlichen Erfordernisse und Bedürfnisse abzustimmen. Die jeweiligen Einfuhrbestimmungen sind zu beachten.
PACKLISTE
Dokumente, Geld
Wie zu jeder Reise + Charterpass/Bordpass, Charter-Vertrag, Bootsführerschein, Funkzeugnis, Crew-Liste, Versicherungsschein(e) …
Segelausrüstung
Ölzeug, Segelstiefel, Südwester, Bordschuhe, Seglerhandschuhe, Seglermesser, Stirnlampe, Taschenlampe, Reservebatterien, wasserdichte Uhr (beleuchtet), ggf. eigene nautische Unterlagen, Schreibutensilien, persönliches Logbuch und Navigationsbesteck …
Toilettenartikel
wie zu jeder Reise + Meerwassershampoo, Toilettenpapier (feucht), Handtuch, Badetuch, Toilettentasche (zum Aufhängen …
Kleidung
Sportliche Kleidung entsprechend Jahreszeit und Temperaturen vor Ort Funktionsbekleidung, Badebekleidung, winddichte Jacke, Sonnenhut/Schirmkappe, Kopftuch, Halstuch, Trainingsanzug, Schlafanzug, Badeschuhe, Sportschuhe (rutschfest) …
Verschiedenes
Fotoapparat, Video-Kamera, Mobiltelefon mit Ladekabel, Sonnenbrille, optische Brille, Ersatzbrillen, Sicherheitsband …
persönliche Medikamente (Kreislauf, Seekrankheit, Verdauung, Schmerzen, Pille …) Insektenschutz, Sonnenschutz, Schnorchel-Ausrüstung, Reise-Nähzeug, Schlafsack, ggf. Bettwäsche, Rucksack, Einkaufstasche …
Abfallbeutel, Kaffeefilter, Frischhaltefolie, Geschirrtücher, Flüssigwaschmittel, rutschfeste Unterlage, Literatur, Spiele …
GPS-Empfänger (Handgerät), Anemometer (Handgerät), Handpeilkompass … (Skipper) Werkzeug, Ersatzmaterial (Bändsel, Schäkel, 5 m Stahlseil + Klemmen, Kabelbinder, Tape …) Raucher: Sturmfeuerzeug, Aschenbecher mit Deckel
Der Platz an Bord ist beschränkt und Koffer sind schlecht zu stauen. Es sollte daher alles in Taschen verpackt werden. Elektrische Geräte sollten für die Bordspannung von 12 V (24 V) geeignet sein, 230 V stehen meist nur in Marinas zur Verfügung.
1.4 SKIPPERS VERANTWORTUNG
Der Skipper
(als Vertreter des Eigners)
trägt die unteilbare Verantwortung für die
Sicherheit von Schiff und Crew
sowie für alle Maßnahmen und Entscheidungen, die am Schiff getroffen werden.
Der Skipper ist für die Einhaltung der relevanten
gesetzlichen Bestimmungen
und
Vorschriften
verantwortlich.
Der Skipper hat dafür zu sorgen, dass sein Schiff „
seeklar“
ist und bleibt.
Der Skipper ist verantwortlich für das Vorhandensein und die ordnungsgemäße Funktion der
Sicherheitseinrichtungen
an Bord sowie dafür, dass die Crew über die Bedienung dieser Sicherheitseinrichtungen und deren Aufbewahrungsort informiert ist
(Sicherheitseinweisung)
.
Der Skipper ist verantwortlich für die
Eignung der Crew
und
ausreichende Bemannung
und dafür, dass die Crew physisch und psychisch in der Lage ist, den geplanten Törn auch bei schwerem Wetter zu bestehen.
Der Skipper hat dafür zu sorgen, dass
ausreichend Proviant, Treibstoff
und
Wasser
an Bord sind.
🛆 Der Skipper muss davon ausgehen, dass er für alles und jeden an Bord verantwortlich ist.
Um dieser Verantwortung gerecht werden zu können, ist ein fundiertes nautisches Wissen erforderlich, eine entsprechende Erfahrung unersetzlich und die nötige Sorgfalt im Umgang mit der Crew und mit dem anvertrauten Schiff Voraussetzung.
1.5 SKIPPER-VERSICHERUNG
Im Jachtsport sind wir mit einem komplexen, meist länderübergreifenden Rechtsgefüge konfrontiert. Skipper und Crew sind durch die Schiffs-Haftpflicht- und Kaskoversicherung (oft) nur unzulänglich geschützt.
Es ist eine spezielle Skipper-Haftpflicht-Versicherung zu empfehlen, die alle Haftungsansprüche gegen Skipper und Crew abdeckt, die durch die Schiffs-Haftpflicht- und -Kaskoversicherung nicht (z.B. Prämien nicht rechtzeitig bezahlt) oder nur unzureichend (z.B. geringe Deckungssumme) gedeckt sind und die auch die Rechtskosten für die Abwehr ungerechtfertigter Forderungen übernimmt. Bei grob fahrlässig verursachten Schäden besteht kein Kasko-Versicherungsschutz.
Bergekosten werden durch herkömmliche Unfall-Versicherungen nur unzulänglich abgedeckt. Auch hier ist eine auf die speziellen Umstände des Jachtsports abgestimmte Skipper-Unfall-Versicherung mit ausreichend hohen Deckungssummen für Bergekosten anzuraten, die bereits die Kosten zur Abwehr von Personenschäden deckt (z.B. Bergemaßnahmen bei Seenot), nicht nur den Personenschaden selbst.
Eine auf den Jachtsport abgestimmte Skipper-Rechtschutz-Versicherung sollte weltweite Geltung haben und der Versicherungsschutz auch für die berechtigte Crew als mitversicherte Personen gelten. Das Risiko eines (auch nur teilweisen) Verlustes der Kaution ist durch eine Charter-Kautionsversicherung versicherbar. Auch eine Charter-Rückstrittsversicherung sollte in Betracht gezogen werden.
Die Kosten für einen ausreichenden Versicherungsschutz von Skipper und Crew sind im Verhältnis zu den sonstigen Törnkosten nur gering, die dadurch gewonnene Sicherheit aber enorm. Auf die Belange des Jachtsports abgestimmte Versicherungen werden von speziellen Versicherern angeboten, z.B. YACHT-POOL.
1.6 SCHIFFSÜBERNAHME
Ein gründlicher Übernahmecheck und technische Einweisung sind unerlässlich für die Schiffssicherheit. Die Übernahme erfolgt durch den Skipper (Co-Skipper assistiert). Ausrüstung und technische Einrichtungen werden anhand einer Checkliste überprüft, der Vercharterer führt die technische Einweisung durch. Das Risiko für erst bei der Rückgabe des Schiffs erkannte Schäden oder fehlende Ausrüstung trägt der Skipper.
ÜBERPRÜFUNG
Anmerkung
A. an Deck
Stehendes Gut
Wantenspanner, Bolzen und Schrauben des Riggs sollten gesichert sein (Splint, Draht, Gewebeband)
Mastprofil und Baum
müssen gerade sein, eine Mastbiegung nach achtern ist bedenklich
Vorsegel, Großsegel
Segel aufheißen, kleinere Schäden reparieren, ggf. Stagreiter, Reffbändsel und fehlende Segellatten ergänzen
Laufendes Gut
klemmende Fallen und Blöcke klarieren, durchgescheuerte Schoten wechseln
Reffeinrichtungen
Bedienung erklären lassen und testen
Ankergeschirr
Kettenlänge (mind. 50 m), Markierungen? Kettenende am Schiff gesichert? Ankerwinsch (Fernbedienung, Ankerstock, elektr. Sicherung), Bedienung erklären lassen und testen Reserveanker mit Geschirr ggf. nachrüsten
Leinen, Festmacher
mind. 50 m lange Landleine, ggf. nachrüstenmind. 2 lange und 2 kürzere Festmacher, ggf. nachrüsten
Relingsstützen
ggf. reparieren bzw. vermerken
Fender
mind. 6 + Heckfender, ggf. nachrüsten
Einfüllstutzen Diesel, Wasser
ggf. markieren, Schlüssel?
Winschen
auf Leichtgängigkeit prüfen, Winschkurbeln (mind. 2), ggf. nachrüsten
Backskiste (Inhalt)
Reservekanister Öl und Diesel, Einfülltrichter, Bootshaken, Pütz, Bootsmannstuhl, Wasserschlauch + Anschlussstücke
Beiboot
Riemen und Blasebalg ggf. nachrüsten, Reparaturset?
Außenbordmotor
Funktion prüfen, Reservetreibstoff
Lenzpumpe(n)
Lenzpumpenhebel
B. Motor
Ölstand, Ölfilter
ggf. nachfüllen, Ölfilter ggf. wechseln
Wasserabscheider
ggf. Wasser ablassen, Ursache erfragen
Treibstoff
ggf. nachfüllen bzw. Stand festhalten
Seewasserfilter
ggf. reinigen
Kühlflüssigkeit
ggf. nachfüllen
Keilriemenspannung
überprüfen (muss sich ca. 1,5 cm eindrücken lassen)
C. Funktionsprüfung Motor (Motor warm laufen lassen)
Motorstart
Start- und Stoppvorgang erklären lassen
Farbe der Abgase
siehe Kapitel Motor
Motorkühlung
Betriebstemperatur, Wasserausstoß am Auspuff, ggf. Reparatur durch Fachmann
Öldruckkontrollleuchte, Ladekontrollleuchte
müssen umgehend nach Motorstart erlöschen, ggf. Überprüfung durch Fachmann
D. Getriebe
Schraube
rechts- oder linksgängig? Kraftübertragung im Vor- und Rückwärtsgang prüfen, Vibrationen spürbar?
Abdichtung Wellenlager
Stopfbuchse darf ein wenig Wasser durchlassen
Schaltung
Schaltung muss leichtgängig sein, ggf. schmieren oder Bowdenzug wechseln
E. Ruderanlage
Kraftübertragung
durch vollen Einschlag nach beiden Seiten überprüfen – Reparatur durch Fachmann (ggf. Übernahme verweigern)
Ruderspiel
prüfen, Geradeaus-Markierung anbringen
Notpinne
ggf. nachrüsten, Aufsetzen auf Ruderschaft ausprobieren
F. Bordelektrik
Schaltpaneel
Schaltkreise erklären lassen (welcher Verbraucher in welchem Schaltkreis?)
Batterieanlage(n)
Funktionen Batterieschalter erklären lassen, ggf. Pole reinigen und fetten, Säurestand prüfen, ggf. destilliertes Wasser nachfüllen, Ladezustand prüfen
Landstromanschluss
Ladevorgang erklären lassen, Landanschlusskabel mit passenden Steckern vorhanden?
Beleuchtung
überprüfen (alle stromversorgt?)defekte Leuchtmittel oder Sicherungen wechselndefekte Schalter: Reparatur durch Fachmann
Kompassbeleuchtung
überprüfen, welcher Schaltkreis?
Navigationslichter
überprüfen, ggf. Reparatur durch Fachmann(kein Auslaufen ohne funktionierende Navigationslichter)
sonstige Stromverbraucher
Funktion prüfen, ggf. Reparatur durch Fachmann
G. unter Deck
Bilge
muss sauber und trocken sein, Bilgenpumpe kontrollieren (Schwimmerschalter) – ggf. reparieren
Schmutzwasserpumpe(n)
Funktion überprüfen (evtl. Filter verschmutzt)
Seeventile
für Pantry und Nasszellen, alle Seeventile dicht?
Toilette
Funktionen überprüfen (auspumpen/einpumpen), ggf. Reparatur durch Fachmann
Druckwasseranlage
Funktion Druckwasserpumpe prüfen, Wasservorrat (… l), Umschaltventil bei mehreren Tanks
Gasherd
manuelle Absperrung vorhanden? Zündsicherung prüfen
Flüssiggasanlage
Füllstand Gasflasche? Reserve-Gasflasche? Schläuche und Anschlüsse in Ordnung? ggf. Übernahme ablehnen
Gaswarnanlage
Funktion mit Feuerzeugbenzin prüfen
Werkzeug
evtl. ergänzen
Reservematerial
Keilriemen, Impeller, Öl- und Dieselfilter müssen an Bord sein, Reserve-Leuchtmittel, Ersatzbatterien – ggf. ergänzen
Taschenlampe, Handscheinwerfer
Funktion prüfen, ggf. aus eigenem Bestand ergänzen
H. Navigation
Schiffsdokumente
Versicherungspolicen, Charterlizenz, Permit, Zulassung, Genehmigung Funkanlage, Bedienungsanleitungen
Kompass
Beleuchtung, Deviationstabelle, ggf. selbst erstellen
Kartentisch
Handpeilkompass, Navigationswerkzeug, Fernglas, Seekarten, INT 1, Hafenhandbuch, Leuchtfeuerverzeichnis, Gezeitentafel oder -kalender ggf. ergänzen
Navigationsinstrumente
Logge, Echolot (Anzeige mit Handlot überprüfen), Windanzeige – Funktionen testen, Beleuchtung?
GPS-Empfänger, Plotter
Funktionen erklären lassen, elektronische Seekarten?
Barometer, Borduhr
sind vorgeschrieben
Kurzwellenempfänger
Funktionen erklären lassen
Funkanlage
ggf. wichtige Kanäle bzw. Frequenzen notieren
I. Sicherheitsausrüstung
Rettungswesten, Safetybelts
für jedes Crew-Mitglied, ansonsten kein Auslaufen
Seenotmittel
Optische Kontrolle, Verfallsdatum prüfen, ggf. austauschen
Rettungsinsel
Prüfvignette kontrollieren, ggf. neue Rettungsinsel
Feuerlöscher
mind. 2, Prüfdatum kontrollieren
Rettungskörper, Rettungsleuchte
Rettungskörper an 20-m-Leine vorgeschrieben Rettungsleuchte Funktion prüfen, ggf. Batterie wechseln
Radarreflektor
ist vorgeschrieben, ggf. nachrüsten
Tagzeichen
Ball und Kegel auf SY vorgeschrieben, ggf. nachrüsten
Signalflaggen
mind. N und C, Q, ggf. nachrüsten
Gastlandflagge(n)
ggf. nachrüsten
Nebelhorn
ggf. nachrüsten
Wantenschneider
ggf. nachrüsten
Logstandsm
Betriebsstunden Motorh
🛆 Kaution mittels Kreditkarte hinterlegen (Überweisung kann bei ungerechtfertigter Inanspruchnahme rückgängig gemacht werden).
Seeklar ist eine Jacht, die ausreichend gebunkert (Proviant, Wasser, Treibstoff) hat und hinreichend bemannt ist, deren stehendes und laufendes Gut, Ankergeschirr, Ruderanlage, Navigationslichter, Sicherheitsausrüstung und nautische Ausrüstung kontrolliert, die Segel klar zum Setzen sind und die Maschine klar zum Laufen ist.
1.7 CREW-EINWEISUNG
Die Crew-Einweisung vor dem ersten Ablegen hilft der Crew sich an Bord zurechtzufinden und ist für den Skipper verpflichtend. Schiffs- und Sicherheitseinweisung sind durch Logbucheintrag zu dokumentieren.
Kojeneinteilung
Rettungswesten, Sicherheitsgurte
(Safetybelt)
– Gebrauch erklären, anpassen und verteilen
Seeventile
– Lage und Funktion erklären
Feuerlöscher
– Lage und Gebrauch erklären
Seenotsignale
– Aufbewahrungsort, Gebrauch erläutern
Anleinen
(nur)
an fest montierten Beschlägen oder Strecktauen zeigen
Rettungsring
und
Rettungslicht
(Blitzboje)
– Gebrauch erklären
Funkgerät
erklären
(nur bei Seenot, auf Anweisung des Skippers)
Rettungsinsel
– Aufbewahrung, Gebrauch erklären
Maschine
– Bedienung erklären
(Motorstart und -stopp, ein- und auskuppeln)
Ankergeschirr, Notruderpinne, Lenzpumpen
– erklären
Flüssiggasanlage
– Handhabung erklären
Bord-WC
– Handhabung erklären
elektrische Anlage
–
Batteriesystem und Schalttafel erklären
Manöver
– Reffen, Beidrehen, An- und Ablegen, Ankern so bald als möglich üben
Co-Skipper
– Ersatz des Schiffsführers, wenn dieser ausfällt
POB-Manöver
(Person overboard)
muss unbedingt geübt werden
2JACHTTECHNIK
2.1 RUMPF
Die klassische Fahrtenjacht weist für gute Am-Wind-Eigenschaften eine schlanke Rumpfform auf. Moderne, für den Charterbetrieb konzipierte Jachten, haben meist einen breiteren Rumpf aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK), einem Verbundwerkstoff aus mit Harz getränkten Glasfasermatten. Daneben werden Jachten noch aus Aluminium oder konventionell aus Holz gebaut. GFK-Rümpfe werden meist als Rundspanter gebaut, Aluminium-Rümpfe meist als Knickspanter.
Der für die Stabilität eines Kielbootes notwendige Ballast wird im Kiel angeordnet. Moderne Jachten können bis ca. 120° gekrängt werden, bevor sie durchkentern und (theoretisch) kieloben in eine stabile Lage gelangen können. Der Ballast kann im gesamten Kiel verteilt sein oder in einem bombenförmigen Anhang an der Unterseite der Kielflosse (Bulb, Ballast-Bombe). Vorteil der Ballast-Bombe ist die günstige Lage des Schwerpunkts. Der Gesamtballast kann deutlich verringert werden, was die Schiffe leichter und damit schneller macht.
Beim Flossenkiel ist ein Ballastkiel in der Schiffslängsachse angeordnet. Langkieler (Kiel erstreckt sich über nahezu die gesamte Rumpflänge) sind kursstabil, aber auch träge und weisen einen großen Drehkreis auf. Kurzkieler (relativ kurzer Kiel) sind schnell und wendig (kleiner Kurvenradius). Ein Hubkiel oder Schwenkkiel hat einen variablen Tiefgang, erfordert aber eine aufwändige Mechanik oder Hydraulik.
Beim Doppelkiel ist der Ballast in den beiden seitlichen Kielen angeordnet. Sie wirken der Abdrift durch Vergrößerung der Lateralfläche entgegen. Der Kimmkieler hat drei Kiele, einen flachen Ballastkiel in der Schiffslängsachse und zwei seitlich angeordnete Kielflossen. Beide Kielformen eignen sich speziell für Tidengewässer (trockenfallen), haben aber meist schlechtere Segeleigenschaften als Mittelkieler.
Kleinere Boote und Mehrrumpfboote können zur Verbesserung der Amwind-Eigenschaften mit einem einziehbaren oder klappbaren Schwert ausgestattet sein.
Nach der Anzahl der Rümpfe unterscheidet man den klassischen Einrumpfer (Monohull), Katamarane (Multihull) mit zwei gleich großen Rümpfen, Trimarane mit einem Mittelrumpf und zwei Auslegerrümpfen.
Das Ruder eines Kurzkielers ist ein freistehendes Spatenruder oder Balanceruder (ein Teil des Ruderblattes ist vor der Ruderachse). Das Ruderblatt ist beim Langkieler durch die Form des Kiels oder durch eine Ruderleitflosse (Skeg) geschützt.
Die Steuerung kleinerer Schiffe erfolgt mit einer direkt am Ruderschaft aufgesetzten Pinne. Der Vorteil ist die direkte Übertragung der Schiffsbewegung, der Nachteil die erforderlichen hohen Steuerkräfte. Größere Jachten weisen eine Radsteuerung auf.
2.2 RIGG
Das Rigg besteht aus dem Mast, dem stehenden Gut (Wanten, Stage, Backstagen) und dem laufenden Gut (sämtliches Tauwerk in der Takelage außer dem stehenden Gut, vorwiegend zur Segelbedienung und samt allen Beschlägen). Rigg und Segel sind die Takelage.
2.2.1 Mast und stehendes Gut
Der Baum ist mit dem Mast über den Lümmelbeschlag verbunden. Stage spannen den Mast in Schiffslängsrichtung ab: nach vorn das Vorstag (trägt das Vorsegel) und manchmal zusätzlich ein Baby- oder Trimmstag, nach achtern das Achterstag. Ein Verbindungsstag zwischen den Toppen zweier Masten nennt man Genickstag. Die Abspannungen des Mastes quer zur Schiffslängsachse sind die Wanten (je nach Lage: Topp-, Ober-, Mittel- und Unterwanten). Zur Lastverteilung sind die Topp- oder Oberwanten im oberen Bereich durch Salings zum Mast hin abgestützt. Backstage (auf Fahrtenjachten selten) als Trimmeinrichtung für den Mast zählen zu den Wanten. Sie sind seitlich am Achterdeck befestigt und spannen dem Mast daher nach achtern und nach der Seite ab. Beim Segeln müssen sie auf der Luvseite durchgesetzt und auf der Leeseite losgeworfen werden.
2.2.2 Laufendes Gut
Fallen und Schoten sind die wichtigsten Teile des laufenden Guts. Mit den Fallen werden die Segel geheißt (gesetzt) bzw. niedergeholt (geborgen). Mit den Schoten werden die Segel gefiert bzw. angeholt. Die Dirk führt von der Nock des Großbaums über einen Block im Masttopp zu einer Klampe am Mast oder ins Cockpit und hält den Baum, wenn das Großsegel nicht gesetzt ist. Die gleiche Funktion hat eine Baumstütze (Rohrkicker). Der Baumniederholer ist eine Talje, die das Aufsteigen des Großbaums bei achterlichem Wind verhindert. Reffleinen dienen zum Einholen der Segel, die Leine zur Bedienung einer Rollreffanlage des Großsegels ist der Ausholer.
2.2.3 Segel
Ganz allgemein lassen sich Segel in Rahsegel und Schratsegel einteilen: Rahsegel sind viereckige Segel, die mit ihrem oberen Liek an einer Rah, einer waagerecht am Mast befestigten Spiere, angeschlagen sind. Die Rahen stehen quer zur Schiffslängsachse, und so sind Rahsegler zwar bestens zum Segeln mit achterlichem Wind geeignet, aber zum Aufkreuzen kaum brauchbar. Rahsegel sind heute nicht mehr gebräuchlich.
Schratsegel sind mit ihrem Vorliek in der Mittschiffsebene am Mast oder einem Stag befestigt sind (Ausnahme: Spinnaker). Das Gaffelsegel ist eine ältere Form eines Schratsegels, viereckig und mit dem Oberliek an einer eigenen Spiere, der Gaffel, befestigt. Auf modernen Booten werden fast ausschließlich Hochsegel (auch: Bermudasegel) eingesetzt. Das Hochsegel ist dreieckig und mit dem Vorliek am Mast (Großsegel) oder an einem Stag (Vorsegel, Fock) befestigt.
Die Segel, die als Besegelung auf Am-Wind-Kursen vorgesehen sind, heißen Hauptsegel (Arbeitssegel). Auf Jachten mit einem Mast sind das Großsegel und Fock. Die Segelfläche der Hauptsegel soll auch bei wenig Wind für einen gewissen Antrieb ausreichen. Bei stärkerem Wind müssen die Segel auf kleinere gewechselt oder die Segelfläche verkleinert (gerefft) werden. Das Vorsegel wird gegen ein kleineres Segel getauscht oder gerefft, das Großsegel wird immer gerefft. Wegen der einfacheren (und sicheren) Bedienung sind Rollreffanlagen weit verbreitet.
Alle anderen Segel, die auf besonderen Kursen (z.B. Vor-Wind-Kurs) oder bei besonderen Windstärken (Starkwind, Schwachwind) gesetzt werden, heißen Beisegel. Sie werden zusätzlich zu den Hauptsegeln oder an deren Stelle gefahren.
Bei schwerem Wetter wird anstatt der Fock eine Sturmfock gefahren und anstatt des Großsegels ein Trysegel. Beide Segel sind aus besonders kräftigem Tuch und sehr flach geschnitten. Die Genua ist ein übergroßes, das Großsegel überlappendes Vorsegel aus leichtem Tuch und bauchig geschnitten. Wegen ihres großen Einsatzbereiches wird sie auf Fahrtenjachten häufig eingesetzt.
Das wichtigste Beisegel ist wohl der Spinnaker (Spi) für (leichte) raume Winde, der mit einem losen Unterliek gefahren wird. Er ist aus sehr leichtem Tuch mit ballonartigem Schnitt. Als Blister wird ein asymmetrisch geschnittener, etwas verkleinerter Spinnaker bezeichnet, der wesentlich einfacher in der Handhabung ist als der Spinnaker, da er ohne Baum mit einer Halsleine gefahren wird. Der Gennaker hat ein ähnlich asymmetrisches Profil wie der Blister und wird häufig an einer Art Bugspriet gefahren. Das flachere Profil erlaubt spitzere Windeinfallswinkel als mit dem Blister. Der Code Zero ist ein flach geschnittenes Leichtwettersegel, das wie der Gennaker gefahren wird. Der Allrounder ist eine doppellagige Genua, mit dem Vorliek im Profil einer Rollreffanlage. Sie wird auseinandergefaltet an zwei Teleskopbäumen gefahren und kann stufenlos gerefft (eingerollt) werden. Der Booster ist eine Leichtwindversion des Allrounders.
❒Hochsegel
Die drei Seiten des Segels sind das Vorliek (auch: Mastliek beim Großsegel) als vordere Seite, das Unterliek als untere Seite und das Achterliek als hintere Seite (achtern).
Die drei Ecken werden als Segelkopf (oben), Segelhals (darunter) und Schothorn (achtern) bezeichnet.
Das Vorsegel ist am Vorliek mit Stagreitern am Vorstag geführt oder in der Keep eines Profilstags (Rollreff). Das Großsegel wird mit Mastrutschern in einer Nut am Mast geführt (Bindereff) oder in einem Profil des Rollreffs. Beim Bindereff werden die Reffleinen durch die Reffkauschen geführt. Mit den Reffbändseln an Reffgattchen wird das überschüssige Tuch beim Reffen an den Baum gebunden.
Das Vorsegel wird mit zwei Schoten gefahren. Die Umlenkung erfolgt über Blöcke seitlich an Deck (Holepunkte), die auf Schienen in Schiffslängsrichtung verstellbar sind. Das Großsegel wird mit einer Schot gefahren. Der Angriffspunkt der Großschot wird quer zur Schiffslängsachse mit dem Traveller verstellt. Die Spannung des Vorlieks beim Großsegel wird mit der Cunningham (führt durch eine Kausch am Unterliek) reguliert.
Beim Lattensegel sorgen Segellatten für eine bessere Profilierung des Segels, es kann weiter ausgestellt (Wölbung des Achterlieks) werden und ermöglicht so eine größere Segelfläche.
Als Standard-Segeltuch werden Polyestertuche (Diolen, Trevira, Dacron, Terylene …) in unterschiedlichen Schnitten und Qualitäten verwendet. Sie sind empfindlich gegen Abrieb und Knicke (nicht unnötig im Wind schlagen lassen) und altern durch UV-Bestrahlung. Modernere Segeltuche sind Laminate aus Dacron und Mylarfolie, sogenannte Sandwich-Tücher. Auf Fahrtenjachten werden zunehmend auch Laminate aus PE-Fasern (Spectra, Dyneema) eingesetzt. Zur Verbesserung der Festigkeit werden quer zum PE-Garn Aramid-Fasern (Kevlar) eingearbeitet und mit Folie verbunden. Damit wird eine etwa fünfach höhere Festigkeit gegenüber Dacron erzielt (sehr teuer, daher fast ausschließlich im Regattasport).
2.2.4 Jachttypen
Die Typenbezeichnung erfolgt nach der Art des Riggs, nach der Anzahl der Segel (Hauptsegel) und Masten und deren Anordnung.
Das Cat-Boot ist ein Segelboot mit einem Mast und nur einem Segel, dem Großsegel, ohne Vorsegel. Die Slup (Sloop) hat einen Mast, ein Großsegel und ein Vorsegel (Fock oder Genua). Beim Topprigg greift das Vorstag am Masttopp an, dementsprechend reicht auch das Vorsegel bis zum Masttopp. Beim Fraktional-Rigg sitzt das Vorstag tiefer (z.B. auf 7/8 der Masthöhe). Meist sind zusätzliche Backstagen erforderlich, und das Vorsegel fällt kleiner aus. Der Kutter fährt ein zweites Vorsegel vor der Fock, den Klüver.
Die Ketsch hat einen zweiten (niedrigeren) Mast (Besanmast) innerhalb der Wasserlinie. Bei der Yawl steht der kleinere Besan (Treiber) außerhalb der Wasserlinie. Wie bei der Ketsch kann die Anzahl der Vorsegel variieren. Beim Schoner steht vor dem Großmast ein etwas kleinerer (oder gleich großer) Fock- oder Vormast. Als Vorsegel sind Fock und Klüver üblich.
Durch die Aufteilung der Segelflächen können größere Jachten leichter ausbalanciert werden. Die kleineren Segelflächen erfordern einen geringeren Kraftaufwand.
2.3 MOTOR
Als Jachtmotor hat sich der 4-Takt-Dieselmotor durchgesetzt. Der Dieselmotor ist ein Selbstzünder, er benötigt keine Zündanlage (und keinen Vergaser), ist zuverlässig, robust und sicher (Dieseldämpfe sind bei normaler Arbeitstemperatur nicht explosiv).
2.3.1 Funktionsprinzip
Im ersten Takt (Ansaugventil offen) bewegt sich der Kolben nach unten, Luft wird angesaugt. Im zweiten Takt (Ventile geschlossen) steigt der Kolben nach oben, die Luft wird verdichtet und dadurch auf 500–700 °C erhitzt. Kurz bevor der Kolben den oberen Wendepunkt (Totpunkt) erreicht, wird der Kraftstoff über die Einspritzdüsen fein zerstäubt eingespritzt. Im dritten Takt (Arbeitstakt), kommt es zur Entzündung des Kraftstoff-Luft-Gemisches, die den Kolben nach unten treibt. Im vierten Takt (Auslassventil offen) stößt der Kolben nach oben, die Abgase werden in die Auspuffanlage gedrückt. Die vier Hübe (Arbeitsspiel) bewirken zwei Umdrehungen an der Kurbelwelle. Die Kraftübertragung vom Kolben auf die Kurbelwelle erfolgt über die Pleuelstangen. Ein Schwungrad überbrückt die drei Nicht-Arbeitstakte.
Einspritzpumpe, Nockenwelle (Ventilsteuerung), Wasserpumpe(n), Kraftstoffpumpe und Generator werden direkt oder indirekt von der Kurbelwelle angetrieben.
2.3.2 Kraftstoffsystem
Das Kraftstoffsystem wird in einen Niederdruckteil (Kraftstofftank bis Einspritzpumpe) und einen Hochdruckteil (Einspritzpumpe bis Einspritzdüsen) unterteilt.
Der Diesel-Kraftstoff wird von der Kraftstoffpumpe zur Einspritzpumpe gefördert. Über eine Rücklaufleitung gelangt überschüssiger Kraftstoff zum Tank zurück. Die Kraftstoffleitungen sind mit flexiblen Verbindungen (Dichtungen metallisch) verbunden, um Leitungsbruch durch Motorvibrationen zu verhindern. Mit dem Absperrhahn (sollte in der Nähe des Tanks sein) kann das Krafststoffsystem abgesperrt werden (Filterwechsel, Brand). Das im Kraftstoff enthaltene Wasser (Kondensat) fällt am Wasserabscheider aus und wird über eine Ablassschraube abgelassen. Sind feste Rückstände im Schauglas sichtbar, muss der Tank gereinigt werden. Der Vorfilter gegen grobe Verschmutzungen hat meist einen Filtereinsatz aus engmaschigem Draht, der Feinfilter einen Wegwerf-Filtereinsatz.
Der Filterwechsel erfolgt mit einem Bandschlüssel, der neue Filter wird von Hand angezogen. Anschließend müssen die Kraftstoffleitungen entlüftet bzw. wieder mit Diesel befüllt werden. Am höchsten Punkt des Systems (üblicherweise der Feinfilter) wird die Entlüftungsschraube gelöst und mit dem Handhebel der Kraftstoffpumpe so lange gepumpt, bis der Kraftstoff blasenfrei austritt. Ist kein Handhebel vorhanden, kann ggf. auch der Anlasser betätigt werden, um die Kraftstoffleitungen zu befüllen. Muss auch die Einspritzpumpe entlüftet werden, dann nur nach der Betriebsanleitung, damit nicht irrtümlich eine Einstellschraube verdreht wird. Weist der Dieselmotor eine Kaltstarteinrichtung (mit Kraftstoffeinspritzung) auf, ist diese durch Lösen der Leitung an den Düsen ebenfalls zu entlüften.
🛆 Arbeiten am Hochdruckteil sollten nur von einem Fachmann durchgeführt werden.
Die Einspritzpumpe erzeugt einen Druck bis zu 1000 bar. Verteiler-Einspritzpumpen versorgen über ein Verteilventil die Einspritzdüsen, oder jede Einspritzdüse wird von einer eigenen Einspritzpumpe versorgt. Die eingespritzte Kraftstoffmenge bestimmt die Motordrehzahl. Der Drehzahlregler ist meist eingebaut, er bestimmt die maximale Drehzahl und sorgt für eine konstante Drehzahl bei wechselnder Belastung. Der Zahnriemen, der die Einspritzpumpe antreibt, ist nach bestimmten Betriebsstunden gemäß Herstelleranleitung zu wechseln, die Einspritzdüsen müssen entweder gewartet werden oder sind auszutauschen (Lebensdauer bis zu 1000 Betriebsstunden).
Gestartet wird der Dieselmotor mit einem Motorschlüssel und/oder Startknopf. Als Kaltstarthilfe wird zusätzlich Kraftstoff zugeführt, und im Verbrennungsraum sorgen Glühkerzen für die Aufheizung und schließlich Entzündung des Diesel-Luft-Gemisches.
Abgestellt wird ein Dieselmotor durch Unterbrechung der Kraftstoffzufuhr. Die Stoppeinrichtung wird häufig mit einem (roten) Knebel am Motorpaneel betätigt. Erst nach Stillstand des Motors, der durch ein akustisches und optisches Signal bestätigt wird, darf der Motorschlüssel betätigt werden. Direkt am Motor befindet sich noch eine manuell zu bedienende Stoppeinrichtung. Neuere Ausführungen ermöglichen das Abstellen des Motors direkt über den Motorschlüssel wie beim Pkw.
2.3.3 Luftzufuhr
Die zur Verbrennung des Kraftstoffs erforderliche Luft wird über einen Luftfilter angesaugt. Der Filtereinsatz ist entweder ein Papierfilter als Wegwerffilter oder ein Drahtgeflecht zum Reinigen. Turbolader werden vom Abgasstrom angetrieben und verbessern die Motorleistung durch Verdichtung der Ansaugluft. Ein Zwischenkühler sorgt bei manchen Motoren für eine Kühlung der aufgeladenen Zuluft, die dadurch mit mehr Kraftstoff angereichert werden kann.
2.3.4 Kühlsystem
Luftgekühlte Motore sind sehr laut und benötigen viel Raum, das System hat aber den Vorteil, dass die Motorenteile nicht mit Wasser beaufschlagt sind und daher nicht korrodieren. Bei der Einkreiskühlung wird das Seewasser von der Seewasserpumpe direkt in Kanälen über den Motorblock in den Auspuff gepumpt. Über einen Thermostat erfolgt die Aufteilung der Kühlwassermenge über den Motor bzw. in das Abgassystem. Die Motortemperatur wird auf 50 - 60 °C begrenzt, um zu verhindern, dass Salz aus dem Seewasser ausfällt und sich in den Kanälen ablagert. Verunreinigungen des Seewassers können den Durchfluss verringern.
Die Zweikreiskühlung hat einen inneren, geschlossenen Kühlkreis, der mit einer Kühlflüssigkeit gefüllt ist, und einen eigenen Seewasserkreislauf mit Seewasserpumpe, Filter und Seeventil. Die Wärmeübertragung vom inneren auf den äußeren Kreislauf erfolgt im Wärmetauscher. Die Motortemperatur wird über einen Thermostat auf die optimale Betriebstemperatur von etwa 90 °C geregelt. Ein defekter Thermostat führt zur Überhitzung des Motors und muss ausgetauscht werden. Die Vorteile der Zweikreiskühlung sind die optimale Betriebstemperatur und dass es zu keinen Korrosionen, Verunreinigungen oder Salzablagerungen kommt.
Der Seewasserfilter von wassergekühlten Motoren muss mindestens 20 cm über der Wasserlinie liegen, damit das Seewasser nicht zu den Ventilen zurückfließen kann. Die Kühlwasserleitungen sind am Motorblock mit flexiblen Schläuchen angeschlossen. Kühlwasserpumpen sind zumeist Impellerpumpen mit einem Impeller aus Gummi (Neopren). Ersatzimpeller und Dichtungen müssen mitgeführt werden.
Der Kühlmittelstand im Ausgleichsbehälter ist regelmäßig zu kontrollieren und ggf. nachzufüllen. Wird der Motor zu heiß, ist der ungehinderte Austritt des Kühlwassers aus dem Auspuff zu überprüfen (Seeventil voll geöffnet? Auspuffanlage frei?). Eine undichte Stelle im Wärmetauscher ist an einem Wasseraustritt am Überlaufrohr (bei laufendem Motor) zu erkennen.
2.3.5 Auspuffsystem
An den Auspuffkrümmer am Motorblock ist ein flexibler, verstärkter Gummischlauch angeschlossen, der an der Durchführung durch den Spiegel endet. Zur Kühlung der Abgase wird das Seewasser der Motorkühlung in das Abgassystem geleitet (dient auch zur Geräuschdämpfung). Ein Wassersammler am tiefsten Punkt sammelt das Wasser nach dem Abstellen des Motors. Im Betrieb wird das Wasser durch den Druck der Abgase nach außen befördert. Der Wassersammler kann auch manuell entleert werden. Ein Schwanenhals vor der Durchführung durch den Rumpf verhindert das Eindringen von Seewasser. Ist der Motor nahe an oder unter der Wasserlinie eingebaut, muss das Kühlsystem belüftet werden (Vakuumventil, Belüftungsleitung), damit kein Wasser zu den Ventilen zurückfließen kann. Manche Auspuffanlagen haben einen zusätzlichen Schalldämpfer eingebaut.
2.3.6 Schmierung
Bei manchen langsam laufenden Motoren wird das Motoröl durch die bewegten Teile des Motors verteilt (Schleuderschmierung). Normalerweise aber wird das Motoröl über eine Pumpe im Motor verteilt. Die Ölförderpumpe ist zumeist eine von der Nockenwelle angetriebene Zahnradpumpe. Das Motoröl wird über einen Saugkorb in der Ölwanne angesaugt und zu den Lagern verteilt. Das Motoröl transportiert den Abrieb an den Maschinenteilen in den Ölfilter (Wegwerffilter). Der Filterwechsel erfolgt bei Betriebstemperatur. Die neue Filterkartusche sollte mit Öl gefüllt sein. Der intervallmäßig vorgeschriebene Ölwechsel ist Angelegenheit des Eigners und wird kaum vom Skipper durchzuführen sein.
2.3.7 Einhebelschaltung
Gas und Getriebe werden gleichzeitig betätigt. Wird der Gashebel nach vorn V (hinten R) geschoben, schaltet das Wendegetriebe die Drehrichtung der Schraube auf Voraus-(Retour-)fahrt, je weiter, desto höher die Drehzahl. In der Neutralstellung N dreht der Motor mit der eingestellten Leerlaufdrehzahl im Leerlauf.
2.3.8 Motorelektrik
Der Dieselmotor benötigt Elektrizität nur zum Starten und zur Überwachung bzw. zur Anzeige der Betriebsfunktionen, nicht während er läuft. Zwischen Starterbatterie und Anlasser sitzt das selbstständig arbeitende Startrelais, da die Batterieströme für das Motorschloss zu groß wären.
Der Motorschlüssel betätigt den Vorglühschalter, der wirkt auf das Startrelais, das den Hauptstromkreis schließt. Manche Motoren haben noch eine Starthilfe eingebaut. Zwischen Generator (Lichtmaschine) und Batterie befindet sich das Amperemeter, zwischen den Polen des Reglers ein Voltmeter. Generator und Vorglühschalter sind abgesichert. Wird der Motorschlüssel betätigt, leuchten die Warnlampen Ladestrom und Öldruck auf, bis der Motor läuft.
Der Generator wird über den Keilriemen angetrieben und erzeugt Wechselstrom, der über den eingebauten Gleichrichter in Gleichstrom umgewandelt wird und mit dem in erster Linie die Batterie(n) geladen wird (werden). Die Spannung des Keilriemens sollte zwischen den beiden am weitesten auseinanderliegenden Scheiben 12 - 15 mm Spiel zulassen. Eine zu geringe Spannung lässt den Keilriemen durchrutschen: der Generator erreicht nicht die zur Ladung erforderliche Drehzahl, der Keilriemen erwärmt sich und bricht. Eine zu hohe Spannung verkürzt die Lebensdauer des Generators. Die Keilriemenspannung wird durch Verstellen des Tragarms, auf dem der Generator sitzt, eingestellt. Ein eingebauter Regler regelt die Spannungsabgabe. Bei 14,4 A regelt der Regler die Spannung herunter und gibt nur noch Strom zur Spannungserhaltung ab.
Die üblichen Starterbatterien sind Säurebatterien, die zwar den hohen Anlasserstrom zum Starten liefern, aber nicht zu viele Ladezyklen vertragen (für das Bordnetz sind wartungsfreie AGM- oder Gelbatterien besser geeignet). Die Starterbatterie(n) ist (sind) vom Bordnetz getrennt, um eine Entladung durch sonstige Verbraucher an Bord auszuschließen. Bei manchen Systemen lassen sich über einen Batteriehauptschalter Starter- und Bordnetzbatterien zusammenschalten (sollte die Starterbatterie einmal ausfallen). Beim Umschalten von einer Batterie auf eine andere darf die erste Batterie erst vom Netz getrennt werden, wenn die zweite Batterie bereits zugeschaltet ist, da sonst der Regler des Generators zerstört wird. Deshalb darf auch kein Batteriekabel abgeklemmt werden, während der Motor läuft.
Im Motorpaneel ist das Motorschloss (Stopp – Ein – Vorglühen – Start) untergebracht, Drehzahlanzeige, Betriebsstundenzähler, Warn- und Kontrollleuchten Batterieladung, Alarmsummer, Kühlwassertemperatur und Öldruck sowie ggf. Startschalter und Kaltstartschalter (wenn nicht am Motorschloss). Zusätzliche Anzeigen je nach Bauart sind möglich, z.B. Anzeigen für Öldruck und Betriebstemperatur.
2.3.9 Dieselverbrauch
Der Kraftstoffverbrauch eines Jacht-Dieselmotors beträgt bei maximaler Drehzahl (~ 3000 1/min) etwa 0,27 - 0,34 l/kWh (Benzinmotor 0,42 - 0,54 l/kWh). Bei 80 % der Höchstdrehzahl beträgt der Verbrauch nur noch die Hälfte, die Fahrt durchs Wasser verringert sich nur unwesentlich. Die effektivste Drehzahl für Marschfahrt wird bei etwa 2000 1/min liegen.
2.3.10 Motorkontrollen
Die Maschine muss auch auf Segeljachten jederzeit einsatzbereit sein und daher regelmäßig kontrolliert bzw. gewartet werden.
KONTROLLEN BEI STILLSTEHENDEM MOTOR
01
Kühlsystem
(alle 20 Betriebsstunden)
Dichtheit prüfen: Schlauchverbindungen nachspannen, Risse in Schläuchen mit Tape umwickeln und mit Schlauchschelle sichern, gebrochene Schläuche ersetzen. Füllstand Kühlkreis kontrollieren: Kühlflüssigkeit nachfüllen (Markierung Ausgleichsbehälter).
02
Motoröl
(alle 20 Betriebsstunden)
Ölstand kontrollieren: Öl bis zur Markierung (Ölmessstab) nachfüllen.
Farbe des Motoröls: Grau bis Weiß deutet auf Wasser im Öl hin – Ölwechsel erforderlich, anschließend Motorüberholung.
Ölfilter gemäß Wartungsintervall Hersteller wechseln.
03
Kraftstoffsystem
(alle 20 Betriebsstunden)
Dichtheit prüfen: Anschlüsse gefühlvoll nachziehen, evtl. Dichtungen wechseln.
Vor- bzw. Feinfilter gemäß Wartungsintervall Hersteller wechseln, System entlüften (Handhebel Dieselpumpe).
04
Keilriemenspannung
(alle 20 Betriebsstunden)
Keilriemen sollte sich zwischen den beiden am weitesten auseinanderliegenden Scheiben 12–15 mm eindrücken lassen, nachspannen über Verstellung des Generators.
05
Auspuffanlage
(alle 50 Betriebsstunden)
Dichtheit prüfen: lose Verbindungen nachspannen, Risse mit hitzebeständigem Tape umwickeln.
06
Motoraufhängungen
(alle 50 Betriebsstunden)
Lose Muttern samt Kontermuttern nachziehen.
07
Elektrokabel
Anschlüsse an der Batterie und am Anlasser kontrollieren: reinigen bzw. nachziehen.
KONTROLLEN BEI LAUFENDEM MOTOR
08
Motorstart
Vor jedem Start: Seeventil muss offen sein.
Nach dem Start: Kontrollleuchten Öldruck und Ladestrom müssen erlöschen, sobald der Motor läuft, wenn nicht, Motor abstellen und Ursache feststellen.
Kühlwasser tritt stoßweise am Auspuff aus, wenn nicht, Motor abstellen und Ursache feststellen.
09
Kühlsystem
(1 x täglich)
Leckagen am Wärmetauscher zwischen innerem und äußerem Kühlkreislauf am Überlauf Kühlwasserdeckel erkennbar (Reparatur Fachmann).
Reparatur (an den Anschlüssen) nur bei stehendem Motor.
10
Kraftstoffleckage
Abdichtung mit Ersatzschlauch und Schlauchklemmen.
11
Motorölleckage
Ölstand auf Minimum absenken (absaugen), Dichtungen und Dichtflächen reinigen, ggf. Dichtungen tauschen.
12
Vibrationen
Ungewöhnliche Vibrationen können viele Ursachen haben (Lager, Welle, Zylinderausfall). Reparatur in Werkstätte.
13
Stopfbuchse
Kontrolle während der Fahrt: Ein paar Tropfen je Stunde sind normal, sonst Stopfbuchse nachziehen (nicht zu viel, da sonst die Welle beschädigt wird) oder Fett einpressen.
2.3.11 Motordefekte und deren Behebung
MOTORPROBLEME, URSACHEN, BEHEBUNG
01
Starter dreht nicht durch
Batteriekontakte, Kontakte am Anlasser und am Batteriehauptschalter überprüfen: ggf. Kontakte reinigen und nachziehen.
Batteriespannung mit Messgerät überprüfen (volle Batterie 12,7 V): Bei geringer Batteriespannung auf Bordnetzbatterien umschalten.
Kabel am Startschalter oder Zündschloss überprüfen: ggf. Kontakte reinigen (Korrosion) und befestigen.
Wenn der Anlasser klemmt, ist er eventuell durch Drehen des Motors mit der Handkurbel wieder in Gang zu setzen.
02
Starter dreht, Motor springt nicht an
Überprüfen, ob genug Treibstoff im Tank ist und ob der Absperrhahn geöffnet ist: ggf. Kraftstoff nachfüllen bzw. Absperrhahn öffnen.
Batteriespannung mit Messgerät überprüfen (volle Batterie 12,7 V): Bei geringer Batteriespannung auf Bordnetzbatterien umschalten.
Kabel am Startschalter oder Zündschloss überprüfen: ggf. Kontakte reinigen (Korrosion) und befestigen.
Stellung des Dekompressionshebels überprüfen: ggf. in die richtige Stellung bringen (evtl. Rückholfeder gebrochen).
Kabelanschluss des Drehzahlbegrenzers überprüfen: ggf. wieder anschließen.
An der Entlüftungsschraube des Feinfilters prüfen, ob Kraftstoff in die Niederdruckleitung gelangt (Handhebel an der Kraftstoffpumpe).
Verbindung Gashebel zum Regelhebel am Motor prüfen: ggf. wieder herstellen.
Hochdruckleitung (Einspritzpumpe bis Einspritzdüsen) auf Risse überprüfen: Reparatur ggf.durch Fachmann.
Vorfilter und/oder Feinfilter überprüfen: ggf. Filter wechseln, System entlüften (Handhebel Kraftstoffpumpe).
Niederdruckleitung auf Lecks überprüfen: ggf. undichte Stellen abdichten.
Luft im System: Sind alle Verbindungen auf der Saugseite überprüft, System entlüften (Feinfilter, evtl. Einspritzpumpe nach Betriebsanleitung und ggf. Kaltstarteinrichtung).
Wasser im Motoröl (grau oder weiß): Zylinderkopfdichtung defekt: Reparatur durch Fachmann. Wassereintritt durch Auspuffanlage (schwere See): Seeventil schließen, Einspritzdüsen abschrauben, Motor von Hand drehen, mit Wasser durchsetztes Öl absaugen, frisches Öl einfüllen, Seeventil wieder öffnen.
03
Motorüberhitzung
(erhöhte Temperaturanzeige, quälendes Motorgeräusch, Qualm aus dem Auspuff bzw. Wassersammler, kein Kühlwasseraustritt am Auspuff, Motor hat sich festgefressen)
Ansaugung Seewasser verstopft: Motor stoppen und Verstopfung beseitigen.
Geschlossenes Seeventil öffnen, verstopftes Seeventil reinigen.
Impeller der Kühlwasserpumpe defekt: Seeventil schließen, defekten Impeller und abgebrochene Reste entfernen und neuen Impeller eingefettet einsetzen.
Verdacht auf defekten Thermostat: Seeventil schließen, Thermostat ausbauen, in Gefäß mit Wasser geben und erhitzen. Ggf. Thermostat tauschen (eine kurze Strecke bei geringer Belastung kann auch mit defektem Thermostat weitergefahren werden).
Sind die Kühlwasserkanäle im Motor verstopft, ist ein Ausbau des Motors erforderlich.
04
Schwarzer Rauch aus dem Auspuff
(Motor überlastet, zu wenig Frischluft)
Leine o. Ä. in der Schraube: durch mehrmaliges Einlegen des Vor- und Rückwärtsganges versuchen, den Propeller zu befreien, sonst tauchen.
Auspuffanlage blockiert: reinigen; Verstopfung entfernen.
Zu wenig Frischluft: Luftfilter reinigen bzw. wechseln, Motorraumbelüftung prüfen.
05
Motor läuft, kein Schub
Schraube abgefallen, Scherstift bzw. Längskeil gebrochen oder herausgefallen: in den nächsten Hafen segeln.
Getriebe defekt: Reparatur durch Fachmann.
Bowdenzug zum Getriebe hat sich gelöst: neu befestigen oder von Hand direkt am Getriebe schalten.
06
Motor setzt manchmal aus
Luftfilter verstopft: Filter reinigen bzw. wechseln.
Motorraumbelüftung bzw. Tankentlüftung blockiert: Teile entfernen.
Abgenutzte Kolbenringe, schlecht sitzende Ventile oder undichte Zylinderkopfdichtung: Reparatur in Werkstätte.
07
Außergewöhnliche Vibrationen oder Geräusche
Muttern der Motorlagerung lose: nachziehen.
Gebrochenes/loses Motorlager zerstört meist auch Stopfbuchse und Wellenbock: Wassereintritt, höchste Gefahr.
Wellenkupplung lose: nachziehen.
Eventuell kündigt sich ein Motorschaden durch eingedrungenes Wasser oder zu wenig Öl im Motor an (Maßnahmen siehe oben).
Gebrochener/loser Wellenbock kann mit Bordmitteln kaum repariert werden.
2.4 STEUERUNG
Vorteil der Pinnensteuerung ist die direkte Übertragung der Schiffsbewegung. Der Rudergänger spürt jede Änderung des Ruderdrucks sofort. Sie hat aber auch den Nachteil von hohen Steuerkräften: Auf Segeljachten ab etwa 33 Fuß Länge ist eine Radsteuerung sinnvoll, bei Jachten mit Mittelcockpit ist sie unumgänglich, da die Pinne nur direkt auf den Ruderschaft aufgesteckt werden kann.
Bei der Radsteuerung erfolgt die Kraftübertragung hydraulisch oder mechanisch, z.B. mit Schneckengetriebe (gute Kraftübersetzung, schwierige Einschätzung des Ruderdrucks). Auf Fahrtenjachten findet man meist eine Radsteuerung mit Seil- oder Bowdenzügen vor. Die Kraftübertragung vom Steuerrad auf den Ruderquadranten erfolgt über Steuerseile. Der Ruderquadrant setzt die Zugkraft der Steuerseile in eine Drehbewegung um. Der Ruderschaft ist bis zum Deck geführt. Bei einem Ausfall der Steuerung wird mit der Notpinne gesteuert.
🛆 Eine Geradeaus-Markierung am Steuerrad (z.B. Behelfstakling) erleichtert das Manövrieren, vor allem in Achterausfahrt, wesentlich.
2.5 ELEKTRISCHE ANLAGE
Die Hauptbausteine des elektrischen Systems an Bord sind: Batterie, Schalttafel, Generator (Lichtmaschine), Ladegerät, Landanschlusskabel und Verbraucher und Kabelnetz. Der Motor erzeugt über den Generator 12 V Wechselspannung, die der eingebaute Gleichrichter in Gleichstrom umwandelt. Größere Schiffe arbeiten mit 24 V (kleinere Leitungsquerschnitte bzw. geringere Spannungsverluste). Motorelektrik und Bordnetz sind meist getrennt, mit jeweils eigenen Batterien bzw. Batterieblöcken. Beide Systeme werden jeweils über einen eigenen Batterieschalter ein- bzw. ausgeschaltet und können manchmal auch gekoppelt werden (z.B. wenn die Starterbatterie leer oder defekt ist).
2.5.1 Batterie
Für das Bordnetz besonders geeignet sind AGM-Batterien, bei denen der Elektrolyt nicht flüssig, sondern in einem Vlies gebunden ist, oder Gelbatterien mit einem gelförmigen Elektrolyt. Beide Typen sind nahezu wartungsfrei, halten länger und sind weniger empfindlich gegen Tiefenentladung. Sie sind aber auch teurer.
Die Batterie muss gegen Erschütterung gesichert sein und der Batterieraum nach außen belüftet (Säureaustritt). Blei-Säure-Batterien sind mit einem Elektrolyt (ver-dünnte Schwefelsäure) gefüllt. Der Füllstand muss über dem Oberrand der Bleiplatten liegen, nachfüllen mit destilliertem Wasser. Der Ladezustand kann mit einem Säureheber anhand der Dichte des Elektrolyts relativ exakt gemessen werden: Batterie voll 1,28 kg/l, halbvoll 1,20 kg/l und entladen 1,15 kg/l. Mit einem Voltmeter kann an den Polen auch die Ruhespannung (eine Stunde nach Belastung bzw. Ladung, 20 °C) gemessen werden: Batterie voll 12,7 V, halbvoll 12,3 V und entladen 11,9 V.
Die Nennspannung einer Bleizelle ohne Stromentnahme beträgt 2,0 V. Sie darf nicht unter 1,75 V je Zelle sinken, da sonst die Bleiplatten zerstört werden. Die Ladespannung einer 12-V-Batterie beträgt 13,8 - 14,1 V. Der Regler des Ladegeräts bzw. Generators regelt die Ladespannung entsprechend dem Ladezustand automatisch und begrenzt diese bei der kritischen Spannung von 14,4 V (2,4 V je Zelle). Ist der Regler defekt, wird mit hoher Spannung weiter geladen. Die Batterie erwärmt sich, fängt an zu kochen, hochexplosives Knallgas bildet sich und die Batterie wird zerstört. Ein Ladevorgang dauert 8 bis 12 Stunden, eine Vollladung 24 Stunden.
Entladeschlussspannung 10,5 V: minimale Spannung (1,75 V je Zelle) bis zu der eine Batterie entladen werden darf; darunter wird die Batterie geschädigt.
Ruhespannung 11,6–12,7 V: leere Batterie 11,6 V, volle Batterie 12,7 V
Ladespannung 13,8–14, 1 V: wird vom Regler reguliert
Gasungsspannung 14,4 V: maximale Spannung (2,4 V je Zelle) mit der eine Batterie geladen werden darf; darüber wird die Batterie zerstört.
❒Batteriekapazität
Die Kapazität in Amperestunden (Ah) ist ein Maß für die von einer Batterie speicherbaren Strommenge. Zur Erhöhung der Kapazität werden mehrere Batterien zu einem Batterieblock zusammengeschaltet. Bei der Serienschaltung von Batterien addiert sich deren Spannung: Zwei 12-V-Batterien in Serie geschaltet liefern eine Spannung von 24 V.
Bei der Reihen- oder Parallelschaltung addiert sich die Stromstärke bei gleicher Spannung und damit die Kapazität des Batterieblocks. Die Nennkapazität einer Batterie gilt für eine etwa 20-stündige Entladung. Werden kurzzeitig große Strommengen entnommen, sinkt die Kapazität rasch. Unter Berücksichtigung einer Entladereserve von 20 % beträgt die nutzbare Kapazität einer 120-Ah-Batterie unter 100 Ah.
Die Verbraucher einer 40-Fuß-Segeljacht (Instrumente, Navigationslichter, Pumpen, Autopilot, Beleuchtung, Kühlbox …) haben einen Strombedarf von etwa 340 Ah in 24 Stunden bei durchschnittlicher Betriebsdauer.
Über einen Batteriehauptschalter kann man Starter- und Bordnetzbatterien einzeln zuoder abschalten bzw. das gesamte Stromnetz ausschalten. Wird von einer Batterie auf eine andere umgeschaltet, darf die erste Batterie erst dann vom Netz getrennt werden, wenn die zweite Batterie bereits zugeschaltet ist, da sonst der Diodenschalter des Generators zerstört wird. Deshalb darf auch kein Batteriekabel abgeklemmt werden, während der Motor läuft.





























