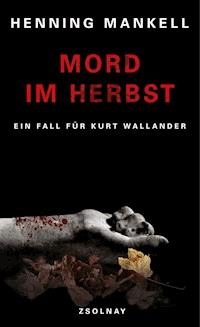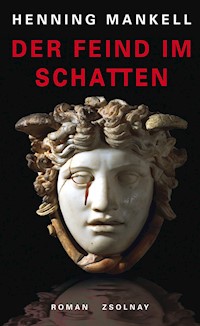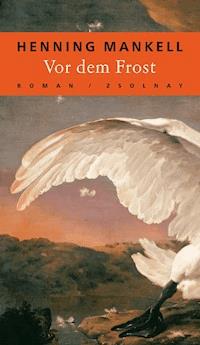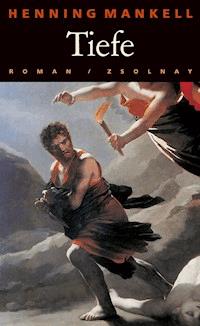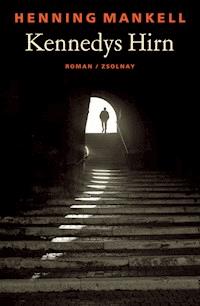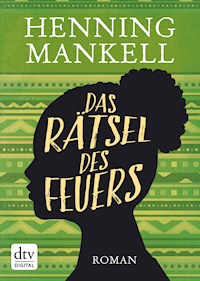
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Die Sofia-Reihe
- Sprache: Deutsch
Die Liebe hat schöne und dunkle Seiten... Als Sofias Schwester an Aids erkrankt, bricht für Sofia eine Welt zusammen. Dann aber verliebt sie sich in Armando, den »Mondjungen« – und lernt die schönen Seiten der Liebe kennen ... Henning Mankells Jugendbuch-Afrika-Trilogie erstmals als eBook!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 213
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Henning Mankell
Das Rätsel des Feuers
Aus dem Schwedischen von Angelika Kutsch
dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München
Für Kari,
die mich zu Sofia
geführt hat
Zur Erinnerung an Rosa
Ich will noch eine Geschichte erzählen.
Diesmal von Sofia
und ihrer Schwester Rosa.
Es ist kurz vor
der afrikanischen Dämmerung.
Sofia ist gerade aufgewacht.
Noch ist es dunkel.
Aber bald wird sich die Sonne
wie eine feuerrote Kugel über den Horizont erheben.
Zu einem weiteren Tag in Sofias Leben …
1.
Eines Morgens erwachte Sofia mit dem Gefühl, dass etwas Besonderes passieren würde. Etwas, das sie noch nie erlebt hatte. Vielleicht sogar etwas, das zu einem entscheidenden Ereignis in ihrem Leben werden würde.
Wie üblich wachte sie auf, kurz bevor Frau Mukulelas Hahn zu krähen begann. Sie mochte den Hahn nicht. Niemand im Dorf mochte ihn. Er krähte immer zu früh, lange bevor der erste Streifen Morgenlicht über den Bergen im Osten erschien. Herr Temba, der gegenüber von Frau Mukulela wohnte, schimpfte oft mit ihr, weil sie sich nicht von dem Hahn trennte, der nicht wusste, wann ein Hahn still zu sein oder zu krähen hat. Herr Temba hatte mehrere Male gedroht, den Hahn umzubringen, und als er einmal auf dem Markt in Boane ungewöhnlich viele von den Körben verkauft hatte, die er herstellte, bot er ihr an, den Hahn zu kaufen. Dann wollte er ihm den Kopf abschlagen und ihn aufessen. Aber Frau Mukulela hatte ihre großen Brüste in dem Stoff zurechtgeschubst, den sie um ihren Körper geschlungen hatte, und wütend geantwortet, ihr Hahn sei nicht zu verkaufen.
Sofia lag in der Dunkelheit und lachte leise bei der Erinnerung daran. Sie mochte Herrn Temba und Frau Mukulela. In Wirklichkeit stritten sie sich wahrscheinlich gar nicht um den Hahn. Vermutlich war Herr Temba böse, weil Frau Mukulela nicht in seine Hütte ziehen wollte. Beide waren allein. Frau Mukulelas Mann war zu den Gruben in Südafrika gefahren und hatte dort eine andere Frau gefunden, mit der er jetzt zusammenlebte. Herr Temba war Witwer, seine Frau war schon vor einigen Jahren gestorben.
Sie zanken sich, weil sie einander mögen, dachte Sofia.
Dann lachte sie wieder. Frau Mukulela hatte mächtige, große Brüste. Immer wenn sie sich über etwas aufregte, schubste sie sie zurecht, als ob sie ihrer Wut im Weg wären.
Rosa schlief auf dem Fußboden neben Sofia.
Sie konnte Rosas Atemzüge in der Dunkelheit hören. In dem anderen Raum, hinter dem Vorhang, der vor der Türöffnung hing, schliefen ihre Mama und die beiden kleineren Brüder. Das waren Geräusche, die ihr Geborgenheit gaben. Sofia mochte diese Morgenstunde, wenn sie als Einzige wach war.
Sie lag in der Dunkelheit und dachte daran, was sie an diesem Tag erwartete. Zuerst würde sie sich die beiden Plastikbeine anschnallen, die sie trug, seit sie auf eine Mine getreten und ihre Schwester Maria gestorben war. Während sie sich die Beine anlegte, würde sie mit Maria reden. Das tat sie jeden Morgen. Auch wenn Maria nun schon vier Jahre tot war, schien sie Sofia trotzdem jeden Morgen zu besuchen. Merkwürdig war nur, dass Maria seitdem nicht gewachsen war. In Sofias Gedanken sah sie immer noch aus wie an jenem Morgen, als all das Schreckliche geschah. Sofia stellte sich vor, Maria käme sie aus der anderen Welt besuchen, aus der Unterwelt. Man wurde in der Erde begraben und dann öffnete sich tief dort unten im Dunkel eine Tür zum Reich der Toten. Vielleicht war es auch ein Fluss, der langsam hervorsickerte und dann immer breiter wurde, und dort gab es ein Schiff mit einem Segel, das der unterirdische Wind blähte, man trieb fort in das andere Land, wo die Toten waren. In Gedanken fragte sie Maria, wie es in dieser anderen Welt war, und sie meinte Marias Antwort zu hören. Dort sah es genauso aus wie in dem Dorf, in dem Sofia wohnte. Alles war wie üblich. Eigentlich bestand kein Unterschied darin, ob man tot war oder lebendig.
Dann verschwand Maria. Sie trug ein weißes Kleid und glitt in die Sonne hinein, wie von den Lichtstrahlen angezogen.
Jeden Morgen begann alles auf die gleiche Weise. Die Beine lehnten an der Wand. Maria zeigte sich. Danach ging Sofia auf den Hof und wusch sich. Das Wasser holte sie aus dem Dorfbrunnen, der am Weg zur Stadt lag. Obwohl sie immer noch mit zwei Krücken ging, hatte sie gelernt, den Wassereimer auf dem Kopf zu balancieren. Wenn sie sich gewaschen und ihr Gesicht in der Spiegelscherbe betrachtet hatte, die sie einmal auf dem Weg zur Schule gefunden hatte, war es Zeit, Mama Lydia zu helfen. Lydia entfachte schon ein Feuer und bereitete das Frühstück vor, bevor sie selbst hinaus zum Machamba1 ging, wo sie Gemüse und Mais zog. Sofia sollte den Hof fegen. Wenn sie damit fertig war, hatte Rosa schon angefangen, auf dem kleinen Acker direkt neben dem Haus zu arbeiten, er lag zwischen Frau Mukulelas Haus und dem Weg, der zum Markt führte. Am Nachmittag musste Sofia eine Hose für Herrn Temba flicken, und dann wollte sie ein Stück Stoff zuschneiden, aus dem sie ein Kleid für Rosa nähen wollte.
Alles würde wie immer sein.
Ungewöhnlich war nur, dass sie nicht zur Schule musste. Letzte Woche war die Lehrerin Fräulein Adelina zu Besuch gekommen und hatte erzählt, das undichte Schuldach sollte endlich repariert werden. Von irgendwoher war Geld gekommen. Deswegen hatten die Kinder ein paar Tage frei.
Einen Extratag freizuhaben konnte ja ganz schön sein. Aber nicht mehr. Sofia ging gern in die Schule. Tief im Innern ihrer Träume sah sie sich weiß gekleidet. Doktor Sofia. Doch niemandem, nicht einmal Rosa, hatte sie von diesem Traum erzählt. Manchmal war er so groß und weit entfernt, dass er sie fast erschreckte. Aber er kehrte jeden Tag wieder. Es war, als hätte sie einen eigensinnigen, hübschen Schmetterling in ihrem Kopf, der sich weigerte, sie zu verlassen …
Bald würde es hell werden.
Aber vorher würde der Hahn krähen. Sie zog die Decke bis zum Kinn und fragte sich, was Besonderes ausgerechnet heute geschehen würde.
Vielleicht würde sie sich verlieben? Vielleicht würde auf dem Weg ein Junge daherkommen, dem es egal war, dass sie zwei künstliche Beine hatte? Sie spürte, wie ihr Körper heiß wurde, und versuchte sich den Jungen vorzustellen.
Im selben Augenblick begann der Hahn zu krähen.
Rosa drehte sich auf dem Fußboden um, ohne aufzuwachen. Sofia tastete mit ihrer Hand über Rosas Haar. Sie hatte Zöpfe. Von allen Geschwistern mochte Sofia ihre große Schwester Rosa am liebsten. Rosa war siebzehn Jahre alt. Mit ihr konnte sie über alles reden und sie lachten oft zusammen.
Der Morgen begann. Sofia streichelte Rosa übers Haar.
Sie ahnte nichts von dem Schrecklichen, das an dem Tag geschehen würde, der gerade begonnen hatte.
2.
Sofia hatte oft überlegt, dass sich das Leben fast nur aus Ereignissen zusammensetzte, von denen man nichts im Voraus wusste. Auch wenn man plante, was man tun wollte, geschah häufig etwas Unerwartetes. Sofia erinnerte sich ganz deutlich, wann sie diesen Gedanken zum ersten Mal gedacht hatte. Es war nach der großen Katastrophe gewesen. An jenem Morgen, jenem ganz gewöhnlichen Tag, als Sofia auf die Mine getreten war, die in der Erde vergraben lag und ihre Schwester Maria umgebracht hatte. Der Tag, an dem sie ihre beiden Beine verloren hatte; damals hatte sie gelernt, dass im Voraus nichts verlässlich und sicher war. Im Leben kam es immer auf alles an. Wenn man schlafen ging, wusste man nicht, ob es am nächsten Tag, wenn man aufwachte, regnen würde. Man wusste nie, wann man Magenschmerzen oder einen juckenden Mückenstich bekommen würde an einer Stelle am Körper, die nur ein anderer kratzen konnte.
Man wusste nie, wann es ein guter oder ein schlechter Tag werden würde.
Man konnte nur hoffen.
Sofia hatte mehrere Male versucht, mit Rosa darüber zu reden.
Aber Rosa war es egal. Sie fand Sofia kindisch. Außerdem war Rosa fast immer verliebt. Dann hatte sie nur Zeit, an den neuen Jungen zu denken. Wenn Sofia ihr die Zöpfe flocht, waren sie einander am nächsten. Dann teilten sie sich ihre innersten Gedanken mit. Aber nicht alle. Sofia wusste, dass Rosa ihre Geheimnisse hatte, genau wie sie selber. Man kam einem anderen Menschen nie so nah, dass man alle Gefühle und Träume teilen konnte. Immer gab es eine kleine Höhle, deren Zugang man nicht preisgab.
Trotzdem teilten sie alles Wichtige miteinander. Rosa war älter als Sofia. Sie hatte länger gelebt und sie hatte mehr erlebt. Sie konnte von Dingen erzählen, die Sofia noch nicht erlebt hatte. Besonders solche Dinge, die man Liebe nannte. Und Sofia hörte zu und merkte sich alles gut.
Aber es gab auch etwas wie eine unsichtbare Grenze zwischen ihnen.
Rosa war noch nie auf eine Mine getreten. Sie besaß noch ihre Beine, mit denen sie geboren worden war. Keine Plastikstümpfe mit festgemachten Schuhen, die Sofia sich jeden Morgen anschnallte und jeden Abend abnahm.
Manchmal dachte Sofia, dass nicht nur sie ihre Schwester Maria verloren hatte. Maria war auch Rosas Schwester gewesen. Trotzdem schien Rosa nicht so sehr um Maria zu trauern wie Sofia. Maria besuchte Rosa auch nicht jeden Morgen. Jedenfalls hatte Rosa noch nie etwas davon gesagt. Das hätte sie getan. Sofia überlegte vorher immer ganz genau, ehe sie ein Geheimnis verriet. Aber Rosa war anders. Sobald ihr ein Gedanke durch den Kopf flog, hatte er sich schon in Worte verwandelt, die aus ihrem Mund kamen.
Es gab also Dinge, über die man nur schwer reden konnte.
Häufig war Sofia neidisch auf Rosa, weil sie richtige Beine hatte. Nie würde sie lernen, genauso hübsch zu gehen wie Rosa, sich nie in den Hüften wiegen wie sie. Sofia würde sich immer auf mindestens eine Krücke stützen müssen, und sie würde immer steif gehen, als hätte sie zwei Stelzen unter den Knien. Es war schwer zuzugeben, dass sie neidisch war. Rosa konnte ja nichts dafür, dass es Sofia gewesen war, die mit Maria gespielt hatte, als sie auf die Mine getreten war. Manchmal schämte Sofia sich, dass sie neidisch auf Rosa war. Manchmal morgens, wenn sie darauf wartete, dass der Hahn krähte, machten die Gedanken sie so wütend, dass sie Rosa am liebsten geschlagen hätte, die immer noch auf dem Fußboden lag und schlief.
Außerdem war Rosa hübscher als sie.
Selbst wenn Sofia ihre Beine behalten hätte, wäre sie nie so hübsch geworden und hätte auch nie so einen schönen Körper bekommen wie Rosa. Sofia war untersetzt, Rosa dagegen groß und schlank. Sofia hatte größere Brüste. Rosas Brüste hatten genau die richtige Größe. Es kam vor, dass sie ihre nackten Körper kichernd miteinander verglichen, bevor sie sich schlafen legten. Dann zündeten sie eine Kerze an und betasteten und kniffen einander. Manchmal fühlte Lydia sich in dem anderen Raum gestört und fragte, was sie da trieben. Dann hörten sie sofort auf. Aber wenn Lydia anfing zu schnarchen, flüsterten sie noch lange in der Dunkelheit. Es gab immer so viel zu bereden. Nicht zuletzt über all die Jungen, die sich darum prügelten, in Rosas Nähe zu sein.
Sofia stand auf, schnallte die Beine an, zog sich an und ging hinaus. Lydia war schon dabei, ein Feuer zu entfachen.
Sofia wusch sich das Gesicht. Rosa kam aus der Hütte. Sie gähnte und streckte sich. Ihr Gesicht hatte sie mit einer Creme eingerieben, die sie von einem ihrer Freunde bekommen hatte. Als sie das Gesicht zur Sonne hob, glänzte ihre Haut. Sofort spürte Sofia wieder diesen Stich. Ihre Haut würde nie so hübsch glänzen wie Rosas. Außerdem würde sie wohl nie einen Jungen treffen, der ihr so eine Creme schenkte, wie Rosa sie hatte.
Rosa kam zu Sofia.
»Ich weiß gar nicht, warum ich so müde bin«, sagte sie.
»Du schläfst eben zu wenig«, sagte Lydia streng. »Du treibst dich abends zu lange herum. Dir laufen einfach zu viele Jungen nach.«
Lydia rührte in dem kochenden Wasser im Eisenkessel. Aber Sofia sah, dass sie einen hastigen Blick auf Rosas Bauch warf. Das tat sie jeden Morgen. Sofia fragte sich, wonach sie eigentlich guckte. Etwa, ob Rosa schwanger war? Bei Mama Lydia wusste man nie so genau.
Rosa kauerte sich in den Schatten der Hütte.
Sofia ging zu ihr und lehnte sich gegen die Wand.
»Ich bin so müde«, wiederholte Rosa. »Wie lange ich auch schlafe, ich habe das Gefühl, als hätte ich keine Kraft.«
»Bist du krank?«
Rosa schüttelte den Kopf.
»Mir tut nichts weh.«
Dann sprachen sie nicht mehr darüber.
Das Frühstück war fertig. Die Familie versammelte sich am Feuer. Lydia verteilte das Essen, Maisgrütze für jeden. Sofia half, den zweitjüngsten Bruder zu füttern. Faustino, der noch keine vier Jahre alt war. Alfredo, der sechs war, aß langsam, damit das Essen lange reichte.
Sofia war nicht ganz sicher, wer Faustinos Vater war. Ihr eigener, Alfredos, Marias und Rosas Vater war im Krieg von Banditen umgebracht worden. Von ihm gab es ein Schwarz-Weiß-Foto, ausgeblichen und eingerissen. Lydia hatte erzählt, dass ein Fotograf das Bild gemacht hatte, als sie frisch verheiratet waren und er in den Diamantengruben in Südafrika arbeitete. Manchmal, wenn Sofia bedrückt war, nahm sie das Foto hervor, das in Lydias Gesangbuch lag, und betrachtete es. In Gedanken hatte sie Maria mehrere Male gefragt, ob sie jetzt mit ihrem Vater zusammenwohnte, der auch tot war. Aber Maria hatte nie geantwortet.
Doch wer Faustinos Vater war, wusste sie nicht.
Es war ein Geheimnis, das Lydia nicht verriet. Hin und wieder redeten Rosa und Sofia darüber. Rosa hatte eines Abends, kurz bevor sie einschliefen, Sofia zugeflüstert, dass vielleicht Herr Temba Faustinos Vater war. Sofia war ganz bestürzt gewesen. Sollte Mama Lydia Herrn Temba wirklich einmal erlaubt haben, in ihrer Hütte zu übernachten, als sie sich einsam fühlte? Sofia mochte Herrn Temba, das war das eine. Aber es war etwas ganz anderes, sich vorzustellen, dass er mit Lydia geschlafen hatte und er womöglich der Vater von Faustino war. Sie hatte protestiert und Rosa hatte ausweichend geantwortet und gesagt, vielleicht war auch alles ganz anders, als sie dachte.
Einmal hatte Sofia Lydia gefragt.
Da es eine schwierige Frage war und Lydia manchmal sehr aufbrausend sein konnte, hatte sie einen Moment gewählt, als Lydia guter Laune war. Da hatte sie die Frage so ganz beiläufig gestellt, als ob sie gar nicht wichtig wäre und die Antwort auch nicht, die sie vielleicht bekommen würde. Lydia hatte nur gelacht und geantwortet:
»Es war ein netter Mann, der vorbeigekommen ist. Und dann ist er wieder verschwunden.«
Sofia hatte keine weiteren Fragen gestellt. Lydia hatte es nicht gern, wenn ihre Kinder sie bedrängten. Aber Sofia gefiel es nicht, dass ihr Bruder Faustino einen Vater hatte, den sie nicht kannte.
Der Morgen verging wie üblich.
Frau Mukulela kam vorbei und wünschte ihnen einen guten Morgen. Sie war neugierig und passte immer auf, ob der Hof sauber und ordentlich war oder ob eins der Kinder eine neue Jacke hatte. Das passierte fast nie, und Frau Mukulela konnte zufrieden zurück zu ihrem Haus wanken. Ihr passte es nicht, wenn sich bei ihren Nachbarn etwas änderte. Jedenfalls nicht zum Besseren. Frau Mukulela wollte immer die sein, die sich den schönsten Stoff um den Körper schlingen konnte und deren Hühner die meisten Eier legten. Auf dem Weg blieb sie oft eine Weile stehen und zankte sich mit Herrn Temba, der sich schon in der Dämmerung vor seine Hütte setzte und an seinen Körben arbeitete.
Lydia hob Faustino auf ihren Rücken und band ihn fest, nahm die Hacke und setzte sich zum Machamba in Bewegung, der einige Kilometer entfernt lag, in Richtung der hohen Berge, die im Sonnendunst kaum zu sehen waren. Sie ging schnell, als ob der Tag allzu kurz wäre für alles, was sie schaffen wollte. Sofia sah ihr nach. Lydia war mager und ausgemergelt. Neun Kinder hatte sie geboren. Vier waren noch am Leben. Fünf Kinder waren gestorben, und eins davon war Maria. Sofia sah ihr nach, wie sie den Weg entlangeilte, und überlegte, was Lydia eigentlich dachte. Sie hatte Kinder geboren, die gestorben waren, und jeden Tag eilte sie hinaus zu ihrem Acker und dem Gemüse, das sie verkaufen und mit dem sie ein wenig Geld verdienen wollte.
Lydia verschwand in der Sonne.
Genau wie Maria, dachte Sofia. Und sie fragte sich, ob sie später einmal wie Lydia werden würde. Obwohl sie niemals so schnell würde gehen können. Die Krücken würde sie nie beiseitelegen können. Und es war auch nicht sicher, ob sie Kinder bekommen würde.
Sie sah auf den Weg hinaus, der für einen Moment menschenleer war.
Blinzelte in die Sonne, in der Lydia verschwunden war. Aber niemand kam. Kein Junge, der stehen bleiben und sie anschauen würde und dem es egal war, dass sie keine Beine hatte, nur eine Krücke unter jedem Arm.
Sofia seufzte und drehte sich um.
Rosa hatte sich von ihrem Platz an der Hauswand erhoben und bückte sich nach ihrer Hacke, die auf der Erde lag. Sofia runzelte die Stirn. Rosa schien Mühe zu haben, die Hacke hochzuheben. Als ob sie von gestern bis heute plötzlich doppelt so schwer geworden war. Aber Rosa legte sich die Hacke auf die Schulter und streckte den Rücken. Begann auf den kleinen Ackerflecken zuzugehen, der an Frau Mukulelas Land grenzte, wo die Hühner scharrten.
Sofia blieb stehen und sah Rosa an.
Zuerst wusste sie nicht, warum. Dann merkte sie, dass sich etwas verändert hatte. Rosa ging nicht wie sonst, mit leichten Schritten, geradem Rücken und wiegenden Hüften. Sie schien sich vorwärtszuschleppen, als ob jeder Schritt eine Qual wäre. Sofia blinzelte und schaute ihr weiter nach. Jetzt hatte Rosa den Acker erreicht. Dann hob sie die Hacke.
Und ließ sie fallen.
Rosa sank auf die Knie.
Sofia hielt den Atem an. Dann packte sie ihre Krücken und hüpfte zu Rosa.
»Was ist?«, fragte sie.
»Ich weiß nicht«, antwortete Rosa. »Ich bin so schrecklich müde.«
Sofia sah sie an. Plötzlich fiel ihr auf, dass Rosa in der letzten Zeit abgemagert war.
Und in diesem Augenblick durchzuckte es sie. Es war ein Gefühl, als würde ihr Magen eiskalt werden.
Es war die Angst.
Das ist nicht wahr, dachte sie. Nicht Rosa, nicht meine eigene Schwester.
Rosa schaute zu Sofia auf.
Ihr Gesicht glänzte immer noch. Aber nicht von der Creme, die sie von einem ihrer Freunde geschenkt bekommen hatte.
Es war Schweiß.
Sofia bückte sich. Ihre Hand, die sie auf Rosas Stirn legte, zitterte.
Rosa hatte Fieber.
Sie war krank.
Sofia spürte, wie die Kälte in ihrem Magen wuchs.
Es war, als ob die Sonne verschwunden und die Nacht plötzlich zurückgekehrt wäre.
3.
Sofia half Rosa zum Bett in der Hütte.
Rosa wollte sich auf den Fußboden legen, auf den Platz, wo sie immer schlief. Aber Sofia sagte Nein. Rosa war krank, sie musste im Bett liegen. Das Bett hatte Sofia Herrn Temba zu verdanken. Er hatte es ihr geschenkt, weil es ihr schwer fiel, sich ohne Beine vom Fußboden zu erheben, als sie nach der langen Zeit im Krankenhaus zurückgekommen war. Er hatte es bei einem Lehrer in Boane getauscht, der es selbst gegen ein altes Fahrrad eingetauscht hatte.
Rosa streckte sich auf dem Bett aus.
»Mir tut nichts weh. Ich bin nur müde.«
»Du hast Fieber«, sagte Sofia.
Rosa sah sie an.
»Warum zittert deine Stimme so?«
»Sie zittert nicht.«
Rosa starrte sie an.
»Ich bin nicht krank.«
»Du hast Fieber. Aber es ist bestimmt nichts Ernstes.«
Rosa legte den Kopf auf dem Kissen zurecht und schloss die Augen. Sofia sah sie an. Rosa hatte recht gehabt. Sofias Stimme hatte gezittert. Die Kälte im Magen war immer noch da. Die ganze Zeit versuchte sie sich einzureden, dass sie sich täuschte. Rosa hatte nichts Ernstes, nur ein bisschen Fieber, war ein bisschen müde. Das konnte jedem passieren. In einigen Tagen würde sie wieder wie immer sein.
Aber in Sofia war noch eine andere Stimme.
Eine Stimme, die ihr widersprach. Rosa hatte die Hacke fallen lassen. Sie war auf der Erde zusammengesunken. Fieber bekam man nicht einfach so. Und sie war dünn geworden. Vor allem das. Die Stimme in Sofias Kopf rief immer lauter. Warum hatte sie es nicht früher bemerkt? Dass Rosa fast nie ihr Essen aufaß? Das war früher nicht so gewesen. Aber in den letzten Monaten hatte sie fast nach jeder Mahlzeit einen großen Teil ihrer Mais- oder Reisportion zurück in den Topf gekratzt.
Rosa schlug wieder die Augen auf.
»Ich habe Kopfschmerzen. Es ist so hell.«
Sofia hatte sich auf die Bettkante gesetzt und die Krücken neben sich gelegt. Sie nahm eine der Krücken und schob damit die Gardine, die sie aus einem alten Stoffrest genäht hatte, so weit vor, dass sie das Fenster bedeckte.
»Möchtest du Wasser?«, fragte Sofia.
Rosa schüttelte den Kopf.
»Ich schlaf eine Weile«, antwortete sie. »Dann geht es mir wieder besser. Geh lieber hinaus und pass auf, dass Alfredo nichts anstellt.«
Rosa hatte recht.
Ihn konnten sie nicht allein lassen. Sofia erhob sich vom Bett und ging hinaus. Gleichzeitig fragte sie sich, ob ein Sinn darin war, dass sie gerade heute schulfrei hatte. Wenn das Leben sich aus Ereignissen zusammensetzte, von denen man im Voraus nichts wusste, so geschah es auch manchmal, dass Dinge zusammenpassten, ohne dass es geplant war. Wie jetzt: Die Schule hatte Geld bekommen, um das undichte Dach zu reparieren, und sie war genau an diesem Tag zu Hause, als Rosa die Hacke fallen ließ.
Alfredo zeichnete mit einem Stock im Sand vor der Hütte. Er war groß für sein Alter, fast dick. Er trug nichts weiter als eine zerrissene Hose. Die hatte einmal Herrn Temba gehört. Sofia hatte sie als Lohn bekommen, weil sie Herrn Tembas kaputte Hemden geflickt hatte. Sie sah, dass die Hose schon wieder geflickt werden musste.
Er zeichnete einen Menschen in den Sand, erkannte Sofia.
»Wer ist das?«, fragte sie.
»Weiß nicht«, sagte Alfredo.
»Geh nicht ans Feuer«, sagte Sofia.
Alfredo antwortete nicht, nickte nur. Vermutlich fand er sie nörgelig. Immerhin war er schon sechs und wusste, was er nicht durfte. Und er gehorchte fast immer.
Sofia ging zum Acker, wo Rosas Hacke lag.
In der Ferne konnte sie Frau Mukulela singen hören. Sie sang immer laut und sie sang falsch. Die Melodien waren falsch und die Worte bildeten keine Verse. Sofia lauschte.
Die Hühner sind gut,
aber ich brauche mehr,
vielleicht sollte ich mir einen Hund anschaffen.
Der Nagel an meinem linken großen Zeh ist eingerissen.
Sofia schüttelte den Kopf.
Frau Mukulela konnte wirklich nicht gut Lieder erfinden.
Sie bückte sich nach der Hacke.
Die wog nicht schwerer als gestern. Trotzdem war sie Rosa aus der Hand gefallen. Sofia nahm sie mit und lehnte sie gegen die Hauswand. Lydia konnte es nicht leiden, wenn man nachlässig mit den Geräten umging. Auf dem Acker müsste Unkraut gezupft werden. Aber Rosa hatte keine Kraft. Sie lag in der Hütte und hatte Fieber. Sofia würde ihre Arbeit erledigen. Doch erst einmal musste sie sich hinsetzen und eine Weile nachdenken. Sie zog einen der niedrigen Holzschemel heran, die ihnen als Stühle dienten, und setzte sich in den Schatten an der Hauswand, wo sie Alfredo im Auge hatte.
Dann legte sie die Hand auf ihren Bauch.
Da drinnen war es immer noch ganz kalt. Sofia versuchte an etwas Schönes zu denken. Etwas, das nichts mit Rosa zu tun hatte. Aber es ging nicht. Ihre Gedanken kehrten wieder zu dem Krankenhaus zurück, in dem sie fast ein Jahr gelegen hatte, als das Unglück passiert war.
Im Krankenhaus hatte sie das Zimmer mit vielen anderen geteilt. Manchmal waren es so viele Kranke gewesen, dass die Betten nicht reichten. Da konnte es geschehen, dass zwei Kranke ein Bett teilen mussten. Oder sie lagen auf Bastmatten unter den Betten, zwischen den Betten, überall, wo Platz war. Viele von ihnen waren schwer krank und mindestens jeden zweiten Tag starb jemand. Lange Zeit hatte ein junger Mann mit schweren Brandwunden, die er sich zugezogen hatte, als seine Hütte abgebrannt war, im Bett neben Sofia gelegen. Nie sagte er etwas und nie kam ihn jemand besuchen. An einem Nachmittag, kurz bevor sie zu essen bekommen sollten, starb er. Am nächsten Tag kam ein neuer Patient in das Bett. Es war ein Mädchen, das auf einer Trage hereingebracht wurde. In den ersten Tagen schlief sie nur. Aber als sie wach wurde, begannen sie und Sofia miteinander zu reden. Nachdem sie sich erzählt hatten, wie sie hießen und woher sie kamen, fragte das Mädchen, das Deolinda hieß, was Sofia fehlte. Und Sofia erzählte, was passiert war, sie schlug das Laken beiseite und zeigte Deolinda die verbundenen Beinstümpfe.
Dann fragte Sofia Deolinda, warum sie im Krankenhaus lag.
Ihre Antwort war unerwartet.
»Ich werde sterben«, antwortete sie.
Sie lächelte, als sie das sagte. Ein Lächeln, das von weit her kam, ein Lächeln, das Sofia noch nie gesehen hatte. Jetzt begriff sie, dass Menschen, die wussten, dass sie sterben würden, nicht schreien oder weinen mussten. Auch sterbende Menschen hatten ein Lächeln. Selbst wenn sie erst neunzehn waren wie Deolinda.
Frau Mukulela hatte aufgehört zu singen.
In einer Hütte auf der anderen Seite des Weges schimpfte eine Frau mit ihrem Mann. Es ging darum, dass sie ihn für faul hielt. Sofia hörte nicht länger hin.
In ihren Gedanken kehrte sie ins Krankenhaus zurück.
Deolinda hatte ihr erzählt, warum sie sterben musste. Sie hatte eine Krankheit, von der Sofia noch nie gehört hatte. Es war ein Virus. Wenn der erst einmal in den Körper eingedrungen war, verschwand er nie wieder. Auch wenn man lange damit leben konnte, führte er schließlich zum Tod.