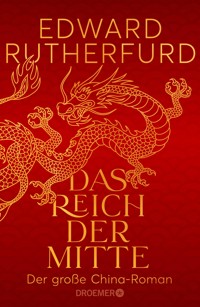
17,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Opulent, farbenprächtig, hochspannend und zutiefst menschlich Der historische Roman »Das Reich der Mitte« von Bestseller-Autor Edward Rutherfurd entführt ins chinesische Kaiserreich des 19. Jahrhunderts und erzählt vom Zusammenprall von Ost und West, der schließlich zur Entstehung des heutigen China führte. China, 1838: Das stolze Kaiserreich ist für Fremde meist unerreichbar. Abenteurer schmuggeln Opium ins Land, um es gegen Tee, die im Westen so begehrte Handelsware, zu tauschen. Die Versuche der Qing-Dynastie, der Droge Einhalt zu gebieten, führen schließlich zu den Opiumkriegen, die das uralte Kaiserreich für immer verändern sollten. Über das schicksalhafte, blutige 19. Jahrhundert, von Shanghai über Peking und die Chinesische Mauer entspinnt sich eine große Geschichte über Glücksritter, Abenteurer, Gewinner und Verlierer, über den Aufstieg und Fall eines großen Kaiserreichs und den immerwährenden Konflikt zwischen Kulturen, Traditionen und Weltmächten. Edward Rutherfurds epischer historischer Roman erzählt die Geschichte von Missverständnissen und Demütigungen, von Habgier, Liebe und uralten Traditionen – eine monumentale Saga, die in ihrer Dramatik und Ehrlichkeit das heute China verstehen hilft. www.edwardrutherfurd.com
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1509
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Edward Rutherfurd
Das Reich der Mitte
Der große China-Roman
Aus dem Englischen von Henriette Zeltner Shane und Sylvia Bieker
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
China, 1838: Das stolze Kaiserreich ist für Fremde meist unerreichbar. Abenteurer schmuggeln Opium ins Land, um es gegen Tee, die im Westen so begehrte Handelsware, zu tauschen. Die Versuche der Qing-Dynastie, der Droge Einhalt zu gebieten, führen schließlich zu den Opiumkriegen, die das uralte Kaiserreich für immer verändern sollten. Von den schicksalhaften, blutigen Konflikten des neunzehnten Jahrhunderts über Maos Kulturrevolution bis in die Gegenwart, von Shanghai über Peking und die Chinesische Mauer entspinnt sich eine große Geschichte über Glücksritter, Abenteurer, Gewinner und Verlierer, über den Aufstieg und Fall eines großen Kaiserreichs und den immerwährenden Konflikt zwischen Kulturen, Traditionen und Weltmächten.
Inhaltsübersicht
Widmung
Karten
Anmerkung des Autors
Rote Sonne, gelber Fluss
Opium
Macau
Hongkong
Das Fenster
Die Nemesis
Zhapu
Der Palast
Taiping
Moment der Wahrheit
Sommerpalast
Pflichtergeben
Der Missionar
Jingdezhen
Westsee
Gelber Fluss
Boxer
Der Auftrag des Himmels
Nachwort
In respektvoller Erinnerung an
ARTHUR WALEY, Mitglied des Order of the Companions of Honour,
Dichter und Gelehrter,
dessen Übersetzungen der chinesischen Klassiker mich seit fünfzig Jahren inspirieren
Anmerkung des Autors
DAS REICH DER MITTE ist in erster Linie ein Roman, allerdings vor dem Hintergrund realer Ereignisse.
Wenn historische Persönlichkeiten in der Geschichte vorkommen, dann geht ihre Beschreibung, die hoffentlich fair ist, auf mich zurück. Alle Hauptfiguren – Trader, Charlie Farley, die Brüder Odstock, Nio, Shi-Rong, Mei-Ling, Lacquer Nail, Herr Liu, Herr Ma, Guanji sowie deren Familie und Freunde – sind erfunden.
Ich stehe in der Schuld folgender Autoren und Wissenschaftler, auf deren umfangreiche Forschung, oft an Primärquellen, dieser Roman sich stützt.
Allgemeine Einführungen: John Keay für die lesbarste Einführung in die Geschichte Chinas; Caroline Blunden und Mark Elvin für ihren Cultural Atlas of China – eine wunderbare Quelle; und Marina Warner für ihre lebendig illustrierte Biografie der »Drachen-Kaiserin«.
Spezielle Werke: Julia Lovell für ihre Arbeit zum Opiumkrieg von 1839; Peter Ward Fay für weitere Details zu diesem Krieg und zum Opiumhandel; Zhang Yangwen zur Verwendung von Opium in China. Einzelheiten aus dem Leben eines Eunuchen lieferte Jia Yinghuas Biografie über Sun Yaoting, zu Konkubinat und Dienerschaft informierten mich Hsieh Bao Huam sowie der von Ida Pruitt verfasste Bericht von Ning Lao T’ai-t’ai über das Leben eines Bediensteten. Bei meinen Schilderungen des Füßebindens verließ ich mich auf die Arbeiten von Dorothy Ko. Dankbar bin ich Mark C. Elliott, weil er mir das komplexe Thema Mandschu nahebrachte, vor allem aber Pamela Kyle Crossley, deren detailreiche Erforschung von drei Generationen ein und derselben Mandschu-Familie es mir ermöglichte, über die fiktionale Familie Guanji zu schreiben. Für Einzelheiten zum Sommerpalast bin ich Guo Daiheng, Young-tsu Wong und insbesondere Lillian M. Li für ihre Arbeit über Yuanmingyuan dankbar. Bei der Beschreibung des kaiserlichen Justizsystems und des Gesetzes über Folter habe ich mich auf die exzellente Monografie von Nancy Park verlassen. Zum Thema Feng-Shui und zu den Besonderheiten der Dörfer in Südchina bin ich Xiaoxin He und Jun Luo für einen entsprechenden Artikel zu Dank verpflichtet. Meine Schilderungen von Taiping stützen sich auf Studien von Stephen R. Platt und Jonathan Spence. Besonders dankbar bin ich Diana Preston für ihren tagesgenauen Bericht über die Belagerung der Gesandtschaften während des Boxeraufstands, der mir so reichlich Arbeitsmaterial lieferte.
Persönlichen Dank schulde ich Julia Lovell für ihren weisen und hilfreichen Rat, mit dem sie mich auf den richtigen Weg gebracht hat; Dr. James Greenbaum, Tess Johnston und Mai Tsao für hilfreiche Gespräche; Sing Tsung-Ling und Hang Liu für ihr sorgsames, kulturbezogenes Gegenlesen meiner ersten Entwürfe; und Lynn Zhao für ihre gründliche Überprüfung der historischen Fakten im gesamten Manuskript. Alle noch verbliebenen Fehler gehen allein auf mein Konto.
Sehr dankbar bin ich auch Rodney Paull, der mit außerordentlicher Sorgfalt und Geduld die Karten erstellte.
Und wieder einmal danke ich meinen Lektoren, William Thomas bei Doubleday und Oliver Johnson bei Hodder. Nicht nur für die wunderbare Teamarbeit, sondern für ihre großartige Liebenswürdigkeit und Geduld während der langen und technisch schwierigen Phase, in der ich den Roman entwarf. Außerdem danke ich Michael Windsor in Amerika und Alasdair Oliver in Großbritannien für ihre beiden so verschiedenen, aber gleichermaßen fantastischen Umschlaggestaltungen. Vielmals bedanken möchte ich mich beim Team aus Khari Dawkins, Maria Carella, Rita Madrigal, Michael Goldsmith, Lauren Weber und Kathy Hourigan bei Doubleday.
Wie immer danke ich auch Cara Jones und dem gesamten Team bei RCW.
Schließlich bedanke ich mich natürlich noch bei meiner Agentin Gill Coleridge, der ich seit inzwischen sechsunddreißig Jahren unermessliche Dankbarkeit schulde.
Namen: Die chinesischen Ortsnamen in diesem Buch entsprechen weitgehend der modernen Form. Eine Ausnahme bilden wenige Fälle, wenn westliche Figuren im Gespräch Bezeichnungen wie Kanton (Gangzhou) und Peking benutzen, da das im 19. Jahrhundert so üblich war.
Rote Sonne, gelber Fluss
Januar 1839
Zuerst hörte er die Stimme hinter sich nicht. Eine rote Sonne brannte ihm aufs Gesicht, während er durch die Mitte der Welt ritt.
Vierzig Meilen seit der Morgendämmerung. Hunderte lagen noch vor ihm. Und es blieb nicht viel Zeit, vielleicht gar keine mehr. Er wusste es nicht.
Bald würde die riesige, magentafarbene Sonne untergehen, eine melancholische violette Dämmerung verbreiten, und er würde rasten müssen. Im Morgengrauen dann wieder weiter. Und sich die ganze Zeit über fragen: Würde er seinen Vater, den er liebte, noch antreffen und sich entschuldigen können, bevor es zu spät war? Der Brief seiner Tante war ganz eindeutig gewesen: Sein Vater lag im Sterben.
»Herr Jiang!« Diesmal hörte er es. »Jiang Shi-Rong! Warten Sie!«
Er wandte den Kopf. Ein einzelner Reiter trieb sein Pferd die Straße entlang. Nachdem die rote Sonne ihn so lange geblendet hatte, brauchte Jiang einen Moment, um zu erkennen, dass es Herrn Wens Diener Wong war. Was mochte das bedeuten? Er brachte sein Pferd zum Stehen.
Wong – ein kleiner, untersetzter, kahlköpfiger Mann, der ursprünglich aus dem Süden stammte – führte den Haushalt des betagten Gelehrten. Dieser vertraute ihm völlig und hatte den jungen Jiang gleich nach der Ankunft unter seine Fittiche genommen. Wong schwitzte. Er muss wie ein kaiserlicher Bote geritten sein, um mich einzuholen, dachte der junge Mann.
»Ist mit Herrn Wen alles in Ordnung?«, fragte Jiang besorgt.
»Ja, ja. Er lässt ausrichten, Ihr müsst sofort nach Peking zurück.«
»Zurück?« Jiang sah ihn entgeistert an. »Aber mein Vater liegt im Sterben. Ich muss zu ihm.«
»Habt Ihr schon von Lord Lin gehört?«
»Selbstverständlich.« Ganz Peking hatte über den bescheidenen Beamten getratscht. Man hatte wenig über ihn gewusst, bis er den Kaiser derart beeindruckte, dass dieser ihn mit einer Mission von großer Wichtigkeit betraute.
»Er möchte Euch sehen. Auf der Stelle.«
»Mich?« Er war doch ein Niemand. Nicht mal das. Ein bedeutungsloser Versager.
»Herr Wen hat Lord Lin von Euch geschrieben. Er kennt Lord Lin noch aus der Schulzeit. Doch Herr Wen hat Euch nichts davon gesagt, damit Ihr Euch nicht falsche Hoffnungen machen solltet. Als Lord Lin nicht antwortete …« Er machte ein trauriges Gesicht. »Dann heute Morgen, nachdem Ihr aufgebrochen wart, erhielt Herr Wen eine Nachricht. Vielleicht wird Lord Lin Euch in seine Truppe aufnehmen. Doch zuvor will er Euch sehen. Also trug Herr Wen mir auf, zu reiten wie tausend Teufel, um Euch zurückzuholen.« Er sah den jungen Mann eindringlich an. »Das ist eine große Chance für Euch, Jiang Shi-Rong«, sagte er leise. »Wenn Lord Lin mit seiner Mission Erfolg hat und er mit Euch zufrieden ist, dann wird der Kaiser persönlich Euren Namen hören. Ihr seid wieder auf dem Weg zum Glück. Ich freue mich für Euch.« Er deutete eine Verbeugung an, um auf den künftigen Status des jungen Mannes zu verweisen.
»Aber mein Vater …«
»Er könnte schon tot sein. Ihr wisst es nicht.«
»Und er könnte noch leben.« Mit gequälter Miene wandte der junge Mann den Blick ab. »Ich hätte früher aufbrechen sollen«, murmelte er. »Ich war zu beschämt.« Er drehte sich wieder zu Wong. »Wenn ich jetzt umkehre, kostet mich das drei Tage. Wenn nicht mehr.«
»Wenn Ihr Erfolg haben wollt, müsst Ihr Gelegenheiten nutzen. Herr Wen sagt, Euer Vater würde sicherlich wollen, dass Ihr Lord Lin aufsucht.« Der Bote schwieg kurz. »Herr Wen hat Lord Lin mitgeteilt, dass Ihr Kantonesisch sprecht. Ein großer Vorzug zu Euren Gunsten – für diese Mission.«
Shi-Rong sagte nichts. Sie wussten beide, dass er es Wong zu verdanken hatte, dass er den kantonesischen Dialekt des Dieners sprach. Zuerst hatte der junge Mandarin-Chinese es amüsant gefunden, ein paar Alltagsbegriffe von Wong zu lernen. Doch schon bald stellte er fest, dass Kantonesisch beinah eine eigene Sprache war. Es umfasste mehr Töne als Mandarin. Aber er hatte ein gutes Ohr, und nachdem er ein, zwei Jahre lang täglich mit Wong plauderte, hatte er begonnen, es gut genug zu sprechen, um sich verständigen zu können. Sein Vater, der eine geringe Meinung von den Menschen aus dem Süden hatte, reagierte amüsiert, als er von dieser Errungenschaft erfuhr. »Wobei ich denke, dass es eines Tages nützlich sein könnte«, hatte er zugegeben. Herr Wen hatte ihm geraten: »Verachte die kantonesische Sprache nicht, junger Mann. Sie enthält viele uralte Wörter, die im Mandarin, das wir sprechen, schon verloren gegangen sind.«
Wong sah ihn eindringlich an. »Herr Wen sagt, vielleicht bekommt Ihr nie wieder eine solche Gelegenheit.«
Jiang Shi-Rong starrte in die rote Sonne und schüttelte betrübt den Kopf.
»Das weiß ich«, sagte er leise.
Eine Minute lang verharrten beide reglos. Dann setzte der junge Mann schweren Herzens und schweigend sein Pferd wieder in Bewegung. Zurück nach Peking.
Am Ende jener Nacht, fünfhundert Meilen entfernt, in der Küstengegend westlich des Hafens, den die restliche Welt damals Kanton nannte, war ein Nebel vom Südchinesischen Meer heraufgezogen und hatte die Welt in Weiß gehüllt.
Das Mädchen trat ans Tor des Innenhofs, schaute hinaus und glaubte sich allein.
Trotz des Frühnebels konnte sie die Gegenwart der Sonne spüren, die irgendwo hinter dem Dunst schien. Doch den Rand des Teichs, der nur dreißig Schritte vor ihr lag, konnte sie nicht erkennen. Genauso wenig wie die morsche Brücke, von der aus ihr Schwiegervater, Herr Lung, gerne den Vollmond betrachtete und sich selbst daran erinnerte, dass der Teich ihm gehörte und er der reichste Bauer des kleinen Dorfs war.
Das Mädchen lauschte in die feuchte Stille. Manchmal war ein leises Platschen zu hören, wenn eine Ente den Kopf ins Wasser tauchte und ihn danach schüttelte. Doch sie hörte nichts.
»Mei-Ling.« Ein Zischen irgendwo rechts von ihr.
Sie runzelte die Stirn. Alles, was sie erkennen konnte, war das Bambusgebüsch neben dem Pfad. Vorsichtig ging sie einen Schritt darauf zu.
»Wer ist da?«
»Ich bin’s. Nio.« Eine Gestalt erschien neben dem Bambus und kam auf sie zu.
»Kleiner Bruder!« Ihre Miene hellte sich auf. Obwohl er jahrelang fort gewesen war, hätte sie ihn sofort erkannt. Er hatte noch die charakteristische Narbe auf Nase und Wange.
Nio war nicht wirklich ihr Bruder. Sie waren sogar kaum verwandt, hätte man einwenden können. Er stammte aus der Familie ihrer Großmutter mütterlicherseits, die zum Stamm der Hakka gehörte. Nachdem seine Mutter und seine Schwestern an einer Seuche gestorben waren, hatte sein Vater ihn zwei Jahre lang Mei-Lings Eltern anvertraut, bevor er wieder heiratete und den Sohn zurücknahm.
Sein Name war richtig ausgesprochen Niu, doch im Dialekt seines Heimatdorfs klang er eher wie Nyok, wobei man das K am Ende kaum hörte. Deshalb hatte Mei-Ling sich für einen Kompromiss entschieden und den Namen Nio erfunden. Mit einem kurzen O. Und dabei war es geblieben.
Lange bevor sein Vater ihn zurückholte, hatte Mei-Ling Nio als ihren Bruder adoptiert. Seither war sie seine große Schwester.
»Wann bist du angekommen?«, flüsterte sie.
»Vor zwei Tagen. Ich kam her, um dich zu besuchen, aber deine Schwiegermutter erklärte mir, ich solle nicht wiederkommen. Danach ging sie zum Haus deiner Eltern und erklärte ihnen, sie sollten mich nicht in deine Nähe lassen.«
»Warum hat sie das getan?«
Obwohl Nio mit seinen fünfzehn nur ein Jahr jünger war als Mei-Ling, bemerkte sie, dass er noch immer eher kindlich aussah. Er starrte einen Moment lang auf den Boden, bevor er zugab: »Vielleicht wegen etwas, das ich gesagt habe.«
»Warum bist du hier, Kleiner Bruder?«
»Ich bin fortgelaufen.« Er lächelte, als wäre das etwas, worauf man stolz sein konnte.
»Oh, Nio …« Sie wollte ihn gerade nach Einzelheiten fragen, als er ihr bedeutete, dass jemand vom Tor hinter ihr aus sie beobachtete.
»Warte morgen früh am Eingang zum Dorf«, sagte sie rasch zu ihm. »Ich werde versuchen, beim ersten Morgenlicht dort zu sein. Wenn nicht, komm am nächsten Tag wieder. Und jetzt lauf. Schnell, schnell.«
Nachdem Nio hinter dem Bambus verschwunden war, drehte sie sich um.
Die junge Frau mit dem ovalen Gesicht stand am Tor. Willow war ihre Schwägerin. Sie nannten sich gegenseitig Schwestern, aber da endete auch schon jede Gemeinsamkeit zwischen ihnen.
Sie war nach dem anmutigen Weidenbaum benannt. Doch ohne ihre bessere Kleidung und die Schminke, die sie sorgsam auf ihr Gesicht auftrug, hätte sie ausgesprochen schlicht gewirkt. Willow entstammte einer reichen Bauernfamilie namens Wan aus dem Nachbarbezirk. Obwohl sie den älteren Sohn von Herrn Lung geheiratet hatte, nannten die Leute aus dem Dorf sie höflich und wie es traditionell üblich war, Frau Wan. Gemäß dem Status der Familie Wan, der mehr Müßiggang erlaubte, waren Willows Füße gebunden worden, als sie ein Mädchen war. Deshalb lief sie jetzt mit eleganten Trippelschritten, die sie von armen Bäuerinnen wie Mei-Ling unterschieden, deren Familie auf den Feldern arbeitete.
Willow war ein wenig größer und nahm eine gezierte Haltung ein, als würde sie sich damenhaft vorneigen. Mei-Ling war relativ klein und stand gerade auf ihren naturgegebenen Füßen wie das arbeitende Bauernmädchen, das sie schließlich auch war. Schon seit frühen Kindertagen galt sie als das hübscheste Mädchen im Dorf. Wären ihre Eltern nicht so arm gewesen, hätten sie ihr vielleicht auch die Füße gebunden, sie in edle Kleider gesteckt und als nachrangige jüngere Frau oder Konkubine an einen Kaufmann in einer der Städte der Gegend verkauft. Doch so hübsch sie auch sein mochte – niemand hätte es je für möglich gehalten, dass sie einen Sohn von Herrn Lung heiraten würde.
Tatsächlich hielten die meisten Leute die Ehe für einen Skandal. Ihre Schwiegermutter war außer sich vor Wut gewesen.
Es gab noch einen weiteren Unterschied zwischen den beiden Frauen. Willow hatte ihrem Ehemann bereits ein Kind geschenkt – auch wenn es zum Missfallen seiner Eltern nur ein Mädchen gewesen war. Zum Glück jedoch war sie bereits wieder im fünften Monat schwanger.
Als sie in den vorderen Innenhof des Lung-Hauses zurückgingen, sah Willow Mei-Ling gelangweilt an.
»Ich weiß, wer das war.«
»Oh?«
»Das war dein Cousin Nio. Ich weiß alles über ihn. Du nennst ihn Kleiner Bruder.« Sie nickte träge. »Alle im Haus wussten, dass er da ist, aber wir durften es dir nicht sagen.«
»Nicht einmal mein Ehemann?«
»Er wollte schon, aber er fürchtete, du würdest versuchen, Nio zu treffen, und dich in Schwierigkeiten bringen. Er hat versucht, dich zu beschützen, sonst nichts.«
»Wirst du es Mutter sagen?«
»Du kannst mir vertrauen, Schwester.«
Im Innenhof stand ein kleiner Orangenbaum. Als Willow ihn erreicht hatte, blieb sie stehen.
»Versuch nicht, ihn zu treffen, Schwester. Wenn Mutter es herausfindet, wird sie dich auspeitschen. Oder Schlimmeres.«
Es war früher Nachmittag in Kalkutta, als eine einspännige Mietkutsche zwei junge Engländer in den hübschen Vorort Chowringhee brachte. Die Fensterläden waren überall fest verschlossen, um das grelle Licht abzuhalten. Und obwohl es die kühlste Jahreszeit Indiens war, war es immer noch heller und heißer als an den meisten Sommertagen in Großbritannien.
Charlie Farley hatte ein fröhliches Gemüt. Beim Kricket, das er gut beherrschte, brachte man ihm aufgrund seiner Größe Respekt entgegen. Sein rundliches Gesicht wirkte noch rundlicher, seit sein blonder Haaransatz weiter zurückwich. »Ich bin noch nicht kahl«, hatte er fröhlich bemerkt, »aber bis es Zeit für den Tee ist, wird es so weit sein.« Seine blassblauen Augen hinter den Brillengläsern blickten freundlich, aber keineswegs leichtgläubig. Nicht nur beim Kricket, sondern in allen Lebensbereichen spielte er geradlinig.
Sein Freund John Trader war ein wenig größer, und sein Haar erinnerte an schwarze Oliven. Er war schlank und ziemlich gut aussehend. Allerdings blickten seine durchdringend kobaltblauen Augen nicht glücklich.
»Das ist alles ein schrecklicher Fehler«, sagte er in düsterem Ton.
»Unsinn, John«, sagte Charlie Farley. »Ich habe dem Colonel gesagt, dass du mir das Leben gerettet hast. Er wird sehr zivilisiert mit dir umgehen.« Wenige Augenblicke später knirschten die Räder der Mietkutsche auf dem Kies einer kurzen Einfahrt. »Jetzt werden wir nur rasch diese Briefe bei meiner Tante Harriet deponieren und schon wieder unterwegs sein. Also bemüh dich um ein fröhliches Gesicht.«
Das Haus seiner Tante war ein typischer kolonialer Bungalow der besseren Sorte, mit einer Veranda vorne und hinten, deren breite Traufen von dicken, weiß gestrichenen ionischen Säulen gehalten wurden. Der luftige Eingangsbereich führte zu einem schlichten, aber freundlichen Wohnzimmer sowie zu einem Esszimmer, beide in englischem Stil eingerichtet. Als die beiden Männer sich der Tür näherten, schienen aus jedem Winkel makellos weiß gekleidete indische Bedienstete aufzutauchen.
Tante Harriet hatte die Kutsche anscheinend gehört, denn sie befand sich schon dort. Charlie liebte seine Tante. Wie seine Mutter, deren Schwester, hatte sie sich das lockige goldblonde Haar ihrer Jugend bewahrt. Sie besaß blaue Augen, die einen offen anblickten. Sie und ihr Mann begegneten jedem Neuankömmling in British Calcutta mit der entspannten Gastfreundschaft, die quasi Markenzeichen für den Lebensstil von Kaufleuten in den Kolonien war.
»Was machst du hier, Charlie?«, erkundigte sie sich. »Solltet ihr Jungs nicht arbeiten?«
»Wir haben schon gearbeitet, Tante Harriet«, antwortete Charlie. »Aber heute Morgen ist ein Packen Briefe aus England eingetroffen, darunter auch einer von Mutter an dich. Da dachte ich, den bringe ich dir sofort.«
Tante Harriet lächelte.
»Und ich vermute mal, jetzt möchtet ihr was zu futtern?«
»Absolut nicht. Wir können uns sogar überhaupt nicht aufhalten, weil wir auf dem Weg zum Lunch mit Colonel Lomond sind.«
»Mit Colonel Lomond? Wie beeindruckend.«
»Vater ist nämlich mit ihm zur Schule gegangen«, erklärte Charlie. »So habe ich uns eine Einladung zum Mittagessen in seinem Club verschafft. Dachte, es würde John Spaß machen, sich den mal anzusehen.«
»Na, dann beeilt euch mal lieber, Jungs«, sagte Tante Harriet. »Bei Colonel Lomond dürft ihr euch nicht verspäten.«
»Sind schon wieder weg«, sagte Charlie.
Es war an der Zeit für ein Gespräch von Mann zu Mann. Und weil sie nun zehn Minuten zu zweit in der Kutsche hatten, beschloss Charlie, es jetzt zu führen.
»Weißt du, was mit dir nicht stimmt, Trader?«
»Sag’s mir.« Trader rang sich ein halbes Lächeln ab.
»Du bist ein guter Freund. Ich würde dir mein Leben anvertrauen. Aber du bist ein launischer Kerl. Schau dich nur heute an. Du musst doch nichts anderes tun als beobachten und genießen.«
»Ich weiß.«
»Aber es steckt noch mehr dahinter. Dein Problem ist, dass du nie zufrieden bist. Was auch immer du hast, stets träumst du davon, mehr zu haben.«
»Da könntest du recht haben.«
»Ich meine, du warst ein Waisenkind, was wirklich verdammtes Pech war. Aber auch nicht das Ende der Welt. Du hast eine anständige Schule besucht. Du hast ein nettes Sümmchen geerbt. Du hast mich zum Freund. Wir sind bei Rattrays, einem der besten Kommissions- und Handelshäuser Indiens. Und auch wenn du’s anscheinend nicht glaubst, du bist ein attraktiver Teufelskerl, und die Hälfte aller Frauen in Kalkutta ist in dich verliebt. Was willst du mehr?«
»Ich weiß es nicht, Charlie«, gestand sein Freund. »Erzähl mir von diesem Colonel Lomond, den wir gleich treffen werden. Hat er Familie?«
»Eine Frau. Ich besuche sie gelegentlich. Du weißt schon, aus Höflichkeit und so. Eine liebenswürdige Dame. Sein Sohn ist in der Armee, etwas älter als wir. Eine Tochter hat er auch. Bin ihr ein- oder zweimal im Haus begegnet. Ganz attraktiv.« Charlie lächelte. »Aber ich wahre eine gewisse Distanz. Der Colonel würde es nicht schätzen, wenn ich mich zu kumpelhaft benähme.«
»Weil er ein Aristokrat ist.«
»Alte schottische Familie. Älterer Bruder am Stammsitz der Familie – du weißt schon.«
»Und wir sind Kaufleute, Charlie. Handeltreibende, Staub zu seinen Füßen.«
»Er behandelt mich anständig.«
»Weil dein Vater mit ihm zur Schule gegangen ist.« Der dunkelhaarige junge Mann schwieg kurz. Als sein Freund darauf nichts erwiderte, fuhr er fort: »Weißt du, was mich ärgert, Charlie?«
»Was?«
»Männer wie Lomond schauen auf uns herab, weil wir im Geschäft sind. Aber was ist denn das britische Empire? Ein riesiges Handelsunternehmen. War es immer schon. Wer hält Indien am Laufen? Die Ostindische Kompanie. Wem gehört die Armee hier? Der Ostindischen Kompanie. Na gut, heutzutage ist die britische Regierung bis auf den Namen identisch mit der Kompanie, und ein Großteil des Handels befindet sich in den Händen von unabhängigen Kaufleuten wie uns. Aber es bleibt eine Tatsache, dass der Grund für die Existenz der Armee, in der Colonel Lomond und die Angehörigen seiner Klasse Offiziere sind, der Schutz des Handels ist. Also von dir und mir. Ohne Kaufleute keine Armee.«
»Das wirst du ihm aber nicht sagen, oder?«, fragte Charlie nervös.
»Vielleicht.« Trader sah ihn erst grimmig an, dann lächelte er. »Keine Sorge.«
Charlie spitzte die Lippen, schüttelte den Kopf und kam dann wieder auf sein Thema zurück. »Warum kannst du nicht einfach nach den Regeln spielen, John? So, wie die Dinge stehen, haben du und ich doch ziemlich gute Karten. Mein Vater hat sein Leben lang für die Ostindische Kompanie gearbeitet und ist mit einem anständigen Vermögen in Rente gegangen, weißt du. Er besitzt ein großes Haus in Bath. Unser Nachbar ist ein Generalmajor. Lustiger alter Kerl. Spielt mit meinem Vater Karten. Siehst du, was ich meine? Das würde mir auch reichen.«
»Es ist nicht zu verachten, Charlie.«
»Aber wenn ich mehr wollte, dann müsste es so funktionieren: Vielleicht würde ich bei Rattrays mein Glück machen und am Ende mit genug Vermögen aufhören, um mir ein Landgut zu kaufen und ein Gentleman mit Grundbesitz zu werden. Passiert ja andauernd. Mein Sohn käme vielleicht in ein gutes Regiment und würde sich als Offizier mit einem der Lomonds verbrüdern.« Farley sah seinen Freund ernst an. »So läuft das Spiel der gesellschaftlichen Schichten, Trader, wenn du es spielen willst.«
»Das dauert lange.«
»Ein paar Generationen, mehr nicht. Aber weißt du, was man so schön sagt?« Charlie Farley lehnte sich zurück und lächelte. »Ehrbarkeit … ist nur eine Frage von Kontakten.«
Als er durch das strenge Portal des Bengal Military Club trat, spürte John Trader, wie die düstere Stimmung ihn wieder erfasste. Es fing schon mit dem schwarzen Gehrock an, in dem ihm unangenehm heiß war. Eigentlich war er nur für das kühlere britische Klima gemacht, doch die Kleidervorschriften des Clubs verlangten eine solche Ausstattung. Und dann war da natürlich noch der Club selbst.
Die Briten herrschten noch nicht über ganz Indien, aber sie waren die Herren über Bengalen. Und in der großartigen bengalischen Stadt Kalkutta sah man das überall: auf der Rennbahn, auf den Golfplätzen und nirgendwo deutlicher als auf der Esplanade. Dort starrte die riesige klassizistische Fassade des Bengal Military Club in kolonialer Pracht auf diejenigen herab, die an seinen Türen vorbeiliefen.
Wer waren diese Passanten? Nun, Inder und Anglo-Inder natürlich, aber auch Briten: Kaufleute, Händler, die Mittelklasse und all jene darunter, also Menschen, die nicht herrschten, sondern arbeiteten.
Denn die Angehörigen des Bengal Military Club waren Herrschende. Armeeoffiziere, Richter, Verwaltungsbeamte des britischen Empires, Nachfolger des kaiserlichen Roms – oder für was auch immer sie sich selbst halten mochten. Wie die römischen Senatoren wetteiferten sie, und diese Recken und Grundbesitzer verachteten sowohl die Gewerbetreibenden als auch, und ganz besonders, die Kaufleute.
Colonel Lomond erwartete sie bereits in der weitläufigen Eingangshalle, von deren Wänden Staatsmänner und Generäle mit vernichtendem Blick auf John herunterstarrten. Sogleich wurden sie in den Speisesaal geführt.
Das Tischtuch aus weißem Leinen war gestärkt und bretthart. Georgianisches Silberbesteck, Teller aus Wedgwood-Porzellan, schwere Kristallgläser. Zur Suppe wurde Sherry serviert, damit ging es los. Die französische Küche mochte in Mode sein, doch dem Colonel sagte sie nicht zu. Daher gab es ehrliches Rindfleisch mit Kohl und Kartoffeln. Das Gemüse wurde in einer hiesigen britisch geführten Gärtnerei angebaut. Der Wein schmeckte ausgezeichnet. Kurz gesagt, hätten sie sich genauso gut in einem Club im Herzen Londons befinden können.
Colonel Lomond trug an diesem Tag Uniform: eine schicke dunkelrote Tunika zu schwarzen Hosen. Er war groß, schlank und sein dünner werdendes Haar noch dunkel. Da seine Augenbrauen sich an den Enden nach oben wölbten, wirkte er wie ein edler Falke. Er war durch und durch schottischer Chief.
Es war offensichtlich, dass er sich vorgenommen hatte, freundlich zu dem jungen Farley zu sein, den er als »mein Junge« ansprach, während er Farley senior, der inzwischen in Bath lebte, als »deinen lieben Vater« bezeichnete.
»Ich habe einen Brief von deinem lieben Vater erhalten. Er schreibt, der alte General Frobisher würde jetzt in seiner Nähe wohnen.«
»Kennen Sie ihn, Sir?«
»Ja. Ein großartiger Jäger. Großwild.«
»Tiger?«
»Selbstverständlich. Als er anfangs hier war, wisst ihr, da pflegte man noch zu Fuß zu jagen. Nicht wie heutzutage mit Elefanten.« Er nickte Charlie wohlwollend zu.
Was hatte Charlie Farley bloß an sich, dass Colonel Lomond ihn mochte? Zum einen war er natürlich ein liebenswürdiger Kerl, genau wie sein Vater immer. Geradeheraus, höflich, umgänglich. Doch da war noch etwas. Er wusste, wo er hingehörte, und gab sich damit zufrieden. Charlie würde niemals die Grenzen überschreiten. Als er Lomond freimütig erzählte, er hätte da einen Freund, der sich dafür interessieren würde, den Club einmal von innen zu sehen, er selbst aber außerstande wäre, ihm diesen Wunsch zu erfüllen, »außer wenn Sie uns zum Lunch dorthin bitten würden, Sir«, da hatte Lomond sie auf der Stelle eingeladen. »Vorwitziger junger Kerl«, hatte der Colonel später auch seiner Frau gegenüber bemerkt. Allerdings mit demselben Wohlwollen, das er auch einem draufgängerischen jungen Offizier entgegengebracht hätte. Allerdings würde Charlie ihn niemals in Verlegenheit bringen, indem er versuchte, dem Club beizutreten. Nicht dass es Colonel Lomond besonders gestört hätte, wenn Charlie Farley Mitglied geworden wäre. Aber darum ging es natürlich gar nicht. Wie alle, die das britische Empire regierten, wussten, ging es nicht um den Einzelfall, sondern darum, was dieser nach sich ziehen könnte.
Das brachte den Colonel dazu, seinen Blick auf John Trader zu richten.
Der junge Trader hatte irgendetwas an sich, das Lomond nicht gefiel. Er war sich nicht sicher, um was es sich handelte. Da der dunkelhaarige junge Mann Farleys Freund war, würde er sich ihm gegenüber natürlich freundlich erweisen. Doch die Jahre, die er nun schon in Indien lebte und dabei die Entwicklung von Männern beobachtete, hatten Colonel Lomond eine Art sechsten Sinn beschert. Und so empfand er im Moment das gleiche Unbehagen wie damals, kurz bevor er eine Kobra in seinem Haus entdeckt hatte.
»Aus welcher Gegend des Landes stammen Sie?«, versuchte er es. Immer eine unverfängliche Frage.
»Zunächst wuchs ich in Südwestengland auf, Sir«, erwiderte Trader. »Dann etwas außerhalb von London. In Blackheath.«
»Blackheath, ja? Früher gab’s in der Gegend Straßenräuber, nicht wahr?« Obwohl er das in scherzhaftem Ton sagte, schwang da vielleicht der Hinweis mit, dass auch Trader selbst ein Straßenräuber sein mochte? Natürlich nicht. »Haben Sie dort noch Familie?«
»Ich habe keine lebenden Angehörigen mehr«, antwortete Trader.
»Überhaupt niemanden?«
»Es gab entfernte Verwandte meines Vaters, von vor Generationen, glaube ich. Doch es kam zu einem Familienstreit, und sie haben nie mehr miteinander gesprochen. Ich kenne nicht einmal ihre Namen und wüsste nicht, wo sie sein könnten.«
»Oh.« Der Colonel unternahm einen weiteren Versuch. »Sie sind aber nicht mit Farley zur Schule gegangen, oder?«
»Nein, Sir. In Charterhouse.«
»Gute alte Schule.« Der Colonel nahm einen Schluck Wein. Nicht ganz Harrow natürlich, wo er und die Farleys gewesen waren.
»Trader hat mir das Leben gerettet, Sir«, meinte Charlie hoffnungsvoll.
Colonel Lomond sah Charlie unverbindlich an. Sie wussten beide, dass Charlie ihm das bereits erzählt hatte. Doch diesem dunklen Fremden gönnte der Colonel diesen Triumph nicht.
»Freut mich zu hören«, sagte er mit einem knappen Kopfnicken. »Wenn wir irgendwann zusammen abendessen«, fügte er vage in Traders Richtung hinzu, »dann müssen Sie mir die ganze Geschichte erzählen.«
Für das Dessert wurde die Tischdecke entfernt. Der Colonel reichte die Karaffe mit Portwein herum. Sie hatten gut gegessen. Hätte der Colonel Trader vorhin nicht direkt angesprochen, während er Charlie geradezu liebevoll betrachtete, hätte man ihn für geistesabwesend halten können. Doch nun schien ihn noch etwas zu beschäftigen.
»Sag einmal, mein Junge, dein Handelshaus, Rattrays …« Er beugte sich gerade so weit zu Charlie vor, dass man die Besorgnis spürte. »Denen geht es doch gut, nicht wahr?«
»Absolut, Sir. Gesund wie ein Fisch im Wasser.« Charlie lächelte. »Mein Vater hat mich das Gleiche gefragt. Seit dem letzten Crash, Sir, setzt Rattrays aufs Maßhalten.«
»Gut.« Der Colonel nickte erleichtert. Es war erst zwei Jahre her, dass das mächtige Handelshaus Palmers Pleite gemacht hatte. – Ein Opfer übermäßiger Gier und Verschuldung, die wie die Pest immer wieder auf jedem Markt auftraten. Das hatte damals den Niedergang der meisten Kommissions- und Handelshäuser in Kalkutta nach sich gezogen und zahllose Witwen und Waisen ruiniert. »Selbstverständlich«, konzedierte der Colonel über sein Glas Portwein hinweg, »damals im letzten Jahrhundert haben einige Nabobs der East India Company in nur wenigen Jahren riesige Vermögen angehäuft.« Sein Blick wurde versonnen und ließ vermuten, dass selbst ein wackerer Soldat wie er, sollte das Glück seinen Weg kreuzen, hunderttausend Pfund extra nicht abgeneigt wäre.
»Die einzigen Kerle, die derzeit schnell ein Vermögen machen, Sir«, sagte Charlie, »sind diejenigen, die nach Kanton gehen, in den Handel mit China.«
»Das habe ich schon gehört. Ein etwas schmutziges Geschäft, nicht wahr?«, fügte der Colonel leise hinzu.
»Also, wir stecken da nicht mit drin, Sir«, meinte Charlie und bekam dafür ein zustimmendes Nicken.
Nachdem er so lange höflich geschwiegen hatte, meldete sich nun John Trader zu Wort.
»Es tut mir leid, dass Ihnen der Handel mit China nicht gefällt, Sir«, merkte er an. »Er basiert auf Tee, stimmt’s?« Schwang in seinem Ton eine Spur von Drohung mit?
»Tee. Natürlich«, brummte der Colonel.
»Die Briten trinken Tee, der aus China importiert wird, weil das beinah der einzige Ort ist, an dem er angebaut wird. Der Tee wird besteuert. Und die Teesteuer deckt den Großteil der laufenden Kosten der britischen Marine.«
»Das weiß ich nun wirklich nicht«, sagte der Colonel.
»Also kann es nicht der Tee sein, gegen den Sie Einwände haben, Sir«, fuhr Trader fort. »Ist es das Opium, mit dem wir China im Gegenzug für den Tee beliefern, das Ihnen missfällt?«
»Die Chinesen können kaufen, was sie wollen, möchte ich meinen«, stellte Colonel Lomond fest und warf Charlie einen Blick zu, der ihm klarmachen sollte, dass er genug davon hatte.
»Die Engländer und ihr Tee«, schaltete Charlie sich in munterem Ton ein. »Man möchte gar nicht glauben, wie viel die Leute davon trinken können. Dabei braucht den ja niemand wirklich. Aber die Leute bestehen darauf, ihn zu bekommen. Und jedes Jahr mehr davon.« Er warf Trader einen warnenden Blick zu. »Tatsächlich wird alles davon in Silber bezahlt, muss man wissen.« Er wandte sich direkt an den Colonel. »Sir, ich fürchte, dass wir jetzt aufbrechen müssen. Wegen der Arbeit und allem, Sie verstehen.«
»Natürlich, mein Junge. Ist mir immer eine Freude, dich zu sehen«, erwiderte Lomond dankbar.
»Es handelt sich um ein Dreiecksgeschäft«, hielt Trader leise, aber beharrlich am Thema fest. »Chinesische Händler kommen durch unsere Vermittler in Kanton an Opium. Diese Chinesen bezahlen unsere Mittelsmänner in Silber. Das benutzen die Vermittler, um Tee einzukaufen. Aber woher stammt das Opium? Aus Indien. Hauptsächlich aus Bengalen. Angebaut von der East India Company. So verhält es sich doch, nicht wahr, Sir?«
Colonel Lomond antwortete nicht. Stattdessen erhob er sich vom Tisch. Indem er Charlie vertraulich am Arm fasste, zwang er Trader, hinter ihnen zu gehen, während er sie beide zum Ausgang führte.
Augenblicke später stiegen sie zusammen die Stufen des Clubs hinunter. An deren Ende hätten sich ihre Wege getrennt, wenn nicht eine Stimme von der Straße sie unterbrochen hätte.
»Papa!« Das kam aus einer Kutsche mit Dach. Darin wurde, begleitet von ihrer Mutter, einer Bediensteten, einem Kutscher und eskortiert von Vorreitern, eine junge, in Seide gekleidete Dame mit Sonnenschirm die Esplanade entlanggefahren. Die Kutsche hielt.
»Guten Tag, Papa«, sagte Agnes Lomond. »Hattest du ein gutes Mittagessen?«
Colonel Lomond hatte zwar nicht mit dieser Begegnung gerechnet, wandte sich aber trotzdem mit einem Lächeln seiner Tochter zu. Seiner Frau warf er einen warnenden Blick zu, den diese sogleich registrierte.
»Ihr beiden kennt den jungen Farley natürlich«, sagte er freundlich, während die beiden Damen Charlie grüßten. »Und das hier«, fügte er vage hinzu und zeigte mit einer plötzlich wie erschlafften Hand auf Trader, »ist ein Freund von ihm.«
»John Trader«, sagte Trader und lächelte zunächst Mrs Lomond höflich zu, bevor er den Blick auf ihre Tochter richtete. Sobald seine dunkelblauen Augen auf der jungen Frau ruhten, wandte er sie nicht mehr von ihr ab.
Agnes Lomond war zwanzig und bereits eine Lady. Man konnte sie nicht anders nennen. Ihre Mutter war eine würdevoll stattliche Matrone. Agnes dagegen schlank wie ihr Vater und ein wenig größer als die Mutter. Ihr gut gegen die Sonne geschütztes Gesicht zeigte einen wunderschön hellen Teint. Und auch wenn ihre Nase ein wenig zu lang war, um noch als hübsch zu gelten, ließ sie sie nur noch aristokratischer wirken. Über ihren Charakter konnte man nur spekulieren.
Vielleicht war es diese Undurchschaubarkeit oder ihr rötlich braunes Haar oder die Tatsache, dass sie gesellschaftlich unerreichbar war. Es mochten auch ihre walnussbraunen Augen sein oder das starke Verlangen, sie ihrem Vater zu stehlen – aber jedenfalls stand John Trader der Mund offen, und er starrte Agnes Lomond wie in Trance an.
Ihre Mutter sah es und schritt sofort ein. »Begleitest du uns?«, fragte sie ihren Gatten, der sogleich in die Kutsche stieg. »Wir müssen Sie und Ihren Freund ja wieder an die Arbeit lassen, Mr Farley.« Sie gönnte Charlie ein Kopfnicken, das er mit einer Verbeugung quittierte, während die Kutsche schon davonfuhr.
Trader vergaß, sich zu verbeugen. Er stand nur starrend da.
Die rote Sonne ging erneut unter, als Jiang Shi-Rong den Kiefernhain verließ, durch den die alte Straße führte, und die Stadt erblickte. Hoch über ihm hingen breite Wolkenstreifen wie ein himmlischer Brustkorb und nahmen das orangefarbene Glühen der Sonne im Westen auf. Wie immer, wenn er zu den mächtigen Mauern, Türmen und ausladenden geschwungenen Dächern mit schimmernden Ziegeln hinaufschaute, stockte Jiang Shi-Rong der Atem.
Peking. Prachtvoll.
Doch war es auch seine Stadt?
Jiang wusste, dass die Menschen, die sich selbst Han nannten – sein Volk –, an dieser Stelle vor dreitausend Jahren eine befestigte Stadt errichtet hatten. Es lag erst fünf Jahrhunderte zurück, dass Kubla Khan, ein Enkel von Dschingis, dem mächtigen mongolischen Eroberer, China unterworfen hatte. Nachdem er das sagenhafte Xanadu auf dem Gelände seiner sommerlichen Jagden hatte errichten lassen, bestimmte er diese nördliche Stadt zur chinesischen Hauptstadt.
Nach nicht einmal hundert Jahren war es einer einheimischen Han-Dynastie, der brillanten Ming, gelungen, die Mongolen zu vertreiben und die Große Mauer so zu verstärken, dass sie auch andere Eindringlinge abhielt. Die Hauptstadt Kubla Khan behielt man jedoch bei. Drei Jahrhunderte lang regierten die Ming China.
Es war ein goldenes Zeitalter. Literatur und die Künste blühten. Chinesische Gelehrte druckten die größte Enzyklopädie der Pflanzenheilkunde, die die Welt je gesehen hatte. Chinesische Flotten erforschten den Westen bis nach Afrika. Ming-Porzellan war weltweit begehrt.
Doch selbst die strahlende Ming-Dynastie ging zu Ende. Das Muster hatte man in China schon so oft gesehen: schrittweise Degeneration, ein schwacher Kaiser, ein Bauernaufstand, ein ehrgeiziger General, der versuchte, die Macht an sich zu reißen. Und in diesem Fall außerdem eine erneute riesige Invasion aus dem Norden. Diesmal handelte es sich um einen Zusammenschluss von Clans – die Mandschu – aus den gewaltigen Wäldern und Ebenen nordöstlich der Großen Mauer.
Die Mandschu-Armeen waren in großen Einheiten, den sogenannten Bannern, organisiert, die jeweils ein Prinz oder vertrauenswürdiger Fürst anführte. Als das Ming-Reich zerbrach und unter ihr Joch kam, wurden die großen Städte von Bannermännern besetzt und blieben das auch für die nächsten Jahrhunderte.
Die stolzen Han-Chinesen waren nun Untertanen. Ihre Männer wurden gezwungen, eine Mandschu-Frisur zu tragen: Hierfür wurde der Vorderkopf rasiert und der Rest der Haare zu einem einzigen langen Zopf geflochten, der über den Rücken fiel.
Auch wenn die Chinesen unterlegen waren, ihre Kultur bestand fort. Die Mandschu waren natürlich stolz auf ihre kriegerische Vergangenheit, doch als Herrscher über die riesigen Städte, die Paläste und Tempel Chinas, gaben sie sich bald einen chinesischen Namen – die Qing oder Ch’ing – und regierten bald mehr oder weniger wie chinesische Kaiser. Die Qing-Kaiser brachten den Göttern ewige Opfer, einige waren äußerst bewandert in chinesischer Literatur.
Jiang schuldete ihnen Gehorsam. Doch sogar jetzt wusste er wie so viele Han-Chinesen noch, dass er und sein Volk die wahren Erben der jahrtausendealten chinesischen Kultur waren und eigentlich den Lehnsherren, denen er diente, überlegen.
Die riesige äußere Mauer vor ihm erstreckte sich über vier Meilen von Osten nach Westen, und in der Mitte befand sich ein mächtiges Torhaus. Innerhalb der Mauer, rechts, auf einem großen Hügel über dem Gelände, konnte er die große trommelförmige Pagode des Himmelsaltars sehen, vor der der Kaiser die althergebrachten Zeremonien abhielt, um die Götter um gute Ernten zu bitten, und deren dreistöckige, blaue Ziegeldächer sich unter der rötlichen Glut der Wolken indigoblau färbten.
Nachdem sie das Tor passiert hatten, ritten er und Wong auf einem erhöhten Damm ein paar Meilen weiter nach Norden in Richtung der noch beeindruckenderen, vier Quadratmeilen großen Anlage der Inneren Stadt, die von einer Mauer mit mächtigen Wachtürmen an jeder Ecke geschützt wird.
Es dämmerte, als sie die Stadt betraten, vorbei an den Bannermännern in ihren Mandschu-Hüten, Wämsern und Stiefeln. Die Marktstände auf beiden Seiten der breiten Straße schlossen gerade, ihre Schilder wurden abgenommen. Müllsammler, einige mit breitkrempigen Hüten, die meisten mit Scheitelkappen, beugten sich über ihre Schaufeln und füllten Dung in große Steingutgefäße. Ein schwacher Geruch von Dung, Soja und Ginseng erfüllte die Luft.
Diese Innere Stadt war keineswegs das Zentrum von Peking. Denn in ihr, hinter dem kolossalen Tor des Himmlischen Friedens, lag eine weitere ummauerte Zitadelle, die Kaiserstadt, und in ihr, jenseits eines Wassergrabens, vor fast aller Augen durch ihre purpurnen Mauern verborgen, die goldbedeckte Verbotene Stadt, das innerste Heiligtum, der riesige Palast und die Privatgemächer des Himmlischen Kaisers.
Ihr Weg führte sie an diesem Abend in das nordöstliche Viertel der Inneren Stadt, in eine ruhige Straße, wo in einem schönen Haus neben einem kleinen Tempel der Gelehrte Herr Wen wohnte. Jiang war müde und freute sich auf eine Rast.
Doch kaum hatten sie den kleinen Hof betreten, eilte der alte Gelehrte aus dem Haus.
»Endlich!«, rief er. »Ihr müsst zu Lord Lin gehen. Er reist morgen ab. Aber er wird dich noch heute Abend treffen, wenn du sofort gehst. Sofort.« Er drückte Jiang einen schriftlichen Passierschein für die Kaiserstadt in die Hand. »Wong wird dich führen«, wies er an. »Er kennt den Weg.«
Sie betraten die Stadt zu Fuß, nicht durch das große Tor des Himmlischen Friedens, sondern durch einen kleineren Eingang in der Ostmauer der Kaiserstadt, und kamen bald zu einem stattlichen Gästehaus der Regierung mit einem breiten, geschwungenen Dachvorsprung, in dem Lord Lin logierte. Wenige Minuten später fand sich Shi-Rong in einem kleinen Saal wieder, in dem Lord Lin auf einem großen, aus Rosenholz geschnitzten Sessel saß.
Auf den ersten Blick war nichts Besonderes an ihm. Er hätte ein beliebiger stämmiger Mandarin mittleren Alters sein können. Sein schmaler, spitzer Bart war ergraut, die Augen standen weit auseinander. In Anbetracht des strengen Rufs hatte Jiang erwartet, dass der Hochkommissar dünne Lippen haben würde, aber in Wirklichkeit waren sie ziemlich voll.
Dennoch hatte er etwas sehr Würdevolles an sich, etwas Stilles. Er hätte auch der Abt eines Klosters sein können.
Jiang verbeugte sich.
»Ich hatte bereits einen jungen Mann als Sekretär für mein Büro ausgewählt.« Lord Lin sprach ihn leise an, ohne sich vorzustellen. »Aber dann wurde er krank. Ich wartete. Es ging ihm immer schlechter. In der Zwischenzeit hatte ich von Herrn Wen, einem Gelehrten, dem ich vertraue, einen Brief über dich erhalten. Das betrachtete ich als ein Zeichen. Herr Wen erzählte mir von dir. Einige gute Dinge, einige weniger gute.«
»Dieser ergebene Diener fühlt sich zutiefst geehrt, dass sein Lehrer, Herr Wen, an ihn denkt, Hochkommissar. Von seinem Brief wusste er nichts«, gestand Jiang. »Herr Wens Meinung ist in allen Betrachtungen gerecht.«
Ein leichtes Nicken ließ erkennen, dass diese Antwort zufriedenstellend war.
»Er hat mir auch berichtet, dass du deinen sterbenden Vater besuchen wolltest.«
»Konfuzius sagt: ›Ehre deinen Vater‹, Hochkommissar.«
In den gesamten Analekten des Konfuzius gab es kein zentraleres Thema. »Und die Väter der Väter«, fügte Lin leise hinzu. »Ich möchte dich auch nicht an deiner Pflichterfüllung hindern. Aber ich habe dich in einer wichtigen Angelegenheit hierhergerufen, und mein Auftrag stammt vom Kaiser selbst.« Er hielt inne. »Zuerst muss ich dich jedoch besser kennenlernen.« Er warf Jiang einen strengen Blick zu. »Dein Name, Shi-Rong, bedeutet ›Gelehrtenehre‹. Dein Vater hatte große Hoffnungen in dich gesetzt. Doch du hast deine Prüfungen nicht bestanden.«
»Dieser ergebene Diener hat versagt.« Jiang ließ den Kopf hängen.
»Warum? Hast du dich genug angestrengt?«
»Ich dachte, das hätte ich. Ich schäme mich.«
»Dein Vater hat die Beamtenprüfungen in der Hauptstadt im ersten Anlauf bestanden. Wolltest du es besser machen als er?«
»Nein, Eure Exzellenz. Das wäre respektlos. Aber ich hatte das Gefühl, ich hätte ihn enttäuscht. Ich wollte nichts anderes, als ihm zu gefallen.«
»Du bist sein einziger Sohn?« Er blickte Jiang scharf an, und als der junge Mann nickte, merkte er an: »Das ist keine leichte Last. Hast du die Prüfungen als beängstigend empfunden?«
»Ja, Hochkommissar.«
Das war eine Untertreibung. Die Reise in die Hauptstadt. Die Reihe der kleinen Kabinen, in die jeder Kandidat für die gesamte dreitägige Prüfung eingesperrt war. Es hieß, wenn man während der Zeit starb, würde der Körper eingewickelt und über die Stadtmauer geworfen.
»Manche Kandidaten schmuggeln Unterlagen hinein. Sie betrügen. Hast du das getan?«
Jiang zuckte zusammen. Ein Anflug von Wut und Stolz erschien auf seinem Gesicht, bevor er seine Züge kontrollieren konnte. Sofort neigte er respektvoll den Kopf, dann blickte er wieder auf. »Das hat Euer Diener nicht getan, Hochkommissar.«
»Dein Vater hatte eine gute Laufbahn, wenn auch eine bescheidene. Er ging nicht als reicher Mann in den Ruhestand.« Lin stockte kurz und sah Jiang an, der nicht wusste, was er davon halten sollte. Aber er erinnerte sich an Lins Ruf, in allen Geschäften streng korrekt zu sein, und antwortete wahrheitsgemäß.
»Ich glaube, Exzellenz, mein Vater hat sich in seinem ganzen Leben noch nie bestechen lassen.«
»Wenn es anders wäre«, erwiderte der ältere Mann leise, »wärst du nicht hier.«
Er warf Jiang einen weiteren nachdenklichen Blick zu. »Wir werden nicht nur an unseren Erfolgen gemessen, junger Mann, sondern auch an unserer Beharrlichkeit. Wenn wir scheitern, müssen wir uns mehr anstrengen. Auch ich bin beim ersten Mal bei den Beamtenprüfungen in der Hauptstadt durchgefallen. Hast du das gewusst?«
»Nein, Hochkommissar.«
»Ich absolvierte sie ein zweites Mal. Wieder bin ich durchgefallen. Beim dritten Mal habe ich bestanden.« Er ließ das wirken und fuhr dann gestreng fort: »Wenn du mein Sekretär wirst, musst du stark sein. Du wirst schwer arbeiten müssen. Wenn du scheiterst, wirst du aus deinen Fehlern lernen und es dann besser machen. Du wirst niemals aufgeben. Hast du verstanden?«
»Ja, Hochkommissar.«
»Herr Wen hat mir erzählt, er glaubt, dass du beim nächsten Mal bestehen wirst. Doch zuerst sollst du für mich arbeiten. Bist du einverstanden?«
»Ja, Eure Exzellenz.«
»Gut.« Lin nickte. »Erzähl mir, was du über Opium weißt.«
»Leute, die es sich leisten können, rauchen es gerne«, antwortete Jiang. »Aber werden sie süchtig, verschwenden sie ihr ganzes Geld dafür. Es macht sie krank. Der Kaiser hat Opium verboten.« Er hielt inne und überlegte, ob er es wagen sollte, die Wahrheit zu sagen. »Trotzdem scheint jeder es zu bekommen.«
»Richtig. Innerhalb einer Generation hat sich der Drogenhandel verzehnfacht. Die Zahl der Menschen, die süchtig werden, bis sie nutzlos sind, verarmen, ruiniert und sterben … Es ist schrecklich. Die Menschen können ihre Steuern nicht bezahlen. Das Silber strömt aus dem Reich, um Opium zu bezahlen.«
»In China wird ebenfalls Opium angebaut, glaube ich.«
»Das stimmt. Aber fast alles kommt mittlerweile von jenseits der Meere. Unsere chinesischen Schmuggler kaufen es von den wilden Piraten. Was sollen wir also tun?«
Erwartete er eine Antwort auf diese Frage?
»Euer Diener hat gehört, Eure Exzellenz, dass es möglich ist, die Menschen von dieser Sucht abzubringen.«
»Wir versuchen es. Aber es ist sehr unsicher. Der Kaiser hat mir die Vollmacht erteilt, alle notwendigen Schritte zu unternehmen. Ich beabsichtige, die Schmuggler hinzurichten. Welche weiteren Probleme drängen sich dir auf?« Er beobachtete den jungen Mann, sah, wie unbehaglich ihm zumute war. »Du arbeitest jetzt für mich. Du hast mir jederzeit die Wahrheit zu sagen.«
Shi-Rong holte tief Luft. »Ich habe gehört, Exzellenz – auch wenn ich hoffe, dass es nicht stimmt –, dass die örtlichen Beamten an der Küste von den Schmugglern dafür bezahlt werden, dass sie ihre Aktivitäten nicht sehen.«
»Wir werden sie fassen und bestrafen. Wenn nötig, mit dem Tod.«
»Ah.« Langsam dämmerte es Jiang, dass dies keine einfache Aufgabe werden würde. Sich selbst Bestechungsgeldern zu verweigern war das eine, sich die Feindschaft der Hälfte der Beamten an der Küste zuzuziehen das andere. Nicht gut für seine Karriere.
»Du wirst keine Freunde haben, junger Mann, außer dem Kaiser und mir.«
Shi-Rong senkte den Kopf. Er fragte sich, ob er wohl eine plötzliche Krankheit vortäuschen könnte – so, wie es ihm jetzt in den Sinn kam, könnte das der andere junge Mann getan haben, der eigentlich für den Posten vorgesehen war. Nein, das glaubte er nicht.
»Euer Diener ist sehr geehrt.« Und dann verspürte er trotz des kalten Grauens, das in ihm aufstieg, die Neugier, eine weitere Frage zu stellen. »Wie wollt Ihr mit den Piraten verfahren, Exzellenz? Den Barbaren jenseits der Meere.«
»Ich habe mich noch nicht entschieden. Das werden wir sehen, wenn wir an der Küste sind.«
Shi-Rong senkte erneut den Kopf. »Ich habe eine Bitte, Hochkommissar. Darf ich meinen Vater besuchen?«
»Geh augenblicklich zu ihm. Entweder um ihn zu begraben oder um dich von ihm zu verabschieden. Es wird ihn freuen, dass du eine solche Stellung erhalten hast. Aber du darfst nicht bei ihm bleiben. Obwohl es deine Pflicht wäre, zu bleiben und um ihn zu trauern, musst du sofort an die Küste reisen. Betrachte dies als einen Befehl des Kaisers persönlich.«
Shi-Rong wusste kaum, was er denken sollte, als er und Wong sich auf den Rückweg zum Haus von Herrn Wen machten. Er wusste nur, dass er schlafen musste und im Morgengrauen wieder aufbrechen würde.
Am nächsten Morgen stellte er zu seiner Überraschung fest, dass Wong aufgesattelt hatte und bereit war, mit ihm zu reiten.
»Er wird mit dir bis nach Zhengzhou reiten«, teilte ihm Herr Wen mit. »Du musst auf dem gesamten Weg üben, Kantonesisch zu sprechen.«
Der betagte Lehrer dachte an alles.
Am Abend plagte Mei-Ling die Angst. Nicht, dass irgendetwas angesprochen worden wäre. Zumindest noch nicht. Sie hatte alle Aufgaben erledigt, die ihre Schwiegermutter ihr aufgetragen hatte. Am Nachmittag war die ältere Frau zu einer Nachbarin gegangen, und Mei-Ling hatte ein wenig aufgeatmet. Die Männer waren draußen im Bambuswald auf dem Hügel gewesen. Willow hatte sich ausgeruht, was ihr in Anbetracht ihres Zustands und des Reichtums ihrer Familie auch erlaubt war. Also war Mei-Ling mit ihren Gedanken allein gewesen.
Hatte Schwester Willow das Geheimnis für sich behalten? Oder wusste ihre Schwiegermutter von Nios Besuch am Morgen? Mutter wusste normalerweise alles. Vielleicht war bereits eine Strafe für sie vorbereitet.
Und dann war da noch der morgige Tag, über den man sich Gedanken machen musste. Mei-Ling verfluchte ihre eigene Dummheit. Warum hatte sie Nio gesagt, dass sie ihn treffen würde?
Weil sie ihn liebte, natürlich. Weil er ihr Kleiner Bruder war. Aber was war bloß in sie gefahren? Sie hatte nicht einmal mit ihrem Ehemann darüber gesprochen – ihrem Mann, den sie noch mehr liebte als ihren Kleinen Bruder. Doch selbst ihr Mann konnte sie nicht vor Mutter beschützen. Keine junge chinesische Ehefrau widersetzte sich ihrer Schwiegermutter.
Sie sollte besser nicht hingehen. Das wusste sie. Nio würde das verstehen. Aber sie hatte ihr Wort gegeben. Sie mochte arm sein, aber Mei-Ling war stolz darauf, nie ihr Wort zu brechen. Vielleicht, weil sie und ihre Familie im Dorf nichts galten, war für sie dieser Stolz, nicht wortbrüchig zu werden, immer eine Ehrensache gewesen, schon als sie noch ein kleines Mädchen war.
Wie sollte sie das überhaupt anstellen? Selbst wenn sie sich unbemerkt hinausschleichen könnte, wie groß war die Wahrscheinlichkeit zurückzukehren, ohne dass ihre Abwesenheit bemerkt worden war? Im besten Fall gering. Und was dann? Es bestand keine Möglichkeit, einer fürchterlichen Strafe zu entgehen.
Höchstens eine. Aber auch nur vielleicht. Sie war sich da jedoch nicht sicher. Das machte ihr Sorgen.
Der Abend begann gut. Die Familie ihres Mannes besaß das beste aller Bauernhäuser im Dorf. Hinter dem größten Innenhof befand sich ein stattlicher Hauptraum, in dem sie sich wie immer alle versammelt hatten.
Ihr gegenüber, auf einer breiten Bank, saß Willow mit ihrem Ehemann, Elder Son. Trotz seines knochigen Körperbaus und seiner von der Arbeit immer noch schmutzigen Hände, die zu knorrig waren, um mit Willows Eleganz mitzuhalten, schienen sich die beiden unter dem Blick seiner Mutter recht wohlzufühlen. Elder Son trank ein wenig Huangjiu-Reiswein und richtete von Zeit zu Zeit eine Bemerkung an seine Frau. Als sich Willows Blick mit dem von Mei-Ling traf, zeigte ihr Gesicht weder Anzeichen von Schuld noch von Mitschuld. Glückliche Willow. Sie war dazu erzogen worden, mit ihrer Miene niemals irgendeine Gefühlsregung zu zeigen.
Mei-Ling saß neben Second Son auf der Bank. Waren sie allein, sprachen sie normalerweise viel miteinander, aber sie wussten, dass sie sich jetzt nicht unterhalten sollten. Andernfalls würde seine Mutter sie mit einem unmissverständlichen »Du redest zu viel mit deiner Frau, Second Son« zum Schweigen bringen. Aber von ihrem Platz aus konnte Mutter nicht sehen, dass Mei-Ling diskret seine Hand berührte.
Die Leute hielten Second Son für den Dummkopf der Familie. Er war fleißig, kleiner als sein Älterer Bruder und schien immer zufrieden, sodass er bald den Spitznamen Happy erhielt – ein Name, der vermuten ließ, dass er ein wenig einfältig gestrickt sein könnte. Aber Mei-Ling wusste es besser. Sicherlich war er nicht ehrgeizig oder weltgewandt, sonst hätte er sie nie geheiratet. Aber er war genauso intelligent wie alle anderen. Und er war freundlich. Sie waren erst seit sechs Monaten verheiratet, und sie liebte ihn schon.
Seit er hereingekommen war, hatte keine Gelegenheit bestanden, ihm von Nio zu erzählen. Sie war sich sicher, dass er sie anflehen würde, nicht zu gehen, um den Familienfrieden zu wahren. Was könnte sie also tun? Sich im Morgengrauen davonschleichen, ohne es ihm zu sagen?
Im hinteren Teil des großen Raumes spielte der alte Herr Lung mit drei Nachbarn Mah-Jongg.
Herr Lung war immer sehr ruhig. Mit seinem kleinen grauen Bart, seiner Scheitelkappe und dem langen, dünnen Zopf, der ihm über den Rücken hing, sah er wie ein freundlicher Weiser aus. Jetzt, da er zwei erwachsene Söhne hatte, zog er sich befriedigt aus dem Leben zurück und überließ ihnen die meiste harte Arbeit – obwohl er dennoch seine Felder beaufsichtigte und alle Pachten eintrieb. Wenn er durchs Dorf ging, gab er den Kindern Naschereien, aber schuldeten ihre Eltern ihm Geld, stellte er sicher, dass er es bekam. Herr Lung redete nicht viel, doch wenn, dann meist, um den Leuten mitzuteilen, dass er reicher und weiser war als seine Nachbarn.
»Ein Händler erzählte mir einmal«, bemerkte er, »dass er ein Mah-Jongg-Spiel aus kleinen Elfenbeinsteinen gesehen hätte.« Seines war aus Bambus gefertigt. Die armen Leute benutzten Mah-Jongg-Spielkarten.
»Oh, Herr Lung«, fragte einer der Nachbarn höflich, »wollen Sie sich ein Elfenbein-Set kaufen? Das wäre doch sehr elegant.«
»Vielleicht. Aber bislang habe ich so etwas noch nirgendwo entdeckt.«
Sie spielten weiter. Seine Frau sah schweigend von ihrem Stuhl in der Nähe zu. Ihr Haar war straff über den Kopf gezogen, und das betonte ihre hohen Wangenknochen. Ihr Blick war starr auf die Spielsteine gerichtet. Ihre Miene schien darauf hinzudeuten, dass sie, wenn sie mitgespielt hätte, besser abgeschnitten hätte als die anderen.
Nach einer Weile wandte sie sich an Mei-Ling. »Ich habe heute deine Mutter auf der Straße gesehen.« Sie starrte sie unheilvoll an. »Sie hatte einen Jungen bei sich. Einen Hakka-Jungen.« Sie hielt kurz inne. »Deine Mutter ist eine Hakka«, fügte sie unangenehmerweise hinzu.
»Meine Mutter war Hakka«, sagte Mei-Ling. »Sie ist nur zur Hälfte Hakka.«
»Du bist die erste Hakka in unserer Familie«, erklärte ihre Schwiegermutter kalt.
Mei-Ling senkte den Blick. Die Botschaft war deutlich. Die Schwiegermutter gab ihr zu verstehen, dass sie von Nios Besuch wusste und darauf wartete, dass sie das zugab. Sollte sie? Mei-Ling wusste, es wäre besser, es zu tun. Aber eine kleine rebellische Flamme loderte tief in ihr auf. Sie sagte nichts. Ihre Schwiegermutter starrte sie weiterhin an.
»Es gibt viele Stämme in Südchina«, verkündete Herr Lung und sah von seinem Spiel auf. »Die Han zogen ein und beherrschten sie. Aber das Volk der Hakka ist anders. Das Hakka-Volk ist ein Zweig der Han. Sie sind ebenfalls aus dem Norden hierhergekommen. Sie haben ihre eigenen Bräuche, aber sie sind wie Cousins und Cousinen der Han.«
Mutter sagte daraufhin nichts. Sie mochte über alle anderen herrschen, aber sie konnte sich nicht mit dem Oberhaupt des Hauses anlegen. Zumindest nicht in aller Öffentlichkeit.
»Das habe ich auch schon gehört, Herr Lung«, meldete sich einer der Nachbarn zu Wort.
»Das Volk der Hakka ist mutig«, sagte Herr Lung. »Sie leben in großen Rundhäusern. Man sagt, sie hätten sich mit Stämmen aus der Steppe jenseits der Großen Mauer gemischt, mit Leuten wie den Mandschu. Deshalb binden selbst die reichen Hakka ihren Frauen nicht die Füße.«
»Es heißt, dass sie sehr unabhängig sind«, meinte der Nachbar.
»Die machen nur Ärger!«, schrie Mutter Mei-Ling plötzlich an. »Dieser Nio, den du Kleiner Bruder nennst, ist ein Unruhestifter. Ein Verbrecher.« Sie stockte kurz, um Luft zu holen. »Aus der Familie der Mutter deiner Mutter. Er ist nicht einmal mit dir verwandt.« Denn in den Augen der Han-Chinesen zählte eine solche Verwandtschaft auf weiblicher Seite kaum als Familie.
»Ich glaube nicht, dass Nio gegen das Gesetz verstoßen hat, Mutter«, sagte Mei-Ling leise. Sie musste ihn verteidigen.
Die ältere Frau machte sich nicht einmal die Mühe, etwas zu antworten. Sie wandte sich an ihren jüngeren Sohn.
»Siehst du, wozu das führt? Die Ehe ist kein Spiel. Deshalb wählen die Eltern die Braut aus. Anderes Dorf, anderer Clan, reiches Mädchen für reichen Jungen, armes Mädchen für armen Jungen. Andernfalls nur Ärger. Du kennst das Sprichwort: Die Türen des Hauses sollten zusammenpassen. Aber nein. Du bist störrisch. Der Heiratsvermittler findet eine gute Braut für dich. Die Familien sind sich einig. Und dann weigerst du dich, deinem Vater zu gehorchen. Du bringst Schande über uns. Und dann sagst du plötzlich, dass du dieses Mädchen heiraten willst.« Sie starrte Mei-Ling an. »Dieses hübsche Mädchen.«
Hübsch. Das war fast eine Anklage. Jede Bauernfamilie, selbst eine bedeutende Familie wie die Lungs, bestätigte den guten alten Sinnspruch: Die hässliche Frau ist ein Schatz im Haus. Ein reicher Mann wählt vielleicht ein hübsches Mädchen als Konkubine. Aber ein ehrlicher Bauer will eine Frau, die hart arbeitet und für ihn und seine Eltern sorgt. Hübsche Mädchen waren fragwürdig. Sie konnten zu eitel sein, um zu arbeiten. Schlimmer noch, sie konnten von anderen Männern begehrt werden.
Alles in allem, so hatte das Dorf festgestellt, hatte das Verhalten von Second Son bewiesen, dass er ein Narr war.
»Sie stammt aus einem anderen Clan«, wies er freundlich hin.
»Clan? Es gibt fünf Clans in diesem Dorf. Du wählst die kleinste und die ärmste Familie. Und nicht nur das, ihre Hakka-Großmutter war die Konkubine eines Kaufmanns. Er warf sie hinaus, als er auf der Durchreise in die nächstgelegene Stadt war. Sie lässt sich mit einem Gipser ein, und die beiden sind froh, einen armen Bauern zu finden, der ihrer Tochter ein Dach über dem Kopf gibt. Ein undichtes Dach. Das sind die Eltern deiner Braut.«
Während dieser Tirade hielt Mei-Ling den Kopf gesenkt. Auch wenn es verletzend war, war es ihr nicht peinlich. In einem Dorf gibt es keine Geheimnisse. Jeder wusste das ohnehin alles.
»Und jetzt«, schloss ihre Schwiegermutter, »will sie uns Verbrecher ins Haus holen. Und du sitzt nur da und lächelst. Kein Wunder, dass dich die Leute den Dummkopf der Familie nennen.«
Mei-Ling schaute ihren Mann an. Er saß ganz still da und sagte kein Wort. Doch auf seinem Gesicht lag das ruhige, glückliche Lächeln, das sie so gut kannte.
Dieses Lächeln gehörte zu den Gründen, warum die Leute ihn für einfältig hielten. Dasselbe Lächeln hatte er Woche für Woche aufgesetzt, als seine Eltern auf ihn einprügelten, weil er sich weigerte, die von ihnen ausgewählte Braut anzunehmen. Er hatte sogar noch gelächelt, als sie gedroht hatten, ihn aus dem Haus zu werfen.
Und dieses Lächeln hatte geholfen. Er hatte sie zermürbt. Mei-Ling wusste es. Er hatte sie zermürbt, weil er sie wider alle Vernunft heiraten wollte.
»Du hast für meinen älteren Bruder eine gute Ehe geschlossen. Sei damit zufrieden.« Das sagte er ruhig und leise.
Einen Moment lang schwieg seine Mutter. Alle wussten, die Ehe ihres älteren Sohnes mit Willow wäre ideal – sobald sie einen Sohn gebar. Allerdings erst dann. Sie widmete ihre Aufmerksamkeit wieder Mei-Ling. »Eines Tages wird dieser Nio hingerichtet. Je früher, desto besser. Du darfst ihn nicht sehen. Verstanden?«
Alle sahen Mei-Ling an. Niemand sagte etwas.
»Mah-Jongg«, meinte Herr Lung in aller Ruhe und sammelte das ganze Geld auf dem Tisch ein.
Es war Willow, die die Gestalt am Eingang bemerkte, und sie gab ihrer Schwiegermutter ein Zeichen, die sich zusammen mit ihren beiden Söhnen und deren Ehefrauen umgehend ehrfürchtig erhob.
Ihr Gast war ein alter Mann. Sein Gesicht war mager, der Bart lang und weiß wie Schnee. Seine Augen waren vom Alter schmal und in den Winkeln nach unten gerichtet, als ob er fast schliefe. Aber er war dennoch der Dorfälteste. Herr Lung ging auf ihn zu, um ihn zu begrüßen.
»Ich fühle mich geehrt, dass Sie gekommen sind, Ältester.«
Sie servierten ihm grünen Tee, und einige Minuten lang unterhielten sie sich wie üblich. Dann wandte sich der alte Mann an seinen Gastgeber. »Sie sagten, Sie hätten mir etwas zu zeigen, Herr Lung.«
»In der Tat.« Herr Lung erhob sich und verschwand durch einen Türrahmen.
Im hinteren Teil des großen Raumes befand sich eine Nische mit einem großen Diwan, auf dem bequem zwei Personen Platz fanden. Die Frauen stellten nun einen weiteren niedrigen Tisch vor den Diwan. Als dies geschehen war, kam Herr Lung wieder herein und trug seine in Seide eingeschlagenen Errungenschaften. Sorgfältig packte er das erste aus und reichte es dem alten Mann zur Begutachtung, während sich die drei Nachbarn um ihn scharten und ihn beobachteten.
»Als ich letzten Monat in Guangzhou war, habe ich das gekauft«, sagte Herr Lung zum Ältesten. »Die in den Opiumsalons sind aus Bambus gefertigt. Aber diese hier habe ich bei einem Händler gekauft.«
Es war eine Opiumpfeife. Der lange Stiel war aus Ebenholz, der Kopf aus Bronze gefertigt. Um den Teil unterhalb des Kopfes, der als Sattel bezeichnet wurde, verlief ein Band aus hochwertig gearbeitetem Silber. Das Mundstück war aus Elfenbein gefertigt. Die dunkle Pfeife schimmerte sanft. Ein Raunen der Bewunderung ging durch die Menge.
»Ich hoffe, diese Pfeife wird dir gefallen, Ältester, wenn wir heute Abend zusammen rauchen«, sagte Herr Lung. »Sie ist für meine meistverehrten Gäste.«
»Ganz sicher, ganz sicher«, antwortete der alte Mann.
Dann packte Herr Lung die zweite Pfeife aus. Und alle staunten.
Ihr Aufbau war komplizierter. Ein im Inneren verlaufendes Bambusrohr war von einem Kupferrohr umschlossen, und das Kupfer war mit grüner Kantonemaille überzogen, in die zur Verzierung Muster in Blau, Weiß und Gold eingebracht waren. Die Schale war rot glasiert und mit kleinen schwarzen Fledermäusen geschmückt – dem chinesischen Symbol für Glück. Das Mundstück war aus weißer Jade.
»Ah … Sehr kostspielig.« Der alte Mann sprach aus, was alle dachten.
»Wenn du dich auf den Diwan legst, Ältester, bereite ich unsere Pfeifen vor«, sagte Herr Lung.
Das war das Zeichen für die Nachbarn, sich zurückzuziehen. Opiumrauchen war eine private Zeremonie, zu der nur der Älteste geladen war.





























