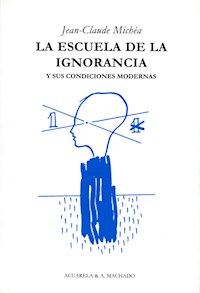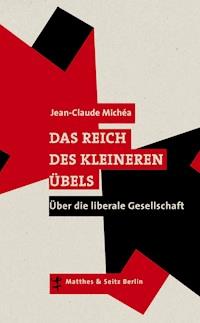
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Mit seinem Essay "über die liberale Gesellschaft" avancierte Jean-Claude Michéa in kurzer Zeit zu einem der meistdiskutierten politischen Philosophen Frankreichs. In seiner ebenso scharfsinnigen wie spitzzüngigen theoriegeschichtlichen Untersuchung des Liberalismus zeigt Michéa, dass sich der kulturelle Liberalismus freier individueller Entfaltung, der heute zum Grundinventar linker Positionen gehört, nicht vom Wirtschaftliberalismus des freien Marktes trennen lässt und immer auf ihn zurückfällt. Gegen die linke Illusion, beide Spielarten des Liberalismus gegeneinander ausspielen zu können, plädiert Michéa für eine Befreiung des Moralischen aus der Sphäre des Privaten und für allgemein verbindliche positive Werte. Nur so gelingt der Auszug aus dem "Reich des kleineren Übels" des Liberalismus. Eine radikale Intervention, die das politische Selbstverständnis von Links und Rechts grundlegend in Frage stellt und herausfordert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 222
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jean-Claude Michéa
Das Reich des kleineren Übels
Über die liberale Gesellschaft
Aus dem Französischenvon Nicola Denis
Für Linda Kizico Hudan.Ohne ihre Menschlichkeit, ihre Bildungund ihre wertvollen Ermutigungenwäre dieses kleine Buch niemals erschienen.
Inhaltsverzeichnis
Vorbemerkung
IDie Einheit des Liberalismus
Anmerkungen
IIMethodenfragen
Anmerkungen
III»Offene Gesellschaft« und Politik der Notwendigkeit
Anmerkungen
IVTractatus juridico-economicus
Anmerkungen
VEgoismus und common decency
Anmerkungen
VIDas Unbewusste der modernen Gesellschaften
Anmerkungen
VIIVom Reich des kleineren Übels zur schönen neuen Welt
Der Ausgangspunkt von Das Reich des kleineren Übels ist ein Vortrag, den ich im Januar 2007 auf Einladung meines Freundes André Perrin im Rahmen eines Fortbildungsseminars für Philosophielehrer an der Académie de Montpellier gehalten habe. In stark überarbeiteter Form bildet er die Hauptachse des ersten Kapitels. Wie alle theoretischen Arbeiten enthält dieser Essay eine Vielzahl von Anmerkungen. Um dem Leser entgegenzukommen, habe ich die den Kapiteln nachgestellten Anmerkungen, die jeweils einer bestimmten Textstelle entsprechen, so abgefasst, dass sie als »Skolien«, sprich als unabhängige kleine Zusätze, gelesen werden können (was gleichfalls für die wiederum den »Skolien« angefügten Anmerkungen gilt). Dieser Essay lässt sich also ohne Bedenken auch linear lesen.
Winston Churchill sagte über die Demokratie, sie sei die schlechteste aller Staatsformen, »abgesehen von allen anderen Formen«. Für den liberalen Geist ließe sich schwerlich eine passendere Formulierung finden. Bezeigt er einerseits einen unverbrüchlichen Optimismus in Bezug auf die Fähigkeit der Menschen, zum »Herrn und Eigentümer der Natur« zu werden, so stellt er andererseits einen tiefen Pessimismus unter Beweis, sobald es darum geht, ihre moralische Fähigkeit einzuschätzen, aus eigener Kraft eine anständige Welt aufzubauen. Wie wir später sehen werden, findet dieser Pessimismus seinen Unsprung in der äußerst modernen Vorstellung, ebenjene Versuchung, hier auf Erden die Herrschaft des Guten und der Tugend einführen zu wollen, sei die eigentliche Quelle aller Übel, die der Menschheit permanent zu schaffen machten. Diese Kritik der »Tyrannei des Guten« hat selbstredend ihren Preis. Sie zwingt uns, die moderne Politik als eine rein negative Kunst zu betrachten, welche die am wenigsten schlechte Gesellschaft entwirft. In diesem Sinne müssen wir den Liberalismus so verstehen, wie er sich selbst versteht: als die Politik des kleineren Übels.
I
Die Einheit des Liberalismus
Eines dürfte außer Frage stehen: Wären Adam Smith oder Benjamin Constant wieder unter uns – womit zumindest das Niveau der politischen Diskussion merklich angehoben würde –, sie hätten die größten Schwierigkeiten, die Rose ihres Liberalismus im Kreuze der Gegenwart1 zu erkennen. Daraus erklärt sich wohl die unglaubliche intellektuelle Verwirrung, die derzeit allenthalben in Bezug auf den Gebrauch dieses Wortes herrscht. Viele würden gerne einen »guten« politischen und kulturellen Liberalismus von einem »schlechten« wirtschaftlichen Liberalismus unterscheiden. Auch die Kritik an Letzterem müsse differenzieren, je nachdem, ob man es mit dem »richtigen« Liberalismus, einem »Neo-« oder »Ultraliberalismus« zu tun habe. Die von mir vertretene These kann für sich immerhin das Verdienst beanspruchen, die Frage zu vereinfachen. In der Tat bin ich der Auffassung, dass die historische Bewegung, die die modernen Gesellschaften tief greifenden Veränderungen unterzieht, grundlegend als logische Erfüllung (oder als Wahrheit) des liberalen philosophischen Projekts zu verstehen ist, so wie es sich seit dem 17. Jahrhundert und insbesondere seit der Aufklärung allmählich ausgeformt hat. Das bedeutet, dass die seelenlose Welt des zeitgenössischen Kapitalismus die einzige historische Gestalt ist, zu der sich die ursprüngliche liberale Doktrin konkret entwickeln konnte. Sie ist, mit anderen Worten, der real existierende Liberalismus. Und zwar, wie wir sehen werden, sowohl in ihrer ökonomischen Variante (die traditionell eher von der politischen »Rechten« bevorzugt wird) als auch in ihrer kulturellen und politischen Variante (deren Verteidigung zur Spezialität der zeitgenössischen »Linken« geworden ist, namentlich der »radikalen Linken«, der vollmundigsten Fraktion des modernen Spektakels).
Meiner These, über die natürlich kein Konsens bestehen kann, müssen unbedingt zwei Erläuterungen vorangestellt werden. Von »liberaler Logik« zu sprechen, setzt zunächst einmal voraus, dass man die Intentionen der verschiedenen klassischen Autoren sorgfältig von den politischen und zivilisatorischen Auswirkungen trennt, die ihr Denksystem – wie ich meine, unvermeidlicherweise – mit hervorgebracht hat. Das ist eine Übung, die den Liberalen nicht fremd sein dürfte, da sie sich mit Adam Ferguson im Allgemeinen darüber einig sind, dass die tatsächliche Evolution der Gesellschaften zunächst »das Ergebnis menschlichen Handelns, doch nicht die Ausführung irgendeines menschlichen Entwurfs« ist. In jedem Fall handelt es sich um eine Übung, die so alt ist wie die Philosophie selbst und letztlich der Methode entspricht, die Platon im anwendet, um die tatsächlichen Gefahren der Sophistik aufzuzeigen. Bekanntlich wird die platonische Kritik in drei Teilen vorgebracht. Der erste Teil des Dialogs stellt die Axiomatik des Gorgias vor, der gewissermaßen den Adam Smith der Rhetorik verkörpert. Auf diesen ersten Schlagabtausch folgt die kritische Prüfung der Standpunkte des Polos, einem Schüler Gorgias’, der es verstand, von manchen philosophischen Implikationen der ursprünglichen Axiomatik Gebrauch zu machen, die sein Meister aus Gründen des persönlichen Anstands gewöhnlich vermieden hatte. Dieses zweite Moment entspricht der »real existierenden Rhetorik« im Athen des 4. Jahrhunderts. Der Dialog endet schließlich mit der Einmischung des Kallikles: eine unabdingbare Fantasiefigur, die für Platon all das symbolisiert, was eines Tages aus der Sophistik werden könnte, wenn sie zum Unglück der Polis alle Möglichkeiten ausschöpfte, die logisch in ihrem Programm angelegt sind. Daraus lässt sich folgern, dass Gorgias zwar nicht mit Kallikles verwechselt werden darf, trotzdem aber in gewisser Weise für sämtliche Folgen, die ein potenzieller »Kallikles« womöglich aus seinen Postulaten ableiten könnte, intellektuell verantwortlich ist.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!