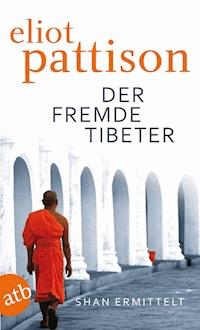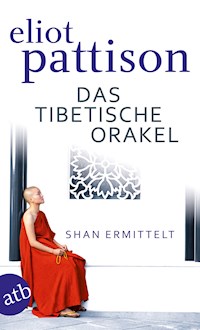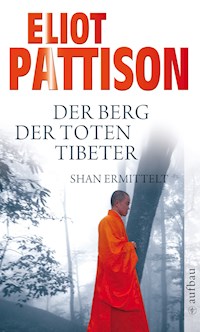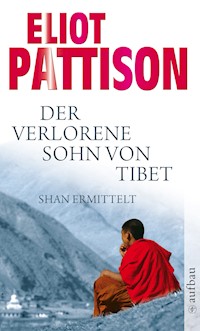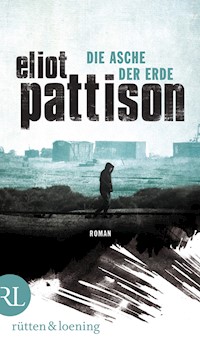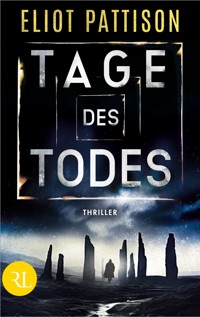9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Magisch und packend.
Der Schotte Duncan ist von den Engländern wegen Hochverrats zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt worden. Doch statt ihn ins Zuchthaus zu werfen, soll er zur Strafe in den neuen Kolonien arbeiten. Schon die Überfahrt ist voller Rätsel und Gefahren. Zwei Morde geschehen, rituelle Zeichen tauchen auf, die indianische Spuren aufweisen, und immer wieder ist von Stony Run die Rede, einem Ort, wo es einen geheimnisvollen Kampf gegen die Indianer gegeben haben soll. Man verlangt von ihm, den Mörder zu finden - oder sein bester Freund findet sich am Galgen wieder ...
Mit seiner Serie um den Ermittler Shan hat Eliot Pattison ein Millionenpublikum begeistert - nur schreibt er über die Besiedlung Amerikas und den Aufbruch in eine die wunderbare neue Welt.
„Ein Roman mit vielen Höhepunkten und überraschenden Wendungen.“ NDR.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 812
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Über Eliot Pattison
Eliot Pattison ist Journalist und Rechtsanwalt. Er ist oft nach Tibet und China gereist und lebt mit seiner Familie in Oley, Pennsylvania. Er hat mit seiner Tibet-Serie um den Ermittler Shan eine Thriller-Serie der Sonderklasse geschrieben.
Sechs weitere Romane aus dieser Serie liegen im Aufbau Taschenbuch vor: »Der fremde Tibeter«, »Das Auge von Tibet«, »Das tibetische Orakel«, »Der verlorene Sohn von Tibet«, »Der Berg der toten Tibeter«, »Der tibetische Verräter« sowie »Der tibetische Agent«
Von Eliot Pattison liegen außerdem ein Roman über den Highlander Duncan »Das Ritual« und der Roman »Die Asche der Erde« vor.
Mehr zum Autor unter www.eliotpattison.com
Thomas Haufschild, geb. 1967, arbeitet seit 1991 als Übersetzer und hat alle Romane von Eliot Pattison ins Deutsche übertragen.
Informationen zum Buch
Magisch und packend.
Als der junge Schotte Duncan von den Engländern im Jahr 1759 in die neuen Kolonien gebracht wird, ahnt er nicht, welche Rolle er dort spielen soll. Schon auf der Überfahrt geschieht der erste Mord – und ein seltsames indianisches Ritual findet statt, das Duncan als Einziger durchschaut. Man verlangt von ihm, den Mörder zu finden – oder sein bester Freund findet sich am Galgen wieder.
Mit seiner Serie um den Ermittler Shan hat Eliot Pattison ein Millionenpublikum begeistert – nur schreibt er über die Besiedlung Amerikas und den Aufbruch in eine die wunderbare neue Welt.
Amerika im 18. Jahrhundert. Der Schotte Duncan ist von den Engländern wegen Hochverrats zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt worden. Doch statt ihn ins Zuchthaus zu werfen, soll er zur Strafe in den neuen Kolonien arbeiten. Schon die Überfahrt ist voller Rätsel und Gefahren. Zwei Morde geschehen, rituelle Zeichen tauchen auf, die indianische Spuren aufweisen, und immer wieder ist von Stony Run die Rede, einem Ort, wo es einen geheimnisvollen Kampf gegen die Indianer gegeben haben soll.
»Ein Roman mit vielen Höhepunkten und überraschenden Wendungen.« NDR
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Eliot Pattison
Das Ritual
Roman
Aus dem Amerikanischen von Thomas Haufschild
Inhaltsübersicht
Über Eliot Pattison
Informationen zum Buch
Newsletter
Die Hauptpersonen
Kapitel Eins
Kapitel Zwei
Kapitel Drei
Kapitel Vier
Kapitel Fünf
Kapitel Sechs
Kapitel Sieben
Kapitel Acht
Kapitel Neun
Kapitel Zehn
Kapitel Elf
Kapitel Zwölf
Kapitel Dreizehn
Kapitel Vierzehn
Kapitel Fünfzehn
Kapitel Sechzehn
Kapitel Siebzehn
Karte
Zeittafel
Nachwort
Impressum
Gewidmet James Fenimore Cooper und Thomas Macaulay – mit Dank und der Bitte um Nachsicht.
Die Hauptpersonen
Duncan McCallum – ein Schotte, der wegen Rebellion gegen die Engländer zu Zwangsarbeit in den Neuen Kolonien verurteilt wird. Hofft dort seinen Bruder zu finden.
Adam Monroe – Schotte und der beste Freund Duncans, aber kein Sträfling. Er reist freiwillig in die Neuen Kolonien. Ein Mann mit einem Geheimnis.
Evering – Professor, soll als Hauslehrer bei Lord Ramsey arbeiten. Er kennt sich mit Kometen und Ritualen aus.
Lister – ein alter schottischer Seemann, Aufseher an Bord der Anna Rose.
Woolford – Offizier der englischen Armee, kennt sich als Ranger mit den Sitten und Ritualen der Indianer aus.
Reverend Arnold – anglikanischer Pastor. Geistlicher Beistand von Lord Ramsey in Edentown.
Lord Ramsey – englischer Adeliger, Herr von Edentown, möchte im Namen der Englischen Krone einen Idealstaat in der Neuen Welt errichten.
Flora – eine unbekannte Frau an Bord der Anna Rose.
Hawkins – ein Trapper, der im Auftrag Lord Ramseys arbeitet, entschiedener Gegner der Indianer.
Tashgua – ein Schamane, der besondere Rituale beherrscht.
Kapitel Eins
September 1759, Nordatlantik
Hoffnung war die tödlichste Sache der Welt – davon war Duncan McCallum nach zwei Monaten auf einem englischen Sträflingsschiff fest überzeugt. Seine Leidensgefährten fielen weder dem Skorbut noch irgendeiner der anderen Schiffskrankheiten zum Opfer, auf die er dank seiner medizinischen Kenntnisse beständig achtgab. Nein, die Hoffnung streckte sie nieder, denn Hoffnung barg die Saat der Verzweiflung, und diejenigen, die einst voller Zuversicht an Bord gekommen waren, verloren auf dem dunklen, nasskalten Gefangenendeck mittlerweile sämtlichen Lebensmut.
»Platz da!«, hörte Duncan einen Mann aus der Nähe des Bugs rufen, gefolgt von Schritten, die in seine Richtung eilten. Er schreckte aus seinem Versteck zwischen zwei Fässern hoch und sprang in die Wanten. Duncan hatte inständig gehofft, diesmal keine Aufmerksamkeit zu erregen, hatte sich sogar eingeredet, er könne im Nebel unbemerkt in den Laderaum zurückkehren. Falls ihm nun aber doch eine erneute Züchtigung bevorstand, würde er sich bei Gott nicht einfach fügen, sondern seinen Wärtern einige Mühe abverlangen und sich selbst etwas Zeit zur Lösung des quälenden Rätsels verschaffen, dessentwegen er sich aus der morgendlichen Warteschlange vor der Essenausgabe fortgestohlen hatte. Sofern es überhaupt ein Gegengift gegen seine eigene Verzweiflung gab, wusste Duncan, wo es zu finden war.
Während er emporstieg, sah er wieder einmal die Gesichter der Toten an sich vorüberziehen. Ian, der stattliche junge Drucker, der nur wenige Stunden vor seiner Hochzeit verhaftet worden war und bei Antritt der Reise Liebeslieder gesungen hatte. An seinem letzten Tag war ein westwärts fahrendes Postschiff längsseits gegangen und hatte einige Briefsendungen übergeben, darunter ein Schreiben seiner Verlobten, in dem sie ihm das Ende ihrer Verbindung mitteilte, weil ihre Eltern ihr keinen Umgang mit einem Verbrecher gestatteten. Ian hatte den Brief stundenlang angestarrt. An jenem Abend war er dann zum Bug geschlichen, hatte sich hingelegt und seine Kehle mit dem Sand gefüllt, der dort in einem Eimer stand. Und Stewart Ross, der Steinmetz und Ingenieur, der sich mitten in der Nacht mit den Zähnen eine Pulsader geöffnet hatte, nachdem er erfahren musste, dass sein einziger Sohn im Krieg gegen Frankreich gefallen war. Doch es war das Antlitz von Adam Munroe, Duncans einzigem echten Freund unter den Häftlingen, das stets vor seinem inneren Auge verweilte. Er konnte sich noch gut daran erinnern, wie Adam lachend einen Rüsselkäfer angefeuert und mit Holzknöpfen auf dessen Rennsieg gewettet hatte. Am folgenden Tag jedoch hatte er auf einmal verdrießlich gewirkt, als habe etwas oder jemand ihn grundlegend verwandelt. Im Laufe der nächsten vierundzwanzig Stunden hatte Duncan dann hilflos mit angesehen, wie Adams Gesicht einzusinken schien und wie das Leben so unaufhaltsam aus seinen Augen wich, als würde ihn nicht nur die innere Stärke verlassen, sondern tatsächlich Blut aus seinen Adern rinnen.
Hätte er Zeit, Papier und Tinte gehabt, hätte Duncan eine Abhandlung über das todbringende Gift der Verzweiflung verfassen und die unterschiedlichen Auswirkungen auf die einzelnen Gefangenen schildern können. Das letzte Kapitel wäre eine Beschreibung seiner selbst gewesen, denn die eigenen Symptome waren ihm beileibe nicht entgangen, wenngleich er sie aus seltsamer Distanz zur Kenntnis nahm. Er hatte den hohlen Blick seines Spiegelbilds im Wasserfass gesehen, hatte die zitternden Hände bemerkt, die Appetitlosigkeit, die plötzliche Besessenheit, mit der er an seine Kindheit in Schottland zurückdachte, die einzige unbeschwerte Zeit seines vierundzwanzigjährigen Lebens. Zu Anfang der Reise in die Neue Welt hatte Duncan sich noch mit der vagen Aussicht auf einen Neubeginn getröstet, doch die ernüchternde Realität des Sträflingsdaseins hatte ihn auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, und nun bestand sein letzter verbliebener Antrieb darin, unbedingt den schrecklichen Tod seines Freundes ergründen zu wollen.
Er stieg hinauf, ohne nach unten zu blicken. Seine Hände und Füße erklommen die Seilsprossen ganz von selbst, wie früher so oft auf den Hebridenbooten seiner Jugend. Er schwang sich von einer Rah zur nächsten. Die Gischt der windumtosten Wogen durchnässte sein schäbiges Hemd und brannte in den offenen Striemen, die er dem letzten Mal verdankte, als die Aufseher ihn an den Mast gebunden und ausgepeitscht hatten. Er nahm Spiere für Spiere denselben Weg wie zwei Tage zuvor Adam, derweil Duncan gewaltsam von den Wärtern zurückgehalten worden war und hilflos hatte zusehen müssen. Adam war auf den Ausguck am Großmast gestiegen, hatte dort etwas ins Holz geritzt und dann spöttisch vor den Offizieren und anderen Seeleuten salutiert, die in der Nähe des Bugs versammelt standen.
Während Duncan nun nach oben eilte, hörte er den Steuermann besorgt etwas rufen. Zweifellos befürchtete der Mann, einer seiner Kameraden könne abstürzen, denn der große Rahsegler stampfte durch schwere See, acht Wochen nach der Abfahrt aus Glasgow, mitten auf dem offenen Ozean. Nebelfetzen wirbelten um die Masten, und Duncan kletterte hektisch immer weiter hinauf. Er wusste, die rachsüchtigen Verfolger würden keinesfalls aufgeben. Ein Verstoß gegen die Haftbestimmungen käme einer tätlichen Schmähung des Königs gleich, hatte der Kapitän verkündet und demjenigen zweieinhalb Shilling versprochen, der Duncan beim nächsten Vergehen als Erster ergreifen würde. Duncan war bereits dreimal entwischt und hatte die Freiheit von Wind und Meer zuletzt eine geschlagene halbe Stunde genossen, bevor er vorn am Bugspriet entdeckt worden war. Mittlerweile war aus ihm der bevorzugte Prügelknabe geworden, das Lieblingsopfer eines jeden Schlägers unter den Matrosen. Der Kapitän hatte gelobt, beim nächsten Vorfall würde Duncan vierzig Peitschenhiebe erhalten und die ganze Nacht an den Mast gefesselt bleiben, damit sein wundes Fleisch der salzigen Gischt ausgesetzt wurde.
Er stieg mit grimmiger Entschlossenheit weiter, schwang sich vom Fockmast herüber und erreichte endlich den Ausguck, die Plattform hoch über Deck, wo Adam eine Weile ausgeharrt und das Holz bearbeitet hatte. Als Duncan die mit einem Nagel eingeritzten Linien sah, war er im ersten Moment zuversichtlich, verlor aber gleich wieder allen Mut. Er hatte auf ein paar erhellende Sätze gehofft, auf eine Erklärung dessen, was seinen Freund so unvermittelt zugrunde gerichtet hatte, oder wenigstens auf geheime Anweisungen zur Entschlüsselung der kryptischen Hinterlassenschaft Adams. Doch sein Freund hatte hier keine Worte eingekerbt, sondern nur zwei primitive Zeichnungen: Eine stellte eine plumpe Kreatur mit rundem Schwanz und ausgebreiteten Schwingen dar, die andere zwei geschwungene Linien, die an beiden Enden zusammenliefen, wie der Umriss des Buchstabens S. Die letzte bedeutungslose Geste eines Mannes, dessen Existenz im Namen des Königs bis auf den letzten Tropfen ausgepresst worden war.
Sobald Adam die Arbeit am Mast beendet hatte, war er an einem Seil zur Backbordreling hinuntergeglitten und auf ihr entlanggerannt, während die Wärter immer näher kamen. Duncan hatte das leere Grinsen seines Freundes bemerkt, sich losgerissen und zu ihm eilen wollen. Im selben Moment hatte Adam einem der Aufseher eine eiserne Fessel von der Schulter gezogen, sie sich um den Hals gelegt und war zum Heck gelaufen. Am Ende der Reling war er einfach weitergerannt und hatte die Kette fest an sich gedrückt. Duncan war einen Augenblick später dort eingetroffen und hatte begriffen, dass sein Freund nicht aufzutauchen gedachte, sondern mit ausgebreiteten Armen in die Tiefe vorstieß. Das Letzte, was Duncan von ihm sah, war eine bleiche nackte Fußsohle, die mit kraftvollem Schwimmstoß in der Finsternis verschwand.
Nun holte Duncan einen dunklen Gegenstand aus der Tasche, eine kleine schwarze Steinfigur von etwa zehn Zentimetern Länge. Als sie an jenem verhängnisvollen Morgen zum Essenempfang an Deck gestiegen waren, hatte Adam mit festem Griff Duncans Schulter gepackt, ihm etwas ins Ohr geflüstert und dann sogleich die Takelage erklommen. Zunächst war Duncan sich gar nicht bewusst gewesen, dass Adam ihm diesen Stein in die Hand gedrückt und seine Finger darum geschlossen hatte, als wolle er den Gegenstand verbergen. Erst mehrere qualvolle Minuten später, nachdem Adam im Meer versunken war, hatte Duncan sich an die Figur und an Adams letzte Worte erinnert.
»Es tut mir leid«, hatte sein Freund ihm zugeraunt. »Sie will nichts mehr mit mir zu tun haben«, hatte er gesagt, als wäre die Figur lebendig. »Ich habe sie enttäuscht. Du bist es, den sie jetzt braucht.«
In den wenigen ungestörten Momenten, die ihm seitdem geblieben waren, hatte Duncan dieses beunruhigende schwarze Ding genau in Augenschein genommen und erwartet, es würde ihm irgendeine Art von Erklärung liefern. Doch es handelte sich lediglich um einen Stein, aus dem jemand ein klobiges, hässliches Geschöpf mit fettem Hintern gemeißelt hatte. Der breite Kopf hing zwischen zwei dicken Vorderbeinen, als würde die Kreatur sich verneigen. In einem Loch auf der Unterseite steckte ein kleiner Zettel. Ich war mutlos, denn nur ein Geisterseher kann verstehen, was getan werden muss, stand dort. Aber nun sehe ich, dass du einer wirst. Lass dich von der Alten an ihr Ziel führen. Auf der Rückseite standen drei weitere hastig hingekritzelte Zeilen. Duncan, ich wollte mich auf keinen Fall mit dir anfreunden, aber ich hätte nie gedacht, dass wir uns so ähnlich sind. Ich erwarte nicht, dass du verzeihst, was ich dir und deinem Clan angetan habe, aber ich bete, dass du es eines Tages zumindest verstehen wirst. Der angebliche Zweck der Company ist in Wahrheit genau das Gegenteil. Die wollen dich benutzen, und dann müssen sie dich töten. Die wissen, wer du bist.
Als Duncan nun die groben Skizzen im Holz anstarrte, machte sich in seinen Eingeweiden ein Gefühl breit, das ihm so schwarz und kalt wie der Stein vorkam. Er war sich so sicher gewesen, hier etwas vorzufinden, das seine Hoffnungslosigkeit lindern und Adams rätselhafte Worte erklären würde, irgendeinen dünnen Strohhalm, an den er sich hätte klammern können. Doch er war völlig umsonst geflohen, und nun würde man ihm wegen der Kritzeleien eines Verrückten die Haut vom Rücken peitschen.
Die wissen, wer du bist. Wieso hatte Adam seinem Rätsel diesen Satz hinzugefügt? Natürlich wusste man, wer Duncan war – ein gewöhnlicher Hochländer, seelisch gebrochen, haltlos, ohne Aussicht, je wieder Fuß zu fassen.
Die Linien im Holz stellten eine absurde Grabinschrift dar, nicht nur für Adam, sondern auch für Stewart und Ian. Es war kein Zufall, dass drei der gebildetsten Männer der Company, eigentlich die prädestinierten Anführer, nun tot waren, denn sie hatten den größten Überblick besessen und die größten Träume gehegt. Sie waren schlau genug gewesen, um zu erkennen, dass die englischen Richter ihnen durch das zugefügte Unrecht sämtliche Türen dauerhaft verschlossen hatten; hätten sie weitergelebt, wären ihnen nur noch Alpträume geblieben.
Er betrachtete die Zeichnungen, bis ein Dunstschleier sich vor sie schob. Dann blickte er auf. Das Schiff war in eine flache Nebelbank vorgedrungen, die alles unterhalb der Plattform in eine dicke weiße Wolke hüllte. Von unten drang kaum ein Geräusch herauf, lediglich ein paar Rufe, die nicht länger wütend, sondern verängstigt klangen, und dazu ein seltsames Wehklagen. Duncan war allein und wurde in Sonnenlicht getaucht, das durch einen Riss in der dichten Wolkendecke hinabfiel. Er hörte das Ächzen der Segel, das Knarren der Takelage. Hier oben jenseits der dichten wirbelnden Schwaden kam er sich vor, als würde er zwischen den Welten schweben, und auf einmal sehnte er sich inständig danach, bei Adam zu sein.
Der Wind trieb den Nebel ein wenig auseinander, und eine Kabellänge voraus war wieder das Meer zu sehen, während das Schiff unter Duncan noch immer in Dunst gehüllt blieb. Riesige Wogen wälzten sich auf den Horizont zu, der von tintenschwarzen Wolken gesäumt wurde. Duncan fühlte sich merkwürdig dünn und unglaublich leicht. Falls er losließ, würde der Wind ihn in den Sturm hinauswehen.
Ein Gefühl durchdringender, schrecklicher Schönheit hatte sich seiner bemächtigt und schien immer stärker zu werden, als würde die Welt ihm etwas zurufen. Erfreue dich an diesem Moment, sagte etwas in seinem Innern. Dies ist Freiheit, wenigstens soweit du sie dir in deinem Leben überhaupt noch erhoffen darfst. Aber an die Stelle seines Herzens war dieses eiskalte leere Ding getreten und breitete sich in seinem ganzen Körper aus. Adams gequälte wirre Worte und seine verrückten Zeichnungen waren einfach nur eine Art Abschiedsgeschenk an Duncan gewesen und hatten dessen letzten Rest Hoffnung aufgezehrt. Mit sonderbarer Erleichterung spürte er, wie die Fäulnis in ihm endlich zur Oberfläche durchbrach.
Er wusste nicht, wie lange er in den Sturm hinausgestarrt hatte, in die Leere von Wind, Wasser und dräuenden Wolken, aber allmählich wurde er sich einer Stimme bewusst, die aus weiter Ferne an seine Ohren drang.
Der Blick in die tosende See enthüllt dir das Antlitz deines Gottes.
Es war die Stimme seines Großvaters, die aus einer jahrelang verschlossenen Kammer seiner Erinnerung ertönte. Als Duncan diese Worte zum ersten Mal gehört hatte – ein kleiner Junge, der bei heraufziehendem Sturm hoch oben auf einer Klippe stand –, waren sie ihm wie eine finstere Warnung erschienen. Nun jedoch, als die raue, krächzende Stimme des alten Mannes über den Zeitraum von fast zwei Jahrzehnten erschallte, musste Duncan wehmütig lächeln. Es war keine Warnung gewesen, sondern eine Herausforderung. Aus irgendeinem Grund wusste Duncan nun, was geschehen war, als die Schaluppe des Großvaters, der damit heimlich Rebellen transportierte, von der Breitseite einer britischen Korvette versenkt wurde. Der alte Clanführer hatte zornig in die dunklen Tiefen geblickt und seinem Gott einen gälischen Fluch entgegengeschleudert, während die eisigen Wogen der Hebridengewässer über ihn hereingebrochen waren.
Duncan ertappte sich dabei, dass er mit den Fingern die runenähnlichen Formen am Mast nachzog. Er hatte sich geirrt. Es ging nicht um die Lösung eines Rätsels, sondern um die Erlösung seiner Person. Erst hatte Adam es ihm gezeigt und nun auch sein Großvater. Manches Schicksal war schlimmer als der Tod, und ein sterbender Clan konnte doch noch über jene triumphieren, die ihn unterjochen wollten. Duncan war bereit, dem Blick seines Gottes standzuhalten.
Das Schiff neigte sich in ein Wellental und befand sich plötzlich außerhalb des Nebels. Duncan hielt sich am Mast fest und spähte vorsichtig über die Kante der Plattform, um nicht gleich wieder entdeckt zu werden. Sie würden ihn bald zu fassen bekommen, diesmal mit Knüppeln und Ketten und fest entschlossen, seinen Rücken in Fetzen zu schlagen.
»Hebt eure Hände!«
Die Aufforderung kam völlig unvermittelt und traf ihn wie ein Hieb. Duncan drückte sich zurück gegen den Mast, so dass der Schmerz in seinen Striemen wieder aufflammte. Dann richtete er den hochgewachsenen, schlanken Leib langsam auf und musterte die tückische Takelage über seinem Kopf. Er würde bis hinauf zur Spitze des Großmasts klettern. Dann brauchte er nur noch auf die richtige Welle zu warten, wenn das Schiff sich auf die Seite legen und er sich dadurch über dem tosenden Wasser befinden würde. Nach unten aufs Deck würde er nicht mehr zurückkehren, auf keinen Fall.
»Schauet das Lamm!«
Duncan wollte schon nach den Seilen greifen, hielt aber inne und blickte erneut über die Kante zu einigen Männern, die unweit des Bugs kauerten, wo ein bärtiger Matrose ein schwarzes Buch schwang. Die Rufe hatten nicht ihm gegolten, sondern den Seeleuten dort unten. Was aber fand dort statt? Eine Totenmesse? Doch er sah keinen in ein Leichentuch gehüllten Körper, keinen ernsten Offizier in steifer Uniform, der die für eine Seebestattung vorgeschriebenen Worte sprach. Es befanden sich sogar überhaupt keine Offiziere an Deck, fiel ihm auf, während salzige Gischt seine Wange traf. Eigentlich hätten überall auf Deck und in den Wanten Matrosen sein müssen, um die Segel zu reffen und das Schiff auf das schwere Wetter vorzubereiten. Duncan erkannte, dass an Bord totenähnliche Stille herrschte, seit man die anderen Gefangenen vor einer Stunde in den Laderaum zurückgebracht hatte. Sogar der Steuermann wirkte beinahe pflichtvergessen, denn er stand neben dem Ruder, hielt es lediglich mit einer Hand und starrte nervös auf das Wasser hinter dem Achterschiff. Duncan war gar nicht verfolgt worden. Die Aufregung hatte einen ganz anderen Grund gehabt.
Von der Gruppe am Bug erklang der ungleichmäßige Chor eines Gebets und wich noch weiter in den Hintergrund zurück, als Duncan den Blick auf die aufgewühlte See richtete. Das Deck schien sich von ihm zu entfernen und aus seinem Bewusstsein zu schwinden. Er brauchte nicht weiter nach oben zu klettern.
Sie hatten den Rand des Sturms erreicht. Duncan hielt sich nur noch mit einer Hand fest und ließ den Wind seinen Körper vom Mast wegdrücken. Er suchte sich eine riesige schwarze Woge in der Ferne aus und schaute ihr entgegen, ließ die Hand allmählich um die Rundung des Masts gleiten und forderte seinen Gott heraus, ihm gegenüberzutreten und sich Duncans gehässigem Spott zu stellen.
Plötzlich legte sich eine starke Hand um seinen Arm und zog ihn zurück.
»Das wäre ein schreckliches Ende, Junge.«
Duncan brauchte nicht hinzusehen. Er erkannte den ältesten der Aufseher an dessen rauer Stimme. »Bloß ein Herbststurm, Mr. Lister.«
»Mach dich nicht über mich lustig, McCallum«, sagte der ältere Mann. »Hab ich einen solchen Blick auf dieser Reise nicht schon viel zu oft gesehen? Ich weiß, was in dir vorgeht, auch wenn du selbst es vielleicht nicht begreifst.«
Duncan schaute sich zu Lister um und hielt verwirrt inne, als er den Schmerz auf dem narbigen, wettergegerbten Gesicht des Mannes sah. Lister war ebenfalls ein Sträfling, genau wie all die anderen Aufseher, von denen die Gefangenen überwacht wurden, ein Kalfaktor, der sich auch außerhalb der Zellen oder verschlossenen Laderäume bewegen durfte. Er hatte den Großteil seines Lebens auf See verbracht, war in der Kriegsmarine gewesen, dann zweiter Maat auf einem der Handelsschiffe, die den Atlantik befuhren – bis man ihn wegen irgendeines Vergehens verurteilte. Von allen Wärtern hatte nur Lister eine gewisse Freundlichkeit an den Tag gelegt, hatte mit Duncan oft über das Meer gesprochen und erst letzte Nacht die Laterne näher an die verriegelte Tür des Gefangenendecks geschoben, um Duncan, der schreibend an der Schwelle saß, etwas mehr Licht zu verschaffen. Die schwarze Woge erreichte und passierte das Schiff. Die beiden Männer hielten sich an der Takelage fest, stemmten sich gegen das Auf und Ab des Masts und musterten einander forschend.
Als Duncan schließlich etwas erwiderte, kam seine Kehle ihm trocken und wund vor. »Adam«, sagte er und wies auf die primitiven Zeichnungen.
»Was für eine schändliche Angelegenheit«, murmelte Lister verächtlich und registrierte dann Duncans fragenden Blick. »Ich kann dir keinen Grund nennen, aber tief im Innern weiß ich, dass wir einen Mord mit angesehen haben, ganz so, als hätte jemand einen Dolch in Munroes Rücken gestoßen. Bei ihm war es anders als bei den anderen. Adam wollte nicht sterben. Er musste sterben.«
Duncan verspürte eine unerwartete Regung. Der alte Seemann hatte die Worte gefunden, die sich Duncans eigenem Herzen die ganze Zeit zu entringen versuchten.
»Das war dieser verfluchte Rotrock«, sagte Lister.
Das Gefühl der Leere legte sich einen Moment lang. Hatte Duncan, was Adams Tod betraf, irgendetwas falsch verstanden? »Lieutenant Woolford?«, fragte er. Es befand sich nur ein Angehöriger der königlichen Armee an Bord.
»Du warst doch dabei. Du hast gehört, wie Woolford sagte, unser Bestimmungsort habe sich geändert und wir würden nun Edentown in der Kolonie New York anlaufen.« Lister fixierte Duncan mit grimmigem Blick. Bis zu Woolfords Ansprache hatten die Führer der Company die Männer in dem Glauben belassen, das Ziel ihrer Reise sei Virginia oder Georgia, wo auf den Tabak- und Baumwollplantagen unzählige deportierte Sträflinge arbeiteten. »Adam ist in der Miliz gewesen«, fügte er sachlich hinzu, als würde das viel erklären. »Das wilde Hinterland von New York ist Kriegsgebiet.«
Duncan sah Lister an und musste abermals an Adams letzte Worte denken. Die wollen dich benutzen, und dann müssen sie dich töten. Er hatte gewusst, dass Adam viele Jahre in der Kolonie Pennsylvania zugebracht hatte, doch sein Freund war den Fragen über das frühere Leben in der Neuen Welt stets ausgewichen. Stattdessen hatte er Geschichten über die Städte und Gasthäuser der Kolonien erzählt und Duncan versprochen, er werde ihm eines Tages Berge und Seen zeigen, die es mit denen in Schottland aufnehmen könnten. »Soll das heißen, Adams Tod hängt mit irgendeinem Vorfall in Amerika zusammen?«
»Ich habe gesehen, wie er bei Woolfords Worten leichenblass geworden ist. An jenem Abend hat er mich um einen Bleistift und ein Stück Papier gebeten. Am nächsten Tag war er tot.«
»Nachdem Woolford unser neues Ziel verkündet hatte, wollte er mit Adam sprechen«, erinnerte Duncan sich. »Adam ließ mich ihm ausrichten, er sei krank, und der Lieutenant möge am nächsten Tag wiederkommen.« Doch es hatte für Adam keinen nächsten Tag mehr gegeben. Duncan dachte kurz über Listers Worte nach. »Vor den Franzosen hat Adam bestimmt keine Angst gehabt.«
»Hab ich was von Franzosen gesagt? In dieser Wildnis lauern Gefahren, die Gott keinem Menschen zugedacht hat.« Lister biss die Zähne zusammen und starrte einer weiteren gewaltigen Woge entgegen, als würde allmählich auch er in dem schnell heraufziehenden Sturm eine Art von Botschaft erkennen.
Nach einem Moment deutete Duncan erneut auf die merkwürdige Tiergestalt, die in den Mast geritzt war. »Wissen Sie, was das sein soll?«
»Ein Biber, würde ich sagen.«
Duncan berührte die Linien mit den Fingerspitzen. »Ich habe noch nie einen Biber gesehen.« Er kannte die pelzigen Biberfellmützen, die in der vornehmen Gesellschaft Englands groß in Mode gekommen waren, aber er hatte bislang keine Vorstellung von der Körperform des Tiers gehabt.
»Eine große runde Ratte mit einem Schwanz wie ’ne Bratpfanne.« Lister runzelte die Stirn. »Aber diese hier hat Flügel.« An Deck wurden wieder verängstigte Rufe laut, gefolgt von den barschen Anweisungen der Offiziere.
Duncan wollte den kalten schwarzen Stein aus der Tasche ziehen und ihn Lister zeigen. »Was hat das wohl zu bedeuten, Mr. Lister?«
Doch der alte Maat schaute hinab zu dem Durcheinander auf Deck und missverstand ihn. Zum ersten Mal bemerkte Duncan die dunkle Verfärbung auf der rechten Seite seines Gesichts, das Grau rund um sein Auge. Jemand hatte Lister einen heftigen Hieb verpasst. »Der Kapitän schickt nach dir«, sagte der Wärter, ohne aufzublicken.
»Um mich wieder auspeitschen zu lassen.« Duncan musterte die Takelage über ihren Köpfen. Auch wenn Adam recht hatte und die Führer der Company ihn für irgendeinen geheimen Zweck benötigten, war es ihnen offenbar gleichgültig, ob er zuvor körperlich und seelisch zugrunde gerichtet wurde.
»Heute nicht. Es gibt mächtig Ärger. Fast alle Matrosen weigern sich zu arbeiten. Irgendein medizinisches Problem. Das Wort des Kapitäns reicht den Männern nicht aus. Wir haben nach Professor Evering gesucht, aber der ist spurlos verschwunden.« Der Gelehrte nahm als Passagier an der Überfahrt teil. »Bestimmt hat er sich vor dem Sturm irgendwo im Laderaum verkrochen. Der Koch ginge womöglich auch, aber jedes Mal wenn ein Unwetter aufzieht, leert dieser Schwachkopf einen halben Krug Rum.«
Duncan schob den Stein zurück in die Tasche. »Ich bin kein Arzt.«
»Die Männer sagen, du hast Anatomie studiert. Ob du dein Leben wegwirfst, geht nur dich und deinen Gott etwas an. Aber hier an Bord gibt es noch hundert andere Seelen, die heute nicht sterben wollen. Es kommt mir wie Teufelswerk vor …« Der alte Seemann warf bei diesen Worten einen Blick über Duncans Schulter, verstummte abrupt und stieß einen Fluch aus. Dann umschlang er mit einem Arm Duncans Leib und klammerte sich mit dem anderen am Mast fest.
Die zweite riesige Woge brach über den Bug des Schiffes herein, begrub ihn unter sich und toste in Richtung Heck, während die Männer an Deck sich laut schreiend auf den nächstbesten Halt stürzten. Für einen langen, schrecklichen Moment verschwand das gesamte Oberdeck in wirbelndem Schaum, und Lister und Duncan waren allein. Nur die drei großen Masten ragten wie Bäume aus der See empor. Der Wind fuhr mit Macht auf sie herab und zerriss das Bramsegel über ihren Köpfen.
Dann kam das Schiff wieder frei, das Wasser strömte von Deck, und der Seegang verlor ein wenig an Stärke. Die Haltetaue des zerstörten Segels gaben nach, die nasse Leinwand fiel flatternd hinab und blieb an den Wanten der Backbordreling hängen. Zwei Matrosen rannten darauf zu, doch das Segeltuch löste sich und fiel über Bord. Einer der Männer beugte sich weit vor, bekam das Segel aber nicht mehr zu fassen. Er taumelte zurück, packte seinen Kameraden am Arm und floh mit entsetzter Miene zu den betenden Männern am Bug. »Es ist zu spät!«, stöhnte er. »Sie kommen uns holen!«
Lister ließ Duncan los und bedeutete ihm, sich auf die Plattform zu setzen. Beim Anblick der panischen Besatzung schüttelte er erbittert den Kopf. »Die meisten dieser Narren stammen aus Cornwall oder von den Westindischen Inseln. Da ist einer abergläubischer als der andere. Falls der Kapitän nicht bald die Ordnung wiederherstellt, ist das Schiff verloren. Ich würde gern weiterleben, Junge.« Er klang fast flehentlich. Als Duncan nichts erwiderte, sah Lister ihn an und seufzte. »Früher gab es mal McCallums an der Westküste des Hochlands, in der Nähe von Lochlash. Sie waren die Gutsherren der kleinen Inseln. Sind das deine Leute gewesen?«
Duncan musterte ihn unschlüssig und nickte zögernd. Dann wandte er sich wieder den verängstigten Männern an Deck zu. Von den anderen Wärtern, die sonst liebend gern auf die Jagd nach Ausreißern gingen, war immer noch nichts zu entdecken. Lister war ein erfahrener Maat. Wenn er das Schiff in Gefahr wähnte, würde er der Mannschaft sicherlich Beine machen. Doch dann fiel Duncan ein, dass auch Lister ein Sträfling war.
»Ein stolzes, eigensinniges Völkchen«, fuhr der Alte fort. »So tapfer wie nur irgendwer in Prince Charlies Armee. Bei Culloden haben die McCallums Seite an Seite mit meinem eigenen Clan gekämpft.« Damit war die letzte verzweifelte Schlacht gemeint, in deren Verlauf die aufständischen Jakobiten Schottlands im Jahre 1746 vernichtend von der englischen Armee geschlagen worden waren.
Duncan blickte erstaunt auf.
Lister sah sich nach allen Seiten um und senkte die Stimme. »Ich trage mich immer mit dem Namen Lister in die Schiffsbücher ein. Man glaubt, ich sei englischer Abstammung und in Glasgow aufgewachsen. Nur wenige wissen, dass ich in Wahrheit McAllister heiße.«
Der alte Maat bedachte Duncan mit ruhigem, wissendem Blick. Familiäre Bande ins Hochland waren riskant. Die Enthüllung dieses Geheimnisses konnte Lister den Aufseherstatus und noch sehr viel mehr kosten. Am Tag vor ihrer Abfahrt hatte die Company, die nahezu vollständig aus Hochlandschotten bestand, antreten und dabei zusehen müssen, wie ein Schafhirte gehängt wurde, weil er unerlaubt Schwerter und Plaids versteckt hatte.
Nach einem Moment schaute der Aufseher kurz zum Achterdeck, wo inzwischen der Segelmeister stand, den Steuermann verwünschte und nach Männern rief, die das Focksegel reffen sollten. Als niemand reagierte, stieß Lister einen Fluch aus und sah dann wieder Duncan an. In seinen sonst so unerschütterlichen Augen lag Sorge. »Es waren schwierige Jahre, Junge. Und du schaust drein wie einer, der vom Schlachtfeld gekrochen ist. Aber du dürftest damals noch ein kleines Kind gewesen sein, am Schürzenzipfel deiner Mutter.«
»Ich war in Flandern auf der Schule. Und meine Mutter hatte längst all ihre Schürzen zu Bandagen zerrissen«, entgegnete Duncan angespannt. »Jemand hat mir eine Zeitung mit einem Bericht der Schlacht zu lesen gegeben. Dort stand, es seien im Anschluss zahllose Männer gehängt worden, als Verräter am englischen König, mit der Anweisung, dass niemand die Toten abschneiden dürfe. Die Namen standen auch dort. Mein Vater und all seine Brüder mussten an den Galgen des Königs vermodern. Einige Wochen später, als man unsere Ländereien in Besitz nehmen wollte, hat meine Mutter einen englischen Offizier mit einem Messer am Arm verletzt. Sie und meine Schwestern haben das Haus nicht lebend verlassen. Ebenso wenig mein sechsjähriger Bruder. Nur wir beide, die wir auf der Schule gewesen sind, haben überlebt.« Duncan war überrascht. Er hatte seit Jahren nicht mehr über jene finsteren Tage gesprochen.
An Deck wurden noch mehr angsterfüllte Rufe laut. Einige Männer deuteten auf eine Stelle jenseits des Hecks.
»Und das Meer wird seine Toten freigeben«, verkündete eine verzweifelte Stimme.
Duncan erkannte die Worte und sah hinab. Ein Matrose rezitierte aus der »Offenbarung«, anstatt das Schiff vor dem Sturm zu schützen. Duncan erschauderte. Es stimmte. Wenngleich der Wind derzeit etwas nachgelassen hatte, lag die volle Wucht des Sturms dicht voraus, und die Besatzung des Schiffes war von einer lähmenden Furcht ergriffen.
»Wir fahren in die Neue Welt, Junge«, sagte Lister. »Du kannst dir dort ein neues Leben aufbauen.«
»Ich hatte ein neues Leben«, gab Duncan verzagt zurück und schaute wieder gen Himmel. »Verwandte in Yorkshire haben mich großgezogen. Ich durfte nie in der Mundart unserer Heimat sprechen und auch nie meine toten Eltern erwähnen. Einen richtigen Engländer haben sie aus mir gemacht, und ich konnte die besten Schulen in Holland und England besuchen. Ich hatte drei Jahre Medizin studiert und sollte der Praxis eines Arztes in Northumbrien beitreten. Dann klopfte vor sechs Monaten der letzte meiner Großonkel an meine Tür und bat mich, ihm Zuflucht zu gewähren. Er war unser letztes Clanoberhaupt und schon über achtzig. Ich hatte geglaubt, er habe sich all die Jahre auf den entlegenen Inseln im Norden versteckt.«
»Nun bitte auch ich dich um Hilfe, genau wie er«, drängte Lister.
»Drei Wochen später kamen sie, um ihn zu holen. Es hieß, er sei ein Straßenräuber. Ich wurde festgenommen, weil ich ihm geholfen hatte, und dann im Namen des Königs zu sieben Jahren Kerker verurteilt. Nach vier Monaten zerrte man mich mehr tot als lebendig aus diesem schimmeligen Loch und vor einen Richter, der mir mitteilte, der König habe beschlossen, Gnade walten zu lassen. Statt Kerkerhaft würde ich sieben Jahre Zwangsarbeit in den Kolonien ableisten müssen.« Er klang verbittert. »Eine Verbannung hat der Richter es genannt. Eine Pilgerfahrt, auf der ich Gelegenheit hätte, über meine Sünden nachzudenken.« Er sah dem Aufseher in das wettergegerbte Gesicht. »Ich hatte ein neues Leben, und jetzt habe ich gar nichts mehr.«
Duncan wusste, dass er nie Arzt werden und nie seinen geheimen Traum erfüllen würde, genug Wohlstand anzusammeln, um den ehemaligen Hochlandbesitz seiner Familie zurückkaufen zu können. Zudem hatte Adam etwas in Duncans Zukunft gesehen, das diesem bislang verborgen blieb. Nach den sieben Jahren Zwangsarbeit winkte ihm nicht die Freiheit. Man würde ihn benutzen und dann töten. Auch Adam war irgendwie benutzt und getötet worden. Duncan wurde abermals von Verzweiflung gepackt. »In meiner Hängematte liegt ein Brief, Mr. Lister. Vielleicht könnten sie ihn ja an meinen Bruder in New York weiterleiten.« Duncan hatte den Großteil der letzten Nacht darauf verwandt, diesen Brief zu verfassen, während die anderen Häftlinge schliefen. Auch sein Bruder war gezwungen gewesen, die Clanvergangenheit hinter sich zurückzulassen. Der englische König, hatte Duncan zum Abschluss geschrieben, hat nun endgültig Vergeltung an unserer Familie geübt.
»Gott weiß, wie leid es mir tut, Junge. Aber es dürfte auf diesem Schiff viele gute Männer geben, die einst die Distel getragen haben«, verkündete Lister in Anspielung auf das alte Wahrzeichen Schottlands. »Ohne deine Hilfe werden auch sie sterben. Und die Männer in den Rattenlöchern.«
Duncan verzog das Gesicht. Die stets verschlossenen Zellen im hinteren Teil des Gefangenendecks waren für die gewalttätigsten der Häftlinge bestimmt, allesamt Mörder. Sie wurden auf Befehl des Königs auf die Westindischen Inseln transportiert, um dort auf den todbringenden Zuckerrohrfeldern zu arbeiten.
»Ein jeder hier hat vor Gericht gestanden und wurde von englischen Richtern verurteilt«, fuhr Lister fort. »Ich kenne dieses Schiff. Der Fockmast ist geschwächt und wird wie ein Zweig umknicken, sobald der Sturm richtig losbricht. Er könnte beim Sturz eine der Frachtluken einschlagen, und dann läuft der Rumpf langsam voll. Die in den Zellen werden als Erste ertrinken.« Er hielt inne. »Redeat«, murmelte er dann. Das hieß Möge er zurückkehren und war ursprünglich ein Wahlspruch der Jakobiten gewesen, bezogen auf die Wiederkehr des schottischen Stuartprinzen. Im Laufe der Zeit hatte es sich jedoch in eine Art Stoßgebet aller Hochländer verwandelt, sozusagen eine Anrufung der Götter Schottlands. »Die Ramsey Company wird untergehen, ohne Gelegenheit, sich zu beweisen«, fügte Lister hinzu. Mit Ausnahme der Zelleninsassen waren alle Häftlinge einem Großgrundbesitzer namens Ramsey unterstellt worden. Reverend Arnold, der anglikanische Pastor, der die Company begleitete, nannte sie eine Gemeinschaft geplagter Seelen, die im Paradies der Neuen Welt Erlösung erlangen würde.
Unten schimpfte jemand lauthals. Ein Offizier verfolgte zwei Matrosen, die mit einem eleganten Stuhl aus einer der Kabinen zum Vorschein gekommen waren. »Was ist denn mit denen los?«, fragte Duncan, als die beiden Männer den Stuhl über die Reling warfen. Ein weiterer Mann tauchte auf und schleuderte Branntweinflaschen ins Meer, wobei er jedes Mal ein banges Gebet aufsagte. Man brachte der See Opfergaben dar.
»Heute früh ist der Teufel erwacht. Du musst dem ein Ende bereiten.«
Duncan verkniff sich die Frage, die ihm unwillkürlich in den Sinn kam. Wie, um alles in der Welt, sollte er den Wahnsinn da unten aufhalten? »Was auch immer ich in mir hatte, das fähig war, anderen Menschen zu helfen, ist auf dem Boden meiner Kerkerzelle zurückgeblieben«, erklärte er verbittert. Er konnte nun Blitze sehen, lange gezackte Strahlen, die über den Horizont schossen.
»Warum gerade heute, Junge?«
»Wir laufen bald in den Hafen ein. Ich werde nicht noch einmal Gelegenheit zur Flucht erhalten. Einem Angehörigen der Company bleibt nur eine Art und Weise, seine Freiheit zum Ausdruck zu bringen. Mein Clan wird nicht in Sklaverei enden.«
»Es sind doch nur sieben Jahre, McCallum. Sei nicht so hochmütig. Du bist noch jung.«
Duncans Blick richtete sich wieder auf die windgepeitschten Wogen. »Wollen Sie etwa andeuten, Mr. Lister, für Leute wie Sie und mich sei ein langes Leben die Mühe wert?«
Nun war es an Lister, zu verstummen und den Blick aufs Meer zu richten. »Was ist aus deinem Großonkel geworden?«, fragte er nach einer ganzen Weile.
»Man hat mich aus meiner Zelle geholt, weil ich unbedingt Zeuge sein sollte. Bei der Urteilsverkündung am Galgen hat man ihn einen reulosen Verräter genannt. Er hat eine Jig getanzt und ausgespuckt, als der Henker ihm die Schlinge um den Hals legte.«
»Ist dein Bruder älter als du?«
»Ein Jahr jünger.«
Diese Auskunft schien etwas in Lister zu bewirken. Er betrachtete Duncan, als wäre es das erste Mal, wobei seine Augen auf merkwürdige Weise funkelten. Dann verzog er das Gesicht, als gefiele ihm nicht, was er sah. »Sieh dich nur an«, knurrte er. »Behandelst du so alle, die vor dir gegangen sind?«
Es war unglaublich, aber die tadelnde Stimme, die Duncan hörte, war die seines Großvaters, ebenso wie der missbilligende Blick, der in den Augen des alten Seemanns lag. Duncan spürte, wie sich in ihm etwas regte, und er wurde sehr still. Den Sturm nahm er gar nicht mehr wahr. Lister hatte eine weitere lange verschlossene Kammer in Duncans Erinnerung aufgestoßen, eine Kammer voller Alpträume, in denen der verwesende Leichnam seines Vaters vom Galgen auf ihn zeigte und ihn beschuldigte, den Clan im Stich gelassen zu haben, um Engländer zu werden.
»Hast du vergessen, was es heißt, der Älteste zu sein?«
»Nein, ich … ich konnte nicht …«, stammelte Duncan nach einem Moment. Eine andere, diesmal jedoch oft besuchte Kammer enthielt Erinnerungen an lange Tage in Gesellschaft seines Großvaters. Ehrfürchtig hatte der Junge dem heißblütigen alten Schotten dabei zugesehen, wie dieser die Pflichten eines Clanältesten wahrnahm, die Unschuldigen schützte, die Speisekammern der Armen füllte, für harte Gerechtigkeit unter den Lehnsmännern der weit verstreuten Inseln sorgte, die traditionell den McCallums unterstellt waren, und sogar Ertrinkende rettete, denn sein Großvaters war der beste Schwimmer weit und breit gewesen. »Mein Clan wurde ausgelöscht.«
»Solange du und dein Bruder atmen, gibt es einen Clan.«
Duncan sah Lister verwundert an. Während all der Tage voller Qualen seit seiner Verhaftung war ihm nie dieser Gedanke gekommen. Die Henker seines Onkels hatten Duncan zum Clanoberhaupt gemacht.
»Mein Gott, McCallum!«, zischte Lister. »Hör auf zu jammern! Du bist durch dein Blut mit deinem Clan verbunden, mit den Lebenden und den Toten, mit allen, die die Distel tragen. Auf diesem Schiff geht der Tod um, und falls es Überlebende gibt, wird man den Schotten die Schuld zuschieben. Was wird ein Clanführer dagegen tun?«
Duncan blickte von Lister zu dem Sturm, der sie fast erreicht hatte. Er wusste keine Antwort.
»Was ist, wenn es stimmt, was Reverend Arnold vor kaum einer Viertelstunde gesagt hat? Was ist, wenn du der Einzige bist, der das Schiff retten könnte?«
»Arnold?« Arnold war derjenige, der Duncan vom Gerichtsgebäude mitgenommen und auf das Sträflingsschiff gebracht hatte. »Ich bin ihm nichts schuldig.«
»Und wenn es stimmt, dass der Professor deine Hilfe braucht?«
Duncan wandte sich zu dem alten Seemann um. »Evering?«
»Als Adam an seinem letzten Abend an der Luke gesessen hat, sagte er, ich solle dir ausrichten, Evering habe den Schlüssel zu unser aller Rettung gefunden, wisse aber nicht, wie man ihn benutzen müsse. Er sagte, ich solle McCallum helfen, den Professor zu beschützen.«
Duncan schaute wieder auf die Wellen, um sich seine Überraschung nicht anmerken zu lassen.
»Er sagte, du solltest darauf achten, wie Evering seinen Kometen erklärt«, fügte Lister verwirrt hinzu. »Rette uns«, wiederholte er. »Denn sonst müssen wir alle sterben.«
Duncan hielt sich an einem Seil fest und lehnte sich hinaus, als könne der Wind seinen Verstand klären. Der Sturm rief immer noch nach ihm, aber in einem Winkel seines Gehirns zählte eine leise Stimme bereits die Möglichkeiten auf, Evering in seinem Versteck im Laderaum ausfindig zu machen. Nein, er konnte unmöglich nach dort unten, ohne von den anderen Aufsehern erwischt zu werden.
»Meine Großmutter war eine McCallum von einer deiner Inseln«, sagte Lister, als Duncan nichts erwiderte. »Mein Clan wurde ebenfalls zerschlagen, Junge, und seine Asche ist im Wind verweht. Früher einmal stammten wir alle von denselben Inseln.« Der alte Maat bekam die Worte nur mühsam über die Lippen.
»Was wollen Sie damit sagen?«
Lister strich mit den Fingerspitzen nachdenklich über Adams Zeichnungen im Holz und sah Duncan dann ernst an. »Ich ersuche dich um Schutz, Clan McCallum«, sagte er langsam und bedächtig und wählte dabei eine der traditionellen Anreden eines Clanoberhaupts. »Ich versichere dich meiner Gefolgschaft.«
Duncan spürte, wie sein Mund sich zu einem schmerzlichen Lächeln verzog. »Sie verpflichten sich einem verurteilten Strafgefangenen? Was soll diese Farce, Mr. Lister? Ich bin ein Niemand. Sogar weniger als das.« Duncan war allenfalls ein schwacher Schatten seines Großvaters. Doch sein Lächeln erstarrte, als er Listers ernste, gekränkte Miene bemerkte. Es war ein alter Brauch, dass Hochländer einem durch Blutsbande verwandten Clan im Austausch für dessen Schutz ihre Loyalität anbieten konnten.
»Ich gebe dem Herrn des McCallum-Clans mein Wort.«
Duncan verfolgte wie betäubt, dass Lister sich in die Hand spuckte und sie ihm entgegenstreckte.
»Gott sei mein Zeuge«, verkündete der alte Seemann feierlich.
»Man will meinen Tod«, sagte Duncan. »Und ich kenne nicht mal den Grund dafür.«
»Im Land unserer Väter wäre das eine Auszeichnung, Junge. Nach meiner Erfahrung sind die besten Clanführer schwieriger zu bezwingen als ein wilder Ochse, und wenn sie am Ende sterben, dann zu ihren eigenen Bedingungen. Ein Gefangener des Königs findet leicht den Tod. Ein Clanoberhaupt hingegen hat die Pflicht, am Leben zu bleiben, und sei es nur, um dem König eins auszuwischen.«
In der Heimat hatte es zur Einführung eines neuen Clanführers stets eine prächtige Zeremonie gegeben, mit Dudelsäcken und Schwerttänzen. Um die Dämonen zu vertreiben, schlug man mit geknoteten Seilen auf den Boden zu Füßen des Amtsträgers und brachte ihm dann ein Bündel getrockneter Disteln dar. Aber in einer Welt, in der Dudelsäcke und Tartans verboten waren, litten auch die Traditionen.
Duncan ließ zu, dass Listers schwielige Finger sich um die seinen schlossen, und erwiderte verunsichert den Händedruck. In diesem Moment frischte der Wind wieder auf, wechselte die Richtung und drückte das Schiff zur Seite, so dass es eine Zeitlang unmittelbar vor einer hohen, von achtern kommenden Woge fuhr.
»Jesus, Maria und Josef!«, stöhnte der alte Maat und klammerte sich wie eine Landratte an den Mast.
Als Duncan seinem Blick folgte, überkam ihn ein eisiger Schauder. In der Wasserwand hinter dem Heck hing ein Mann, das fahle Gesicht auf das Schiff gerichtet, mit einem Arm winkend, als fordere er die Besatzung auf, sich zu ihm zu gesellen. Deshalb hatten die beiden Matrosen, die das heruntergefallene Segel bergen wollten, sich so erschrocken. Es ist zu spät, hatte einer von ihnen gerufen, sie kommen uns holen.
»Die Toten werden sich erheben«, sagte Lister mit hohler Stimme. Er klang zum ersten Mal wirklich verängstigt.
Duncan bewegte sich nicht willentlich, sondern schien nur dabei zuzusehen, wie sein Körper an den Rand der Plattform trat, ein Tau griff und flink nach unten kletterte.
»Ein Häftling!«, schrie einer der Aufseher und rannte auf Duncan zu. Ein Arm legte sich um seinen Hals. Ein anderer Mann rammte Duncan einen Ellbogen in die Seite und wollte ihn niederschlagen. Duncan riss sich los und lief zur Backbordreling.
»Das ist McCallum! Lasst ihn in Ruhe!«, befahl Lister hinter ihm, als ein junger Matrose sich auf Duncan stürzte, um ihn niederzuringen.
»Er ist kein Verfolger!«, rief Duncan und wies auf die Reling. »Der Mann wird mitgezerrt!« Der Matrose ließ ihn zögernd los und half Duncan dann dabei, die Knoten zu entwirren, mit denen ein Fass an der Reling befestigt war. Duncan deutete auf eine Strebe hinter der Tonne. Dort war ein Seil angebunden, das über Bord hing und bereits etwas Holz abgescheuert hatte.
»Eine Rettungsleine!«, keuchte der Matrose, während er und Duncan das Fass beiseite schoben und anfingen, das Seil einzuholen.
Lister kam hinzu und half ihnen. »Was nützt eine Rettungsleine, wenn niemand dich über die Reling kippen sieht?«, murmelte der Aufseher. »Das hier war bloß ein Unfall«, fügte er hinzu, als wolle er die sich um sie versammelnden Männer beruhigen. Doch als sie die schaurige Last an Deck hievten, zuckte sogar Lister zusammen und wich ächzend zurück. Das Seilende war nicht um die Taille des Mannes geknotet, sondern um dessen Hals.
»Professor Evering!«, rief der junge Matrose entsetzt, fasste sich an den Bauch und erbrach sich über die Reling.
Duncan verspürte einen Stich im Herzen. Er zwang sich, in das bleiche Gesicht zu sehen, dessen braune Augen überrascht ins Leere emporstarrten. Es handelte sich tatsächlich um den freundlichen Professor mittleren Alters, der diese Reise angetreten hatte, um für die Familie Ramsey als Hauslehrer tätig zu werden. Und Evering war es auch, der angeblich eine Möglichkeit gefunden hatte, Duncan vor dem drohenden Tod zu bewahren.
»Das Seil«, stellte Duncan mit heiserem Flüstern fest. »Sein Arm hatte sich in dem Seil verfangen. Deshalb sah es so aus, als würde er uns zuwinken.«
»Hier waren Menschen am Werk, nicht Dämonen«, teilte Lister den verängstigten Seeleuten mit, die aber nicht darauf reagierten. Er verzog das Gesicht und bedeutete Duncan, ihm zu der Luke unterhalb des Ruders zu folgen. »Der Kapitän«, raunte er finster.
Wenig später standen sie in der Kammer, die von den Seeleuten Kompassraum genannt wurde. Der Schiffszimmermann hatte hier zwischen einigen Kisten, auf die der Name der Ramsey Company aufgemalt war, ein kleines Podest errichtet. Darauf lag der elegante Kompass, den Lord Ramsey bei einem Londoner Handwerker in Auftrag gegeben hatte und der im Verlauf der Reise abschließend kalibriert werden sollte. Lister schob Duncan auf einen Kreis grimmig dreinblickender Männer zu, darunter der bärtige Kapitän und sein Erster Offizier sowie Reverend Arnold, der strenge Anglikaner, der an Bord regelmäßige Gottesdienste abhielt, und Lieutenant Woolford, der Armeeoffizier, der mit ihnen nach New York fuhr. Dahinter drückten sich im Schatten mehrere Matrosen herum; manche von ihnen beobachteten verstört den Kapitän und dessen Begleiter, und einer kniete sogar und betete, während Tränen über seine Wangen rannen.
Lister raunte dem Kapitän etwas ins Ohr.
»Ihr verdammter Narr von einem Gelehrten!«, herrschte der Kapitän den Pastor an und wirbelte dann zu Duncan herum. »War Everings Brustkorb geöffnet?«
Duncan starrte ihn verwirrt an.
»Lässt sich denn so schwer feststellen, ob ein Mann sein Herz verloren hat?«, schimpfte der Kapitän. »Red schon, oder bist du blind?«
»Sein Körper schien unversehrt zu sein«, stotterte Duncan und suchte in den Mienen der anderen vergeblich nach einer Erklärung.
Der Kapitän stieß einen Fluch aus, schickte den Ersten Offizier an Deck, packte Duncan dann unvermittelt, zerrte ihn in den Kreis und zeigte auf den Kompass. »Da! Stammt das von einem Menschen?« Seine Stimme war zornig, aber in seinen Augen lag eindeutig Angst.
»Ich verstehe nicht, was …« Duncans Blick fiel auf das Podest, und die Worte blieben ihm im Hals stecken. Der Kompass war voller Blut. Unten vor dem Postament hatte jemand mehrere Gegenstände zu einem kleinen Kreis angeordnet: die Feder eines großen Vogels, zwei Häufchen kleiner Knochen, eine riesige schwarze Kralle, eine metallene Schnalle, ein gelbes Auge von fünf Zentimetern Breite und – gebettet auf einen flachen Salzhügel – ein großes blutiges Herz. Am Rand des Kreises, gegenüber dem Podest, stand eine kleine Kohlenpfanne, wie sie bisweilen vom Koch benutzt wurde. In ihr schwelten die Reste einer Tabakrolle. Oberhalb des grausigen Zirkels hing von einer der Messingstellschrauben ein Riemen mit einem bunten Ledermedaillon. Duncan erkannte es sofort. Er hatte es oft um Adam Munroes Hals hängen gesehen.
Sein Blick blieb nicht an dem Kreis, sondern an dem Schmuckstück haften. Es war, als sei Adam zurückgekehrt, um Duncan an seine Pflicht zu erinnern. Er wich unwillkürlich zurück, bis der Kapitän ihn am Kragen fasste und so grob zu dem Podest stieß, dass er zu Boden fiel. »Keiner der Matrosen wird sich in die Wanten trauen!«, brüllte er. »Die haben nur Ohren für die alten Schwachköpfe, die irgendwas von einem Fluch faseln und behaupten, man habe einem der Männer das Herz aus dem Leib gerissen. Angeblich sind die Toten dieser Reise mit dem Sturm zurückgekehrt, um uns zu holen.« Der Kapitän biss die Zähne zusammen, um sich offenbar ein wenig zu beruhigen. »Die Hälfte der Mannschaft versteckt sich irgendwo unter Deck, so dass wir nicht mal alle durchzählen können, um herauszufinden, ob einer fehlt. Du magst zwar ein unverschämtes Großmaul sein, ein abscheulicher Dieb, der ehrliche Passagiere bestiehlt, doch jetzt …«
»Ich habe noch nie gestohlen …«, wollte Duncan protestieren, aber der Kapitän trat ihm in den Bauch.
»… jetzt erzählt der gute Reverend uns auf einmal, dass du ein Anatom bist, dass du Gott liebst und der Company dienst, dass die Männer auf dich hören werden. Das Auge dürfte von einem großen Fisch stammen. Doch das Herz … Sag meinen Leuten, dass sie nichts zu befürchten haben. Sag ihnen, dass niemand getötet wurde. Der Koch liegt besoffen in seiner Hängematte. Wir haben Vieh an Bord, als Frischfleisch für die Kombüse. Er könnte uns sagen, ob das Herz zu einem der Tiere gehört. Aber wir können nicht so lange warten. Brich diesen verdammten Zauber! Sag es ihnen, McCallum, sofort!«
Duncan sah jedoch nicht das blutige Herz an. Sein Blick wanderte von dem Medaillon zu dem anglikanischen Geistlichen, dem hohlwangigen Mann in Schwarz. Duncan hatte bisher kaum ein Wort mit ihm gewechselt. Der Reverend war während der Reise zumeist in seiner Kabine im Vorderschiff geblieben, genau wie Lieutenant Woolford und Professor Evering. Falls man den Gerüchten Glauben schenken durfte, gab es dort noch einen weiteren Passagier, der allerdings zu krank war, um sich aus dem Bett zu erheben.
»Auch Reverend Arnold bittet dich, uns behilflich zu sein«, fügte der Kapitän angespannt hinzu. Es klang eher bedrohlich. Arnold nickte ermutigend.
Als Duncan aufblickte, sah er, dass die Hand des Kapitäns auf dem Kolben einer großen Pistole lag, die in seinem Gürtel steckte. »Ist dir klar, was auf dem Spiel steht?«, schrie der Mann. »Meine Besatzung hat sich in einen Haufen feiger Memmen verwandelt! Ohne sie ist das Schiff verloren!« Er zog die Waffe und zielte auf Duncans Kopf. »Mensch oder Tier?«
Duncan griff nicht nach dem Herzen, sondern nach der langen gescheckten Feder, und drehte ihren Schaft zwischen den Fingern, um sie besser in Augenschein nehmen zu können. Sie stammte nicht von einem Meeresvogel, sondern von einem Falken. Diese Raubvögel waren an Land beheimatet, und das Schiff befand sich schon seit Wochen auf hoher See. Am oberen Ende der Feder hatte jemand zwei schräge zinnoberrote Streifen aufgemalt. Mit dem Kiel der Feder rollte Duncan das Herz auf die Seite. In einer der Arterien steckte ein runder silberner Gegenstand. Duncan berührte die Kralle und überlegte, ob er sie als Werkzeug benutzen sollte, um das Objekt zum Vorschein zu bringen. Sie war so groß wie sein Zeigefinger und an der Spitze messerscharf. Ein Tier mit solchen Klauen hatte er noch nie gesehen.
»So haben die Dämonen das Herz herausgerissen!«, stöhnte jemand im Schatten.
»Schwarzer Hochlandzauber!«, rief ein anderer. »Werft die verdammten Clansmänner über Bord!«
Duncan hob den Kopf und fühlte Listers Blick auf sich ruhen. Man würde den Schotten die Schuld zuschieben, hatte der Aufseher ihn gewarnt. Ein Clanführer habe die Pflicht, sie zu beschützen.
»Wer hat Zutritt zu diesem Raum?«, fragte Duncan den Kapitän. Er achtete nur auf die Pistole in der rechten Hand des Mannes und sah daher nicht dessen linke Faust kommen, die an seine linke Schläfe krachte.
Der Kapitän spannte den Hahn der Waffe. »Du verfluchter Hochländer! Ich werde nicht zulassen, dass ein geflohener Sträfling mein Schiff in Gefahr bringt. Du weißt, was du zu tun hast, wenn du in einer Minute noch am Leben sein willst!«
»Geliebter Vater«, warf eine ruhige Stimme ein, »bitte führe diese arme Seele in der Stunde unserer größten Not.«
Duncan fragte sich, welche der anwesenden armen Seelen Reverend Arnold wohl gemeint haben mochte. Da wurde über ihnen ein neues Geräusch laut, ein leises Heulen, das nicht vom Wind stammte, gefolgt von noch mehr ängstlichen Rufen.
Einer der Männer im Hintergrund rannte aus dem Raum, dann noch einer. »Eine Seehexe!«, kreischte eine panische Stimme an Deck. Als der Kapitän sich umwandte, schnappte Duncan sich Adams Medaillon, sprang an Arnold vorbei und durch die offene Luke hinaus. Lister folgte ihm, der fluchende Kapitän ebenfalls.
Als Duncan das Oberdeck betrat und das Medaillon einsteckte, fand er dort ein Dutzend Männer vor. Drei saßen vor einer festgezurrten Kiste und hoben schützend die Arme vor die Augen, wobei einer noch zusätzlich eine Axt zwischen den Füßen hielt. Zwei andere mühten sich mit einem langen Tau ab, das hoch oben vom Fockmast herunterhing, und befestigten es an einem dicken Pfosten der Reling; auf diese Weise wurde dem Mast, der laut Lister geschwächt war, bei schlechtem Wetter zusätzliche Stabilität verliehen. All die anderen starrten mit äußerstem Entsetzen eine bleiche Gestalt auf der untersten Rah des Fockmasts an. Es war eine junge barfüßige Frau in einem weißen Kleid. Ihr langes dunkles Haar wirbelte um ihren Kopf.
Das war unmöglich. Es gab an Bord keine Frauen, abgesehen von dem stämmigen Eheweib des Kapitäns und einigen Mörderinnen, die tief unter Deck dauerhaft in ihren Zellen eingeschlossen waren. Duncan schaute zu Lister. Der Aufseher sah nicht die Frau, sondern ihn an, mit der gleichen tadelnden Miene wie zuvor, als sei Duncan dafür verantwortlich, dass die Fremde geflohen war und sich offenbar umbringen wollte. Lister hatte ihn daran erinnert, dass alle Zelleninsassen Schotten waren. Als ihre Blicke sich nun trafen, stieß der alte Maat nur ein einziges grimmiges Wort aus, das im heftigen Wind kaum zu verstehen war. »Redeat.« Sein Stoßgebet für alle Schotten.
Die Frau schien die Rah entlangzugleiten, völlig ungeachtet des tückischen nassen Holzes. Als sie das Ende erreichte, legte sie eine Hand um das schmale, diagonal verlaufende Halteseil, das die Spitze der Rah mit dem Mast verband. Ihr Gesicht war nach vorn auf den sich verfinsternden Horizont gerichtet, und die andere Hand wies mit ausgestreckten Fingern gen Himmel.
»Banshee!«, rief der Matrose unmittelbar neben Duncan. »Sie befiehlt den Sturm auf uns herab!« Einer der Männer am Stütztau ließ von dem losen Seilende ab, zog zwei hölzerne Klampen aus der Reling und schleuderte sie nach der Frau. Die ignorierte die Wurfgeschosse, die dicht an ihrem Kopf vorbeiflogen.
»Banshee!«, wiederholte ein anderer Mann, als der Kapitän an Deck erschien. Beim Anblick der Frau erstarb dem Offizier der Fluch auf den Lippen und wurde zu einem gequälten Stöhnen.
In der Ferne zuckten Blitze. Das tiefe Donnergrollen schien dem Meer zu entspringen, nicht dem Himmel.
»O Herr, ich flehe dich an!«, keuchte eine hektische Stimme. Reverend Arnold stand an der Seite des Kapitäns. »Woolford!«, rief der Geistliche und wandte sich zu dem Kompassraum um.
Die Frau hielt kurz inne und schaute zögernd hinab zu Duncan und den Männern hinter ihm. Ihr anmutiges Gesicht war von tiefem Kummer gezeichnet. Dann blickte sie wieder hinaus aufs Meer und stieg über das Ende des Halteseils.
Die Rufe verstummten. Sogar Arnold hielt in seinen inbrünstigen Gebeten inne. Alle Augen waren auf die Frau gerichtet, die nun das Seil losließ, beide Hände zum Himmel emporreckte, mit nur noch einem nackten Fuß auf der schwankenden Rah stand und den anderen um das untere Ende des Seils gehakt hatte. Als das Schiff sich zur Seite neigte und die Spitze der Rah sich hoch über das Deck hob, schien ein Sturz unabwendbar zu sein, aber wie durch ein Wunder geriet die Fremde nicht aus dem Gleichgewicht. Das Schiff richtete sich wieder auf. Duncan sah Lister in die Wanten des Fockmasts springen und eilig hinaufklettern, unmittelbar gefolgt von Lieutenant Woolford. Doch sobald das Ende der Rah sich wieder über dem Wasser befand, streckte die fahle Gestalt ihre Hände noch ein Stück höher und nahm ihren Fuß von dem Seil, das ihr Halt gegeben hatte.
Sie schien einen Moment lang in der Luft zu schweben, dann fiel sie langsam in die Tiefe. Ihr weißes Kleid blähte sich vor dem schwarzen Himmel, und ihre blassen Arme zeigten unverwandt nach oben.
Niemand sprach. Niemand rührte sich – außer Duncan. Ohne lange nachzudenken, griff er sich die Axt, hackte mit einem einzigen kräftigen Hieb das Stütztau des Fockmasts los und knotete sich das Ende um den Leib. Aus dem Augenwinkel registrierte er die auf ihn gerichtete Pistole. »Ergreift ihn!«, befahl der Kapitän. Dann schoss eine Stichflamme aus dem Lauf der Waffe. In Duncans Brustkorb brandete ein gewaltiger Schmerz auf. Er wurde zurückgeschleudert, kippte über die Reling und stürzte hinab in die brodelnde Finsternis.
Kapitel Zwei
Duncans Hölle war ein kalter schwarzer Ort auf dem Meeresgrund. In seiner Jugend hatte er des Öfteren Predigten über sich ergehen lassen müssen, in denen die Qualen der reulosen Sünder beschrieben wurden, und als er nun nass, frierend und zitternd in der Dunkelheit zu sich kam, fragte er sich, in welcher Hölle seine verlorene Seele gelandet sein mochte.
Auf einmal jedoch fing der Boden an zu schwanken, und seine stark schmerzenden Rippen verrieten ihm, dass er nicht gestorben war. Er fiel gegen eine Wand aus dicken Planken. Dann beförderte ein plötzliches Aufbäumen des Decks ihn gegen eine andere Wand. Er breitete die Arme aus und stand auf. In welchem Teil des Schiffes befand er sich? Es handelte sich um eine kleine Kammer von rund zwei Metern Länge und sogar noch geringerer Breite. Duncan war etwas über einen Meter achtzig groß, konnte sich hier drinnen aber nicht vollständig aufrichten. Der Boden war mit fauligem Stroh bedeckt. Eine der Wände war im unteren Teil nach innen geneigt, und er konnte darin oder dahinter eine Bewegung spüren. Ein Geschöpf auf der anderen Seite ächzte wütend und drückte mit aller Macht gegen die Wand, als wolle es sich einen Weg ins Innere bahnen. Nein, erkannte er mit jähem Schrecken, er befand sich unterhalb der Wasserlinie, und was dort an die Planken schlug, war die gefräßige See. Hektisch tastete er den gesamten Raum ab. An einem Haken in der Ecke hing ein großes Stück Segeltuch, und in der gegenüberliegenden Wand gab es eine schwere Tür. Doch die schmale Pforte hatte keinen Riegel und ließ sich nicht öffnen.
Duncan keuchte verzweifelt auf. Er steckte in einer der Zellen, die sonst den Mördern vorbehalten waren. Lister hatte behauptet, das Schiff werde sinken, und nun war Duncan in einem der Rattenlöcher eingesperrt und würde wie alle anderen ertrinken. Er lief auf und ab, sein Herz raste, und die Stelle an seiner Seite, wo die Kugel des Kapitäns ihn gestreift hatte, fühlte sich feucht und taub an. Vergeblich versuchte er sich zu erinnern, was geschehen war, nachdem das schwarze Wasser über seinem Kopf zusammengeschlagen war. Was hatte er getan, dass man ihn in diesen übergroßen Sarg einschloss? Erst hatte er unbedingt sterben wollen, und dann, nachdem er mit Lister gesprochen und Adams Medaillon gesehen hatte, war plötzlich sein Lebenswille erwacht.
Irgendwo über ihm wurden ängstliche Rufe laut. Jemand forderte, die Pumpen sollten bemannt werden, ein anderer verlangte nach einer Bibel. Duncan hörte, dass vor der Tür Wasser vorbeiströmte, und merkte erschrocken, wie sich zu seinen Füßen eine Pfütze bildete. Er hämmerte an die Tür, bis seine Fäuste wehtaten; dann geriet das Schiff ins Schlingern, Duncans Kopf schlug gegen die Wand, und er verlor erneut das Bewusstsein.
»Schwarzer Schlangenwind, schwarzer Schlangenwind, komm hervor.«
Der leise, unheimliche Singsang hallte durch Duncans Alptraum, während er allmählich wieder zu sich kam. Die seltsamen Worte wiederholten sich immer und immer wieder, kamen von überall und nirgendwo. Duncan zwickte sich, riss die Augen auf und drückte sogar auf die Wunde an seiner Seite. Der jähe Schmerz ließ ihn sich aufsetzen.
»Schwarzer Schlangenwind, schwarzer Schlangenwind, komm hervor.«
Er war wach, aber der Alptraum hörte nicht auf.
Der Sturm hingegen schien sich gelegt zu haben. Das Meer kämpfte nicht länger mit dem Schiffsrumpf, und das Wasser war aus der Zelle abgeflossen. Duncan zog sich die nasse Kleidung aus und wickelte sich in das Segeltuch. Dann saß er in der schwarzen Leere da und lauschte dem bedrückenden, wehmütigen Gesang. Er begriff, dass ihm nicht etwa sein Verstand einen