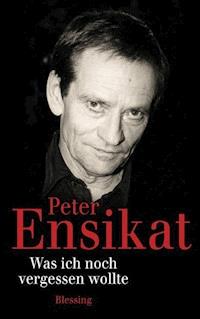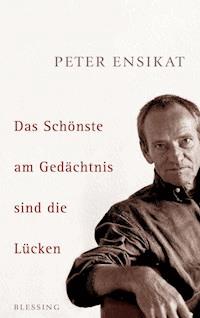
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blessing
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2009
»Was ich noch vergessen wollte …« PETER ENSIKAT
Peter Ensikat hat über drei Jahrzehnte lang die Kabarettszene der DDR maßgeblich geprägt. In seinem neuen Buch betrachtet er die Welt gelassen, auf verhalten satirische, höchst amüsante Weise. Er rückt Erich Honecker in eine verblüffende Nähe zum letzten sächsischen König, und er entdeckt erstaunliche Parallelen zwischen sich und einem Satiriker aus brauner Zeit. Und er fragt sich, wie System erhaltend seine Rolle als Kabarettautor mit »hohen staatlichen Auszeichnungen« wohl gewesen sein mag, wo er doch effektiv nichts tat, um das ungeliebte Regime zu verhindern.
Peter Ensikat über sein neues, autobiographisch gefärbtes Buch: »Zur falschen Zeit (zur Nazizeit), am falschen Ort (im Osten), in falschen Verhältnissen (armen) geboren und aufgewachsen in einer untergegangenen Gänsefüßchenrepublik, der einst nur so genannten, jetzt ehemaligen Ex-DDR. Mit den Jahren dämmerte mir, dass ich was dafür kann, dass ich nichts dafür konnte. Ich habe die falsche Vergangenheit. Leugnen hilft nicht, ich bleibe auch als Derzeitiger ein Ehemaliger.«
Zwei Fotos in seinem Schreibtisch – eines zeigt den Autor mit Erich Honecker, als der ihm 1988 den Nationalpreis überreichte, das andere seinen Schwiegervater mit dem letzten sächsischen König – bilden den Hintergrund für Geschichten über Geschichte, bieten dem Autor einen brillanten Einstieg für satirische Betrachtungen über zwei Wendezeiten in Deutschland, über fremde und eigene Verstrickungen in nicht gerade menschenfreundlichen Zeiten. Dazu Ensikat: »Mein Schwiegervater empfand die Novemberrevolution von 1918 als persönliche Niederlage. Für mich war die Wende 1989 zugleich Befreiung und doch auch Niederlage. Ich gehörte zu den Ersten, die unter dem Ast lagen, an dem wir so lange gesägt hatten. Auch der Verlust eines Gegners kann ein Verlust sein. Jedenfalls waren es zwei Revolutionen – die eine habe ich erlebt, von der anderen habe ich gelesen. Nachdem ich jetzt lese, was über die von mir erlebte Revolution geschrieben wird, misstraue ich allem, was ich über die andere gelesen habe.«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 432
Ähnliche
Peter Ensikat
Das Schönste am Gedächtnissind die Lücken
Peter Ensikat
Das Schönste
am Gedächtnis sind
die Lücken
Karl Blessing Verlag
Inhalt
9Das Schönste am Gedächtnis sind die Lücken
13Alte Fotos
19Sein König und mein Staatsratsvorsitzender
27Bruder Honecker
30Die Herrscher und ihre Narren
41Sachsens Kriegshelden
48Die richtige und die falsche Seite
55Die Russen kommen
60Wenn es mal wieder anders kommt
66Was tut man, wenn es anders kommt?
76Wie wäscht man sich rein?
83Opfer gibt es immer wieder
93Bruder Reimann
97Wie emigriert man nach innen?
110Vom vergangenen Glück deutscher Zweistaatlichkeit
130Ein Feind, ein guter Feind
Sag mir, wo die Blumen sind
oder
143Wo ist der Schnee vom vergangenen Jahr?
151Die Unaussprechliche
163Armut ist ein Glanz von innen
168Der Patriot in uns und um uns herum
181Wie ich den Himmel offen sah
189Wir sind das Volk, aber wer sind die anderen?
204Wer hat die Wende gewonnen, wer verloren?
214Freiheit oder soziale Sicherheit
223Wann ist die deutsche Einheit vollendet?
226Wenn wir alle Sachsen wären
237Von der Gnade, eine Zeitenwende zu erleben
252Vom Realitätsverlust der Politik
Sinn und Form
oder
262Die Banalität des Banalen
271Wenn wir erst alle Rentner sind
278Wie lustig ist die Spaßgesellschaft?
283Von den Vorzügen der Diktatur
293Was bleibt übrig? Eine Fußnote im Geschichtsbuch
302Die wunderbare Zeit der Anarchie
311Multikulti – ein westeuropäischer Irrtum
317Glücklich ist, wer vergisst
In der Wurstelei unseres Jahrhunderts, in diesem Kehraus der weißen Rasse, gibt es keine Schuldigen und auch keine Verantwortlichen mehr. Alle können nichts dafür und haben es nicht gewollt... Wir sind zu kollektiv schuldig, zu kollektiv gebettet in die Sünden unserer Väter und Vorväter. Wir sind nur noch Kindeskinder... Uns kommt nur noch die Komödie bei.
Friedrich Dürrenmatt 1955
Das Schönste am Gedächtnis sind die Lücken
Bei Jean Paul las ich: »Die Erinnerung ist das einzige Paradies, aus dem man nicht vertrieben werden kann.« Das mag stimmen, gilt aber nur so lange, wie man nicht versucht, die eigenen Erinnerungen mit anderen zu teilen. Wenn zwei dasselbe erlebt haben, müssen ihre Erinnerungen an das gemeinsam Erlebte nichts, aber auch gar nichts miteinander zu tun haben. Diese Erfahrung machen nicht nur Eheleute oder Geschwister, Kinder und Eltern. Hundert Leute, die dasselbe erlebt haben, können hundert unterschiedliche Geschichten davon erzählen, ohne dass einer lügen muss. Wir erinnern uns nämlich nicht nur verschieden. Wir erleben auch ganz und gar unterschiedlich. Dazu muss nicht erst einer Täter und der andere Opfer sein. Das ist ohnehin nicht immer so genau zu trennen.
Wir sollten uns selbst nichts vormachen und von den Historikern nichts vormachen lassen – die Erinnerung täuscht, und Geschichte gehört nicht zu den exakten Wissenschaften, eher zu den mehr oder weniger schönen Verpackungskünsten. Auch das sorgfältigste und gänzlich unvoreingenommene Quellenstudium kann allenfalls zu dem führen, was man bei Gericht einen Indizienbeweis nennt. Die ganze Wahrheit steht nirgendwo geschrieben. In den Akten so wenig wie in unserem Gedächtnis. Man kann sich ihr allenfalls annähern. Auch die felsenfeste Überzeugung, dass einen das Gedächtnis nicht trügt, hat nur auf dem Treibsand unseres selektiven Erinnerungsvermögens gebaut. Schon damit der Kopf uns nicht platzt, müssen wir aussuchen, was wir uns merken wollen und können. Das Verdrängen funktioniert sowohl bewusst als auch unbewusst. Die Grenzen zwischen beiderlei Arten der Verdrängung sind fließend. Und manche – aus welchem Grund auch immer – erfundene Geschichte glaubt man, irgendwann wirklich erlebt zu haben. Man muss sie nur oft genug erzählen.
Eine Faustregel lautet: Je schlechter das Gedächtnis, desto schöner die Erinnerungen. So kann es durchaus passieren, dass irgendwann auch die trübste Vergangenheit zur besonnten wird, zur guten alten Zeit eben. Da können die Ewig-Heutigen noch so spotten über die Ewig-Gestrigen. Wartet nur, balde erinnert ihr euch auch an die besseren Zeiten von damals und erntet das vereinigte Kopfschütteln der Nachgeborenen, die euer ganz ohne Nachsicht gedenken werden, wenn keine falschen Rücksichten mehr zu nehmen sind. Nostalgie ist die Sehnsucht nach der guten alten Zeit, in der man nichts zu lachen hatte.
Wie sind wir, die mit der Gnade der späten Geburt Gesegneten, über unsere Eltern hergezogen, weil sie die Nazizeit verdrängt hatten, von nichts Bösem gewusst haben wollten, obwohl wir doch im Nachhinein so genau wussten, dass sie gewusst haben mussten. Ohne noch viel nachzudenken, machten wir uns die Formel zu Eigen: Es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Diese moralische Überlegenheit reichte für uns Ostgeburten allerdings nur bis ins Jahr 1989. Da standen wir moralisch Gerechtfertigten nun plötzlich selbst mit dem falschen Leben zur falschen Zeit am falschen Ort und suchten nach ähnlichen Ausflüchten wie zuvor unsere Eltern.
Der Unterschied war: Nach 1945 hatte sich eine überwältigende deutsche Mehrheit nur vor einer verschwindenden Minderheit zu rechtfertigen. Die Rechtfertigung gelang weitgehend, da die Mehrheit für den Neuanfang gebraucht wurde und die internationale Lage einen Schulderlass zwingend erscheinen ließ. Der Kalte Krieg stimmte die Sieger versöhnlich mit dem Feind von gestern, weil sie ihn für den Kampf gegen den neuen Feind brauchten. Der große Aufwasch konnte so lange aufgeschoben werden, bis die mit der späten Geburt Gesegneten das Erinnerungs-Geschäft übernommen hatten.
1989 hatte sich eine östliche Minderheit der großen westlichen Mehrheit zu stellen, die ihre moralische Überlegenheit dem Glück verdankte, nicht dabei gewesen zu sein. Der Aufwasch erfolgte also umgehend und gründlich. Endlich gab es einen Abschnitt deutscher Geschichte, der mehrheitlich zu bewältigen war, weil die Mehrheit ja nicht betroffen war. So kam es zu manchem kurzen Prozess. Richtig und Falsch, Gut und Böse lagen ja scheinbar offen zu Tage. Mit dem Mut der Unbeteiligten hielten die Gerechten Gericht über die Ungerechten. Das führte zu einem überwältigenden Sieg der Selbstgerechtigkeit.
Wir mussten erleben, dass auch die Unerbittlichkeit der Opfer neue Opfer produzieren kann. Ein Biermann reicht für mehrere Generationen von Rechtbehaltern. Nicht nur die Täter müssen verdrängen, auch Opfer wollen an die Zeit, bevor sie Opfer wurden, manchmal nicht erinnert werden. Ein ganz reines Gewissen ist ohne ein bisschen Nachwäsche nicht zu haben.
Wann steht man wo auf der richtigen Seite? Die Antwort weiß ganz allein der Wind, und der wechselt eben immer mal wieder. Man legt sich am besten vorher nicht fest. Dann kann man nachher alles vorher gewusst haben. Mögen andere von ihren Gedächtnislücken schweigen, ich schweige von den meinen.
Alte Fotos
Vor mir liegen zwei alte Fotografien. Die eine stammt vom 20. Februar 1908, die zweite vom 6. Oktober 1988. Auf der ersten ist der letzte sächsische König Friedrich August Nummer drei im Kreise Leipziger Geschäftsleute zu sehen. Der Junge links neben dem König, fast verdeckt von seiner Majestät, wurde viel später einmal mein Schwiegervater.
Auf dem zweiten Foto bin ich – ganz im Hintergrund – zu sehen. Neben mir stehen ein paar meiner DDR-Kabarett-Kollegen. Mein direkter Nachbar ist der Vogtländer Jürgen Hart, der einst mit »Sing, mei Sachse, sing« berühmt wurde. Daneben steht Hans Krause, einer meiner Vorgänger im Amte der »Distel«-Direktion. Im Vordergrund ist mein Freund Wolfgang Schaller Hand in Hand mit Erich Honecker zu sehen. Ich habe den versilberten Handschlag im Moment der Aufnahme schon hinter mir.
Wir lassen uns gerade von unserem Staatsratsvorsitzenden den Nationalpreis der DDR überreichen. Zwar nur dritter Klasse und im Kollektiv, aber immerhin – einen Scheck über 8000 Ost- Mark Schmerzensgeld gab es für jeden. In der Urkunde steht, wofür wir den Preis bekamen: »Für das von hoher Qualität getragene Gesamtschaffen des politisch satirischen Kabaretts in der DDR.« Die Auszeichnung fand anlässlich des 39. Jahrestages jener DDR statt, die ein Jahr und ein paar Tage später so plötzlich, wie lang erwartet, untergehen sollte. Wir sind also – wie mein Freund Schaller uns gerne nennt – »Widerstandskämpfer mit hohen staatlichen Auszeichnungen« im Amtssitz des Staatsrates.
Ich erinnere mich noch gut an das mulmige Gefühl während des Festaktes. Satire lebt immer und überall vom Missverständnis. Aber war diese staatliche Anerkennung nicht nur ein weiterer Beweis dafür, dass unsere ganze Satire die reine Hofnarretei war? Machten wir uns mit der Annahme des Nationalpreises nicht selbst zur Lachnummer? Das Foto von der Preisübergabe bekam ich dann von der Protokollabteilung des Staatsrates zugeschickt und habe es tief unten im Schreibtisch mit der Urkunde und den tausend Glückwünschen verstaut. Nein, stolz war ich nicht auf die Auszeichnung, aber mutig genug, sie abzulehnen, eben auch nicht. Dabei wäre die einzige Folge solcher Ablehnung gewesen, dass ich künftig mit weiteren Auszeichnungen nicht hätte rechnen dürfen.
Dass er mit »seinem König« zusammen auf ein Foto kam, darauf war mein Schwiegervater zeit seines Lebens stolz. Auch dann noch, als der König kein regierender Herrscher mehr war, sondern nur noch der komische »Sachsen-Geenich«, ein Unikum, von dem man kaum mehr wusste als das, was von ihm in Form von Anekdoten auf die Nachwelt gekommen war.
Aufgeschrieben, zum Teil wohl auch erfunden, hatte diese Anekdoten ein älterer Kollege von mir – der Leipziger Kabarettist und Schriftsteller Hans Reimann. Mein Schwiegervater kannte viele davon auswendig und sprach gern von »seinem König« und von dieser »sächsischen Ulknudel« Reimann. Der hatte in den Zwanzigerjahren in Leipzig und anderswo so erfolgreich linkes Kabarett gemacht, zwei satirische Zeitschriften herausgegeben – Der Drache und Das Stachelschwein. Außerdem hat er für viele linke Blätter, darunter auch für die Weltbühne, geschrieben. Dass dieser Reimann damals ein Linker war, scheint meinen ganz und gar nicht linken Schwiegervater nicht gestört zu haben. Jedenfalls hat er davon nie gesprochen.
Nicht gesprochen wurde im Leipziger Bürgerhaus auch über die seltsame Wandlung des einst »bürgerlich-radikalen« Satirikers zum »Naziclown«. Der Dramatiker und Emigrant Carl Zuckmayer nannte ihn in seinem Geheimreport, den er im Jahre 1943 im Exil für einen amerikanischen Geheimdienst schrieb, »von allen Nazi-Kreaturen die übelste Erscheinung«. Er hatte ihn aus seiner »linken Zeit« gekannt und war ihm dann zu Nazizeiten bei einem heimlichen Berlin-Besuch noch einmal begegnet.
Achtzig Jahre liegen zwischen den beiden Aufnahmen. Noch zehn Jahre Königreich Sachsen im Kaiserreich Deutschland, die ganze Weimarer Republik, zwölf Jahre »Tausendjähriges Reich«, zwei Weltkriege und fast 40 Jahre DDR. Mein Schwiegervater war in beiden Kriegen Soldat, und er war es gern. Er starb dreiundneunzigjährig in Leipzig, ein Jahr vor jener zweiten deutschen Revolution des 20.Jahrhunderts, die ich dann hautnah und nicht ganz unbeteiligt selbst erleben durfte. Von der ersten deutschen Novemberrevolution 1918 sprach er zeit seines Lebens mit Empörung. Ihm, dem kaiserlichen Offiziersanwärter, der »im Felde unbesiegt« nach Hause gekommen war, hatten auf dem Leipziger Hauptbahnhof irgendwelche Halunken, die sich Soldatenräte nannten, die Rangabzeichen von der Uniform gerissen. So ein Umsturz, der alle Rangfolgen durcheinander brachte, war ganz und gar nicht nach dem Geschmack meines Schwiegervaters.
Seit ich heute lesen kann, was so alles über die von mir erlebte Revolution geschrieben wird, misstraue ich übrigens vielem, was ich über die andere zu lesen bekam. Geschriebene Geschichte ist offensichtlich etwas ganz anderes als das, was der Normalsterbliche so erlebt zu haben glaubt. Aufgeschrieben wird sie nun mal von den jeweiligen Siegern. Da können die Verlierer erzählen, was sie wollen. Weil aber aus Siegern immer mal wieder Verlierer werden, muss die Geschichte auch immer mal wieder umgeschrieben werden. Auch wo das Gute siegt, müssen nicht immer die Besten gewinnen. Aber dass nach siegreichen Revolutionen immer das Gute gesiegt hat, ist allen guten Siegern klar. Von selektivem Erinnerungsvermögen sind eben – wie wir alle – auch die Historiker nicht frei. Sie forschen ja auch selten für sich allein. Meist tun sie es in gesellschaftlichem Auftrag.
Mein Schwiegervater hätte die Revolution von 1989, im Gegensatz zu der von 1918, wohl von Herzen begrüßt, auch wenn er mit Revolutionen im Allgemeinen ganz und gar nichts am Hut hatte. Er hasste jede Art von Durcheinander. Aber dass diese Wende zum »natürlichen« Kapitalismus über kurz oder lang kommen müsste, das gehörte zu seinen festen Überzeugungen. Er, der bekennende Antikommunist, ließ sich auch im real-existierenden Sozialismus von uns Besserwissern seine Kaiserzeit nicht schlecht machen. Für das, was unterm Kaiser besser war, fand er übrigens ganz ähnliche Argumente, mit denen mancher von uns dann die DDR nachträglich so schön zu reden versuchte, wie sie erst in der Erinnerung werden konnte. Was hat seinerzeit das Brötchen gekostet oder die Straßenbahnfahrt? Und solche Kriminalität wie heute gab es früher grundsätzlich nicht – weder unterm Kaiser, noch in der DDR. Mit ruhigem Abstand betrachtet verliert viel Böses seinen Schrecken. Was früher war, wird irgendwann schön.
Dass einer wie ich in seine bürgerliche Familie einheiraten durfte, muss mein Schwiegervater wohl für eine der hinzunehmenden Kriegsfolgen gehalten haben. Standesunterschiede, die für ihn immer eine entscheidende Rolle gespielt hatten, galten im Osten einfach nichts mehr. Seine Liebe zu Adel und Militär hatte wohl vor allem etwas mit seinem Hang zum Hierarchischen zu tun. Ordnung liebte er, klare Regeln und Unterstellungsverhältnisse, wie sie beim Militär selbstverständlich sind. Gern erzählte er von adligen Freunden im Leipzig der Weimarer Republik. Bemerkenswert fand er, dass sie ihn, den Bürgerlichen, wie einen der ihrigen behandelt hätten. Weniger bemerkenswert fand ich, dass er mich schließlich auch nicht mehr als »das Subjekt« betrachtete, das sich in seine Familie eingeschlichen hatte. Nein, nachdem er nicht hatte verhindern können, dass seine Tochter und ich heirateten, ließ er mich zumindest nicht mehr spüren, dass ich eigentlich nicht dazugehörte. Irgendwann gewöhnte er sich an das Unvermeidliche, mag es ihm auch noch so unnatürlich erschienen sein. Am Vorabend der Hochzeit bot er mir – weil seine Frau ihn drängte – sogar das Du an. Es ist uns beiden anfangs gar nicht leicht gefallen, davon Gebrauch zu machen.
Einmal begleitete ich ihn zu einem Nachbarn, der seine Übersiedlung in die Bundesrepublik vorbereitete und uns einige seiner Möbel verkaufen wollte. Zu meiner Verblüffung hörte ich, wie mein Schwiegervater diesen Nachbarn respektvoll mit »Herr Oberst« anredete. Das war Anfang der Sechzigerjahre. Der »Herr Oberst« trug in der eiskalten, aber herrschaftlich eingerichteten Wohnung einen mit Fell gefütterten Offiziersmantel ohne Rangabzeichen. Als er meinen Schwiegervater freundlich aufforderte, ihn doch einfach »Kamerad« zu nennen, war der sichtlich geschmeichelt. Selbst hatte er es nur bis zum Major gebracht. Von Kameraden, mit denen er sich nach dem Krieg immer mal wieder traf, hatte er gehört, dass seine »Beförderung zum Oberstleutnant bereits unterwegs gewesen sei«. Aber in den Wirren der letzten Kriegstage ist sie wohl irgendwie verloren gegangen. Das erzählte er mir mehrmals mit nicht zu überhörendem Bedauern.
Mich nannte er lange Zeit leicht herablassend den »Gaukler«, und das nicht nur, weil ich Schauspieler war. Als eher linker Revoluzzer, der ich damals sein wollte, passte ich so gar nicht in sein deutsch-nationales Weltbild. Ich hatte ja nicht mal »gedient«. Dieses »gedient oder nicht gedient« spielte für ihn auch in DDR-Zeiten eine entscheidende Rolle. Zu seinem Bild vom Manne gehörte einfach die militärische Ausbildung, egal, ob sich die Armee nun kaiserlich nannte, faschistisch oder sozialistisch. Dass seine Enkel dem Dienst in der Nationalen Volksarmee der DDR ablehnend gegenüberstanden, konnte er einfach nicht verstehen. Seinem Vaterland, egal, welchem, hatte man zu dienen. Dass ich solchen Dienst in jeder Armee ablehnte und den in der Nationalen Volksarmee schließlich verweigerte, nahm er kommentarlos hin. Von mir, dem eingeheirateten Gaukler, erwartete er wohl sowieso nichts Besseres.
Bei all seinen Gewissheiten, die er durch die Zeitläufte gerettet hatte, war er alles andere als ein Fanatiker. Im Gegenteil – er ließ über fast alles ruhig mit sich reden, ohne sich allerdings in seinen Überzeugungen im Geringsten verunsichern zu lassen. Im Ton blieb er bei aller Liebe zum Militärischen immer zivil und wahrte auch im Streit noch die Formen. Seine weniger konservativ eingestellte Frau nannte er manchmal, wenn sie ihm allzu heftig widersprach, »Kommunistin«. Das gehörte für ihn wohl zu den schlimmsten Schimpfwörtern. Im Übrigen war er ein wunderbarer Plauderer. Gerade seine Kriegsgeschichten – vor allem die vom Ersten Weltkrieg – waren amüsant anzuhören. Tote kamen darin nicht vor. Von Kameradschaft war die Rede, von einem insgesamt eher lustigen Soldatenleben.
Wir haben uns später – ich war ja nun mal in der Familie – sogar gut verstanden. Unsere Meinungsverschiedenheiten haben wir – mit den Jahren immer müheloser – ausgeschwiegen oder mit einem leicht besserwisserischen Lächeln als Skurrilität des jeweils anderen auf sich beruhen lassen. Ich fühlte mich, trotz meiner prinzipiell linken Ansichten ausgesprochen wohl in der eher großbürgerlichen Welt meines Schwiegervaters. Die andere Meinung wurde hier zwar auch nicht geliebt, aber doch geduldet. Das war in unseren linken Kreisen nicht immer so selbstverständlich.
Beinahe herzlich wurden unsere Gespräche, wenn wir auf die DDR zu schimpfen kamen – er von der eher kaisertreuen Warte aus, ich mehr von der linksintellektuellen Seite her. Wir hatten einen gemeinsamen Gegner, und das verband über alle Standesunterschiede hinweg. Aber das war etwas, was DDR- Bürger der verschiedensten Überzeugungen und unabhängig von sozialer Herkunft immer geeint hat – man wusste, wogegen man war, ohne sich auf ein Wofür-auch-immer einigen zu müssen. Das schuf ein Klima des gegenseitigen Vertrauens und gab einem bei aller Ratlosigkeit doch ein gewisses Gefühl von Geborgenheit.
An der grundsätzlichen Haltung zum Staat DDR änderte auch eine hohe staatliche Auszeichnung, wie es der Nationalpreis war, nichts. Das weiß ich auch von anderen, mir bekannten Nationalpreisträgern. Selbst mein durch und durch »reaktionärer« Schwiegervater schrieb an Erich Honecker, nachdem er von diesem einen staatlichen Glückwunsch zu seinem neunzigsten Geburtstag erhalten hatte, dass es ihm ein »Herzensbedürfnis« sei, sich dafür persönlich bei ihm als Staatsratsvorsitzenden zu bedanken. Dabei war er auch mit 90 nicht nur bei guter Gesundheit, sondern auch bei klarem Verstand. Auch der Kommunist Honecker war eben als Staatsratsvorsitzender in gewissem Sinne eine Autorität.
Sein König und mein Staatsratsvorsitzender
Sie hatten vieles gemeinsam, sein letzter sächsischer König und mein vorletzter Staatsratsvorsitzender. Beide – der letzte Friedrich August von Sachsen, wie der vorletzte Erich der DDR – waren leidenschaftliche Jäger und Skatspieler. Auch die Liebe zu militärischen Aufmärschen und Fackelzügen verband sie. Wenn sie durch ihr Land reisten zu allerlei Betriebsbesichtigungen oder Denkmalseinweihungen, dann hatten Behörden und Betriebe zu schließen, damit das Volk Spalier bilden konnte, und die Herrscher was zu winken hatten. Beide legten großen Wert darauf, von ihrem Volk geliebt zu werden. Das allerdings gelang dem lockeren Sachsen-König unvergleichlich viel besser als dem stocksteifen Staatsratsvorsitzenden.
Ihr Verhältnis zu Kunst und Kultur war von ähnlicher Schlichtheit geprägt. Vom König erzählte man, dass er bei ernsteren Kunstanlässen meist eingeschlafen sei. Sein Lieblingsstück im Dresdner Schauspielhaus soll Der Raub der Sabinerinnen gewesen sein. Ob Honecker überhaupt ein Lieblingsstück hatte, ist nicht bekannt. Das »Lied vom kleinen Trompeter, dem lustigen Rotgardistenblut«, soll er immer wieder gern gesungen haben oder das alte FDJ-Lied »Bau auf , bau auf , Freie Deutsche Jugend, bau auf«. Beide – König und Staatsratsvorsitzender – mussten allerdings, das gehört nun mal zum Herrscheralltag quer durch alle Systeme, bei allerlei offiziellen Anlässen immer wieder gute Miene machen zu unvermeidlichem Spiel, das ihnen da als künstlerische Umrahmung zugemutet wurde. Ihre gemeinsame Vorliebe für Blasmusik ergab sich schon aus beider Jagdleidenschaft.
Zu den sie verbindenden Pflichten gehörte unter anderem die Eröffnung der regelmäßig stattfindenden Dresdner Kunstausstellungen. Honecker konnte man bei solchen Eröffnungen in den DDR-Fernsehnachrichten ausführlich bewundern. Das gehörte zur sozialistischen Hofberichterstattung. Es war äußerst komisch zu beobachten, wie der kleine Mann so angestrengt wie vergeblich versuchte, bei den anschließenden Rundgängen, immer an der Bilderwand entlang, wenigstens etwas Kunstverständnis vorzutäuschen. Er lauschte ergeben den Erläuterungen der begleitenden Malerfunktionäre, wenn sie ihm die ausgestellten Kunstwerke näher zu bringen versuchten. Dass er mit der ganzen modernen Malerei nichts anzufangen wusste, war ihm zwar deutlich anzusehen, aber die Mühe, trotzdem so zu tun als ob, war doch nicht zu übersehen. Dabei hatte ja vorher schon eine strenge Auswahlkommission dafür zu sorgen, dass da nichts gezeigt würde, was den Landesherren allzu sehr überfordern könnte. Künstlerisch, wie natürlich auch politisch.
Darf man den zahlreichen anekdotischen Überlieferungen glauben, so machte König Friedrich August gar kein Hehl aus seiner Abneigung gegen allen modernen Schnickschnack in der Kunst. Einmal soll er – das gehört zu Hans Reimanns schönsten Anekdoten über ihn – vor einem Bild stehen geblieben sein, auf dem die Wiese blau und der Himmel grün gemalt waren. Als er den Maler nach dem Sinn solcher Farbgebung fragte, erklärte dieser: »Majestät, ich sehe das so.« Der königliche Kommentar lautete schlicht aber bestimmt: »Da hätten’se nich Maler wer’n soll’n.«
Ich bin sicher, Honecker hatte bei so manchem Bild so manchen DDR-Malers ähnliche Gedanken. Aber im Gegensatz zur souveränen Schlichtheit des echten sächsischen Königs, versuchte Honecker so angestrengt wie vergeblich, einen König zu spielen, und blieb dabei doch immer nur der echte saarländische Dachdecker, dessen proletarisches Kunstverständnis über das Schalmeienspiel nie hinausgegangen war.
Gemeinsam wiederum ist beiden ungleichen Herrschern, dass sie zum Schluss, als das Volk in Sachsen gegen sie auf die Straße ging, auf dieses Volk nicht schießen ließen. Friedrich August 1918 nicht in Dresden und Honecker 1989 nicht in Leipzig. Während sich der König von seinem damals kurzzeitig ungehorsamen Sachsenvolk mit den unvergesslichen Worten »Macht eich eiern Dreck alleene!« verabschiedete, musste der gestürzte SED-Chef selbst noch den Mann zu seinem Nachfolger vorschlagen, der ihn gerade gestürzt hatte. So bewiesen der Sachse am Ende Größe und der Saarländer Parteidisziplin, die er wohl auch für Größe hielt.
Von Honecker ging damals das Gerücht, dass er sich noch am Tage seiner Absetzung in die Schorfheide zur Jagd fahren ließ. Das dürfte aber auch sein letzter Jagdausflug gewesen sein. Aus einem privilegierten Rentnerdasein, mit dem er an diesem Tage vielleicht noch gerechnet hatte, wurde nichts mehr. Keine Staatsjagd, nicht mal ein Skatabend im Genossenkreis sollte ihn über den Machtverlust hinwegtrösten. Aus der Palastrevolution im Politbüro der SED wurde kurz darauf ein weit über Sachsen hinausreichender Volksaufstand, der auch die stürzte, die ihren obersten Genossen gerade gestürzt hatten. Dass er als oberster Arbeiter- und Bauernführer seines Arbeiter- und Bauernstaates einmal von eben diesen Arbeitern und Bauern verjagt werden würde, damit hatte Honecker wohl in seinen schlimmsten Angstträumen nicht gerechnet. Er schien wirklich geglaubt zu haben, von denen, die für ihn so lange Spalier gestanden hatten, auch geliebt zu werden.
Auch König Friedrich August schien seinen Sachsen die ganze Revolution bis zur letzten Minute nicht so recht zuzutrauen. »Ich habe den Leiten nischt gedahn, und die duhn mir ooch nischt«, soll er gesagt haben, als seine Minister ihn vor den Aufständischen warnten. Noch am Morgen des 8. November 1918, die Unruhen hatten längst die Residenz erreicht, ließ er sich des schönen Wetters wegen mit seiner Schwester, Prinzessin Mathilde, durch die Dresdner Heide kutschieren. Am Abend desselben Tages musste er sich dann von seinen treuen Ratgebern erst mühsam überzeugen lassen, dass es nun höchste Zeit wäre, die Koffer zu packen. Als es dunkel wurde, ließ er also sein Auto kommen und verließ das Dresdner Schloss, um – auf dem Umweg über sein Jagdschloss Moritzburg und Schloss Gutenborn in der Lausitz – Schutz zu suchen in seinem schlesischen Exil Sibyllenort, einem der schönsten und größten Schlösser in Deutschland. Im Gegensatz zu Honecker besaß der König auch außerhalb seines Herrschaftsbereiches mehrere Ausweichschlösser, die auch nach erfolgter Revolution in seinem Besitz blieben. Und mit ihm reisten immer mehrere Bedienstete, darunter ergebene Chronisten, die die königlichen Fluchtwege für die Nachwelt dokumentiert haben.
Auch Honeckers Flucht wurde von allerlei Journalisten begleitet. Diese Begleitung allerdings glich eher einer Verfolgungsjagd. Die Bilder vom gejagten Staatsratsvorsitzenden a.D. hatten zwar kaum Nachrichtenwert, befriedigten aber das Rachebedürfnis seiner ehemaligen Untertanen, die es ihm jetzt ganz besonders übel zu nehmen schienen, dass sie ihm so lange zugejubelt hatten. Er, ohne dessen Bild vorher kaum eine Zeitung oder Nachrichtensendung des DDR-Fernsehens denkbar war, versuchte nun vergeblich, sich den Kameras und Mikrofonen zu entziehen.
Als die untreuen Untertanen des Monarchen am 10. November 1918 in Dresden die Republik ausriefen, taten sie das nicht etwa vom Balkon des Königsschlosses aus, sondern – wie sich das für brave sächsische Revolutionäre gehörte – im Zirkus Sarrasani.
Der König aber konnte ungestört und von seinem schon wenig später reuigen Sachsenvolk eher verehrt als verfolgt, noch 14 Jahre lang seinen Freizeitgeschäften nachgehen, die hauptsächlich aus Reisen, Jagen und Skat spielen bestanden. Seine zahlreichen Reisen führten ihn immer mal wieder durch Sachsen. Und seine Untertanen a.D. jubelten ihm nun wieder zu wie in guten alten Monarchie-Zeiten. Bei so einer unangemeldeten Jubelfeier auf dem Leipziger Hauptbahnhof soll Majestät das Coupé-Fenster seines Salonwagens geöffnet haben, nicht etwa, um sich für den Jubel zu bedanken, sondern um so vorwurfsvoll wie ironisch zu bemerken: »Ihr seid mir scheene Rebubliganer.« Auf seine Visitenkarte hat er, so sagt man, nach seiner Abdankung schreiben lassen: »Friedrich August, König ohne Sachsen«.
Erst am 18. Februar 1932 ereilte den gestürzten Landesvater ein ganz und gar friedliches Ende in seinem weichen schlesischen Schlossbett. Noch am Vorabend soll er beim Skatspiel gewonnen haben und deshalb bei bester Laune eingeschlafen sein.
Honecker wurde von seinen Genossen nicht nur aus seinem Haus in Wandlitz verjagt, er wurde von seiner eigenen Justiz dann vom Krankenbett direkt ins Gefängnis verbracht. Nachdem ihn diese Justiz aus Mangel an Erfahrung mit nichtsozialistischer Rechtsprechung hatte freilassen müssen, wurde er nun vom Zorn desselben Volkes gejagt, von dessen Jubel er sich kurz zuvor noch hatte täuschen lassen. Ausgerechnet in einem Pfarrhaus fand der Atheist dann das bisschen Schutz und Obdach, das ihm seine eigenen Genossen nicht hatten gewähren wollen oder können. Seine Konten waren gesperrt, und sein einziges Schloss »Hubertusstock« war sowieso immer nur »Volkseigentum« gewesen. Was das bedeutete, wurde ihm nun wohl, da er selbst nur noch Volk war, auf eher tragische Weise bewusst. Immer hatte er sich nur um die Macht gekümmert. Die persönliche Eigentumsfrage scheint er, der vorher so viel Privateigentum hatte verstaatlichen lassen, nie gestellt zu haben. Bis zum 15. Dezember 1989 hatte er – nach eigener Aussage – ganze 184000 DDR-Mark zusammengespart und erwartete neben seiner Rente als Verfolgter des Naziregimes eine Mindestrente von 517 Mark.
Der abgedankt habende sächsische König schickte – kaum angekommen in seinem Schloss – die ersten, noch ganz und gar harmlosen Vermögensforderungen nach Dresden. Er verlangte – fröhlicher Lebemann, der er im Gegensatz zum trockenen Honecker war –, ihm 400 Flaschen Wein aus seinem Dresdner Weinkeller ins schlesische Exil zu schicken.Es muss wohl an der noch leicht revolutionär eingetrübten Stimmung in Dresden gelegen haben, dass man ihm statt der verlangten 400 Flaschen nur ganze 200 bewilligte.
Das scheint den lebensfrohen Monarchen derart verärgert zu haben, dass er nur ein Vierteljahr später – in einer »Denkschrift« – Entschädigungen in Millionenhöhe verlangte. Mit seinem auf 25 Millionen Mark geschätzten Vermögen war er ja einst der reichste Mann in Sachsen gewesen. Von all ihren Reichtümern wurden den Wettinern in einem geheimen Kabinettsbeschluss vom Mai 1919 schließlich 15 Millionen Mark Kapitalien und eine monatliche Grundrente von 260 000 Mark zugesprochen. Das unter den Kriegsfolgen leidende Volk durfte davon natürlich nichts wissen. Es hätte der Sachsen Liebe zu ihrem König Abbruch tun können. Als bekannt wurde, dass ihm 1924 noch einmal 300000 Goldmark als Abfindung gezahlt wurden, kam es in Dresden, Leipzig und Chemnitz sogar zu großen Protestkundgebungen. Und nirgendwo war der Widerstand gegen die »Fürstenabfindung« im Jahre 1926 größer als im ehemaligen Königreich Sachsen.
Aber als dann die überlebt habenden Wettiner sofort nach Ende der kommunistischen Herrschaft wieder in ihr Sachsenland kamen, wurden sie daselbst von den Enkeln der ehemaligen Untertanen auf das Untertänigste begrüßt. Die Wiedersehensfreude dauerte allerdings nur so lange, bis ihre ganz neuen alten Forderungen nach Rückgabe von oder Entschädigung für allerlei fürstliches Eigentum bekannt wurden. Man traf sich – so ist das nun mal im Rechtsstaat – vor Gericht wieder. Dass die Wettiner dabei nicht leer ausgingen, versteht sich von selbst.
Honecker bekam nach allerlei missglückten Fluchtversuchen statt einer Abfindung von der nun vereinigten westdeutschen Justiz einen Haftbefehl zugestellt und landete in einem Gefängnis, in dem er als Kommunist zu Nazizeiten schon einmal eingesessen hatte. Dass er vom Gericht nicht mehr zu seiner verdienten Haftstrafe verurteilt werden konnte, lag daran, dass die von eben diesem Gericht bestellten Ärzte feststellen mussten, dass er diese Strafe aus Krankheitsgründen sowieso nicht mehr würde antreten können. Er wurde für verhandlungsunfähig erklärt. So durfte er zu Frau und Tochter nach Chile ausreisen, wo er – Glück für die Mediziner – kurz darauf an der diagnostizierten Krankheit auch wirklich starb. Schließlich hatte man den Angeklagten vor Gericht mehrmals verdächtigt, Altersschwäche und Krebserkrankung nur heimtückisch vorzutäuschen.
Anders als weiland der Göring-Witwe wurde der Witwe Honecker von der Bundesrepublik keine Witwenrente zugesprochen. Kurz vor dem Tod ihres Mannes war es einem deutschen Kamerateam gelungen, das Ehepaar Honecker mit versteckter Kamera noch einmal in ihrem chilenischen Kleingarten zu filmen. Da sah ich nun im Fernsehen meinen gewesenen Staatsratsvorsitzenden und Generalsekretär, aus dessen Hand ich einst den Nationalpreis empfangen hatte, beim Sprengen des Gartens.Er muss sich etwas ungeschickt angestellt haben,jedenfalls nahm Frau Margot – sichtlich genervt – ihm einfach den Gartenschlauch aus der Hand, und er wehrte sich nicht. Das Bild hat sich mir tief eingeprägt. Selbst den Gartenschlauch ließ er sich zum Schluss aus der Hand nehmen – mein einst so allmächtiger Staatschef.
Ich durfte ihm dann einen Nachruf für die Frankfurter Hefte schreiben. Dem habe ich auch heute wenig hinzuzufügen.
Bruder Honecker
Wer hätte gedacht, dass einer wie ich einmal einem wie ihm einen Nachruf schreiben dürfte – der Satiriker dem Staatsoberhaupt. Solche Schmach erfährt wohl auch der kleinste Diktator nur, wenn er vorher gestürzt worden ist. Nun ja, im eigentlichen Wortsinn erfährt er es ja auch gar nicht mehr. Ich spreche hier von Atheist zu Atheist.
Mein Nachruf gilt den Hinterbliebenen, also auch mir – einem von 16 Millionen ehemaligen DDR-Bürgern. Wir sind die Konkursmasse des eingegangenen Unternehmens, das er – wenn schon nicht mit unserer Billigung, so doch mit unserer Duldung – so lange geleitet hat. Ich gebe zu, ich habe ihm seinerzeit, wie andere auch, oft den Tod gewünscht, weil nur sein Tod Veränderung im ewigen Mief dieses Arbeiter- und Bauernstaates erhoffen ließ. Die biologische Lösung nannten wir das damals zynisch, als wir nicht zu hoffen wagten, dass dieses Staatsvolk der Mitläufer – ich auch – sich jemals zu zivilem Ungehorsam nach östlichem Vorbild durchringen würde.
Kurz bevor sich dieser zivile Ungehorsam im ganzen Volk durchgesetzt hatte, war Honecker von seinen engsten Mitläufern im Politbüro schon in vorauseilendem Ungehorsam gestürzt worden. Mit ihm war der Schuldige an allem, was wir erduldet hatten, gefunden. Und nun wollte Krenz uns grüßen als Reformpatriot und Wendeheld. Kein unschuldiger Kampfgenosse bot damals dem einen schuldigen Diktator auch nur Asyl an. Ja, die von ihm einst berufene Justiz erwählte ihn sofort zum Angeklagten und verfolgte Honecker bis an sein Krankenbett. Das Wort Justizirrtum erwies sich wieder mal als reine Tautologie. Dass sich der vom Generalsekretär zum einfachen Nichtmehr-Genossen degradierte Honecker dieser Justiz durch Flucht zu entziehen suchte, verstand ich nur zu gut. Führer sind nur selten mutiger als die Geführten, sobald sie die Führung verloren haben. Ich empfand zum ersten Mal tiefes Mitgefühl mit ihm und die alte Verachtung für meinesgleichen, die nur zu gern dahin treten, wo sie vorher hineingekrochen waren.
Dem kleinen Bruder Honecker blieb schließlich nur noch die Flucht zum großen Bruder.Aber aus dem ewigen Bruderbund war inzwischen eine Rette-sich-wer-kann-Bewegung geworden, und so blieb dem ehemaligen DDR-Bürger Honecker nur übrig, was anderen DDR-Bürgern vorher übrig geblieben war – die Flucht in eine westliche Botschaft.
Ihm verhalf diese Flucht aber nicht mehr in die Freiheit. Schließlich war er vor keiner Diktatur davongelaufen, sondern vor dem nun endlich gesamtdeutschen Rechtsstaat, der in seinem Falle offensichtlich nicht Rente, sondern Rache wollte. Rache für ein in tiefen Unschuldsgefühlen aufgewühltes Ostvolk, dem der Rechtsstaat nun endlich mal beweisen wollte, dass er nicht nur mit den kleinen Mauerschützen, sondern auch mit dem großen Staatsratsvorsitzenden fertig würde.
Dass dieser Staatsratsvorsitzende a.D. schon sehr alt und sehr krank war , konnte für die Justiz nur bedeuten, dass sie ihm kurzen Prozess machen müsste. Dass er während dieses Prozesses in einem Gefängnis untergebracht war, in das ihn schon mal eine andere deutsche Justiz gesperrt hatte – mein Gott, eine gewisse Kontinuität kann man deutscher Justiz eben nicht absprechen. Klar war ja ohnehin, dass es sich bloß um einen symbolischen Prozess würde handeln können, mit einem symbolischen Angeklagten und einem symbolischen Urteil. Im Namen eines symbolischen Volkes. Schließlich hatten die Mediziner herausgefunden, was die Juristen nicht glauben wollten – Honeckers Lebenszeit war schon so begrenzt, dass man ihn ohnehin zu nichts mehr verurteilen konnte, womit er zu bestrafen wäre.
Ich bin dem Rechtsstaat dankbar, dass er wenigstens die Medizin das sein lässt, was der Justiz so schwer zu fallen scheint – human. Die Medizin bewahrte die Justiz und uns alle vor dem Irrtum, mit der Verurteilung des EINEN alle andern freisprechen zu können.
Im deutschen Justizvollzug wäre vermutlich ein Märtyrer gestorben. In Chile starb ein alter Mann und nicht mehr.
Ihren toten König holten die Sachsen sofort wieder heim. Am 18. Februar 1932 war er in Sibyllenort gestorben. Am 23. Februar statteten sie ihm in der Katholischen Hofkirche zu Dresden eine wahrhaft majestätische Begräbnisfeier aus. Die Einzelheiten dazu hatte der König kurz vor seinem Tod selbst noch in sein Testament diktiert. Zutritt hatten nur geladene Trauergäste und »Offiziere in Uniform«. Der Dresdner Anzeiger berichtete am nächsten Tage ausführlich von der gewaltigen Anteilnahme der Bevölkerung. Starke Polizeikräfte mussten aufgeboten werden, um das trauernde Sachsenvolk fern zu halten von der noblen Trauergesellschaft, die der ergreifenden Gedächtnisrede von Prälat Müller, dem Hofkaplan und Skatbruder des Königs, lauschte. »Zahlreiche Solokräfte der Staatsoper hatten sich für diese besondere Feier in den Chor der Staatsoper eingereiht. Von jenseits der Elbe dröhnte dumpf der Trauersalut der Artillerie.«
Außer der königlichen Familie waren auch zahlreiche Vertreter anderer deutscher Fürstenhäuser erschienen. Und der greise Reichspräsident Hindenburg hatte seinen Sohn, den Oberst von Hindenburg, als seinen offiziellen Vertreter geschickt. Für den ehemaligen Kaiser war Prinz Eitel von Preußen angereist. Die Staatsregierung, die städtischen Körperschaften und alle Reichs- und staatlichen Behörden, die Hochschulen des Landes, das Diplomatische Korps – sie alle ließen es sich nicht nehmen, dem toten König die letzte Ehre zu erweisen.
Es waren in der Tat »scheene Rebubliganer«, die da ihren gestürzten König zu Grabe trugen.
Der Verbleib von Honeckers Asche ist nach wie vor unbekannt. Die Urne soll dem Vernehmen nach im Haus seiner Witwe in Chile stehen.Er selbst soll noch den Wunsch geäußert haben, in Deutschland begraben zu werden.Ob das einmal – und sei es nur bei Nacht und Nebel – geschehen wird, ist ungewiss.
Die Herrscher und ihre Narren
Als der König einmal – natürlich in Zivil – durch Dresden spazierte, sah er, wie einem Kutscher das Pferd durchging. Von Pferden verstand Friedrich August als passionierter Jäger etwas. Es gelang ihm, das Pferd aufzuhalten. Der Kutscher, ein Dresdner Fleischermeister, dankte dem König, den er als solchen nicht erkannte, für seine geistesgegenwärtige Hilfe und fragte: »Bist wohl ooch ä Fleescher?« Darauf der König: »Ä wo, ich sähe bloß so aus.«
Gäbe es nicht diese Anekdoten, von Friedrich August hätte die Nachwelt wohl kaum etwas im Gedächtnis behalten. Irgendwelche staatsmännischen Verdienste sind nicht bekannt. Zu dringend erforderlichen Reformen in Sachsen schien er genauso wenig Neigung verspürt zu haben wie später der fast allein regierende Honecker in seiner DDR.
Zu Friedrich Augusts Lebzeiten vermittelten diese gern erzählten, volkstümlichen Geschichten den sächsischen Untertanen das schöne Gefühl, einen König zu haben oder wenigstens gehabt zu haben, der so ganz einer der ihren war. Ein König zum Anfassen. Aus unerforschlichen Gründen bewundert der kleine Mann den großen am meisten dafür, dass er auch nur ein Mensch ist, einer wie du und ich.
Für den Rest des deutschen Reiches waren die Geschichten von diesem komischen »Geenich« aus Dresden wohl nur ein willkommener Beweis für sächsische Einfalt. Noch im DDR- Kabarett genügte es, einen Parteisekretär sächsisch sprechen zu lassen, um ihn lächerlich zu machen. Das funktionierte erstaunlicherweise auch in Sachsen. Von seiner Begegnung mit dem König damals in Leipzig erzählte mein Schwiegervater auch so eine Schnurre, die in Reimanns Anekdotensammlung gepasst hätte. Man hatte für das Gruppenfoto mit König einen Stuhl für Majestät bereitgestellt. Aber er sagte nur: »Nu ihr Klabbser, wenn ihr euch nich setzt, hock ich mich ooch nich offn Stuhl.« Und blieb stehen.
Von Honecker gab es ein paar Witze, wie es sie vorher von Ulbricht und anderen Spitzengenossen auch gegeben hatte. Es waren im Grunde immer die gleichen. Man brauchte – wie in den Amtsstuben die Bilder – in den Witzen nur die Namen auszutauschen. Der eigentliche Reiz dieser Witze bestand darin, dass sie verboten waren. Solches Verbot wurde in frühen DDR- Zeiten noch streng gehandhabt – da konnte man für einen politischen Witz sogar ins Gefängnis kommen. Später gehörten sie zum festen Repertoire fast aller ostdeutschen Wohnstuben und Stammtische.
Auch die Genossen erzählten sie weiter und hatten dabei das schöne Gefühl, etwas Verbotenes zu tun, ohne irgendeine Strafe fürchten zu müssen. Die unzähligen DDR-Witzsammlungen, die dann nach der Wende erschienen sind, lesen sich heute eher fad und langweilig. Der gute alte DDR-Witz ist eben ohne den konspirativen Ton, den wir einst in allen Lautstärken beherrschten, auch nicht mehr das, was er mal war.
Hans Reimanns Anekdoten-Büchlein Dr Geenich erreichte unendlich viele Auflagen, unter anderem wohl auch deshalb, weil bekannt wurde, dass es Versuche gab, dem Autor den Vortrag seiner harmlosen kleinen Geschichten verbieten zu lassen. Der geschäftstüchtige Verleger Steegemann, mit dem sich der kaum weniger geschäftstüchtige Reimann später in anderer Sache vor Gericht erbittert gestritten hat, hatte eine verkaufsfördernde Idee. Am 31. März 1923 schickte er dem König ein Exemplar einer als »Fürstenausgabe« deklarierten Edition der Anekdoten auf Japan-Bütten in Maroquinleder. Dazu schrieb er seiner Majestät: »... Ich bitte ganz ergebenst, mir die Frage huldvollst erlauben zu wollen, ob Euer Majestät gegebenen Falles sich bereit finden lassen möchte, einige Exemplare dieser Ausgabe mit Euer Majestät Namenszug zu versehen und so auch äußerlich Euer Majestät Zustimmung zu diesem Buche, dessen echter Verfasser ja Euer Majestät ohnehin sind und bleiben, zu geben. In Ehrfurcht Euer Majestät ganz gehorsamer Paul Steegemann.«
Der angeblich so volkstümliche und humorvolle König hatte zwar den so gehorsamen Verleger keiner Antwort gewürdigt, aber er tat ihm einen viel größeren Gefallen. Er verklagte den Verfasser Hans Reimann. Eine bessere Reklame konnte der sich gar nicht wünschen.
Auf dass die Geschichte schön im Gedächtnis des Lesepublikums bleibe, hat der Verleger den ganzen lustigen Vorgang umgehend in einem weiteren Buch dokumentiert, in Hans Reimann, Mein Kabarettbuch, Paul Steegemann-Verlag Hannover und Leipzig, Copyright 1924.
Und da lese ich – viele Jahre Kabarettautor im Lande Walter Ulbrichts und Erich Honeckers – etwas mir nur allzu Vertrautes. Der gute alte König wehrte sich gegen das, was er als Verunglimpfung seiner hohen Person empfand, mit den gleichen Mitteln, mit denen sich später auch die Staatsratsvorsitzenden der größten und schönsten DDR dieser Welt gegen unbotmäßige Kritiker zu wehren pflegten – mit Protestschreiben aus allen zur Verfügung stehenden Kreisen der werktätigen Bevölkerung.
Der »gemeinsame Betriebsrat sowie der Arbeiter- und Angestelltenrat der Herrschaft Sibyllenort« protestierten in einer von der Presse veröffentlichten und an den Herrn Polizeipräsidenten, den Magistrat und den Herrn Stadtverordneten-Vorsteher zu Breslau gerichteten Entschließung gegen die »Verunglimpfung des früheren Königs von Sachsen«, der ihr jetziger Brotgeber war. In ihrem Protestschreiben heißt es sehr schön: »Wir halten es für unsere Ehrenpflicht, einen Mann wie unsern Brotherrn, der zu bescheiden ist, um aus seiner stillen Zurückgezogenheit herauszutreten und gegen solche Angriffe auf seine Person mit gesetzlichen Mitteln vorzugehen, der immer hilfsbereit die Not vieler Armen zu lindern sucht, der stets den Bedürfnissen seiner Arbeitnehmer nach Möglichkeit Rechnung trägt, in Schutz zu nehmen.«
Auch der noch viel bescheidenere Erich Honecker ließ sich bei jedem Angriff auf seine Person, seine Partei oder seinen Staat – das war ja irgendwie alles eins, also seins – umgehend von seiner Arbeiterklasse in Schutz nehmen. Die protestierte sozusagen auf Knopfdruck in Leserbriefen oder auf spontanen Betriebsversammlungen, bis er dann gar nicht anders konnte, als das verbieten zu lassen, was die weiten Kreise der Bevölkerung auf sein Geheiß verbieten zu lassen gefordert hatten. Es konnte auch vorkommen, dass sich in einem Kabarett-, Kinooder Theatersaal empörte Kampfgruppen der Arbeiterklasse oder klassenbewusste Jugendliche in blauen FDJ-Hemden unter das verblüffte Publikum mischten, um eine ihn, Erich Honecker, und damit alle Werktätigen der DDR beleidigende Aufführung zu verhindern oder wenigstens lautstark gegen sie zu protestieren.
In Breslau erging dann auch am 18. Oktober 1923 auf Antrag des Herrn Oberst a.D. Albrecht von Thaer, der den viel zu bescheidenen König a.D. vor Gericht vertreten hatte, die einstweilige Verfügung: »Dem Antragsgegner wird bei Vermeidung einer Haftstrafe für jeden Fall der Zuwiderhandlung verboten, den Herrn Antragsteller betreffende Anekdoten, sei es aus dem von ihm verfassten Buch ›Dr Geenich‹, sei es sonstige Anekdoten, vorzutragen oder sonstwie zu verbreiten.«
Reimann – das schreibt er selbst in seiner Autobiographie Mein blaues Wunder – nahm die Verfügung nicht ernst. Im Gegenteil – er trug sie in vollem Wortlaut zu Beginn seiner Breslauer Veranstaltung vor. Das Publikum jubelte und hörte dann mit umso größerer Begeisterung die soeben verbotenen Anekdoten. Das geschah im Jahre 1923. Doch als der Autor ein Jahr später wieder in Breslau auftreten wollte, wurde er tatsächlich direkt vor seinem Auftritt verhaftet und für ein paar Tage eingesperrt. Das brachte ihm ein großes Presseecho und viel neue Popularität ein.
Die Folgen solcher Verfügungen oder Verbote waren damals die gleichen wie später zu Honeckers Zeiten – nichts war so interessant wie das, was verboten war oder eventuell verboten werden könnte. Ich bin auf viele Bücher oder Theatervorstellungen erst aufmerksam geworden, nachdem ich in der Presse gelesen oder gerüchteweise gehört hatte, dass die Partei etwas an ihnen auszusetzen hätte. Nichts Gedrucktes verbreitete sich in der DDR so schnell wie ein verbotenes Buch. Allein das Gerücht, irgendetwas sollte verboten werden, genügte, dass jeder dieses Etwas lesen, sehen oder hören wollte.
Mag sein, dass der Geenich nicht begriffen hat, welchen Nachruhm er dem Reimann einmal zu verdanken haben würde. Der Autor und sein Verleger waren ihrem König wohl umso dankbarer, dass er ihnen außer seinen komischen Aussprüchen nun auch noch diese hübsche Justizposse geschenkt hatte. Zensur hatte und hat eben immer einen großen Unterhaltungswert.
Wir DDR-Satiriker verdankten der Zensur ganz allgemein natürlich auch viel von unserer Popularität. Aber von unserm König Honecker persönlich verklagt zu werden, diese Ehre wurde meines Wissens keinem von uns zuteil. Jedenfalls drang davon nichts an die Öffentlichkeit. Bei uns wurde auch nicht erst verklagt, es wurde gleich verboten. Fast immer unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Mein höchstes Verbot, und das erfuhr ich selbst nur hinter vorgehaltener Hand, stammte vom Chef der Staatssicherheit, Erich Mielke. Darauf war und bin ich zwar stolz. Aber irgendeinen Vorteil brachte es mir nicht, von so hoher Stelle verboten zu werden. Mielkes Verdikt erreichte meinen Text, bevor er veröffentlicht werden konnte. Der Stasi-Chef hat es mir auch nicht etwa persönlich erteilt, sondern ließ es mir von anderer Stelle, ziemlich weit unten, mitteilen und zwar grußlos. Der Rechtsweg war ausgeschlossen,jeder Widerspruch sinnlos.
So etwas Unangenehmes ließen die obersten DDR-Chefs grundsätzlich von den unteren Organen vollstrecken, die – wenn es eilte – manchmal selbst erst nachträglich erfuhren, was sie gerade wieder verboten hatten.So musste Ende des Jahres 1988 der Postminister der DDR aus der Morgenpresse erfahren, dass er am Abend zuvor eine sowjetische Zeitschrift verboten hatte, die seines obersten Chefs Unwillen erregt hatte.
Komische private Äußerungen von Honecker, die man zu Anekdoten hätte verarbeiten können, wurden nicht bekannt. Im Kabarett genügte es, einfach seinen Tonfall zu kopieren, und das Publikum jubelte. Was er so auf Parteitagen gesagt hat, stand zwar überall gedruckt, aber dass das je einer wirklich gelesen hätte, wage ich zu bezweifeln. Parteidokumente wurden in der DDR »studiert«, aber nicht gelesen. Dass der Staatsratsvorsitzende so viel weniger Heiterkeit ausgelöst hat als dr Geenich, liegt auch nicht nur daran, dass der sächsische Dialekt so viel komischer ist als der saarländische.Es liegt wohl eher daran, dass er – im Gegensatz zum Geenich mit den vielen komischen Eigenheiten – eher ein Mann ohne Eigenschaften war. Das Komischste, was man von ihm – allerdings erst nach der Wende – erfuhr, war seine Vorliebe für Softpornos. Die ließ er sich von den Genossen der Staatssicherheit aus dem Westen besorgen. Diese ausführenden Genossen waren eben nicht nur für den Schutz, sondern auch für die umfassende Versorgung und Betreuung der führenden Genossen in Wandlitz zuständig. Selbstverständlich unterlagen sie einer strengen Schweigepflicht und durften keinem weitererzählen, was sie ihren weisen Führern da aus dem Westen ranschaffen mussten. Honecker selbst gab später zu Protokoll: »Wenn uns heute vorgeworfen wird, der Bevölkerung Wasser gepredigt, aber selbst Wein getrunken zu haben, das heißt, feudal gelebt zu haben, kann ich nur sagen, und das aus vollem Herzen, dass das nicht stimmt.« Nun ja, direkt feudal sind Softpornos ja nun auch wieder nicht.
Einen einzigen wirklich komischen Satz von Honecker habe ich im Gedächtnis behalten. Den wiederholte er oft genug auch im Fernsehen, wenn er sich von irgendwem verabschiedete: »Alles Gute, auch im persönlichen Leben!« Welches Leben es neben dem persönlichen noch geben sollte, ist mir bis heute ein Rätsel geblieben. Was er zu mir bei der Verleihung des Nationalpreises gesagt hat, habe ich vergessen. Vielleicht hat er gar nichts gesagt. Denn was hätte er mir auch sagen können? Wir kannten uns ja nicht. Dass er je einen Text von mir gelesen oder gehört hatte, halte ich für ganz und gar unwahrscheinlich. Dass er überhaupt mal in einem Kabarett war, kann ich mir nicht vorstellen. Zu seinen Vorlieben gehörte Satire bestimmt nicht. Er war eine ganz und gar ironiefreie Persönlichkeit.
Vom »persönlichen Leben« unseres Staatsratsvorsitzenden wusste man fast nichts. Und was gerüchteweise bekannt wurde, durfte weder gedruckt noch sonstwie öffentlich verbreitet werden. Er hauste mit den anderen obersten Parteiführern hinter den Mauern der Politbürosiedlung Wandlitz. Dass sie einander nicht ausstehen konnten, haben die entmachteten Greise dann übereinstimmend zu Protokoll gegeben. Ich hatte das immer vermutet. Der unbeschreibliche Wandlitzer Luxus aber, von dem in der Bevölkerung Wunderdinge erzählt worden waren, bestand – das wurde nach der Wende mit Empörung zur Kenntnis genommen – aus Messingmischbatterien in Bad und Küche. Gewöhnliche DDR-Bürger mussten sich mit solchen aus Kunststoff begnügen. Und sie tranken dort heimlich westliches Büchsenbier, während das Volk nur östliches Flaschenoder Fassbier zu kaufen bekam. Auch Südfrüchte bekamen die hohen Genossen wohl mehr als wir, und Videorecorder hatten sie lange vor uns. Vielleicht aßen sie sogar Erdbeeren im Winter. Seit ich nun selbst weiß, wie die schmecken, fällt es mir schwer, sie im Nachhinein um solchen Luxus zu beneiden.
Fast jeder von ihnen besaß irgendwo im Wald ein mit allerlei Luxus, aber wenig Geschmack ausgestattetes Jagdgrundstück mit entsprechendem Wach- und Bedienungspersonal. Ihre Ferien verbrachten die obersten Genossen gewöhnlich, abgeschirmt von jeder Öffentlichkeit, auf einer winzigen Insel im Greifswalder Bodden. Dort waren sie einander ausgeliefert wie in Wandlitz. Das kann so sehr erholsam nicht gewesen sein. Wenn sie zur Arbeit fuhren, dann wurden sie in großen Westautos – Bonzen- schleudern genannt – durch die für sie abgesperrten Straßen der Hauptstadt befördert. Die Häuser an der »Protokollstrecke« waren, nur so weit die Augen der alten Genossen reichten, bunt angemalt. Was außerhalb ihres begrenzten Blickfeldes verfiel, mussten sie nicht mitansehen. Ist es ein Wunder, dass ihr DDR-Bild weit schöner war als das unsere?
Auch von einem »persönlichen«, also privaten Leben der neben Honecker führenden Genossen stand zumindest nichts in der Zeitung. Hier und da tauchten immer mal irgendwelche Gerüchte auf. So wurde dem einen oder andern nachgesagt, er sei Alkoholiker. Mich verwunderte es eher, dass sie das nicht alle wurden, da in ihrem Wandlitzer Altenheim. In den Medien strahlten sie farblose Langeweile aus. Was sie sagten, war so belanglos wie austauschbar. Nein, auch zu großen Bösewichtern fehlte ihnen das Format. Selbst Mielke wirkte nicht wie ein großer böser Staatssicherheitsminister, eher wie ein kleiner, böser Hauswart, der unter Verfolgungswahn litt.
Von Honecker wusste man gerüchteweise, dass er, bevor er seine Margot in zweiter oder dritter Ehe heiraten durfte, ein Parteiverfahren wegen Ehebruchs über sich hatte ergehen lassen müssen. Das Gerücht besagte ferner, dass dieses Parteiverfahren damals von einem Genossen geleitet wurde, der später erster Sekretär der SED-Bezirksleitung Leipzig geworden ist. Deshalb soll Honecker dann, als er oberster Partei- und Staatschef wurde, dafür gesorgt haben, dass der Bezirk Leipzig in der Mittelvergabe benachteiligt wurde. Was wiederum zur Folge gehabt haben soll, dass Leipzig mehr als andere Städte in der DDR dem Verfall preisgegeben wurde. Ob das alles mit jenem Parteiverfahren etwas zu tun hatte oder nicht, vermag ich nicht zu beurteilen. Aber dass ausgerechnet die Messestadt Leipzig zur Honecker-Zeit mehr verfiel als andere vergleichbare DDR- Städte, das war nicht zu übersehen.
Ich bin als Kind der hochschwangeren Margot Feist – das war ihr Mädchenname – einmal begegnet. In den Fünfzigerjahren gab es in Dresden ein Pioniertreffen, zu dem ich »delegiert« wurde. Sie war damals so was wie unser Oberpionier. Jedenfalls durfte ich ihr – das war eine Auszeichnung – die Hand geben. Aufgefallen ist mir schon damals dieses gütig-wissende Lächeln, mit dem unsere führenden Genossen ihr tiefes Verständnis für die Sorgen der kleinen Leute zu erkennen gaben. Was mich – wie alle kleinen Leute – damals besonders beeindruckte, war natürlich, dass sie auch nichts Besonderes war und mir kleinem Finsterwalder Jungpionier die Hand gab, als sei das gar nichts Besonderes.
Viele Jahre später – sie war schon Volksbildungsministerin und ich Schauspieler am Berliner Kindertheater – habe ich sie einmal im Zuschauerraum des Deutschen Theaters in Berlin gesehen. Damals ging das Gerücht um, sie habe ein Verhältnis mit einem der Schauspieler dort. Auch von Erich Honecker gab es immer mal solche Gerüchte von kleineren Liebschaften. Das stand natürlich in keiner Zeitung und interessierte, soweit ich mich erinnere, auch kaum einen. Die Honeckers waren für uns – wie die anderen Spitzengenossen – reine Funktionsträger und sonst gar nichts. Schon damals war auch für DDR-Bürger jedes europäische Königshaus weitaus interessanter als die triste Kleinbürgerherrlichkeit der eigenen Landesfürsten.
Ganz anders verhielt es sich einst mit dem Interesse der Sachsen am Privat- und vor allem Liebesleben ihrer Monarchen. Der Kronprinz Friedrich August hatte seine spätere Gemahlin, Luise von Toscana, ausgerechnet da kennen gelernt, wo er nach seinem Sturz das Exil verbringen sollte – aufjenem Schloss Sibyllenort in Schlesien. Ihre Verlobung und erst recht ihre Vermählung 1891 in der Wiener Hofburg waren gesellschaftliche Ereignisse, die nicht nur von der sächsischen Öffentlichkeit mit dem gleichen Interesse verfolgt wurden wie heutzutage jede Prinzenhochzeit im demokratischen Europa. Der biedere Sachse und die lebenslustige Wienerin aus dem Hause Habsburg galten als Traumpaar. Öffentlich gefeiert wurde auch die Geburt jedes der sechs Kinder des hohen Paares. Die Prinzessin erfüllte mit diesem reichen Kindersegen und ihrem ausgeprägten Wiener Charme alle Erwartungen, die man damals in eine künftige Landesmutter setzte.
Aber mehr als fürstliche Eheschließung und Kindstaufen erregte die sächsische Öffentlichkeit ein Skandal. Die sehr populäre, zukünftige Königin von Sachsen fing, nachdem sie ihrem Gatten die vielen Kinder geboren hatte, ein Techtelmechtel mit einem Klavierspieler und Komponisten aus Florenz an, einem Herrn Toselli. Während der Gemahl – vermutlich zur Jagd – in Schlesien oder auf Schloss Moritzburg weilte, soll sie sich mit ihrem Pianisten auf Schloss Pillnitz zum Liebesspiel getroffen haben. So eine Homestory stellte alle Politik in den Schatten. Schließlich floh die Ehebrecherin mit ihrem Liebhaber in die Schweiz und teilte dem Hofe per Depesche mit, dass sie nicht die Absicht habe, zu ihrem Gemahl nach Dresden zurückzukehren. Möglicherweise hatte sie nebenbei auch ein Verhältnis mit dem Hauslehrer ihrer Kinder. Nur von ihm, einem belgischen Sprachlehrer namens André Giron, war nämlich in der offiziellen Scheidungsverlautbarung des Hofes die Rede. Toselli wurde darin gar nicht erwähnt. In Dresden jedenfalls gab es – ähnlich wie später in London, als sich Lady Di und Prinz Charles trennten – die wildesten Gerüchte. Wie die Angelsachsen ihre Diana, so verehrten auch die Obersachsen ihre Luise von Toscana.
Man hielt sie nicht nur für intelligenter als ihren etwas einfältigen Mann. Von ihr erwartete man auch, dass sie mit ihren liberalen Ansichten Einfluss auf die reformfeindliche Politik des verknöcherten Dresdner Hofes nehmen würde. Als der von ihr verlassene Gemahl im Jahre 1904 schließlich König wurde, bildete