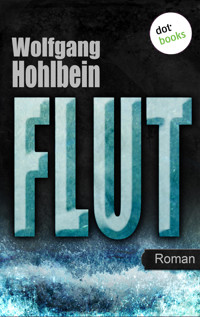Das Schwert der Finsternis: Die Abenteuer des Thor Garson - Fünfter Roman E-Book
Wolfgang Hohlbein
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Eine uralte Legende erwacht zum Leben: Der Mystery-Abenteuerroman „Das Schwert der Finsternis“ von Bestsellerautor Wolfgang Hohlbein jetzt als eBook bei dotbooks. Das Gerücht verbreitet sich rasend schnell. Ist tatsächlich das Schwert des Dschingis Khan gefunden worden? In der Mongolei sollen sich Tausende, wenn nicht gar Hunderttausende Hunnen zusammenrotten, um die alte Weissagung zu erfüllen: Derjenige, der das Schwert erhebt, wird unbesiegbar sein und das mongolische Weltreich neu begründen. Der berühmte Abenteurer Thor Garson ahnt von alledem noch nichts, als er zu einem festlichen Empfang in die Russische Botschaft geladen wird. Dort bittet ihn die attraktive Kommissarin Tamara Jaglova um Hilfe. Doch die Gefahr ist bereits näher als geahnt – jemand will verhindern, dass Thor diesen Abend überlebt … Packend, spannend, mysteriös – die Kultserie für alle Fans von Indiana Jones und Lara Croft! Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der fünfte Roman der Thor Garson-Serie „Das Schwert der Finsternis“ von Wolfgang Hohlbein. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 463
Ähnliche
Über dieses Buch:
Das Gerücht verbreitet sich rasend schnell. Ist tatsächlich das Schwert des Dschingis Khan gefunden worden? In der Mongolei sollen sich Tausende, wenn nicht gar Hunderttausende Hunnen zusammenrotten, um die alte Weissagung zu erfüllen: Derjenige, der das Schwert erhebt, wird unbesiegbar sein und das mongolische Weltreich neu begründen. Der berühmte Abenteurer Thor Garson ahnt von alledem noch nichts, als er zu einem festlichen Empfang in die Russische Botschaft geladen wird. Dort bittet ihn die attraktive Kommissarin Tamara Jaglova um Hilfe. Doch die Gefahr ist bereits näher als geahnt – jemand will verhindern, dass Thor diesen Abend überlebt …
Packend, spannend, mysteriös – Die Kultserie für alle Fans von Indiana Jones und Lara Croft!
Über den Autor:
Wolfgang Hohlbein, 1953 in Weimar geboren, ist Deutschlands erfolgreichster Fantasy-Autor. Der Durchbruch gelang ihm 1983 mit dem preisgekrönten Jugendbuch MÄRCHENMOND. Inzwischen hat er 150 Bestseller mit einer Gesamtauflage von über 44 Millionen Büchern verfasst. 2012 erhielt er den internationalen Literaturpreis NUX.
Die Romane der Die Abenteuer des Thor Garson-Reihe
Dämonengott Das Totenschiff Der Fluch des Goldes Der Kristall des Todes Das Schwert der Finsternis erscheinen bei dotbooks.
Wolfgang Hohlbein veröffentlicht bei dotbooks auch die folgenden eBooks:
Azrael Azrael – Die Wiederkehr Almanach des Grauens (mit Dieter Winkler)Fluch – Schiff des Grauens Das Netz Im Netz der Spinnen sowie die ELEMENTIS-Trilogie mit den Einzelbänden Flut, Feuer und Sturm und die große ENWOR-Saga
Die Jugendromane Nach dem großen Feuer, Der weiße Ritter: Wolfsnebel, Der weiße Ritter: Schattentanz, Drachentöter, Ithaka
und Kinderbücher Teufelchen, Saint Nick – Der Tag, den dem der Weihnachtsmann durchdrehte, NORG: Im verbotenen Land und NORG: Im Tal des Ungeheuers erscheinen ebenfalls bei dotbooks.
Wolfgang Hohlbein im Internet: www.hohlbein.de
***
Originalausgabe April 2018
Copyright © der Originalausgabe 2018 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Redaktion: Frank Rehfeld
Titelbildgestaltung: Tanja Winkler, Weichs
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (aks)
ISBN 978-3-96148-238-2
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort Schwert der Finsternis an: [email protected]
Gerne informieren wir Sie über unsere aktuellen Neuerscheinungen und attraktive Preisaktionen – melden Sie sich einfach für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Wolfgang Hohlbein
Das Schwert der Finsternis
Die Abenteuer des Thor Garson – Fünfter Roman
dotbooks.
Ein namenloser Fluss an der russisch-mongolischen Grenze Mitte des vorigen Jahrhunderts
Auf einen Ort zu stoßen, dessen Name auf keiner Karte verzeichnet war, das war an sich nichts Außergewöhnliches. Schon gar nicht hier, in einem Winkel der Welt, von dem die allermeisten Menschen kaum wussten, dass er existierte, geschweige denn, wo er lag und wie es dort aussah.
Auch auf eine kleine Ansiedlung zu treffen, die man in den schon etwas detaillierteren Karten, die die Bewohner dieses Landes von ihrer Heimat angefertigt hatten, vergebens suchte, wäre allerhöchstens ein bisschen überraschend gewesen. Ein bisschen, aber nicht sehr.
Und selbst ein Dorf, dessen Position und Name in den schon sehr viel genaueren militärischen Kartenwerken der Gegend fehlte, wäre noch vorstellbar gewesen, wenn auch schon schwerer. Sogar hier, am unbestrittenen Ende der zivilisierten Welt (und vielleicht schon ein bisschen dahinter), pflegte das Militär prinzipiell alles zu wissen, was es zu wissen gab – und nach Möglichkeit auch noch ein bisschen mehr. Trotzdem … es war denkbar.
Aber auf eine ganze Zeltstadt zu stoßen, die noch vor achtundvierzig Stunden schlicht und einfach nicht da gewesen war, das erschütterte Michail bis in die tiefsten Tiefen seiner Kosakenseele. So tief, dass er seit nunmehr gut zwei Minuten reglos im aufgeklappten Turmluk des T32 stand, auf die Ansammlung kunterbunter Zelte im Tal unter sich hinabstarrte und weder den eisigen Wind registrierte, der wie mit dünnen gläsernen Klingen in sein Gesicht schnitt und sich mittlerweile anschickte, seinen sorgsam gestutzten Vollbart mit Eis zu verkrusten, noch die immer nervöseren Blicke, die das halbe Dutzend Panzerinfanteristen in seiner Begleitung abwechselnd ihm und der Kette pelzvermummter Gestalten zuwarf, die sich langsam den Hang hinauf und auf den Panzer zubewegten.
Er glaubte es einfach nicht.
Er glaubte es nicht, weil es nicht sein konnte, und es konnte nicht sein, weil es nicht sein durfte. Basta.
Unverschämterweise streckte die Wirklichkeit in Gestalt besagter Zelte und Männer seiner unerschütterlichen Überzeugung weiter beharrlich die Zunge heraus, und so tat Michail schließlich das, was er schon vor anderthalb Minuten hätte tun sollen – er ließ mit einem verwirrten Seufzer zuerst den Feldstecher und dann sich selbst zurück in das Turmluk des Panzers sinken. Natürlich stieß er sich prompt den Hinterkopf bei dieser Aktion, und er ließ auch jetzt den gleichen, unflätigen Fluch hören wie jedes Mal, wenn das passierte.
Michail hasste diesen Panzer. Da er Kosak mit Leib und Seele war, verachtete er prinzipiell alles, was nicht vier Beine, einen Schweif, eine Mähne und Nüstern hatte, aber diesem speziellen Panzer galt sein ganz besonderer Hass. Seit er dieses rasselnde, schnaufende, klirrende, stinkende Ding vor einem halben Jahr zum ersten Mal gesehen hatte, hasste er es, und er war überzeugt davon, dass dieser Hass auf Gegenseitigkeit beruhte, denn es verging kein Tag, an dem er sich nicht mindestens einmal daran stieß, schnitt, prellte, klemmte oder die Finger verbrannte. Michail wusste, dass seine Männer bereits hinter vorgehaltener Hand Wetten abschlossen, auf welche Weise er sich wohl das nächste Mal verletzen würde, wenn er das staubgraue Ungeheuer auch nur von der Seite ansah. Wer auch immer behauptete, Maschinen hätten keine Seele, hatte entweder nicht alle Tassen im Schrank oder er log. Zumindest dieser T32 hatte eine Seele. Und sie war schwärzer als die des Teufels.
Nun konnte man nicht unbedingt sagen, dass Michail unvoreingenommen gewesen wäre, was dieses Fahrzeug anging. Oder sein Kommando. Oder die Umstände seiner Versetzung hierher überhaupt. Von diesem Land ganz abgesehen.
Schon Michails Urgroßvater war Kosak gewesen. Wie sein Großvater. Und sein Vater auch.
Michail war es nicht.
Das hatte verschiedene Gründe, hauptsächlich aber den, dass die Bolschewiken einen Preis auf die Köpfe von Männern wie ihn ausgesetzt hatten, sodass es Michail schon früh ratsam erschienen war, sowohl seinen Namen als auch gewisse Details in seiner Geburtsurkunde und seinen übrigen Papieren zu ändern. Zum anderen gehörte Michail unglücklicherweise zu jenen Menschen, die prinzipiell den Sand bildeten, der das Räderwerk jeder großen Organisation zum Knirschen brachte. Die Rote Armee war eine immens große Organisation, und wenn sie auch im Grunde nicht viel mehr tat, als sich selbst zu verwalten, so gab es doch eine Menge Zehen, auf die man treten konnte. Michail war auf ihnen allen nach Kräften herumgehopst – mit dem Ergebnis, dass er sich schneller am Ende der Welt wiedergefunden hatte, als er seinen eigenen Namen buchstabieren konnte. Einzig der Umstand, dass er neben allem anderen auch noch ein Kriegsheld war, dessen Taten nicht einmal der Oberste Sowjet in Moskau ohne weiteres ignorieren konnte, hatte ihn davor bewahrt, als einfacher Soldat statt als Offizier hier zu landen und den Rest seiner Tage damit zu verbringen, Latrinen zu säubern. Aber das war auch schon alles.
»Genosse Kommandant?«
Michail fuhr aus seinen düsteren Überlegungen auf und blickte an seinen Knien vorbei hinab ins Gesicht des Bordkanoniers, der eingezwängt wie in einer Sardinenbüchse unter ihm hockte. Sein Gesicht war rot vor Kälte. Das war eine weitere Gemeinheit, mit der dieser Panzer aufzuwarten wusste. Egal ob er stand oder fuhr, es war in seinem Inneren immer ein bisschen kälter als draußen. Natürlich nur im Winter. Im Sommer war es stets heißer.
»Ja?«, grunzte er.
Der Mann deutete mit einer Kopfbewegung auf den kaum fingerbreiten Sehschlitz vor sich. »Ich glaube, sie kommen näher.« Seine Stimme klang fast ängstlich.
Michail seufzte erneut und sehr tief, schob Kopf und Schultern aber wieder aus dem Turmluk heraus, wobei er sorgsam darauf achtete, sich diesmal nicht den Hinterkopf anzuschlagen. Es gelang ihm, aber dafür prellte er sich das rechte Knie.
Die Gestalten waren tatsächlich näher gekommen, nahe genug, dass er sie jetzt auch ohne Feldstecher erkennen konnte. Michail spürte, dass ihre sonderbare Kleidung ihm eigentlich etwas sagen sollte. Zu diesem vagen Gefühl kam seine stärker werdende Beunruhigung. Spürte etwas in ihm vielleicht eine Gefahr, die von den Männern in den langen, bunt bestickten Wollmänteln ausging?
Einen Moment dachte er ganz ernsthaft über diese Frage nach, verneinte sie aber dann. Es waren vierzig, vielleicht sogar fünfzig, aber sie waren nicht – und wenn, dann allenfalls mit Messern, Speeren und – lächerlich! – lederbezogenen Schilden – bewaffnet, während er selbst fünf mit Maschinenpistolen und Karabinern ausgerüstete Infanteristen draußen und zwei weitere Männer hier drinnen hatte. Außerdem saß er sicher hinter zweieinhalb Zentimetern bestem russischem Stahl und gebot über eine 7,5cm-Kanone und zwei doppelläufige Maschinengewehre.
Nein – was ihn beunruhigte, das war nicht die Gefahr, die von diesen Männern ausging. Es war die Tatsache, dass sie hier waren.
Wenn er sich diese Zeltstadt dort unten ansah, dann musste der Stamm aus mindestens zweihundert Nomaden bestehen – und wie, zum Teufel, hatten es zweihundert Menschen geschafft, mit Sack und Pack hierherzukommen, ohne dass er es gemerkt hatte? Und – viel interessanter – was wollten sie hier?
Wenn man dieses Zeltlager genauer in Augenschein nahm und seine Fantasie auch nur ein kleines bisschen spielen ließ, dann fiel einem sehr schnell zweierlei auf: Erstens, dass es nicht den Eindruck machte, in aller Hast und nur für ein paar Tage errichtet worden zu sein. Und zweitens, dass es durchaus auf Zuwachs gebaut war. Was, um alles in der Welt, hatte dieses Gesindel vor? Sich hier häuslich niederzulassen oder vielleicht gleich einen eigenen Staat auszurufen? Nun, Michail würde sowohl gegen das eine als auch gegen das andere etwas unternehmen.
Ganz besonders gegen das eine. O ja, er würde noch etwas tun, sobald sie zurück in der Garnison waren: nämlich dem verantwortlichen Offizier, der hier vor zwei Tagen angeblich keine Menschenseele angetroffen hatte, so kräftig in den Arsch treten, dass er den Geschmack seiner Stiefelspitzen auf der Zunge spürte.
»Ich glaube, Sie haben recht, Fjodor«, antwortete Michail schließlich. Diese Antwort war erstens überflüssig und erfolgte zweitens mit gehöriger Verspätung. Beides waren seine Untergebenen von ihm gewohnt. Seine Vorgesetzten auch.
Fjodor schwieg eine ganze Weile. Dann, und in einem Ton, der fast ängstlich darauf bedacht war, auch nicht die Spur von Kritik am offenkundigen Zögern seines Vorgesetzten mitklingen zu lassen: »Vielleicht … sollte man etwas tun? Mit ihnen reden … vielleicht.«
»Vielleicht«, pflichtete ihm Michail bei. Vielleicht war eines seiner Lieblingsworte. Es ließ so viele schöne Möglichkeiten offen. Unter anderem die, gar nichts zu tun.
Aus eng zusammengekniffenen Augen – die Sonne spendete zwar kaum Wärme, aber ihr Licht war geradezu stechend – blickte er auf die Ansammlung gleichermaßen alberner wie bedrohlicher Gestalten hinab, die sich seinem Panzer und den fünf Rotarmisten mittlerweile bis auf gut hundert Meter genähert hatten. Nicht nahe genug, um den Ausdruck auf ihren Gesichtern wirklich zu erkennen. Trotzdem war da etwas … Verschlagenes? Unsinn!
»Was sind das für welche?«, murmelte er. »Tungusen? Kirgisen?« Er blickte zwischen seinen gespreizten Beinen hindurch in Fjodors hochgerecktes, breites Mongolengesicht. Dann wusste er es. »Mongolen«, sagte er. Er gab sich keine Mühe, die Verachtung, die in seiner Stimme dabei mitschwang, auch nur irgendwie zu unterdrücken. Was nichts mit dem Volk der Mongolen oder gar mit Fjodor persönlich zu tun hatte. Wie gesagt – Michail war Kosak mit Leib und Seele, und ein waschechter Kosak verachtete nun einmal jeden, der kein Kosak war. Zumindest Michail tat das. »Sie sind doch Mongole …«, begann er.
Fjodor räusperte sich. »Nun ja. Mein Großvater mütterlicherseits –«
»… Also sprechen Sie auch ihre Sprache«, führte Michail den Gedanken mit messerscharfer Logik zu Ende. »Gehen Sie hinaus und reden Sie mit ihnen. Fragen Sie die Burschen, was sie hier zu suchen haben.«
Fjodor wand sich wie der berühmte Fisch an der Angel. »Vielleicht wäre das keine so gute Idee«, sagte er vorsichtig.
Michails linke Augenbraue verschwand unter dem Rand seiner Kosakenmütze, die er – völlig unberührt von sämtlichen Bekleidungsvorschriften der Roten Armee – zu seiner Uniform trug. Wenigstens hier draußen, wo es niemand sah. »Das war kein freundschaftlicher Rat, Genosse«, sagte er. »Das war ein Befehl!«
»Ich weiß, ich weiß«, sagte Fjodor hastig. »Ich dachte nur … es wäre vielleicht besser, wenn der Panzer einsatzfähig bliebe. Nur für den Fall der Fälle«, fügte er mit einem verlegenen Lächeln hinzu.
Michail starrte ihn an, aber dann nickte er. Schon weil der Umstand, dass Fjodor den Panzer verließ, zwangsläufig auch bedeutete, dass er aus dem Turmluk heraus- und wieder hineinklettern musste. Im Zweifelsfalle vier neue, schmerzhafte Schrammen oder Beulen. Er entschied sich dagegen.
Die Clownparade war wieder näher gekommen. Noch achtzig Meter, schätzte Michail. Das reichte. Mit einem Ruck warf er sich in die Brust, bildete mit den Händen einen Trichter vor dem Mund und schrie mit vollem Stimmaufwand: »Wer seid ihr? Was sucht ihr hier?«
Er bekam keine Antwort. Gute zehn Sekunden vergingen, und die Meute hatte sich auf vielleicht siebzig Meter genähert, bis Michail sich eingestand, dass die Männer weder ihm noch seiner Uniform oder dem roten Stern auf beiden Seiten seines Panzers genügend Respekt zollten, um zu antworten. Oder auch nur stehen zu bleiben. Allmählich wurde Michail doch ein wenig mulmig zumute …
Mit herrischer Geste wies er auf den Panzerinfanteristen, der das Pech hatte, dem T32 am nächsten zu stehen. »Sie da! Gehen Sie hin und fragen Sie, wer die sind!«
Der Mann setzte sich zögernd in Bewegung. In seinem langen rotbraunen Mantel sah er kaum weniger lächerlich aus als die Gestalten vor ihm, dachte Michail. Und zugleich irgendwie … verloren?
»Das gefällt mir nicht«, sagte Fjodor unter ihm. »Vielleicht sollten wir besser den Motor anlassen?«
»Red keinen Unsinn, Genosse«, knurrte Michail verächtlich. »Das sind doch nur ein paar harmlose Herumtreiber.«
Der Rotarmist hatte die bunt gekleidete Schar erreicht und blieb stehen, aber er kam nicht einmal dazu, den Mund zu öffnen, denn einer der Männer zog kommentarlos ein Schwert unter dem Mantel hervor und schlug ihm den Kopf ab. Das alles ging so schnell und fast undramatisch, dass Michail geschlagene fünf Sekunden einfach in seinem Panzerluke stand und aus fassungslos aufgerissenen Augen auf den Kopf mit der pelzgefütterten Mütze starrte, der eine blutige Spur durch den Schnee zog, während er wie ein Ball den Hügel hinunterrollte. Dann schien alles gleichzeitig zu geschehen; rasend schnell, als hätte jemand die Wirklichkeit ein paarmal gefaltet, damit die Dinge schneller als eigentlich möglich ablaufen konnten: Der enthauptete Körper des Panzerinfanteristen neigte sich steif wie ein Brett und nach einer absurden Verzögerung zur Seite und fiel in den Schnee. In den Händen der gut fünfzig Gestalten, die plötzlich wie ein Mann losrannten und dabei ein markerschütterndes Geheul und Gebrüll anstimmten, erschienen plötzlich jene Schwerter und Krummsäbel, die sie unter ihren langen Mänteln verborgen hatten. Michails verbliebene vier Panzerinfanteristen zerrten ihre Gewehre von den Schultern; zwei von ihnen legten sofort auf die Heranstürmenden an; die beiden anderen suchten hastig Deckung hinter dem T32.
Das alles geschah in ungefähr einer Sekunde.
In der zweiten ließ sich Michail in den Turm hineinfallen, knallte die gepanzerte Luke über sich zu (wobei er sich kräftig die Finger der linken Hand quetschte) und brüllte, so laut er konnte: »Lass diesen verdammten Motor an!«
Während der Fahrer unter ihnen ebenso verzweifelt wie vergeblich versuchte den schweren Dieselmotor des Panzers zu starten, versuchte Michail sich an Fjodor vorbeizuquetschen, um mit ihm den Platz hinter der Kanone zu tauschen. Gleichzeitig tat er sein Bestes, hinter eines der beiden schweren Maschinengewehre zu gelangen und ebenso gleichzeitig einen Blick durch die Sehschlitze nach draußen zu werfen. Zwei dieser drei Unternehmungen schlugen fehl; der Platz im Turm des T32 war einfach nicht ausreichend, um Michail nach unten und Fjodor zugleich nach oben zu lassen, sodass für eine Sekunde ein hoffnungsloses Geschiebe und Gedränge entstand.
Im Verschluss des Maschinengewehres klemmte er sich den gleichen Finger noch einmal, den er sich eben erst im Turmluk des Panzers gequetscht hatte, aber zumindest klappte es mit dem Blick nach draußen.
Er war bloß nicht sehr glücklich darüber. Die Angreifer hatten sich dem Panzer mittlerweile auf knapp zwanzig Meter genähert. Ein erster Speer flog in hohem Bogen heran und prallte klappernd von den Panzerplatten ab, und genau in diesem Moment – endlich! – kamen seine Leute auf die Idee, das Feuer zu eröffnen. Im Inneren des Panzers klangen die Schüsse der schweren Armeekarabiner sonderbar gedämpft und leise, aber Michail sah das orangerote Mündungsfeuer und den Bruchteil einer Sekunde danach stürzten zwei Gestalten leblos in den Schnee.
Der Rest stürmte ungerührt weiter. Sie schrien irgendetwas, aber Michail verstand es nicht. Er verschwendete auch keine Zeit darauf, es verstehen zu wollen, sondern kämpfte fluchend mit dem Verschluss des MG. »Was ist mit diesem Scheiß-Motor?!«, brüllte er.
Er bekam keine Antwort, aber wenigstens gelang es ihm endlich, seinen Daumen aus dem Verschluss des MG heraus- und den Ladestreifen hineinzubekommen. Die Angreifer waren am Ziel. Ein Hagel von Speeren, Pfeilen und geschleuderten Äxten prasselte auf den Panzer und wohl auch Michails Leute herab, denn er hörte einen gurgelnden Schrei und im eingeschränkten Sichtfeld des Sehschlitzes sah er eine schlaffe Hand, die ein Gewehr fallen ließ. Die drei anderen Soldaten schossen verzweifelt weiter und fast jede Kugel traf – die Angreifer jedoch stürmten unbeeindruckt näher.
Direkt in die erste Salve aus Michails MG hinein.
Auf eine Distanz von jetzt kaum noch fünf Metern war die Wirkung verheerend. Fünf oder sechs Männer wurden scheinbar zugleich von den Füßen gerissen und fielen reglos in den Schnee, der Rest spritzte in alle Richtungen auseinander. Michails MG folgte ihnen unbarmherzig. Er erwischte zwei, drei weitere Gestalten, dann war der Ladestreifen verschossen.
Michails Fluch ging im Dröhnen des anspringenden Motors unter. Der Panzer stieß eine gewaltige Qualmwolke aus und rollte los, und hinter ihm stürzte einer der beiden Rotarmisten, die sich gegen seine Flanke gelehnt hatten, mit einem überraschten Keuchen in den Schnee. Michail bemerkte es nicht einmal. Er war voll und ganz damit beschäftigt, einen neuen Munitionsgurt in das MG zu stopfen und Fjodor anzuschreien, der tatenlos über ihm im Turm des Panzers hockte. »Idiot! Warum schießt du nicht?«
»Aber worauf denn?«, fragte Fjodor. »Sie sind viel zu nahe!« Michail warf einen Blick nach draußen und sah ein, dass Fjodor recht hatte. Diese Verrückten waren mittlerweile sogar zu nahe für sein MG – was ihn allerdings nicht daran hinderte, Fjodor lauthals weiter zu verfluchen und mit einer erstaunlichen Vielzahl von Beschimpfungen zu bedenken.
Langsam gewann der Panzer an Tempo. Das Gewehrfeuer draußen hatte aufgehört und Michail fürchtete zu recht, dass er den Grund dafür kannte. Trotz seiner MG-Salve mussten noch mindestens zwanzig oder dreißig dieser Verrückten den Panzer erreicht haben; seine Männer hatten nicht die Spur einer Chance.
Na gut, dachte Michail grimmig. Fünf von uns. Fünfzig von euch, wenn ich mit euch fertig bin. Mindestens.
»Schneller!«, brüllte er den Fahrer an. »Fahr ins Dorf! Wir radieren sie aus!«
Der Motor brüllte auf und Fjodor nahm Michails Worte zum Anlass, seine Kanone abzufeuern. Die Granate schlug einen guten Kilometer hinter der Zeltstadt ein und ließ eine zwanzig Meter hohe Staub- und Trümmerfontäne in die Luft steigen.
»Idiot!«, brüllte Michail. Gleichzeitig sah er sich wild um, sofern der winzige Sehschlitz dies zuließ. Wo waren sie? Zumindest einer von ihnen war ganz in seiner Nähe, aber das merkte Michail erst, als ein halber Meter rasiermesserscharf geschliffener Stahl durch die Sichtluke hereinfuhr und eine dünne, teuflisch brennende Linie in seinem Gesicht hinterließ.
Michail kreischte, warf sich zurück und schlug ganz instinktiv mit dem Unterarm nach der Klinge. Der dicke Wintermantel bewahrte ihn vor einer weiteren Verletzung. Er hörte einen Schrei, die Klinge verschwand aus dem Sehschlitz und plötzlich war ein Schatten vor ihm. Michail drückte ab und nahm den Finger erst vom Abzug, als er spürte, wie etwas unter die Ketten des Panzers geriet, das härter als Schnee, aber weicher als Felsen war.
Sie sind auf dem Panzer!, dachte Michail entsetzt. Der T32 raste in einem Höllentempo den Hügel hinab, aber ein paar dieser Halbaffen mussten ihn geentert haben wie ein vorbeisegelndes Schiff. Großer Gott, vielleicht waren sie gerade dabei, das Turmluk aufzubrechen oder irgendwie Benzin hineinzukippen – in seinen Panzer!
Michails heiliger Zorn über diese Unverschämtheit ließ ihn für einen Moment seine Angst vergessen. Wütend zerrte er an dem entsprechenden Hebel und ließ den Turm hochschwenken. Etwas prallte mit einem dumpfen Laut gegen den Lauf der Kanone und stürzte in den Schnee (und, wie Michail inständig hoffte, unter die Ketten), einen zweiten Angreifer erwischte er mit einem kurzen Feuerstoß des MGs. Als er auf den dritten zielen wollte, schwang sich der Bursche wie ein Zirkusartist am Kanonenrohr in die Höhe und verschwand aus dem Rechteck, durch das Michail die Außenwelt wahrnehmen konnte.
Michail tat das, womit er den Großteil der letzten fünf Minuten verbracht hatte. Er fluchte lauthals, ließ das MG fahren und drängte sich an Fjodor vorbei zum Turmluk hinauf. Über ihm polterte etwas. Michail riss das Turmluk auf, duckte sich und gab gleichzeitig einen Feuerstoß aus seiner Kalaschnikow ab.
Ein Schrei ertönte, einen Herzschlag später von einem dumpfen Aufprall gefolgt. Mit einem triumphierenden Grinsen richtete sich Michail auf – und brüllte vor Schmerz, als geschliffener Stahl tief in seine Schulter drang. Er spürte, wie sein linkes Schlüsselbein brach.
Die Klinge wurde zurückgezogen und ein neuer, noch schlimmerer Schmerz ließ rote Lichtblitze vor Michails Augen tanzen. Instinktiv packte er die Kalaschnikow mit beiden Händen, riss sie hoch über den Kopf und fing den nächsten Schwerthieb mit der Waffe ab.
Die Erschütterung riss ihm die Kalaschnikow aus den Händen. Sein linker Arm war plötzlich ohne Kraft und sank nutzlos herab. Warmes Blut tränkte seinen Mantel und lief an seinem Rücken hinab. Trotz der Schmerzen stemmte er sich mit einem Schrei vollends aus dem Turmluk heraus, packte den Angreifer, der gerade zu einem weiteren Hieb ausholte, mit der unverletzten Rechten und entrang ihm das Schwert. Todesangst und Wut verliehen ihm übermenschliche Kräfte. Er riss den Burschen in die Höhe, rammte ihm das Knie in den Leib und versetzte ihm einen Stoß, der ihn vom Turm herunter auf das Heck des Panzers stürzen ließ. Sofort versuchte der Angreifer sich wieder aufzurappeln, aber Michail ließ ihm keine Chance: Ehe der Schmerz in seiner Schulter übermächtig werden und ihm die Sinne rauben konnte, zog er die Pistole unter dem Mantel hervor und erschoss ihn.
An die nächsten zehn Sekunden erinnerte er sich nicht mehr.
Als er wieder halbwegs klar denken konnte, hatte der Panzer den Fuß des Hügels erreicht. Fjodor musste einen weiteren Schuss abgegeben haben, denn zwei der bunten Zelte waren verschwunden und ein halbes Dutzend anderer stand in Flammen.
Aber irgendetwas stimmte nicht.
Es dauerte eine Weile, bis die Erkenntnis in Michails schmerzvernebeltes Bewusstsein vordrang, dann aber begriff er es: Nichts in diesem Dorf rührte sich. Die Zelte brannten lichterloh. Trümmer und glühende Granatsplitter hatten ein Dutzend weitere Behausungen durchlöchert. Es hätte Dutzende, wenn nicht Hunderte Verletzte geben müssen, Schreie, Flüchtende …
Nichts. Das Dorf war leer.
Es war leer, weil sie … gewollt hatten, dass Michail den Panzer hier herunterbrachte!
»Idiot!«, murmelte Michail. Diesmal galt das Wort ihm selbst. Mit zusammengebissenen Zähnen stemmte er sich in die Höhe und blickte sich um.
Und dann sah er sie.
Die Männer, die den Angriff auf seinen Panzer überlebt hatten (es waren weit mehr, als Michail befürchtet hatte!), waren auf halber Höhe des Hügels stehen geblieben, aber über ihnen, zweihundertfünfzig, vielleicht dreihundert Meter entfernt …
Michail zweifelte einige Sekunden lang ernsthaft an seinem Verstand.
Auf der Kuppe des Hügels waren Reiter erschienen. Hunderte, zwei-, drei-, vielleicht vierhundert pelzvermummte Gestalten, die auf kleinen, struppigen Ponys hockten, Gestalten mit Schilden und Speeren und spitzen, pelzverbrämten Hüten.
Und es waren nicht irgendwelche Reiter.
Das waren … Hunnen!, dachte Michail ungläubig. Unmöglich!, dachte er. Un-mög-lich! Er fantasierte! Es konnte keine andere Erklärung geben. Er lag im Lazarett und fantasierte sich das alles zusammen!
Eine der Gestalten oben auf dem Hügel hob plötzlich den Arm und ein halbes Dutzend Reiter glitt aus den Sätteln. Michail wusste nicht warum und er wollte es plötzlich auch gar nicht mehr wissen. So rasch es seine Schulter zuließ, rutschte er in den Turm zurück und zog das Luk mit der unverletzten Hand über sich zu. Ein Blick in Fjodors schreckensbleiches Gesicht verriet ihm, dass dieser die Reiter ebenfalls gesehen hatte. Dann wurde Fjodor noch ein bisschen blasser und riss erschrocken die Augen auf.
»Ihre Schulter!«, keuchte er. »Sie sind ja verletzt!«
»Ein Kratzer«, presste Michail zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor. Rasch ließ er sich an Fjodor vorbei wieder auf seinen Platz hinter dem MG sinken und brüllte den Fahrer an: »Umdrehen! Los, wenden!« Gleichzeitig ließ er den Turm so herumschwenken, dass er den Hügel im Auge behalten konnte.
Leider nicht die Reiter, dazu war der Winkel zu ungünstig. Aber es verging nicht einmal eine Minute, da wusste Michail, was die Männer getan hatten, die aus den Sätteln gestiegen waren.
Der Panzer hatte eine schwerfällige halbe Drehung vollendet, bei der er ein weiteres halbes Dutzend Zelte dem Erdboden gleichgemacht hatte, als etwas in einer gewaltigen Wolke aus Pulverschnee den Hügel hinabgerollt kam.
Es war ein Baumstamm.
Er war unterwegs anscheinend abgelenkt worden, denn er verfehlte den Panzer um fast dreißig Meter und riss eine breite Spur der Zerstörung in das brennende Zeltdorf. Aber es war nur der erste einer ganzen Lawine von Baumstämmen, die polternd und dröhnend den Hang hinuntergerast kam.
»Schneller!«,brüllte Michail. »Gib Gas! Schneller!« Er war der Panik nahe – nicht ganz zu unrecht, wie er eine Sekunde später begriff, als das erste der tödlichen Geschosse den Panzer traf. Ein ungeheurer Aufprall ließ den T32 erbeben. Michails Zähne schlugen heftig aufeinander. Sein Mund füllte sich mit Blut. Hochspritzender Schnee nahm ihm die Sicht. Er schrie vor Schmerz und Angst, spuckte abgebrochene Zähne aus und versuchte sich irgendwo festzuklammern, und im gleichen Moment traf ein zweiter, ungleich härterer Schlag den Panzer.
Michail spürte, wie die Ketten auf der linken Seite den Kontakt zum Boden verloren und durchdrehten. Für einen entsetzlichen Moment war er fest davon überzeugt, dass der Panzer umkippen würde, dann fiel dieser mit einem dritten, noch härteren Schlag zurück, und irgendwie brachte der Fahrer das Kunststück fertig, ihn vollends zu drehen und sogar ein kleines Stück den Hang hinaufzurollen. Gerade im richtigen Moment, um Michail erkennen zu lassen, wie sich eine zweite Lawine den Hang hinunter in Bewegung setzte.
Diesmal bestand sie nicht aus Bäumen, sondern aus Reitern, die Schwerter, Speere und Bögen schwangen. Ein gellender Schrei aus Hunderten und Aberhunderten von Kehlen drang an Michails Ohr. Diesmal verstand er, was sie schrien. Es war ein einziges Wort. Immer und immer wieder: »Temujin! Temujin! Temujin!«
»Großer Gott«, flüsterte Michail. »Was …« Und plötzlich schrie er: »Fjodor! Schieß doch, verdammter Idiot!«
Fjodor feuerte nicht. Die Kanone über Michail blieb stumm, und als er den Kopf in den Nacken warf und nach oben blickte, sah er auch, warum das so war: Fjodor hing reglos und mit blutüberströmtem Gesicht in seinem Sitz. Er hatte sich an seiner eigenen Kanone den Schädel eingeschlagen.
»Fahr«, murmelte Michail. »Los!«
Der Panzer setzte sich in Bewegung, aber er kam nur ein paar Meter weit, ehe die beschädigte Kette auf der linken Seite vollends riss. Das Fahrzeug begann sich auf der Stelle zu drehen und kam zur Ruhe, als der Fahrer die Sinnlosigkeit seiner Bemühungen einsah und den Motor abschaltete. Michail ließ den Turm ein kleines Stück herumschwenken, um die heranstürmende Reiterhorde im Auge zu behalten. Sie hatten die Hälfte des Hügels hinter sich gebracht und schrien noch immer ihren schrillen, monotonen Schlachtruf: »Temujin! Temujin! Temujin!«
»Was tun wir, Genosse?«, fragte der Fahrer. Die Ruhe in seiner Stimme überraschte Michail im ersten Moment, bis ihm klar wurde, dass auch er ganz plötzlich keine Angst mehr hatte, sondern eine fast heitere Gelassenheit verspürte.
Er könnte hinauf in den Turm steigen und versuchen die Kanone selbst abzufeuern, überlegte er. Oder sein MG leerschießen, um wenigstens noch ein paar von ihnen mitzunehmen.
Aber er tat nichts von alledem. Er saß einfach da, blickte den heranstürmenden Reitern entgegen und lauschte ihren gellenden, fast schon hysterischen Schreien. Warum tun sie das?, dachte er. Laut und sehr ruhig sagte er: »Ich fürchte, diese Geschichte nimmt kein gutes Ende, Genosse.«
Er seufzte, schmiegte die Hände um das MG und zog sie wieder zurück, ohne dem Abzug auch nur nahe zu kommen, seufzte noch einmal und fügte bloß für sich und in Gedanken hinzu: Ich hätte bei den Kosaken bleiben sollen, wie mir mein Vater geraten hat.
Er sollte recht behalten.
Mit beidem.
Washington D. C., Russische Botschaft Zwei Monate später
Auf den ersten Blick sah alles ganz harmlos aus: der verschwenderische Prunk des in festliches Licht getauchten Botschaftsgebäudes, die überschäumende, fast schon ein wenig aufgesetzt wirkende Fröhlichkeit der durcheinander redenden, lachenden Menschen in ihren Abendkleidern und Fracks, das Glitzern von dicken Brillantkolliers auf ebenso dicken Frauenhälsen, das Klirren von Glas, dezente Musik, die im Raunen der Menschen fast unterzugehen schien, und die vornehme Eleganz prunkvoller Stilmöbel, die schön gewesen wären, hätte der Bewohner dieser Räumlichkeiten auch nur eine Spur von Geschmack besessen. Hier aber wirkten sie ebenso protzig und fehl am Platz wie die kostbaren Antiquitäten. Dazu die livrierten Diener, die ihre überladenen Tabletts mit der Geschicklichkeit von Artisten durch die Menge jonglierten, ohne auch nur ein einziges Mal irgendwo anzustoßen oder gar ihre Last fallen zu lassen …
Alles schien perfekt aufeinander abgestimmt, als wäre dieser Empfang gar kein wirklicher Empfang, dachte Thor, sondern eine Szene aus einem Hollywood-Film, in der ein übergenauer Regisseur des Guten ein wenig zu viel getan hatte. Diese Typen wirkten tatsächlich wie frisch aus dem Wachsfigurenkabinett entsprungen. Thor überlegte, ob das Klischee der feinen Gesellschaft nun daher kam, dass diese Leute wirklich so waren – oder ob sie sich so benahmen, weil sie versuchten möglichst genau dem Bild zu entsprechen, das man sich im Allgemeinen von ihnen machte.
Nun ja – solche Überlegungen waren müßig und führten zu nichts; außer zu einer noch weiteren Verschlechterung seiner ohnehin angeschlagenen Laune. Und das war noch vorsichtig ausgedrückt …
Thor angelte ein Champagnerglas vom Tablett eines vorbeihastenden Kellners und musterte die dicht gedrängte Menschenmenge, während er an seinem Glas nippte. Der Champagner schmeckte ein bisschen nach Rasierwasser, fand er, versetzt mit einem Schuss Soda, damit es prickelte.
Einen Moment lang fragte er sich, ob all diese Typen hier eigentlich lebten oder ob sie vielleicht tatsächlich nur Abziehbilder waren, auf magische Weise zu einer Art Pseudo-Leben erwacht. Da gab es kleine, dicke Männer mit halbmeterbreiten Schärpen, die trotzdem alle Mühe hatten, ihre Kugelbäuche zu bedecken, andere kleine, fette Männer, die sich mit herausgeputzten Wasserstoffsuperoxyd-Schönheiten geschmückt hatten – hübsche Dinger in Thors Alter, die ihm vielleicht sogar gefallen hätten, hätten sie ein bisschen lebendiger ausgesehen. Dezent gekleidete Herren in maßgeschneiderten Cuts, die sich nach Kräften bemühten durch ihre bloße Anwesenheit den Rest dieser Gesellschaft auszustechen …
Gott, wie er dieses Affentheater hasste!
Er fühlte sich alles andere als wohl in seiner Haut, aber das lag zu einem Gutteil daran, dass er anlässlich dieses Abends zumindest äußerlich in eine Haut geschlüpft war, die ihm noch nie gefallen hatte. Er hatte zuvor mit Dale Anderson gesprochen, seinem Mentor und früheren Lehrer, und Dale hatte darauf bestanden, dass Thor einen Frack oder wenigstens einen schwarzen Zweireiher trug. Nach einer gut zweistündigen Diskussion hatten sie sich auf einen Kompromiss geeinigt, der die Form eines schlichten dunkelgrauen Anzuges und einer schlecht sitzenden Fliege hatte – mit dem Ergebnis, dass Thor nicht nur diese Gesellschaft nicht gefiel, sondern er dieser Gesellschaft auch nicht. Die leicht pikierten Blicke waren ihm ebenso wenig entgangen wie das Getuschel hinter vorgehaltenen Händen. Er gehörte nicht hierher und ungefähr zum tausendsten Mal an diesem Abend fragte er sich, was er überhaupt hier tat.
Aber das war nicht alles. Noch lange nicht. Thor hatte im Laufe seines manchmal etwas hektischen Lebens eine Art sechsten Sinn dafür entwickelt, wenn irgendetwas nicht so war, wie es scheinen wollte. Sein Unbehagen lag nicht allein an der steifen Garderobe oder der Tatsache, dass seine Kiefermuskulatur vom ständigen Zurückgrinsen allmählich wehzutun begann. Es lag auch nicht an den stämmigen – wenn auch freundlich dreinblickenden – Hünen, die auffallend unauffällig an den Türen standen und deren Jacketts sich in Achselhöhe verdächtig ausbeulten; dies war ein alltägliches Übel, wenn man in einer russischen Botschaft zu Gast war und in den Botschaften fast aller anderen Nationen auch. Paranoia gehörte heutzutage anscheinend zum guten Ton.
Allerdings musste er zugeben, dass die Repräsentanten des einzigen wahren Arbeiter- und Bauernstaates dieser Welt ganz besondere Prachtexemplare der Gattung homo paranoikus waren. Die Erben des Zarenregimes mochten sich auf die Fahnen geschrieben haben ihrem erwählten Volk das Paradies auf Erden zu bringen, aber in punkto Verfolgungswahn standen sie ihren Vorgängern wahrscheinlich in nichts nach.
Aber auch das war es nicht.
Etwas stimmte hier nicht.
Mit jeder Sekunde wurde er sich sicherer, dass ihn sein Gefühl nicht trog. Manchmal fing er eine Bewegung aus den Augenwinkeln auf, die ihm ein bisschen zu hektisch vorkam. Blicke, die rasch und verstohlen getauscht wurden, kleine, scheinbar unverfängliche Gesten … Und vor allem das Gefühl. Es lag wie eine unsichtbare elektrische Spannung in der Luft. Das Gefühl – nein, schon fast so etwas wie das sichere Wissen, dass etwas geschehen würde. Etwas, das auf einem normalen Empfang nicht geschah; nicht einmal in einer russischen Botschaft.
Thor schüttelte den Kopf und nahm einen weiteren Schluck aus dem langstieligen Champagnerglas. Hinter seiner Stirn klingelte eine kleine, schrille Alarmglocke und er hatte noch nicht die geringste Ahnung warum. Aber das Schrillen war eindeutig zu laut, um ignoriert zu werden, und er hatte frühzeitig gelernt, auf seinen sechsten Sinn für Gefahren zu hören.
Er stellte das Glas auf dem Tablett eines vorüberhuschenden Kellners ab und setzte sich in Bewegung. Er hatte vor, sich auf die Galerie zu begeben, um einen besseren Überblick über den Saal zu gewinnen. Doch schon am Fuße der breiten, mit einem Teppich aus rotem Samt bedeckten Treppenstufen scheiterte er an einer Gestalt, die ihn um zwei Kopflängen und eine Brustbreite übertraf und ein Gesicht hatte, das aussah, als hätte jemand vor nicht allzu langer Zeit versucht es einer kosmetischen Operation zu unterziehen, dabei aber Skalpell und Schere mit Spitzhacke und Schaufel verwechselt. Vielleicht rasierte sich der Bursche auch mit Hammer und Meißel.
»Sehr traurig, aber nicht zutreten, bitte«, sagte der Hüne im Frack in gebrochenem Englisch und schenkte Thor ein Lächeln, das selbst einen Gorilla in die Flucht geschlagen hätte. Thor kannte die Art, auf die ihn diese Augen anblickten, nur zu gut. Kalt. Wach. Taxierend. Der Mann brauchte bloß einen einzigen Blick, um sein Gegenüber abzuschätzen und in eine der beiden einzigen Kategorien einzuordnen, in denen sein erbsengroßes Gehirn zu denken imstande war: in mögliche Gegner und mögliche gefährliche Gegner.
Thor Garson jedoch war nicht der Mann, der sich von Äußerlichkeiten wie schaufelgroßen Fäusten oder Muskelsträngen, die fast so dick waren wie seine eigenen Oberarme, einschüchtern ließ. Er wollte gerade zu einer Entgegnung ansetzen, als er aus den Augenwinkeln heraus eine hinter ihm auftauchende Gestalt bemerkte. Gleichzeitig blitzte es in den Augen des Riesen auf; und es war ein Blick, den Thor nur zu gut kannte! Er wirbelte herum und duckte sich leicht, auf einen Schlag oder einen anderen Angriff gefasst.
Eine Zehntelsekunde später wäre er am liebsten in den Parkettboden versunken. Er spürte, wie alle Farbe aus seinem Gesicht wich.
»Wenn ich Ihnen helfen kann, Mister Garson – Sie sind doch Mister Thor Garson, richtig?«
»Oh, nennen Sie mich einfach Thor«, stotterte Thor. Seine Art zu leben und vor allem seine diversen, nicht ungefährlichen Hobbys brachten es mit sich, dass er oft und reichlich Gelegenheit fand, in das berühmte Fettnäpfchen zu treten, manchmal mit beiden Füßen und so tief – wie Dale einmal scherzhaft bemerkt hatte –, dass er gerade noch weit genug herausschaute, um Handzeichen zu geben. Gewöhnlich machte ihm das nichts aus. Situationen, bei denen andere vor lauter Peinlichkeit im Boden versunken wären, pflegte Thor Garson mit einem Lächeln oder einer saloppen Bemerkung abzutun.
Normalerweise.
Irgendwie war diese Situation nicht normal.
Eine junge Frau stand vor ihm. Recht groß, ausgesprochen hübsch, mit langem blonden Haar, das sie allerdings hochgesteckt trug, was unpassend streng wirkte. Diesen Eindruck verstärkte noch die russische Uniform, mit der sie ihre aufregenden Körperformen verhüllt hatte. Ohne Zweifel der hübscheste Soldat, der Thor Garson je untergekommen war.
Sie sprach mit deutlich hörbarem russischen Akzent, und wenn es überhaupt etwas an ihr gab, das noch aufregender war als ihr Engelsgesicht oder der Körper einer Venus von Moskau, dann war es ihre Stimme: tief, sinnlich und mit einem Unterton, der etwas in Thor vibrieren ließ. Er hatte noch nie erlebt, dass ihn eine Frau so verwirrte wie diese Frau; einfach weil sie da war.
»Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle?« Sie deutete eine leichte, wenig feminine Verbeugung an, ließ Thor dabei aber keine Sekunde aus den Augen. Tief in ihrem Blick glaubte er ein Lächeln zu erkennen, das wärmer war als die berufsmäßige Freundlichkeit, die jeder hier zur Schau trug, und das nur ihm allein galt. Aber vielleicht redete er sich das auch bloß ein. Bei einer Frau wie dieser hatte kein Mann eine Chance, der nicht mindestens über das Aussehen eines Tyrone Power, den Intelligenzquotienten eines Albert Einstein und das Bankkonto eines Howard Hughes verfügte. Dummerweise traf auf Thor keines dieser Attribute zu.
»Mein Name ist Tamara Jaglova, Kommissarin der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken. Ich habe Sie schon den ganzen Abend gesucht, Mister Garson.«
Thor bemerkte sehr wohl, dass ihre gestelzte Sprache eindeutig nicht ihm, sondern dem grinsenden Muskelpaket vor der Treppe galt. So neigte auch er sich leicht vor, griff nach Tamaras Arm und hauchte einen perfekten Handkuss, der einen österreichischen K.u.k.-Rittmeister vor Neid hätte erblassen lassen.
Die Gestalt, die dabei neben Tamara auftauchte, nahm er erst richtig zur Kenntnis, als er sich wieder aufrichtete. Dabei war der Mann im Grunde nicht zu übersehen.
Er bot einen wahrhaft imposanten Anblick; und das nicht einmal wegen seiner Größe. Alles andere als ein Zwerg überragte er Thor aber um kaum mehr als einen Zoll. Seine Schultern waren so breit, dass Thor sich bequem dahinter hätte verstecken können, und über seinem Leib spannte sich eine blutrote Schärpe, die um zwei Nummern zu klein schien. Doch nur sehr wenig von dem, was von innen gegen die Nähte seiner Jacke drückte und seine Schultern ausbeulte, war überflüssiges Fett. Er bewegte sich auf die nur plump scheinende Art eines wirklich starken Mannes. Seine Hände waren breit, mit kurzen Fingern und Schwielen, die verrieten, dass er nicht immer maßgeschneiderte Paradeuniformen getragen und sich auf gebohnertem Parkett bewegt hatte. Die Augen des Mannes waren eiskalt und schienen Thor mehr wie einen potenziellen Meuchelmörder denn wie einen Gast zu mustern. Trotzdem spürte Thor keine Feindschaft. Vielleicht gehörte sein Gegenüber einfach zu jener Art von Menschen, die prinzipiell in jedem Menschen einen potenziellen Feind sahen.
»Sie werden den Botschafter kennen, Mister Garson: Seine Exzellenz Graf Dimitri Sverlowsk.«
»Ich hatte bisher nicht das Vergnügen«, entgegnete Thor, wobei er die Chancen abwog, dem Botschafter die Hand zum Gruß zu reichen, ohne Gefahr zu laufen, dass dieser sie ihm abriss. Er entschied sich dagegen.
Seine Exzellenz musterte ihn von oben bis unten und der Anblick schien nicht unbedingt seine Gnade zu finden. »Ich hoffe, Sie amüsieren sich, Mister Garson«, sagte er schließlich. Seine Stimme klang so hart, wie sein Gesicht aussah. Vielleicht gurgelte er jeden Morgen mit einem Glas Schwefelsäure, abgeschmeckt mit kleingebrochenen Rasierklingen. »Ihr Ruf als Journalist mit großen Erfolgen vor allem im Bereich der Archäologie ist Ihnen vorausgeeilt. Mein Land ist sehr ergiebig, was Funde der Vergangenheit angeht.« Er machte eine bedeutungsvolle Pause und fuhr dann eine Spur schärfer fort: »Man sagt, Sie wären so etwas wie ein Spezialist, wenn es darum geht, verborgene Schätze zu finden?«
»Sagt man das?« Das Klingeln der Alarmglocke zwischen Thors Schläfen wurde zu einem schrillen Geheul. Sverlowsk stellte diese Frage nicht zufällig oder nur, um Konversation zu machen. Und er war kein besonders guter Schauspieler.
Sverlowsk nickte. »Ja. Böse Zungen behaupten sogar, Sie wären so eine Art moderner Grabräuber.« Er lächelte ein Lächeln, bei dem es einer Kobra gegruselt hätte, und fuhr fort: »Aber das sind sicher nur die üblichen Verleumdungen, unter denen jeder zu leiden hat. Eine unschöne Begleiterscheinung, wenn man im Rampenlicht steht. Mit dem Erfolg kommen die Neider.«
Er angelte sich ein Glas vom Tablett eines vorübereilenden Kellners, leerte es in einem Zug und stellte es zurück, noch bevor der Lakai außer Reichweite gekommen war; und das alles, ohne Thor auch nur einen Sekundenbruchteil aus den Augen zu lassen.
»Wie gesagt – auch meine Heimat ist reich an Schätzen aus unserer glorreichen Vergangenheit. Und manchmal bleiben diese Kunstschätze sogar in unseren Museen, Mister Garson. Wo sie ohne Zweifel besser aufgehoben sind als im Westen, nicht wahr?«
Es kam so gut wie niemals vor, dass Thor Garson verlegen wurde. »Ich stimme Ihnen zu, Herr Botschafter. Bei Gelegenheit würde ich mich freuen, das archäologische Museum in Moskau zu besuchen, um einen Artikel darüber zu schreiben. Wie ich hörte, wurde im letzten Monat ein neuer Flügel speziell für westliche Funde angebaut?«
Mit einer bedauernden Geste brach der Botschafter das eben erst begonnene Gespräch ab. »Wenn Sie mich jetzt entschuldigen möchten – als Gastgeber warten einige Verpflichtungen auf mich. Mister Garson …«
Sverlowsk drehte sich brüsk um und eilte gemessenen Schrittes davon. Aber Thor entging keineswegs das leise, ärgerliche Zucken seiner Hände und die etwas zu wuchtigen Schritte.
Trotzdem wäre Sverlowsk nicht der Mann gewesen, der er war, hätte er sich nicht wenigstens äußerlich perfekt im Griff gehabt. Schon nach wenigen Schritten riss er theatralisch die Arme hoch und steuerte auf einen dürren Mann zu, der soeben seinen Mantel ablegte und beim Anblick des Botschafters in höchste Verzückung zu geraten schien. Thor hatte Mühe, nicht mit einem Seufzen die Augen zu verdrehen, und wandte sich wieder erfreulicheren Dingen zu, wie zum Beispiel dem Anblick von Tamara Jaglova. Er erwartete, sie verärgert oder zumindest angespannt zu sehen. Immerhin hatte Thor soeben nicht nur den Gastgeber dieses Abends, sondern auch ihren unmittelbaren Vorgesetzten beleidigt; und russische Offiziere waren dafür bekannt, Niederlagen auf dem Schlachtfeld durch ausgiebiges Herumtrampeln auf ihren Untergebenen wettzumachen. Aber in diesem Punkt unterschieden sie sich wahrscheinlich kaum von ihren Kollegen in allen anderen Armeen der Welt …
Tamara wirkte völlig gelöst, fast sogar ein wenig amüsiert. Und auf ihren Lippen lag tatsächlich ein warmes Lächeln, das Thor mit dieser unerquicklichen Episode versöhnte, ihn aber gleichzeitig noch mehr verwirrte.
»Es tut mir leid«, sagte sie entschuldigend. »Der Botschafter ist ein Mann mit … nun, etwas verstaubten Ansichten. Archäologie ist für ihn ein Buch mit sieben Siegeln.«
»Warum spricht er dann darüber?«, fragte Thor.
Tamara lächelte noch fröhlicher. »Seit wann sprechen Politiker über Dinge, von denen sie etwas verstehen?«
»Beziehungsweise«, fügte Thor hinzu, »wovon verstehen sie überhaupt etwas?«
Sie lachten beide, und Tamara warf Sverlowsk einen langen, kopfschüttelnden Blick nach, ehe sie mit einem angedeuteten Achselzucken fortfuhr: »Er ist sehr stolz auf unsere Vergangenheit.«
»Ich dachte, alles, was mit dem Zarenreich zusammenhängt, wäre prinzipiell schlecht«, sagte Thor.
Das spöttische Glitzern in Tamaras Augen verstärkte sich.
»Natürlich«, antwortete sie gelassen. »Aber es waren ja auch nicht der Zarewitsch oder seine Familie, die all die großen Kunstwerke unserer Vergangenheit geschaffen haben. Es waren … wie sagt man bei Ihnen? Ach ja – kleine Leute. Ausgebeutete Arbeiter und unterdrückte Künstler. Ein Kunstwerk verliert nicht an Wert oder Qualität, nur weil ein Tyrann den Künstler dazu gepresst hat, es zu erschaffen, nicht wahr?«
Thor blinzelte. Er war nicht ganz sicher, ob er verstand, was Tamara meinte. Irgendwie wurde er das Gefühl nicht los, dass sie mit ihm spielte. Aber wenn, dann war es ein Spiel, das ihm durchaus gefiel. »Der Botschafter ist auf jeden Fall sehr stolz auf alles, was aus der Erde unseres großen Heimatlandes kommt«, fuhr Tamara fort. »Schätze, die den anderen Staaten mit stolzgeschwellter Brust vorgeführt werden wie …«
»Wie eine Truppenparade?«, schlug Thor vor. Die Worte rutschten ihm gegen seinen Willen heraus, aber Tamara schien kein bisschen beleidigt. Eine Sekunde lang blickte sie ihn irritiert an, dann lachte sie.
»Sie sind nicht dieser Meinung«, stellte Thor fest.
»Aber nein.« Sie lachte wieder leise. »Ich fürchte, Sie haben durch diese … Staffage einen ganz falschen Eindruck von mir bekommen, Mister Garson.«
»Thor.«
»Thor – gut. Dann für Sie aber auch Tamara.« Sie winkte einem der emsig herumeilenden Kellner und nahm zwei Gläser von dessen Tablett. »Trinken wir darauf.«
Sie stießen an. Thor leerte sein Glas und versuchte dabei nicht fortwährend Tamara anzustarren. Es kam selten vor, dass ihn eine Frau aus der Fassung brachte – aber Tamara war es gelungen. Er fragte sich, was mit ihm los war.
»Sie müssen wissen, dass wir Kollegen sind, Thor«, fuhr Tamara fort, gerade als das Schweigen peinlich zu werden drohte. »In gewisser Weise jedenfalls. Ich habe genau wie Sie Archäologie studiert, im Gegensatz zu Ihnen mein Studium sogar abgeschlossen. Aber da ich in offiziellem Auftrag hier bin …« Sie deutete auf ihre Uniform. »Ich kann Ihnen sagen, dass ich mich in dieser Kleidung nicht sehr wohl fühle«, raunte sie ihm zu.
Thor schmunzelte. »Da geht es mir ähnlich.«
»Ihnen gefällt meine Uniform auch nicht?«, fragte Tamara mit perfekt geschauspielerter Überraschung. Dann lächelte sie verschmitzt. »Ich hoffe, Sie verlangen jetzt nicht von mir, dass ich sie ausziehe, vor all diesen Leuten.«
Thor starrte sie eine Sekunde lang perplex an, ehe er das spöttische Glitzern in ihren Augen bemerkte. Er empfand eine Mischung aus leichter Verärgerung und Zorn, als er spürte, wie ihm das Blut ins Gesicht schoss. Tamara hatte es tatsächlich geschafft, ihn in Verlegenheit zu bringen. Und das kam nun wirklich selten vor. Er gab einen unechten Räusper von sich. »Sie machen mich neugierig, Tamara. Ihnen habe ich die Einladung hierher zu verdanken, nicht wahr? Um was für einen Auftrag handelt es sich? Dale – Professor Anderson – war nicht gerade redselig.«
Sie blickte sich kurz um und fixierte einen Punkt hinter Thors Rücken. Er wandte den Kopf und blickte geradewegs in das verheerend grinsende Gesicht des Muskelmannes am Fuße der Treppe. Der Kerl brachte es sogar fertig, drohend dreinzublicken, wenn er wirklich nett zu sein versuchte.
»Wechseln wir lieber die Räumlichkeiten«, schlug Tamara vor. »Die Sache ist zu bedeutend, als dass wir offen –«
Thor nickte. Das hieß – er wollte es. Aber da war wieder dieses Gefühl drohender Gefahr, das ihn warnte. Irgendetwas geschah – jetzt!
»Kommen Sie, Tamara.« Er nahm sie bei der Schulter und drängte sie zum Ausgang, wobei er ihren verwirrten Blick ebenso ignorierte wie die instinktive Bewegung, mit der sie den Arm hob und seine Hand abzustreifen versuchte. »Fragen Sie nicht, vertrauen Sie mir einfach. Ich weiß selbst nicht genau, was –«
Weiter kam er nicht.
Vor dem Portal entstand Tumult. Jemand begann mit erhobener, befehlsgewohnter Stimme zu reden, um abrupt wieder zu verstummen. Dann tauchten Gestalten im Eingang auf. Sie waren ganz in schwarz gekleidet und Thor glaubte Abzeichen auf den Westen zu erkennen, ohne sie identifizieren zu können.
Was er jedoch deutlich sah, das waren die Maschinenpistolen, die die Männer in den Händen hielten.
Thor reagierte blitzschnell. Zwei Schritte zur Linken war eine Tür. Er war mit einem Sprung dort, drückte die Klinke herunter. Unverschlossen – gut! Der Raum dahinter war dunkel. Durch ein großes Panoramafenster konnte man in den Park hinausblicken, der sich an das Botschaftsgebäude anschloss. Eine von Scheinwerfern beleuchtete steinerne Jagdgöttin erhob sich dort aus den Wasserkaskaden eines reichlich geschmacklosen Springbrunnens, dahinter bewegten sich Schatten, die alles oder nichts bedeuten konnten. Auch hier im Raum waren Schatten, aber Thor identifizierte sie ganz instinktiv als ungefährlich. Alle seine Sinne liefen auf Hochtouren. Er dachte kaum noch, sondern reagierte rein intuitiv. Thor drängte Tamara in den Raum, schlüpfte selbst hinterher und schob die Tür hinter sich zu. Alles war so schnell gegangen, dass Tamara gar nicht richtig begriffen zu haben schien, was überhaupt geschah.
Sie riss sich von ihm los, machte aber nur einen halben Schritt, ehe sie wieder stehen blieb und sich verwirrt zu ihm herumdrehte.
»Thor, was …?«
Thor legte hastig den Finger auf die Lippen. »Still! Ich muss hören, was die Typen vorhaben. Öffnen Sie ein Fenster und halten Sie sich bereit. Möglich, dass wir schnell verschwinden müssen.«
»Aber –«
»Schhhht!« Thor schob die Tür wieder einen Spalt auf und lugte hinaus.
In den wenigen Augenblicken, seit die Schwarzgekleideten den Saal betreten hatten, war in der Abendgesellschaft heilloses Chaos ausgebrochen. Menschen schrien und rannten durcheinander, das Orchester hatte aufgehört zu spielen und den Kellnern fielen nun doch die Gläser von ihren Tabletts. Alles lief in Panik umher, mit Ausnahme einer dicken Frau, die offensichtlich so betrunken war, dass sie gar nicht mehr mitbekam, was geschah, denn sie bewegte sich schwankend am kalten Büffet entlang und versuchte im hochgehaltenen Saum ihres Kleides von den Köstlichkeiten zu retten, was zu retten war. Der Anblick war so bizarr, dass Thor eine geschlagene Sekunde darauf verschwendete, die Frau anzustarren, ehe er sich wieder auf den Grund des allgemeinen Chaos‘ besann. Die Schwarzgekleideten hatten sich im Raum verteilt und schienen die Anwesenden zum Ausgang zu treiben, aber sie machten nicht von den Kalaschnikows Gebrauch. Noch nicht. Eine Gruppe von fünf, sechs Mann kam geradewegs auf die Tür zu.
Mit einem leisen Fluch drückte Thor sie ins Schloss und suchte vergeblich nach einem Schlüssel. Als er sich umwandte, stand Tamara noch immer hinter ihm, eine schwarze Ledermappe in den Händen.
»Mister Garson!«, begann sie, wurde aber sofort von Thor unterbrochen.
»Still! Ich fürchte, sie kommen her! Wenn sie uns hören, ist es aus.« Er sah sich suchend im Raum um und deutete schließlich auf den schwarzen Schlagschatten neben der Tür.
»Dorthin!«, sagte er gehetzt. »Schnell!«
Tamara rührte sich nicht.
»Verdammt!«, fluchte Thor, einer Verzweiflung nahe. »Verstecken Sie sich, ehe sie hier sind!«
Tamara seufzte und blickte auf ihre Mappe, und Thor sah ein, dass es wahrscheinlich schneller ging, wenn er ihr den Gefallen tat. »Was ist das?«, fragte er resignierend.
»Meine Unterlagen. Das hier ist das Zimmer, in dem wir uns besprechen wollten. Ich –«
Ein lautes Poltern an der Tür unterbrach sie. Thor fluchte, stemmte sich mit der Schulter gegen die Tür und suchte nach festem Stand. Eine Sekunde später traf ein heftiger Schlag die Tür, sprengte sie auf und ließ Thor haltlos zurücktaumeln.
Tamara griff rasch zu und fing seinen Sturz auf.
Thor Garson wirbelte herum und verpasste dem Schatten, der plötzlich hinter ihm stand, einen kräftigen Tritt an eine Stelle, an der auch Männer in Uniformen und mit Maschinenpistolen ganz besonders empfindlich sind. Der Mann krümmte sich, und Thor packte die Tür und warf sie mit aller Kraft zu. Sie krachte ins Gesicht des Burschen und flog vibrierend wieder auf, sodass Thor sehen konnte, wie der Angreifer mit ausgebreiteten Armen gegen seine Begleiter prallte und sie mit sich zu Boden riss. Mit einem zweiten Tritt schloss Thor die Tür wieder, sprang zur Seite und riss Tamara mit sich; nur für den Fall, dass die Burschen dort draußen vielleicht doch noch auf den Gedanken kamen, ihre Kalaschnikows zu benutzen.
»Los, zum Fenster!«
»Nein!« Tamara löste sich energisch aus seinem Griff. »Verdammt, Thor, hören Sie mir doch zu! Das sind –«
»Später!«, keuchte Thor und stieß sie weiter auf das Fenster zu. »Wir müssen raus hier!«
Tamara riss sich mit einem Ruck von ihm los, sodass Thor ins Stolpern kam und um ein Haar schon wieder gestürzt wäre. »Aber das sind unsere Männer!«
Thor blieb abrupt stehen.
»Das sind … was?«
Sie funkelte ihn an, während Thor mit einem hastigen Schritt sein Gleichgewicht wiederfand. Ihre Augen sprühten zornige Blitze. »Ich kenne die Abzeichen. Diese Männer sind Angehörige des Sowjetischen Geheimdienstes. Eine Spezialeinheit, die eigens zum Schutz hochrangiger Offiziere aufgestellt wurde. Ich weiß zwar nicht, was sie hier wollen, aber –«
Wieder wurde die Tür aufgerissen. Der Mann, der darin erschien, war derjenige, den Thor niedergeschlagen hatte. Er war bleich und zitterte am ganzen Leib und aus seiner Nase floss Blut. Thor registrierte erleichtert, dass die Kalaschnikow lose an ihrem Lederriemen über seiner Schulter hing und seine Hände leer waren.
Aber seine Erleichterung hielt sich in Grenzen, als er sah, wie groß die geballten Fäuste des Russen waren. Thor hob beschwichtigend die Hände. »Ganz ruhig, Towarisch. Ein Missver- ump…«
Die Faust seines Gegenübers erstickte sowohl die zweite Hälfte des Wortes als auch Thors letzte Hoffnung, bei dem Mann auf so etwas wie Verständnis oder gar Nachsicht zu stoßen. Er taumelte zurück, riss die Hände schützend vor das Gesicht und erinnerte sich einen Sekundenbruchteil zu spät daran, dass der Rest seines Körpers nicht aus Beton bestand. Die Fäuste des Soldaten hämmerten in seinen Magen, seine Rippen und seine Herzgrube, so schnell, gezielt und hart, dass Thor schon nach dem ersten Hieb begriff, dass er einem Mann gegenüberstand, der gelernt hatte, seine Fäuste einzusetzen.
Er wankte rückwärts, blockte mehr durch Glück als Können einen weiteren Hieb ab – allerdings nur, um sofort in das hochgerissene Knie des Russen zu laufen. Bunte Sterne explodierten vor seinen Augen. Mit einem fast komisch klingenden Schmerzlaut brach Thor in die Knie, und noch bevor Kommissarin Jaglova eingreifen konnte, warf sich der Soldat auf ihn und kugelte mit ihm über den Teppich.
Thor wehrte sich, so gut er konnte, aber der Russe war ihm hoffnungslos überlegen und Wut und Schmerz gaben ihm noch zusätzliche Kraft. Er hörte Tamara irgendetwas schrill und auf russisch rufen, aber sein Gegner schien seiner Muttersprache plötzlich nicht mehr mächtig zu sein, denn er schlug und drosch weiter auf Thor ein, und er hätte wahrscheinlich noch lange nicht damit aufgehört, wäre da nicht plötzlich eine zweite, sehr viel schärfere Stimme gewesen, die etwas von der Tür her schrie.
Zwar verstand Thor die russischen Worte nicht, aber sie waren ohnehin für den Angreifer bestimmt. Der Mann stieß Thor mit einem letzten Schnauben zurück und sprang wieder auf die Beine. Thor wollte es ihm nachmachen, knickte aber sofort wieder ein. Er fiel nach vorn, prallte mit dem Gesicht auf einen dicken Teppich, der seinem Sturz sehr viel weniger von seiner Wucht nahm, als ihm recht war, und wälzte sich mühsam auf den Rücken. Ein schlanker, sehniger Russe mit kurzgeschorenem Haar stand breitbeinig über ihm. Einen Moment lang blickte er mit fast wissenschaftlichem Interesse – und sehr wenig Mitleid – auf ihn herab, dann murmelte er ein einzelnes Wort in seiner Muttersprache, reichte Thor die Hand und zog ihn hoch. Sein Griff war so fest, dass Thors Hand hörbar knirschte. Er verbiss sich den Schmerz und ließ sich von dem Russen auf die Beine helfen, während dieser einige rasche Worte mit Tamara wechselte.
Thor wischte sich mit dem Handrücken über die aufgeplatzte Lippe. Er wusste, dass es zu ernsten diplomatischen Verwicklungen kommen konnte, wenn man ihm sein Handeln als Angriff auf sowjetische Armeeangehörige anlastete. Ganz gleich, warum er es getan hatte. Dale würde toben, wenn er hörte, was hier geschehen war.
Aber sein Gegenüber schien nicht nachtragend zu sein. Dazu hatte er auch gar keine Zeit, wie Thor an seinem leicht gehetzt wirkenden Blick erkannte.
»Mister Garson?«, richtete der Russe das Wort an ihn. »Keine Zeit für lange Erklärungen. Sie und Kommissarin Jaglova müssen das Gebäude schnellstens verlassen.«
»Was ist geschehen?« Tamara trat mit einem raschen Schritt zwischen Thor und den Russen. Fast beiläufig registrierte Thor, dass sie die Frage in Englisch gestellt hatte, was in dieser Situation eigentlich ungewöhnlich war; zumal sie sich eine Sekunde zuvor noch in ihrer Muttersprache mit dem Mann unterhalten hatte.
Der Russe salutierte knapp. »Eine Bombendrohung, Genossin Kommissar«, erklärte er nun doch. »Wir erfuhren vor Minuten erst von einem geplanten Attentat auf Sie.«
»Ein Attentat?« Tamaras Augenbrauen rutschten ein Stück nach oben. »Genosse Sverlowsk hat keine Feinde hier, und –«
Sie stockte. Ein verblüffter Ausdruck breitete sich auf ihren Zügen aus. »Sagten Sie – auf mich?Aber das ist doch Unsinn! Ich meine … wer sollte mir etwas tun wollen?« Sie lachte, aber es klang ein bisschen zu gekünstelt, um ihren Schrecken ganz zu verbergen.