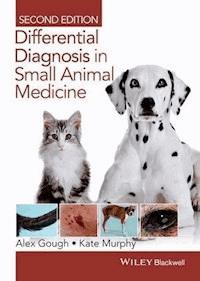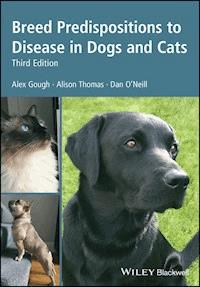9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Assassinen von Rom
- Sprache: Deutsch
Das Leben eines Spions – das Schicksal eines Imperiums Der Auftakt der neuen Rom-Serie – für alle Fans des alten Roms und Leser:innen von Simon Scarrow und Robert Fabbri 210 n. Chr.: Die Römer haben Britannien fest in der Hand. Als der einfache Spion Silus auf einer seiner Missionen den Stammesführer der Maeatae köpft, übt dessen Sohn Maglorix grausame Rache. Während Maglorix und Silus einander nach dem Leben trachten, möchte Kaiser Caracalla Silus' Heldentat belohnen und nimmt ihn in den Bund der Arcani, einen Geheimbund von Attentätern und Spionen, auf. Fortan muss sich Silus als Assassine inmitten brutaler Konflikte unter Beweis stellen. Doch schon bald beginnt seine uneingeschränkte Loyalität zum Kaiser zu bröckeln … »Düster und realistisch, spannend und rasant. Ein erstklassiger historischer Roman!« Simon Turney, Bestsellerautor Verankert in detaillierter historischer Recherche, mit ausführlichen Anmerkungen des Autors Alle Bände der ›Die Assassinen von Rom‹-Reihe: Band 1: Das Schwert des Kaisers Band 2: Der Dolch des Kaisers Alle Bände sind unabhängig voneinander lesbar
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 565
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Über das Buch
210 n. Chr.: Die Römer haben Britannien fest in der Hand. Um Angriffe lokaler Stämme zu verhindern, werden Spione ins ganze Land entsendet – unter ihnen auch der wagemutige Silus. Wochenlang trotzt er Kälte und Einsamkeit in den rauen Wäldern Kaledoniens. Als es ihm durch einen Zufall gelingt, den Stammesführer der Maiatai zu köpfen, übt dessen Sohn Maglorix grausame Rache. Fortan hat Silus nur noch einen Wunsch: den Tod des Kaledoniers.
Doch während er Maglorix nach dem Leben trachtet, sieht er sich mit weiteren Aufgaben konfrontiert. Denn Kaiser Caracalla möchte – anders als sein Bruder und Mitkaiser Geta – Silus’ Heldentat belohnen und nimmt ihn in den Bund der Arcani auf. Als Assassine in der Elitetruppe der Attentäter und Spione muss er sich fortan immer brutaleren Konflikten stellen. Scheitern ist dabei keine Option. Doch all das Elend und Blutvergießen bringen Silus zum Nachdenken – kann er dem Kaiser treu bleiben und seine Taten im Namen Roms mit seinem Gewissen vereinbaren?
Alex Gough
Das Schwert des Kaisers
Die Assassinen von Rom
Roman
Aus dem Englischen von Kristof Kurz
Für Naomi und Abigail, zum Dank für all die Liebe und Unterstützung
Erstes Kapitel
210 n. Chr. Kaledonien
Silus kämpfte sich fünfzehn Meilen nördlich des Antoninuswalls mitten im Feindesland durch dichtes Unterholz.
»Scheiße«, sagte er.
Regenwasser lief aus seinem Haar über die Stirn und tropfte von seiner Nase, was sich anfühlte wie ein schlimmer Schnupfen. Er zitterte, obwohl er ein wollenes Unterhemd unter der wasserdichten Lederkleidung trug und sich mit spärlich belaubten Zweigen zugedeckt hatte. Dass es so früh am Tag bereits dämmerte, überraschte ihn nicht, immerhin lag Kaledonien weit im Norden und war berüchtigt für sein schlechtes Wetter, insbesondere gegen Ende des Winters – so wie jetzt im Martius, dem ersten Monat des Amtsjahres. Die Augusti hatten entschieden, den Feldzug gegen die aufständischen Stämme jenseits der nördlichsten Grenze des Reiches um ein weiteres Jahr zu verlängern. Diese Stämme mussten vor der Ankunft der Legionen selbstverständlich ausgekundschaftet werden, und mit dieser spannenden und verantwortungsvollen Aufgabe hatte man Silus betraut, der im Rang eines Explorators bei den romtreuen Hilfstruppen diente. Aus diesem Grund also lag er hier draußen in diesem nasskalten Wald und versuchte, nicht an Unterkühlung zu sterben.
Er rutschte auf dem Boden herum, da sich ein Ast gefährlich nahe an den Weichteilen in seinen Körper bohrte. Dabei floss ihm das kalte Wasser, das sich in einer Falte seines Umhangs gesammelt hatte, den Rücken hinunter. »Scheiße!«, fluchte er abermals und so laut, wie er es sich erlauben konnte, ohne auf sich aufmerksam zu machen. Man konnte sich keinen beschisseneren Auftrag vorstellen. Seine Kameraden saßen gerade bei ihren jeweiligen Contubernales schön gemütlich in ihren Baracken, schoben Wachdienst oder wurden allerhöchstens auf kurze Patrouillen geschickt. Er dagegen fror sich hier seit Tagen die Eier ab, lebte von dem, was er jagte und sammelte, und wenn er sich nicht gerade vor Entdeckung, Gefangennahme, Folter und Hinrichtung fürchtete, zerfloss er vor Selbstmitleid.
Wo bei allen Göttern war er überhaupt? Irgendwo in der Nähe musste die Wallburg sein, die die Einheimischen Dùn Mhèad nannten. Seinen Befehlshabern waren Gerüchte von einer bevorstehenden Rebellion zu Ohren gekommen, woraufhin sie ihn losgeschickt hatten, um das zu tun, was er am besten konnte. Und dazu gehörte nun mal, irgendwo im Wald zu kauern, unentdeckt zu bleiben, den Feind auszukundschaften und lebendig zurückzukehren.
Sein Zenturio hatte Silus als »einen der besten Exploratores der ganzen Armee« bezeichnet. Die strenge Erziehung, die ihm sein römischer Vater hatte angedeihen lassen, hatte seinen Körper gestählt und ihn mit einer bedingungslosen Treue dem römischen Imperium gegenüber erfüllt. Gleichzeitig fühlte er sich als halber Barbar in der Wildnis Kaledoniens wie zu Hause: Er beherrschte die Sprache der Einheimischen fließend und hatte keine Schwierigkeiten, als einer der ihren durchzugehen. Doch das alles half ihm einen Scheiß dabei, diese gottverdammte Wallburg zu finden.
Inzwischen war es zu dunkel, um noch irgendetwas auszukundschaften. Er beschloss, sein Nachtlager in einer Mulde zwischen den Wurzeln einer großen Eiche aufzuschlagen. Er füllte seinen Wasserschlauch an einem nahe gelegenen Wasserlauf und legte zwei Fangschlingen aus. Dann nahm er das letzte Stückchen Käse aus dem Leinensack, wickelte es aus, verschlang es in zwei Bissen und spülte es mit ein paar Schlucken eiskalten Wassers hinunter. Anschließend erleichterte er sich ein Stück flussabwärts, kauerte sich in die Mulde und bedeckte sich zur Tarnung und zum Schutz vor der Kälte mit Zweigen. Ohne große Hoffnung auf Schlaf schloss er die Augen und stellte sich vor, den warmen, weichen Körper seiner Frau in den Armen zu halten.
Er wurde von einem Rascheln in der Nähe geweckt. Silus riss die Augen auf, widerstand jedoch dem Drang, aufzuspringen und nach seinen Waffen zu greifen. Es war gut möglich, dass man ihn noch nicht entdeckt hatte. Durch den plötzlichen Übergang vom Schlaf in einen Zustand äußerster Wachsamkeit raste sein Herz. Erst jetzt bemerkte er mit Erstaunen, dass es bereits dämmerte. Er hatte die ganze Nacht hindurch traumlos geschlafen. Das Rascheln auf dem laubbedeckten Boden wurde immer lauter. Er wusste zwar nicht, mit wie vielen Gegnern er es zu tun hatte, doch seine einzige Chance war, das Überraschungsmoment zu nutzen, möglichst viel Schaden anzurichten und in der darauffolgenden Verwirrung zu entkommen.
Dann tauchte nur wenige Fuß von ihm entfernt ein schwarzer Schatten aus dem Unterholz: ein großer Eber, der im Laub nach Wurzeln und Schnecken wühlte. Silus atmete erleichtert auf und musste gleichzeitig an Wildschweinbraten am Spieß denken, woraufhin sich sein Magen verkrampfte und ihm das Wasser im Mund zusammenlief. Vorsichtig bewegte er die Hand auf das Messer in seinem Gürtel zu, hielt dann aber inne. Der Eber war ziemlich groß und hatte scharfe Hauer. Es wäre kein leichter Kampf. Da er keinen Bogen mitgenommen hatte, blieb ihm nur ein Überraschungsangriff mit dem Messer. Doch selbst wenn es ihm gelänge, den Eber zu überrumpeln, wären der Kampflärm und die Schreie des Wildschweins – und im schlimmsten Fall auch seine eigenen – meilenweit zu hören. Sehr zum Missfallen seines knurrenden Magens wartete er also ab, bis sich das Tier wieder getrollt hatte. Dann verließ er sein Versteck, streckte sich und dehnte den in letzter Zeit ständig verspannten Nacken, bevor er ohne große Zuversicht nach den Fangschlingen sah.
Die erste war leer, in der zweiten hatte sich zu seiner Freude ein Eichhörnchen verfangen. Es kämpfte nur noch schwach gegen den Draht an, der tief in seinen Hals schnitt. Silus brach dem Tier mit einem Handgriff das Genick, häutete es und weidete es aus. Ein Feuer kam nicht infrage – erstens durfte er nicht entdeckt werden und zweitens hätte er es bei diesem Regen sowieso nicht in Gang bekommen. Für den Fall, dass das Kaninchen an ansteckenden Krankheiten litt, sprach er ein kurzes Gebet an Valetudo, die Göttin der Gesundheit, sowie an Apollo, den Gott des Sonnenlichts und der Heilung, den er bei der Gelegenheit auch um ein Nachlassen des Regens bat. Dann schlang er das rohe Eichhörnchenfleisch in großen Bissen hinunter, um es so wenig wie möglich schmecken zu müssen.
Dabei erinnerte er sich an das erste Eichhörnchen, das er roh verzehrt hatte. Damals – er war fünf Jahre alt gewesen – hatte seine Familie noch beim Stamm der Brigantes gelebt. Sein Vater hatte es ihm auf einem langen Jagdausflug gegeben, doch das Fleisch war so glitschig und schleimig gewesen, dass er es sofort wieder von sich gegeben hatte. Sein Vater hatte ihm eine Tracht Prügel verpasst und ihn gezwungen, das Erbrochene noch einmal zu essen und diesmal auch bei sich zu behalten. Vater, was warst du nur für ein Arschloch, dachte er. Trotzdem war das, was er Silus beigebracht hatte, für die Legion von großem Wert – und damit letzten Endes auch die Ursache dafür, dass er hier in diesem ungemütlichen Wald hockte. Ein Grund mehr, dich zu hassen, Vater.
Silus vergrub die Überreste seiner Mahlzeit, füllte den Wasserschlauch auf, sammelte die Schlingfallen ein und verrichtete seine Notdurft. Dann blickte er zum Himmel auf. Die Eichen und Birken hatten noch nicht angefangen zu blühen, sodass die Äste über ihm größtenteils kahl waren. Lediglich die immergrünen Fichten sorgten für Farbtupfer. Die Wolkendecke war so dick, dass er den Stand der Sonne nicht ausmachen konnte. In einem weniger dichten Wald hätte er womöglich anhand der Wuchsrichtung der zum Licht strebenden Zweige ermitteln können, wo Süden war, doch hier standen die Bäume so eng beisammen, dass sich ihre Äste einfach nur kerzengerade nach oben zum spärlichen Sonnenlicht streckten. Auch das Moos, das in lichteren Wäldern an der schattigeren Nordseite der Bäume zu finden war, half ihm nicht weiter. Hier in diesem beständigen Dämmerlicht wuchs das Moos überall.
Silus zuckte mit den Schultern und marschierte seiner Schätzung nach in nördlicher Richtung weiter.
Nachdem er sich einen halben Tag lang durch den Wald gequält hatte und über vom Laub bedeckte Wurzeln und Erdlöcher gestolpert war, lichteten sich die Bäume schlagartig. Zu seiner Rechten ragte auf dem breitesten und höchsten Hügel der Umgebung Dùn Mhèad auf, die Wallburg, die er gesucht hatte.
Jedenfalls war er sich einigermaßen sicher, dass es sich um Dùn Mhèad handelte, da es in der Nähe keine andere größere Ansiedlung gab. Die Wallburg bestand aus einigen wenigen reetgedeckten Rundhäusern, einem Langhaus, mehreren Zelten und kleineren Gebäuden, die von einem Gürtel aus Erdwällen und Gräben sowie von einer Palisade aus zugespitzten Baumstämmen umgeben waren. Silus konnte keine einzige Mauer aus Stein oder Ziegel entdecken, und auch sonst hatte das Ganze wenig Ähnlichkeit mit einer römischen Befestigung. Eine gut ausgerüstete Legion wäre in der Lage, die Burg im Handstreich einzunehmen – vorausgesetzt, sie kämpfte sich zuvor viele Meilen lang durch feindliches, unwirtliches Terrain. Die Kaledonier sowie die Maeatae – ein Zusammenschluss mehrerer Stämme, zu denen auch die Venicones gehörten – waren inzwischen Meister der indirekten Kriegsführung und hatten den römischen Invasoren durch Hinterhalte und Fallen größere Verluste beigebracht als jemals in einer offenen Feldschlacht.
Silus suchte sich ein Versteck am Waldrand, tarnte sich mit Nadelzweigen und beobachtete die Wallburg. Er war noch etwa eine Viertelmeile entfernt und konnte kaum Einzelheiten erkennen, doch dass in der befestigten Siedlung Hochbetrieb herrschte, war offensichtlich. Das Klirren von Hammer auf Amboss hallte hell über das tiefe Muhen des innerhalb der Befestigung zusammengetriebenen Viehs hinweg. Zu Silus’ Rechten – von Osten, wenn er sich nicht irrte – stieg ein etwa zwanzig Mann starker Kriegertrupp den Hügel hinauf. Sie waren mit Speeren und kleinen Rundschilden bewaffnet und trugen Umhänge und Hosen, aber keine Rüstungen. Als das Tor in der Palisade geöffnet wurde, um sie einzulassen, konnte Silus einen Blick in die Festung werfen, in der sich bereits eine größere Streitmacht versammelt zu haben schien. Die Männer saßen herum und tranken, trugen Übungskämpfe mit ihren Speeren aus oder gingen anderen Beschäftigungen nach. Dann wurde das Tor wieder geschlossen. Silus schätzte, dass sich etwa vierhundert Menschen in der Wallburg befanden. Frauen, Kinder oder Alte hatte er allerdings nur wenige gesehen.
Das war eine Kriegerschar, die sich für einen Überfall bereit machte.
Silus dachte an seine Kameraden im Kastell. Sosehr er sie auch darum beneidete, dass sie warm und trocken und satt in ihren Baracken hockten und höchstens hin und wieder auf ungefährliche Patrouillen geschickt wurden, durfte er doch auf keinen Fall zulassen, dass dieser Haufen ohne Vorwarnung über sie herfiel.
Falls sie überhaupt vorhatten, das Kastell anzugreifen. Möglicherweise hatten sie es auch auf eine römische Siedlung abgesehen wie die, in der er mit seiner Frau Velua und seiner Tochter Sergia lebte. Bei dieser Vorstellung krampften sich seine Eingeweide zusammen. Nun musste er sich entscheiden, ob er abwartete und versuchte, noch mehr in Erfahrung zu bringen, oder das, was er hier gesehen hatte, so schnell wie möglich seinen Befehlshabern meldete. Nach kurzer Überlegung kam er zu dem Schluss, dass nichts, was er hier noch auskundschaften mochte, wichtiger als die Nachricht war, dass sich eine kriegslüsterne Barbarenhorde für den Kampf rüstete. Wenn er blieb, riskierte er zudem, entdeckt zu werden. Vorsichtig ging er rückwärts in den Wald zurück, bis er sich einigermaßen im Schutz der Bäume befand. Er richtete sich auf und streckte sich, dann kehrte er der Wallburg den Rücken und machte sich auf den Heimweg.
Er hatte gerade einmal fünfzig Schritt zurückgelegt, als ihn ein Geräusch innehalten ließ. Etwas brach durch das Unterholz. Er legte die Hand auf das Messer und drehte sich mit klopfendem Herzen in die Richtung, aus der der Lärm kam. Ein großer Hirsch lief durch den Wald auf Silus zu, schreckte zurück, sobald er ihn bemerkte, und verschwand im Dickicht. Silus wartete, bis sich Atem und Herzschlag beruhigt hatten, dann machte er sich wieder auf den Weg, weg von der Wallburg und tiefer in den Wald hinein.
Kurz darauf blieb er ein weiteres Mal stehen; diesmal hörte er tiefe, immer lauter werdende Stimmen. Er versteckte sich hinter einer Eiche und spähte vorsichtig um den dicken Baumstamm. Als er eine Bewegung bemerkte, sah er genauer hin: Zwei, nein, drei Männer führten ihre Pferde am kurzen Zügel am Waldrand entlang. Silus schlich sich näher, wobei er den Boden mit den Zehenspitzen prüfte, bevor er sein Gewicht darauf verlagerte, damit er nicht versehentlich auf einen trockenen Ast trat. Bald war er den Männern so nahe, dass er ihre Unterhaltung belauschen konnte. Sie sprachen Keltisch mit veniconischem Dialekt, sodass Silus das meiste verstand.
Seinem Tonfall nach zu urteilen war der älteste der Männer auch ihr Anführer.
»Maglorix, der Hirsch gehört mir. Ich allein werde ihn zur Strecke bringen.«
»Aber mein Fürst! Das ist doch Zeitverschwendung. Wir müssen uns um dringendere Angelegenheiten kümmern.«
»Zeitverschwendung? Wähle deine Worte mit Bedacht, Maglorix. Auch wenn du mein Sohn bist – wenn du mir nicht den nötigen Respekt erweist, mache ich dich einen Kopf kürzer.«
Maglorix neigte das Haupt. »Voteporix, mein Herr und Fürst, bitte verzeiht mir, doch es ist meine Pflicht, Euch zu beraten. Die Männer warten darauf, dass Ihr zu ihnen sprecht. Sie wollen erhebende Worte und Geschichten und Bier.«
»Wovor fürchtest du dich, Maglorix? Glaubst du etwa, dass wir hier, tief in unserem eigenen Land, auf Wegelagerer oder gar eine römische Patrouille treffen? Ganz bestimmt nicht. Was macht dir dann Angst? Geister und Dämonen?«
Sofort machte Maglorix ein kurzes Handzeichen zur Abwehr des Bösen. Sein Vater schnaubte verächtlich.
»Natürlich nicht«, sagte Maglorix. »Ich fürchte nichts außer der Hexe, den Aos-sídhe und meinen Fürsten.«
Voteporix nickte. »Nun gut. Buan, du kümmerst dich um die Pferde. Maglorix, mit mir.«
Buan, ein großer, glatzköpfiger Krieger, nahm gehorsam die drei Zügel in die Hand und führte die Pferde mit ausdrucksloser Miene weiter.
Silus überlegte fieberhaft. Die Namen sagten ihm nichts, doch der Sohn hatte seinen Vater als Fürsten bezeichnet. Er hatte es also mit dem Anführer und obersten Kriegsherrn des Stammes sowie seinem Sohn und vielleicht auch Thronfolger zu tun! Was jetzt? Noch konnte er den Rückzug antreten, um seinen Vorgesetzten von dem bevorstehenden Überfall Meldung zu machen. Doch was, wenn er etwas Wertvolleres mitbrachte – zum Beispiel den Kopf eines rebellischen Stammesfürsten? Wenn er ihren Anführer unschädlich machte, konnte er nicht nur einen Einfall der Barbaren verhindern, sondern sich zudem auf eine ordentliche Belohnung freuen. Wie mochte die wohl aussehen? Geld? Eine Beförderung? Die Versetzung in eine nicht ganz so beschissene Einheit, sodass er mehr Zeit zu Hause bei Velua und Sergia verbringen konnte?
Silus biss die Zähne zusammen. Er war hin- und hergerissen. Die Vernunft befahl ihm, die Beine in die Hand zu nehmen, sich für einen zur Zufriedenheit ausgeführten Auftrag loben zu lassen und weiter für einen beschissenen Sold dieses beschissene Land auszukundschaften, während seine Frau und seine Tochter in einem beschissenen Haus saßen und sich fragten, wo er war und ob und wann er wieder nach Hause kam. Doch was, wenn er eine wahre Heldentat vollbrachte?
Die beiden Männer kamen immer näher. Silus hatte die Gelegenheit zur unbemerkten Flucht verstreichen lassen: Seine Unentschlossenheit hatte die Entscheidung für ihn getroffen. Er zog das Messer und nahm so leise wie möglich eine Fangschlinge aus der Tasche.
Die beiden Männer schlichen auf der Suche nach der Hirschfährte durch den Wald. Silus verhielt sich vollkommen ruhig. Er hatte den Rücken gegen den dicken Eichenstamm gepresst und lauschte konzentriert den Schritten im Laub. Dann schloss er die Augen und stellte sich die genaue Position der beiden Männer vor. Der größere – der Stammesfürst – ging zuerst am Baum vorbei. Sein Sohn folgte ihm auf dem Fuße. Silus verließ seine Deckung und pirschte sich an sie heran. Er roch Bier und ranzigen Schweiß.
Maglorix, ein großer, schlanker und kräftiger Mann mit langen roten Locken, ging vorsichtig hinter seinem Vater her. Silus passte sich seinem Rhythmus an, sodass seine eigenen Schritte von denen des Fürstensohnes übertönt wurden. Als er nahe genug war, holte er tief Luft, hob das Messer und ließ den Griff mit voller Wucht auf Maglorix’ Hinterkopf krachen.
Sofort ging der junge Mann ohne einen Laut zu Boden. Silus ließ das Messer fallen. Voteporix wollte sich gerade umdrehen, als sich der Kundschafter auf ihn stürzte und ihm eine Fangschlinge um den Hals legte. Der Stammesfürst riss vor Schreck die Augen auf. Vergebens versuchte er, den Draht, der Luftröhre und Blutzufuhr abschnitt, mit den Fingern zu lösen. Er schlug und trat um sich und warf ruckartig den Kopf zurück, sodass sein Schädel mit Silus’ Gesicht zusammenprallte. Dieser lockerte seinen Griff selbst dann nicht, als ihm das Blut aus der Nase schoss und ihm vor Schmerz Tränen in die Augen traten. Er biss die Zähne zusammen und zog weiter an der Schlinge, bis die Gegenwehr seines Opfers allmählich schwächer wurde und schließlich ganz aufhörte.
Silus ließ den leblosen Körper vorsichtig zu Boden sinken, lockerte die Schlinge aber erst, als er sich sicher war, dass der Mann sein Leben ausgehaucht hatte. Er warf einen Blick auf den reglos und mit blutendem Kopf daliegenden Maglorix, dann suchte er das Messer und packte Voteporix bei den Haaren. Die Augen des Toten waren weit geöffnet, die Pupillen nach oben verdreht. Der Draht hatte tief in den Hals geschnitten. Silus setzte das Messer an der blutigen Linie an und schnitt drauflos, indem er die Klinge wie eine Säge hin und her fahren ließ. Blut spritzte, als er die Arterien durchtrennte, blutiger Schaum quoll aus der Luftröhre. Schließlich klappte er den Kopf nach hinten und kappte die Sehnen, die die Halswirbel zusammenhielten. Mit einem letzten Schnitt durch die Haut löste sich das Haupt vom Torso. Er hob es hoch und starrte in das tote Gesicht. Ein Schauer durchfuhr ihn, und er fragte sich, ob er wirklich die richtige Entscheidung getroffen hatte.
»Vater!«
Silus wirbelte herum. Maglorix lag auf einen Ellenbogen gestützt da. Seine Augen rollten wie die eines Wahnsinnigen hin und her, eine Gesichtshälfte war blutverschmiert. Vor Schreck stand ihm der Mund offen.
»Vaaaater!« Nun schrie er. Instinktiv drehte sich Silus zum Waldrand um und hörte kurz darauf, wie Buan durch den Wald pflügte, um seinem Herrn zu Hilfe zu eilen. Silus machte einen Schritt auf Maglorix zu und trat ihm kräftig ins Gesicht. Der Kopf des Fürstensohnes wurde nach hinten geschleudert und er verlor erneut das Bewusstsein. Silus stopfte das blutige Haupt von Fürst Voteporix, dem Stammesoberhaupt der Venicones, in seinen Rucksack und rannte los.
Er versuchte erst gar nicht, Lärm zu vermeiden, da ihn Maglorix durch seinen Schrei ohnehin verraten hatte. Jetzt kam es allein auf Schnelligkeit an. Kurzzeitig spielte er mit dem Gedanken, stehen zu bleiben und sich zum Kampf zu stellen, doch Buan war von kräftiger Statur und zweifellos ein erfahrener Krieger. Silus dagegen war kleiner als die meisten Männer, und obwohl er Messer und Drahtschlinge geschickt einzusetzen vermochte, wenn er das Überraschungsmoment auf seiner Seite hatte, bezweifelte er, dass er einen ihm körperlich derart überlegenen Gegner in einem Kampf Mann gegen Mann besiegen konnte. Außerdem durfte er sich durch nichts davon abhalten lassen, mit dem Kopf und der Nachricht von einem bevorstehenden Kriegszug das Kastell zu erreichen.
Buan würde beim Anblick seines enthaupteten Fürsten ganz sicher vor Schreck innehalten und dann nach dem bewusstlosen Maglorix sehen, was Silus einen Vorsprung verschaffte. Allerdings wusste er nicht, in welchem Zustand Maglorix war. Vielleicht war er bereits wieder bei Bewusstsein, doch es war auch nicht ausgeschlossen, dass er nie wieder aufwachte. Buan würde sich entscheiden müssen, ob er zur Wallburg zurücklief und Hilfe holte oder auf eigene Faust die Verfolgung aufnahm: eine Verzögerung, die Silus so gut wie möglich auszunutzen gedachte.
Nachdem er eine Weile geradeaus gelaufen, absichtlich Äste zertreten und deutliche Fußspuren in Matsch und Laub hinterlassen hatte, blieb er stehen und lief etwa hundert Schritt in seinen eigenen Fußstapfen zurück, bevor er in einen im rechten Winkel abgehenden Wildwechsel einbog. Nun achtete er sorgfältig darauf, keine abgebrochenen Äste oder sonstige Spuren zu hinterlassen. Er bewegte sich schnell, aber gleichzeitig so vorsichtig und leise wie möglich.
Kurz darauf ertönte lautes Knacken und Rascheln hinter ihm. Er widerstand dem Drang, einfach loszurennen, und verließ sich ganz auf sein Täuschungsmanöver. Silus konnte zwei unterschiedliche Stimmen ausmachen, von denen eine Befehle brüllte und Wutschreie ausstieß: Maglorix war ganz offensichtlich wieder bei Bewusstsein. Silus’ Herz raste vor Anstrengung und Furcht. Als sich die Stimmen im Wald verloren, atmete er etwas ruhiger, doch schon bald wurden sie wieder lauter. Sie hatten das Ende seiner Fährte erreicht und schnell herausgefunden, dass er in seinen eigenen Fußspuren rückwärtsgegangen war. Also war wenigstens einer der beiden nicht dumm und ein guter Fährtenleser. Sie kamen immer näher. Mit Schrecken begriff Silus, dass sie dem Weg folgten, den er eingeschlagen hatte.
»Beim Hades, so eine Scheiße«, murmelte er und rannte los. Mit der Heimlichtuerei war es nun vorbei – jetzt zählte nur noch, schneller als seine Verfolger zu sein.
Es war eine Frage der Ausdauer. Das Unterholz war viel zu dicht, um einfach loszurennen, und des störenden Rucksacks konnte er sich auch nicht entledigen. Zum einen befand sich darin sein Proviant für den Rückweg, zum anderen hatte er sein Leben für den Kopf riskiert und würde ihn ganz bestimmt nicht einfach so zurücklassen. Seine Beine schmerzten und er keuchte vor Anstrengung. Nun verfluchte er sich für seinen Wagemut und versuchte den Gedanken zu verdrängen, dass er dadurch vermutlich seine Frau zur Witwe und seine Tochter zur Halbwaise gemacht hatte.
Doch nach und nach wurden die Geräusche hinter ihm leiser. Entweder war Silus der Ausdauerndere oder Maglorix war noch zu mitgenommen für eine längere Verfolgungsjagd und Buan wollte ihn in diesem Zustand nicht allein lassen. Schließlich verstummten das Knacken der Äste und das Trampeln der schweren Schritte vollständig.
»Rööööömer!«
Maglorix’ Schrei wurde durch den Wald gedämpft, drang aber immer noch laut und deutlich an Silus’ Ohren.
»Röööömer! Ich habe dein Gesicht gesehen und werde dich finden! Du gehörst mir!«
Silus zog den Kopf ein und rannte los.
Als sie am südlichen Waldrand ankamen, musste sich Maglorix auf Buan stützen. Die gänseeigroße Beule an seinem Hinterkopf pulsierte schmerzhaft im Takt seines Herzschlags. Sein Bart war mit dem Blut verklebt, das nach dem Tritt des Römers aus seiner Nase gespritzt war. Als er vorsichtig die höchstwahrscheinlich gebrochene Nase betastete, überkam ihn ein plötzlicher Schwindel, und einen Augenblick lang wurde ihm schwarz vor Augen. Buan merkte, dass Maglorix’ Beine nachgaben, legte wortlos einen Arm um seinen Brustkorb und stützte ihn, bis der Schwächeanfall nachließ. Der Sohn des Stammesfürsten ließ den Blick über die Auen, Hügel und Wälder seiner Heimat schweifen und sprach ein Gebet in nüchternem Ton und ohne die Stimme zu erheben.
»Cailleach Bhéara, göttliche Hexe, ich schwöre bei allem, was mir lieb und teuer ist, dass ich mich an dem Römer rächen werde, der meinen Vater getötet und entehrt hat. Er wird leiden, so wie ich gelitten habe. Dies gelobe ich feierlich.«
Buan neigte als stummer Zeuge dieses Gelübdes den Kopf. Maglorix schloss die Augen. Zwei Bilder hatten sich tief in seinen Geist eingebrannt: das abgetrennte, bluttriefende Haupt seines Vaters und das Antlitz des Römers, der es in die Höhe gehalten hatte. Er hatte das schlammverschmierte Gesicht des Mörders lediglich im Zwielicht und auch nur einen Augenblick gesehen, bevor dieser ihn bewusstlos geschlagen hatte, doch er würde es nicht vergessen. Niemals.
Maglorix starrte auf den Boden. Der Römer war längst über alle Berge. Wut und Trauer verliehen dem Fürstensohn nicht länger die nötige Kraft für die Verfolgung. Buan wäre noch ausdauernd genug gewesen, weigerte sich aber standhaft, seinem angeschlagenen Schützling von der Seite zu weichen und dem Römer hinterherzujagen. Maglorix musste sich wohl oder übel damit abfinden, dass ihm seine Beute entkommen war.
Er deutete auf die Spuren der genagelten Stiefel im Schlamm.
»Ich muss wissen, wo er herkam. Und was er mit dem Kopf meines Vaters vorhat.«
»Herr, Eure Familie und Eure Männer machen sich bestimmt schon Sorgen. Wir sollten umkehren.«
»Nein!« Maglorix spie das Wort förmlich aus. »Heute ist nicht der Tag der Vergeltung, aber er wird bald kommen. Doch dazu muss ich wissen, wo der Römer zu finden ist.« Er ließ den riesenhaften Krieger stehen und folgte stur den Spuren in südlicher Richtung. Buan folgte seinem Herrn seufzend und hielt sich immer in seiner Nähe, um ihn aufzufangen, falls ihm erneut schwarz vor Augen wurde.
Sie marschierten den ganzen Tag durchs Grenzgebiet, vorbei an einsamen Gehöften und Siedlungen. Mehrmals verloren sie die Spur, doch Maglorix, der sich seit frühester Kindheit mit den besten Kriegern und Jägern seines Vaters im Fährtenlesen geübt hatte, fand sie immer nach kurzer Zeit wieder. Als es dämmerte, sahen sie in der Ferne den Antoninuswall und das Kastell, das die Römer Voltania nannten.
Maglorix spuckte aus. Der Antoninuswall mit seinen Gräben, Schanzen, Kastellen und Befestigungen, der sich von der Ost- bis zur Westküste Kaledoniens erstreckte, war ein Stachel in seinem Fleisch. Der Wall war zu Lebzeiten seines Großvaters errichtet worden, doch kurz nach seiner Fertigstellung hatten die Kaledonier die Römer bis zum Hadrianswall im Süden zurückgedrängt – bis der verfluchte römische Feldherr Septimius Severus mit seinen Legionen das Gebiet erneut besetzt, den Wall wiederaufgebaut und Kaledonien verwüstet hatte.
Sein Großvater hatte ihm von dem großen kaledonischen Heerführer Calgacus erzählt, der dem römischen Eroberer Agricola Widerstand geleistet hatte, aber schließlich bei der Schlacht am Mons Graupius besiegt worden war.
Über hundert Winter später waren Severus und sein Sohn im Hochland eingefallen. Die Kaledonier und die mit ihnen verbündeten Stämme, darunter auch die als »Hundesippe« bezeichneten Venicones, zu denen Maglorix gehörte, hatten einen zermürbenden Kleinkrieg gegen die Legionen und ihre Hilfstruppen geführt und ihnen schwere Verluste beigebracht. Severus hatte mit Verwüstung und Grausamkeit geantwortet. Noch heute kamen den kampfgestählten Kriegern aus Maglorix’ Stamm die Tränen, wenn sie am Lagerfeuer davon erzählten, wie ihre Eltern an Bäume genagelt, ihre Schwestern von ganzen Kompanien vergewaltigt und ihre Kinder dem Hungertod überlassen worden waren, nachdem die Römer das Korn verbrannt und das Vieh niedergemetzelt hatten. Die einst so stolzen Kaledonier hatten sich angesichts ihrer drohenden Vernichtung zu Friedensverhandlungen bereiterklärt, die jedoch an den unannehmbaren Forderungen des hochmütigen Severus gescheitert waren. Die Kaledonier und ihre Verbündeten waren zu schwach, um die Römer in einer offenen Feldschlacht herauszufordern, und setzten ihre Strategie der Nadelstiche fort, indem sie von Dùn Mhèad aus zu Überfällen und Raubzügen aufbrachen. In der Wallburg hatte sich fast ein halbes Tausend wütender Krieger versammelt, die es kaum erwarten konnten, Tod und Verderben über die römischen Barbaren zu bringen.
Und dann war dieser römische Spion aufgetaucht, der nicht nur Maglorix’ Vater ermordet und dessen Leichnam geschändet, sondern zweifellos auch die Kriegsvorbereitungen beobachtet hatte. Gut möglich, dass er genau in diesem Augenblick seinen Befehlshabern darüber Bericht erstattete, während Maglorix vor der uneinnehmbaren römischen Befestigung stand und seine Zeit verschwendete, anstatt seinen Kriegern den Befehl zum Angriff zu geben, bevor sich die Römer gefechtsbereit machen konnten.
»Buan …«, fing er an, dann runzelte er die Stirn. Die Spuren des römischen Kundschafters waren immer noch deutlich im morastigen Boden zu erkennen. Doch sie führten nicht auf das Kastell zu.
Maglorix folgte der Fährte, wo sie den Weg nach Voltania verließ. Buan blieb stets dicht an seiner Seite. Der Leibwächter sagte nichts, hielt jedoch wachsam nach Patrouillen oder feindlich gesonnenen Einheimischen Ausschau, die sie den Römern ausliefern wollten. Maglorix dagegen war ganz auf die Fußspuren konzentriert. Mit Einbruch der Dämmerung erreichten sie den Gipfel eines Hügels, von dem aus sie eine jener kleinen, von den Römern Vicus genannten Siedlungen erblickten, die in der Nähe jedes Kastells zu finden waren und diejenigen beherbergten, die den Legionen folgten oder von ihnen profitierten: Händler, Handwerker, Schankwirte, Huren und nicht zuletzt die Familien der Soldaten.
Maglorix schüttelte den Kopf, was er sofort bereute, als ihn ein stechender Schmerz durchzuckte. Dann tadelte er sich für seine Begriffsstutzigkeit. Erst jetzt wurde ihm klar, weshalb der Kundschafter nicht gleich zu seinen Vorgesetzten gerannt war, um Meldung zu machen und das Haupt seines Vaters zu überbringen. Der Römer war eine lange Zeit unter miserablen Bedingungen allein im Feindesland unterwegs gewesen. Was war diesem Mann wichtiger, als seine Pflicht zu erfüllen? Eine Hure? Das war nicht ausgeschlossen, doch Maglorix bezweifelte, dass einem Mann, der so lange Kälte, Hunger und Einsamkeit ertragen hatte, zuallererst der Sinn nach Befriedigung fleischlicher Gelüste stand. Er an der Stelle des Soldaten mit den genagelten Stiefeln hätte sich nach warmem Essen, einem warmen Bett und den Umarmungen seiner Liebsten gesehnt. Kein Zweifel: Der Römer war bei seiner Familie.
Maglorix sah sich das kleine Städtchen genauer an. Es bestand aus mehreren größeren Gebäuden – Tempel, Geschäfte, Lagerhäuser – und vielen bescheidenen, aus Backsteinen oder lediglich aus mit Lehm verkleidetem Flechtwerk errichteten Wohnhäusern. Hunde, Hühner, Schweine und Kinder trieben sich spielend, pickend und schnüffelnd in den Gassen zwischen den Gebäuden herum. Eine Tür ging auf und eine dicke Frau schrie etwas Unverständliches auf Latein, woraufhin zwei Kinder widerwillig das Spiel mit einem Welpen einstellten und ins Haus schlichen. Die Tür fiel wieder zu.
Maglorix hatte genug gesehen.
»Buan, merk dir diesen Ort gut«, sagte er. »Hier werden wir den Römern zeigen, wie es sich anfühlt, wenn das eigene Heim dem Erdboden gleichgemacht wird.«
Zweites Kapitel
Silus stieß so ungestüm die Tür auf, dass sie gegen die Steinwand krachte und ein Stück des Strohdaches vor ihm auf den Boden fiel. Ein kleines, fünf oder sechs Jahre altes Mädchen versteckte sich kreischend hinter den Beinen seiner Mutter und spähte misstrauisch dazwischen hervor. Erst jetzt wurde Silus bewusst, wie angsteinflößend er auf ein Kind wirken musste. Sein verfilzter Bart starrte vor Schlamm und in den braunen, ungepflegten Haarsträhnen hingen Zweige und Laub. Er hatte schon seit einer Ewigkeit nicht mehr gebadet und stank dementsprechend, darüber hinaus trug er eine schwere Tasche mit einem großen getrockneten Blutfleck darauf mit sich herum.
Die Mutter des Mädchens sah Silus kühl an.
»Was willst du hier? Du hast hier nichts zu suchen.«
»Gar nichts?«, fragte er. »Noch nicht mal einen Kuss?«
Sie trat vor und verpasste ihm eine schallende Ohrfeige.
»Du wolltest in zwei Tagen wieder zurück sein!«, schrie sie. »Ich dachte, du seist tot!«
»Aber Velua, geliebte Gattin«, sagte er in einem, wie er hoffte, besänftigenden Tonfall. »Befehle sind dazu da, um ausgeführt zu werden. Egal, wie lange es dauert.«
»Scheiß auf die dreckige Hure von Befehl. Was ist mit deiner Familie?«
»Ich bin Soldat, Liebste, und muss dorthin gehen, wo man mich hinschickt. Aber dafür haben wir ein Dach über dem Kopf und Essen auf dem Tisch.«
Sie blickte durch die Löcher im reparaturbedürftigen Dach zum Himmel auf, dann sah sie den altbackenen Brotlaib und ein wenig schmackhaft wirkendes Stück Käse auf dem Tisch an.
»Meinst du etwa dieses Dach? Dieses Essen?«
»Mama? Ist das Papa?«, fragte das Mädchen.
Silus ging in die Knie und breitete die Arme aus. »Sergia, mein Schatz, ich bin’s!«
Sergia kreischte abermals, doch diesmal vor Freude. Sie rannte auf ihn zu und umarmte ihn fest, dann trat sie einen Schritt zurück und rümpfte die Nase. »Papa, du stinkst.«
»Ich weiß, meine Kleine. Da, wo ich war, gab es keine Badehäuser.«
»Wo warst du denn?«
»Ich habe dich und deine Mama vor den bösen Kaledoniern und Maeatae beschützt.«
Sergia formte mit Daumen, Zeige- und Mittelfinger einen Kreis und spuckte aus, um das Böse abzuwehren.
Silus lächelte, dann überkam ihn eine bleierne Müdigkeit. Er schloss die Augen und legte eine Hand auf die Stirn.
Sofort war Velua an seiner Seite und legte eine stützende Hand auf seine Schulter. »Fehlt dir etwas, Liebster?«
»Nein, mein Schatz. Es war nur ein sehr … fordernder Auftrag, und ich bin hundemüde.«
Velua drehte sich zu ihrer Tochter um. »Sergia, steh nicht einfach nur herum! Bring deinem Vater Wein und mach etwas Wasser über dem Feuer warm, damit er den Schmutz und Gestank von sich abwaschen kann. Komm, Silus, leg dich doch erst mal hin.«
Velua führte ihn an der Hand in das Schlafzimmer, das eigentlich nur eine mit einem Vorhang vom Hauptraum abgetrennte Nische war. Ein einfacher Holzrahmen mit Strohmatratze diente der Familie als Bett. Mitten darauf lag eine kleine, alte schwarz-weiße Hündin. Sie öffnete die Augen einen Spalt weit, schnüffelte und überlegte. Dann sprang sie auf und lief kläffend in kleinen Kreisen herum.
»Issa! Immer mit der Ruhe, alte Dame«, sagte Silus grinsend und hob sie hoch. »Du bist inzwischen wohl ganz taub geworden, wenn du von dem Tumult gerade eben nichts mitbekommen hast.«
Er drückte sie an sich. Sie leckte eifrig sein schlammverkrustetes Gesicht.
»Christus und alle Götter des Olymp sind mein Zeuge, dass er diesen Hund mehr liebt als mich«, sagte Velua.
»Aber nicht doch, du Blüte meines Lebens«, sagte er, während er weiter mit der alten Hündin schmuste. »Obwohl ich Issa länger kenne als dich …«
»Wir sollten sie in den Kochtopf stecken. Dann wäre sie wenigstens noch zu etwas gut. Ich weiß gar nicht mehr, wann sie zum letzten Mal eine Ratte totgebissen oder ein Eichhörnchen mitgebracht hat.«
»Sie hat zwölf Sommer hinter sich und ist jetzt im verdienten Ruhestand«, tadelte er seine Frau.
»Hmm. Trotzdem – wenn sie nicht aufhört, ins Haus zu pissen, wird sie den dreizehnten nicht mehr erleben. Und jetzt zieh die dreckigen Lumpen aus. Die müssen gekocht werden. Oder am besten gleich verbrannt.«
Velua half Silus aus der Hose und der Tunika. Sie sagte nichts, als sie die von den Zweigen und Dornen zerkratzte Haut und die von den Stürzen auf Äste und Steine herrührenden Blutergüsse erblickte, doch ihr mitleidiger Gesichtsausdruck und ihre sanften Berührungen straften ihre strengen Worte von vorhin Lügen.
Sergia schob den Vorhang beiseite und brachte Silus mit Wasser gemischten Wein. Er nahm den Becher dankbar entgegen und trank in tiefen Zügen. Der Wein löschte seinen Durst und wärmte seinen leeren Magen. Sergia verschwand wieder und kam kurz darauf mit einer Schüssel lauwarmen Wassers zurück. Velua hielt prüfend eine Fingerspitze hinein, dann nickte sie.
»Gut gemacht, Sergia. Hier, nimm diese Kupfermünze, geh zu Senovara hinüber und lass dir sechs Eier geben. Die kochen wir uns zum Abendessen.«
Sergia nahm grinsend die Münze und lief zur Tür.
»Ach, Sergia«, rief Silus, woraufhin Sergia stehen blieb und ihren Vater erwartungsvoll anblickte. »Frag doch mal, ob du eine halbe Stunde mit Senovaras Welpen spielen darfst.« Er zwinkerte seiner Frau zu. »Oder gleich eine ganze Stunde.«
»Ja, Papa«, sagte das Mädchen und lief aus der Tür.
»Erst verschwindest du zwei Wochen lang spurlos, und wenn du endlich zurückkommst, stinkst du wie ein Rumtreiber, der in einem Schweinestall geschlafen hat. Du glaubst ja wohl nicht, dass …«
Er brachte sie mit einem langen, leidenschaftlichen Kuss zum Schweigen. Sie schmiegte sich an ihn, legte die Arme um ihn und erwiderte den Kuss, wobei sie die Zunge tief in seinen Mund schob. Silus ließ sich wieder aufs Bett sinken und zog sie mit sich, sodass sie auf ihn fiel.
»Silus«, sagte sie lachend. »Das ist mein Ernst. Du bist schmutzig.«
»Genau wie deine Fantasie.«
Er küsste sie noch einmal, legte die Hand auf eine Brust, drückte und knetete. Trotz oder vielleicht auch gerade wegen der Angst und Anstrengung der letzten Tage war er über die Maßen erregt. Velua setzte sich auf ihn, nahm ihn in sich auf und ließ ihrer Leidenschaft freien Lauf. Zeit und Schwangerschaft waren nicht spurlos an ihrem Gesicht und Körper vorübergegangen, doch für ihn war sie nach wie vor schön wie eine Göttin, und er sah ihr den ganzen, zugegebenermaßen nicht besonders langen Liebesakt über in die Augen.
»Das ging ja schnell«, sagte Velua.
»Ich bin etwas aus der Übung«, sagte Silus, starrte an die Decke und fragte sich, ob die zu erwartende Belohnung für einen anständigen Dachdecker reichen würde. Vielleicht konnte er seiner Frau ja etwas Schmuck schenken – bei Venus, sie hatte es sich redlich verdient. Velua entstammte einer wohlhabenden römisch-britannischen Familie. Ihr Vater hatte sie verstoßen, als sie sich in einen einfachen Soldaten verliebt und ihn geheiratet hatte. Silus war noch nicht einmal Legionär, sondern lediglich Angehöriger der Hilfstruppen. Doch nicht mehr lange: Jetzt winkten Ruhm, Geld und vielleicht eine Beförderung.
Ein Schrei von hinter dem Vorhang ließ sie beide hochfahren. Velua war schneller aus dem Bett und riss den Vorhang zurück. Dann erstarrte sie vor Schreck und schlug eine Hand vor den Mund. Silus, der direkt hinter ihr stand, konnte sich schon denken, was seine Tochter zum dritten Mal an diesem Nachmittag hatte loskreischen lassen.
Sergia stand mit dem Rücken zur Wand da und tastete mit den Handflächen hinter sich über den Lehm, als suchte sie nach einer Möglichkeit, dem grässlichen Anblick noch weiter zu entfliehen. Dabei schrie sie ununterbrochen und hatte die Augen starr auf den Boden gerichtet. Silus folgte ihrem Blick und seine Befürchtung bestätigte sich.
Als das neugierige Kind auf der Suche nach Mitbringseln den Rucksack seines Vaters geöffnet hatte, war Voteporix’ abgetrennter Kopf herausgerollt und ruhte nun etwas schief an der Stelle, an der er auf dem strohbedeckten Boden zum Liegen gekommen war. Die blinden Augen des toten Stammesfürsten waren nach oben verdreht, als wollte er die eigenen Augenbrauen betrachten. Der Mund war zu einem höhnischen Grinsen verzogen, das schwarze, verfaulte Zähne enthüllte, das lange, graue Haar war verfilzt und verklebt, eine Gesichtshälfte mit gallertartigen Klumpen aus getrocknetem Blut bedeckt. Der Hals endete abrupt an einem ausgefransten Wundrand. Die weißen Halswirbel, die Blutgefäße, die Speise- und Luftröhre waren deutlich zu erkennen.
»Bei Mutter Maria, Venus und Minerva Sulis«, flüsterte Velua, dann wandte sie sich zu Silus um. »Was im Namen aller heiligen Göttinnen ist das?«
Silus ging an ihr vorbei, hob Sergia auf, nahm sie in die Arme und drehte sie weg von dem Schrecken, der so plötzlich in ihrem Heim erschienen war. Sie schrie immer noch. Er hielt ihr den Mund zu.
»O Götter, wahrscheinlich glauben die Nachbarn bereits, dass ich dabei bin, euch zu ermorden. Wenn sie so weiterschreit, treten sie uns noch die Tür ein.«
Velua ging auf ihn zu und riss Sergia aus seinen Armen. Sie wiegte sie sanft hin und her und strich mit der Hand über ihr Haar, bis das Kreischen allmählich in blubberndes Schluchzen überging. Velua funkelte Silus böse an. »Was«, sagte sie mit leiser, bedrohlicher Stimme, »ist das, du dummes Arschloch?«
»Keine Flüche vor Kinderohren«, sagte Silus und bereute den Versuch, die Situation mit einem Scherz zu entschärfen, sofort. Sie schien ihn mit Blicken töten zu wollen. »Lass es mich dir erklären.«
»Vielleicht solltest du erst mal deiner Tochter erklären, dass das, was du da angeschleppt hast, kein Dämon ist.«
Silus trat hinter Velua und hob das Kinn seiner Tochter, bis sie ihm in die Augen sah. »Mein kleiner Honigkuchen«, sagte er. »Das war ein böser Mann. Ein Maeata. Ich habe dir gesagt, dass ich gegen sie kämpfe, um euch zu beschützen, weißt du noch? Und bei dem hier habe ich dafür gesorgt, dass er dir nichts mehr tun kann.«
Sergia schluckte ein paarmal. »Wollte er dir auch wehtun?«
»Ja«, sagte Silus. Das entsprach zwar nicht ganz der Wahrheit, aber der veniconische Stammesfürst hätte sicher nicht gezögert, ihn aufzuspießen, wenn er die Gelegenheit dazu gehabt hätte. »Aber weil er jetzt tot ist, ist Britannien sicherer für uns.«
»Und wenn du seinen Geist mitgebracht hast und der uns heute Nacht umbringt, wenn wir schlafen?«
Bei dieser Vorstellung unterdrückte Silus ein Schaudern. Bei den Göttern, dachte er, hoffentlich nicht. »Aber nein, meine Kleine. Dir kann hier überhaupt nichts passieren. Dein Papa wird niemals zulassen, dass dir etwas Schlimmes zustößt.«
Velua bedachte ihn mit einem letzten vernichtenden Blick und ging mit Sergia ins Schlafzimmer hinüber. Silus beugte sich seufzend vor, hielt den auf dem Boden liegenden Rucksack auf und ließ den Kopf mit einem leichten Tritt hineinrollen. Dann knotete er ihn fest zu und warf ihn in die Ecke, wo er mit einem dumpfen Geräusch landete. Sein Blick fiel auf die Eier, die Sergia geholt hatte. Er schätzte die Wahrscheinlichkeit, sie zum Abendessen zu bekommen, eher gering ein. Silus kauerte sich in eine Ecke und vergrub den Kopf in den Händen.
Velua schmollte so lange, dass er sich gleich mehrere glaubwürdige Entschuldigungen für seine Sorglosigkeit hätte ausdenken können, wäre er nicht zu müde dafür gewesen. Seufzend fand er sich damit ab, ihr die Wahrheit zu sagen.
Seine Frau schob den Vorhang zurück und kam mit leisen Schritten und finsterer Miene in den Raum.
»Sie schläft«, sagte sie.
»Gut.«
Es folgte eine unangenehme Gesprächspause. Velua setzte sich auf einen Hocker. War dies der richtige Moment, um ihr die Wahrheit zu sagen?
»Also?«, fragte sie. Es war definitiv der richtige Moment.
Nachdem er ihr von seinem Erkundungsbefehl erzählt hatte, der ihn zwei Wochen lang in die Wildnis geführt hatte, saß Velua einfach nur da und starrte ihre im Schoß verschränkten Hände an. »Du bist wütend auf mich«, sagte er, als die Stille unerträglich wurde.
»Natürlich bin ich wütend auf dich«, sagte Velua mit ruhiger, leiser und beinahe tonloser Stimme.
»Tut mir leid«, sagte Silus. »Ich hätte das verdammte Ding gar nicht erst ins Haus bringen dürfen, sondern damit sofort ins Kastell gehen müssen. Ich würde doch Sergia niemals absichtlich so erschrecken. Oder dich.«
»Du bist wirklich scheißdämlich.«
»Hm. Stimmt.«
»Weißt du überhaupt, warum ich wütend auf dich bin?«
»Weil ich so lange weg war?«, riet Silus. »Weil ich den Kopf mitgebracht habe? Weil ich schmutzig bin?«
»Nein, Silus. Weil du dabei hättest draufgehen können.«
»Ach so«, sagte er. »Deshalb.«
»Ja, deshalb. Du bist ein unvernünftiges und unnötiges Risiko eingegangen. Willst du, dass deine Frau zur Witwe wird und deine Tochter ohne Vater aufwächst?«
»Aber Liebste, ich bin dieses Risiko doch nur für euch eingegangen. Sieh dir doch diese beschissene Bruchbude hier an! Du hast Besseres verdient. Dieser Kopf könnte alles ändern. Vielleicht bekomme ich einen Bonus. Oder werde befördert. Dann kann ich dir Schmuck und Schminke kaufen und Sergia Spielsachen und schöne Kleider.«
»Ich habe meinen Reichtum aufgegeben, um mit dir zusammen zu sein. Du beleidigst mich, wenn du mir unterstellst, dass mir Geld wichtiger ist als unsere Liebe.«
Dies war der richtige Augenblick, um ihr mitzuteilen, wie viel sie ihm bedeutete und wie dankbar er für ihre Liebe war. Doch statt schöner Worte kamen ihm zu seiner eigenen Überraschung die Tränen. Er ließ den Kopf hängen, bedeckte die Augen mit einer Hand und versuchte, nicht zu schluchzen. Wahrscheinlich lag es auch an der tiefen Erschöpfung, dass er sich derart von seinen Gefühlen überwältigen ließ.
Dann spürte er eine Hand auf seiner Schulter. Velua kniete neben ihm. Er hob den Kopf und blickte in ihr besorgtes Gesicht.
»Was hast du denn?«
»Ich liebe dich«, sagte er mit erstickter Stimme, vergrub seinen Kopf an ihrer Schulter und ließ den Tränen freien Lauf. Sie wiegte ihn sanft in ihren Armen und hielt ihn auch dann noch fest, als er aufgehört hatte zu schluchzen. Er genoss ihre Wärme und das entspannende Auf und Ab ihres Brustkorbs.
Sergia spähte hinter dem Vorhang hervor. »Mama, warum weint Papa denn? Hat ihm der Dämonenkopf was getan?«
»Aber nein, mein Schatz. Papa geht’s gut. Er ist nur müde.«
»Mama und ich passen schon auf dich auf, Papa. Jetzt bist du ja zu Hause und musst dir keine Sorgen mehr machen.«
Wieder wurde Silus von schweren Schluchzern geschüttelt.
»Du bist wirklich scheißdämlich«, sagte Geganius, Silus’ unmittelbarer Vorgesetzter.
Alle Erwartungen und Hoffnungen flossen förmlich aus ihm heraus, bis Silus wie ein leerer Wasserschlauch vor dem stämmigen Zenturio stand.
»Aber … aber das ist der Kopf von Voteporix, dem Stammesfürsten der Venicones. Dem Anführer der Krieger, die uns angreifen wollten.«
»Angreifen wollten?«, wiederholte Geganius. »Ja, glaubst du denn, dass du den Angriff damit verhindert hast?«
»Also, ich …«
»Wenn ich deinem Vater den Kopf abschlage, würdest du dann einfach mit den Schultern zucken und nach Hause gehen?«
Silus hatte sich in seiner Kindheit und Jugend sehr oft gewünscht, jemand möge seinem Vater den Kopf abschlagen. Aber er verstand, worauf der Zenturio hinauswollte.
Geganius schüttelte den Kopf. »Wahrscheinlich glaubst du jetzt, dass du dafür Ruhm, Ehre und eine Beförderung verdient hast?«
»Nein, Herr«, log Silus. »Ich hatte ausschließlich den Schutz Britanniens und die Ehre Roms im Sinn.«
»Komm mit. Wir erzählen dem Präfekten lieber gleich, was du für eine Riesenscheiße gebaut hast.«
Geganius führte den geknickten Silus zur Amtsstube des Präfekten. Dessen Sekretär, ein groß gewachsener und glatzköpfiger ehemaliger Sklave fortgeschrittenen Alters, sah sie von oben herab an. Seine Hakennase erinnerte Silus an die Büste von Julius Caesar, die er einmal gesehen hatte.
»Was willst du, Geganius?«
»Pallas, wir müssen sofort mit Präfekt Menenius sprechen.«
»Er ist beschäftigt«, sagte Pallas. »Kommt ein andermal wieder.«
»Es ist wirklich dringend.«
»Das sagen alle.«
»Du wirst ihm jetzt sofort ausrichten, dass wir ihn sprechen wollen«, sagte Geganius mit drohender Stimme. »Wenn Menenius erfährt, dass du uns in dieser Angelegenheit nicht unverzüglich vorgelassen hast, reißt er dir die Eier ab.« Geganius musterte den Freigelassenen von oben bis unten. »Falls du überhaupt noch welche hast.«
Pallas warf voller Abscheu den Kopf zurück und verschwand in der Amtsstube des Präfekten. Nach einem unverständlichen Wortwechsel öffnete Pallas die Tür wieder und winkte sie herein.
Menenius, ein ergrauter Veteran, der sich aus eigener Kraft vom einfachen Soldaten bis zum Präfekten des Kastells hochgearbeitet hatte, saß hinter einem mit Schriftrollen und Wachstäfelchen bedeckten Schreibtisch und sah sie mit gereizter Miene an.
»Was willst du, Geganius? Sprich, und fasse dich kurz.«
»Silus hier kann die Angelegenheit sicher viel besser erklären als ich.« Er nickte Silus auffordernd zu.
Silus, dessen Mund plötzlich staubtrocken war, öffnete den Rucksack und zog den Kopf am Haarschopf heraus.
Pallas stieß einen leisen Schrei aus. Menenius dagegen kniff nur leicht die Augen zusammen. »Was in aller Scheißgötter Namen ist das?«
Geganius stieß Silus den Ellenbogen in die Rippen.
»Das«, sagte Silus und bemühte sich nach Kräften um eine einigermaßen feste Stimme, »ist … ich meine, war … Voteporix, ein Stammesfürst der Venicones.«
Nun machte Menenius große Augen. »Silus«, sagte er. »Du bist wirklich scheißdämlich.«
Silus verzog das Gesicht. Allmählich glaubte er es selbst.
»Wie genau lauteten deine Befehle, Soldat? Raus mit der Sprache.«
»Herr, ich sollte den Berichten mehrerer Händler nachgehen, die angeblich in der Gegend um Dùn Mhèad aufrührerische Umtriebe beobachtet hatten. Mein Befehl lautete, das Gebiet nördlich des Walls auszukundschaften und herauszufinden, ob diese Gerüchte der Wahrheit entsprechen.«
»Und?«
»Es ist wahr, Herr. Ich konnte einen großen Feindesverband von schätzungsweise fünfhundert Kriegern beobachten, der sich in der Wallburg versammelt hatte.«
Menenius stieß einen Pfiff aus. »Genug, um uns richtig Ärger zu machen, meinst du nicht auch, Geganius?«
»Ja, Herr, wenn sie uns unvorbereitet angetroffen hätten, noch dazu jetzt, wo sich der Kaiser und Caracalla noch im Winterlager in Eboracum befinden. Aber mit Vorwarnung? Wenn ich die Patrouillen zurückbeordere, die Garnison in Gefechtsbereitschaft versetze und mit einheimischen Hilfstruppen verstärke, sollten wir mit ihnen fertigwerden.«
»Wohl wahr«, sagte Menenius. »Und da du genau wusstest, dass es von höchster Wichtigkeit war, uns vor diesem bevorstehenden Angriff zu warnen, hast du alles, was in deiner Macht stand, getan, um schnell und sicher zurückzukehren und Meldung zu machen, richtig?«
»Ja, Herr«, sagte Silus und hoffte inständig, dass sie nicht herausfanden, dass er die letzte Nacht im Vicus mit seiner Frau in seinem Bett verbracht und sich erst heute Morgen zum Dienst gemeldet hatte.
»Und wie im Namen aller Götter des Olymp, von Christus und Maria und Mithras und jeder anderen beschissenen Gottheit«, schrie Menenius und sprang auf, »kommt es dann, dass der Kopf eines Maeatae-Fürsten hier vor mir liegt?« Er knallte die Faust auf den Tisch.
»Herr«, sagte Silus, »ich dachte …«
»Du hast gedacht, Soldat? Bist du dir da sicher?«
»Ja, Herr. Die Gelegenheit war günstig, und ich dachte, dass der Tod ihres Anführers ihre Moral möglicherweise so schwächt, dass sie den Angriff abblasen.«
»Ihre Moral schwächt? Dazu will ich dir eine Geschichte erzählen, Soldat. Eines Tages, als wir noch Kinder waren, hat mir mein älterer Bruder ein Wespennest gezeigt und mich davor gewarnt, die Wespen zu ärgern, da sie sonst auf mich losgehen würden. Und was habe ich getan, sobald mein Bruder weg war? Natürlich sofort mit einem Stock in das Nest gestochen. Die Wirkung, die dieser Stock auf die Moral der Wespen hatte, ist ungefähr dieselbe, den die Ermordung, Schändung und Enthauptung ihres Fürsten auf die Maeatae haben wird.«
Silus lief es kalt den Rücken hinunter. Langsam dämmerte ihm, dass er die Situation völlig falsch eingeschätzt hatte und seine Fehlentscheidung nicht nur für seine Soldatenlaufbahn Konsequenzen haben würde.
Menenius setzte sich wieder und holte tief Luft. »Pallas«, sagte er, »wir müssen Boten zu den uns benachbarten Kastellen entlang des Walls entsenden und sie von einem höchstwahrscheinlich bevorstehenden, allem Anschein nach gegen Voltania gerichteten Maeatae-Angriff in Kenntnis setzen. Wir bitten sie um jeden Mann Verstärkung, den sie entbehren können, raten ihnen aber auch dringend, sich gefechtsbereit zu machen für den Fall, dass es die Barbaren doch auf ein anderes Kastell abgesehen haben. Geganius, du versetzt die Garnison in Alarmbereitschaft. Jeder hat rund um die Uhr Waffen und Rüstung zu tragen, bis die Gefahr vorüber ist. Lass die Ausrüstung überprüfen und sieh zu, dass wir genug Vorräte, Holz, Pfeile und Schleudern haben, falls es zu einer Belagerung kommt. Die Barbaren können in einer Stunde oder auch erst in einer Woche angreifen. Später eher nicht – so lange halten sie es nicht miteinander aus, ohne sich gegenseitig an die Gurgel zu gehen.«
»Ja, Herr«, sagte Geganius. »Und was ist mit ihm?« Er deutete mit dem Kinn auf Silus.
»Lass ihn in eine Zelle sperren. Da soll er über seine Torheit nachdenken, bis ich mir die passende Strafe für ihn überlegt habe.«
»Aber Herr!«, protestierte Silus.
»Mach es nicht noch schlimmer«, sagte der Präfekt. »Geganius, schaff ihn mir aus den Augen.«
Maglorix blickte auf die Gesichter derjenigen herab, die sich zur Ratsversammlung im großen Rundhaus eingefunden hatten. Er saß auf einem hohen, mit menschlichen und tierischen Schädeln verzierten Thron, die anderen Ratsmitglieder hatten auf niedrigeren Stühlen oder einfachen, aus Ästen und Baumstämmen zusammengezimmerten Bänken im Kreis vor ihm Platz genommen. Sie waren völlig unterschiedlichen Alters. Erc, der älteste unter ihnen, hatte sechzig Winter auf dem Buckel. Viele waren im Gesicht und auf den Armen, und diejenigen, die die Tunika verschmähten, auch auf der Brust tätowiert. Ebenso viele trugen Narben von Gefechten gegen die Römer oder gegen andere Stämme zur Schau.
Erc ließ Maglorix nicht aus den Augen, während er mit zahnlosem Kiefer auf einem Brennnesselblatt herumkaute. Maglorix konnte den Ausdruck auf dem Gesicht des alten Mannes nicht enträtseln. Andere, leichter zu deutende Mienen verrieten Mitleid, Angst, Wut, Argwohn oder Verachtung. Sein Kopf schmerzte noch leicht, doch er hatte ordentlich gegessen und geschlafen und fühlte sich in der richtigen Verfassung, sein Anliegen vor den Rat zu bringen.
»Ihr alle wisst, weshalb mein Vater euch hier versammelt hat. Seit zwei Jahren verwüsten die Römer unser Land. Ihr Kaiser – verflucht seien er und seine Familie – konnte uns nicht besiegen und will uns nun mit Mord, Vergewaltigung und Raub in die Knie zwingen. Wir alle haben Brüder, Vettern, Söhne und sogar Frauen im Kampf gegen die barbarischen Invasoren verloren. Caracalla, der Sohn des Kaisers, hat seine Armeen gegen unsere Brüder im hohen Norden geführt, und wir alle wissen, was er dort angerichtet hat. Wir haben es mit eigenen Augen gesehen. Er hat das Korn verbrennen lassen, damit unser Volk verhungert. Er hat die Dörfer in Brand gesteckt, damit unser Volk erfriert. Wie viele Kinder der Kaledonier und Maeatae sind diesen Winter vor Hunger und Kälte gestorben? Ihr Blut klebt an Caracallas Händen, als hätte er sie eigenhändig hingeschlachtet. Er hat unsere Männer getötet und unsere Frauen vergewaltigt und mit seinem Samen befleckt, sodass sie jetzt römische Bastarde austragen müssen. Selbst die Römer haben unseren Ahnen Calgacus, der bei Mons Grapius besiegt wurde, nicht vergessen. Erc, möchtest du uns an seine Worte erinnern?«
Erc spuckte das Blatt aus und wiederholte den berühmten Satz, den der kaledonische Anführer dem Geschichtsschreiber Tacitus zufolge vor über hundert Jahren nach seiner Niederlage gegen Agricola – Tacitus’ Schwiegervater – ausgesprochen hatte: »Plündern, Morden, Rauben nennen sie mit falschem Namen Herrschaft, und wo sie Einöde schaffen, sprechen sie von Frieden.«
Maglorix sah zustimmendes Nicken, aber auch Unentschlossenheit und gegen ihn gerichteten Groll.
»Mein Vater wollte Feuer mit Feuer bekämpfen und die Römer lehren, uns zu fürchten. Er wollte sie hinter den Wall zurücktreiben, zurück zu den Votadini und Novantae und den anderen feigen Britonenstämmen, die ja schon vor langer Zeit die Beine für die Römer breitgemacht haben. Und jetzt haben sie ihn ermordet. Nicht im ehrenvollen Kampf, sondern auf die hinterhältigste Art und Weise. Und damit nicht genug, sie haben auch seinen Leichnam geschändet und seinen Kopf als Trophäe mitgenommen. Diese Beleidigung darf nicht ungesühnt bleiben. In seinem Namen und um seines Angedenkens willen werde ich euch gegen die Römer anführen. Wir werden ihn mit einem großen Sieg rächen und unsere Ehre wiederherstellen.«
Die Beifallsrufe waren nicht so laut, wie Maglorix gehofft hatte, und drangen auch nicht aus jeder Kehle.
Maglorix sah zu Lon hinüber. Der Druide hatte sich, wie es der Brauch war, das Haar bis zur Schädelmitte abrasiert. Dahinter fiel es weiß über seine Schultern. Er hatte eine lange, spitze Nase, zu weit auseinanderliegende Augen und vom Kopf abstehende Segelohren, die durch die traditionelle Haartracht erst recht zur Geltung kamen. Seine lange, feuerrote Robe war mit Goldstickereien geschmückt, dazu trug er einen goldenen Torques um den Hals. Am Ende des Holzstabs, den er bei sich führte, war eine Glocke angebracht. Der heilige Mann des Stammes, der hochmütig am anderen Ende des Raumes saß, gab zwar vor, unparteiisch zu sein, quittierte Maglorix’ Blick aber mit einem beinahe unmerklichen Kopfnicken. Maglorix lächelte in sich hinein. Er war froh, diesen Mann, der sowohl innerhalb des Stammes über großen Einfluss verfügte als auch in seiner Rolle als Mittler zwischen Menschen und Göttern eine wichtige Position bekleidete, an seiner Seite zu wissen.
»Wir sind zu wenige«, rief ein Stammesältester. »Endlich herrscht Waffenstillstand mit den Römern, und nach den katastrophalen Ereignissen des letzten Jahres lecken die Kaledonier genau wie die meisten anderen Maeatae-Stämme noch ihre Wunden. Wir sind nicht in der Lage, einen Krieg zu führen.«
»Ich verlange ja nicht von euch, es mit dem ganzen römischen Imperium aufzunehmen«, sagte Maglorix. »Ich schlage eine Strafexpedition vor – um unseren Stolz zurückzuerlangen und als Vergeltung und zur Ehre meines Vaters.«
»Das ist doch alles müßiges Gerede«, warf ein anderes Ratsmitglied ein, ein schmalgesichtiger, glatzköpfiger Mann namens Muddan. »Du bist nicht unser Anführer.«
»Wirklich nicht, Muddan?«, fragte Maglorix und richtete den Blick auf den alten Mann mit dem weißen Bart.
»Nein«, sagte Muddan unbeeindruckt, »bist du nicht. Fürst der Venicones wird man nicht durch Abstammung, sondern durch Wahl des Ältestenrates.«
»Dann trifft es sich ja gut, dass ihr alle hier versammelt seid. Also bitte, wählt mich zum Stammesfürsten, damit wir endlich zur Tat schreiten können.«
»Jeder Kandidat muss seine Redekunst, Stärke und Weisheit auf die Probe stellen und beweisen, dass er würdig ist, uns anzuführen. Für deinen Vater wurde keine Ausnahme gemacht und für seinen Nachfolger – wer das auch immer sein mag – genauso wenig.«
»Wer das auch immer sein mag? Ich bin durch Geburtsrecht und die Kraft meines rechten Armes der neue Fürst. Wir haben keine Zeit für solchen Unsinn. Während ihr sabbernden alten Narren debattiert, bringen sich die Römer in Gefechtsbereitschaft.«
»Sei vorsichtig, wie du mit denen sprichst, die älter und weiser sind als du«, sagte Muddan mit leiser Stimme.
Maglorix sprang vom Thron und in die Mitte des Kreises, um den die Mitglieder der Ratsversammlung saßen, zog in einer fließenden Bewegung das Schwert und beschrieb damit einen Bogen.
»Dieses Schwert verleiht mir alle Weisheit, die ich brauche. Ist unter euch einer, der mein Recht anzweifelt, diese Klinge als Fürst der Venicones zu führen?« Er drehte sich einmal um die eigene Achse und sah dabei jedem Ratsmitglied nacheinander in die Augen, woraufhin alle ohne Ausnahme den Kopf senkten. Schließlich erreichte Maglorix’ Blick den hinter dem Thron stehenden Buan. Der treue Leibwächter seines Vaters lächelte und nickte ihm knapp zu. Maglorix nickte zurück und wandte sich dann der Ratsversammlung zu. »Das wäre also geklärt. Niemand stellt mein Recht, euch anzuführen, infrage. Daher befehle ich euch allen …«
»Ich stelle dieses Recht infrage.«
Maglorix blickte in die Richtung, aus der die Stimme gekommen war. Die Silhouette eines großen, breitschultrigen Kriegers zeichnete sich im Licht ab, das durch die offen stehende Tür fiel. Zottiges, verfilztes Haar fiel über den Wolfspelz um die Schultern des Neuankömmlings.
»Tarvos«, sagte Maglorix und spuckte aus. »Du bist kein Mitglied der Ratsversammlung und hast daher nicht das Recht, mich herauszufordern.«
»Ich habe deine Rede gehört, Maglorix. Hast du nicht gesagt, dass der neue Anführer heute durch das Geburtsrecht und einen kräftigen Arm bestimmt wird? Wir haben denselben Großvater, lieber Vetter. Wollen wir nicht herausfinden, wer den stärkeren rechten Arm hat?«
»Du spielst mit deinem Leben«, sagte Maglorix mit zusammengekniffenen Augen.
»So sei es.«
Tarvos stürmte in die Mitte des Kreises und zog das Schwert. Maglorix taxierte seinen Gegner aufmerksam. Sein Vetter war einen halben Kopf größer und verfügte daher über eine etwas längere Reichweite, er selbst hingegen war zwei Jahre älter. Tarvos besaß noch nicht die voll ausgebildete Muskulatur eines Kriegers auf dem Zenit seiner Kraft, da konnte er noch so höhnisch grinsen. Maglorix hatte seit Längerem keinen Übungskampf mehr mit ihm bestritten, wusste jedoch, dass er unter seinen Altersgenossen als ebenso unbarmherzig wie talentiert im Umgang mit der Klinge galt.
Tarvos stand breitbeinig da, einen Fuß leicht vor den anderen gesetzt, und ließ das Schwert im lockeren Griff an der Seite herunterbaumeln. Maglorix hatte den Thron im Rücken. Die Spitze seiner Klinge berührte den Boden.
»So sei es, Tarvos. Ich stehe vor dem Thron meines Vaters. Du willst doch meinen Platz einnehmen, oder nicht?«
Misstrauisch trat Tarvos einen Schritt vor. Er witterte eine Falle – immerhin hatte auch Maglorix den Ruf eines listenreichen und durchtriebenen Kämpfers.
»Wieso zögerst du, Tarvos? Da war deine Mutter schneller bei der Sache – bedauerlicherweise zu deinem Nachteil.«
»Wovon redest du?«, knurrte Tarvos.
»Mein Vater war außer sich vor Wut, als er erfuhr, dass seine Schwester für einen römischen Soldaten die Schenkel gespreizt hat.«
Tarvos erbleichte. »Das ist eine Lüge.«
»Und neun Monate später hat sie dich ausgeschissen. Zögerst du deshalb? Weil du tief in deinem Inneren wie ein Römer kämpfen willst? In Schildkrötenformation, mit Männern zu allen Seiten, die dich beschützen?«
»Maglorix, das geht zu weit«, sagte Muddan. Maglorix beachtete ihn nicht.
»Sie hat deinem Vater die Hörner aufgesetzt, doch er hat diese Hure zu sehr geliebt, um ihr bei lebendigem Leib die Haut abzuziehen«, sagte Maglorix. »Deshalb hat er Schimpf und Schande ertragen und dich wie einen eigenen Sohn aufgezogen. Was siehst du mich so an, Tarvos? Wusstest du das nicht? Du musst es doch geahnt haben. Sehnst du dich insgeheim nicht nach dem Stadtleben? Träumst du nicht davon, Badehäuser zu besuchen, dich faul auf einem Sofa zu fläzen und von deinen Sklaven mit Weintrauben füttern zu lassen?«
Tarvos schwieg. Er hatte den Mund zu einer dünnen Linie zusammengepresst. Sein Schwert zitterte.
»Warum willst du Anführer dieses Stammes werden, Tarvos?«, fuhr Maglorix fort. »Um bei der ersten Gelegenheit deinen römischen Brüdern und Schwestern um den Hals zu fallen? So wie deine Hurenmutter damals?«
Tarvos stürmte brüllend durch den Kreis auf Maglorix zu, das Schwert im zweihändigen Griff hoch über den Schultern erhoben. Als er nahe genug war, holte er zu einem Schlag aus, der einen menschlichen Schädel so mühelos wie einen Apfel gespalten hätte.
Maglorix wich geschickt aus, hob die eigene Waffe und lenkte die gegnerische Klinge damit ab. Tarvos’ Schwert krachte so heftig in den Thron, dass es Kleinholz aus der Rückenlehne machte, sich in die Sitzfläche bohrte und einen Augenblick lang dort stecken blieb.
Mehr als diesen Augenblick brauchte Maglorix nicht. Während Tarvos das Schwert aus dem Holz zu befreien versuchte, wirbelte Maglorix herum und rammte seine Klinge so tief in den Rücken seines Vetters, dass die Spitze in einem Blutstrahl aus der Brust drang. Tarvos brach zusammen. Sein Körper verkrampfte sich erst und erschlaffte dann. Der Gestank seiner sich entleerenden Gedärme erfüllte den Raum.