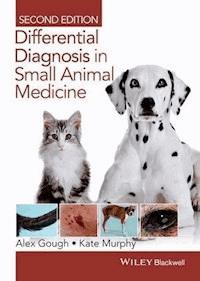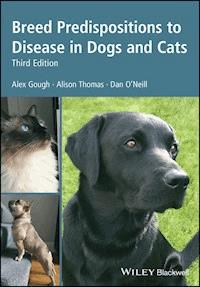9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Assassinen von Rom
- Sprache: Deutsch
Das Schicksal Roms ruht auf den Schultern eines Mannes Hervorragend, spannend und actionreich – perfekt für Fans des alten Roms Rom, 211 n. Chr.: Nachdem Caracalla seinen Bruder Geta ermordet und die Kaiserwürde an sich gerissen hat, ordnet er eine brutale Säuberungsaktion unter Getas Anhängern an. Währenddessen wird der Sohn von Caracallas Verbündetem Marcellus nach Ägypten entführt. Aber warum? Der kaiserliche Assassine Silus erhält den Auftrag, den Jungen aufzuspüren und zu retten, von dem man behauptet, er sei in Wahrheit Caracallas Kind. Während Rom unter der Last des Gemetzels zusammenbricht, reist Silus nach Alexandria. Dort muss er alles riskieren, um den Jungen, das Reich und letztendlich sein eigenes Leben zu retten ... »Düster und realistisch, spannend und rasant. Dies ist ein erstklassiger historischer Roman, und Gough ist eindeutig bereit, seinen Platz unter den führenden Autoren des Genres einzunehmen.« SJA Turney, Autor der ›Praetorian‹-Serie zu Band 1 der Reihe ›Die Assassinen von Rom‹ von Alex Gough Alle Bände der ›Die Assassinen von Rom‹-Reihe: Band 1: Das Schwert des Kaisers Band 2: Der Dolch des Kaisers Band 3: Die Axt des Kaisers
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 510
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über das Buch
Rom, 211 n. Chr.: Kaiser Caracalla ist umtriebig. Nachdem er seinen Bruder Geta ermordet und den Thron für sich beansprucht hat, ordnet er ein grausames Blutbad an: Alle, von denen er glaubt, dass sie nicht auf seiner Seite stehen, sollen sterben. Doch Silus, gefürchteter Assassine im Geheimbund der Arcani, hat es satt, wahllos zu morden. Da kommt es gerade recht, dass er und sein Freund Atius für eine neue Mission nach Alexandria geschickt werden – endlich können sie den stinkenden Gassen Roms entkommen. In Afrika sollen sie Avitus, den entführten Sohn von Caracallas Verbündetem Marcellus, ausfindig machen. Noch ahnen sie nichts von den Gefahren, die sie dort erwarten.
Von Alex Gough ist bei dtv außerdem erschienen:
Das Schwert des Kaisers
Der Dolch des Kaisers
Alex Gough
Die Axt des Kaisers
Die Assassinen von Rom Band III
Roman
Aus dem Englischen von Kristof Kurz
Erstes Kapitel
Dezember 211 n. Chr. Rom
Silus war grün und blau von den Prügeln, die er hatte einstecken müssen, und den Steinen, mit denen man ihn im Tumult beworfen hatte. Seine Arme schmerzten von einem Schwertkampf, und da er einmal durch die ganze Stadt gelaufen war, um den Kaiser zu retten, war er todmüde. »Scheiße«, sagte er, als er das Chaos vor sich erblickte.
Atius nickte. »Da kann ich dir nur zustimmen.«
Sie verließen die Castra praetoria, wo der nun allein regierende Kaiser Severus Antoninus, genannt Caracalla, von seinen treuesten Leibwächtern und Prätorianern bewacht wurde, und machten sich auf den Weg zu Silus’ Bleibe in der Subura. Dabei kamen sie nur langsam voran, denn in der Stadt herrschte Chaos. Vor wenigen Stunden noch hatten die beiden Brüder Caracalla und Geta über die Stadt geherrscht. Dann hatte Geta versucht, Caracalla zu ermorden, doch Letzterem war es mithilfe von Silus – der unmittelbar zuvor Gefangenschaft und Folter entkommen war – gelungen, seinen Bruder zu töten und den Thron an sich zu reißen.
Nun waren Silus und Atius auf dem Weg zurück zu Silus’ Wohnung, wo sie sich mit reichlich Wein und Schlaf von ihren Verletzungen und ihrer Erschöpfung erholen wollten.
Bedauerlicherweise wurde dieser einfache Plan durch eine Prätorianereinheit durchkreuzt, die sich auf dem Vicus Patricius herumtrieb, jener breiten Straße, die vom Viminal zur Subura führte. Die sonst mit ihren auf Hochglanz polierten Rüstungen und Lederstiefeln so makellos herausgeputzten Prätorianer waren von Caracalla persönlich von der Leine gelassen worden: Sie hatten seine ausdrückliche Erlaubnis, sich für ihre Treue zum Kaiser zu belohnen, indem sie Tempel und Schatzhäuser plünderten. Nun waren ihre Uniformen von Staub, Blut und Erbrochenem bedeckt, die Schließen ihrer Rüstungen und Gürtel waren gelockert oder standen offen. Sie lachten, jubelten und grölten lallend ihre Lieder.
Neben Caracallas Versprechen, ihren Sold und ihre Verpflegung aufzubessern, hatten sie noch einen weiteren Grund zum Feiern: Sie hatten soeben einen kleinen Tempel ausgeraubt. Nun umringte ein halbes Dutzend Soldaten in dem Innenhof davor einen Priester, der gerade alt genug war, um sich rasieren zu müssen. Blut und Rotz strömten aus seiner Nase. Er flehte die lachenden Soldaten auf Knien an, ihr Treiben zu beenden.
Auf den Stufen, die zur Portikus vor dem Tempeleingang führten, saßen ein Zenturio und sein Optio vor einer kleinen Truhe und zählten die Silberstücke darin mit der staunenden Freude kleiner Kinder, die in eine Tüte voller Honigsüßigkeiten blicken. Einige Soldaten hatten den Kopf in den Nacken gelegt und schütteten sich aus Silberkelchen Wein in die offenen, überquellenden Münder, sodass er ihnen am Kinn hinunterlief.
Silus und Atius sahen sich müde an.
»Das wird recht hässlich«, murmelte Silus.
»Dann passt du ja prima dazu«, sagte Atius.
»Na los.«
Sie näherten sich vorsichtig dem betrunkenen Soldatentrupp, wobei sie versuchten, so harmlos wie möglich zu wirken und die Hände von ihren Schwertern fernzuhalten. Als sie noch etwa ein halbes Dutzend Schritt entfernt waren, bemerkte sie ein Prätorianer und stand ruckartig und leicht schwankend auf. Er hatte einen dichten roten Haarschopf – seinen Helm hatte er wohl schon vor längerer Zeit abgelegt. »Was wollt ihr Pisser denn?«
»Keinen Ärger«, sagte Silus. »Wir wollen nur vorbei.«
»Diese Straße gehört uns«, sagte der Soldat.
»Diese Straße gehört dem Kaiser, dem Senat und dem Volk von Rom«, sagte Silus.
»Heute Nacht ist Rom unser«, sagte ein weiterer Soldat. Wein troff aus seinem buschigen schwarzen Bart. »Der Kaiser selbst hat uns erlaubt, alles zu nehmen, was wir wollen. Keiner darf uns daran hindern, hat er gesagt.«
»Ich war dabei«, erwiderte Silus. »Er hat gesagt, dass ihr nehmen sollt, was euch zusteht. Aber dabei hat er weder von irgendwelchen Straßen gesprochen, noch davon, Priester zu verprügeln.«
Der Rothaarige sah zu dem Priester hinüber, der just in diesem Augenblick einen heftigen Tritt in die Magengrube erhielt. Mit schützend vor den Kopf gehaltenen Händen krümmte er sich auf dem Boden zusammen, zog die Knie an und schluchzte leise. »Der wollte uns daran hindern, das Geld mitzunehmen«, sagte der Rotschopf. »Selber schuld.«
»Der kümmert uns nicht, wir wollen nur vorbei. Moment mal«, sagte Silus. »Ist das nicht der Tempel von Mefitis, der Göttin der üblen Ausdünstungen? Ich könnte mir vorstellen, dass die Strafe für die Schändung ihres Heiligtums und das Verprügeln ihres Priesters recht … unangenehm ausfallen dürfte.«
Die beiden Prätorianer sahen sich unsicher an. Nun waren auch ihre Kameraden auf die Neuankömmlinge aufmerksam geworden.
»Was trödelt ihr da rum? Schlagt ihnen die Schädel ein«, sagte der Zenturio, reichte die Truhe seinem Optio und kam mit wütender Miene zu ihnen herüber. »Ich würde euch beiden dringend raten, euch zu verpissen«, sagte er. Seine Stimme war heiser von Jubelgeschrei, gebrüllten Befehlen und dem allgegenwärtigen Rauch.
»Zenturio, wir haben einen ausgesprochen anstrengenden Tag hinter uns. Wir wollen einfach nur nach Hause.«
»Seid ihr taub? Verpisst euch!«
Silus seufzte. »Wir wollen euch nichts tun.«
Der Zenturio sah sie verblüfft an, dann stieß er ein bellendes Gelächter aus und deutete auf seine Soldaten. »Ich habe zwanzig Männer hier. Gut ausgebildete Kämpfer.«
»Kämpfer?«, fragte Atius. »Ich dachte, ihr seid Prätorianer.«
Der Zenturio zog knurrend das Schwert. Atius wollte dasselbe tun, doch Silus legte ihm beschwichtigend die Hand auf den Arm.
»Zenturio, Eure Männer sind betrunken. Sie feiern und sind nicht in der Verfassung, zu kämpfen. Ihr mögt in der Überzahl sein, aber das schreckt uns nicht ab. Wenn es hart auf hart kommt, werden viele von euch sterben, und Ihr seid der Erste. Also überlegt Euch noch einmal gründlich, was Ihr mit diesem Schwert zu tun gedenkt.«
Der Zenturio war es nicht gewohnt, dass jemand außer seinen Vorgesetzten so mit ihm sprach. Er sah sich ratlos nach seinem Optio um. Der hatte aufgehört, Münzen zu zählen, und beobachtete die Szene interessiert.
»Scheiße, wer seid ihr überhaupt?«, fragte der Zenturio.
Silus war sich selbstverständlich im Klaren darüber, dass er dies nicht einfach so vor aller Welt verkünden durfte, doch er hatte die Nase gestrichen voll. Voll von der Geheimniskrämerei, von diesem Streit, von diesem langen Tag des Kämpfens und Tötens. Er trat einen Schritt auf den Zenturio zu, drückte dessen Schwertklinge mit dem Handrücken beiseite und beugte sich vor. »Zenturio, Ihr habt doch sicher schon von den Arcani gehört.«
Der Mann erbleichte und machte große Augen. »Ihr seid …?«
»Befehlt Euren Männern, uns Platz zu machen. Sofort.«
Der Zenturio schluckte und nickte. »Lasst sie durch«, rief er.
Die Soldaten bildeten eine Gasse, durch die Silus und Atius hocherhobenen Hauptes marschierten. Die beiden waren zu müde, um Angst zu haben. Die Prätorianer funkelten sie böse an und fluchten leise, doch keiner wagte es, sich mit den beiden Arcani anzulegen.
Kurz darauf setzten die Prätorianer das Plündern und Verwüsten fort, während Silus und Atius weiter durch ungewohnt leere Straßen gingen, vorbei an verschlossenen und verbarrikadierten Häusern, an verlassenen, umgekippten und manchmal sogar brennenden Fuhrwerken, deren Rauch je nach Ladung unterschiedlich roch – nach Getreide, Gemüse, Kräutern oder Tuch. Einige wenige verschreckte Bürger liefen geduckt und mit ängstlichem Blick durch die Straßen, um sich so schnell wie möglich in Sicherheit zu bringen.
Silus fragte sich, wie groß der Schaden an dieser prachtvollen Stadt wohl sein würde. Feuer stellte eine ständige Gefahr dar, auch wenn es jetzt weitaus mehr Steinbauten gab als noch zu früheren Zeiten. Rom war in der Vergangenheit durch Fluten, Brände und Belagerungen weitaus schlimmer in Mitleidenschaft gezogen worden und hatte stets überlebt. Nichtsdestotrotz würde in dieser Nacht unsägliches Leid geschehen.
Sie umrundeten eine Ecke und wären beinahe in einen Legionär der städtischen Kohorten gelaufen, der an einer Wand lehnte und zwei Kameraden dabei zusah, wie sie eine Frau drangsalierten. Ihre dicke Augenschminke war verlaufen und hatte dunkle Tränenspuren auf ihren Wangen hinterlassen. Die beiden Soldaten ließen sie auf allen vieren herumlaufen und dabei wie eine Wölfin heulen. Einer piekte ihr mit der Schwertspitze ins Hinterteil. »Und jetzt knurren, kleine Lupa«, sagte er. Die bemitleidenswerte Frau fletschte die Zähne und versuchte sich an einem Knurren, das jedoch bald zu einem Schluchzen wurde. Die Männer brüllten vor Lachen.
Der an der Wand lehnende Soldat legte Silus eine Hand auf die Schulter. »Witzig, oder?«
»Finde ich nicht«, sagte Silus.
»Ach so, ihr seid nicht von hier«, sagte der Soldat. »Passt auf, ich erklär’s euch. Bei uns heißt ›Lupa‹ nicht nur Wölfin, sondern auch Hure. Deshalb muss die Hure hier so tun, als wäre sie eine Wölfin.«
»Ein geradezu genialer Einfall«, sagte Silus mit ernster Miene. »Findest du nicht auch, Atius?«
»Ganz großartig. Könnte von diesem Kerl sein, von dem wir letztens diese Komödie gesehen haben … Pluto?«
»Plautus«, sagte Silus. »Ja, der wäre stolz, wenn ihm so etwas einfallen würde.«
Der Legionär verengte die Augen zu Schlitzen und sah sie misstrauisch an. »Wollt ihr mich verarschen?«
Silus roch den starken Wein in seinem Atem. Offenbar hatte der Mann die Ironie ihrer Bemerkungen tatsächlich nicht so ganz verstanden.
»Das reicht, würde ich sagen. Lasst sie gehen«, befahl Silus.
Jetzt wurde dem Soldaten der städtischen Kohorten langsam klar, dass die beiden das Ganze nicht so lustig fanden wie er selbst. Er legte die Hand auf den Schwertknauf. »Was geht euch das hier überhaupt an?«
»Gar nichts. Aber das heißt nicht, dass wir einfach so daran vorbeigehen müssen, oder?«
»Silus, er hat ja recht«, sagte Atius. »Das geht uns nichts an. Willst du die ganze Nacht durch die Straßen ziehen und für jede Frau in Bedrängnis den Retter in der Not spielen?«
»Ja, hör auf deinen Kumpel«, sagte der Legionär. »Lass uns unseren Spaß und verpiss dich. Das ist die letzte Warnung.«
Die Frau stieß einen Schrei aus. Silus blickte über die Schulter des Soldaten und sah, dass sie sich zu einer Kugel zusammengekrümmt hatte, während sie von einem Legionär – einem kleinen Mann mit breiten Schultern und schwarzen Locken – mit heftigen Tritten traktiert wurde.
Silus rammte seine Stirn gegen die Nase des Mannes vor sich. Knorpel knackte, und sofort strömte Blut über das Gesicht und die hübsche Uniform des zurücktaumelnden Soldaten. Silus ließ einen Aufwärtshaken gegen seinen Kiefer folgen. Der Soldat verdrehte die Augen, dann gaben seine Beine unter ihm nach und er ging zu Boden.
Die beiden anderen Männer blickten auf. Ganz offensichtlich nahmen sie Silus und Atius erst jetzt so richtig wahr. Sie ließen von der zitternden, im Staub der Straße liegenden Frau ab und kamen auf sie zu. »Was habt ihr denn mit Sulinus angestellt?«, fragte einer mit ehrlichem Staunen.
»Die haben ihn fertiggemacht«, sagte der Kleine, der die Frau getreten hatte.
»Der gehört mir«, sagte Silus und deutete auf ihn.
Atius seufzte. »Versuchen wir zumindest, sie nicht umzubringen?«
»Da kann ich nichts versprechen.«
»Was habt ihr da zu flüstern?«, wollte der größere der beiden Soldaten wissen. »Warum verpisst ihr euch nicht einfach und holt euch gegenseitig einen runter, bevor ich euch die Schwänze abschneide?«
»Na gut, vielleicht wird es doch ganz lustig«, sagte Atius.
Die Wachen sahen sich unsicher an. Sie hatten ihre Waffen gezogen, aber sie waren auch betrunken und wussten ohne Befehlshaber nicht so recht, was sie tun sollten.
Die beiden Arcani nahmen ihnen die Entscheidung ab. Gleichzeitig traten sie vor und stellten sich ihrem jeweiligen Gegner. Silus wich einem Hieb gegen seine Körpermitte mühelos aus. Die Klinge zischte harmlos durch die Luft. Der schwarzhaarige Legionär griff mit wutverzerrtem Gesicht ein weiteres Mal an. Wieder hieb er ins Leere, als der grinsende Silus zur Seite sprang. Das tat richtig gut. Nach so viel Verrat, Heimtücke, Folter und Mord war ein ehrlicher Kampf Mann gegen Mann genau das Richtige.
Silus tänzelte um seinen Gegner herum, blickte ihm in die Augen und sah so dessen nächste Angriffe voraus, vor denen er sich spielend leicht wegduckte, zurückzuckte und zur Seite wich. Der Soldat wurde immer wütender, die Hiebe ungestümer und ungenauer, und bald keuchte und atmete er immer schneller. Silus musste nur auf den richtigen Augenblick warten.
Der kam schneller als gedacht. Der Soldat war nicht nur betrunken, sondern auch in erbärmlich schlechter körperlicher Verfassung. Ein weiterer kräftiger Hieb ging meilenweit daneben. Die Schwertspitze senkte sich, und der Mann schien kaum noch Kraft zu haben, sie wieder zu heben. Schnell machte Silus einen Schritt auf seinen Gegner zu, packte das Handgelenk seines Waffenarms mit der Linken und schlug ihm gleichzeitig mit dem rechten Unterarm ins Gesicht. Der Mann taumelte zurück. Silus verdrehte sein Handgelenk, bis der Soldat das Schwert vor Schmerz fallen ließ.
Der Legionär stürzte sich auf ihn, um ihn in den Schwitzkasten zu nehmen, doch Silus duckte sich unter seinen Armen hindurch und schlug ihm zweimal in den Magen. Der Mann krümmte sich zusammen. Silus packte ihn bei den Haaren, riss seinen Kopf nach unten und das eigene Knie gleichzeitig in die Höhe. Der Zusammenprall war so heftig, dass sein eigener Körper erbebte. Er schleuderte den Soldaten von sich, der reglos auf dem Boden liegen blieb.
Silus sah sich um. Atius hatte seinen Fuß auf die Brust des anderen Legionärs gestellt und sein Schwert auf den Unterleib des zitternden Mannes gerichtet. »Was dauert denn da so lange?«, fragte er.
Silus zuckte mit den Schultern. »Ein Festessen muss man genießen, oder nicht?«
»Die beiden würde ich nicht als Festessen bezeichnen. Eher als verdorbene Fleischpasteten.« Atius schaute auf den Mann unter sich herab. »Wie war das jetzt mit dem Schwanzabschneiden?«
»Bitte nicht«, keuchte der Legionär. »Das sollte doch nur ein Spaß sein. Der Kaiser persönlich hat es uns erlaubt.«
Silus schüttelte den Kopf. Offenbar hatten alle Prätorianer und Soldaten der städtischen Kohorten Caracallas Befehl, sich ihre Belohnung direkt aus den Schatzhäusern und Tempeln zu holen, als Freibrief für Raub, Belästigung, Vergewaltigung und Mord aufgefasst. Er wandte sich der Frau zu, die an den Straßenrand gekrochen war und nun dort saß, das Kinn auf die Knie gestützt und die Arme um die Schienbeine geschlungen.
Silus hielt ihr die Hand hin. Sie sah mit großen, angsterfüllten Augen zu ihm auf. »Was habt ihr mit mir vor?«, fragte sie im Flüsterton.
»Überhaupt nichts«, sagte Silus. »Wir bringen dich höchstens nach Hause. Wo wohnst du?«
»Im Lupanar der Venus.«
»Und willst du auch wieder dahin zurück?«
»Herr, ich bin eine Sklavin. Wo sollte ich denn sonst hin?«
Silus nickte. »Na schön, dann wollen wir dich zumindest heil nach Hause bringen.«
Die Frau zögerte, dann nahm sie seine Hand und ließ sich aufhelfen. Als sie das Gewicht auf ein Bein verlagerte, zuckte sie zusammen. Silus hielt ihr den Arm hin, auf den sie sich dankbar stützte. »Vielen Dank, Herr. Es ist nicht weit.«
»Was machen wir mit dem hier?«, fragte Atius. »Soll ich ihm den Schwanz abschneiden?«
»Bitte nicht!«, schrie der Soldat.
»Lass ihn laufen«, sagte Silus. »Diese Idioten tun nichts anderes als Tausende anderer Soldaten heute Nacht auch. Es ist nicht an uns, sie zu bestrafen.«
Atius wartete wenigstens so lange, bis der Mann wieder zu zittern anfing, dann nahm er den Fuß von seiner Brust. »Also gut, bringen wir die Frau in Sicherheit, und dann nichts wie ab nach Hause.«
Silus nickte. Sie ließen der Frau den Vortritt, und da das Lupanar der Venus nur zwei Straßen entfernt war, schafften sie es ohne weitere Zwischenfälle dorthin. Ein Fresko der nackten Göttin unter einem großen Phallus zierte die Fassade des kleinen Bordells. Silus hämmerte an die verschlossene Tür. Da er weder eine Antwort erhielt noch Geräusche aus dem Haus hörte, klopfte er noch lauter. »Aufmachen!«
Endlich waren Schritte zu hören. »Wir haben geschlossen«, sagte eine heisere, zittrige Greisenstimme von der anderen Seite. »Verschwindet.«
»Wir bringen dir eins deiner Mädchen. Öffne wenigstens ihr.«
Schweigen. »Sind Prätorianer oder Legionäre der städtischen Kohorten in der Nähe?«, fragte der Alte schließlich.
»Nein«, sagte Silus. »Aber ich bezweifle, dass das noch viel länger der Fall sein wird.«
Wieder Schweigen. »Woher soll ich wissen, dass das keine Falle ist? Vielleicht wollt ihr mir ja mein Geld und meine Frauen wegnehmen.«
Silus schüttelte den Kopf. Dann wandte er sich zu der Frau um. »Wie heißt du?«
»Agathina, Herr.«
»Sag ihm, dass hier keine Soldaten sind und du in Sicherheit bist.«
»Herr? Ich bin es, Agathina. Der Mann sagt die Wahrheit. Er hat mich vor den Soldaten gerettet.«
Nach einem weiteren Augenblick des Schweigens hörten sie, wie der Riegel von der Tür genommen wurde und sich ein schwerer Schlüssel im Schloss drehte. Dann öffnete sich die Tür einen Spalt weit, und ein alter Mann mit spitzer Nase spähte vorsichtig heraus. Nun wurde es Silus zu dumm – er drückte die Tür auf, sodass der dürre Alte zurücktaumelte. Silus, Atius und Agathina betraten das Bordell, dann legte Atius den Riegel wieder vor.
»Agathina!«, sagte der Alte. »Wo warst du denn?«
»Du hast mich zu diesem Kaufmann geschickt … Onesiphorus heißt er. Weißt du das nicht mehr?«
»Ich sollte dich nach Strich und Faden versohlen lassen, weil du dich so spät noch draußen herumtreibst und dein Leben und mein Eigentum in Gefahr bringst.«
»Ich glaube, für heute hat sie genug Prügel abbekommen«, sagte Silus.
Der Mann sah ihn mit zusammengekniffenen Augen an, dann setzte er ein schmieriges Lächeln auf. »Aber selbstverständlich, natürlich. Ich bin Karpos, der Besitzer dieses Lokals und der hier arbeitenden Frauen. Und Ihr seid …?«
»Silus. Und das ist Atius.«
»Vielen Dank, dass Ihr Agathina sicher nach Hause gebracht habt. Leider kann ich es Euch nicht mit klingender Münze vergelten, aber wenn ich das nächste Mal im Tempel eine Opfergabe darbringe, werde ich für Euch beten. Ich wünsche Euch einen sicheren Nachhauseweg, kommt wohlbehalten durch diese finstere Nacht.« Er wollte den Riegel wieder entfernen.
Atius legte eine Hand auf seinen Arm. »Soll das ein Scherz sein?«
Karpos sah Atius mit einer Miene ehrlicher Verwirrung an. »Herr, ich kann Euch nicht ganz folgen.«
»Wir haben deine Sklavin gerettet und uns dabei selbst einer nicht unbeträchtlichen Gefahr ausgesetzt. Und jetzt bietest du uns zum Dank dafür, dass wir dir dein Eigentum zurückgebracht haben, noch nicht einmal einen Becher Wein an?«
Karpos zögerte. Einerseits wollte er diese beiden gefährlich aussehenden Burschen so schnell wie möglich loswerden, sie andererseits jedoch nicht verärgern. »Aber sicher. Ich dachte nur, dass Ihr es in einer solchen Nacht bestimmt eilig habt, in Euer Heim und zu Eurer Familie zurückzukehren. Selbstverständlich dürft Ihr so lange hierbleiben, wie Ihr wollt.«
»Großartig.« Atius marschierte in die Gaststube, setzte sich auf ein schmuddeliges Sofa und legte die Füße hoch. »Und bitte ein ordentliches Glas.«
Silus setzte sich ebenfalls. Sosehr er sich auch nach seinem Bett sehnte – es war schlauer, erst einmal abzuwarten, bis das Schlimmste vorüber war. »Wir bleiben heute Nacht hier«, entschied er.
»Wer hätte das gedacht, Silus verbringt die Nacht in einem Bordell«, bemerkte Atius staunend.
»Es ist eben das Vernünftigste.«
»Genau, und da wir schon mal hier sind, können wir unseren Aufenthalt auch genießen.«
»Herr«, sagte Karpos, »ich habe kein Bett frei. Meine Huren schlafen bereits.«
»Die lassen sich doch aufwecken«, sagte Atius.
»Er wird auch dafür bezahlen«, sagte Silus. »Richtig?«
»Wenn es sein muss«, knurrte Atius. »Aber der Wein geht aufs Haus, oder?«
Karpos dachte über diesen Vorschlag nach, dann nickte er. »Soll ich eine für Euch aufwecken?«
»Lasst mich doch erst einmal zu Atem kommen, ich bin doch kein Gott! Wo bleibt der Wein?«
Karpos schenkte ihnen starken, sauren Wein ein. Silus setzte sich ebenfalls auf ein Sofa und nahm einen großen Schluck aus seinem Becher. Als er sich zurücklehnte, spürte er plötzlich, dass er die Augen kaum noch offen halten konnte. Er stellte den Becher auf dem Boden ab, drehte sich auf die Seite und schlief sofort ein.
Als sich Silus und Atius am nächsten Morgen auf den Weg machten, hing der Gestank von Asche und Furcht über der Stadt, und auf den Straßen herrschten Ungewissheit und Angst. Die Prätorianer waren wieder in ihre Kasernen zurückgekehrt – bis auf einige wenige, die vor den Geschäften oder im Dreck der Seitengassen ihren Rausch ausschliefen oder sich mit den falschen Bürgern angelegt und eine ordentliche Abreibung kassiert hatten. Allmählich kehrte die Stadt so gut es ging zum Alltag zurück. Sie kamen an einem wütenden Schuster vorbei, der Bretter an die aufgebrochene Tür seines Ladens nagelte, an einem Kind, das heulend die blutigen Überreste eines kleinen Hundes an sich drückte, einem Bäcker, der zerschlagene Töpferwaren und Tische beiseiteräumte, um wieder Brot für seine wartenden Kunden backen zu können. Die Anspannung der Menschen war deutlich zu spüren – sie fragten sich, ob das Schlimmste vorbei war oder ihnen erst noch bevorstand. Silus jedenfalls hatte keine Antwort auf diese Frage.
Als sie Oclatinius’ Amtsstube erreichten, hatte eine tiefe Niedergeschlagenheit von Silus Besitz ergriffen. Nach einem Jahr der Angst und Ungewissheit hatte die Rivalität zwischen Caracalla und Geta mit dem Tod des Letzteren geendet. Nun musste Rom doch endlich zur Ruhe kommen – aber weshalb wurde er dann das dumpfe Gefühl nicht los, dass alles noch schlimmer werden würde?
Offenbar stand ihnen ihr Unbehagen ins Gesicht geschrieben: Oclatinius bemerkte die gedrückte Stimmung sofort. Er selbst sah jedoch auch nicht besonders glücklich aus, wie Silus bemerkte.
»Kopf hoch, Männer. Das ist nicht das Ende der Welt.«
»Das sieht Geta sicher anders«, sagte Atius.
»Atius! Wann lernst du endlich, dein blödes Maul zu halten? Du solltest den Göttern danken, dass du für mich arbeitest, sonst würde ich dich für so eine Bemerkung auf der Stelle als Verräter hinrichten lassen.«
»Herr, ich wollte nur die Stimmung etwas auflockern«, sagte Atius.
»Wie wär’s, wenn du die Klappe hältst und zuhörst?«
Atius spitzte die Lippen, nickte aber schweigend.
Oclatinius schüttelte schicksalsergeben den Kopf. »Ich habe eine Aufgabe für euch. Die wird euch gefallen.«
Silus lauschte aufmerksam, konnte Atius jedoch ansehen, dass ihm die Bemerkung, der Auftrag hätte dann ja wohl mit Wein und Huren zu tun, auf der Zunge lag. Glücklicherweise konnte er sie sich verkneifen.
»Wie ihr euch sicher denken könnt, muss der Kaiser zuerst seine Position festigen. Ein Herrscherwechsel ist immer ein heikler Zeitpunkt, besonders wenn er, wie in diesem Fall, durch Gewalt zustande kam. Denkt an die vier anderen Thronanwärter, die sich damals mit Septimius Severus um die Kaiserwürde gestritten haben. Pertinax und Didius Julianus starben noch in Severus’ erstem Regierungsjahr, Niger im zweiten und Albinus im vierten. Oder, um ein Beispiel aus der ferneren Vergangenheit zu bemühen: Nach Neros Tod …«
»Wir haben schon verstanden, Herr.« Silus fühlte sich wie erschlagen, er war todmüde und gewiss nicht in der Stimmung für eine Geschichtsstunde.
Als ihm Silus ins Wort fiel, verfinsterte sich Oclatinius’ Miene. Er setzte sich an den Schreibtisch und blickte die beiden Arcani nacheinander an, wobei er das mittlerweile entstandene unbehagliche Schweigen absichtlich in die Länge zog. »Irgendwelche Beschwerden von eurer Seite?«, fragte er.
»Beschwerden, Herr?«, fragte Silus. »Nein.«
Atius schüttelte den Kopf.
»Muss ich euch an euren Schwur erinnern?«
»Nein, Herr.«
»Ich glaube doch. Ihr habt dem Kaiser und den Arcani die Treue geschworen. Ich bin der Kommandant der Arcani und diene dem Kaiser. Ist daran etwas unklar?«
»Nein, Herr.«
»Gaius Sergius Silus, Lucius Atius: Was ist euer Wort wert?«
Die beiden Arcani sahen ihn empört an.
»Herr«, protestierte Atius. »Ich habe Euch keinen Grund gegeben, an meiner Treue zu zweifeln.«
»Silus, was ist mit dir? Du hast einen Befehl missachtet und eine Kameradin getötet. Hältst du dich nur dann an deinen Eid, wenn es dir in den Kram passt?«
Silus errötete und ließ den Kopf hängen. Vergebens suchte er nach den richtigen Worten, um seine Taten zu rechtfertigen. »Der Kaiser hat mir vergeben«, stammelte er schließlich.
Oclatinius sprang auf und richtete den Finger auf Silus. »Weil du ihn erpresst hast!«, brüllte er.
»Ich habe ihm das Leben gerettet!«, schrie Silus zurück.
Oclatinius stützte sich schwer atmend mit den Händen auf dem Tisch auf. Er schluckte. »Ja. Ja, das ist wahr. Und deshalb wird dir in den kommenden Tagen und Wochen nichts geschehen, während andere, deren Treue fragwürdiger ist, Caracallas Rachefeldzug zum Opfer fallen werden.«
»Rachefeldzug?«
»Offenbar habt ihr das Ganze doch nicht so gut verstanden, wie ihr vorgebt. Rom wird von einem Kaiser regiert, der vor Kurzem seinen Vater verloren und soeben seinen eigenen Bruder getötet hat, dessen Verhältnis zu seiner Schwiegermutter gelinde gesagt kompliziert ist, der seine eigene Frau ermorden ließ und nun um den Thron und sein Leben fürchten muss. Das Blut wird in Strömen fließen, und ihr werdet viel davon vergießen. Ich frage euch daher noch einmal: Muss ich euch an euren Eid erinnern?«
»Nein, Herr«, murmelten Silus und Atius gleichzeitig.
»Lauter!«
»Nein, Herr!«
Oclatinius setzte sich wieder. »Na schön, kommen wir zur Sache. Wie gesagt, ich habe eine Aufgabe für euch. Silus, da du so großen Gefallen an Rache und Vergeltung hast, wirst du Gaius Septimius Severus Aper, einem Vetter des Kaisers, einen Besuch abstatten und ihn töten. Aper war aufseiten Getas und arbeitete gegen Antoninus. Er unterhielt ein Netz aus Spionen, zu denen übrigens auch Bek gehörte.«
»Nur ihn, Herr? Nicht auch seine Frauen und Kinder?«
»Nur ihn«, bestätigte Oclatinius.
Silus nickte erleichtert. »Ihr habt von einem Netz gesprochen. Wer gehörte noch zu Apers Spionen?«
Oclatinius sah ihn finster an. »Darüber musst du dir im Augenblick keine Gedanken machen. Vergiss es einfach.«
Oclatinius hatte sich verplappert, was ihm sichtlich unangenehm war. Hatte sich der scheinbar so unfehlbare Meisterspion etwa einen Schnitzer geleistet? Immerhin war er bereits im Greisenalter, und es war kaum einen Tag her, dass man ihn eingesperrt, gefoltert und verwundet hatte. Selbst ein Oclatinius war nicht vollkommen. Anstatt die Bemerkung zu vergessen, prägte Silus sie sich zur etwaigen späteren Verwendung gut ein.
»Du darfst Rache an dem Mann üben, der Bek befohlen hat, uns einzusperren und zu foltern. Freust du dich denn nicht?«
»Ich bin ein Arcanus, Herr. Ich befolge meine Befehle.«
Oclatinius seufzte. »Na schön. Solange du den Auftrag erledigst, kannst du von mir aus schmollen, wie du willst.«
»Wie lauten Eure Befehle, Herr?«, fragte ein kleiner, schlanker, aber auch sehniger Mann mit östlichem Akzent. Seine Haut war hellbraun wie eine noch nicht ganz reife Olive.
Aper stopfte goldene Teller und Becher in einen großen Leinensack. Seine Sklaven rannten in der Domus hin und her, rafften Wandteppiche und Statuen zusammen und luden die wertvollsten und am leichtesten zu tragenden Möbelstücke auf vor dem Haus wartende Fuhrwerke. Ein Sklave räumte hastig den Hausaltar ab. Dabei ließ er einen der Lares fallen – die bronzene Götterstatue landete auf dem Boden, dabei brach ihr ausgestreckter Arm ab, in dessen Hand sie eine Trankopferschale hielt.
»Du Tölpel«, rief Aper. »Willst du den Fluch der Götter über uns bringen?« Er stellte den Leinensack ab, lief auf den entsetzten Sklaven zu und riss ihm die beschädigte Statue aus der Hand. »Du hast Glück, dass wir es so eilig haben, sonst würde ich dir für dieses Missgeschick die Haut vom Rücken peitschen lassen. Geh mir aus den Augen.«
Der Sklave entfernte sich rasch. Aper versuchte vergeblich, den Arm wieder an der Statue zu befestigen. Das konnte wohl nur ein Schmied an einer Esse. »Ihr Hausgötter, ich werde euch reichlich Opfergaben darbringen, um für diese Beleidigung Buße zu tun. Nur … ist es jetzt gerade ein ganz schlechter Zeitpunkt. Vergebt mir.«
»Eure Befehle, Herr«, sagte der Mann, der neben ihm stand, in einem etwas dringlicheren Ton. »Was soll ich tun?«
Aper wirbelte zu ihm herum. »Renn um dein Leben, Aziz«, zischte er.
Aziz trat einen Schritt zurück. »Herr, wir können Caracalla nicht nach Belieben schalten und walten lassen. Er wird die Götter des Ostens nicht ehren und die Syrer verfolgen lassen, die seinen Bruder unterstützt haben. Nur weil wir auf das falsche Pferd gesetzt haben, heißt das doch nicht, dass wir …«
»Das Spiel ist aus, du Narr. Verschwinde, solange du noch kannst.«
»Aber das geht nicht. Die anderen …«
»Genug! Einen besseren Rat kann ich dir nicht geben. Nimm die Beine in die Hand oder warte hier darauf, bis Oclatinius’ Männer dich finden.«
»Aber außer Euch und Festus weiß doch niemand von mir.«
»Dann solltest du hoffen, dass sie weder Festus noch mich schnappen und unter Folter dazu zwingen, die Namen derer preiszugeben, die für Geta gearbeitet haben. Oclatinius ist in dieser Hinsicht sehr erfindungsreich, ich kann mir also nicht vorstellen, dass wir tapfer genug sein werden, diese Namen mit ins Grab zu nehmen.«
Aziz überlegte und beobachtete dabei die hektische Aktivität um sich herum. Die Domus erinnerte ihn an einen Ameisenhaufen in Aufruhr. Schließlich gelangte er zu einer Entscheidung. »Es ist noch nicht vorbei. Nur weil Ihr nicht den Mut habt, weiter für unsere Sache einzutreten, muss das noch längst nicht für alle gelten.«
Aper drehte sich zu ihm um. »Mut? Hüte deine Zunge. Und sprich mich gefälligst mit ›Herr‹ an.«
»Nein. Ihr verdient es nicht länger, dass man Euch mit Hochachtung begegnet. Ich werde Festus aufsuchen und weiterkämpfen.«
»Dann tu, was du nicht lassen kannst«, entgegnete Aper. »Aber geh mir aus dem Weg. Ich habe nämlich vor, diese verdammte Stadt zu verlassen und meine Haut zu retten.«
Aziz schnaubte verächtlich. »Ich sollte Euch auf der Stelle mit meinem Schwert durchbohren, aber ich gehe davon aus, dass mir Oclatinius diese Arbeit schon sehr bald abnehmen wird. Lebt wohl.«
Aziz drehte sich um, marschierte aus der Domus und stieß dabei einen Sklaven zur Seite, der ihm im Weg stand. Aper sah ihm einen Augenblick lang hinterher, dann schüttelte er den Kopf und machte sich wieder daran, seine Reichtümer in den Sack zu stopfen.
Silus und Atius erreichten die Domus von Caracallas Vetter ohne Zwischenfälle. In Gaius Septimius Severus Apers Haus nahm man zunächst keine Notiz von ihnen: Die Sklaven waren zu sehr damit beschäftigt, die Anweisungen zu befolgen, die ihnen der Hausverwalter zubrüllte, wenn er nicht gerade ihre Langsamkeit verfluchte.
Ohne das Schwert zu ziehen, gingen die beiden Arcani durch das Vestibulum ins Atrium und beobachteten kopfschüttelnd das dort herrschende Durcheinander. Allmählich wurde man auf sie aufmerksam. Die Sklaven hielten inne und starrten sie an. Der Hausverwalter, der mit dem Rücken zu ihnen dastand, brüllte weiter Befehle, bis Silus ihm auf die Schulter tippte. Der Mann drehte sich mit einem Fluch auf den Lippen um, erblickte die beiden bewaffneten Attentäter und verstummte augenblicklich. Er trat einen Schritt zurück und hob flehentlich die Hände. »Bitte verschont mich. Ich tue alles, was Ihr verlangt.«
»Wo ist dein Herr?«
»Im Peristyl«, sagte der Hausverwalter mit zitternder Stimme und deutete hinter sich, ohne den Blick von Silus’ Schwert zu nehmen.
»Besten Dank. Mach ruhig weiter, auch wenn das hier reine Zeitverschwendung ist. Du wirst schon bald einem neuen Herrn dienen.«
Der Hausverwalter erbleichte und entfernte sich mit gesenktem Haupt.
Silus und Atius gingen weiter in einen von einem Säulengang umschlossenen, geschmackvoll angelegten und liebevoll gepflegten Garten. Weitere Türen führten in verschiedene Privatgemächer, direkt gegenüber war eine Treppe zu den Räumen im ersten Stock. Zwei Sklaven versuchten gerade, eine große, halbnackte Marmorvenus von ihrem Sockel zu heben. Ein hochgewachsener Mann in einem roten, von einer Goldbrosche zusammengehaltenen Umhang rief ihnen ungeduldig Anweisungen zu. »Sieh zu, dass du sie festhältst. Und jetzt kippen. Kippen!«
»Gaius Septimius Severus Aper«, sagte Silus.
Aper drehte sich um und starrte die beiden Eindringlinge an. Die Sklaven hielten inne, obwohl die Statue nur noch mit der Kante auf dem Sockel stand und ihr Gewicht auf einem Sklaven ruhte, der alle Mühe hatte, sie nicht fallen zu lassen. Einen Augenblick lang sah es so aus, als wollte Aper etwas sagen, doch dann drehte er sich um und rannte mit der Geschwindigkeit einer von einer Hundemeute verfolgten Katze davon.
Fluchend nahm Silus die Verfolgung auf, wobei er den Sklaven, der die Statue hielt, mit dem Ellenbogen aus dem Weg stieß. Atius wollte ebenfalls losrennen, als die Venus vor ihm auf den gepflasterten Boden fiel und zersprang. Er machte einen Satz zurück, um nicht von den Marmorbrocken getroffen zu werden.
»Pass doch auf!«, rief er seinem Freund hinterher, während er weiterrannte.
Aper hielt auf die Treppe am Ende des Peristyls zu. Er erklomm sie, wobei er mit jedem Schritt drei Stufen auf einmal nahm. Dabei riss er sich den Umhang von den Schultern und schleuderte ihn hinter sich. Silus war ihm so dicht auf den Fersen, dass er direkt hineinrannte. Der Stoff wickelte sich um sein Gesicht, er stolperte, fiel vornüber und stieß mit den Knien schmerzhaft gegen eine Stufenkante. Er befreite sich von dem Umhang, stand auf und lief weiter.
Aper hatte das Ende der Treppe erreicht und rannte eine offene Galerie entlang, die sich über dem Garten erhob. »Aper! Bleibt stehen!«, rief ihm Silus hinterher. »Es hat keinen Zweck. Ihr sitzt in der Falle.«
»Schert euch zum Hades, Meuchelmörder.« Aper riss eine kleine Tür am Ende der Galerie auf und lief hindurch. Silus spähte in den kleinen, im Vergleich zum lichtdurchfluteten Garten dunklen Raum. Im schwachen Lichtschein, der durch ein Fenster fiel, war kaum etwas zu erkennen. Er zog das Schwert, trat vorsichtig ein und wartete blinzelnd, bis sich seine Augen an die Finsternis gewöhnt hatten. Nun hatte auch Atius zu ihm aufgeholt. Silus bedeutete ihm mit erhobener Hand, vor der Tür zu warten. Er ging noch einen Schritt weiter hinein, dann machte er einen Satz und knallte die Tür zu, damit er sehen konnte, ob sich Aper dahinter versteckt hielt.
Der jedoch sprang mit Gebrüll hinter einem Schrank hervor, wobei er eine Bronzestatue über seinem Kopf schwang. Silus, der sich gerade umgedreht hatte, riss einen Arm in die Höhe, um den Schlag abzuwehren, der dadurch seinen Schädel verfehlte, aber seine Schulter traf. Er schrie vor Schmerz auf, während Aper zum Fenster stürzte. Dort drehte er sich zu Silus um, wobei seine Silhouette das hereinfallende Sonnenlicht verdeckte. »Verflucht seist du und der schändliche Kaiser, dem du dienst.« Mit einem Schrei sprang er durch die Fensteröffnung.
Silus rannte zum Fenster und blickte hinunter. Atius stieß die Tür auf und kam mit gezogenem Schwert hereingestürmt. Als er begriff, dass keine unmittelbare Gefahr drohte, stellte er sich zu Silus und schaute ebenfalls auf die Straße hinab.
»Oh«, sagte er. »So war das sicher nicht geplant.«
Aper war nicht aus dem Fenster gesprungen, um seinem Leben ein Ende zu setzen. Er hatte fliehen wollen, und obwohl ein Sturz aus dieser Höhe keinesfalls tödlich war, hatte es das Schicksal nicht gut mit ihm und seinen alten Knochen gemeint. Nun lag er auf dem schmutzigen Straßenpflaster und hielt sich das Bein. Die untere Hälfte seines Unterschenkels stand in einem unnatürlichen Winkel ab, ein spitzes weißes Knochenstück ragte aus der zerrissenen, blutigen Haut.
Silus seufzte. »Du behältst ihn im Auge. Ich gehe runter.« Er verließ den Raum, lief die Treppe wieder hinunter und mit schnellen Schritten durch das Haus. Die Sklaven hatten die Arbeit inzwischen gänzlich eingestellt und beobachteten ihn ängstlich und unsicher. Als Silus das Atrium durchquerte, stürzte eine Frau auf ihn zu. Er hob das Schwert, um sich zur Wehr zu setzen, doch sie warf sich auf die Knie und ergriff den Saum seiner Tunika. »Herr, ich bitte Euch, verschont ihn. Er ist ein guter Mensch.«
Silus riss sich los, woraufhin sich die völlig in Tränen aufgelöste Frau an sein Bein klammerte. Silus bückte sich und löste behutsam ihren Griff. Sie folgte ihm, als er das Haus verließ und auf die Rückseite der Domus ging, wo sich Aper in der Hoffnung, sich irgendwie in Sicherheit zu bringen, über den Boden schleppte.
»Gaius«, rief die Frau, sobald sie ihn erblickte. Sie lief zu ihm und legte die Arme um ihn. Ihre Tränen fielen auf ihn herab.
Aper sah seiner Frau in die Augen, dann ergab er sich in sein Schicksal. »Es ist vorbei, Liebste. Verzeih mir.« Er blickte zu Silus auf. »Bitte verschont sie.«
»Mein Befehl bezieht sich nur auf Euch«, sagte Silus. »Ansonsten wird niemand zu Schaden kommen. Nicht durch meine Hand.«
Aper nickte. »Wie leicht hätte sich das Blatt wenden können. Dann säße Geta nun auf dem Thron und ich wäre Prätorianerpräfekt. Dass es nicht so gekommen ist, habe ich wohl dir zu verdanken.«
»Es wird Zeit. Macht Euren Frieden.«
Aper nickte und schloss die Augen, woraufhin Silus vortrat und ihm das Schwert in die Brust bohrte. Die Klinge glitt an den Rippen vorbei durch seinen Körper und trat am Rücken wieder aus. Dabei stieß die Schwertspitze gegen das Straßenpflaster und brach ab.
Aper umklammerte die Klinge, dann fiel er zurück und lag schließlich still da. Silus zog das Schwert heraus und blieb einen achtungsvollen Augenblick lang stehen, während die Frau, die er soeben zur Witwe gemacht hatte, ihren toten Mann heulend in die Arme schloss.
Nun kam auch Atius hinzu und stellte sich neben Silus. Sein Blick fiel auf das Schwert seines Freundes. »Schade drum. War ein schönes Schwert.« Silus erschien diese Bemerkung zwar höchst unpassend, doch die Klinge war wirklich zu einem ungünstigen Augenblick zu Bruch gegangen. Bei der Geschwindigkeit, mit der er sich neue Feinde machte, wollte er nicht ohne Waffe herumlaufen.
Auf der anderen Straßenseite stand ein rußverschmierter Mann und beobachtete sie. Ganz offensichtlich gehörte er zu den Vigiles und war nach seiner Nachtschicht auf dem Weg nach Hause. Er schien unschlüssig darüber, ob er eingreifen sollte oder nicht. Einen Mord auf offener Straße zu verhindern, gehörte zwar zu seinen Pflichten, andererseits gelangte er schnell zu der Einsicht, dass er gegen die beiden bewaffneten Täter wenig ausrichten konnte.
Atius nahm Silus das Schwert ab und ging auf den Mann zu. »Gib mir dein Beil«, sagte er. »Nimm das Schwert dafür. Den Schaden hat ein guter Schmied schnell behoben, und dann kannst du es entweder behalten oder für eine anständige Summe verkaufen.«
»Aber ich …«
Atius hielt ihm das Schwert hin. Seine Miene duldete keinen Widerspruch. Zögerlich zog der Mann das Beil mit dem kurzen Holzgriff aus dem Gürtel. In der Schneide waren mehrere Scharten – anscheinend hatte er es in dieser Nacht benutzt, um einen Brand zu bekämpfen oder Menschen aus einem Feuer zu retten, für das zweifellos die marodierenden Prätorianer verantwortlich gewesen waren.
Atius reichte Silus das Beil. »Hier, bis du was Besseres findest.«
Silus nahm die Waffe, wog sie in der Hand und betrachtete prüfend das Blatt. Besser als nichts. Er blickte noch einmal auf die trauernde Witwe herab und sah dann zur Domus hinüber, wo der Hausverwalter und die Sklaven in der Tür standen und ihren toten Herrn anstarrten. Silus seufzte. »Gehen wir.«
Zweites Kapitel
Caracalla stand in einer purpurfarbenen Toga vor den versammelten Mitgliedern des Senats. Nach außen hin gab er sich ruhig und selbstbewusst – kein Wunder, hatte er doch gegen alle Gepflogenheiten einen bewaffneten Prätorianertrupp aufmarschieren und zwei Mann tief um die Sitzbänke der Senatoren herum Aufstellung nehmen lassen. Er verfehlte seine einschüchternde Wirkung nicht. Zusätzlich sorgte das Gewicht des Brustpanzers, den er als weitere Vorsichtsmaßnahme unter der wallenden Toga aus feinster Wolle trug, für ein Gefühl der Sicherheit.
Der Senat hatte sich vollzählig unter freiem Himmel auf dem Gipfel des Kapitolhügels versammelt – wenn alle Mitglieder zusammenkamen, reichte der Platz in der Curia Iulia, wo die Senatssitzungen üblicherweise stattfanden, nicht aus. Trotz der Nachmittagssonne war es recht kühl, wie im Winter nicht anders zu erwarten. Viele Senatoren hatten bleiche Gesichter, manche zitterten sogar – ob vor Kälte oder Angst, vermochte Caracalla nicht zu erkennen.
Er erinnerte sich daran, wie Geta – der damals wahrscheinlich noch keine fünf gewesen war – einmal eine Schlange unter einem Stein entdeckt hatte und zu ihm gelaufen war, um sich bei seinem älteren Bruder in Sicherheit zu bringen. Caracalla hatte ihn in den Arm genommen und ihn davon überzeugt, dass die grässliche Schlange viel mehr Angst vor ihm als er vor ihr hatte. Er hätte beinahe gelacht, als ihm bewusst wurde, dass es ihm jetzt mit dem Senat genauso ging – wer hatte mehr Angst vor dem anderen?
Doch der Gedanke an den Bruder, den er eigenhändig getötet hatte, zerschmetterte jegliche Fröhlichkeit, die er empfand, so, wie er damals den Kopf der Schlange mit einem Stein zerschmettert hatte. Die Seelenqualen, die ihn so plötzlich überkamen, ließen seine Eingeweide verkrampfen. Er zwang sich dazu, an etwas anderes zu denken, um nicht von Trauer übermannt zu werden.
Musste er den Senat wirklich fürchten? Auf den ersten Blick machte diese Versammlung von größtenteils alten, gebrechlichen und hinfälligen Männern keinen besonders bedrohlichen Eindruck. Als könnte man sie mit Lippenbekenntnissen abspeisen, ohne sich um ihre Meinung zu scheren. Doch wenn ein Herrscher einen anderen ablösen wollte, war er auf die Unterstützung des Senats angewiesen. Und jedes Mitglied dieses ehrwürdigen Organs hatte viel Geld, gute Beziehungen, gehörte einer mächtigen Familie an und besaß ganze Heerscharen von Klienten, die ihrem Patron bedingungslosen Gehorsam schuldig waren. Viele, wenn auch nicht alle Senatoren hatten im Amt eines Prokonsuls oder Statthalters irgendwo im Reich Legionen in die Schlacht geführt, die ihnen auch heute noch treu ergeben waren.
Außerdem waren Geburt und Abstammung keine Garantie für die Erlangung der Kaiserwürde. In der Geschichte Roms hatte es überhaupt nur drei Kaiser gegeben, die den Thron von ihrem leiblichen Vater geerbt hatten: Titus, Domitian und Commodus, wobei die letzteren beiden im Senat äußerst unbeliebt gewesen waren. Caracallas Vorteil war, dass er sein Amt bereits als Mitkaiser ausgeübt hatte und daher nicht zum Kaiser ausgerufen, sondern lediglich als alleiniger Herrscher bestätigt werden musste. Trotzdem war seine Macht alles andere als gesichert – nun kam es darauf an, das noch etwas wackelige Fundament seiner Herrschaft durch Überredungskunst, Einschüchterung, Bestechung und die Beseitigung möglicher Gefahren zu festigen.
Die Gefolgschaft der Prätorianer und Legionen hatte er sich erkaufen müssen. Am Vormittag hatte er das südlich von Rom gelegene Alba besucht, um die Unterstützung der Legio II Parthica zu gewinnen – eine schmachvolle, geradezu niederschmetternde Erfahrung. Anfangs hatte man ihm gar den Zutritt zum Hauptquartier der Legion verwehrt, eine Demütigung, wie er sie in den zwanzig Jahren, die sein Vater Kaiser gewesen war, nicht erlebt hatte. Die Legio II Parthica hatte Severus im Krieg gegen die Parther gute Dienste geleistet und war daraufhin nach Alba verlegt worden – als Reserve für den Fall, dass das Volk rebellierte oder ein Usurpator nach dem Thron griff. Somit war sie seit Jahrhunderten die erste Legion, die in Italien selbst stationiert war, und durch ihre Nähe zu Rom hatten sie Geta öfter zu sehen bekommen als jeder andere Teil der Armee. Viele Legionäre grollten Caracalla, da sie nach wie vor der Ansicht waren, nicht einem, sondern zwei Kaisern die Treue geschworen zu haben.
Dies ärgerte Caracalla umso mehr, hatte er diese Legion in Britannien doch höchstpersönlich in die Schlacht geführt. Dies war wohl auch der Grund, weshalb es ihm letztendlich gelang, die Soldaten für sich zu gewinnen – dies und ein üppiges Bestechungsgeld, zu dem auch die Anhebung des Solds um die Hälfte gehörte, ein Versprechen, das er bereits den Prätorianern gemacht hatte. Indem er sie und den einzigen anderen nennenswerten militärischen Verband in der unmittelbaren Nähe Roms auf seine Seite gezogen hatte, war seine Herrschaft zumindest kurzfristig gesichert. Nun galt es, den Senat für sich zu gewinnen – oder sich ihn durch Einschüchterung gefügig zu machen.
Caracalla hatte einen reich geschmückten, vergoldeten Thron vor den Senatoren aufstellen lassen. Er stieg die drei Stufen des Podestes hinauf und nahm auf der gepolsterten Sitzfläche Platz. Zu seiner Rechten stand Papinianus. Er war einer der beiden Prätorianerpräfekten und außerdem mit Caracallas Stiefmutter Julia Domna verwandt (Laetus, der andere Prätorianerpräfekt, hatte durch einen Boten ausrichten lassen, dass er schwer erkrankt sei und das Bett hüten müsse). Zu seiner Linken befand sich der vor Kurzem zum Stadtpräfekten ernannte Marcellus, der die städtischen Kohorten befehligte. Caracalla sah sich einen Augenblick lang mit klopfendem Herzen und Gänsehaut um. Die vor ihm Versammelten bekamen nichts davon mit, sie sahen lediglich seine in Falten gelegte Stirn und die geschürzten Lippen. Er wusste, wie einschüchternd seine Gesichtszüge, der dichte lockige Bart, die breite Stirn und die dunklen Augen wirken konnten, doch um die erfahrenen Männer vor sich zu beeindrucken, brauchte es mehr als das, auch wenn er sie mit seiner Machtdemonstration sichtlich erschreckt hatte.
Gemurmel erhob sich unter den Senatoren, ein, zwei Mutige wagten es sogar, ihm wütende Fragen zuzurufen.
»Warum ist die Garde bewaffnet?«
»Wo ist Euer Bruder?«
Er wartete, bis Stille eingekehrt war, die hier und da durch eine Ohrfeige oder einen Schlag mit dem Schwertknauf erzwungen werden musste. Dann stand er auf. Klar und deutlich hallte seine tiefe Stimme über die Hügelkuppe. »Wenn ein Mann seinen Bruder erschlägt, wird er für dieses vermeintliche Verbrechen verurteilt, sobald es ans Licht kommt. Er wird umgehend als Brudermörder oder noch schlimmer beschimpft. Man bedauert das Opfer und hasst den Sieger. Doch manchmal kann man eine solche Tat, wenn man die Beweggründe des überlebenden Bruders ganz nüchtern betrachtet, nicht anders als gerechtfertigt bezeichnen – als Notwehr, um sich selbst zu verteidigen, anstatt alle Demütigungen untätig hinzunehmen und sich einen Feigling schimpfen zu lassen.
Mein Bruder hat mir mehrmals nach dem Leben getrachtet. Zum Beispiel wollte er mich während der Saturnalien vergiften, aber mir treu ergebene Männer konnten diesen Mordanschlag vereiteln und dem Meuchler das Geständnis entlocken, dass er in Getas Auftrag gehandelt hatte. Dennoch habe ich diesem die schändliche Tat aus brüderlicher Liebe und um der Eintracht willen vergeben, mehr noch: Auf die dringende Bitte der Augusta hin erklärte ich mich bereit, mich mit ihm allein und unbewaffnet zum Friedensgespräch zu treffen.
Mich und die Kaiserin dabei zu überrumpeln – in Begleitung mehrerer Männer, die er gedungen hatte, um mich zu töten –, war sein letzter Akt der Heimtücke.
Ich habe mich gegen einen Feind zur Wehr gesetzt, für den ich schon lange kein Bruder mehr war. Es ist nur recht und billig, sich gegen solche Niedertracht zu verteidigen, genauso wie sich Romulus einst wehrte, als sein Bruder sein Werk verspottete.
Ganz zu schweigen von Germanicus, dem Bruder des Tiberius, von Britannicus, dem Bruder des Nero, oder Titus, dem Bruder des Domitian. Selbst Marcus Aurelius, der ein großer Freund der Philosophie und des menschlichen Strebens nach Größe war, konnte die Arroganz seines Stiefbruders nicht länger ertragen und ließ ihn beseitigen.«
Caracalla beobachtete aufmerksam jede Regung des Publikums. Dass die genannten Kaiser tatsächlich ihre Brüder getötet hatten, gehörte – insbesondere, was Marcus Aurelius anging – wohl ins Reich der Legende. Doch wie er bereits erwartet hatte, wagte es keiner der Senatoren, ihn darauf hinzuweisen.
»Und als man Gift für mich mischte und das Schwert auf mich richtete, habe auch ich mich gegen meinen Feind verteidigt, denn wie sollte man einen Bruder, der zu solchen Taten fähig ist, wohl anders nennen?
Ich sage euch: Dankt den Göttern, dass euch wenigstens ein Kaiser geblieben ist. Stellt eure Differenzen in Denken und Handeln beiseite, genießt euer Dasein in Sicherheit und lasst euch von einem einzigen Kaiser führen, so, wie Jupiter der alleinige Herrscher der Götter ist.«
Als er verstummte, war es bis auf das Knarren der Prätorianeruniformen und den Wind, der um den Hügel strich, völlig still: keine Buhrufe oder Pfiffe, kein Applaus, keine Jubelschreie. Caracalla ließ den Blick über die Senatoren schweifen und auf denen ruhen, die Anhänger seines Bruders gewesen waren. Aper war bereits tot und Laetus hatte es nicht gewagt zu erscheinen, doch die beiden waren nicht die Einzigen, die Geta mehr oder weniger treu ergeben gewesen waren. Sobald er denjenigen ins Gesicht sah, ließen sie schnell den Blick sinken oder rissen vor Schreck die Augen weit auf.
Zufrieden sah er, dass niemand Anstalten machte, seine Herrschaft infrage zu stellen. »Meine erste Verfügung als alleiniger Herrscher soll sein, allen, die sich im Exil befinden, die Rückkehr nach Rom zu gestatten.«
Das sorgte für ungläubiges Luftschnappen unter den Senatoren. Vielerlei Taten zogen die Strafe der Verbannung nach sich: Verbrechen wie Verrat und Mord, aber auch Frevel gegen die Götter oder einfach nur, beim Kaiser in Ungnade zu fallen. Caracalla zählte darauf, dass ihm die Edelmänner, die er auf diese Weise begnadigte, gewogen sein würden – als Gegengewicht zum afrikanischen Lager, das seinen Bruder unterstützt hatte. Und er hoffte inständig, dass sich diese Großzügigkeit nicht eines Tages rächte.
»Und nun schwört mir die Treue.«
Er stand auf und stellte sich gerade hin. Im Chor legten die Senatoren ihren Eid auf Caracalla als alleinigen Kaiser des römischen Imperiums ab. Der musste die Zähne aufeinanderbeißen, um sie am Klappern zu hindern, peinlich berührt von dieser Reaktion seines Körpers auf den immensen Druck, der seit mindestens gestern auf ihm lastete. Was nun, Antoninus?, fragte er sich nachdenklich. Nun war Sicherheit das Wichtigste – seine eigene und die Roms. Ein weiterer Bürgerkrieg wie der, bei dem sein Vater den Thron errungen hatte, kam nicht infrage. Rom brauchte einen starken und verlässlichen Herrscher. Genau wie sein großes Vorbild Alexander würde er das Reich zum Ruhm führen. Doch zuerst musste er die Feinde im Inneren beseitigen. Und zwar mit rücksichtsloser Gründlichkeit.
Caracalla quittierte den Schwur des Senats lediglich mit einem Nicken, dann schritt er langsam das Podest hinunter und entfernte sich von den versammelten Senatoren. Eine plötzliche Müdigkeit überkam ihn. Er hatte seit eineinhalb Tagen nicht geschlafen – eineinhalb Tage, in denen er um sein Leben gekämpft, seinen Bruder getötet, sich die Unterstützung zweier verschiedener Streitmächte erbettelt, erschmeichelt und erkauft und schließlich den Senat durch Einschüchterung gefügig gemacht hatte. Mit einem Mal gaben seine Knie nach, und er geriet ins Straucheln. Papinianus hielt ihm den Arm hin, und er klammerte sich daran fest. Marcellus näherte sich von der anderen Seite, und gemeinsam machten sie sich schweigend und mit einer Hundertschaft Prätorianer im Gefolge auf den Weg zum kaiserlichen Palast.
Als Caracalla dort eintraf, verneigten sich vier seiner germanischen Leibwächter vor ihm. Da er wusste, wie misstrauisch die Römer Fremden gegenüber waren, hatte er sie nicht mitgenommen. Seine Vermutung, dass ihm Volk und Senat eher gewogen waren, wenn er mit einer aus Prätorianern bestehenden Eskorte erschien, hatte sich bewahrheitet. Doch jetzt war er wieder im Palast und konnte die Prätorianer entlassen, denen er sowieso weniger vertraute als den Germanen, von denen jeder Einzelne bei seinen Göttern geschworen hatte, ihn mit seinem Leben zu schützen. Papinianus und Marcellus blieben ebenfalls und warteten gehorsam auf ihre Befehle. Doch Caracallas Verstand war wie leergefegt.
Er ließ sich in einen Polsterstuhl im Tablinum fallen und starrte ins Leere. Was hätte er jetzt empfinden müssen? Triumph? Erleichterung? Trauer? Er war einfach nur erschöpft. Seine Lider wurden schwer, und ihm fehlte die Willenskraft, sie wieder zu öffnen. Schon spürte er Somnus nahen und ließ sich von dem Gott des Schlafes in dessen Reich tragen.
Dann erschien Geta vor ihm – so lebensecht, dass er seinen nach süßem Wein duftenden Atem zu riechen glaubte. Sein Gesicht war so bleich wie frischgewalkte Wolle, und ein Ausdruck des Tadels und der tiefen Enttäuschung lag darauf.
Caracalla erwachte mit einem Schrei.
»Augustus, fehlt Euch etwas?«, fragte Marcellus und beugte sich ängstlich über ihn.
Caracalla sah sich gehetzt um, dann holte er tief Luft, um sein rasendes Herz zu beruhigen. Egal, ob Traum oder Vision – Hauptsache, es war nicht die Wirklichkeit.
Ihn überkam das Bedürfnis, sich trösten zu lassen. Er hatte keinen Vater mehr, keine Mutter, keinen Bruder und keine Frau, doch es gab jemanden, der für ihn da war. »Ich will die Kaiserin sehen. Ihr verräterischer Sohn hat sie verwundet, und ich möchte mich mit eigenen Augen davon überzeugen, dass sie wohlauf und in Sicherheit ist.«
Er stand auf. Papinianus hielt ihm den Arm hin, doch Caracalla stieß ihn wütend von sich. Zielstrebig marschierte er mit Papinianus, Marcellus und den vier germanischen Leibwächtern im Gefolge durch den Palast zu den Gemächern seiner Stiefmutter. Allein die Vorstellung, Julia Domna zu sehen – wenn auch in der Öffentlichkeit, wo er sie weder in die Arme nehmen noch ihre Wärme spüren oder ihre Hände und Lippen küssen konnte –, hob seine Laune.
Als er das Atrium der Kaiserin betrat, fand er sie dort mit mehreren Edelfrauen sitzend vor. Zu seinem Entsetzen befanden sie sich in tiefer Trauer. Domna saß auf einem Sofa, Tränen liefen über ihr Gesicht. Cornificia, eine Tochter des Kaisers Marcus Aurelius, hielt ihre Hand. Wenn sie Domna nicht gerade gutgemeinte Ratschläge erteilte oder Binsenweisheiten von sich gab, vergoss sie ebenfalls reichlich Tränen. »Schrecklich«, sagte sie zwischen tiefen Schluchzern. »Was für eine schreckliche, schändliche Tat. Mein Bruder hat meinen Mann und meinen Sohn ermorden lassen, daher weiß ich, wie schwer es für eine Mutter ist, ihr sterbendes Kind in den Armen zu halten. Sein eigener Bruder hat Geta heimtückisch ermordet … Die Götter werden ihn bestrafen.«
»Was ist hier los?«, brüllte Caracalla.
Das Heulen und Jammern verstummte sofort, und erschrocken wandten sich die trauernden Frauen zu Caracalla um. Der schäumte vor Wut über Cornificias Worte und darüber, wie sehr seine Tat seine Geliebte erschüttert zu haben schien. »Habe ich euch etwa erlaubt, zu trauern? Ist es anständig und schicklich, Tränen für einen Mann zu vergießen, der den Kaiser und das Imperium selbst verraten hat? Der seinen Bruder um seines eigenen Vorteils willen ermorden wollte? Weshalb sollten wir uns seinetwegen die Brust entblößen, die Haare ausraufen und Asche über uns schütten?«
»Antoninus«, sagte Julia Domna besänftigend, stand auf und hob die von einem Verband umwickelte Handfläche. Frisches Blut war durch den weißen Stoff gesickert. Beim Anblick der Verletzung, die sein Bruder seiner Geliebten zugefügt hatte, wurde er noch wütender.
»Es wird nicht getrauert«, sagte er. »Wir sollten jubeln, weil ein Verräter sein Ende gefunden hat.«
Nun stand Cornificia ebenfalls auf und richtete den Finger auf Caracalla. »Ein Kaiser, der Sohn eines Kaisers und der Bruder eines Kaisers – wenn man jenen denn so bezeichnen kann – ist von uns gegangen. Das ganze Imperium sollte den Tod eines so vielversprechenden Mannes beweinen, der Rom so viel hätte geben können. Wenigstens seine Mutter sollte doch Tränen um ihn vergießen dürfen.«
»Du wagst es, so mit mir zu sprechen?« Caracalla war nun völlig außer sich vor Zorn. »Mit welchem Recht nimmst du dir Derartiges vor deinem Kaiser heraus?«
»Mit dem Recht meiner Geburt und meiner Vorfahren«, entgegnete Cornificia und schüttelte die Hand ab, die Julia zur Beruhigung und Warnung auf ihren Arm gelegt hatte. »Ich bin die Tochter des großen Marcus Aurelius und Schwester des Kaisers Hadrian. Rom selbst fließt durch meine Adern. Ich habe miterlebt, wie das Reich von zu Recht vergöttlichten Männern wie meinem und Eurem Vater regiert wurde, und ich habe es in die Hände von Tyrannen fallen sehen – Tyrannen wie mein Bruder oder wie Ihr!«
Caracalla fehlten einen Augenblick lang die Worte. So vor seinen Leibwächtern, vor Marcellus und Papinianus und vor diesen verfluchten kreischenden Frauen getadelt zu werden, war unerhört und durfte nicht geduldet werden.
»Papinianus, sperr sie ein. Was sie da redet, ist Verrat!«
»Antoninus, nicht«, flehte Domna.
»Tu, was ich dir sage, Papinianus.«
Papinianus schüttelte traurig den Kopf. »Nein, Augustus.«
Caracalla drehte sich mit vor Staunen offenem Mund zu ihm um. »Papinianus, du verweigerst mir den Gehorsam?«, fragte er fassungslos. Papinianus hatte mit seiner Meinung nie hinter dem Berg gehalten und auch Caracalla nicht so bedingungslos unterstützt wie etwa Marcellus. Er hatte sich für Frieden zwischen den Brüdern eingesetzt, als Caracalla Krieg gewollt hatte. Doch so eindeutig hatte er sich noch niemals zuvor gegen ihn gestellt.
»Bitte verzeiht, Augustus, doch das ist Unrecht. Cornificia hat sich nichts zuschulden kommen lassen.«
»Sie hat zum Aufstand gegen den Kaiser aufgerufen.«
»Womöglich ist es tatsächlich ihr Recht. Wie sie schon sagt: Sie ist die Tochter eines Kaisers.«
»Papinianus, du bist für mich nicht nur Berater, sondern auch Freund. Trotzdem warne ich dich davor, dich mir zu widersetzen.«
»Augustus, in dieser Angelegenheit habe ich keine andere Wahl.«
Seine Worte hingen einen Augenblick lang in der Luft. Caracallas Herrschaft war an einem Scheideweg angelangt. Welche Richtung würde er einschlagen? Wahre Stärke zeigte sich in dem Vermögen, jenen zu vergeben, die ihm den Gehorsam verweigerten – so, wie es einst Julius Caesar getan hatte. Ein starker Herrscher würde Demütigung und Ungehorsam mit einem Schulterzucken abtun und die Schuldigen mit einer Ermahnung davonkommen lassen. Ein starker Herrscher würde in der Gewissheit weiterregieren, dass Armee, Senat und Volk fest hinter ihm standen.
Leider besaß er diese Stärke noch nicht. Er hatte sich die Treue der in Italien stationierten Soldaten erkauft und den Senat zum Gehorsam gezwungen. Noch gab es viele Unzufriedene, die für Geta Partei ergriffen hatten und sich Caracallas Herrschaft weiterhin widersetzen oder sich gar hinter ihrem eigenen Anwärter auf dem Thron versammeln würden. Konnte er diese Männer ebenfalls mit Geld und der Aussicht auf Straffreiheit ruhigstellen? Oder würden sie solche Versprechungen als Zeichen der Schwäche auslegen und ihm nur noch entschlossener Widerstand leisten?
Caracalla war ein großer Bewunderer Sullas, des Diktators, der seine Macht durch Proskriptionen gesichert hatte, mit denen er Tausende von Staatsfeinden öffentlich geächtet und dadurch zum Tode verurteilt hatte. Mit dem »Staat« hatte er selbstverständlich sich selbst gemeint. Sulla war ein hervorragender Feldherr, aber ein gnadenloser Herrscher gewesen. Nichtsdestotrotz hatte er seine Gegner überlebt, schließlich das Amt des Diktators niedergelegt und sich auf seine Ländereien zurückgezogen, wo er eines natürlichen Todes gestorben war. Für Caracalla war Sulla ein beinahe so großes Vorbild wie Alexander selbst. Letzterer hatte bekanntermaßen nicht lange genug gelebt, um das Reich, das er gegründet hatte, auch zu regieren. Wenn es Alexander gelungen wäre, siegreich nach Hause zurückzukehren – hätte er wohl mit ebenso harter Hand regiert wie Sulla?
Domna sah ihn an. Ihre Augen waren gerötet, die Schminke verschmiert. Sie so leiden zu sehen, brach ihm für gewöhnlich das Herz, doch diesmal verhärtete es sich in seiner Brust.
»Wachen, nehmt Cornificia und Papinianus fest und sperrt sie ein, bis ich mein Urteil über sie gefällt habe.«
Die germanischen Leibwächter – kräftige, langhaarige Grobiane – traten vor. Zwei packten Papinianus’ Arme mit festem Griff, obwohl dieser keinen Widerstand leistete. Cornificia hingegen ließ sich nicht so einfach gefangen nehmen und schlug die erste Leibwächterhand, die sich ihr entgegenstreckte, zornig beiseite. »Wage es nicht, Hand an mich zu legen, du dreckiger Barbar!«
Der Leibwächter drehte sich mit fragendem Blick zu Caracalla um. Der Kaiser nickte einfach nur, woraufhin der Germane erneut versuchte, Cornificia zu packen. Sie ließ die Hand vorschnellen und verpasste ihm eine Ohrfeige. Der Mann hielt sich die Wange, auf der sich ein roter Handabdruck abzeichnete. Dann grinste er und versetzte ihr ihrerseits einen Schlag mit dem Handrücken. Ihr Kopf wurde zur Seite geschleudert, sie fiel auf Hände und Knie und keuchte vor Schmerz und Entrüstung. Noch während sie um Fassung rang, packten sie zwei Leibwächter unter den Achselhöhlen, zogen sie auf die Füße und zerrten sie unter den ungläubigen Blicken Julia Domnas und der anderen entsetzten Edelfrauen davon. Papinianus ließ sich mit hängendem Kopf hinter Cornificia aus dem Raum führen.
Julia Domna trat auf Caracalla zu und streckte eine zitternde Hand nach ihm aus.
Er kehrte ihr den Rücken zu. »Marcellus, hiermit ernenne ich dich zum Prätorianerpräfekten«, sagte er.
»Jawohl, Augustus. Es ist mir eine Ehre, Euch auch in diesem Amt dienen zu dürfen.«
»Rom ist voll von Anhängern meines verräterischen Bruders. Wir müssen uns so schnell wie möglich um sie kümmern. Fangen wir mit den Verschwörern in dem Flügel des Palastes an, den Geta bewohnt hat. Nimm dir eine Hundertschaft Prätorianer und verhafte alle, die sich dort verstecken. Und dann lässt du diese verfluchten Trennmauern zwischen den Palastflügeln wieder einreißen. Ich will in meinem eigenen Haus wandeln können, wie es mir beliebt.«
»Ja, Augustus.«
»Und jetzt komm mit, wir gehen ein paar Schritte. Es gibt eine Menge zu besprechen und viele Pläne zu schmieden.«
Caracalla und Marcellus verließen Julia Domnas Atrium. Die Kaiserin starrte ihm mit ungläubiger Miene hinterher.
Cassius Dios Bein wollte nicht aufhören zu zittern. Sein Knie zuckte wie zu einem unhörbaren Takt, sein Fuß tippte auf den Boden. Er verschränkte die Hände im Schoß und beugte sich vor, doch auch dadurch verschwand das mulmige Gefühl in seiner Magengegend nicht. »Festus, du hättest ihn sehen sollen. Der Leichnam seines Bruders ist noch nicht kalt, da stellt er sich schon vor uns hin und verkündet, wie sehr wir den Göttern zu Dank verpflichtet seien, dass sie ihn beschützt hätten. Und dass wir ihm vertrauen und ihm die Treue schwören sollen. Unmittelbar, nachdem er den Mord an seinem Bruder mit der unglaubwürdigen Geschichte gerechtfertigt hat, Geta hätte ihm nach dem Leben getrachtet.«