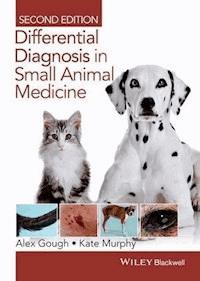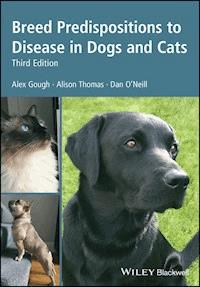9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Assassinen von Rom
- Sprache: Deutsch
Brüder. Imperatoren. Tödliche Feinde. Der zweite Band der neuen Rom-Serie von Alex Gough – für alle Fans des alten Roms und Leser:innen von Simon Scarrow und Robert Fabbri Rom, 211 n. Chr.: Kaiser Severus liegt auf dem Sterbebett. Seine verfeindeten Söhne Geta und Caracalla bereiten sich auf einen verheerenden Machtkampf um den Thron vor. Als kaiserlicher Assassine im Geheimbund der Arcani wird Silus durch die brutalen Aufträge der Brüder auf eine harte Probe gestellt. Und da auch das Imperium unter der Belastung zu zerbrechen beginnt, muss er sich fragen, was ihm wichtiger ist: Rom oder seine eigene Seele. - Die mitreißende Geschichte rund um den kaiserlichen Assassine Silus geht weiter - Drohende Bürgerkriege, politische Intrigen und grausame Morde – während der letzten Dynastie der römischen Kaiserzeit lauern die Gefahren überall Alle Bände der ›Die Assassinen von Rom‹-Reihe: Band 1: Das Schwert des Kaisers Band 2: Der Dolch des Kaisers Alle Bände sind unabhängig voneinander lesbar
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 563
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Über das Buch
Rom, 211 n. Chr.: Silus, mittlerweile gefürchteter Assassine im Geheimbund der Arcani, begibt sich in das Herz des römischen Imperiums. Kaiser Septimius Severus’ letzte Stunden sind angebrochen – die Feindschaft seiner beiden Söhne Caracalla und Geta über die Thronfolge nimmt bedrohliche Ausmaße an. Schnell wird klar: Für die beiden Brüder kann es nur einen Herrscher geben. Inmitten des gefährlichen Strudels aus Intrigen müssen die Arcani Silus, sein Freund Atius und Neuzugang Daya grausame Aufträge ausführen, die Silus’ Gewissen immer mehr belasten. Als er dann auch noch von einem heiklen Geheimnis Caracallas erfährt, welches das gesamte Imperium ins Chaos stürzen könnte, steht er vor einer Entscheidung, die nicht nur ihn das Leben kosten könnte.
Alex Gough
Der Dolch des Kaisers
Die Assassinen von Rom Band II
Roman
Aus dem Englischen von Kristof Kurz
Erstes Kapitel
Winter 210–211 n. Chr. Eboracum
Silus war müde wie ein Steinbruchsklave und sein Hintern wund geritten. Sie waren kurz vor Eboracum und er sehnte sich nach einem großen Bier und einem warmen Bett. Plötzlich hielt er sein Pferd an.
»Scheiße«, sagte er und warf seinem ebenfalls völlig erschöpften Reisegefährten einen Blick zu.
»Scheiße«, pflichtete Atius ihm bei.
Vor ihnen lag das von mächtigen Türmen flankierte Nordtor der Stadtmauer. Die gepflasterte Straße, auf der sie unterwegs waren, führte durch die einladend geöffneten Torflügel direkt zu Erfrischung und Erholung – doch leider versperrte ihnen ein halbes Dutzend Prätorianer mit glänzenden Rüstungen, makellosen roten Mänteln und erhobenen Speeren den Weg.
Silus sah sich um. Hinter ihm befanden sich lediglich ein von langsam dahintrottenden Ochsen gezogener, mit Töpferwaren beladener Karren und ein gebückt gehender alter Mann mit einem Sack voll Gemüse über der Schulter. Die Soldaten waren also ganz offensichtlich hier, um Silus und Atius in Empfang zu nehmen.
»Sieh dir diese Volltrottel an«, sagte Atius. »Ich wette, dass noch keiner von denen das Schwert im Kampf gezogen hat. Die sitzen doch nur faul in ihrer Wachstube und verprügeln irgendwelche Leute, wenn es ihr Kommandant so will. Ansonsten schlagen sie sich die Bäuche voll und ficken die Frauen, die darauf warten, dass die echten Männer wieder nach Hause kommen.«
Silus seufzte.
»Ich bin mir sicher, dass Menenia in deiner Abwesenheit nichts mit einem Prätorianer angefangen hat«, sagte er, was Atius etwas zu besänftigen schien. »Dazu hatte sie ja auch keine Zeit, weil sie für die halbe sechste Legion die Beine breitgemacht hat«, schob er hinterher.
Atius sah ihn mit finsterer Miene und gefletschten Zähnen an. »Silus, wir haben eine Menge zusammen durchgestanden. Aber wenn du das noch mal sagst, werde ich deine Eingeweide hier auf der Straße verteilen.«
»Beruhige dich«, sagte Silus. Ein Lächeln spielte um seine Mundwinkel. Er hatte in letzter Zeit wahrlich nicht viel zu lachen gehabt, doch seinen Freund auf die Palme zu bringen, sorgte zuverlässig für Erheiterung. »Das war doch nur ein Scherz.«
»Mir egal. Wenn du das noch mal sagst, schieb ich dir mein Messer zwischen die Rippen, bevor du Luft zum Lachen holen kannst.«
»He!« Die beiden drehten sich zu dem Zenturio um, der den kleinen Prätorianertrupp anführte. »Wir stören doch nicht etwa?«, fragte er in gespielt höflichem Ton.
»Doch«, sagte Silus. »Wir führen gerade eine wichtige Unterhaltung, und außerdem steht ihr uns im Weg. Was wollt ihr Pisser überhaupt?«
Dem Zenturio klappte der Kiefer herunter. Dann richtete er sich zur vollen Größe auf und warf sich in die Brust. Anscheinend war er einen derartigen Mangel an Unterwürfigkeit nicht gewohnt. »Seid ihr Gaius Sergius Silus und Lucius Atius?«, fragte er im gewichtigsten Tonfall, zu dem er imstande war.
»Lucius?«, fragte Silus. »Jetzt kennen wir uns schon so lange, aber ich hab dich noch nie nach deinem Vornamen gefragt.«
»Weil er dir auch völlig egal ist«, sagte Atius.
»Seid ihr Gaius Sergius Silus und Lucius Atius?«, brüllte der Zenturio.
»Ja doch«, sagte Silus. »Sehr erfreut. Und Ihr seid …?«
»Ich bin Pontius Calvinus, Zenturio der Prätorianergarde. Und ihr seid verhaftet.«
»Auf wessen Befehl?«, fragte Silus.
»Auf direkten Befehl von Kaiser Publius Septimius Geta Augustus.«
»Na, wer hätte das gedacht«, murmelte Silus.
»Mit denen werden wir schon fertig«, sagte Atius in einem Flüsterton, der absichtlich gerade laut genug für die Ohren der Prätorianer war.
»Schon gut«, sagte Silus. »Tun wir lieber, was diese netten Männer von uns wollen.« Er stieg ab und händigte seine Waffen aus. Atius folgte widerwillig seinem Beispiel. Sie wurden von jeweils zwei Prätorianern gepackt und grob durch die Stadt geschubst – nicht zu einem großen Bier und einem weichen Bett, sondern in eine klamme Zelle.
Dort saßen sie auf einer Steinbank und betrachteten die vielen in das Mauerwerk geritzten Inschriften.
»Tertius fickt Eunuchen.«
»Verica ist die beste Hure von ganz Eboracum.«
»Mit Vorsicht zu genießen«, stand neben einer groben Phallusdarstellung.
»Crotus hat hier geschissen.«
Und tatsächlich erfüllte ein Exkrementhaufen in der Ecke die Zelle mit seinem üblen Gestank.
Silus vergrub den Kopf in den Händen. »Scheiße«, sagte er leise.
Die Zellentür flog auf und vier stämmige Prätorianer traten ein, gefolgt von Zenturio Calvinus.
»Stillgestanden«, bellte er.
Silus und Atius sahen sich an, zuckten mit den Schultern und richteten sich langsam auf.
»Gaius Sergius Silus. Lucius Atius. Ihr seid der Desertion und Befehlsverweigerung angeklagt und für schuldig befunden worden. Zur Strafe werdet ihr auf dem Exerzierplatz gesteinigt. Ergreift sie, Männer.«
Bevor Silus etwas erwidern konnte, hatten zwei Prätorianer ihn und Atius auch schon an den Armen gepackt und zerrten sie mit festem Griff aus der Zelle.
»Was soll der Scheiß?«, brüllte Silus dem vor ihm marschierenden Zenturio in den Rücken. Calvinus reagierte nicht.
»Ihr macht einen Fehler!«, schrie Atius.
»Holt Oclatinius her«, verlangte Silus. »Er wird für uns bürgen.«
Sobald der Name des alten Veteranen fiel, wechselten die Prätorianer ängstliche Blicke. Calvinus dagegen ging ungerührt weiter, ohne Silus auch nur eines Blickes zu würdigen. Man führte sie auf den Exerzierplatz vor den Mauern der Stadt, wo bereits ein Dutzend wie üblich aufs Feinste herausgeputzte Prätorianer in einer Reihe Aufstellung genommen hatten. Vor jedem lag ein Haufen faustgroßer Steine. Silus und Atius wurden zu zwei in den Boden gerammten Holzpfählen geführt und mit den Händen hinter dem Rücken daran festgebunden. Allmählich begriffen sie den Ernst der Lage.
Die Erkenntnis, dass er in Todesgefahr schwebte, traf Silus wie ein Schlag in die Magengrube. »Halt!«, schrie er. »Ich verlange, meinen Vorgesetzten zu sprechen. Wir haben auf direkten, persönlichen Befehl des Kaisers gehandelt!«
»Knebelt sie«, befahl Calvinus. Man stopfte ihnen Stoffstreifen in den Mund und knotete diese am Hinterkopf zusammen.
Silus wehrte sich und brüllte, doch seine Schreie wurden vom Knebel erstickt. Atius sah ihn mit hilflosem Blick an. War dies nun das Ende, nachdem sie so viel miteinander durchgestanden hatten? Sie hatten in Schlachten gekämpft und Blut vergossen, hatten Folter ertragen und waren im letzten Augenblick der Hinrichtung durch die Barbaren entgangen. Dass sie jetzt nicht durch die Hand des Feindes, sondern durch ihre Kameraden den Tod finden sollten, war eine so himmelschreiende Ungerechtigkeit, dass er fast darüber gelacht hätte.
»Alle Mann Steine aufheben«, befahl Calvinus.
Die Prätorianer taten wie geheißen. Einige wiegten ihren Stein nachdenklich in der Hand, andere machten eine finstere Miene oder lächelten gar blutrünstig.
Silus sah sich verzweifelt nach einem Ausweg, nach Rettung im letzten Augenblick um. Sein Herz raste, kalter Schweiß lief über seine Stirn.
»Die ersten beiden: Werft!«
Zwei Prätorianer traten vor und schleuderten ihre Steine aus zehn Schritt Entfernung auf Silus und Atius. Ein Stein kam auf Silus zugeschossen. Er zog den Kopf ein, und das Geschoss prallte gegen den Holzpfahl hinter ihm. Atius wurde in den Magen getroffen, woraufhin er einen durch den Knebel gedämpften Schrei ausstieß. Einige Prätorianer machten sich über den Kameraden lustig, der Silus verfehlt hatte, oder äfften Atius’ Schmerzenslaut nach. Andere dagegen sahen mit unbewegter Miene zu.
Silus brüllte gegen das Stoffstück in seinem Mund an. Das durfte doch nicht sein!
»Die nächsten beiden: Werfen!«
Diesmal streifte der Stein Silus’ Oberarm, und wieder schrie er in den Knebel. Der andere Stein prallte gegen Atius’ Brustkorb. Silus hörte das Knacken einer brechenden Rippe. Sein Freund ließ den Kopf hängen. Er atmete so schwer, dass seine Nasenflügel bebten.
»Die nächsten beiden! Wer …«
»Halt!«, rief eine befehlsgewohnte Stimme in einem Ton, der keinen Widerspruch duldete. Die Prätorianer drehten sich um und nahmen Haltung an, als ein alter, aber noch sehr rüstiger Mann auf sie zumarschierte. Es war Oclatinius. Den Göttern sei Dank, dachte Silus und bekam vor Erleichterung weiche Knie.
»Was soll das, Zenturio?«
»Herr, Ihr seid nicht befugt, Euch hier …«
»Weißt du, wen du vor dir hast?«, brüllte Oclatinius.
»Ja, Herr«, antwortete der Zenturio kleinlaut.
»Möchtest du mir noch einmal erklären, wozu ich befugt bin oder nicht?«
»Nein, Herr.«
»Dann sag mir, was hier vor sich geht.«
»Diese Männer sind Deserteure und wurden zum Tod verurteilt.«
Oclatinius kehrte dem Zenturio den Rücken zu und deutete auf zwei Prätorianer. »Schneidet sie los und holt einen Arzt.«
Die Prätorianer gehorchten eilends.
»Aber Herr …«, protestierte der Zenturio. »Der Befehl kam vom Kaiser persönlich.«
Oclatinius drehte sich zu ihm um und kniff die Augen zusammen. »Von welchem der drei?«
Caracalla, Geta und Julia Domna saßen auf ihren Thronen im Audienzsaal des Palastes, den Septimius Severus für die kaiserliche Familie in Eboracum hatte errichten lassen. Der Kaiser selbst war bettlägerig und zu schwach, um einen ganzen Vormittag lang Anträge und Gesuche über sich ergehen zu lassen, weshalb sich diese nun seine Frau und seine beiden Söhne anhörten.
Caracalla schweifte gedanklich ab, während die Bittsteller, die beide Besitzansprüche an einer Sklavin anmeldeten, ihre jeweilige Sicht der Dinge vortrugen. Die hübsche, rothaarige Britannierin stand mit gesenktem Kopf und geröteten Wangen zwischen ihnen. Der Kläger behauptete, dass sie geflohen sei, aber rechtmäßig ihm gehöre. Der Verteidiger hingegen machte geltend, dass er sie gekauft hatte, nachdem sie wieder eingefangen worden war. Er habe gutes Geld für sie bezahlt und es sei nicht seine Schuld, wenn der frühere Besitzer nicht auf sein Eigentum achtgeben könne.
Solche Angelegenheiten waren ganz nach Getas Geschmack, bemerkte Caracalla. Wahrscheinlich genoss er die Macht, Befehle zu erteilen, wenn er dabei nicht auf einem Schlachtfeld um sein Leben fürchten musste. Oder tat er ihm unrecht? Ihr Vater hatte von jeher darauf abgezielt aus Caracalla einen tüchtigen und siegreichen Feldherrn zu machen, während der jüngere Geta bisher noch keine Gelegenheit gehabt hatte, sich im Kampf zu beweisen. Das Schicksal hatte es so gewollt, und das Imperium verdiente einen Anführer wie Caracalla – kraftstrotzend, auf dem Schlachtfeld gestählt und von den Legionären geliebt. Sobald ihr Vater nicht mehr unter ihnen weilte, würde sich zeigen, ob sie das Reich gemeinsam regieren konnten oder ob auf dem Thron nur Platz für einen war. Caracalla für seinen Teil dachte jedenfalls nicht daran, seinem Halbbruder diesen Platz zu überlassen.
Doch noch hatte er die Hoffnung auf eine fruchtbare Zusammenarbeit nicht aufgegeben. Wenn sich Geta auf Regierungsgeschäfte wie diese beschränkte und Caracalla die wichtigere Aufgabe überließ, das Imperium gegen seine Feinde zu verteidigen, lag eine erfolgreiche gemeinsame Regentschaft durchaus im Bereich des Möglichen.
Er warf Julia Domna einen Blick zu. Sie saß mit geradem Rücken und im Schoß gefalteten Händen da. Um zu zeigen, dass sie aufmerksam zuhörte, hielt sie den Kopf leicht schräg. Inzwischen war sie fünfzig Jahre alt – wie schaffte sie es nur, sich ihre Schönheit zu bewahren und ihm so dermaßen den Kopf zu verdrehen? Vergebens wartete er darauf, dass sie seinen Blick erwiderte. Ihre Aufmerksamkeit galt allein den Bittstellern vor ihnen. Klugerweise ließen sie sich in der Öffentlichkeit nicht das Geringste anmerken – er wollte sich gar nicht erst vorstellen, was geschehen würde, wenn jemand von der Affäre zwischen der Frau des Kaisers und ihrem Stiefsohn erfuhr und es dem Kaiser oder Geta erzählte. Severus würde ihrer beider Hinrichtung wegen Hochverrats anordnen, wodurch Caracalla gezwungen wäre, seine Truppen und Unterstützer um sich zu scharen. Ein weiterer Bürgerkrieg wäre die Folge – gesetzt den Fall, dass seine Verbündeten auch dann noch zu ihm hielten, wenn die Wahrheit ans Licht kam.
Ihr Geheimnis musste unter allen Umständen gewahrt bleiben. Zumindest solange sein Vater noch lebte. Und auch danach durfte er sich vor seinen Feinden keine Blöße geben, bis seine Herrschaft nicht eindeutig gesichert war – doch hatte es jemals einen Kaiser gegeben, bei dem das der Fall gewesen wäre?
Widerwillig richtete er seine Aufmerksamkeit wieder auf die beiden Bittsteller, die nun ihre jeweilige Argumentation noch einmal knapp zusammenfassten. Caracalla beschlich der Verdacht, dass es hier um mehr als den reinen Geldwert der Sklavin ging. Sie war eine schöne Frau, und wie die beiden sie ansahen und über sie sprachen, ließ Begierde und Verlangen, womöglich sogar Liebe erahnen.
Nachdem die Männer fertig waren, herrschte Schweigen.
»Bruder, hast du irgendwelche Vorschläge, wie wir hier verfahren sollten?«, fragte Geta.
Caracalla hatte nicht aufmerksam genug zugehört, um sich ein Urteil erlauben zu können, und winkte ab.
»Julia Augusta?«, fragte Geta. Er begegnete seiner Mutter in der Öffentlichkeit stets mit Hochachtung, aber auch mit einem sanften, liebevollen Ton.
»Das ist keine einfache Entscheidung. Ich kann gut nachvollziehen, weshalb sich beide Parteien im Recht fühlen. Fragen wir doch unseren weisen Rechtsgelehrten um Rat.«
Damit meinte sie den Prätorianerpräfekten Aemilius Papinianus, der wie Julia Domna aus Syrien stammte und außerdem mit ihr verwandt war. Papinianus war ein angesehener Jurist, der siebenunddreißig Bücher Quaestiones und beinahe neunzehn Bücher Responsa verfasst hatte. Caracalla hatte kein einziges gelesen, dafür jedoch Papinianus’ Kommentar zur Lex Iulia de adulteriis coercendis überflogen, dem Strafgesetz von Kaiser Augustus bezüglich Ehebruchs. Eine äußerst unangenehme Lektüre.
Als Papinianus aufstand und das Wort ergriff, fiel Caracalla seine Gemahlin Plautilla ein, die sich auf Lipari, einer kleinen Insel nördlich von Sizilien, im Exil befand. Eine ebenso peinliche wie lästige Frau, die er vor sechs Jahren, als ihr Vater Plautianus wegen Verrats zum Tode verurteilt worden war, in die Verbannung geschickt hatte – was ihm ganz und gar nicht schwergefallen war. Als Severus den Plan gefasst hatte, Rom zu verlassen und einen Feldzug in Africa zu führen, hatte er Caracalla mit ihr verheiratet, um sich den Prätorianerpräfekten Plautianus gewogen zu machen. Plautilla war eine schöne Frau, doch Caracalla verabscheute sie trotzdem. Sie war dumm, ungebildet und verschwenderisch, und ihr unaufhörliches Gejammere war wie das Summen einer lästigen, hartnäckigen Mücke. Dass Caracallas Herz schon damals Julia Domna gehört und diese den Titel der Kaiserin nur ungern mit der hübscheren, jüngeren Frau geteilt hatte, war der Ehe alles andere als förderlich gewesen. Da Severus sie für die Vergehen ihres Vaters nicht hatte bestrafen wollen, war sie der Hinrichtung knapp entgangen und lediglich in die Verbannung geschickt worden. Caracalla war zwar froh, dass er sie vom Hals hatte, doch am liebsten hätte er sie ganz aus der Welt geschafft.
Papinianus stritt sich gerade mit seinem Assessor Domitius Ulpianus, einem weiteren hochangesehenen Rechtsgelehrten, über irgendeine juristische Spitzfindigkeit. Caracalla verstand kein Wort. Weshalb verschwendete er hier seine Zeit, anstatt sich beim Wagenrennen oder im Gymnasium oder bei Julia im Bett zu üben? Und das alles nur wegen einer Sklavin, die gerade einmal eine Handvoll Münzen wert war. Die beiden Männer waren zwar irgendwelche lokalen Würdenträger, aber das Ganze war trotzdem unerträglich.
»Das reicht«, sagte Caracalla. Ulpianus verstummte, und alle drehten sich zu ihm um. »Wir haben uns das Für und Wider angehört und begriffen, dass beide Seiten sowohl im Recht als auch im Unrecht sind. Daher bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass ich diese Sklavin zum doppelten Marktpreis kaufen werde. Der Erlös soll zwischen den beiden Bittstellern geteilt und die Sklavin meinem persönlichen Haushalt zugeführt werden. Fall erledigt. Und jetzt raus mit euch.«
Die Bittsteller sahen sich verwirrt an, dann verneigten und entfernten sie sich. Es war ein gütiges Urteil, bei dem keiner der beiden an Vermögen oder Ansehen Schaden nahm. Dennoch schien keiner glücklich darüber, die hübsche junge Frau ziehen lassen zu müssen. Auch Julia Domna und Geta funkelten ihn böse an. Die Kaiserin war zweifellos eifersüchtig auf die rothaarige Sklavin, und Caracalla würde ihr später unter vier Augen beteuern müssen, dass er sie nicht aus Eigennutz gekauft hatte, sondern um den Streit zu schlichten – auch wenn er wohl früher oder später das Lager mit seiner Neuerwerbung teilen würde.
Geta dagegen war wütend, weil er eigenmächtig und über seinen Kopf hinweg entschieden hatte. Nun, wenn ihr Vater nicht mehr unter ihnen weilte, würde er sich daran gewöhnen müssen.
»Der Nächste«, befahl Geta dem Wachposten an der Tür mit lauter Stimme, um zu zeigen, dass auch er etwas zu sagen hatte.
Überrascht sah Caracalla, dass Marcus Oclatinius Adventus hereingeführt wurde. Der alte Mann mit dem grauen, schütteren Haar, Herr über alle Spione des Imperiums, näherte sich der kaiserlichen Familie ohne Scheu und verneigte sich tief.
»Oclatinius? Wenn es um Staatsgeschäfte geht, würde ich es vorziehen, diese bei einer Privataudienz zu besprechen«, sagte Caracalla.
»Selbstverständlich, Augustus«, sagte Oclatinius. »Doch bei der Angelegenheit, deretwegen ich zu Euch komme, handelt es sich um eine Meinungsverschiedenheit zwischen Euch und Eurem Halbbruder, die der Vermittlung bedarf. Da schien es mir am besten, sie bei dieser Gelegenheit in Anwesenheit der beiden Augusti sowie dieser hervorragenden Rechtsgelehrten zur Sprache zu bringen.«
Papinianus und Ulpianus quittierten das Kompliment mit einem leichten Nicken.
Caracallas Neugier war geweckt. Er sah zu Geta hinüber, der unbehaglich auf seinem Thron herumrutschte.
»Liebster Bruder, wollen wir uns nicht anhören, was Oclatinius zu sagen hat? Du hast doch sicher nichts vor mir zu verbergen, oder?«
»Nichts, was wichtig genug wäre, um dich damit zu belästigen, kaiserlicher Bruder«, sagte Geta.
»Na fein. Sprich, Oclatinius.«
»Habt Dank, Augustus. Wie ihr alle wisst, stehen gewisse Personen in meinen Diensten, die bei den Aufträgen, die sie zum Wohle des Imperiums ausführen, gelegentlich auf eher ungewöhnliche Mittel und Wege zurückgreifen.«
»Auch als Spione bekannt«, sagte Geta tonlos.
»Gewiss, Augustus, außerdem als Exploratores, Speculatores und Frumentarii – oder als Arcani.«
Als Oclatinius das letzte Wort aussprach, legte sich eine eisige Stille über den Raum. Die Wachen standen noch strammer und bewegungsloser da. Die Rechtsgelehrten und die anderen Berater erbleichten.
Geta beugte sich vor. »Von den Arcani sprecht Ihr allerdings nur selten.«
»So ist es«, sagte Oclatinius. »Und das mit guten Gründen.«
»Zum Beispiel?«
»Zum Wohle der Kaiser und des Imperiums handeln sie im Verborgenen. Man weiß, dass es sie gibt, aber nicht, wie ihre Befehle lauten und auf welche Weise sie sie ausführen. Sie sind unheimlich und geheimnisvoll und man spricht nur im Flüsterton von ihnen. Wer es wagt, über ihre Taten zu berichten, riskiert unwillkommenen nächtlichen Besuch. Und doch sitzt einer meiner besten Männer in dieser Stadt in einer Gefängniszelle.«
»Einer deiner besten Männer? Und er hat sich einfach so festnehmen lassen wie ein gemeiner Verbrecher?«, fragte Geta.
»Um nicht das Blut seiner römischen Kameraden vergießen zu müssen, hat er sich den Prätorianern ergeben, die sich jedoch trotzdem sofort daranmachten, ihn ohne vorherige Gerichtsverhandlung hinzurichten. Ich konnte dies im letzten Augenblick verhindern.«
»Und welches Vergehen legt man ihm zur Last?«, fragte Caracalla.
»Als er mit einem Kameraden nach Beendigung eines geheimen Auftrags aus Kaledonien zurückkehrte, gab es wohl ein Missverständnis darüber, wessen Befehl sie unterstellt sind.«
Jetzt dämmerte es Caracalla. »Wie heißen diese Männer?«, fragte er Oclatinius.
»Lucius Atius und Gaius Sergius Silus.«
Caracalla seufzte. Die beiden schon wieder. Aber was druckste Oclatinius so herum, immerhin hatte Caracalla persönlich diesen Einsatz befohlen. Doch genau da lag das Problem: Er hatte ohne Septimius Severus’ Einverständnis gehandelt. Mit der Gesundheit des Kaisers ging es bergab, und bald würde über seine Nachfolge entschieden werden, da konnte es sich Caracalla nicht leisten, den Alten zu verärgern. Er würde sich bei Oclatinius später unter vier Augen bedanken, doch er tat gut daran, sich in der Öffentlichkeit aus dieser Angelegenheit herauszuhalten.
»Und wie lautete ihr Befehl?«
»Der Barbarenfürst, der uns so große Schwierigkeiten gemacht hat, war nach der Schlacht um Cilurnum noch auf freiem Fuß. Es wäre unklug gewesen, ihn einfach ziehen zu lassen, weshalb ich Silus und Atius den Auftrag gegeben habe, ihn aufzuspüren und zu töten.«
Mehrere der Anwesenden holten vor Überraschung hörbar Luft, und selbst Julia Domna, die sich sonst kaum für militärische Angelegenheiten interessierte, spitzte die Ohren.
»Verstehe«, sagte Caracalla. »Ist es ihnen gelungen, ihren Auftrag erfolgreich auszuführen?«
»Ja«, sagte Oclatinius.
Caracalla lächelte insgeheim. Dieser verdammte Barbar würde ihm nicht mehr länger das Leben schwer machen. Der Krieg im Norden war so gut wie beendet. Nun galt es nur noch, einige wenige Widerstandsnester auszuheben.
»Und wer hat dir die Vollmacht für einen solchen Befehl gegeben?«, fragte Geta mit eisiger Stimme.
»Ich habe den Auftrag nach eigenem Ermessen erteilt. Als ich meinen Posten angetreten habe, wurden mir weitreichende Freiheiten bei der Erfüllung meiner Aufgaben zugesichert. Wenn Ihr der Meinung seid, dass ich zu eigenmächtig gehandelt habe, räume ich selbstverständlich meinen Platz für einen fähigeren Mann.«
»Das wird nicht nötig sein«, sagte Julia etwas zu hastig. Das Netzwerk aus Spionen und Informanten, das Oclatinius aufgebaut hatte, war so verwickelt und weitverzweigt, dass es außer ihm keiner vollends durchschaute. Trotz der gewaltigen Macht, die es ihm verlieh, war Oclatinius’ Treue zu den drei Augusti unverbrüchlich. Auch wenn er persönlich Caracalla den Vorzug gab, achtete er sorgfältig darauf, dies in der Öffentlichkeit nicht zu zeigen. Sollte ein anderer seinen Posten übernehmen, wäre das empfindliche Gleichgewicht der Kräfte zwischen den beiden Brüdern und ihrem Vater in Gefahr. Im schlimmsten Fall würde sich jemand, der nicht zur kaiserlichen Familie gehörte, dazu verleiten lassen, selbst die Hand nach dem Purpurmantel des Kaisers auszustrecken. Außerdem wusste niemand, welche Geheimnisse Oclatinius in seinem Herzen verwahrte. Ob der Alte von ihm und Julia Domna wusste, vermochte Caracalla nicht zu sagen, doch er ging davon aus.
»Und weshalb sitzen sie jetzt im Gefängnis?«, fragte Caracalla und bemühte sich, nicht zu neugierig zu klingen.
»Man hat sie beschuldigt, sich unerlaubt von der Truppe entfernt oder einen nicht genehmigten Befehl ausgeführt zu haben. Wie die Anklage im Einzelnen lautet, entzieht sich meiner Kenntnis, doch beide waren kurz davor, hingerichtet zu werden.«
»Wer hat sie festnehmen lassen?«
»Das war Kaiser Geta, werte Augusti.«
Caracalla wandte sich zu seinem Mitkaiser um. »Eine merkwürdige Art, sich für ihre Dienste zu bedanken, mein Bruder.«
Geta wurde rot. »Man hat mich lediglich von der bevorstehenden Rückkehr zweier Deserteure nach Eboracum unterrichtet und mich gebeten, ihre Verhaftung und Verurteilung zu genehmigen. Weder habe ich weitere Einzelheiten erfahren noch erschienen mir die beiden Männer wichtig genug, um mich näher mit ihnen zu befassen. Ich habe die Genehmigung erteilt und mich dann drängenderen Problemen gewidmet.«
Das kam Caracalla nicht besonders glaubwürdig vor. Weshalb hätte man ihn überhaupt mit einer solchen Angelegenheit behelligen sollen? Geta hatte insofern recht, dass es unter seiner Würde war, sich mit zwei Deserteuren zu beschäftigen. Und weshalb waren die beiden nicht von gewöhnlichen Legionären, sondern von Prätorianern festgenommen worden? Plötzlich begriff Caracalla: Geta hatte erkannt, dass Caracalla den Befehl zur Ermordung des Barbarenhäuptlings gegeben hatte, und um ihn zu ärgern und zu verhindern, dass er im Erfolgsfall den Ruhm dafür einheimste, hatte sein Bruder die beiden Spione verhaften lassen und ihre Hinrichtung angeordnet.
»Vielen Dank, dass du uns auf diese Angelegenheit aufmerksam gemacht hast, Oclatinius. Offenbar haben wir es hier mit einem Missverständnis zu tun. Lasst die Männer frei. Sie haben sich weder der Desertion noch der Befehlsverweigerung schuldig gemacht, dementsprechende Anklagen werden sofort fallengelassen.«
»Ja, Augustus«, sagte Oclatinius, verneigte sich und machte Anstalten, sich zu entfernen.
»Warte!«, sagte Geta.
Oclatinius drehte sich wieder um und hob eine Augenbraue. »Augustus?«, fragte er in einem beinahe unverschämten Tonfall.
»Der Befehl, diese Männer zu verhaften, stammt direkt von mir. Mein Bruder ist nicht befugt, ihn zu widerrufen.«
Caracalla knirschte mit den Zähnen und wollte zu einer scharfen Erwiderung ansetzen, doch Oclatinius kam ihm zuvor. »Augustus, Ihr wollt doch nicht etwa jetzt, wo sich das Ganze als Missverständnis herausgestellt hat, weiter an Eurem Befehl festhalten?«
»Alter Ränkeschmied, du hast mir gar nichts zu sagen.« Geta hob die Stimme. »Wenn diese Männer nicht auf den offiziellen Befehl ihrer unmittelbaren Vorgesetzten gehandelt haben, sind sie streng genommen Deserteure. Sie zu begnadigen, nachdem ich zuerst ihre Hinrichtung befohlen habe, wäre ein Zeichen von Schwäche.«
»Du bist ja auch schwach«, murmelte Caracalla, bevor er sich die Bemerkung verkneifen konnte.
Geta sprang auf und richtete einen zitternden Finger auf seinen Bruder. Er war bleich vor unverhohlener Wut. »Nur weil du der Ältere bist und im Krieg gekämpft hast, kannst du mir noch lange keine Befehle erteilen«, rief er. »Ich bin ebenso Augustus und Kaiser wie du. Niemand hat das Recht, meine Anordnungen infrage zu stellen.«
»Niemand?«, fragte eine leise, aber durchdringende Stimme vom Eingang her. Aller Augen lösten sich vom wütenden Geta und richteten sich auf denjenigen, dem die Stimme gehörte: Lucius Septimius Severus – siegreich hervorgegangen aus dem zweiten Vierkaiserjahr, Bezwinger der Parther und Britannier – betrat mit unsicheren Schritten und auf den kräftigen Arm eines Sklaven gestützt den Audienzsaal. »Habe ich da richtig gehört, mein Sohn? Niemand hat das Recht, deine Anordnungen infrage zu stellen?«
»Vater«, sagte Geta, »Ihr habt mich zum Augustus ernannt. Es war nie die Rede davon, dass ich noch Eurem Befehl unterstehe.«
»Du bist kein Narr, also hör auf, dich wie einer zu benehmen. Papinianus, du wirst dafür sorgen, dass Oclatinius’ Männer freigelassen und von allen Anklagen freigesprochen werden, so wie es Antoninus befohlen hat. Oclatinius, Julia, zu mir. Ich wünsche über den Stand der Dinge unterrichtet zu werden.«
Julia Domna eilte an die Seite ihres greisen Gemahls. Oclatinius, der trotz seines eigenen fortgeschrittenen Alters noch über die nötige Körperkraft verfügte, nahm den Platz des Sklaven ein und stützte den Kaiser auf der anderen Seite. Gemeinsam verließen sie den Audienzsaal, in dem nun bis auf den schweren, pfeifenden Atem des Alten Totenstille herrschte.
Sobald sie sich entfernt hatten, wirbelte Geta zu Caracalla herum. »Das ist alles dein Werk!«, schrie er mit vor Entrüstung hoher, quietschender Stimme. »Du hast das alles geplant, um mich zu demütigen.«
Caracalla schüttelte mit trauriger Miene den Kopf. »Das hast du schon selbst ganz gut hinbekommen. Ulpianus, keine weiteren Bittsteller mehr. Schick die, die noch draußen warten, nach Hause. Sie sollen morgen wiederkommen.« Er stand auf, ging aus der Tür und ließ den vor Entrüstung sprachlosen Geta einfach vor seinen peinlich berührten Höflingen stehen.
Ein zerknirschter Prätorianer öffnete ihre Zelle. Pontius Calvinus war nirgendwo zu sehen. Silus half Atius zum Medicus, der ihm vorsichtig die Tunika auszog und dem unablässig Wehklagenden einen festen Verband um den Leib wickelte.
»Bei Christi Wunden, welche Schmerzen«, zischte er durch die zusammengebissenen Zähne.
»Hör auf zu jammern wie ein kleines Kind«, sagte Silus und rieb seine Schulter.
»Leck mich«, sagte Atius, verlor jedoch kein weiteres Wort, bis der Medicus den Verband fertig angelegt und festgesteckt hatte.
»Soll ich auch einen Blick auf dich werfen?«, fragte der Medicus.
»Ich habe schon Schlimmeres überlebt«, sagte Silus.
»Na schön. Dann verschwindet aus meinem Valetudinarium, ich habe auch noch andere Patienten. Ich verordne sechs Wochen Ruhe und zweimal täglich ein Gebet an Akeso.«
»Ich bete zu niemandem außer Christus«, sagte Atius.
»Und wie versteht der sich so auf die Heilkunst?«, fragte der Medicus.
»Er hatte so seine Momente.«
»Na los, melden wir uns bei Oclatinius«, sagte Silus und hielt Atius die Hand hin. Mit dem Verband konnte sich dieser etwas freier bewegen, und er schaffte es ohne Silus’ Hilfe bis vor Oclatinius’ Amtsstube. Sie wurden unverzüglich eingelassen, doch sobald der Alte sie vor sich hatte, strafte er sie mit demonstrativer Nichtachtung. Schließlich blickte er auf. Die beiden Spione standen stramm, wobei Atius aufgrund seiner schmerzenden Rippen das Gesicht verzog.
Schließlich sah Oclatinius sie finster an und bedeutete ihnen, Platz zu nehmen. Atius ließ sich auf der Sitzbank nieder und atmete erleichtert aus.
Oclatinius seufzte. »Schon wieder Ärger mit euch.«
»Das ist ja wohl kaum unsere Schuld«, sagte Atius trotzig. »Herr«, fügte er widerwillig hinzu.
»Wir wurden verhaftet, weil wir Eure Befehle befolgt haben«, ergänzte Silus.
»Das weiß ich wohl«, sagte Oclatinius. »Doch es war von vornherein kein offizieller Auftrag und deshalb mit einem gewissen Risiko verbunden.«
»Wir hätte das Ganze beinahe mit unserem Leben bezahlt. Was sollte diese Scheiße überhaupt? Herr?«
»Das braucht euch nicht zu interessieren. Ihr wart Gegenstand einer politischen Auseinandersetzung auf höchster Ebene, mehr müsst ihr nicht wissen.«
»Wenn sich die Großen streiten, sterben die Kleinen. Hatte es mit einer Meinungsverschiedenheit zwischen Geta und Caracalla zu tun?«, fragte Silus.
»Ihr seid frei, einigermaßen unbeschadet, und die Anklage gegen euch wurde fallengelassen. Also hör auf zu jammern wie ein kleines Kind.«
Atius kicherte leise, als sich Silus nun seinen eigenen dummen Spruch anhören musste.
»Findest du das lustig, Soldat?«
»Nein, Herr. Was geschieht, wenn Severus stirbt, Herr? Wird es einen Bürgerkrieg geben?«
»Erstens: Vom Tod eines Kaisers zu sprechen, ist in manchen Ohren Hochverrat. Zweitens kommt es so, wie es kommt. Und drittens solltet ihr eure Nasen nicht in Angelegenheiten stecken, die euch nichts angehen. Aber genug davon. Trotz des unfreundlichen Willkommens weiß mindestens ein Augustus eure Arbeit zu schätzen. Und ich auch. Silus, du hast dich als würdiges Mitglied der Arcani erwiesen. Ich befördere dich zum Zenturio und weise dich offiziell der Sechsten Legion als Speculator zu. Selbstverständlich bist du weiterhin mir unterstellt.«
»Vielen Dank, Herr.« Silus dachte unwillkürlich daran, wie stolz Velua auf ihn gewesen wäre und wie sehr sie sich gefreut hätte – über die Beförderung und selbstverständlich auch über die damit einhergehende Solderhöhung. Dies stimmte ihn so wehmütig, dass ihm Tränen in die Augen traten. Falls Oclatinius es bemerkte, ließ er sich nichts anmerken.
»Atius, du hast dir ebenfalls einen Platz im Bund der Arcani verdient. Was sagst du dazu?«
»Es wäre mir selbstverständlich eine große Ehre.«
»Dann auf die Knie«, befahl Oclatinius.
Atius stand auf und kniete sich hin, wobei er vor Schmerz die Zähne zusammenbiss. Oclatinius nahm ein Messer vom Schreibtisch, stach sich genau wie unlängst bei Silus’ Einweihung in den Daumen, schmierte das Blut auf Atius’ Stirn und legte die Hände auf seinen Kopf. Dann sprach er einmal mehr die feierlichen Worte: »Diana, Göttin der Jagd, nimm diesen Mann, Lucius Atius, in den geheimen Bund der Arcani auf. Sorge dafür, dass er dem Tod und der ewigen Verdammnis anheimfällt, sollte er unser Vertrauen jemals missbrauchen. Lucius Atius, willst du dem Kaiser und dem Bund der Arcani die Treue schwören?«
»Ich schwöre dem Kaiser und dem Bund der Arcani die Treue«, sagte Atius.
Oclatinius wischte sich den Daumen an einem Lappen ab und setzte sich wieder. Als er aufblickte, bemerkte er, dass Atius immer noch kniete.
»Steh auf, Soldat.«
Atius richtete sich langsam auf. »War das alles?«
»Das war alles«, bestätigte Silus.
»Ich fühle mich nicht anders als vorher.«
Oclatinius stieß ein bellendes Lachen aus. »Das war ja auch kein magisches Ritual, sondern lediglich die Bestätigung dafür, dass du einen neuen Beruf hast. Einen Beruf, in dem allerdings absoluter Gehorsam erwartet wird, wenn du keines grässlichen Todes sterben willst.«
Atius senkte den Kopf. »Wie lautet unser nächster Auftrag, Herr?«
»Soldaten, ihr werdet in die Stadt gehen, euch eine Unterkunft nehmen, euch betrinken, mit einer Frau vergnügen und euch um eure Genesung kümmern.«
»Herr?«
»Der Winter naht. Heuer wird es keine weiteren Feldzüge geben. Der Kaiser ist krank, aber noch Herr der Lage, weshalb seine Söhne sich vorerst nicht öffentlich bekriegen werden. Momentan gibt es also nichts für euch zu tun. Seht zu, dass ihr wieder zu eurer alten Stärke findet, euch regelmäßig in euren Fertigkeiten übt und Ärger aus dem Weg geht. Sobald ich euch brauche, lasse ich euch rufen. Und jetzt raus mit euch.«
Silus und Atius salutierten und verließen Oclatinius’ Amtsstube.
»Was jetzt?«, fragte Atius, als sie auf der Straße standen. Soldaten marschierten vorbei, Händler schleppten ihre Waren zum Markt, Sklaven erledigten Besorgungen, kaiserliche Boten trugen mit Schriftrollen gefüllte Taschen.
Silus kratzte an einem Flohbiss auf seinem Kopf herum. »Bier?«
Zweites Kapitel
Silus – der die Aufregung des Schlachtgetümmels und das Auskundschaften des feindlichen Gebiets gewöhnt war und dessen Leben in letzter Zeit so viele schicksalhafte Wendungen genommen hatte – langweilte sich allein bei der Vorstellung, den Winter in Eboracum verbringen zu müssen, zu Tode. Er saß vor einem außergewöhnlich bitteren Bier und einer außergewöhnlich zähen Fleischpastete und wartete auf Atius, obwohl er sich keine Hoffnungen machte, dass ihm sein Freund die Langeweile vertreiben würde. Früher oder später würde er auf Menenia zu sprechen kommen, auf ihre Schönheit und – wenn Silus besonders viel Pech hatte – wie gut sie im Bett war. Silus seufzte. Er nahm einen Bissen von der Pastete, dann fischte er einen Knorpel aus dem Mund und warf ihn Issa zu. Die kleine alte Hündin, die in Menenias Obhut gewesen war, bis Silus ein Quartier in Eboracum gefunden und sie wieder zu sich genommen hatte, schlang ihn ohne zu kauen hinunter. Im Laufe der Jahre hatte sie viele Zähne verloren, und die, die noch übrig waren, wackelten und waren mit Zahnstein überzogen, sodass er das Tier nur noch mit kleinen Fleischbissen füttern konnte.
Die Tür öffnete sich und kalte, mit ein paar Regentropfen vermischte Luft wehte herein. Atius betrat die Taverne und schloss behutsam die Tür hinter sich. Mehrere Gäste blickten auf, kehrten aber schnell wieder zu ihren Unterhaltungen oder Glücksspielen zurück. Atius schlenderte auf Silus’ Tisch zu, zog sich einen Stuhl heran und ließ sich mit einem langen Seufzen darauf fallen.
Silus bestellte bei dem Sklaven, der sie bediente, ein Bier und schob es Atius hin. Dieser hob den Krug und trank das Bier in so großen Schlucken, dass es zu beiden Seiten an seinen Wangen herunterlief. Schließlich stellte er den leeren Krug ab, wischte sich mit dem Ärmel über das Gesicht und bestellte das nächste. Silus wartete geduldig, bis er auch das hinuntergestürzt hatte.
»Hast du jetzt genug und erzählst mir, was los ist?«, fragte Silus.
»Es ist aus und vorbei. Sie will mich nicht mehr sehen«, sagte Atius.
»Warum?«
»Es ist ihr nicht recht, dass ich noch andere vögle, sagt sie.«
»Ja, so sind die Frauen manchmal.«
»Und sie hat einen anderen kennengelernt«, sagte Atius.
»Ach, Scheiße. Tut mir leid, Atius.«
Atius nickte.
»Weißt du, wer es ist?«
»Nein, das wollte sie mir nicht verraten.«
»Das ist wahrscheinlich auch besser so, wenn ihr seine Eier lieb sind. Und das ist vermutlich der Fall.«
Atius sah ihn böse an.
»Entschuldige. Mit so etwas scherzt man nicht.«
»Silus, was soll ich denn jetzt machen? Ich liebe sie doch so sehr.«
»Das weiß ich nicht, mein Freund. Aber ich weiß, dass man auch den größten Verlust überstehen kann.«
Atius packte die Hand seines Freundes. »Aber das will ich nicht.«
»Es liegt nicht immer in unserer Macht.«
Atius starrte in seinen leeren Krug. »Ich werde mich betrinken.«
Silus fragte sich, ob er seinem Freund diesen Vorsatz nicht ausreden sollte. Was sollte das bringen? Andererseits fiel ihm auch keine bessere Lösung ein. Er rief den Sklaven mit einem Fingerschnippen zu sich. »Zwei Bier«, sagte er.
»Und zwei für mich«, sagte Atius.
Es war eine stockdunkle Nacht. Der Himmel war bedeckt, der kalte Wind wehte ihnen den eisigen Regen wie stechende Nadeln ins Gesicht, als sie volltrunken nach Hause wankten. Das Bier wärmte sie von innen, und sie sangen Arm in Arm ein derbes Marschlied über eine Hure aus Deva. Die Straßen waren still und dunkel, kein Licht drang durch die geschlossenen Fensterläden. Im Vergleich zu Rom war Eboracum eine winzige Stadt, aber trotzdem größer, als es die beiden betrunkenen Freunde gewohnt waren. Das Bier und die Finsternis taten ihr Übriges, und schon bald hatten sie sich rettungslos verlaufen. Sie blieben an einer Kreuzung stehen und lehnten sich gegen eine Hauswand, um nicht umzufallen.
»Legen wir uns doch einfach hier hin«, schlug Atius vor.
Silus war nicht ganz so betrunken wie sein Kamerad. »Dann erfrieren wir.«
»Kalt ist mir nicht«, sagte Atius. »Aber ich muss mich etwas ausruhen.«
»Wenn wir jetzt in unser Quartier zurückkehren, werden wir morgen ganz bestimmt froh darüber sein.«
»Na gut. Wo lang?«
»Keine Ahnung. Fragen wir die da drüben.«
Eine Gruppe von fünf Männern hatte sich in einer überdachten Tempelnische um ein qualmendes Kohlebecken versammelt. Als sich Silus und Atius näherten, bemerkten sie, dass es sich wohl um Veteranen handelte. Einem fehlte eine Hand, ein anderer stützte sich auf eine Krücke, alle trugen Narben. Offenbar hatten sie ihre fünfundzwanzig Jahre bereits abgeleistet, wirkten weder zu dick noch unterernährt. Sie drehten sich zu Silus und Atius um und sahen sie mit finsteren Mienen an. Silus beschlich eine düstere Vorahnung. Atius dagegen schien sich der Gefahr nicht bewusst. Er schwankte auf die Männer zu, die Hand zum Gruß erhoben.
»Guten Abend, Freunde.«
»Was soll an diesem Abend gut sein?«, fragte einer der Männer. »Es pisst und arschkalt ist es auch.«
»Mit etwas Bier im Bauch geht’s schon«, sagte Atius.
»Für unsere Soldatenrente können wir uns nicht viel Bier kaufen. Und viel Arbeit gibt es für verkrüppelte Veteranen auch nicht.«
»Dann geben wir euch ein As für Bier«, sagte Silus. »Wir sind auf dem Heimweg und haben uns verlaufen.«
»Viel Bier bekommt man für ein As ja nicht, oder?«
»Gehört ihr zur Legion?«, wollte ein anderer wissen. »Oder seid ihr bei den Hilfstruppen?«
»Ja«, sagte Atius. »Beides, würde ich sagen.«
»Dann könnt ihr ruhig etwas mehr für eure Kameraden springen lassen.«
»Wir suchen die Baracke der Legio VI. Könnt ihr uns die ungefähre Richtung zeigen?«
Der erste Mann hielt seine verbliebene Hand auf und wartete. Seufzend holte Silus seinen Geldbeutel aus der Tunika, öffnete das Zugband und fischte zwei Asse heraus. Der Mann nahm sie entgegen und warf dem Beutel einen begehrlichen Blick zu.
»Sieht ja ganz gut gefüllt aus.«
Er hatte recht. Auch nach ihrem abendlichen Besäufnis war Silus’ Geldbeutel noch randvoll. Er hatte soeben seinen Sold erhalten und mit Überraschung festgestellt, dass ein Zenturio bei der Legion deutlich besser verdiente als ein Kundschafter bei den Hilfstruppen.
»Lass das bleiben«, sagte Silus, der zusehends nüchtern wurde.
»Was soll ich bleiben lassen, Kamerad? Wir haben dich nur um etwas Hilfe gebeten, von Waffenbruder zu Waffenbruder.«
»Ihr bekommt vier Asse, wenn ihr uns den Weg zu unserem Quartier weist.«
»Das ist aber ziemlich geizig, oder?«
»Stimmt. Aber ich bin auch nicht für meine Großzügigkeit bekannt.«
»He, Freunde«, sagte Atius, dem langsam dämmerte, dass die Männer doch nicht so freundlich waren wie erhofft. »Warum zeigt ihr uns nicht einfach den Weg? Dann verpissen wir uns und niemandem passiert etwas.«
Die Männer sahen sich an und lachten. Auf den ersten Blick mochten Silus und Atius vielleicht den Eindruck machen, als wäre mit ihnen nicht zu spaßen, aber sie waren auch sternhagelvoll, durchnässt wie Kanalratten und hoffnungslos in der Unterzahl.
»Das ist eure letzte Chance«, sagte Atius.
»Oder was?«, fragte der Einhändige.
Bevor Silus etwas sagen konnte, hatte Atius das Messer gezogen. Der große Keltiberer trat vor und rammte die Klinge tief in den Hals des Einhändigen. Der umklammerte mit den immer schwächer werdenden Fingern der verbliebenen Hand den Griff des Messers und versuchte, es herauszuziehen. Schließlich gaben seine Beine unter ihm nach, und er ging zu Boden.
Einen Augenblick lang herrschte Stille, dann gingen die anderen Veteranen gleichzeitig mit Gebrüll zum Angriff über. Es waren keine gewöhnlichen, unbedarften Straßenräuber – diese Männer hatten in derselben Einheit exerziert und gekämpft und wussten, welche Vorteile die Zusammenarbeit im Gefecht hatte.
Obwohl Atius’ Rippenbruch inzwischen verheilt war, hatten er und Silus durch das genossene Bier merklich an Gefechtsfähigkeit eingebüßt. Dafür waren sie jünger, besser in Form und hatten einige schmutzige Tricks auf Lager. Die beiden setzten dem ersten Ansturm kaum Widerstand entgegen, wichen Faustschlägen und Tritten aus und achteten besonders darauf, nicht in eine Umklammerung zu geraten. Vor Silus’ Augen drehte sich alles, sodass seine Hiebe nur selten ihr Ziel fanden. Seine Arme waren schwer wie Blei.
Ein Schlag gegen den Kopf ließ ihn zurücktaumeln, dafür gelang es ihm, die Finger in die Kehle des Angreifers zu stoßen, woraufhin dieser würgend in die Knie ging. Der zweite Angreifer schlug mit einer Keule zu. Die Waffe streifte Silus’ Schläfe, er strauchelte und fiel auf den Rücken.
Atius war ähnlich wechselnder Erfolg beschieden. Sein Messer steckte noch im Hals des Mannes, weshalb er mit Händen und Füßen kämpfen musste. Zwar konnte er seine beiden Gegner allein durch seine enorme Körperkraft auf Distanz halten, nennenswerte Fortschritte zu ihrer Überwältigung machte er aber nicht.
Der Mann mit der Keule beugte sich vor und riss Silus den Geldbeutel vom Gürtel. »Ich hab das Geld, Kameraden«, rief er. »Machen wir, dass wir wegkommen.«
Die drei, die noch standen, ließen ihre beiden Freunde einfach auf dem Boden liegen und humpelten in die Dunkelheit davon. Nachdem ihm Atius aufgeholfen hatte, berührte Silus vorsichtig die Stelle an seinem Kopf, die Bekanntschaft mit der Keule gemacht hatte, und spürte eine eigroße Beule unter seinen Fingern wachsen.
»Scheiße«, sagte er. Er blickte an sich herab auf den Gürtel, an dem soeben noch sein prallgefüllter Geldbeutel gehangen hatte. »Scheiße.«
Aulus Triarius Rufinus ist ein furchtbarer Langweiler, dachte Titurius auf dem Heimweg von der Senatssitzung. Als Konsul des Vorjahres hatte er natürlich das Recht, angehört zu werden, aber war es denn zu viel verlangt, sich ein interessanteres Thema auszusuchen als die bevorstehende Kohlernte? Seufzend zog Titurius die Toga etwas fester um sich. Zwei stämmige Sklaven gingen vor ihm her und stießen jeden zur Seite, der nicht freiwillig oder nicht schnell genug Platz machte. Ein alter, einbeiniger Bettler hob mit flehendem Blick die Hände. Ein Sklave schubste ihn so grob aus dem Weg, dass er mit dem Gesicht voraus in den Kot und Unrat fiel, der nach dem starken Regen in Bächen über die Straße und in die Kanalisation lief. Der Dreck spritzte hoch, als der Krüppel mit einem Schrei darin landete, und braune Tröpfchen fielen auf Titurius’ blütenweiße Toga. Er blieb abrupt stehen.
»Nun sieh dir das an!«
Der muskelbepackte Sklave drehte sich um. Sein Mund formte sich zu einem O, als er den Schmutz auf der Kleidung seines Herrn sah.
»Bitte verzeiht, Herr«, sagte er, eilte zu Titurius und versuchte, den Dreck abzuwischen, wobei er ihn aber nur noch weiter auf der Toga verteilte.
»Halt, hör auf, du machst es ja nur noch schlimmer«, sagte Titurius. »Los, nach Hause.«
»Ja, Herr. Aus dem Weg, Gesindel«, rief der Sklave und stieß die Umstehenden erneut beiseite. Diesmal jedoch achtete er peinlich genau darauf, dass sie nicht in der Nähe seines verärgerten Herrn landeten.
Schließlich ließen sie das Forum hinter sich und gingen den Esquilin hinauf, wo sich Titurius’ Domizil befand – ein bezauberndes Anwesen und hoch genug gelegen, um dem schlimmsten Gestank und Lärm der Stadt zu entgehen, doch selbstverständlich fand man in Rom nirgendwo die Ruhe und den Frieden eines Landsitzes. Der Pförtner stand stramm, als sie sich dem Haupttor näherten.
»Herr, Ihr habt Besuch.«
Titurius seufzte. Was hatte er auch anderes erwartet? Seine Klienten standen schon vor Sonnenaufgang Schlange in der Hoffnung, ihm ihre Bitten – um einen Gefallen, um die Schlichtung eines Streits oder einfach nur um Geld – vorbringen zu können. Die meisten trollten sich am späten Vormittag wieder, und gegenwärtig standen nur noch ein paar außergewöhnlich hartnäckige Bittsteller vor dem Tor und versuchten, Titurius’ Aufmerksamkeit zu erregen.
»Er wartet im Atrium.«
Das klang schon interessanter: Unwichtige Gäste ließen seine Sklaven gar nicht erst ins Haus.
»Wer denn?«
»Cassius Dio, Herr.«
»Hmm.« Unglücklicherweise verfügten Stadthäuser wie dieses nur über einen Ein- und Ausgang, der über das Vestibulum und das Atrium führte. Die Toga zu wechseln, bevor er seinen Gast begrüßte, kam also nicht infrage. Er klopfte so gut wie möglich den Schmutz davon ab und strich die Falten glatt, bevor er das Haus betrat.
Der Boden des Atriums war mit einem kunstvollen Mosaik bedeckt, auf dem Satyrn zusammen mit verschiedenen Kreaturen des Waldes durch üppiges Grün tollten. Zwei Marmorbänke standen vor den Wänden zu beiden Seiten der Tür, die in das eigentliche Domus führte. Auf einer davon saß ein Mann mit grauem Bart und ebensolchem Haar, dessen Ansatz sich bereits deutlich von der breiten Stirn entfernt hatte. Er stand auf, sobald Titurius den Raum betrat. Als dieser sich näherte, um ihn zu begrüßen, konnte er nicht umhin zu bemerken, wie makellos sauber die Toga seines Gastes war. Cassius Dio warf einen Blick auf Titurius’ schmutziges Gewand, und ein Ausdruck höhnischer Verachtung huschte über sein Gesicht, ging aber schnell in ein Lächeln über, als er Titurius die Hand reichte.
»Guten Tag, Dio«, sagte Titurius.
»Dir auch, Titurius.«
»Hast du genug Zeit mitgebracht, um einen Falerner mit mir zu genießen? Der Händler meines Vertrauens hat mir einen ganz besonderen Jahrgang besorgt, der dich sicher fröhlich stimmen wird.«
»Und ich bin ja eine echte Frohnatur, wie du weißt«, sagte Dio mit todernster Miene.
»Leider ist es etwas zu kühl, um im Peristyl zu sitzen. Sollen wir uns ins Tablinum zurückziehen? Ich lasse eine Kleinigkeit servieren.«
»Das wäre ganz wunderbar.«
Titurius führte Dio in den Speisesaal und bot ihm ein Sofa an. Titurius legte sich auf das Sofa daneben und stützte sich auf dem Ellenbogen auf. Beide nahmen Weinkelche von dem sie bedienenden Sklaven entgegen. Dio ließ die rote Flüssigkeit im Kelch kreisen, schnupperte daran, nahm einen Schluck, ließ ihn mit großer Geste im Mund herumwandern und schuckte ihn schließlich hinunter.
»Durchaus zufriedenstellend«, sagte er.
Titurius hob den Kopf und nahm selbst einen Schluck. Tatsächlich hatte der Wein ein Vermögen gekostet und war erstklassig, aber er durfte nicht erwarten, dass Dio dies würdigte.
»Ich habe dich heute nicht im Senat gesehen«, bemerkte Titurius. Sie unterhielten sich auf Griechisch, der Sprache der Oberschicht des Imperiums und insbesondere derjenigen, die sich für besonders gebildet und kultiviert hielten.
»Rufinus hat heute gesprochen, nicht wahr? Was hatte er denn diesmal auf dem Herzen? Die galoppierenden Spargelpreise?«
»Nein, diesmal ging es um die Versorgungsengpässe beim Kohl.«
Dios Mundwinkel zuckten leicht nach oben. »Und da fragst du dich, warum ich nicht anwesend war? Außerdem habe ich gearbeitet.«
»An deiner Geschichte des Imperiums? Bei welcher Ära bist du denn inzwischen angelangt?«
Dios Miene hellte sich schlagartig auf. Den Senator auf seine Leidenschaft und sein Lebenswerk anzusprechen, hob zuverlässig seine Stimmung. »Meine Arbeit wird unvollendet bleiben. Wenn ich die Gegenwart erreicht habe, werde ich bis zu meinem Tod niederschreiben, was um mich herum geschieht. Ich bin bereits dabei, für ein zukünftiges Buch Material über den Feldzug des Kaisers in Britannien zusammenzutragen. Gleichzeitig schreibe ich am vierzigsten Buch, darin geht es um Crassus’ desaströse Niederlage gegen die Parther und die wachsende Kluft zwischen Pompeius und Caesar.«
»Womit der Bruderkrieg seinen Anfang genommen hat.«
»Wären doch alle Kriege Roms so brüderlich gewesen.«
Kinderlachen und Protestschreie drangen an ihre Ohren, dann platzte ein kleines Mädchen, verfolgt von einem älteren Jungen, in das Triclinium. Das Mädchen kreischte, der Junge rief ihr zu, stehenzubleiben, weil er ein Geschenk für sie habe. Sobald sie ihren Vater und seinen togatragenden Gast erblickten, verstummten sie sofort und blieben wie angewurzelt stehen. Der Junge versteckte hastig etwas hinter seinem Rücken.
Titurius musste sich ein Lächeln verkneifen. »Was ist hier los, Kinder?«, fragte er mit strenger Miene und ernstem Ton.
Die beiden Kinder – aufgrund des tiefschwarzen Haares und der dicken dunklen Augenbrauen eindeutig als Geschwister zu erkennen – sahen sich schuldbewusst an, sagten aber nichts.
»Tituria, was treibt ihr da?«
»Nichts, Vater«, sagte das Mädchen.
»Quintus, was hast du da hinter deinem Rücken?«, fragte Titurius.
Zögerlich nahm der Junge die Hände nach vorne, in denen er eine dicke, mit Warzen übersäte Kröte hielt. Tituria trat angewidert einen Schritt zurück.
»Quintus …«, fing Titurius an, doch da quakte die Kröte und zappelte mit den kräftigen Beinen. Quintus rang einen Augenblick mit dem Tier, dann entglitt es ihm, sprang auf den Boden und hüpfte auf Tituria zu.
Das Mädchen kreischte, lief zu ihrem Vater und sprang auf seinen Schoß.
»Bei allen Göttern!«, rief Titurius. »Quintus, du fängst jetzt sofort diese Kreatur wieder ein und wirfst sie ins Peristyl.« Trotz der Wut in seiner Stimme nahm er seine vor Angst schluchzende Tochter fest in die Arme. »Pssst, schon gut. Ich lasse nicht zu, dass dir etwas passiert.«
Quintus jagte der Amphibie eine Weile lang quer durch den Raum hinterher, bevor er sie wieder eingefangen hatte.
»Tut mir leid, Vater«, sagte er keuchend und mit rotem Kopf.
»Raus mit dir, Junge. Und schick deine Mutter zu mir.«
Quintus verneigte sich vor seinem Vater und dessen Gast und eilte davon. Kurz darauf erschien eine dicke Frau in mittleren Jahren mit weiß geschminktem Gesicht und einer dichten, in der Mitte gescheitelten Perücke mit fingerdicken Locken – eine Haartracht, die Julia Domna in Rom in Mode gebracht hatte.
»Autronia, wir haben einen Senator zu Gast. Würdest du bitte das Kind irgendwohin bringen, wo wir sein Geheul nicht mehr hören müssen? Und wenn du schon dabei bist, kannst du dir eine angemessene Strafe für deinen Sohn ausdenken.«
»Ja, Titurius. Cassius Dio, ich muss mich für das Betragen meiner Kinder entschuldigen.«
Dio machte eine beschwichtigende Handbewegung. »Aber woher denn. Ich habe doch selbst Kinder und weiß, welche Belastung sie darstellen können.«
Autronia griff nach Tituria und zog sie mit sich. Titurius drückte noch kurz ihre Hand. Tituria drehte sich um und lächelte ihn durch die Tränen an. Er wartete, bis Frau und Tochter verschwunden waren, dann wandte er sich wieder Dio zu. »Senator, bitte verzeih diese unzumutbare Belästigung. Darf ich nach dem Grund deines Besuchs fragen?«
Dio nahm einen großen Schluck, dann ließ er den Wein im Becher kreisen und starrte hinein, als könne er daraus die Zukunft lesen.
»Rom hatte schon einmal drei Herrscher zur selben Zeit.«
Titurius nickte. »Selbstverständlich. Mein Grammaticus und mein Rhetor haben mich seinerzeit Caesar, Tacitus und Sueton lesen lassen. Und ich habe sogar gelegentlich aufgepasst.«
»Dass Caesar und Pompeius zu Rivalen wurden, war unausweichlich. Beide waren zu stolz, um die Macht zu teilen. Dieses erste Triumvirat wurde nur durch Crassus zusammengehalten, den ältesten und reichsten der drei Regenten. Bis er in die Gefangenschaft der Parther geriet, die sein Gold eingeschmolzen und ihm in den Rachen geschüttet haben.«
»Nimmst du diese Geschichte etwa für bare Münze? Gab es da nicht Zweifel an ihrer Wahrheit?«
»Selbstverständlich ist sie wahr«, blaffte Dio. »Ich konnte sie durch eigene Nachforschungen bestätigen.«
»Interessant«, sagte Titurius. »Sprich weiter.«
»Aber zurück zur Sache: Stell dir Caesar und Pompeius als zwei Elefantenbullen vor – mächtige, wütende Bestien. Crassus ist die starke Eisenkette an ihrem Joch, die sie aneinanderfesselt, obwohl sie daran in verschiedene Richtungen ziehen. Und was passiert, wenn die Kette reißt?«
»Die beiden Bullen sind frei«, sagte Titurius.
»Richtig. Und dann?«
»Nun, ich bin kein Fachmann, aber wahrscheinlich werden die beiden Bullen miteinander kämpfen.«
»Und wehe allen, die im Weg stehen, wenn sie aufeinander losgehen.«
Titurius nickte und nahm einen Schluck Wein.
»Wo wärst du lieber, wenn die beiden Elefantenbullen rasend vor Wut aufeinander zustürmen – auf dem Boden zwischen ihnen? Oder auf dem Rücken des stärkeren Elefanten?«
»Worauf willst du hinaus?«, fragte Titurius, dem ein erstes leichtes Unbehagen den Magen flattern ließ.
Dio sah sich um und vergewisserte sich, dass niemand in Hörweite war. »Severus ist die starke Kette, die seine Söhne zusammenhält.«, sagte er mit gesenkter Stimme.
»Ich würde Geta nicht gerade als Elefantenbullen bezeichnen«, sagte Titurius verächtlich. »Eher als Kälbchen. Und Antoninus – als Eber.«
»Titurius«, sagte Dio ernst. »Mit Severus geht es zu Ende. Wenn man den Berichten aus Britannien trauen kann, wird er den Frühling nicht mehr erleben. Wer weiß, bei der Ewigkeit, die es dauert, bis Kunde aus diesem barbarischen Land Rom erreicht, kann es genauso gut sein, dass er schon tot ist. Die Zeit wird knapp. Bald wird die Kette reißen, und du musst dich entscheiden, auf welchem Elefanten du reiten willst.«
»Senator«, sagte Titurius. »Unsere Treue gilt Rom. Gegenwärtig hat Rom drei gleichberechtigte Kaiser. Von Severus’ Tod zu sprechen grenzt an Verrat – möge er noch viele Jahre unter uns weilen und dann seinen Platz unter den Göttern einnehmen. Und danach hat Rom immer noch zwei Herrscher, und es ist unsere Pflicht, ihnen beiden gleichermaßen zu Diensten zu sein.«
»Sei nicht naiv«, zischte Dio. »Es wird einen Konflikt geben, ob offen oder nicht. Unsere Treue gilt Rom, da hast du völlig recht. Aus diesem Grund müssen wir uns auf die Seite dessen schlagen, der dem Imperium mehr Beständigkeit verspricht. Der ein gebildeter Mann ist und auf seine Berater hört, anstatt sich aus Ruhmsucht Hals über Kopf in die Schlacht zu stürzen.«
»Der am leichtesten zu beeinflussen ist, willst du damit wohl sagen. Ich ahne, welche Seite du meinst.«
»Es hat sich eine Gruppe von aufrechten Männern zusammengefunden, Patrioten, die nur das Beste für Rom im Sinn haben. Ich möchte, dass du einige davon kennenlernst und sie anhörst. Mehr verlange ich nicht von dir.«
»Ich werde darüber nachdenken.«
»Rom ist nicht mehr so mächtig wie einst, Titurius. Unsere Legionen fegen unsere Feinde nicht länger so mühelos hinweg wie zu Zeiten von Augustus, Vespasian oder Trajan. Selbst der große Marcus Aurelius konnte die Barbarenflut nur mit Mühe bekämpfen. Sicher, unser glorreicher Kaiser Septimius Severus hat den Niedergang aufgehalten und die Geschicke des Imperiums gewendet, doch dürfen wir das auch von Caracalla erwarten? Glaubt ihr wirklich, dass er ebenso tüchtig, besonnen und weise ist wie sein Vater?«
Titurius machte eine zweifelnde Miene. In seinen Augen wirkte keiner der beiden jüngeren Mitkaiser besonders vielversprechend. Ihr lockerer Lebenswandel voller Prügeleien, Trinkgelage, Glücksspielen und Wagenrennen war in Rom legendär. Viele vermuteten, dass ihr Vater nur deshalb zu einem Feldzug in ein weit entferntes Land aufgebrochen war, um sie zu beschäftigen. Das Imperium sah sich ständigen Gefahren ausgesetzt, da hatte Dio ganz recht. Der zunehmende Druck durch die Markomannen an den Grenzen des Reiches war nicht zu unterschätzen und bereitete denen, die das wahre Ausmaß der Bedrohung kannten, so manche schlaflose Nacht. Auch mit der Staatskasse stand es nicht zum Besten. Das Imperium, das sich jahrhundertelang durch Eroberungen und Plünderungen finanziert hatte, musste sich nun selbst versorgen, was ihm nur mit Mühe gelang. Der wirtschaftliche Niedergang bedrohte es von innen ebenso wie die Barbaren von außen. In den nächsten Jahrzehnten würde nur eine starke Führung den Zusammenbruch verhindern können. Caracalla und Geta waren noch jung, einer von beiden würde Rom durch die bevorstehende Krise führen – vorausgesetzt, er überlebte Krieg, Krankheiten und Attentate. Vielleicht hatte Dio recht. Womöglich war es an der Zeit, sich für einen Kapitän zu entscheiden, der das Schiff sicher durch den dräuenden Sturm lenken konnte.
»Eine wirklich sehr interessante Unterhaltung, Senator«, sagte Titurius und stand auf. »Du bist sicher sehr beschäftigt, und wie du bestimmt bemerkt hast, muss ich dringend den Schmutz der Stadt von meiner Kleidung und meiner Person loswerden. Setzen wir unser Gespräch doch ein andermal fort. Gerne auch im Beisein deiner Bekannten, wenn du das wünschst.«
Dio stand auf. »Man wird dir Bescheid geben«, sagte er mit finsterer Miene und ging.
Titurius schlenderte nachdenklich in das Peristyl. Im spätwinterlichen Wetter erschien ihm der von Säulen umgebene Garten trostlos. Es hatte wieder angefangen zu regnen. Am gegenüberliegenden Ende des Gartens neckte Tituria unter dem Schutz des vorspringenden Daches ein Kätzchen mit einem Stück Schnur. Das kleine Tier schlug spielerisch mit den Pfoten danach und Tituria kicherte. Er sah zum Himmel auf. Ein Sturm war im Anzug. Ein Schauer durchfuhr ihn, was aber nicht an der Kälte lag.
Drittes Kapitel
Warme Luft stieg vom beheizten Fußboden auf. In der Ecke stand eine mit heißem Wasser und Rosenblüten gefüllte Schüssel und erfüllte das Schlafzimmer mit unaufdringlichem Wohlgeruch. Julia Domnas zuverlässige und vertrauenswürdige Lyraspielerin entlockte den Schafsdarmsaiten mit einem Elfenbeinplektrum eine langsame Weise, deren eingängigen Rhythmus sie auf dem fellbespannten Korpus mitschlug.
Julia saß rittlings auf Caracalla, hob den Körper bei jedem Auftakt und ließ ihn mit jedem Schlag energisch auf ihn herabsinken. Caracalla beobachtete sie durch halb geschlossene Augen. Seine Hände ruhten auf ihren über seinen Hüften gespreizten Schenkeln. Das Zusammenspiel von Musik, Duft und den lustvollen Bewegungen seiner Stiefmutter war überaus reizvoll.
Das Tempo nahm zu, die Schläge wurden schneller. Julia hielt den Takt. Sie hatte die Lippen geöffnet, die Finger in seinem drahtigen Brusthaar vergraben und gab jedes Mal, wenn sie ausatmete, ein leises Stöhnen von sich. Die Musik wurde noch lauter und rasender, dann kam er in ihr zum Höhepunkt, und sie warf sich ihm mit einem Schrei entgegen.
Dann lagen sie still wie die Statuen da, während die Töne der vibrierenden Saiten langsam verklangen. Julia beugte sich vor und küsste den immer noch schwer atmenden Caracalla leidenschaftlich auf den Mund. Er schlang die Arme um sie, hielt sie fest, dann rollte er sie zur Seite. Die Musikerin stimmte ein fröhliches, doch von komplizierten Harmonien bestimmtes Lied an.
Caracalla küsste Julia auf die Lippen, die Wange und den Hals. Er ließ die Fingerspitzen über ihren Rücken wandern. Sie seufzte und schmiegte sich an ihn, legte den Kopf auf seinen sich hebenden und senkenden Brustkorb und schloss die Augen.
Caracalla sah zur Lyraspielerin hinüber. Diese errötete unter seinem Blick und widmete sich ganz ihrem Instrument. Ihre Hände fingen so sehr an zu zittern, dass sie einen falschen Ton anschlug.
»Du spielst ganz wunderbar«, sagte er.
Ihre Hände erstarrten auf den Saiten, die Musik verklang. »Vielen Dank, Herr.«
»Eine phrygische Weise, nicht wahr? Aristoxenische Enharmonik?«
»Das weiß ich nicht, Herr. Meine Mutter hat mir das Lied beigebracht, als ich noch ein kleines Mädchen war.«
Darüber war Caracalla insgeheim erleichtert. Er hatte darauf gehofft, dass die Sklavin keine klassische musikalische Ausbildung genossen hatte. Er selbst interessierte sich zwar für Musik, hatte aber nicht die Geduld, sich eingehender mit ihrer Theorie zu beschäftigen. Seine Bemerkung, die auf undeutlichen Erinnerungen an den Musikunterricht seiner Kindheit beruhte, hatte in erster Linie darauf abgezielt, die kultivierte Julia zu beeindrucken. Falls ihm das gelungen war, ließ sie es sich nicht anmerken. Sie lag mit geschlossenen Augen da, als wäre sie kurz davor, einzuschlafen.
»Reich mir die Lyra.«
Er setzte sich auf und ließ Julia dabei von sich herunter und auf das Bett gleiten. Sie rollte sich auf den Rücken und beobachtete neugierig, wie ihm die Sklavin das Instrument reichte. Die Arme und die Stimmwirbel waren aus Bronze, über die Kalbshaut, die auf die untere Hälfte der Arme gespannt war, verliefen sieben Saiten von gleicher Länge, aber unterschiedlicher Dicke. Er machte sich mit großer Geste daran, die Saiten zu stimmen, obwohl ihm bewusst war, dass er damit höchstwahrscheinlich keine Verbesserung erzielte. Dann fing er an zu spielen.
Es klang selbst seinem eigenen Empfinden nach nicht besonders gekonnt, doch Julia lauschte mit einem nachsichtigen Lächeln auf den Lippen. Für den Lehrer, der ihm das Lied beigebracht hatte, waren die mangelnden Fertigkeiten seines Schülers eine ständige Enttäuschung gewesen. Julia dagegen klatschte erfreut in die Hände, sobald er geendet hatte.
Caracalla machte eine bescheidene Geste und gab das Instrument zurück. »Lassen wir diejenige weiterspielen, die auch wirklich etwas davon versteht«, sagte er.
Unter den Klängen einer weitaus melodischeren Weise gesellte sich Caracalla wieder zu Julia auf das Bett. Er legte sich auf den Rücken, und die neben ihm auf einen Ellenbogen gestützte Julia fuhr mit dem Zeigefinger über seine Brust.
»Wie lange hat er noch?«, fragte Caracalla.
Julia seufzte. »Er war stets so stark wie ein Elefant, aber auch ein Elefant ist nicht unsterblich. Irgendwann ist auch seine Zeit gekommen.«
»Was für ein Jammer. Ich weiß noch, dass er zwei kräftige Männer niederringen, einen erfahrenen Gladiator besiegen und zehn Meilen laufen konnte, ohne ins Schwitzen zu kommen.«
»Er war stets in bester körperlicher Verfassung«, sagte Julia. Caracalla sah sie beleidigt an, und sie hatte zumindest den Anstand, betreten den Blick zu senken.
»Bald ist es so weit«, sagte sie.
»Bist du dir sicher?«
Sie nickte. »Seine Leiden verschlimmern sich stetig. Gicht und Arthritis bereiten ihm höllische Schmerzen, und jeder Atemzug ist eine gewaltige Anstrengung.«
»Und doch will er nicht gehen.«
»Antoninus«, sagte Julia tadelnd. »Das klingt ja gerade so, als wolltest du, dass er stirbt.«
»Selbstverständlich nicht. Nicht im Ernst. Ich liebe meinen Vater und bin stolz auf ihn. Aber er ist nur noch ein Schatten seiner selbst, eine leere Hülle. Ist das überhaupt noch mein Vater?«
»Aber natürlich!«, rief Julia empört.
»Ja, ja. Aber er muss doch unsäglich leiden, körperlich wie geistig. Wäre es nicht ein Akt der Gnade, ihm den Weg zu Serapis etwas zu erleichtern?«
Julia atmete hörbar ein und sah zur Lyraspielerin hinüber, die starr geradeaus blickte und verzweifelt den Anschein zu erwecken versuchte, dass sie nichts gehört hatte. So vertrauenswürdig die Sklavin auch sein mochte – es war unvorsichtig, in Gegenwart anderer von Kaisermord zu sprechen.
Caracalla bemerkte ebenfalls, dass er damit zu weit gegangen war, und legte besänftigend eine Hand auf Julias Arm. »Bitte entschuldige, so war das selbstverständlich nicht gemeint. Es ist eben nicht leicht, ihn so zu sehen.«
»Und darauf zu warten, dass du an der Reihe bist, die Herrschaft zu übernehmen?«
»Julia …«