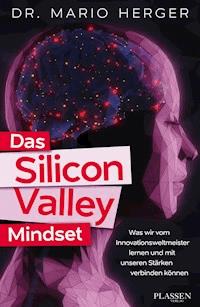
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Plassen Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
"Das Silicon-Valley-Mindset" beschreibt, warum Menschen und Unternehmen im Silicon Valley so extrem innovativ sind und derzeit unternehmerisch dem Rest der Welt überlegen erscheinen. Das Silicon Valley ist eine schier unerschöpfliche Quelle an Innovationen, die immensen Einfluss auf Wirtschaft und Gesellschaft weltweit ausüben. Viele Europäer betrachten diese Entwicklungen skeptisch und werden darin von Medien und deren Experten bestärkt, die sich in Panikmache üben und vorwiegend die Gefahren und Risiken herausstreichen. Dr. Mario Herger rückt die Dinge zurecht und zeigt: Die Innovationsmentalität aus dem Silicon Valley ist erlernbar. Anhand von Interviews und Schritt-für-Schritt-Anleitungen zeigt dieses Insider-Buch, wie die Silicon-Valley-Mentalität mit den eigenen Stärken kombiniert werden kann.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 506
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Copyright der deutschen Ausgabe 2016:© Börsenmedien AG, Kulmbach
Coverfotos & Innenteilfotos: Getty Images, iStock
Covergestaltung: Holger Schiffelholz
Layout und Satz: Sabrina Slopek
Herstellung: Daniela Freitag
Lektorat: Karla Seedorf
ISBN 978-3-86470-354-6eISBN 978-3-86470-369-0
Alle Rechte der Verbreitung, auch die des auszugsweisen Nachdrucks,der fotomechanischen Wiedergabe und der Verwertung durch Datenbankenoder ähnliche Einrichtungen vorbehalten.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in derDeutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Datensind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.
Postfach 1449 • 95305 Kulmbach
Tel: +49 9221 9051-0 • Fax: +49 9221 9051-4444
E-Mail: [email protected]/plassenverlag
Für Sebastian, Gabriel und Darian.
Einleitung
Warum dieses Buch?
Wie das Buch gegliedert ist
1. Warum das Silicon Valley wichtig ist für Europa
Von Weltverbesserern und Sendungsbewusstsein
Innovation
2. Die Ursprünge
Am Anfang stand Kalifornien
Die Grundbausteine
Der Beginn
Der Boom
3. Das Ökosystem
Start-ups und Gründer
Venture-Kapital
Akzeleratoren und Inkubatoren
Universitäten
Industrien
Militär und Weltraum
4. Das Verhaltenssystem
Einstellung und Vertrauen
Die Wahl der Worte
Denken und Handeln
Innovation
Einrichtungen und Unternehmen
Außensicht
Spielen mit und innerhalb von Regeln
Werkzeuge
Systemprobleme
5. Ausgewählte Trends
Automobilindustrie
Fintech
Internet of Things
Raumfahrt
Bildung und Ausbildung
Interfaces
Bausektor
Transport
6. Die Rolle Europas
Innovationszivilisation
Europäer im Silicon Valley
Politik und Gesellschaft
Nachwort
Anhang
Liste der Interviewten
Stellen Sie sich vor, es ist das Jahr 2006. Sie haben eine Million Euro als Investmentkapital zur Verfügung und suchen nach einem vielversprechenden Start-up. Sie kommen in Kontakt mit einem jungen Gründer und der pitcht ihnen seine Idee. „Ich habe eine Plattform, über die sich die Mitglieder Textbotschaften in der Länge von 140 Zeichen senden können. Investieren Sie doch darin!“
Ihre erste Reaktion darauf wäre sicherlich: „Was für eine dämliche Idee!“ Im besten Fall würde diese Start-up-Idee die Abende mit Freunden um eine nette Anekdote bereichern, wenn über den Stand der Start-up-Szene geplaudert wird. So würden die meisten von uns reagieren – nicht aber die Leute im Silicon Valley. Dort konnte dieser junge Gründer eine ganze Menge Geld einsammeln. Sehr viel Geld sogar.
Sie werden gleich erraten haben, um welches Start-up es sich dabei handelt: Twitter. Und diese vermeintlich so dumme Idee hat sich nicht nur als tragfähige Technologie für ein öffentlich gelistetes Unternehmen mit einem aktuellen Börsenwert von 20 Milliarden Dollar erwiesen, sondern übt auch Einfluss auf Gesellschaft und Politik aus, nicht zuletzt zu sehen am Arabischen Frühling.
Warum aber reagieren die Investoren im Silicon Valley so ganz anders als in Deutschland, Österreich oder der Schweiz? Und was macht Start-up-Gründer dort so mutig, solche Ideen öffentlich vorzubringen und zu erwarten, dass sie ernsthaft diskutiert werden?
Wie sich herausstellt, liegen wir mit unserer Einschätzung, was eine gute oder miese Idee ist, ziemlich oft daneben. Eine Idee selbst kostet nichts. Jemand muss mit ihr etwas machen und sie umsetzen. Nur dann beginnt sie, wertvoll zu werden. Ideen werden besser, indem man sie mit anderen diskutiert und verwirklicht. Ideen werden nicht aufgebraucht, sondern wachsen und werden optimiert, wenn man sie mit anderen teilt. Wenn man sie mit anderen bespricht, stößt man auf immer neue Fragestellungen und Ideen.
An Ideen mangelt es normalerweise gar nicht, aber am zweiten Teil, nämlich der Umsetzung. Wie Ideen entstehen und wie sie umgesetzt werden, erweist sich als delikater Prozess, der an vielen Stellen die falsche Richtung einschlagen kann. Wenn aber alles gut geht, kann das zu Innovationen führen, die den Lauf der Dinge und unsere Sicht auf die Welt für immer verändern.
Warum dieses Buch?
Eine Weltregion, die sich geografisch auf einen sehr kleinen Raum konzentriert, hat sich in den letzten Jahrzehnten als besonders erfolgreich in der Generierung und Umsetzung innovativer Ideen hervorgetan. Das Silicon Valley ist aber weniger ein geografisch begrenzter Raum als ein Mindset, eine Mentalität, eine Geisteshaltung zum Leben und zu den Dingen, die vom Optimismus, vom Glauben an die Problemlösekraft der Menschen und vom Glauben an das Gute in ihnen lebt.
Dieses Buch handelt davon – vom Silicon-Valley-Mindset.
Von Unternehmen aus dem Silicon Valley geschaffene Produkte, Dienstleistungen und Plattformen beeinflussen die ganze Welt. Viele Innovationen haben zweifelsohne positive Auswirkungen für viele, andere haben die Existenzgrundlagen alteingesessener Industrien vernichtet und neue Industriezweige etabliert.
Wie machen die Menschen und Unternehmen aus dem Silicon Valley das? Was sind die geheimen Zutaten, wie lautet die magische Formel? Ist das einfach großes Glück oder steckt mehr dahinter? Und wenn ja, was genau? Ist das übertragbar? Kann das gelernt werden?
Die üblichen Berichte über das Silicon Valley verzerren das öffentliche Bild. Artikel und Bücher werden zumeist von Nichtansässigen geschrieben, die für kurze Zeit hierher kommen, manchmal für mehrere Monate mitsamt Familie. In den seltensten Fällen arbeiten sie selbst in einem der Sektoren, meist sind sie außenstehende Beobachter. Kaum einer von ihnen hat je selbst unternehmerische Erfahrung gesammelt. Um das Buch zu verkaufen oder den Berichten zu vielen Klicks zu verhelfen, behilft man sich mit großen Namen, die man interviewt. So vermittelt man den Daheimgebliebenen, dass nur Ausnahmepersönlichkeiten wie Steve Jobs, Elon Musk oder Mark Zuckerberg Erfolg haben und dass das für die Normalsterblichen in Europa somit ohnehin nicht replizierbar ist. Aber diese Herangehensweise kratzt nur an der Oberfläche, erfasst das Wesen des Erfolges verständlicherweise nur unzureichend und bietet keine Lösung für Europa und europäische Gründer, außer dem Ruf nach staatlichen Eingriffen und Regulierungen, um sich vor den Giganten aus dem mächtigsten Tal der Welt zu schützen.
In einer Studie, in der Teilnehmer entweder zehn Eigenschaften eines Superhelden oder zehn Eigenschaften von Superman benennen sollten, meldeten sich diejenigen, die Eigenschaften der Superhelden beschrieben, danach beinahe doppelt so häufig für freiwillige Aufgaben als die, die Superman selbst beschrieben. Drei Monate später nahmen die Teilnehmer der ersten Gruppe sogar viermal häufiger an freiwilligen Aktivitäten teil. 1 Das lässt sich damit erklären, dass wir, wenn wir an die Eigenschaften von Superhelden denken, solche wählen, mit denen wir uns selbst identifizieren können. Bei Superman gelingt uns das nicht. Wenn Medien nun über diese Überflieger, diese Overachiever, aus dem Silicon Valley berichten, dann fällt es uns schwer, daraus Lehren zu ziehen und uns mit ihnen zu identifizieren.
Sich vor allem auf die Erfolgsstorys und Ausnahmepersönlichkeiten zu konzentrieren genügt nicht, weil selbst die erfolgreichsten unter den Gründern nie geradlinig Erfolg hatten, sondern deren Wege mit vielen Umwegen und Misserfolgen gepflastert waren und sind. Elon Musk war bereits zweimal fast pleite, einmal davon mit Tesla, in das er nochmals sein letztes Geld steckte. Und wenn der vierte Raketenstart bei SpaceX ebenso gescheitert wäre wie die drei zuvor, gäbe es SpaceX heute nicht mehr. 2
Entrepreneuren fällt es schwer, mit Nicht-Entrepreneuren von ihren ständigen Kämpfen und Zweifeln zu sprechen, weil sie immer diese Klappt-schon-Mentalität vorzeigen müssen. Bei jedem Gespräch mit potenziellen Kunden muss ein Start-up vorgeben, mehr zu haben oder zu können, als es tatsächlich heute liefern kann. Produktentwicklung und Lernen findet statt, sobald ein Kunde gewonnen wurde, weil oft dann erst die notwendigen finanziellen Mittel dafür da sind. Das ist vielen unerfahrenen Entrepreneuren unangenehm und nagt an ihrem Selbstvertrauen. Man fühlt sich als Schwindler, der noch nicht erwischt worden ist.
Das ist auch als Hochstapler-Syndrom (Impostor-Syndrom) bekannt, die Erfordernis, ständig eine optimistische Einstellung auszustrahlen, um Mitarbeiter, Kunden und Investoren bei Laune zu halten, auch wenn es drunter und drüber geht.
Ich wohne seit 2001 im Silicon Valley. Ich bin in Österreich aufgewachsen, habe ein Ingenieurs- und ein Wirtschaftsstudium absolviert und kenne somit beide Welten: die europäische und die spezielle kalifornische Kultur im Silicon Valley. Als selbstständiger Entrepreneur und durch meine Arbeit vor Ort habe ich einen unkonventionelleren und intimeren Zugang zum Silicon Valley als kurzfristige Besucher. Ich kann mich mit Start-up-Gründern und Kreativen in einer vertrauteren Form austauschen, als Outsider das können. Das sich mir dadurch bietende Bild ergibt ein intimes und realistisches Porträt der Menschen im Silicon Valley. Auf den folgenden Seiten werde ich viele Unternehmer vorstellen, unter anderem ein Vater-Tochter-Gespann mit einem Startup für Kinder, eine junge Entrepreneurin, die Volks- und Mittelschülern durch ihre Plattform hilft, Geld für Schulprojekte aufzutreiben, Start-ups aus Deutschland und Österreich, die mit großen Hoffnungen auf den Durchbruch herkommen, oder den deutschen Mitarbeiter einer Online-Lernplattform, der einen Satz sagte, den er sich in Deutschland nie zu sagen traute: Die Arbeit macht ihm Spaß.
Es brauchte mehrere Jahre, bis ich zum ersten Mal verstand, wo ich hier gelandet war. Als ich 2001 ins Valley kam, war ich der typische Klischee-Europäer, der auf die Naivität und geringe intellektuelle Kapazität der Amerikaner herabsah. Zugleich war ich aber auch beeindruckt von der Hilfsbereitschaft, den Wertvorstellungen und Leistungen, für die Amerikaner bekannt sind. Trotzdem benahm ich mich wie ein Arschloch. Nie zufrieden, immer negativ, Europa als überlegen ansehend. Bis eine Kollegin mir eines Tages an den Kopf warf: „Mario, du gehörst nicht hierher.“ Ich war empört. Wie konnte sie das sagen? Was wusste sie denn schon – sie hatte nicht mal ein Doktortitel wie ich!
Doch dieser eine Satz veranlasste mich nachzudenken und meine Handlungen genauer zu beobachten. Und das ließ mich erkennen, mit welchen Einstellungen Amerikaner aufwachsen und wie sie diese in Verhalten umsetzen. Heute bin ich der Ex-Kollegin dafür ewig dankbar. Deshalb kann ich mitfühlen, wenn ich Europäer hier treffe, die mit derselben Einstellung herkommen und sich damit die Möglichkeit versagen, ihre Stärken mit der Mentalität des Silicon Valley zu verbinden.
Als Silicon-Valley-Neubürger und Neuankömmling durchläuft man vier Phasen:
Phase 1: Oh mein Gott, alle sind so super, nur ich selbst bin ein Arsch.
Phase 2: Naja, nicht alle sind super, es gibt auch Ärsche hier.
Phase 3: Alles im Arsch, ich werde hier nie etwas schaffen.
Phase 4: Egal ob alles im Arsch ist, ich werd’s trotzdem schaffen!
Meine drei Söhne wurden hier geboren, gehen hier zur Schule und wachsen in diesem Umfeld auf. Ich selbst durchlief einen Veränderungsprozess vom besserwisserischen Wiener, dem Formalitäten eingebläut worden waren, zum Evangelisten dieser hier praktizierten Kultur. Gleichzeitig bin ich aber Europäer, dem europäische Werte wichtig sind und dem das Wohl seines Heimatlands und Heimatkontinents am Herzen liegt.
Das möge berücksichtigt werden, wenn ich in diesem Buch vielleicht manchmal zu forsch vorgehe und Europa vielleicht zu schlecht aussehen lasse. Ich bin jedenfalls zu der Überzeugung gelangt, dass man Dinge manchmal sehr direkt ansprechen muss, um die gebotene Dringlichkeit vor Augen zu führen, anstatt durch übervorsichtige Floskeln das Gegenüber zu sehr einzulullen und in trügerischer Sicherheit zu wiegen. Manchmal kann es wirkungsvoller sein, etwas nicht durch die Blume zu sagen.
Nicht alles in Silicon Valley ist durchwegs positiv oder unkritisch zu sehen und nicht jeder hier verkörpert die Silicon-Valley-Mentalität. Diese Erkenntnis ist weder neu noch fehlt es an Menschen, die genüsslich darauf hinweisen und sich mit ihrer kritischen Stimme wenn nicht ihren Lebensunterhalt verdienen, so doch ihren Status als Intellektueller erarbeiten. Europäer gefallen sich darin, zuerst mal auf die Risiken, Gefahren und das Übel hinzuweisen, ohne eigene Vorschläge zu machen. Das ist nicht das Ziel dieses Buches. Ob man mit kritischer oder positiv eingestellter Sichtweise als intelligenter wahrgenommen wird, werden wir noch in einem späteren Kapitel untersuchen. Mein aus dem Silicon Valley gelernter Ansatz besteht darin, zuerst mal das Gute im Menschen und die positiven Möglichkeiten neuer Technologien und Methoden zu sehen. Zu den Problemen kommt man noch früh genug.
Weil Status und Formalitäten, die auf einen Rang hinweisen, Innovation behindern können, werde ich in diesem Buch konsequent das verfolgen, was ich bereits seit Jahren bei Kontakten mit Europäern mache: Ich duze jedermann und -frau ohne Ansehen von Rang und Status. Das hat nichts mit Respektlosigkeit zu tun, sondern erlaubt, den Status quo hinterfragen zu dürfen, egal ob mein Gesprächspartner eine Vorstandsvorsitzende, ein Minister oder eine Professorin ist. Was zählt, sind nicht vergangene Leistungen, sondern was wir hier und jetzt gemeinsam für die Menschheit tun können.
Auf diese Weise gewöhne ich dich gleich Schritt für Schritt an die Silicon-Valley-Mentalität und zeige dir auf, wie du selbst diese übernehmen kannst.
Was ich auch von Anfang an klarstellen möchte, ist, dass wir in Europa ganz tolle Sachen machen. Unsere Ausbildungssysteme zählen zu den besten der Welt, unsere Technologien sind großartig, deutsches, österreichisches und schweizerisches Ingenieurwesen sind Weltspitze. Unsere Länder zählen zu den sichersten und schönsten. Wir haben die besten Sozialsysteme und wir leben in einem Komfort und einer Friedenszeit, die noch vor Jahrzehnten undenkbar waren. Unsere politischen Systeme funktionieren, Kunst und Kultur blühen. Nicht alles ist rosig, aber im Vergleich zu anderen Weltregionen geht es uns gut und wir können zu Recht stolz darauf sein. Es muss aber nicht immer so bleiben und Änderungen sind die einzige Konstante im Leben. Deshalb müssen wir aufgeschlossen und neugierig bleiben und hilfreiche Ideen aus anderen Regionen übernehmen beziehungsweise für uns anpassen, um uns für die Zukunft vorzubereiten und unseren Kindern und Kindeskindern ein erfülltes Leben zu ermöglichen.
Dieses Buch soll dich nicht dazu verleiten, dein Land, deine Kultur, deine Gesellschaft verteidigen zu müssen und mir zu sagen, dass die Leute dort auch toll sind. Ich bin da ganz deiner Meinung. Immerhin bin ich selbst Österreicher und wir sind schon perfekt auf die Welt gekommen. Mit meinem Buch will ich dir aufschlüsseln, was ich in den vergangenen Jahren im Silicon Valley von den Leuten dort gelernt habe, und dich einladen, dir das genauer anzusehen und für dich zu entscheiden, was du davon übernehmen könntest. Verbunden mit deinen eigenen Stärken, den Stärken deiner Kultur, deiner Gesellschaft, deiner Fähigkeiten kannst du das Beste aus zwei Welten nehmen und dich dort verbessern, wo du selber meinst, dass es nicht rundläuft.
Wie das Buch gegliedert ist
Dieses Buch ist in gewisser Weise chronologisch aufgebaut. Zuerst erläutere ich dir meine Motivation für dieses Buch und warum das Silicon Valley so wichtig für Europa ist und wir uns damit beschäftigen müssen. Dann sehen wir uns an, was denn das Silicon Valley eigentlich ist und wie es entstanden ist. Was waren die geschichtlichen Wendepunkte, die zu diesem Phänomen führten? Im umfangreichsten Kapitel untersuchen wir eine ganze Reihe scheinbar kleiner Dinge, die Menschen im Silicon Valley machen, die Mentalität, die sie dazu bringt, neuen Ideen gegenüber aufgeschlossen zu sein, und warum manches, das so verrückt klingt, dort Chancen hat durchzukommen und erfolgreich zu werden. Dann werfen wir einen Blick darauf, was Europa heute im Silicon Valley macht, um zu lernen, um Geschäfte zu machen und um am Puls der Zeit zu bleiben. Wir fragen, was europäische Gesellschaften und die Politik übernehmen können, um ganz Europa innovativer und für die Zukunft gerüstet zu machen. Des Weiteren stelle ich Werkzeuge vor, die als Best Practices von Silicon-Valley-Unternehmen erfunden und angewandt werden, um innovativer und kreativer zu arbeiten.
Alle Kapitel sind gespickt mit Interviews, die ich mit fast zwei Dutzend im Silicon Valley lebenden Menschen geführt habe. Die meisten Interviewten sind aus dem deutschsprachigen Raum. Den Interviewten stellte ich dabei immer dieselben fünf Fragen. Woher kommst du? Was ist dein Werdegang? Wie und warum bist du ins Silicon Valley gekommen? Was sind die deiner Meinung nach größten Unterschiede zu Europa? Was kann das Silicon Valley von Europa lernen? Jeder der Interviewten hatte seine eigenen Erfahrungen, aber zusammengenommen ergibt sich doch ein klares Bild. Manche Unterschiede wurden von allen genannt und jeder hatte seine persönlichen Schnurren zu erzählen. In den Porträts versuchte ich, die Sprache und Geschichte der Interviewten möglichst unverfälscht zusammenzufassen.
Ich hoffe, dass da einiges für dich drin ist und du es nachvollziehen und für dich übernehmen kannst.
Fußnoten
1 Leif D. Nelson, Michael I. Norton: From Student to Superhero: Situational Primes Shape Future Helping, in: Journal of Experimental Social Psychology 41 (2005), S. 423-430
2http://www.bloomberg.com/graphics/2015-elon-musk-spacex/
Lebten wir mit der Technologie von vor 100 Jahren, dann wäre ein Drittel meiner Leser gar nicht am Leben. Sie hätten das Alter gar nicht erreicht. Impfungen, medizinische Methoden, Sicherheitsstandards am Arbeitsplatz und andere technologische Fortschritte waren weder erfunden, geschweige denn in dem Ausmaß verbreitet gewesen, wie wir sie heute als selbstverständlich hinnehmen. So manch einer von euch wäre physisch nicht in der Lage, dieses Buch zu lesen, weil er oder sie an Sehbeeinträchtigungen oder anderen das physische Wohlbefinden beeinträchtigenden Krankheiten leiden würde. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich dieses Werk hätte schreiben können, wäre verschwindend gering gewesen. Ich hätte mein jetziges Alter damals nicht erreicht, und selbst wenn, dann wäre ich vermutlich weder nach Kalifornien gekommen noch als Brückenschläger zwischen diesen Welten tätig.
Die Tatsache, dass du dieses Buch auf Papier oder einem elektronischen Gerät lesen kannst, ist einzig und allein dem unermüdlichen Fortschritt zu verdanken, dem viele unermüdlich Neugierige sich verschrieben haben. Innovation, die als Ergebnis von Entdeckungen und Erfindungen der Menschheit zugutekommt, ist nichts Bedrohliches, sondern etwas Notwendiges und Unvermeidbares. Wenn man sie selbst nicht vorantreibt, tun es andere. Anfang des 21. Jahrhunderts sticht vor allem eine Weltregion hervor, in der Innovation zu blühen scheint. Eine Innovation, die nicht lokal beschränkt ist, sondern gerade durch die dort hervorgebrachten Technologien und Methoden andere Teile der Welt überflutet und inspiriert. Ignoriert man das vorsätzlich, bedeutet das häufig das Aus für regionale Industriezweige und Betriebe. Deshalb ist es wichtig, vom Silicon Valley zu lernen.
Reid Hoffman, LinkedIn-CEO und einer der bekanntesten Investoren im Silicon Valley, zitiert aus einer Entwicklungsstudie der Vereinten Nationen, die zum Schluss kommt, dass die Weltwirtschaft in den nächsten 20 Jahren 600 Millionen neue Arbeitsplätze benötigt. Bestehende Unternehmen werden laut Hoffman gerade mal zehn bis 20 Millionen Arbeitsplätze schaffen können, der Rest muss von Startups kommen, diesen äußerst dynamischen, riskanten und innovativen Unternehmen, die oft mit nicht mehr als dem Glauben an sich selbst beginnen. Wie man Start-ups gründet, welche Rahmenbedingungen wir alle schaffen müssen, um sie erfolgreich zu machen, und wie man Innovation vorantreibt, sind Dinge, die wir lernen und lehren müssen.1
Von Weltverbesserern und Sendungsbewusstsein
‚Weltverbesserer’, ‚Weltveränderer’ und ‚Sendungsbewusstsein’ sind deutsche Begriffe, die an subtiler Gemeinheit und Verachtung kaum zu überbieten sind. So nett sie klingen, werden sie nie mit dieser ursprünglichen Bedeutung der Wörter angebracht. Der gelernte Europäer wird das nie als Kompliment auffassen, sondern immer so, wie es von anderen Europäern gemeint ist: Ein Weltverbesser ist ein ahnungsloser Größenwahnsinniger, der irgendwann gehörig auf die Schnauze fallen wird. Dieses Fazit zog Stefan Quandt anlässlich einer Rede zur Verleihung des Herbert-Quandt-Medienpreises im Juni 2015. 2
Er ist damit nicht alleine. Die meisten Artikel und Kolumnen in deutschsprachigen Medien versuchen, das wilde Biest Silicon Valley durch Worte zu zähmen. Einerseits verwendet man die Produkte ebender Firmen, die man so kritisiert, andererseits steht man fassungslos vor dem, was da passiert. Zum zynischen Weltbild des deutschen Feuilletons passen die Philosophie und die Pläne von Silicon-Valley-Firmen wie die Faust aufs Auge. Das kann doch nicht sein, dass eine Firma als Leitbild „Don’t be evil“ stehen hat! Internet überall hinbringen, und das noch dazu gratis, wie es Facebook mit Internet.org oder Google mit dem ballonbasierten Loon-Projekt machen? Ein Kartendienst, der gratis bereitgestellt wird? Das kann doch nur schiefgehen! Oder doch nicht?
Mit Begriffen wie ‚Hybris’, ‚Wundermänner’, ‚Menschenfreunde’, ‚Avantgardisten’, ‚Halbgötter’, ‚Superhelden’ und ‚Cowboy-Masche’ wird allein in den ersten Absätzen eines längeren Beitrags im Manager Magazin vom April 2015 verächtlich herumgeschmissen, im selben Magazin, das drei Monate später BMW als das „deutsche Apple“3 hochlobte. Der Umkehrschluss aus diesem Artikel und Stefan Quandts Rede ist, dass die Verfasser selbst das Gegenteil davon darstellen. Sind sie somit Weltverschlechterer, Menschenfeinde, keine Wundermänner, Nachhinker sowie wahlweise Vollgötter oder keine Götter? Ganz klar wurde mir das nicht.
Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass die Journalisten dieselben Services und Produkte der kritisierten Unternehmen tagtäglich für Beruf und Freizeit verwenden, und das zeigt ihr Hin- und Hergerissensein, wie sie damit umgehen sollen. Nur ja nicht positiv und unkritisch darüber schreiben, das könnte als naiv angesehen werden und den Verfassern als mangelnde Intelligenz ausgelegt werden!
Harvard-Professorin Teresa Amabile hat diese Verhaltensweise in Experimenten untersucht. Sie legte Studenten zwei Buchrezensionen vor. Eine war eher positiv formuliert, die andere kritisch. Anschließend sollten die Studenten die Intelligenz der Rezensenten einschätzen. Die Studenten bewerteten die Intelligenz des Verfassers der kritischen Rezension höher. Was die Studenten nicht wussten: Beide Buchkritiken waren von Amabile selbst verfasst worden. 4 Wer ist nun intelligenter? Ich oder ich?
In Europa kann man sich mit kritischen Aussagen ganze Karrieren aufbauen. Mit Lust hört man wohlformulierter oder einfach nur polemischer Kritik zu und ergötzt sich am Scheitern der Macher. Schadenfreude ist nicht von ungefähr ein urdeutsches Wort, das in anderen Sprachen nicht existiert. Ein Kritiker muss doch klüger sein, immerhin hat er die Risiken und Gefahren erkannt und zeigt auf, dass man nur scheitern kann! In der Theorie und im Nachhinein erweisen sich diese Hinweise oftmals als richtig. Aus der aktuellen Situation heraus ist es mit der vorhandenen Information jedoch oft schwer, die richtige Entscheidung zu treffen. Was im Nachhinein offensichtlich scheint, war es vorher eben nicht. Forscher bezeichnen das als ‚Rückschaufehler’ (englisch: hindsight bias). Einer der Gründe, warum wir diesen Fehler machen, ist die menschliche Tendenz, uns selbst als kompetent zu sehen. Wir registrieren den Rückschaufehler normalerweise nicht als solchen und es bedarf bewusster Anstrengung, ihn zu vermeiden.
Da mehr Versuche, Ideen umzusetzen, scheitern, als dass sie gelingen, ist die Statistik auf der Seite der Kritiker. Die Frage, die sich jeder Einzelne stellen sollte, ist: Wie will ich in Erinnerung bleiben? Als jemand, der stolz darauf sein kann, etwas verhindert zu haben, oder als jemand, der etwas probiert und vielleicht geschafft hat?
Denn letztendlich zählt nicht der Kritiker. Der amerikanische Präsident Theodore Roosevelt wies 1910 in einer Rede an der Pariser Sorbonne-Universität darauf hin, dass die Ehre demjenigen zusteht, der sich in die Arena gewagt und es versucht hat:
„
Nicht der Kritiker zählt; nicht derjenige, der darauf aufmerksam macht, wie der Starke fällt oder wo der, der anpackt, es besser hätte machen können. Die Anerkennung gebührt dem, der tatsächlich in der Arena steht, dessen Gesicht staubig und verschwitzt und voller Blut ist; der sich wacker bemüht; der sich irrt, der wieder und wieder scheitert, weil es kein Bemühen ohne Fehler und Schwächen gibt; aber der sich tatsächlich bemüht, Taten zu vollbringen; der großartige Begeisterung, großartige Hingabe kennt; der seine Kraft auf eine ehrenwerte Sache verwendet; der im besten Falle am Ende den Triumph einer großen Leistung kennt und der, im schlimmsten Falle, sollte er scheitern, zumindest bei einem kühnen Versuch scheitert, sodass sein Platz nie bei den kalten und furchtsamen Seelen ist, die weder Sieg noch Niederlage kennen.“
Warten, bis jemand etwas tut, führt zu nichts. Wer die Eigeninitiative ergreift, dem weht oft ein scharfer Wind entgegen. Man erinnere sich, als SAP-Gründer Hasso Plattner 1998 das Hasso-Plattner-Institut (kurz HPI) in Potsdam gegründet hat. Der Gründer hat für die nächsten 20 Jahre mehr als 200 Millionen Euro für den Betrieb des Instituts versprochen, das die erste und nach wie vor einzige privat finanzierte universitäre Ausbildungsstätte in Deutschland ist. Was in Deutschland die Ausnahme ist, ist in den USA die Regel. Der enge Kontakt mit den Absolventen spült jährlich eine Milliarde Dollar in die Kassen der Stanford University, die damit neue Lehrstühle, Gebäude, Stipendien und Forschungseinrichtungen finanzieren kann.
Hasso Plattners Motivation für die Gründung des HPIs war seine Erkenntnis, dass das massive Wachstum seiner Firma in Deutschland an seine Grenzen gestoßen war. 1998 – im selben Jahr, als ich bei SAP in der Zentrale begann – wuchs das Unternehmen von 12.000 Mitarbeiter auf fast 20.000. Nicht nur war der Absolventenausstoß der deutschsprachigen Universitäten damit am Limit, es fehlte auch an Ausbildungsprofilen, die moderne Wirtschaftsunternehmen wie SAP angesichts des herannahenden Internetzeitalters benötigten.
Die Reaktion auf Plattners Vorstoß war von Entsetzen und Hass geprägt. Wie kann sich ein Privater nur anmaßen, die Aufgaben des Staates zu übernehmen? Der Staat weiß doch sicher besser, welche Ausbildungszweige die Wirtschaft braucht! Und das HPI werde nur schwer vermittelbare Absolventen erzeugen, weil der Lehrplan ausschließlich auf die kurzsichtigen Bedürfnisse von SAP ausgerichtet ist.
Das HPI hat inzwischen alle Kritiker Lügen gestraft. In den letzten Jahren gehörte es wiederholt zu den Top-5-Informatikausbildungsprogrammen deutschsprachiger Universitäten gemäß CHE Uni-Ranking, erhielt mehrere Preise und die Absolventen sind heiß begehrte Fachkräfte. 5
Nur: Nach wie vor hat sich keine weitere private Institution gefunden, die sich auf diese Weise am höheren Ausbildungssystem beteiligt. Während europäische Firmen und die Bevölkerung sich bei der Lösung gesellschaftlicher Probleme vor allem auf den Staat verlassen, wird das in den USA als Aufgabe der Bürger selbst verstanden. Ein Fundraiser, eine Wohltätigkeitsveranstaltung, Spenden an eine Universität oder zu einem guten Zweck sind dort nicht nur üblich, sondern werden auch immer wieder spontan organisiert.
Hasso Plattner, der seinen Wohnsitz auch im Silicon Valley hat, ließ es nicht nur beim HPI bleiben. 2004 finanzierte er mit 35 Millionen Dollar das Hasso-Plattner-Institut für Design, besser bekannt als d.school, in Stanford. Dazu tat er sich mit David Kelley von der bekannten Designfirma IDEO zusammen, der den Lehrplan aufstellte und dort selbst als Maschinenbauprofessor tätig ist.
Dieses grundsätzliche Misstrauen ist ziemlich verständlich in einem Land, das die theoretischen Grundlagen für zwei völlig konträre, von großem Sendungsbewusstsein durchtränkte Ideologien hervorgebracht und in die Praxis umgesetzt hat – mit hinlänglich bekannten negativen Folgen für die gesamte Region und die Welt. Was erwartet man von einem Land, das zwei Weltkriege verloren hat? Da hat man sich mal etwas getraut, etwas riskiert, und zweimal massiv eins auf den Deckel gekriegt. Die Auswirkungen zeigen sich noch Generationen später.
Aufbruchsstimmung darf nur aufkommen, wenn’s um Urlaub, nicht aber, wenn’s um den Sinn des Lebens geht. Eine „Delle ins Universum schlagen“ gilt im ehemaligen Land der Dichter und Denker und der heutigen Ingenieure als etwas Negatives. Wer will schon eine Delle im Blech?
ANDREA LO
Exemplarisch für Privatinitiativen im Silicon Valley ist das Start-up Piggybackr. Andrea Lo, eine junge, in San Francisco geborene Gründerin, startete diese Crowdfunding-Plattform für Kinder, auf der Schüler für ihre Klassenprojekte oder Sportvereine Sponsorengelder sammeln können. Wegen der strengen amerikanischen Online-Datenschutzgesetze für Kinder unter 13 Jahren, die im Children’s Online Privacy Protection Act festgehalten sind, unterliegt der rechtlich abgesicherte Betrieb einer solchen Plattform einem nicht unerheblichen Aufwand. Andrea schaffte es, alle gesetzlichen Bestimmungen zu erfüllen. Ihr Piggybackr ist die einzige Crowdfunding-Plattform für Kinder und Jugendliche. Bis heute haben die jungen Benutzer bereits 1,5 Millionen Dollar an Geldern generieren können.
Dabei begann für Andrea Lo alles ganz anders. Obwohl in San Francisco geboren, war sie nie sonderlich an Computern und Technologie interessiert. Sie besuchte die Highschool in Cupertino und die Uni in Berkeley und hatte eigentlich eher an eine Karriere in einem mittelständischen oder großen Unternehmen gedacht. Ihren ersten Anstoß zu einem anderen Werdegang erhielt sie, als sie in der Highschool Gelder einsammelte, um Rollstühle für Gehbehinderte in Mexiko zu kaufen. Als sie die insgesamt sieben Rollstühle dann persönlich übergab, war sie berührt von der freudigen Reaktion der Beschenkten. Manche Bedürftigen waren von weit hergekommen und krochen auf dem Boden zum Rollstuhl. Damals kam ihr zum ersten Mal die Idee, dass sie selbst als Studentin etwas bewegen kann.
Trotzdem startete sie nach ihrem Studienabschluss zuerst einmal in einem Beraterjob – und sie hasste ihn vom ersten Tag an. Als 22-Jährige durchlebte sie eine Art Midlife-Crisis. Eine Psychologin, die für Al Gore, den ehemaligen amerikanischen Präsidentschaftskandidaten und US-Vizepräsidenten, gearbeitet hatte, empfahl Andrea, ein Start-up zu gründen und etwas zu machen, das der Welt hilft. Die Idee begann in ihr zu reifen. Der Durchbruch kam, als ihre damals elfjährige Schwester für Tiere in ihrer Schule gemeinsam 400 Dollar einsammelte. Das war eine Menge Geld für eine Elfjährige. Das Mädchen wurde dadurch viel selbstbewusster und später auch zur Klassensprecherin gewählt.
Das motivierte Andrea, an ihrer Idee konkreter zu arbeiten. Wie kann sie Acht- bis Dreizehnjährigen helfen, Spendengelder für ihre Projekte einzusammeln? Was als Idee mit Zeichnungen und einer Präsentation begann, wurde langsam zu etwas Handfestem. Weil sie kein Technikfreak war und keinerlei Programmiererfahrung hatte, musste sie sich einen Programmierer suchen. Sie fand einen Studenten im dritten Semester, der ihr dabei half. Das Projekt wuchs und sie versuchten, in ein Start-up-Akzeleratorprogramm zu kommen, was ihnen aber nicht gelang. In diesem Programm hätten sie Unterstützung von erfahrenen Mentoren erhalten. Andreas Programmierer wollte sein Studium weiterverfolgen und so war sie wieder auf der Suche nach jemand Neuem.
Sie fand einen neuen Mitgründer und es gelang ihr, als einzige Frau in das AngelPad-Akzeleratorprogramm zu kommen, das von ehemaligen Google-Mitarbeitern betrieben wird. Kaum war sie drin, verließ sie ihr Mitgründer. Sie hatte einen ersten Kunden für die erste Version ihrer Website, aber beim Aufbringen von Investmentkapital versagte sie völlig. Dafür fand sie einen neuen Mitgründer. Alles, was sie machte, fühlte sich an, als ob sie zwei Schritte vorwärts und einen zurück ging.
Was sie weitermachen ließ, waren die Ergebnisse, die ihr Startup zeitigte. Sie sah Klassen und Teams Geld einsammeln und das motivierte sie durchzuhalten. Andrea ist als einzige Gründerin des AngelPad noch aktiv, alle anderen haben ihre Start-ups aufgegeben. Entscheidend für den Erfolg ist ihrer Meinung nach, Ausdauer zu zeigen und selbst bei Rückschlägen dranzubleiben. Das unterscheidet erfolgreiche von erfolglosen Gründern. Auch empfiehlt sie, sich Mentoren zu suchen und mit ihnen über Probleme zu sprechen. Vielen Gründern falle es schwer, über Schwierigkeiten und Zweifel zu sprechen, auch weil die Leute viel lieber von Erfolgen hören wollen als von gescheiterten Unternehmungen.
Sich den Silicon-Valley-Spirit anzueignen, wird auch aus anderen Gründen immer wichtiger. Und das hat mit den Veränderungen am Arbeitsmarkt zu tun. Für 2020 wird für die USA vorhergesagt, dass bis zu 40 Prozent der werktätigen Bevölkerung nicht mehr in einem Angestelltenverhältnis, sondern entweder als Freelancer, Vertragsarbeiter oder Zeitarbeitskraft arbeiten wird. 6 In Spanien beträgt seit der Finanzkrise von 2008 die Jugendarbeitslosigkeit 50 Prozent und zwingt viele junge Menschen dazu, nach alternativen Einkunftsmöglichkeiten zu suchen. Das Problem ist symptomatisch für Europa, wie man anhand von Daten aller EU-Länder feststellen kann. 7 Die Schaffung von Arbeitsplätzen ist eine der dringlichsten Aufgaben der EU-Staaten geworden. Jugendliche (insbesondere junge Immigranten), die um die Hoffnung auf eine bessere Zukunft betrogen werden, sind besonders anfällig für radikale Ideologien. Staatliche Maßnahmen, wie man sie von früher kennt, greifen nicht mehr beziehungsweise verpuffen wirkungslos. Neue Konzepte sind gefragter denn je. Hier können wir einiges von den Innovationsweltmeistern lernen.
Was im Silicon Valley durch private Unternehmen passiert, muss in Europa mit Begriffen und durch den Staat gezähmt werden. Industrie 4.0 und Digitale Transformation sind die Schlagworte, mit denen man heute den Wandel angehen möchte. Interessant ist, dass Industrie 4.0 ein Zukunftsprojekt der deutschen Bundesregierung ist, nicht der deutschen Industrie. Das Projekt stößt zwar bei dieser auf Zustimmung, die Initiative wird jedoch den Behörden und Verbänden überlassen. 8
Wie geht die Regierung dabei vor? Man setzt Gremien ein, plant Besprechungen und Treffen und verfasst ausführliche Berichte, Thesenpapiere und Empfehlungen. Standards sollen definiert und Normen entwickelt werden. Dabei hinkt man der Entwicklung in anderen Ländern nach, nicht zuletzt, weil so viele Interessengruppen an den Tisch gebracht werden müssen, dass es fast unmöglich wird, diese effizient zu koordinieren. Unternehmen in den USA schaffen durch Fakten einen Standard. Ein Spiegelbild der traurigen deutschen Zustände ist die Kritik von Heinrich Munz, Systemarchitekt bei KUKA Robotics, anlässlich des Industrie-4.0-Forums am Hasso-Plattner-Institut in Potsdam. Die den Standard definierende Arbeitsgemeinschaft, bei der er stellvertretender Vorsitzender ist, hatte bereits seit zwei Jahren einen solchen fertig. Da die Arbeitsgemeinschaft aber ein öffentlicher Verband ist, darf aus wettbewerbsrechtlichen Gründen der Standard nicht veröffentlicht werden noch dürfen Empfehlungen gegeben werden. 9
Man lasse sich das auf der Zunge zergehen. Zuerst definiert man langsam einen Standard, dann darf man ihn nicht herausgeben. Gesteuert wird das Ganze nicht von der Industrie, sondern von Behörden und Verbänden. Da verwundert es nicht, dass nach mehreren Jahren an Arbeit nach wie vor keine konkreten Ergebnisse vorliegen. 10
Und die bisher vorliegenden Ergebnisse zeigen, dass ein prinzipielles Missverständnis darin besteht, was dieser Wandel alles umfassen soll. Der Schwerpunkt besteht bislang vor allem darin, die Produktionsprozesse zu verändern, um die Industrie auf die bevorstehende flexibilisierte Produktion (Stichwort Mass Customization) vorzubereiten. Völlig ignoriert wird dabei, dass disruptive Innovation nicht nur in einem Bereich passiert, sondern oft in mehreren gleichzeitig. Nicht nur im Fertigungsprozess oder bei neuen Produktfunktionalitäten sind Anpassungen notwendig, sondern auch in anderen Bereichen – vom Geschäftsmodell über die Organisationsstruktur, von den Produktsystemen bis hin zum Kundenengagement. Initiativen wie die Digitale Transformation beziehungsweise Industrie 4.0 scheinen für Innovation das zu sein, was Malen nach Zahlen für die Malerei bedeutet.
Im Englischen gibt es dafür den Begriff analysis paralysis, damit ist eine Lähmung durch zu viel und zu langes Analysieren gemeint. Jedes untersuchte Detail bringt einerseits Erkenntnisse, wirft aber auch neue Fragen und Probleme auf, die gleichfalls untersucht werden. Und so wird fleißig weiteranalysiert, anstatt endlich zu handeln und Dinge umzusetzen.
Innovation
„
Wir haben Notfallpläne. Wir haben aber keinen Plan für ‚Ich habe eine Idee!‘“
Don Norman
Was ist Innovation eigentlich und warum ist sie wichtig? Hört man Managern und Medien aufmerksam zu, dann ist das etwas, das jeder macht, das jeder will und das jeder als notwendig empfindet.
Warum Innovation notwendig ist, haben wir bereits kurz angesprochen. Offen blieb jedoch, wie man innovativ ist. Und tatsächlich stellt uns diese Frage vor einige Herausforderungen, weil wir Menschen dazu neigen, alles zu tun, um Innovation zu be- und verhindern – und das oft unbewusst und aus allzu menschlichen Gründen. Aber sehen wir uns zuerst an, was wir eigentlich unter Innovation verstehen.
Bill Aulet, Entrepreneurship-Dozent am MIT, definiert Innovation als Produkt aus Erfindung und Kommerzialisierung:
Das steht im Einklang mit der Definition der Kreativitätsforscherin Teresa Amabile von der Harvard Business School. Für sie gilt eine Idee dann als kreativ, wenn sie sowohl neu als auch wertvoll ist. Neu nicht für den Erfinder, sondern neu für die Allgemeinheit. Innovativ wird sie, sobald sie umgesetzt, verwirklicht und in den Händen von Menschen zur Anwendung gebracht wird.12
In der Geschichte „Achilles und die Schildkröte“ beschrieb vor 2.500 Jahren der griechische Philosoph Zenon von Elea ein Paradoxon, dem auch vermeintlich Innovationsaufgeschlossene gerne aufsitzen. Angenommen, Achilles läuft doppelt so schnell wie die Schildkröte und die Schildkröte erhält einen Vorsprung von zehn Metern – wann würde Achilles die Schildkröte einholen? Nun ja, sobald Achilles losläuft und die zehn Meter Vorsprung wettgemacht hat, ist die Schildkröte bereits fünf Meter weiter. Die muss Achilles nun auch laufen, wobei die Schildkröte indessen weitere zweieinhalb Meter zurücklegt. Und wenn Achilles diese zweieinhalb Meter gerannt ist, ist die Schildkröte schon wieder ein bisschen vorangekommen, nämlich 125 Zentimeter. Spielen wir das so weiter, dann erscheint es uns, als ob Achilles die Schildkröte nie einholen kann. Wie die meisten von uns in der Schule gelernt haben, beruht dieses Paradoxon auf mehreren Trugschlüssen, und natürlich wird Achilles die Schildkröte nicht nur ein-, sondern sogar überholen.
Ähnlich sieht es mit dem Phänomen Innovation aus, die in zwei Ausprägungen vorkommt. Die eine ist mit der Schildkröte vergleichbar, die andere mit Achilles. Erstere ist die inkrementelle, die andere die disruptive Innovation. Inkrementelle Innovation ist die weiterführende Verbesserung eines Produkts, Services, Prozesses, einer Organisation oder Methode. Frans Johansson, Autor von „The Medici Effect“, beschreibt eine auf dieser Innovation basierende Idee als direktional. Die Idee hat eine Richtung, die sich in relativ leicht vorhersagbaren Schritten entlang bestimmter Achsen bewegt. Die Schildkröte wandert langsam diesen Weg entlang.
Disruptive Innovation hingegen zerstört oder ersetzt existierende Produkte, Services, Prozesse, Organisationen oder Methoden. Es handelt sich um intersektionale Ideen, die durch den Schnittpunkt zweier oder mehr Ideen gebildet werden. Die Pfade der disruptiven Innovation und ihre Ursprünge sind kaum vorhersehbar und können bestehende Industrien zerstören. Das ist unser Achilles, der an der Schildkröte nicht nur vorbeisaust, sondern sie im Vorbeilaufen noch umschmeißt.
Inkrementelle Innovation wird vor allem von Experten durchgeführt. Von Spezialisten, die sich in der Materie sehr gut auskennen und sie optimieren können. Die Abgaswerte eines Dieselmotors immer mehr zu reduzieren, den Produktionsprozess um zehn Prozent effizienter zu machen, die Wartezeiten vor dem Fahrkartenschalter um 20 Sekunden zu reduzieren, dazu benötigt man Expertise.
Disruptive Innovation wird aber vor allem von Nichtexperten geschaffen und überrascht deshalb oft die eigentlichen Experten. Weil sie gut erklären können, warum etwas nicht klappen wird, sind sie völlig verblüfft, wenn jemand einen kombinierten, innovativen Ansatz hat, der die Rahmenbedingungen ändert. Darum werden diese Ansätze von den Experten oft so lange ignoriert, bis es zu spät ist. Tesla Motors, Google und Better Place haben disruptive Innovation im Automobilbereich eingeführt. Deren Gründer sind keine Experten im Automobilbau, sondern kommen aus der Softwarebranche. Deshalb ignorierten deutsche Autobauer diese Start-ups sehr lange. Airbnb und Uber wurden ebenfalls von Softwareexperten gegründet, nicht von Fachleuten aus der Reise- oder Taxibranche.
Disruptive Innovation ist zwar unvorhersehbarer und riskanter als inkrementelle Innovation, aber sie bietet viel mehr Chancen. Frans Johansson zählt die folgenden Charakteristika auf, die intersektionale Ideen bieten:
• Sie sind überraschend und faszinierend.
• Sie machen Sprünge in neue Richtungen.
• Sie eröffnen völlig neue Felder.
• Sie ermöglichen, dass eine Person, ein Team oder eine Firma sie ihr eigen nennen können.
• Sie erzeugen Mitläufer, was bedeutet, dass die Schöpfer die Führerschaft übernehmen.
• Sie erlauben auf Jahre hinaus den Ursprung für direktionale Innovation.
• Sie können auf die Welt auf unvorhergesehene Art einwirken.
Welche Innovation ist nun wichtiger? Die Antwort ist einfach: Beide sind gleich wichtig. Disruptive Innovation wird durch nachfolgende inkrementelle Innovation so weit verbessert, bis die nächste disruptive Innovation notwendig wird. Inkrementelle Innovation erlaubt, die Saat der disruptiven Innovation zu kultivieren, bis sie ausgereift ist. Disruptive Innovation hebt das Ganze auf die nächste Stufe. Wir dürfen nicht vergessen, dass alles von disruptiver Innovation Hinweggeraffte irgendwann selbst mal disruptive Innovation darstellte. Pferde als Transportmittel zu verwenden war sicherlich ein Meilenstein in der menschlichen Entwicklung, Kutschen hinter die Pferde zu spannen und statt Pferden dann einen Motor vor die Kutsche zu ‚spannen’ ein weiterer. Sie nun durch Batterien zu ersetzen ist nur der nächste natürliche Schritt. Den Kutscher zuerst durch den Fahrer und nun durch einen Computer überflüssig zu machen ist nichts Anderes.
Als promovierter Chemiker habe ich gelernt, dass neue chemische Substanzen über verschiedene Syntheseverfahren erzeugt werden können. Wie auf einer Straße kann ich entweder einen Schleichweg nehmen oder die Hauptstraße entlangfahren, um mein Ziel zu erreichen. In der Chemie gibt es verschiedene Ausgangssubstanzen und Methoden, um ein und dieselbe Endsubstanz zu synthetisieren. Nicht alle Pfade sind gleichermaßen praktikabel. In Stoßzeiten mag der Schleichweg besser sein als nachts – dann ist die Hauptstraße schneller. Bei Bauarbeiten kann es ein anderer Umweg sein, der zielführender ist.
Mit Start-ups ist es ähnlich. Auch sie sind stets auf der Suche nach gangbaren Wegen. Allerdings kommt erschwerend hinzu, dass ihnen eventuell sogar das Ziel unbekannt ist. Der Fahrdienstleister Uber fokussiert sich auf den Passagiertransport mit privaten Autos. Aber kann ein Transportservice auch auf andere Vehikel und Zielgruppen umgelegt werden? Kann es ein Uber für Flugzeuge (FlyteNow, PrivateFly), ein Uber für Fahrräder (AirDonkey), ein Uber für die Post (Roadie) geben? Oder kann ein Marktplatz wie Airbnb zur Buchung und Vermittlung von Unterkünften auch für andere Objekte und Zielgruppen verwendet werden? Gibt es ein Airbnb für Garagenstellplätze (ParkatmyHouse, JustPark), ein Airbnb für Lagerplätze (Roost, StowThat, RovingBox), ein Airbnb für Büros (ShareDesk) oder ein Airbnb für Haustiere (Dog-Vacay, Holidog, Mad Paws)? Ohne es auszuprobieren wird man das nicht erfahren. Zu allen genannten Modellvarianten gibt es tatsächlich Start-ups, die austesten, ob ein Markt dafür existiert. Ohne sie vorher recherchiert zu haben, übertrug ich einfach das Uber- und Airbnb-Modell auf ähnliche Objekte. Durch die Suchmaschinen-Eingabe „Uber for airplanes“ et cetera konnte ich ein oder mehrere Start-ups zu jedem Modell finden. Viele ähnliche Ideen werden oft von mehreren Start-ups gleichzeitig verfolgt, nicht nur wegen des „benachbarten Möglichen“ (von dem wir gleich mehr hören werden), sondern weil das Abklopfen von Varianten notwendig ist. Das erklärt auch, warum neun von zehn Start-ups scheitern.
Innovation ist nicht nur beschränkt auf Technologien und Services. Der Innovationsforscher Larry Keeley beschreibt zehn Typen von Innovation: 13
1. Gewinnmodell
2. Netzwerk
3. Struktur
4. Prozess
5. Produktperformance
6. Produktsystem
7. Service
8. Zugangskanal
9. Marke
10. Kundenengagement
Google bot mit seiner Suchmaschine durch PageRank nicht nur einen neuen innovativen Prozess an, Suchergebnisse zu bewerten. Auch die Produktperformance, insbesondere die Geschwindigkeit, mit der Suchergebnisse gefunden wurden, sowie die kurzen Beschreibungen zu den Ergebnissen waren etwas Neues. Mit AdWords kam ein neues Gewinnmodell hinzu. Mittels ortsspezifischer Information werden relevante Ergebnisse auf Smartphone und Computer über neue Zugangskanäle verbreitet. Durch die aufgeräumte und spartanisch gehaltene Website setzte sich die Marke von den mit Informationen zugepflasterten Portalen anderer Suchmaschinenanbieter, wie sie noch vor zehn Jahren gang und gäbe waren, wohltuend ab.
Besonders disruptive Innovation kombiniert oft mehrere Innovationstypen gleichzeitig. Laut Keeleys Untersuchungen kombinierten Topinnovatoren durchschnittlich 3,6 Innovationstypen, durchschnittliche Innovatoren gerade mal die Hälfte davon. Die Börsenkursentwicklung von Unternehmen, deren Innovationen mehr als fünf Innovationstypen kombinieren, ist doppelt so hoch wie der S&P 500 Index. Unternehmen, die durchschnittlich drei bis vier Innovationstypen kombinieren, liegen immer noch fast 50 Prozent über dem S&P 500 Index.
Frans Johannson bezeichnete die Kombination von mehreren Disziplinen zu etwas Neuartigem als Medici-Effekt, benannt nach der italienischen Medici-Familie im 15. und 16. Jahrhundert, aus deren Wirken und Schaffen die Renaissance hervorging. Die Medici brachten Kreative aus verschiedenen Richtungen und Disziplinen zusammen und bewirkten so ein Aufleben und Fortschritte in Kunst, Kultur, Architektur, Wissenschaft und Wirtschaft. 14
Für Keeley lässt dieses Ergebnis nur einen Schluss zu: „Nach 15 Jahren, in denen wir diese zehn Innovationstypen analysiert haben, können wir nun mit hoher Sicherheit sagen, dass ein Unternehmen über die reine Produktinnovation hinausgehen muss, um wiederholt und verlässlich innovativ zu sein. Werden mehrere Innovationstypen kombiniert, garantiert das Unternehmen größeren und nachhaltigeren Erfolg.“
Innovatoren akzeptieren den Status quo nicht so einfach. Sie tendieren dazu, Dinge als verbesserungswürdig zu betrachten, sie stoßen Veränderungen an. Aus kognitiver Sicht tendieren Menschen dazu, alles so zu belassen, wie es ist. Diesen Status-quo-Bias (Tendenz zum Status quo) umgehen Innovatoren und hinterfragen die Funktionsweisen. Was viele Innovatoren gemein haben, ist ihre Neugier, die sich oft schon in früher Kindheit zeigt. Mit Spielzeug wurde nicht gespielt, sondern es wurde zerlegt, um die Funktionsweise zu verstehen – oft zum Schrecken der Eltern, denen es um das Spielzeug leidtat. Statt vorab um Erlaubnis zu fragen, bitten Innovatoren nachher um Verzeihung.
Wo findet man Innovatoren? In Start-ups treten sie als Entrepreneure und in Unternehmen als Produkt- und Prozessinnovatoren (mit genügend entrepreneurischem Geist auch als ‚Intrapreneure’) in Erscheinung. Gibt es Innovatoren auch in Universitäten und Forschungseinrichtungen oder außerhalb von Organisationen? Auf alle Fälle, nur sind laut unserer Definition Entdeckungen und Erfindungen, die nicht kommerzialisiert oder der Menschheit zu ihrem Vorteil zugänglich gemacht werden, keine Innovationen. Und diesen Schritt ermöglichen universitäre Einrichtungen oder unstrukturierte Organisationen in Europa oft nur unzureichend.
Gibt es weitere Gründe, warum Innovation wichtig ist? Wie man anhand der Lebensdauer amerikanischer Unternehmen sehen kann, brauchen diese Innovation, um zu überleben. In den letzten 100 Jahren hat die Lebensdauer von Unternehmen um über 50 Jahre abgenommen von 67 Jahren im Jahr 1920 zu ganzen 15 Jahren im Jahr 2012. 15
Kleibers Gesetz
Wie aber kommt es nun zu Innovation und warum scheint ein und dieselbe Idee plötzlich von mehreren Personen und Unternehmen gleichzeitig aufgegriffen zu werden? Werfen wir dazu einen Blick zurück in die Vergangenheit, um zu erkennen, wo Innovation stattfand. Ob Ägypten, Bagdad, Peking, das Römische Reich, Venedig, Florenz, Wien, Paris, Berlin, London, New York oder das Silicon Valley – Kreuzungspunkte von Verkehrs- und Handelsrouten fungieren gleichzeitig als Orte des Ideenaustauschs. An diesen Kreuzungspunkten kamen und kommen Menschen aus verschiedenen Kulturen zusammen und handeln nicht nur mit Waren, sondern auch mit Ideen. Kein Wunder, dass Hafenstädte wie Venedig, Hamburg, London, Singapur oder San Francisco Brutstätten von Ideen waren oder sind.
Während Großstädte, in denen viele Menschen auf engstem Raum zusammenleben, schon immer eine rasche Verbreitung von Ideen und Innovation ermöglicht haben, kommt einer Erfindung eine besondere Bedeutung als Innovationsbeschleuniger zu, die wir heute als selbstverständlich hinnehmen und über die wir nicht weiter nachdenken. Es handelt sich dabei um den Aufzug.
Nachdem der Mechanikermeister Elisha Graves Otis 1853 den absturzsicheren Aufzug auf der New Yorker Weltausstellung mit sich selbst als Versuchskaninchen vorgeführt hatte, setzte der Siegeszug dieser Technologie ein. Erst der Aufzug ermöglichte das Höhenwachstum von Häusern in Städten. Bis dahin war die Anzahl der Stockwerte weniger durch die Baumaterialien beschränkt als vielmehr durch die Praktikabilität und die nötige Anstrengung, das oberste Stockwerk zu erreichen. Erst durch Aufzüge konnten Städte zu Innovations-Hotspots werden. Sie folgen dabei einer modifizierten Version von Kleibers Gesetz.
Der Schweizer Max Kleiber entdeckte den Zusammenhang zwischen der Masse und dem Stoffwechsel von Tieren. Je größer ein Tier wird, desto höher ist dessen durchschnittliche Lebensdauer. Die Lebensdauer von Fliegen liegt zwischen Stunden und ein paar Tagen. Elefanten hingegen werden mehr als ein halbes Jahrhundert alt. Auch ist die Geschwindigkeit, mit der Vogelherzen Blut pumpen, höher als die bei Giraffen. Interessanterweise scheint die Anzahl der Herzschläge über die Lebensdauer aller Spezies hinweg in etwa gleich zu sein. Die Herzen kleinerer Spezies schlagen eben schneller.
Der theoretische Physiker Geoffrey West wandte im wahrsten Sinne einer intersektionalen Idee Kleibers Gesetz auf einen anderen Organismus an: auf Städte. Gemeinsam mit Kollegen am Santa Fe Institute analysierte West Städtedaten. Das Ergebnis war eindeutig. Städte folgten demselben Kleiberschen Gesetz wie Lebewesen. Mit einer Ausnahme: Innovation. Eine Stadt, die zehnmal so groß war, war nicht zehnmal, sondern 17-mal so innovativ. Eine 50-mal größere Stadt ist 130-mal so innovativ.16
Damit allein lässt sich aber nicht erklären, warum gerade das Silicon Valley so viel innovativer ist als Großstädte mit vergleichbarer Einwohneranzahl. Auch durchläuft das Silicon Valley gerade einen starken Wandel. Sowohl San José im Süden als auch San Francisco im Norden erleben starkes Wachstum. Wer die Gegend um South of Market in San Francisco vor zehn Jahren das letzte Mal besuchte, wird sie heute nicht wiedererkennen. Wo man damals noch vorwiegend Brachland und ein unterentwickeltes Gebiet bemerkte, sieht man heute Wolkenkratzer hochschießen. Einst verfallene Gebäude füllen sich mit neuem Leben und sind Sitz diverser Start-ups. Damit wandert die Start-up-Szene vom Valley in die Stadt, was sich in den getätigten Investitionen widerspiegelt.
Der Städteforscher und Ökonom Richard Florida untersuchte bereits vor Jahren in seinem Buch „The Rise of the Creative Class“ (2002), was Regionen attraktiv für kreative Personen macht. Neueren Zahlen zum Silicon Valley zufolge gibt es in San Francisco immer mehr Start-ups und Venture-Kapital-Investitionen. 2013 waren Start-ups dort für ein Drittel aller erhaltenen Investitionen verantwortlich. 17
Das benachbarte Mögliche
Am 14. Februar 1876 reichte Alexander Graham Bell ein Patent für das Telefon ein. Es war die fünfte Patenteinreichung an diesem Tag. Am selben Tag kam laut 39. Eintrag der Einreichungsliste Elisha Gray und reichte gleichfalls ein Patent für das Telefon ein. Sonnenflecken wurden 1611 von vier verschiedenen Forschern in vier verschiedenen Ländern entdeckt. Die erste elektrische Batterie wurde unabhängig voneinander von Ewald Georg von Kleist und Pieter van Musschenbroek 1745 und 1746 erfunden. Josef Ressel, John Ericsson, Francis Pettit Smith, David Bushnell und Robert Fulton erfanden alle zur gleichen Zeit die Schiffsschraube.
Wie kann es sein, dass gleich mehrere Erfinder, oft durch Länder und Kontinente getrennt, unabhängig voneinander auf dieselbe Idee kommen? Sind das Ausnahmen, ist das Zufall oder steckt da mehr dahinter? Diese Fragen stellten sich bereits 1922 zwei Forscher der Columbia University. Sie fanden mehr als 140 Beispiele von unabhängig voneinander stattfindenden Innovationen und Entdeckungen, die meisten davon innerhalb desselben Jahrzehnts. 18
Der Biologe Stuart Kauffman fand ähnliche Verhaltensmuster bei Organismen. Es müssen gewisse Grundvoraussetzungen vorliegen, damit die nächste evolutionäre Stufe erreicht werden kann. Die Bausteine müssen bereits da sein und daraus ergeben sich wiederum weitere Bausteine. Kauffman nannte diesen Effekt das „benachbarte Mögliche“19.
Die Idee liegt sozusagen in der Luft. Das erklärt, warum mehrere Personen unabhängig voneinander dieselbe Entdeckung oder Erfindung machen können. Nun argumentieren einige, dass eine Erfindung sozusagen nicht vermeidbar ist und damit keine Einzelleistung eines Genies darstellt. Gemäß dieser Argumentation wäre auch das Patentwesen hinfällig, weil diese durch das benachbarte Mögliche in der Luft liegenden Erfindungen offensichtlich sind.
Das benachbarte Mögliche profitiert von der Nähe von Ideen und einem Ökosystem, wie es das Silicon Valley aufweist. Dort werden viele verschiedenen Bauteile sowohl physischer als auch konzeptioneller Natur bereitgestellt. Es ist vergleichbar mit Räumen in einem Gebäude. Um von einem Raum in einen benachbarten Raum zu gehen, müssen Türen da sein. Räume kann ich nicht einfach überspringen, sie müssen durchschritten werden.
Firmen wie SAP hatten bereits Anfang 2000 mobile Lösungen für Krankenhäuser. Aber der Zeitpunkt war zu früh, um damit erfolgreich zu sein. Mit dieser Lösung wurden mehrere Räume übersprungen. Gewisse Bausteine waren eben noch nicht vorhanden. So gab es damals kein WLAN-Netzwerk in Krankenhäusern und die Mitarbeiter waren mit mobilen Geräten noch nicht so vertraut, wie sie es heute sind. Damals prägten einfache Mobiltelefone das Bild, persönliche digitale Assistenten wie der Palm Pilot waren erst seit Kurzem auf dem Markt. Die digitale Krankenakte steckte noch in den Kinderschuhen. Mit anderen Worten: Die Lösung war ihrer Zeit voraus. Sie befand sich außerhalb des benachbarten Möglichen.
Der Apple Newton mit Schrifterkennung aus dem Jahr 1993 war zwar eine tolle Innovation, aber eben zu früh da. Die Babbage-Maschine im Computer History Museum in Mountain View, Kalifornien, ist ein Wunderwerk der Ingenieurskunst. Es war der erste mechanische Computer, der aber erst 150 nach seiner Entwicklung Wirklichkeit werden sollte. Auch dies ein Beispiel für eine Idee, die das benachbarte Mögliche übersprungen hat. Das soll uns nicht daran hindern, vorauszudenken und unserer Zeit voraus zu sein. Oft überholt uns die Zeit schneller, als man meint. Und schon gar nicht soll es uns daran hindern, eine Idee, an der man einmal gescheitert ist, nochmals anzupacken.
Innovation wird verhindert, wenn Ausprobieren bestraft wird, Möglichkeiten versteckt oder unzugänglich gemacht werden oder wenn der momentane Status quo so befriedigend ist, dass niemand dazu bewegt werden kann, mit Änderungen zu experimentieren.
Das unvorhersehbare Mögliche
„
Innovationschancen kommen nicht wie ein Sturm daher, sondern mit dem Rascheln einer Brise.“
Peter Drucker
Was verbindet die Dating-App Tinder und den Kalten Krieg miteinander? Mehr als man glaubt. Als am 4. Oktober 1957 die Sowjetunion eine Rakete mit dem ersten Satelliten Sputnik launchte, begann das Weltraumzeitalter. Gleichzeitig wurden die Grundlagen für die Dating-App Tinder geschaffen, auch wenn deren Gründer noch gar nicht geboren waren. Aber zunächst mal ganz langsam.
Zwei junge Physiker am Laboratorium für Angewandte Physik der Johns Hopkins University in Baltimore, William Guier und George Weiffenbach, waren wie viele ihrer Forscherkollegen an diesem Tag in Gespräche über diese Neuigkeit vertieft. Vor allem ein Detail hatte es ihnen angetan: Sputnik sendete ein Radiosignal aus. Und dieses auf- und absteigende Gezirpe konnte mit einem Empfänger geortet werden, den Weiffenbach für seine Dissertation benutzte. Diese Nachricht sprach sich an der Uni schnell herum und den ganzen Tag schauten Kollegen vorbei, um dem Signal zu lauschen. Weil das schnell langweilig wurde, überlegten die beiden, was sie noch alles aus dem Signal herauslesen konnten. Innerhalb weniger Wochen konnten sie unter Ausnutzung des Dopplereffekts die Geschwindigkeit des künstlichen Erdtrabanten messen und seine Flugbahn herausfinden. Das blieb nicht unbemerkt, und als einige Monate später ihr Abteilungschef sie fragte, ob sie anstelle der Satellitenposition auch den umgekehrten Fall berechnen könnten, nämlich von einem Satelliten aus den Standort eines Objekts auf der Erde, brauchten die beiden nur wenig Zeit, um diese Frage mit ja zu beantworten.
Sie hatten keine Ahnung, dass das Militär die Position eines aufgetauchten Unterseeboots wissen wollte, um die Zielpeilung für Nuklearraketen berechnen zu können. Auf diesem Wunsch basiert letztlich das Global Positioning System (GPS), von dem wir heute, mehr als 50 Jahre später, profitieren. GPS ermöglicht nicht nur modernen Flugzeugen, ihre Position zu eruieren, sondern ist auch die Grundlage für die die Geolokation auf Fahrzeug-Navigationssystemen, für eine Restaurantkritik auf Yelp, einen Foursquare-Check, ein Geospiel wie Ingress oder dass sich Singles auf Tinder finden können. Und dass ein Taxiservice wie Uber entsteht, der ebenfalls auf Geolokation beruht, war ebenso unvorhersehbar wie die Verwendung eines Fahrdienstes, der als Alternative zum Taxi begann und nun von einigen meiner Silicon-Valley-Bekannten zum Abholservice für ihre Kinder umfunktioniert wurde.
Weder Guier noch Weiffenbach hätten diese Verwendungszwecke in den 1950er-Jahren vorhersagen können. Und damit sind sie nicht alleine. Keiner kann vorhersagen, wie bestimmte Erfindungen je eingesetzt werden. Wir können Vorahnungen haben, aber es wird sicherlich immer neue Anwendungsgebiete geben, die uns mit dem heutigen Wissen nicht in den Sinn kommen würden.
Ebenso wenig konnte vor über 150 Jahren niemand vorhersagen, dass aus der von Hügeln und einer Bucht eingeschlossenen Bay Area um ein verschlafenes Dörfchen namens San Francisco das Silicon Valley werden sollte. Und diesen Werdegang werden wir uns jetzt ansehen.
Fußnoten
1 Nicholas Lemann: The Network Man: Reid Hoffman’s big idea, in: The New Yorker, 12.8.2015, http://www.newyorker.com/magazine/2015/10/12/the-network-man
2 Stefan Quandt: „Der Monopolkapitalismus des Silicon Valley ist nicht zukunftsfähig“, in: Manager Magazin 6/2015, http://www.manager-magazin.de/unternehmen/it/stefan-quandt-silicon-valley-nicht-zukunftsfaehig-a-1040713.html
3 Michael Freitag, Astrid Maier, Dietmar Palan: American Hybris, in: Manager Magazin 5/2015, http://www.manager-magazin.de/magazin/artikel/apple-google-facebook-uber-groessenwahn-im-silicon-valley-a-1030869.html
4 Teresa M. Amabile; Brilliant but cruel: Perceptions of negative evaluators, in: Journal of Experimental Social Psychology, März 1983
5 o. Verf: CHE Hochschulranking 2015/16, in: Zeit online, http://ranking.zeit.de/che2015/de/fachbereich?id=800222&ab=3
6 Vivian Giang: 40 Percent of American s Will Be Freelancers by 2020, in: Business Insider, 21.3.2013
7http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Unemployment_statistics
8 Bundesministerium für Bildung und Forschung: Zukunftsprojekt Industrie 4.0, https://www.bmbf.de/de/zukunftsprojekt-industrie-4-0-848.html
9 Hasso-Plattner-Institut: Podiumsdiskussion - Vision Talk im Rahmen des Industrie 4.0 Forum, http://www.tele-task.de/archive/video/flash/26772/
10 Karin Zühlke: Plattform Industrie 4.0 vor dem Aus: „Deutschland hat die erste Halbzeit verloren“, in: elektroniknet.de, 10.2.2015, http://www.elektroniknet.de/elektronikfertigung/strategien-trends/artikel/116855/
11 Bill Aulet: Disciplined Entrepreneurship. 24 Steps to a Successful Startup, Hoboken 2013
12 Frans Johansson: The Medici Effect: Breakthrough Insights at the Intersection of Ideas, Concepts & Cultures, Harvard Business School Press 2004
13 Larry Keeley: Ten Types of Innovation: The Discipline of Building Breakthroughs, Hoboken 2013
14 Frans Johannson: The Medici Effect: Breakthrough Insights at the Intersection of Ideas, Concepts, and Cultures, Boston 2004
15 Alexa Clay, Kyra Maya Phillips: The Misfit Economy: Lessons in Creativity from Pirates, Hackers, Gangsters and Other Informal Entrepreneurs, New York 2015
16 Steven Johnson: Where Good Ideas Come From: The Natural History of Innovation, London 2011
17 Richard Florida: Why San Francisco May Be the New Silicon Valley, in: TheAtlantic.com, 5.8.2013, http://www.citylab.com/work/2013/08/why-san-francisco-may-be-new-silicon-valley/6295/
18 William F. Ogburn, Dorothy Thomas: Are Inventions Inevitable? A Note on Social Evolution, in: Political Science Quarterly Bd. 37, Nr. 1 (März 1922), S. 83-98
19 Stuart Kauffman: At Home in the Universe: The Search for the Laws of Self-Organization and Complexity, New York 1995
Ein bayerischer Kollege stürzt geschockt aus dem Nachbarzimmer in unser voll besetztes Vierpersonenbüro im baden-württembergischen Walldorf. „Schaut euch die Nachrichten an!“ Sämtliche Nachrichtenwebsites, die wir aufrufen, sind nur nach großen Verzögerungen erreichbar, haben auf Schwarzweißfotos umgeschaltet, um Bandbreite zu sparen, und zeigen alle dasselbe Bild: die rauchenden Türme des World Trade Centers in Manhattan. Es ist Dienstag, der 11. September 2001, und die Vereinigten Staaten erleben gerade den schlimmsten Terrorangriff in ihrer Geschichte.
Es ist späterer Nachmittag und wir waren dabei, uns für die anstehenden Telefonkonferenzen mit unseren Kollegen bei SAP Labs in Palo Alto vorzubereiten, für die es gerade frühmorgens war. Viele von ihnen wollten ein paar Stunden später von San Francisco aus ihre Flieger nehmen, um an einem mehrtägigen Workshop in Walldorf teilzunehmen. Dazu kam es aber nicht mehr, weil der amerikanische Luftraum kurze Zeit später für eine ganze Woche gesperrt werden würde.
Jeder, der damals alt genug war, erinnert sich genau, wo er sich befand, als er von den Terrorattacken hörte. Für mich hatte das noch eine weitere Brisanz: Am Tag zuvor hatte ich meinen Reisepass ans amerikanische Konsulat nach Frankfurt geschickt, um mein L1-Visum für meinen Transfer von SAPs Zentrale in Walldorf zur SAP-Niederlassung in Palo Alto zu erhalten. Dort sollte ich für die Weiterentwicklung von SAPs jüngster Produktfamilie in Datawarehousing und Internet zuständig sein. Mein Überführungsflug für den 26. September schien nun hinfällig. Die Welt hatte sich verändert, und meine auf eine ganz andere Weise, als ich gedacht hatte oder ahnen konnte.
Trotz all des Chaos in der Welt hielt ich am 13. September meinen Reisepass mit dem Arbeitsvisum in den Händen, Datumstempel 12.9.2001. So kam ich ins Silicon Valley, in dem gerade die Dotcom-Blase am Platzen war. Von der täglichen halbkilometerlangen Schlange bei der Abfahrt von der Autobahn 280 nach Palo Alto war von einem Tag auf den anderen nichts mehr zu sehen. Hunderttausende hatten die Bay Area verlassen, die damals schon teuer war und nun mit dem Einsetzen der terrorbedingten Rezession keine Jobs mehr bot.
Als SAP-Mitarbeiter hatte ich diesbezüglich nichts zu befürchten. In Krisenzeiten tendieren Unternehmen dazu, ihre externen Dienstleister zu konsolidieren, und das bedeutete zumeist, dass SAP als bevorzugter Dienstleister davon profitierte. Trotzdem erlebte ich die Änderungen am eigenen Leib. Meine vielen Dienstreisen brachten mich regelmäßig nach Europa und zur SAP-Niederlassung nach Israel. Dabei konnte ich persönliche Erfahrungen mit verschiedenen Flughafensicherheitssystemen sammeln. Die israelischen Sicherheitsleute verhielten sich unbeeindruckt, konzentriert und sehr professionell. Sie wussten wohl aus Erfahrung, wie wichtig dieser Job war. Die europäischen Sicherheitsbeamten waren ebenso ruhig, aber es schien eine viel entspanntere Ruhe zu sein. In den USA hingegen herrschte Chaos. Bei den Sicherheitschecks nach 9/11 wurde oft herumgeschrien. Es war offensichtlich, dass die bis dahin gültigen Prozesse nicht effektiv waren. Man gab vor, die Sache im Griff zu haben, aber es sollte noch dauern, bis neue und effektivere Bestimmungen in Kraft treten sollten.
Bezeichnend war ein Erlebnis im November 2001 auf dem Flughafen in San Antonio in Texas, wo ich gerade von einer Konferenz kam und zurück nach San Francisco fliegen wollte. Wegen der neuen Bestimmungen hatte sich der Prozess zur Ausstellung neuer Führerscheine für ausländische Staatsbürger in den USA landesweit verzögert. Meinen kalifornischen Führerschein sollte ich erst neun Monate nach der Führerscheinprüfung erhalten. Damit war der einzige Ausweis, den ich besaß, mein österreichischer Reisepass. Mit diesem reiste ich innerhalb der USA und damit auch von San Francisco nach San Antonio und zurück. Bei der Sicherheitskontrolle zückte ich meinen Reisepass und hörte erstaunt, wie mich der Sicherheitsbeamte im Frankfurter Dialekt auf Deutsch ansprach.
„Deutsche, Holländer, Franzosen hatte ich schon viele hier durchkommen sehen, aber Sie sind der erste Österreicher!“, sagte er. Mein Erstaunen war nicht zu übersehen, deshalb fuhr er fort: „Ich bin vom deutschen Bundesgrenzschutz.“
„Was zum Teufel macht der deutsche Bundesgrenzschutz mitten in Texas?“, lautete meine überraschte Frage.
Er erklärte, dass die amerikanische Regierung befreundete Länder gebeten hatte, für mehrere Monate deren Grenzschutzbeamte abzustellen, um auf allen größeren Flughäfen des Landes das Sicherheitspersonal zu schulen. Wenn an einem Tag gleich vier Flugzeuge entführt werden können, ist das kein Zufall, sondern man hat ein systematisches Problem.
Dieser Terroranschlag war nur ein weiterer Todesstoß für die Silicon-Valley-Blase, die 2001 endgültig platze. Unvorstellbare Bewertungen von Start-ups, die verrücktesten Ideen und nichtexistente Geschäftsmodelle prägten die damalige Start-up-Szene. Von Megastaus zu beinahe leeren Autobahnen innerhalb von wenigen Monaten, so erlebte ich die erste Zeit im Silicon Valley. Heute sieht die Sache, zumindest was den Verkehr betrifft, viel schlimmer aus als 2001. Aber die Szene hat sich gewandelt, wie auch ich mich geändert habe – und das Interesse der Welt am Silicon Valley. Doch blicken wir zunächst einmal 150 Jahre zurück, als das Silicon Valley noch ein nahezu unbeflecktes Stückchen Land war, so, wie man sich den Wilden Westen vorstellt.
Am Anfang stand Kalifornien
Hundertschaften verlassener Schiffe schaukeln in der Bay um San Francisco, wo sich heute das Fährengebäude und die bei Touristen beliebten Piers befinden. Aber im Jahr 1849 waren die Leute nicht als Touristen gekommen, sondern um sich schnurstracks auf den Weg zum American River zu machen. Wo heute Kaliforniens Hauptstadt Sacramento liegt, hatte John Wilson Marshall ein Jahr zuvor beim Inspizieren des Mühlkanals seiner Sägemühle einen Goldnugget gefunden. Die Nachricht von diesem Fund breitete sich in Windeseile aus und Tausende Abenteurer machten sich auf den Weg, um ihr Glück zu versuchen. Der Goldrausch hatte begonnen.
Es war eine beschwerliche Reise, da es nur zwei Möglichkeiten gab, dorthin zu gelangen. Ein Weg war der Oregon-California-Trail, der durch raues und feindliches Terrain führte. Sechs Monate dauerte die Reise, genauso lang wie die alternative Route, die per Schiff von New York über Südamerika nach San Francisco führte. Dieser Weg war nicht weniger beschwerlich, plagten die Passagiere doch Ungeziefer und Seekrankheit, und das alles zu einem maßlos überhöhten Preis. Kaum angekommen, überließen Passagiere und Besatzungsmitglieder ihre Schiffe dem Schicksal, um beim Goldrausch nicht zu kurz zu kommen.
Zwischen 1848 und 1850 explodierte die Einwohnerzahl von San Francisco von beschaulichen 1.000 auf über 20.000. Die Stadt konnte mit dem Wachstum nicht schritthalten und machte aus der Not eine Tugend. Die Hundertschaften verlassener Schiffe wurden teilweise versenkt, um das Fundament für die Piers zu legen, andere wurden in ihre Einzelteile zerlegt, um Baumaterial für Häuser zu gewinnen. Touristen, die heute auf der Embarcadero entlang der Piers wandern, befinden sich einige Meter über diesen Schiffen. Die Stadt wuchs und im Jahr 1850 wurde Kalifornien zum 31. Bundesstaat der Vereinigten Staaten.





























