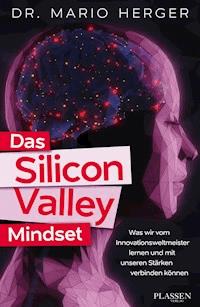Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Plassen Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Feierabend. Bei Uber einen selbstfahrenden Tesla bestellt, der mich fünf Minuten später am Büro abholt und nach Hause bringt. Danach verschwindet das Elektroauto lautlos in der Nacht. Klingt nach Zukunft. Ist es auch. Aber sehr nahe Zukunft. Was bedeutet die Kombination aus autonomem Fahren, Elektromobilität und Sharing Economy für Taxifahrer, Lkw-Fahrer, Arbeiter bei VW und BMW oder Betreiber von Parkhäusern? Wie sehen die Städte der Zukunft aus und welche Herausforderungen bringen sie mit sich? Silicon-Valley-Insider Dr. Mario Herger über eine der größten Umwälzungen seit der Dampfmaschine.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 664
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
DR. MARIO HERGER
Der letzte
Führerscheinneuling
… ist bereits geboren.
Wie Google, Tesla, Apple, Uber & Counsere automobile Gesellschaft verändernund Arbeitsplätze vernichten.Und warum das gut so ist.
Copyright der deutschen Ausgabe 2017:
© Börsenmedien AG, Kulmbach
Covergestaltung: Johanna Wack
Herstellung: Daniela Freitag
Buchsatz: Bernd Sabat, VBS-Verlagsservice
Lektorat: Monika Gehle
Korrektorat: Karla Seedorf
Druck: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-86470-538-0eISBN 978-3-86470-539-7
Alle Rechte der Verbreitung, auch die des auszugsweisen Nachdrucks, der fotomechanischen Wiedergabe und der Verwertung durch Datenbanken oder ähnliche Einrichtungen vorbehalten.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.
Postfach 1449 95305 Kulmbach
Tel: 09221-9051-0 Fax: 09221-9051-4444
E-Mail: [email protected]
www.plassen.de
www.facebook.com/plassenverlag
Für Gabriel, Darian und Sebastian.And for May Kou.
Inhalt
EINLEITUNG
Von Davids und Goliaths
Von der Pferdekotkrise zum Klimawandel
DER LETZTE PFERDEKUTSCHER ODER DIE 1. AUTOMOBILREVOLUTION
Elektriker, Büchsenmacher, Physiker: Automobilpioniere damals und heute
Die Liebe zum Auto: leidenschaftlich und wankelmütig
Signale, Trends und Foresight Thinking
Der iPhone-Moment der Automobilindustrie
DER LETZTE FÜHRERSCHEINNEULING ODER DIE 2. AUTOMOBILREVOLUTION
Daten und Fakten zur Automobilindustrie
Der Antrieb wird elektrisch
Hier rollt die Zukunft heran: Autonome und selbstfahrende Fahrzeuge
Hallo, du: Connected Cars im Dialog
Buchstäblich ein neuer Zeitgeist? Die Sharing Economy auf dem Vormarsch
Forschung, Innovation, Disruption – mehr Geld, mehr Features
Zeithorizont – zur Automobilindustrie auf uns zu?
Womit Hersteller „rechnen“ müssen
Womit Arbeitnehmer rechnen müssen
Welleneffekte und Vertrauensbonus: Im Gleichschritt, marsch!
Auch Ladungen buchen ein Uber
Big „Apple“ und der Kampf um Big Data
You are right „HERE!“
Digitales Erlebnis
Geschäftsmodelle
Vom Förderband über „Vertikale Integration“ zu KI-Design – Produktion im Wandel
Hochleistungs-Batteriezellen an die (Elektro-)Front
Smartes Verkehrsmanagement für „Smart Cities“
ADAC ade? Vom Mitgliederverein zum Flottenclub
FashionTech – Autos machen Kleider
Vor dem Gesetz sind alle (Autos) gleich?
Warum die Bahn nicht länger mobil macht …
Ein Netz ohne Boden – öffentliche Verkehrsmittel auf dem Prüfstand
Pünktlich zum Termin – der „autonome Schlafwagen“ macht’s möglich
Viel Wind ums Öl, doch Strom verändert die Welt …
Es geht auch ohne: Auswirkungen rund ums Erdöl
Sinkende Strompreise: Die Kehrseiten der Medaille
Ferngesteuert und ausgeraubt: Cybercrime meets Cybersecurity
Chitty Chitty Bang Bang: Der Traum vom fliegenden Auto
„EN MARCHE!“ WERKZEUGE UND METHODOLOGIEN FÜR WERKZEUGE UND AUTOMOBILHERSTELLER
Unternehmensleitbilder
Unternehmenskultur
Das Silicon-Valley-Mindset
Innovationsarten nach Clayton Christensen
Ockhams Rasiermesser: Gibt es ein Sparsamkeitsprinzip der Innovation?
Das Keeley-Innovationstypen-Modell: Das Geheimnis liegt in der Kombination
Ein psychologisch sicheres Umfeld: Hinfallen, aufstehen, weitermachen
„Kann ich eine Frage stellen?“
Was, wieso, warum: Question Storming vs. Brainstorming
„Kill the Company“ oder Wie ich mein eigenes Unternehmen zu Fall bringen kann …
180-Grad-Denken: Was macht man mit einem Elektroauto, das nicht fährt?
Haben Sie Déjà-vus oder eher Vuja-Dés?
Moore’s Law: von deutschen Automobilherstellern gegenteilig interpretiert
„Open sources“: Inhouse-Expertise gegen den Rest der Welt
Innovation Outposts – Die Zukunftsmusik spielt im Valley
Ohne Ausbildung und Forschung geht nichts: Wer macht aktuell was und wo?
„EN MARCHE!“ POLITIK UND GESELLSCHAFT IN BEWEGUNG
Kognitive Verzerrungen überwinden
Bedingungsloses Grundeinkommen und Robotersteuern auf die Agenda
Für die Zukunft qualifizieren
Willen zur Veränderung zeigen
NACHWORT
ANHANG
Fußnoten
Einleitung
„Ich versuche, einfach nur über die Zukunft nachzudenken und dabei nicht traurig zu werden.“
–ELON MUSK
GESTATTEN SIE MIR, dass ich Ihnen Max vorstelle. Gerade erst feierte er seinen ersten Geburtstag. Mit viel Kuchen, Luftballons und jeder Menge Geschenke. Nicht nur ist Max ein süßer Knirps, er ist vermutlich auch der Letzte, der noch einen Führerschein machen wird.
Unwahrscheinlich? Nicht in Ihrem Leben? Ganz unrecht haben Sie nicht, wie ich zugeben muss. Ich weiß nämlich nicht, ob es Max sein wird oder Sofie oder Julian. Es könnte sogar ein Kind sein, das in Ihrer Nachbarschaft lebt, aber eines ist sicher: Der letzte Führerscheinneuling wurde bereits geboren. Und ich habe eine Menge Daten und Fakten gesammelt, mit denen wir uns in den Kapiteln dieses Buches ausführlicher auseinandersetzen. Sie werden staunen, wie weit die Entwicklung von selbstfahrenden, elektrischen Ubers schon fortgeschritten ist.
Max (oder Sofie oder Julian) wird sich nicht vorstellen können, wie wir überhaupt auf die Idee kommen konnten, ein Auto besitzen und fahren zu wollen, das mit unförmigen Pedalen und Lenkrad schwer zu bedienen war, uns während der Fahrt davon abhielt, zu arbeiten oder unsere Aufmerksamkeit einem Videospiel zu widmen, und das obendrein als Jahrestribut tausende Tote und Verletzte einforderte. Wie vorsintflutlich waren wir eigentlich? Nun, genauso vorsintflutlich, wie uns heute die Fahrt in einer Kutsche vorkommt. Der Fahrer saß auf dem Kutschbock im Freien, war dabei Wind und Wetter ausgesetzt und richtete, während er über holprige Straßen rumpelte, seinen Blick ständig auf ein paar Pferdehintern.
Freude am Fahren kommt auch heute selten auf, wenn wir wieder einmal zur Stoßzeit im Stau stehen und Müdigkeit, Termindruck und die Suche nach einem Parkplatz uns zu schaffen machen. In Zukunft wird sich der Verkehr noch mehr auf die Ballungsräume konzentrieren als heute. 60 Prozent der Weltbevölkerung werden im Jahr 2030 in Städten leben.1 In den USA sind das heute bereits 80 Prozent der Einwohner, in Deutschland 74 Prozent und in Österreich 66 Prozent.2 In den Städten wird die Nachfrage nach Transportleistung steigen. Mit dem verfügbaren Raum und heutiger Infrastruktur wird es unmöglich sein, das klassische Transportangebot auf diese Anforderungen auszurichten. Für noch mehr Straßen und Parkplätze, um noch mehr Autos in die Stadt zu bringen, gibt es ja heute schon zu wenig verfügbaren Raum.
Allein im Silicon Valley fahren heute mehr als 200 selbstfahrende Autos auf öffentlichen Straßen herum, die von 40 Herstellern betrieben werden, und in den ganzen USA sind es bereits 1.000 Fahrzeuge. Über 700 Unternehmen entwickeln dort Technologien für autonome Autos. Gleichzeitig entsteht eine Autoindustrie an einem der teuersten Standorte, wo gleich mehrere Hersteller Elektroautos und -busse produzieren – Tesla, Lucid Motors, NIO oder Proterra, um nur einige zu nennen. Gleich ein halbes Dutzend Teststrecken liegen nur wenige Kilometer auseinander. In China werden in einer Stadt allein jährlich 25 Millionen Elektromopeds produziert, und drei Dutzend Hersteller bauen Elektroautos. Sechs selbstfahrende Taxiflotten sind weltweit bereits im Probebetrieb und nehmen Passagiere auf. In Kalifornien wird es sogar voraussichtlich ab Ende 2017 autonomen Autos gestattet sein, ohne einen Fahrer, ja sogar ohne einen Menschen an Bord auf den Straßen zu fahren.
Bereits seit 2016 verbaut Tesla in alle seine Wagen Hardware, die Selbstfahrfähigkeit erlauben. Mit einem Software-Update, das noch 2017 oder Anfang 2018 kommt, werden auf einmal alle bis dahin produzierten Autos, also über 100.000 Fahrzeuge, autonom unterwegs sein können. Gleichzeitig gehen die ersten Taxiunternehmen pleite, weil sie gegen Uber und Lyft nicht mehr bestehen können. Und der Kopfpreis für Ingenieure mit der heute so heiß begehrten Expertise zu Künstlicher Intelligenz, Sensortechnologie oder Selbstfahralgorithmen liegt bei 33 Millionen Dollar.
Die neuen Entwicklungen kommen vor allem aus zwei Regionen: aus dem Silicon Valley und aus Asien. Während das Silicon Valley dabei eine natürliche Entwicklung durchläuft und vom American Way of Life mit eigenem Auto zu einem mit selbstfahrenden elektrischen Ubers migrieren wird, überspringen asiatische Länder teilweise eine ganze Epoche. In China beispielsweise haben es viele Menschen innerhalb von ein oder zwei Generationen von einfachen Bauern und Arbeitern zu einem gewissen Wohlstand gebracht und damit eine neue Mittelklasse geschaffen. Und diese Mittelklasse will Autos. Oder zumindest einen Zugang zu individuellen Fortbewegungsmitteln. Alle Zeichen deuten darauf hin, dass hier Ähnliches passieren wird wie nach dem Zusammenbruch des Ostblocks. Ungarn hatte ein besseres Handysystem als Deutschland. Während die Telekom ihre Investitionen in den Aufbau der DSL-Leitungen rückerwirtschaften wollte, hatte Ungarn solche Altlasten nicht; statt teure Leitungen zu verlegen, wurden gleich Handymasten aufgestellt. Eine ganze technologische Generation wurde übersprungen.
Deutschland, Österreich, die Schweiz oder auch Europa generell hinken in allen Bereichen der neuen Automobilindustrie hinterher. Sie spielen keine federführende Rolle mehr, die Innovation geschieht woanders. Wir haben das Auto erfunden, wir bauen die besten Autos, aber die Zukunft wird anscheinend ohne uns geplant. Unsere Hersteller sind heute schon hintendran, und der Abstand vergrößert sich stetig. Dabei hat das wenig damit zu tun, dass die anderen irgendwelche magischen Formeln verwenden oder einfach nur Überflieger sind. Nicht ausländische Unternehmen machen deutschen Konzernen zu schaffen, sondern deutsche Ingenieure in ausländischen Unternehmen, die den deutschen Ingenieuren daheim das Zepter aus der Hand nehmen.
In meinem Buch Das Silicon-Valley-Mindset zählte ich bereits die vielen Verhaltensweisen auf, mit denen sich Menschen bei neuen Ideen gegenseitig helfen und unterstützen. Dabei fiel mir auf, dass ich zur Veranschaulichung vor allem Beispiele aus dem Automobilsektor verwendete. Etwas zu Elektrofahrzeugen hier, ein bisschen zu Ubers neuartigem Taximodell da, und zwischendrin viele Berichte über selbstfahrende Fahrzeuge und die in diesem Sektor neu entstehenden Berufe.
Diese Fokussierung auf die Automobilbranche bereitete mir Unbehagen, weil es doch auch viele gute Beispiele aus anderen Industrien geben musste. Ich nahm einige meiner Argumente und Beispiele aus dem Buch heraus und ersetzte sich durch welche aus anderen Branchen. Als ein Blogartikel in Vorbereitung zur Buchveröffentlichung dann aber innerhalb weniger Tage zigtausende Zugriffe verzeichnen konnte, war eindeutig, wie groß das offensichtliche Interesse im deutschsprachigen Raum an den Veränderungen in der Automobilbranche war. Der Artikel mit dem Titel Deutsche Innovationsprobleme, erklärt am Beispiel von Porsche und Tesla zog hitzige Diskussionen nach sich und ist nach wie vor der beliebteste Beitrag.
Verfolgt man ähnliche Kommentare in anderen Medien, ist rasch zu erkennen, wie sehr das Automobilthema den öffentlichen Nerv trifft. An der Hitzigkeit der Debatten überrascht vor allem, wie gnadenlos dieser stolze deutsche Wirtschaftssektor kritisiert wird. Ankündigungen deutscher Hersteller zu neuen Elektrofahrzeugen und Aussagen von Automanagern, die selbstfahrende Fahrzeuge als „Hype“ bezeichnen, werden mit Spott und Häme überzogen. Das sollte den Autoherstellern zu denken geben. Man ist dabei, das Vertrauen der eigenen Landsleute unwiederbringlich zu verspielen. Der Dieselabgas-Skandal, der ungeheuerliche Umfang der Preisabsprachen und die „Betrugskoordination“ zwischen den deutschen Herstellern sowie andere Fehltritte der letzten Jahre verschlimmern die Lage nur.
Deshalb war es für mich naheliegend, mich dieses Themas umfassender anzunehmen, den heutigen Stand der Entwicklungen zu beschreiben und die einzelnen Puzzleteile zu einem Gesamtbild zusammenzufügen. Dabei bin ich selbst beileibe kein Autoliebhaber. Ich empfinde Autofahren als Zeitverschwendung, lieber würde ich die Zeit mit Lesen verbringen. Als Wiener, geboren in einer Stadt mit ausgezeichnetem öffentlichen Nahverkehr, sah ich zunächst keine Notwendigkeit für mich, den Führerschein zu erwerben. Den machte ich erst mit 22, und mein erstes Auto kaufte ich gezwungenermaßen, als ich nach Kalifornien zog. Selbst während meiner Jahre in Deutschland mit seinem gut ausgebauten öffentlichen Nah- und Fernverkehrsnetz fand ich ein Auto eher belastend als hilfreich. Natürlich hätte ich manchmal eines gebraucht, einiges wäre dann einfacher gewesen. Wenn ich aber daran zurückdenke, wie oft unser Pkw in den engen Straßen der Heidelberger Altstadt beschädigt wurde und wie mühsam die Parkplatzsuche war, hätte ich schon damals lieber auf eins verzichtet.
Mir ist bewusst, dass es heute auch viele Autofahrer gibt, die die Zeit hinterm Steuer genießen, dabei Radio hören und sich entspannen, ihre Gedanken schweifen lassen oder sich einem Audiobuch widmen. Das ist mir natürlich auch in einem Bus oder in der Bahn möglich. Aber wie wird es erst in einem Fahrzeug sein, das mir das Fahren abnimmt?
Seit 2001 wohne ich im Silicon Valley, das vor allem als Mekka für Computernerds gilt und in dem so viel von dem entstand, was wir heute als selbstverständlich ansehen, in unserer Arbeit wie auch zu Hause. Computer, Smartphones, Facebook oder Google sind nur einige dieser neuen Technologien, die aus dem Silicon Valley stammen. Und es fiele leicht, diesen relativ kleinen Flecken in Kalifornien mit gerade einmal dreieinhalb Millionen Einwohnern nur damit zu identifizieren.
In den letzten Jahren fiel mir dort die sprunghaft angestiegene Zahl an Aktivitäten im automobilen Sektor auf. Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht einem von Googles selbstfahrenden Fahrzeugen in und um Mountain View begegne. Und Google ist bei Weitem nicht das einzige Unternehmen, das solche Autos auf den Straßen im Silicon Valley fahren lässt. Wenn ein Start-up namens Tesla einen Apple-ähnlichen Kult mit dem Model S erzeugt und Käufer im frühen Morgengrauen Schlange stehen, um das neueste Modell, das Model 3, vorzubestellen, das zudem noch an einem der teuersten Standorte – nämlich im Silicon Valley – produziert wird, sollte man hellwach werden. Liest man dann von Apples Ambitionen im Automobilsektor, vom Auftreten chinesischer Hersteller mit milliardenschweren Dollarkassen und der Flut von hunderten Automobil-Start-ups, kann nicht mehr geleugnet werden, dass da etwas am Brodeln ist. Je mehr ich mich damit befasste, desto klarer wurde das Bild. Die Tage des Automobils, wie wir es heute kennen, sind gezählt. Wir sind bereits mitten drin in der 2. Automobilrevolution.
Die Signale sind da. Alle Bestandteile, die ein Robotaxi ermöglichen und uns schon das selbstfahrende elektrische Uber gebracht haben, sind verfügbar. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann die Kombination aus Sensoren, Algorithmen, Künstlicher Intelligenz und Apps richtig durchschlagen wird. Seit etwas mehr als einem Jahr entbrennen auch in Deutschland plötzlich Diskussionen um das Automobil, die vorher undenkbar waren. Damit ist das Bewusstsein von Öffentlichkeit und Politik ebenfalls im Wandel begriffen. Eine technologische Revolution, die Hand in Hand geht mit einer Anpassung von Verhaltensweisen und Regeln, führt zu Disruption, zur Zerschlagung eines Marktes. Achten Sie auf die entsprechenden Signale. Sobald sie sich häufen, hat die Disruption bereits begonnen.
Es ist eine Revolution im Gange, die unser Verhältnis zur Heiligen Automobilkuh fundamental verändern und ähnliche, wenn nicht größere Auswirkungen auf unsere Wirtschaft und auf unsere Gesellschaft haben wird, wie sie der Übergang vom Pferd zum motorenbetriebenen Vehikel brachte. Die erste Frage ist nicht, ob, sondern wann diese Veränderungen uns erreichen werden. Angesichts der exponentiellen Kurve, der Technologieentwicklungen folgen, und der Fakten, die bereits im Silicon Valley geschaffen wurden, werden sie rascher kommen, als viele meinen. Und als zweite Frage drängt sich dann auf: Wird Deutschland noch eine Rolle bei und nach dieser 2. Automobilrevolution spielen? Warum sehen deutsche Hersteller, die bislang die besten Autos der Welt bauten, plötzlich alt aus? Und wie können sie vermeiden, in der Bedeutungslosigkeit zu versinken?
Harvard-Professor Clayton Christensen stieß schon vor etlichen Jahren auf dieses Phänomen. In seinen Untersuchungen fand er heraus, dass 50 bis 80 Prozent der Top-Unternehmen einer Branche nach einer disruptiven Innovation in der nächsten Generation nicht mehr unter den Top Ten waren. Die Ergebnisse ähnelten sich, völlig unabhängig von der Branche, die er untersuchte. Gemäß dieser Logik werden in den nächsten Jahren mindestens die Hälfte der Unternehmen, die Marken wie Volkswagen, Audi, Mercedes, BMW, Porsche oder Opel unter ihrem Dach vereinen, nicht mehr unabhängig sein oder gleich gar nicht mehr existieren.
Ich gebe zu, aus deutscher Sicht mag es heute noch mehr als unwahrscheinlich erscheinen, dass es so weit kommen wird. Aber so dachte man auch vor einem Jahrzehnt in der amerikanischen Automobilmetropole Detroit. Große Schlitten und Pick-ups waren das Erfolgsrezept. Genauso wenig konnte man sich so etwas in der Nokia-Zentrale in Espoo bei Helsinki vorstellen. Dort wurde das iPhone mit großer Skepsis betrachtet. Und auch in Rochester im US-Bundesstaat New York war man sich sicher, dass Digitalkameras Filmpapier nie würden ersetzen können. Kodak und Nokia sind heute Namen, die in den Wirtschaftswissenschaften und in der Innovationsforschung als Lehrbeispiele für verpasste Chancen stehen. Wollen wir, dass Volkswagen, Daimler oder BMW bald nur mehr als Inbegriff von Unternehmen gelten, die die Zeichen der Zeit nicht erkannt haben? Dass sie nicht weiter als die Glanzlichter dastehen, die das Auto erfunden haben, den Deutschen die große weite Welt gaben und ihnen einen Riesenappetit auf Reisen machten?
Wir können uns darauf einigen, dass in Deutschland die besten Autos gebaut werden, dass die schönsten Sportwagen aus Italien stammen, dass Frankreich die elegantesten Designs beisteuert, Schweden für die Sicherheitsstandards maßgebend ist und Japan ganz auf Zuverlässigkeit setzt. Allerdings ändern sich die Kriterien für ein richtig gutes Auto gerade. Die Sicherheit eines Autos wird bald nicht mehr vordringlich durch eine stabile Fahrgastzelle und den Airbag bestimmt, sondern durch den Algorithmus, der das fahrerlose Fahrzeug lenkt. Ein elegantes und schönes Design zählt weniger, wenn ich in einem Taxi sitze. Zuverlässigkeit wird für den Flottenmanager relevanter sein als für den Passagier. Und was ein gutes Auto ist, entscheidet sich immer mehr am integrierten Unterhaltungssystem, ein Bereich, den Autohersteller in der Vergangenheit anderen überließen. Wir werden das Auto zukünftig nicht mehr nur als einzelnes Objekt, sondern als System in einem Transportdienstleistungsverbund sehen.
So wie das beste Filmpapier an Bedeutung verlor, als niemand mehr die digital aufgenommenen Fotos ausdruckte, und die beste Handytastatur durch Touchscreens und Stimmeingaben ersetzt wurde, wird auch der Automobilsektor einen extremen Wandel erfahren. Diese Auswirkungen beschränken sich nicht nur auf die Industrie selbst. Unser Verständnis von und unser Umgang mit Mobilität werden sich drastisch ändern, und Städte, Regionen und andere Beteiligte müssen sich an neue Gegebenheiten anpassen. Eine ganze Reihe von Wirtschaftssektoren wird überflüssig, andere kommen neu dazu.
Dies alles werden wir in den folgenden Kapiteln näher beleuchten: wie alles anfing, wie das Automobil unseren Alltag und unsere Städte veränderte, welche neuen Anforderungen bewältigt werden müssen, welche Technologien dahinterstecken, welche Gesetze sie berühren, welche Verhaltensweisen sie beeinflussen und welche Auswirkungen sie auf Gesellschaft, Arbeitsplätze und die Wirtschaftsstandorte haben werden. Uns Europäern stehen dieselben Technologien und Prozesse zur Verfügung wie allen anderen auch. Warum wir trotzdem hinterherhinken, liegt an unserem Verhalten, unserem Mindset. Deshalb gehe ich im letzten Teil des Buches gerade auf diesen Aspekt näher ein, damit wir sehen, wie jeder von uns seinen Beitrag leisten kann und muss, sich einen innovativen und unternehmerisch ausgerichteten Mindset für das Wohl unserer Gesellschaft und der Menschheit insgesamt anzueignen.
Von Davids und Goliaths
„Wenn du Fakten hast, stell sie vor, und wir werden sie verwenden. Aber wenn du eine Meinung hast, dann verwenden wir meine.“
– JIM BARKSDALE, CEO Netscape
GOLIATH, DER UNBEZWINGBARE Riese, hatte keinen Grund, anzunehmen, dass von diesem David, einem schmächtigen Schafhirten, eine Bedrohung ausgehen könnte. David war nicht mal Soldat und kam ohne schwere Rüstung daher, wie es sich für einen richtigen Kämpfer ziemte. Allein die Tatsache, dass der Gegner keinen erfahrenen Soldaten in den Kampf schickte, war lächerlich und roch förmlich nach Verzweiflung. Und trotzdem unterlag Goliath, ohne mitzubekommen, wie ihm geschah. Bevor der Kampf so richtig begonnen hatte, war er auch schon wieder vorbei.
Die Geschichte vom Außenseiter, der gegen einen übermächtigen Gegner gewinnt, klingt zwar gut, konnte aber eigentlich von Anfang an nicht gut ausgehen für den Favoriten. Malcolm Gladwell, Autor von David und Goliath: Die Kunst, Übermächtige zu bezwingen, beschreibt die Ausgangssituation anhand der Originaltexte. Und da wird sofort klar, dass Goliath ein schwer kranker Mann war. Was er sagte und wie er von Zeitgenossen beschrieben wurde, lassen darauf schließen, dass der zweieinhalb Meter große Mann unter Gigantismus litt, mit beträchtlichen Nebenwirkungen. So war Goliath kurzsichtig und konnte seinen Gegner nur aus der Nähe deutlich erkennen. Seine Gelenke machten ihm zu schaffen, und er benötigte Helfer, die ihm seinen Schild zum Kampfplatz brachten. Seine Respekt einflößende Größe und seine Armlänge verschafften ihm im normalen Schwertkampf von Mann zu Mann ausreichend Abstand, um den Gegner zu treffen, selbst aber nicht getroffen zu werden.
David hingegen war in zweifacher Hinsicht ein unterschätzter Underdog. Als einfacher Schafhirte wählte er als Waffe die Steinschleuder, eines richtigen Soldaten unwürdig. David war normalwüchsig, viel kleiner als Goliath, dafür aber wendiger. Seine Waffe erlaubte es ihm, den Gegner aus der Distanz anzugreifen, und das ausgesprochen effektiv. Ein geübter Schütze kann einen Stein mithilfe einer Schleuder auf die Geschwindigkeit einer abgefeuerten Pistolenkugel bringen. Selbst wenn David der „goldene Schuss“ nicht im ersten Versuch gelingen sollte, war er wendig genug und weit genug entfernt, es so oft zu probieren, bis ihm die Steine ausgingen.
Sieht man sich das Ausgangsszenario aus diesem Blickwinkel an, stand Goliath bereits von Anfang an auf verlorenem Posten; er kam mit einem Messer zu einem Schusswaffenduell. Gerade weil – und nicht obwohl – David mit einer unorthodoxen Waffe in den Kampf zog, ergaben sich Vorteile. David hielt sich nicht an die üblichen Regeln eines Duells zwischen Schwertkämpfern, die bedingten, dass sich die Kontrahenten körperlich nahekommen mussten. Und dass der Einsatz einer Steinschleuder als nicht soldatenlike galt, war David schnurzpiepegal. Er war ja keiner, er war Schafhirte.
Der vermeintlich chancenlose Außenseiter, der zu unüblichen Methoden greift, sich nicht an Regeln hält, dem es egal ist, was das Expertenumfeld über ihn denkt, und der damit alle Umfragen Lügen straft, steht im Mittelpunkt vieler solcher David-versus-Goliath-Szenarien. Wir tendieren dazu, dem Underdog die Stange zu halten, müssten aber eigentlich auch Mitleid mit Goliath haben. Zumindest manchmal. Denn oft haben wir es leider mit Riesen zu tun, denen ihr Erfolg zu sehr zu Kopf gestiegen ist. Auch das vorliegende Buch handelt von solchen Goliaths und Davids; wir werden lernen, warum man Davids niemals unterschätzen sollte, warum Giganten verletzlicher sind, als sie nach außen hin scheinen, und warum es bereits jetzt für einige von ihnen zu spät sein könnte. Aber auch das wird eine Rolle spielen: warum sich manche Davids ihre Siege nicht zu Kopf steigen lassen oder sich auf ihren Lorbeeren ausruhen sollten. Davids können rasch selbst zu Goliaths werden und den nächsten Davids als Opfer dienen. Ausschlaggebend für den Gewinn des Underdog war, dass er die Regeln änderte. Wer sich vom Gegner die Waffen diktieren lässt, gewinnt nur in 30 Prozent der Fälle. Wer sein eigenes Spiel spielt, hat dagegen eine 65-Prozent-Chance.3
Wie sehr sich das Verhältnis von Davids und Goliaths im Automobilsektor umgekehrt hat, zeigt das Beispiel der Delegation eines deutschen Premiumherstellers, die auf Besuch im Silicon Valley unterwegs war. Die Autos des Herstellers zählen zu den begehrtesten der Welt und weisen eine Verarbeitungsqualität auf, die ihresgleichen sucht und die die Bilanz des Mutterkonzerns regelmäßig aufpoliert. „Erlkönige“ – also die mit Tarnfolien beklebten Prototypfahrzeuge, die in der Region des Herstellers zu Testzwecken unterwegs sind – werden von Autofans und Fotografen von Automagazinen mit Hingabe gesucht und begutachtet. Und dann drehen sich im Valley die Mitarbeiter desselben Herstellers plötzlich nach jedem Tesla Model S und X um, laufen aufgeregt zur Garage, in der Google seine Flotte an selbstfahrenden Autos parkt, und kleben wie kleine Kinder vor dem Bonbonladen am Garagengitter, um die besten Aufnahmen von hässlichen kleinen Kugelautos zu schießen. Etwas Entscheidendes hat sich verändert, und deutsche Hersteller können es nicht mehr leugnen, auch wenn sie sich äußerlich den Anschein geben, alles unter Kontrolle zu haben und auf der Höhe der Zeit zu sein.
Die Dienstreise eines VW-Mitarbeiters aus Süddeutschland in die Zentrale nach Wolfsburg mit einem ausgeliehenen Tesla ruft das Interesse der Kollegen hervor. Sie drängen sich um das Fahrzeug, wollen es Probe fahren, die Beschleunigung erleben, den Platz im Fahrzeug testen, den großen Touchscreen berühren. So sieht es normalerweise aus, wenn andere Autobauer deutsche Premiummarken unter die Lupe nehmen. Oder wenn deutsche Hersteller sich von einem Ferrari beeindrucken lassen. Doch ein Sportwagen ist für die meisten verzichtbarer Luxus, beim Tesla wird aber sofort klar, dass hier die Zukunft anrollt. Und die ist bereits eingetreten, viel rascher als erwartet.
„Nicht Tesla geschieht den deutschen Herstellern, sondern die Zukunft geschieht ihnen.“
– MARIO HERGER
Wie rasch so etwas gehen kann, zeigt das Beispiel einer Industrie, die einen lang gehegten Traum der Menschheit verwirklichte, nämlich das Fliegen. Orville und Wilbur Wright waren zwei Fahrradmechaniker aus Dayton, Ohio. Schon im Kindesalter hatten sie Vögel beobachtet, wie sie ihre Flügel bewegten, um in der Luft zu bleiben. Die beiden waren dabei so bei der Sache, dass sie die einzelnen Bewegungsabläufe mit ihren Armen nachahmen konnten. Ihre ersten Versuche mit angeschnallten, flügelähnlichen Vorrichtungen führten zu nicht mehr als ein paar aufgeschürften Knien. In der Nachbarschaft galten die beiden als durchgeknallt, denn nur Verrückte hatten wohl nichts Besseres zu tun, als stundenlang im Freien zu stehen und Vögeln nachzujagen.
Aber langsam und stetig bastelten die beiden in ihrer Werkstatt an Flugapparaten und saugten begierig die Veröffentlichungen anderer Luftfahrtpioniere wie Otto Lilienthal oder Octave Chanute in sich auf. Sie bauten sogar einen ersten Windtunnel, um Aerodynamik zu studieren. Nach unzähligen Gleitversuchen gelang den beiden am 17. Dezember 1903 der erste erfolgreiche Motorflug, der 59 Sekunden dauerte und 260 Meter weit führte. Die heimische Bevölkerung sollte erst einige Tage später davon erfahren; man nahm die Nachricht entweder nicht ernst oder hielt sie für bedeutungslos. Ganz anders fiel die Reaktion in Paris aus. Der dortige Aéroclub hatte bereits von den Bemühungen der Brüder Wright durch Korrespondenz mit Chanute erfahren und lud die beiden zu einer Demonstration nach Frankreich ein. Erst danach wurde man auch im eigenen Land auf sie aufmerksam.
Während die Wrights unbeachtet von der Öffentlichkeit ihrem Erfindungsgeist nachgingen, stand ein anderer amerikanischer Flugpionier im Zentrum der Aufmerksamkeit. Samuel Pierpont Langley war ein anerkannter Wissenschaftler, Direktor des Smithsonian Astronomical Observatory und Mitglied der Amerikanischen Akademie der Kunst und Wissenschaften wie der Royal Society.4 Er sehnte sich nach einer Ruhmesleistung ähnlichen Kalibers wie der seines Freundes und Kollegen Alexander Graham Bell, der das Telefon erfunden hatte. Den bemannten Flug sah Langley als die nächste Schwelle, die es zu überwinden galt, und als seine Chance, Lorbeeren zu ernten. Dank seiner Beziehungen und seines Ansehens hatte er vom Kriegsministerium 50.000 Dollar und von der Forschungs- und Bildungseinrichtung des Smithsonian Instituts weitere 20.000 Dollar erhalten, um ein Flugzeug zu bauen. Die New York Times verfolgte seine Bestrebungen auf Schritt und Tritt und hielt ihre Leser regelmäßig über seine Fortschritte auf dem Laufenden. Doch die Versuche brachten nicht den gewünschten Erfolg, und die Wrights liefen ihm still und heimlich den Rang ab. Als er davon hörte, beendete Langley umgehend seine aeronautische Arbeit. Während es ihm um den persönlichen Ruhm gegangen war, trachteten die Brüder Wright danach, Menschen das Fliegen zu ermöglichen.5
Warum aber sprechen wir in einem Buch über Automobile über zwei Flugpioniere, die als Fahrradmechaniker begannen? Weil sich hier ein Muster erkennen lässt, das typisch ist für viele disruptive Innovationen.
Erstens: Meist sind es nicht die Experten auf einem Gebiet, die Disruption in eine Industrie bringen, sondern fast immer Außenseiter, die zunächst für naiv, realitätsfremd und auch für völlig durchgeknallt gehalten werden. Gerade sie sind es aber, die einen unvoreingenommenen Blick auf die Dinge und unkonventionelle Ansätze mitbringen. Und weil sie nicht an die Geschichte dieser Disziplin gebunden sind und im dortigen Hierarchiesystem niemandem etwas schulden, können sie scheinbar respektlos vorgehen. Sie müssen sich nicht um geltende Regeln kümmern oder Angst haben, jemandem auf die Füße zu treten, dem sie verpflichtet sind. Sie betrachten das zu lösende Problem von einer allgemeineren Ebene aus. Man nennt dieses Vorgehen „first principle“ oder „Denken in Grundbegriffen“. Der Grundbegriff kann von keinem anderen Begriff abgeleitet werden und geht zurück auf die ursächliche Problematik. Nicht die Frage „Wie mache ich Kutschen besser?“, sondern „Was ist der eigentliche Grund für Kutschen?“ kommt näher an den Grundbegriff und die zu lösende Problematik heran. Dabei merkt man rasch, dass die Quantensprünge bei der Lösung des Problems nicht in der schrittweisen Verbesserung der existierenden Technologie entstehen, sondern im Finden völlig neuer Ansätze. Diese Art von Denken erfordert aber mehr mentale Energie. Ein Innovationssprung überrascht fast immer die Industrieexperten, die nicht müde werden, auf die Schwierigkeiten oder die Unmöglichkeit eines Vorhabens hinzuweisen, dabei aber nur innerhalb ihrer Grenzen und Rahmenbedingungen denken.
Zweitens: Disruptoren geht es seltener um Ruhm, sondern eher um die Sache an sich. Darum, wie man das Universum verformen oder die Welt besser machen und Menschen helfen kann. Davon spricht auch Tesla-Chef Elon Musk in einem Interview mit dem Handelsblatt, als er die Gründe für die Beendigung der Zusammenarbeit mit Daimler und Toyota nennt.6
„Wir sahen als Problem mit den Projekten, die wir mit Toyota und Daimler durchführten, dass sie letztendlich zu klein gedacht waren. Sie berechneten nur, welchen Betrag sie reinstecken mussten, um die Behörden zufriedenzustellen, und hielten den Aufwand so gering wie möglich. Solche Projekte wollen wir nicht machen. Wir wollen Projekte machen, die die Welt verändern werden.“
Musk will die Welt verbessern, will den Menschen helfen, besser dazustehen als vorher. Im deutschen Sprachraum gelten Weltverbesserer als naive Erbauer von Luftschlössern, die vielleicht sogar in die Klapsmühle gehören. Als Weltverbesserer bezeichnet zu werden gilt hierzulande nicht gerade als Kompliment. Aber wie nennt man dann im Umkehrschluss diejenigen, die nicht danach streben? Weltverschlechterer? Logisch wäre das.
Management auf eine Weise zu verstehen, die in scharfem Widerspruch zu der von herkömmlichem Unternehmertum steht, kommt nicht von ungefähr. Al Gore zitiert in seinem Buch The Future eine Studie, bei der Geschäftsführer und Finanzchefs befragt wurden, ob sie eine gute Investitionsgelegenheit beim Schopf packen würden, auch wenn es bedeutete, dass sie die nächsten Quartalszahlen nicht erreichen würden. Es wird Sie vermutlich wenig überraschen, dass 80 Prozent der Befragten die Frage verneinten.7
Der Verhaltensökonom Richard Thaler wiederum weist auf den innerbetrieblichen Konflikt zwischen der Makro- und Mikrobetrachtung von riskanten Projekten hin. Bei einer Besprechung mit 23 Managern und dem Firmenchef fragte er erstere, ob sie ein Projekt starten würden, bei dem die Erfolgswahrscheinlichkeit bei 50 Prozent liege. Sollte es erfolgreich sein, winke ein Gewinn von zwei Millionen Dollar pro Projekt, im Falle des Scheiterns drohe ein Verlust von einer Million. Insgesamt handle es sich um 23 voneinander unabhängige Projekte. Ergebnis: Von den 23 Managern wären nur drei das Risiko eingegangen, die anderen 20 lehnten ab.
Als man den Firmenleiter fragte, wie viele der Projekte er durchführen lassen würde, antwortete er sofort: „Alle!“ Aus seiner Sicht machte dies auch Sinn. Von den 23 Projekten würde vermutlich die Hälfte ein Misserfolg werden und einen Gesamtverlust von elfeinhalb Millionen Dollar bedeuten. Die erfolgreichen elfeinhalb anderen Projekte aber würden zusammen 23 Millionen Dollar einspielen. Damit ergäbe sich unterm Strich ein positiver Betrag von elfeinhalb Millionen Dollar. Die Manager gaben auf Nachfrage folgende Gründe dafür an, ein solches Projekt nicht angehen zu wollen: Im Erfolgsfall wären maximal ein Schulterklopfen und ein kleiner Bonus drin, im Fall des Scheiterns büßten sie nicht nur intern an Reputation ein, sondern müssten als drastischste Konsequenz mit ihrer Entlassung rechnen. Das Risiko stehe für sie in keiner Relation zum Gewinn.8
Selbst wenn dem Firmenchef bewusst ist, dass er aus Makrosicht alle 23 Projekte durchführen lassen sollte, sind das Belohnungssystem und der Fokus auf die Mikrosicht (also auf Einzelprojekt-Basis) ausgerichtet. Eigentlich sollte ein gescheitertes Projekt, das mit viel Elan angepackt wurde, zumindest genauso belohnt werden wie ein erfolgreiches, denn dabei wurde schließlich etwas riskiert. Aus Makrosicht des Unternehmens ergibt das viel mehr Sinn! Und führt uns zu der überraschenden Schlussfolgerung, dass es eher die mittelmäßig erfolgreichen Projekte sind, die „bestraft“ werden sollten, die, bei denen ganz auf Sicherheit gespielt wurde und die von den supererfolgreichen Projekten sowieso in den Hintergrund gedrängt werden. Wir sind umgeben von Mittelmäßigkeit, weil viele sich nicht trauen oder auch nicht genügend Anreize erhalten, etwas Außergewöhnliches in Angriff zu nehmen. Die heute implementierte Mikrosicht bestraft die Risikofreudigen und sieht Scheitern als Versagen und nicht als Lernerfahrung an.
Angesichts der Nachrichten rund um den Dieselabgas-Skandal, von illegalen Preisabsprachen und staatlichen Förderungen kann man meinen, dass eine falsche Betrachtungsweise und die üblichen Belohnungsmodelle dazu verleiten, sich „durchzuschummeln“. Man strebt eher kurzfristige Gewinne und Geldflüsse an, die nicht unmittelbar mit der Unternehmensmission in Einklang stehen müssen. Wie sich herausstellt, sind die hochprofitablen deutschen Automobilbauer zudem Experten darin geworden, öffentliche Fördertöpfe anzuzapfen. Porsche erhielt für ein Elektrofahrzeugkonzept über sechs Millionen Euro vom Staat, Daimler über 60 Millionen aus Konjunkturpaketen und BMW von 2010 bis 2012 Fördergelder in Höhe von 44 Millionen Euro.9/10 Diese Liste ließe sich beliebig fortsetzen.11 Mit diesen Summen wurde aber – sieht man sich die bisherigen Ergebnisse an – gerade mal minimale Innovation betrieben; in erster Linie fand man Gründe, warum ein neues Konzept nicht funktionieren könne. Die Hauptmotivation scheint weniger in dem Willen zu bestehen, eine bessere Welt zu schaffen, als im Streben nach Macht und Ruhm oder zumindest im Füllen der eigenen Taschen. Das funktioniert so lange, bis auf einmal Quereinsteiger kommen, die vormachen, wie es geht, wenn man nur die nötige Willpower und Ausdauer mitbringt.
Drittens: Unmittelbar nach dem Durchbruch in einer Technologie treten innerhalb kurzer Zeit viele neue Mitspieler auf. Gerade ein Jahr war vergangen, nachdem Wilbur und Orville Wright 1908 ihre ersten öffentlichen Flugvorführungen in den USA und Frankreich unter großer Anteilnahme der Zuschauer absolviert hatten, da meldeten sich bereits beim ersten großen Flugwettbewerb in Reims 22 Piloten mit ihren eigenen Flugmaschinen an.12 Seit Googles selbstfahrende Fahrzeuge in den Schlagzeilen auftauchten und elektrische Teslas ihre Besitzer in den Bann ziehen, sind Dutzende neuer Mitspieler eingestiegen. Anfang 2017 wurden über 700 Unternehmen gezählt, die an Technologien für selbstfahrende Autos arbeiten. Welche das sind, werden wir uns später noch genauer ansehen, eines kann aber vorweggenommen werden: Die deutschen Autohersteller zählen leider nicht zu den führenden Unternehmen, auch wenn sie uns das weismachen wollen.
Autos sind ein wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft geworden. Die Art, wie wir uns fortbewegen, sagt nicht nur etwas über unseren individuellen Status aus, sondern auch etwas über den unserer Gesellschaft. Wir verbringen mehr Zeit im Verkehr als im Urlaub, beim Essen mit unserer Familie oder beim Sex. Verkehr – nicht der geschlechtliche wohlgemerkt – ist zu einer Art Lebensstil geworden. Ein solcher Lebensstil zwingt uns Neuerungen auf. Ganze Industrien, vom Drive-Thru-Starbucks über To-go-Essen bis hin zum Hörbuch, haben sich erst entwickelt oder angepasst, als die mobile Gesellschaft solche Dienste benötigte.
Bevor wir aber zu tief einsteigen, gehen wir nochmals zurück in die romantisch verklärte gute alte Zeit. Zur selben Zeit, als die Wrights ihre Pionierarbeit für Flugapparate leisteten, gab es eine andere, jahrtausendealte Art der Fortbewegung, die von Außenseitern revolutioniert wurde. Es dreht sich dabei alles ums Pferd.
Von der Pferdekotkrise
zum Klimawandel
WIENTOURISTEN KENNEN SIE bestimmt: die Fiaker. Die Pferdekutschen, die man in der Innenstadt mieten kann, um eine Rundfahrt durch die Geschichte der Stadt langsam und bequem mit nur zwei Pferdestärken zu erleben. Dabei hat der eine oder die andere aufmerksame Reisende ganz bestimmt eine rutschenförmige, aus Leder gearbeitete Tasche unter dem Pferdeschweif bemerkt. Diese als „Pferdewindel“ bekannte Vorrichtung soll vermeiden, dass Pferdekot auf den Straßen liegen bleibt.
Was wir heute amüsiert zur Kenntnis nehmen, bereitete den Stadtverwaltungen vor über 100 Jahren schweres Kopfzerbrechen. Mit dem Städtewachstum nahm auch die Anzahl der Fuhrwerke zu, und immer mehr Pferde bevölkerten die Straßen moderner Metropolen. Um 1900 gab es in London 11.000 Kutschen, die als Taxi dienten, dazu mehrere tausend Pferdetramways, Pferdebusse und zahllose Transportwagen für Waren und Güter aller Art. Gut und gern 100.000 Pferde brachten tagtäglich die Bevölkerung von London und New York City auf Trab. Und hinterließen ihre Spuren. Die festen Verdauungsprodukte eines Pferdes kamen auf sieben bis 15 Kilogramm täglich, dazu fiel mehr als ein Liter Urin an. Stellen Sie sich einmal vor, wie eine damalige Großstadt gerochen haben muss, was für eine Seuchengefahr bestand und welchen Ausweichslaloms Spaziergänger ausgesetzt waren, um nicht zu viel Unrat in ihre Wohnungen zu schleppen. In der Sommerhitze wurde der ausgetrocknete Pferdedung durch die Luft gewirbelt, bei Regen verwandelte er sich in eine klebrige Masse. Gleichzeitig war er eine bevorzugte Brutstätte für Hausfliegen, die ebenfalls die Städte heimsuchten. In welcher Form auch immer, Pferdekot war unangenehm – nun wissen Sie auch, woher der Kotflügel seinen Namen hat.
Was für die einen übelriechende Pferdescheiße darstellte, war für die anderen wertvoller Rohstoff und Dünger. Ganze Berufsgruppen lebten vom Aufsammeln, von der Wiederverwertung und dem Verkauf von Pferdemist. Und denken Sie auch an all die in der Pferdeindustrie beschäftigten Fachkräfte wie Hufschmiede, Zaumzeugmacher, Kutschenbauer, Pferdezüchter, die Betreiber von Koppeln, Futtermittelhersteller, Veterinärmediziner und Pferdetrainer, die das Pferdebusiness am Laufen hielten. Die Verwendung der Pferde als reine Arbeits- und Transportkräfte führte zu einer durchschnittlichen Pferdelebensdauer von gerade mal zwei bis drei Jahren. Tiere, die auf den Straßen kollabierten und verstarben, wurden oft nicht gleich entfernt, sondern ein paar Tage liegengelassen, bis die Kadaver so weit ausgetrocknet waren, dass man sie leichter wegschaffen konnten. Den Gestank und die hygienischen Zustände gerade in den heißen Sommermonaten mag man sich heute gar nicht mehr ausmalen.
Kein Wunder, dass die Londoner Times 1894 voraussagte, dass in 50 Jahren bei gleichbleibendem Wachstum jede Straße der Stadt unter drei Metern Pferdescheiße ersticken würde. Die „Große Pferdekotkrise von 1894“ führte 1898 zur ersten internationalen Städteplanungskonferenz in New York, bei der nach Lösungen für die drohende Gefahr gesucht wurde.13
Dabei hatte die Pferdequote noch nicht einmal ihren Höhepunkt erreicht. Für die USA wurde erst 1915 zum „Peak Horse“, sprich zum Jahr mit der größten Anzahl an Vierhufern (knapp über 21 Millionen Pferde).14 Auf drei Amerikaner kam ein Pferd. Exakt 100 Jahre später verkauften Automobilhersteller mehr Fahrzeuge denn je. In den USA zählt man 260 Millionen Fahrzeuge, in Deutschland 43 Millionen und weltweit zwei Milliarden – der höchste Stand an Automobilen, den die Welt je gesehen hat. Wir haben „Peak Car“ erreicht oder stehen unmittelbar davor. Gleichzeitig kommen auf die Automobilindustrie die größten Umwälzungen ihrer Geschichte zu. Droht den Automobilbauern auf dem Höhepunkt ihrer Wirtschaftsmacht ein vergleichbares Schicksal wie der Pferdeindustrie?
Managementberater James C. Collins, Autor von How the Mighty Fall, untersuchte bekannte Fälle von Unternehmen, die auf dem Höhepunkt ihres unternehmerischen Erfolgs innerhalb relativ kurzer Zeiträume in der Bedeutungslosigkeit versanken oder in den Bankrott schlitterten.15 Anhand von Global Playern wie der Bank of America, Motorola, Merck, Hewlett-Packard oder Circuit City identifizierte er fünf Stufen, die ein Unternehmen durchlaufen kann, wobei manchmal aber auch welche ausgelassen werden. Alle konnten auf eine Erfolgsgeschichte zurückblicken, die ihnen die trügerische Sicherheit von Unverwundbarkeit vermittelte. Darauf folgende Überheblichkeit, verbunden mit dem ungezügelten Streben nach mehr und dem Verleugnen von Gefahr und Risiko, ließ diese Unternehmen Fehler über Fehler anhäufen und zu lange auf alte Erfolgsmodelle setzen, bis es zu spät war (siehe Abbildung 1).
Abbildung 1: Fünf Stufen des Niedergangs
Die Automobilbranche befindet sich momentan auf Stufe 3. Mehr Autos denn je werden verkauft, immer leistungsfähigere, sparsamere, größere Modelle kommen auf den Markt, und stark anziehende Hoffnungsmärkte in Asien überdecken die Stagnation in den traditionellen Absatzmärkten Europa und Nordamerika. Letzteres hat allerdings nichts damit zu tun, dass niemand mehr Transportmöglichkeiten benötigt, ganz im Gegenteil. Aber die Einstellung zum Besitz, zum Zugang und zur Verfügbarkeit eines Transportmittels sowie die Bedeutung der Antriebsart und des Fahrerlebnisses ändern sich vor unseren Augen.
Um diese Dynamik zu verstehen, müssen wir uns ansehen, von wem die Firmen geleitet werden und wann sie entstanden sind. Was uns sofort auffällt: Die Chefs der Unternehmen, die den deutschen Herstellern heute zu schaffen machen, sind zugleich auch Gründer. Deutsche Unternehmen hingegen werden vor allem von Managern geführt, was zu weiten Teilen den Unterschied erklärt. Manager sind keine Unternehmer.
Den USA ist es in ihrer Geschichte immer gelungen, Unternehmertum zu ermutigen und zu ermöglichen. Zu den bekanntesten amerikanischen Unternehmern zählen:
•Graham Bell (Bell Lab)
•Thomas Edison (General Electrics)
•Henry Ford (Ford)
•Andrew Carnegie (Carnegie Steel Company)
•Walt Disney (Disney)
•Thomas Watson (IBM)
•Bill Hewlett (Hewlett Packard)
•David Packard (Hewlett Packard)
•Gordon Moore (Intel)
•Bill Gates (Microsoft)
•Michael Dell (Dell)
•Jeffrey Bezos (Amazon)
•Steve Jobs (Apple)
•Larry Page (Google)
•Sergey Brin (Google)
•Mark Zuckerberg (Facebook)
•Elon Musk (Paypal, Tesla, SpaceX)
Allein anhand dieser Aufzählung sehen wir, dass es eine Reihe von Unternehmern gibt, die uns teilweise bereits seit Jahrzehnten ein Begriff sind. Wer fällt uns hingegen bei den deutschen Unternehmern ein? Hier ebenfalls eine (sicherlich unvollständige) Liste der wichtigsten Namen:
•Carl Benz (Daimler-Benz)
•Karl Rapp (BMW)
•Ferdinand Porsche (Porsche/Volkswagen)
•Rudolf Diesel
•August Horch (Audi)
•Claude Dornier (Dornier)
•Werner von Siemens (Siemens)
•Karl Albrecht (Aldi)
•Adi Dassler (Adidas)
•Konrad Zuse (Zuse KG)
•Heinz Nixdorf (Nixdorf)
•Hasso Plattner (SAP)
Welche Aspekte fallen uns auf, wenn wir die Listen vergleichen? Erstens: Vergleichsweise wenige deutsche Unternehmen sind in den letzten Jahrzehnten entstanden, die bekanntesten Unternehmer waren Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts aktiv. Und zweitens: Bei den Amerikanern dominier(t)en vor allem Technologiefirmen.
Unter den sechs „wertvollsten“ Unternehmen im April 2017 befanden sich fünf Technologiefirmen. Apple, die Google-Mutter Alphabet, Microsoft, Amazon und Facebook. Sie allein kommen auf eine Marktkapitalisierung von atemberaubenden 2.900 Milliarden Dollar im Juni 2017. Im Vergleich dazu erreicht die Marktkapitalisierung aller DAX-30-Unternehmen mit 1.350 Milliarden Euro nicht einmal die Hälfte dieser Summe. Alle fünf Firmen sind digitale Unternehmen, drei von ihnen wurden vor weniger als 25 Jahren gegründet, die anderen beiden vor knapp 40 Jahren. Drei von ihnen stammen aus Seattle, die anderen drei aus dem Silicon Valley. Die dominierenden deutschen Unternehmen wie Bosch, Siemens, Mercedes, BMW und Volkswagen sind alle 100 Jahre alt und älter, mit Ausnahme von SAP, das 2017 seinen 45. Geburtstag feierte. 24 der DAX 30-Unternehmen sind älter als 100 Jahre und nur drei jünger als 45. SAP ist dabei das einzige digitale deutsche Unternehmen und zugleich auch das wertvollste.
Es ist also nicht angebracht, der Hybris zu verfallen, denn die zersetzt langsam, aber sicher die Unternehmen. Am spektakulärsten ist das beim Volkswagenkonzern zu verfolgen. Das Machtstreben der Eigentümerfamilien und des Managements führte zu ethisch und rechtlich fragwürdigen Entscheidungen, die im Abgas-Skandal ihren vorläufigen Höhepunkt fanden und das Unternehmen an den Rand des Kollapses brachten. Das zeigt sich in Einbrüchen bei den Verkäufen (gleich 17 Prozent weniger) und auch im Arbeitgeber-Ranking deutscher Absolventen, die Volkswagen auf den achten Platz zurücksetzten.16/17 Ist man mit der Eigentümerstruktur bei VW vertraut, wo die Gründerfamilien nach wie vor über 50 Prozent der Anteile besitzen und 20 Prozent beim Bundesland Niedersachsen liegen, kennt man den Einfluss des Betriebsrats, ohne den bei VW nichts geht, und vertieft man sich in die Produktivität und Profitabilität, dann produziert Volkswagen mit 610.000 Mitarbeitern genauso viele Autos wie Toyota mit gerade mal 340.000 Beschäftigten; und dann ist die Frage nicht mehr, ob, sondern wann Volkswagen zerlegt und vom Markt verschwinden wird.
Doch nun zurück zu einem anderen Kollaps, dem prophezeiten Straßenuntergang durch Pferdekot. Der fand tatsächlich allerdings nie statt, denn auch hier kam es zu einer Revolution.
Der letzte Pferde-
kutscher oder Die 1. Automobil-revolution
Wien um 1900. Zwei Herren stehen am Straßenrand. Eines der neumodischen Automobile fährt vorbei. Beide Herren schauen ihm nach. Wendet sich der eine an den anderen und sagt abschätzig: „Na, das wird auch wieder abkommen.“
DASS ES NICHT ZUM vorhergesagten Kollaps der Städte kam, lag an einer Erfindung, die genauso disruptiv wie unvorhersehbar war: dem Automobil. Mit Carl Friedrich Benz, der 1885 das erste praxistaugliche Auto baute und in Produktion brachte, sank die Bedeutung von Pferden als Transportmaschinen – nicht zuletzt dank seiner wohlhabenden Frau Bertha Benz, die mit der Erfindung ihres Mannes mutig die erste Überlandfahrt von Pforzheim nach Mannheim wagte und damit exzellente Werbung für das neue Fortbewegungsmittel machte. Die von Pferdekot, Hufeisen, Wagenrädern und Pferdeleichen übersäten Straßen wurden bald darauf von Automobilen beherrscht.
Was erhält man, wenn man eine Haarnadel, ein Strumpfband und die unerhörte Menge von zwei Litern Benzin aus einer Apotheke mit dem Wagemut, Erfindungsgeist und der Chuzpe einer Frau kombiniert? Die erste Städtefahrt eines Automobils.
Dank einer Frau, die als Risikokapitalgeberin ihr Erbe in das Start-up ihres Mannes steckte und die Regeln und Gesetze der Gesellschaft bewusst übertrat, um das Geschäft ins Laufen zu bringen, wurde eine deutsche Erfolgsgeschichte erst angestoßen.
1888 glaubten die Anrainer zwischen Pforzheim und Mannheim, ihren Augen nicht zu trauen: Auf der staubigen Landstraße zuckelte eine pferdelose Kutsche. Am Steuer saß eine Frau mit zwei Teenagern. Bertha Benz hatte ihre Söhne Eugen und Richard mit auf die Fahrt mit dem Automobil ihres Mannes genommen, um ihre Mutter in Pforzheim zu besuchen – ohne ihren Mann Carl Benz einzuweihen und ohne die notwendige Erlaubnis der lokalen Behörden eingeholt zu haben.
Auch wenn die Strecke zwischen Mannheim und Pforzheim gerade mal 106 Kilometer beträgt und nach heutigen Maßstäben einen Katzensprung darstellt, war dies im Jahr 1885 eine mehr als beachtliche Leistung. Die drei fuhren zwölf Stunden über ungepflasterte Straßen, mit gelegentlichem Anschieben des Wagens bei Steigungen. Alle paar Kilometer musste der Kühler nachgefüllt werden. Dank Bertha Benz’ Erfindungsgeist, der dem ihres Mannes in nichts nachstand, wurde die Reise zum Erfolg: Sie funktionierte eine Haarnadel um, um eine verstopfte Treibstoffleitung freizubekommen, und benutzte ihr Strumpfband, um eine abgenutzte Zündung zu isolieren.
Die Neuigkeiten verbreiteten sich rasch. Die Fahrt wurde zum regionalen Gesprächsthema, die Zeitungen berichteten ausführlich darüber. Die Werbeaktion war ein Geniestreich von Bertha Benz. Innerhalb eines Jahrzehnts produzierte das Unternehmen ihres Mannes 600 Fahrzeuge pro Jahr.
Ob Carl Benz nun wirklich das Auto erfand oder doch andere früher dran waren, ist letztendlich irrelevant. Die Idee, eine Dampfmaschine oder einen Motor auf eine Kutsche zu setzen, kam anderen Menschen auch. Denn das ist ein gängiges Phänomen in der Geschichte von Erfindungen. Das sogenannte „benachbarte Mögliche“ lässt etwas sozusagen in der Luft liegen, das nur darauf wartet, von jemandem auf die Erde geholt zu werden. Die einzelnen Komponenten sind bereits da, und irgendjemand kommt früher oder später auf die Idee, sie miteinander zu kombinieren. Das Telefon, die Batterie, die Schiffsschraube und eben auch der Kraftwagen wurden gleichzeitig von mehreren Personen erfunden, die oftmals nichts voneinander wussten und sich sogar in unterschiedlichen Ländern oder auf anderen Kontinenten befanden.
Schon 1922 untersuchten zwei Forscher der Columbia University diese Tatsache. Sie fanden mehr als 140 Beispiele von unabhängig voneinander stattfindenden Innovationen und Entdeckungen, die meisten davon wurden sogar innerhalb desselben Jahrzehnts gemacht.1 Ausschlaggebend ist aber, ob eine Erfindung für die Allgemeinheit verfügbar gemacht wird. Der schönste Kraftwagen hilft niemandem, wenn er in der Garage des Erfinders herumsteht. Er muss gebaut und an Nutzer verkauft werden. Erst dann wird er zur Innovation.
Bill Aulet, Entrepreneurship-Dozent am Massachusetts Institute of Technology (MIT), definiert Innovation wie folgt:
Bevor es dazu kommt, müssen Fragen gestellt werden. Und auf diese Fragen müssen Handlungen folgen, die in eine Entdeckung oder gar eine Innovation münden.
Die Vorgehensweise dabei ist bei allen Innovatoren ähnlich. Zuerst stößt jemand auf etwas, was ihm verbesserungswürdig scheint, und er fragt sich: „Warum wird das so gemacht?“ Danach versucht er herauszufinden, wie es besser funktionieren könnte. Die Frage wandelt sich zu: „Was wäre, wenn wir es so machten?“ Hat man sich alle Alternativen und Variationen angesehen, folgt die Frage: „Wie gehen wir es praktisch an?“
Das ist die eigentliche Leistung von Carl und Bertha Benz (und jedes Innovators). Dank des unnachgiebigen Drängens und der Husarenfahrt seiner Frau, die sich ganz im Sinne von Erfindern mit disruptiven Ideen über Verbote und Regulierungen hinwegsetzte, trudelten die Bestellungen ein, und die Serienfertigung der ersten Automobile begann. Eine Frau war dafür verantwortlich, dass das Automobilzeitalter seinen Lauf nahm. Eine gern nur in Nebensätzen erwähnte und doch so überaus bedeutende Leistung in der Geschichte des Automobils.
Wenig bekannt ist auch die Tatsache, dass in den folgenden Jahrzehnten gar nicht klar war, welcher Antrieb die Oberhand gewinnen würde. Neben dem Benzinmotor standen sowohl Dampfmaschinen als auch Elektroantriebe zur Verfügung. Tatsächlich lag im Jahr 1900 der Anteil an Dampfkraftwagen in den USA bei 40 Prozent, 38 Prozent waren elektrisch betrieben und nur 22 Prozent Benziner.4 Es schien sich dabei eine klare Aufgabenteilung herauszukristallisieren. Während Dampfkraftwagen für schwere Lasten Verwendung fanden, waren die Elektrofahrzeuge vor allem im innerstädtischen Bereich im Einsatz. Städte waren damals gerade noch „ergehbar“. Und Benzinautos eigneten sich gut für längere Fahrten in die Vorstädte und auf dem Land.
Unter den amerikanischen Elektrofahrzeug-Herstellern befanden sich Anthony Electric, Baker, Columbia, Anderson, Detroit Electric, Edison, Studebaker und Riker. Aber auch im deutschsprachigen Raum gab es den Flocken Elektrowagen, den Lohner-Porsche und über zwei Dutzend weitere Hersteller. Detroit Electric produzierte in drei Jahrzehnten über 12.000 Elektrofahrzeuge, die mit einer Reichweite von 130 Kilometern angepriesen wurden und knapp 30 km/h erreichten.
Angesichts der großen Verbreitung von Elektrofahrzeugen um 1900 stellt sich die Frage, was zu ihrem Niedergang geführt hat. Nun, das hatte mehrere Gründe. Zum einen brachte die Weiterentwicklung von Verbrennungsmotoren mehr Leistung, Reichweite und Zuverlässigkeit. Musste in der Anfangszeit der Verbrennungsmotor noch per Handkurbel gestartet werden, was weder leicht noch ungefährlich war, weil durch das Anspringen des Motors oft die Handkurbel mitgedreht wurde und Hand- und Armbrüche verursachte, so bedeutete die Erfindung des elektrischen Starters eine Lösung für dieses Problem. Benziner wurden einfacher bedienbar. Andererseits führte die zunehmende Verbreitung zu einer Ausdehnung der Städte, was wiederum eine größere Reichweite der Automobile erforderte. Auf Verbrennungsmotoren basierende Fahrzeuge eigneten sich besser dafür.
Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs war der Siegeszug von Verbrennungskraftfahrzeugen nicht mehr aufzuhalten. Elektroautos und Dampfkraftwagen verschwanden zunehmend aus dem Stadtbild. 1939 schloss dann auch der erfolgreichste Elektrofahrzeughersteller Detroit Electric endgültig seine Pforten.
Elektriker, Büchsenmacher,
Physiker: Automobilpioniere damals und heute
„Sei Realist und verlange das Unmögliche!“
– Anarcho-Slogan
WER ABER WAREN die Männer, die die Pferdeindustrie mit Automobilen hinwegfegten? Wenn wir uns die Lebens- und Ausbildungswege von Carl Benz oder Ferdinand Porsche ansehen, dann fällt uns sofort auf, dass sie nicht aus der Transportindustrie kamen. Benz war Maschinenbauingenieur, Porsche eigentlich Installateur und Elektriker und Nicolaus Otto, nach dem der Otto-Motor benannt ist, sogar Kaufmann, der sich selbst alles notwendige Wissen beibrachte, um an seinen Erfindungen zu tüfteln. Gottfried Daimler durchlief eine Büchsenmacherlehre, bevor er Maschinenbau studierte. Der Webereibesitzer August Sporkhorst und der Verleger Robert Allmers gründeten Hansa-Automobil.5 Johann Puch war Schlosser und Wilhelm von Opel Ingenieur.
Ludwig Lohner dagegen kam als einer der Wenigen aus einer Kutschenmacherfamilie. Der im Jahr 1821 vor Napoleon aus dem Elsass nach Wien geflüchtete Heinrich Lohner hatte das Unternehmen gegründet. Jacob Lohner & Co. stellte Pferdewagen und Luxuskutschen her und wurde sogar zum k.u.k-Hoflieferanten ernannt; 1897 stellte der Betrieb zusammen mit Ferdinand Porsche den ersten Elektrowagen her.6 Relativ rasch konzentrierte sich Lohner dann auf den Flugzeug- und Straßenbahnbau sowie in späterer Folge auf den Bau von Motorrollern. In den USA finden wir Studebaker, der als Kutschenmacher begann und bis in die 1960er Jahre dann Autos produzierte (siehe Tabelle 1).
Name
Leben
Ausbildung
Robert Allmers
1872–1951
Verleger
Herbert Austin
1866–1941
Techniker
Carl Friedrich Benz
1844–1929
Maschinenbauer
Bertha Benz
1849–1944
Risikokapitalgeberin, Mitbegründerin, Ingenieurin, Regelbrecherin, Testpilotin
Ettore Bugatti
1881–1947
Ingenieur
Gottlieb Daimler
1834–1900
Ingenieur, Industrialist
Albert de Dian
1856–1946
Mechaniker, Germanist
Henry Ford
1863–1947
Mechaniker
Frederick William Lanchester
1968–1946
Ingenieur
Hans List
1896–1996
Maschinenbauer
Ludwig Lohner
1858–1925
Kutschenmacher
Wilhelm Maybach
1846–1929
Konstrukteur
Nicolaus Otto
1832–1891
Kaufmann
Ferdinand Porsche
1875–1951
Installateur, Elektriker
Johann Puch
1862–1914
Schlosser
Louis Renault
1877–1944
Mechaniker
Charles Rolls
1877–1910
Ingenieur
Frederick Henry Royce
1863–1933
Ingenieur
August Sporkhorst
1870–1940
Webereibesitzer
Wilhelm von Opel
1871–1948
Ingenieur
Tabelle 1: Ausgewählte Automobilpioniere und ihre Ausbildung
Ganz gleich, ob wir uns Automobilpioniere aus dem deutschsprachigen Raum, aus Frankreich, England oder den USA ansehen – kaum jemand von ihnen war vorher in der Kutschen- oder Pferdeindustrie tätig gewesen. Wie ist es möglich, dass Außenseiter alteingesessene Unternehmen verdrängen und diese den Übergang in die neue Zeit nicht schaffen?
Harvard-Professor Clayton Christensen hat sich damit bereits vor vielen Jahren beschäftigt. Als er eine Untersuchung zu Speichermedien über mehrere Generationen hinweg durchführte und sich die Hersteller von Magnetbändern über Floppy Disks bis hin zu Memory Sticks ansah, realisierte er, dass sich unter den Herstellern der neuen Generation 50 bis 80 Prozent Neueinsteiger befanden. Den dominanten Anbietern der Vergangenheit gelang nur in den seltensten Fällen der Übergang in die nächste Technologie-Ära und die Verteidigung einer führenden Rolle.7
Das gilt für alle Industrien, in denen disruptive Innovationen die Grundfesten erschütterten, egal, wohin man blickt. Kodak und Polaroid verpassten völlig den Sprung in die Welt der Digitalkameras, die Videoverleihkette Blockbuster konzentrierte sich zu lange auf den Verleih in Läden, bis es zu spät war, um Netflix Paroli zu bieten. Noch 1975 war Eumig der größte Filmprojektorenhersteller der Welt, was keine Rolle mehr spielte, als Videorekorder auf den Markt kamen. Das Unternehmen meldete 1982 Konkurs an, und das mit 100 Prozent Marktanteil in einem Markt, der auf null geschrumpft war. 2007 war Nokia noch mit einem Drittel unbestrittener Marktführer bei Mobiltelefonen, aber bereits ein Jahr später brachen die Umsätze ein. Apples iPhone hatte seinen Siegeszug begonnen.
Zwischen 1956 und 1981 wurden jährlich 24 Unternehmen aus der „Forbes-500-Liste“ gestrichen. Zwischen 1982 und 2006 waren es schon jährlich 40.8 Alle zwei Wochen verschwindet ein Unternehmen aus dem „S&P500-Index“, was heißt, dass innerhalb von 16 Jahren 75 Prozent aller Unternehmen ausgetauscht werden.9 Wer den Sprung verpasst, wer hinterherhinkt, verliert. Oder wie Googles inoffizielles Motto lautet: „If you are not fast, you are fucked.“ (Wenn du nicht schnell bist, dann hast du ausgeschissen.)
Studebaker oder Lohner waren Ausnahmen, die den Sprung vom Kutschenhersteller zum Automobilproduzenten schafften. Der Umbruch kommt meist nicht aus der eigenen Disziplin, sondern wird oft erst durch andere Industriezweige angestoßen oder zumindest beschleunigt. 1859 sprudelte erstmals das Öl in den USA. Auf der Weltausstellung von 1876 in Philadelphia wurden neben mechanischen, landwirtschaftlichen und wissenschaftlichen Errungenschaften auch die erste Schreibmaschine, das Fahrrad und Heinz Tomato Ketchup vorgestellt. Das Fahrrad sollte dabei eine ganze Generation von Mechanikern entstehen lassen, die ihre Erfahrung später in die Entwicklung des Flugzeugs und des Automobils steckten. Um 1900 drehten sich nahezu ein Drittel aller eingereichten Patente in den USA um Verbesserungen für das Fahrrad. Ohne die Schreibmaschine wären moderne Unternehmen mit ihren Massenproduktionen und ihrem Verlangen nach Dokumenten kaum denkbar gewesen.
In der 2. Automobilrevolution wird dieses Muster erneut erkennbar. Der Background der modernen Pioniere und die Fortschritte in kritischen Technologien weisen darauf hin. Tesla-Chef Elon Musk ist Physiker. Googles Larry Page und Sergey Brin sind Informatiker wie auch Shai Agassi, der das Batterieaustauschunternehmen Better Place gegründet hat, und die Gründer von Uber und Lyft, die eben auch nicht aus der Transport- und Taxibranche kommen. Sechs von acht Gründern von Drive.ai haben ihren Doktor in Künstlicher Intelligenz gemacht.10 Sebastian Thrun, Gewinner des DARPA Grand Challenge und Mitgründer der Google-Selbstfahrabteilung, war Professor für KI in Stanford. Anthony Levandowski, dessen Start-up 510 Systems in der Google-Selbstfahrabteilung aufging und der gemeinsam mit Thrun federführend an der Entwicklung beteiligt war, ist Wirtschaftsingenieur.11 Fast gleichzeitig gelangen Durchbrüche in Künstlicher Intelligenz, fielen die Preise und stieg die Leistungsfähigkeit von Sensoren; Speichermengen und Prozessorgeschwindigkeiten erlauben die Bearbeitung der anfallenden Daten.
Kommen wir nun wieder auf David und Goliath zurück. Wie gelingt es diesen vermeintlichen Außenseitern nur, gestandene Industrien zu erschüttern, nachhaltig zu verändern und die Platzhirsche aus dem Geschäft zu drängen? Mit was für einer Waffe bringen sie den Kontrahenten zu Fall? Eine neue Umgangsweise mit (Fach-)Wissen und das richtige Mindset könnten hier die Antwort sein. Und man verstehe das nicht falsch: Solide Expertise ist für Innovation und Kreativität wichtig, sie bildet einen der Grundpfeiler. Gefährlich wird es, wenn man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht, wenn man zu tief eintaucht und Lösungen außerhalb des eigenen Spezialgebiets nicht erkennen kann.
Standen bei den Kutschenmachern noch Pferdezucht und Kutschenbau im Vordergrund, verschob sich mit dem Automobil der Fokus auf den Motor und alles, was damit zusammenhing. Gleichzeitig wurde das Fachwissen über Pferde(-Transport) in diesem Bereich überflüssig. Auch wenn die ersten Automobilisten noch viele Nachteile gegenüber dem erprobten System von vier Beinen und zwei bis vier Rädern in Kauf nehmen mussten, änderte sich die Gesamterfahrung. Disruptive Innovation ist nicht gleichzusetzen mit rein technologischer Innovation. Zwar gab es Letztere mit den entsprechenden Auswirkungen, aber andere Faktoren spielten eine ebenso bedeutende Rolle. Die Fahrzeuge konnten längere Strecken schneller bewältigen. Die physischen Beschränkungen von Pferden spielten keine Rolle mehr. Aufwendungen für Stallungen, Futter, Tierarzt oder Bedienstete fielen weg, auch der Gestank und die bereits erwähnten hygienischen Nachteile. Selbst wenn die ersten Motoren noch übel rußten und röhrten, es noch kein großflächiges Tankstellennetz gab oder Werkstätten, die den frühen Fahrern bei Pannen helfen konnten, wurden diese Minuspunkte doch über die Jahre hinweg beseitigt, und die Mobilität per Automobil erwies sich als viel vorteilhafter als die mit Pferdewagen.
Gegenargumente werden bei jedem Fortschritt laut, heute so wie gestern. Experten raten von Elektrofahrzeugen oder selbstfahrenden Autos ab, warnen vor Gefahren. Das Netzwerk an Ladestationen ist noch nicht dicht genug! Wer hat Schuld, wenn ein selbstfahrendes Auto einen Unfall baut oder jemanden tötet? Wie gefährlich sind Batterien, wenn sie zu brennen anfangen? Wie stoppt man ein selbstfahrendes Auto, das mit einer Bombe bestückt wurde?
Die neuen Automobilpioniere des digitalen Zeitalters betrachten Probleme jedoch erst einmal als reines Softwareproblem, sie wenden Methoden und Prinzipien aus der Softwareindustrie an, die Automobilexperten unbekannt sind. Anstatt auf Perfektion zu warten, bringen sie Beta-Versionen heraus. Reid Hoffman, Mitgründer des sozialen Netzwerks LinkedIn und des Bezahldienstes Paypal, sagt dazu: „Wenn du dich nicht für deine erste Version schämst, dann hast du zu lange darauf gewartet, sie auszuliefern.“12 Die Wertschöpfung liegt nicht mehr so sehr im „Verbiegen von Blech“, sondern im Programmieren von Softwarecodes. All das erlaubt es, den fundamentalen Zweck eines Autos zu hinterfragen. Wozu dient es eigentlich?
Dagegen klingen die seit Jahrzehnten gepflegten Slogans der Autohersteller wie „Vorsprung durch Technik“ oder das erst mit dem Abgas-Skandal aufgegebene „Das Auto“ im Zeitalter von Staus und Umweltverschmutzung immer schaler. BMW übersieht mit seinem „Freude am Fahren“, dass bei Weitem nicht so viele Leute Autofahren als Leidenschaft ansehen, wie es der Konzern annimmt. Das ist sicherlich bedingt durch den Selbstselektionsprozess bei der Einstellung neuer Mitarbeiter. Wer bewirbt sich denn bei BMW/Daimler/VW/Audi? Doch Leute, die selber gern Auto fahren. Was dabei von den Automobilherstellern vergessen wird, ist ihre eigentliche Mission. Und die besteht nicht darin, Freude am Fahren zu ermöglichen. Die besteht auch nicht darin, ein Transport- oder Mobilitätsproblem zu lösen. Ein Auto soll Verbindungen zwischen Menschen, Orten und Dingen in der physischen Welt herstellen. Das Auto ist ein „Connector“. Ich fahre nicht in die Stadt, weil ich Freude am Fahren habe, sondern weil ich mich mit Freunden treffen will. Ich fahre nicht zur Arbeit aus purer Lust am Fahren, sondern weil ich mich mit meinen Kunden und Mitarbeitern austauschen möchte, um gemeinsam etwas zu schaffen.
Immer häufiger übernehmen nun mobile Geräte diese Aufgabe. Ein iPhone ist ein virtueller Connector zwischen Menschen. Wenn ich selbst das Auto steuern muss, kann ich mich in diesem Moment nicht gut mit ihnen verbinden, weil ich auf den Verkehr achten muss. Dass viele Menschen trotzdem ihre Smartphones während der Fahrt bedienen und sich und andere dabei gefährden, zeigt, wie stark das Verlangen nach Kontakt ist.
Die deutschen Autobauer – wie auch die Platzhirsche in anderen Ländern – stellen sich dabei selbst ein Bein, ohne es zu merken. Durch die Bedeutung gerade dieses Sektors für die heimische Wirtschaft ist die Politik geneigt, der Branche immer wieder entgegenzukommen und ihr Vorteile zu verschaffen. Lobbyisten wissen das nur allzu gut auszunutzen. Weniger strenge Abgasvorschriften, geringe oder keine Strafen bei Vergehen, Fördergelder, die die eigenen Hersteller bevorzugen – alles unter dem Deckmäntelchen, Arbeitsplätze zu erhalten und den Standort zu fördern. Dabei wiegt man sich in Sicherheit und übersieht, dass ein Tsunami auf einen zurollt.13 Wie Helikoptereltern, die den eigenen Nachwuchs vor Enttäuschungen schützen wollen und sie damit geradezu abhängig von sich machen, verhindert die Bundesregierung, dass sich die eigenen Unternehmen dem Wettbewerb stellen und konkurrenzfähig bleiben.
Politiker fürchten, dass langfristige Maßnahmen zu kurzfristigen „Bestrafungen“ führen. Ein Dieselverbot könnte Liebesentzug von Autobauern wie auch von zornigen Dieselautobesitzern bedeuten, die nicht mehr in bestimmte Stadtgebiete fahren dürften und deshalb diese Politiker auch nicht mehr wählten. Dabei ist diese Angst eher unbegründet. Wie eine Studie der Columbia University herausfand, gewöhnen sich die Wähler nach sechs bis neun Monaten an eine unpopuläre Maßnahme und vergessen ihren ursprünglichen Widerstand.14 Stattdessen erliegen Politiker oft der „Vetokratie“, bei der es einfacher ist, etwas zu blockieren als etwas anzuschieben.15 Mit dem Versprechen gut bezahlter Posten nach einer Politikerkarriere bei den Lobbyarbeit leistenden Unternehmen wird da in der Amtsperiode so einiges verabschiedet, was nicht unbedingt im Interesse der Allgemeinheit liegt.
Dabei würde man sich wünschen, dass wir weiter als nur bis zur nächsten Wahl oder dem nächsten Quartalsbericht blickten. Das „Große Gesetz der Irokesen“ berücksichtigt bei jeder Erwägung einer Maßnahme deren Auswirkung bis auf die siebte Generation.16 Im Zeitalter von Quartalsergebnissen und Shareholder Value sind sieben Generationen so weit weg von uns wie die Dinosaurier – wenn auch in umgekehrter Richtung.
Die Liebe zum Auto:
leidenschaftlich und wankelmütig
„Glaube keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast.“
– Geflügeltes Wort
DIE SIEBTE GENERATION seit Erfindung des Automobils erreichen wir so langsam, und wir müssen wohl sagen, dass unsere Vorfahren ihren Job ziemlich schlecht gemacht haben. Zwar ersticken wir nicht mehr in Pferdekot, dafür aber in Autoabgasen, und wir sind so abhängig von unseren Fahrzeugen wie nie zuvor. Autos haben uns dazu gebracht, Städte für Autos und nicht für Menschen zu planen.