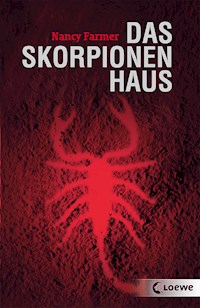
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Loewe Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Als Matt in den Spiegel blickt, sieht er nicht nur sich. Als Matt Freunde sucht, findet er Verrat. Als Matt die Wahrheit erfährt, ist er auf der Flucht. Matt ist kein gewöhnlicher Junge. Sein Schicksal ist das Skorpionenhaus. Matt ist in der Zukunft geboren, hinein in eine Welt, die ihn verabscheut. Denn Matt ist ein Klon. In einer Gesellschaft, die keine Skrupel kennt, gerät er in ein gefährliches Netz aus Intrigen und Täuschungen. "Ein utopischer Roman, der von wahren und starken Charakteren lebt – Menschen, die sich wirklich um andere sorgen, Kinder, die unsicher und verletzlich sind, mächtige Diktatoren, die man bedauern muss, charakterstarke und sympathische Menschen, die schreckliche Fehler machen." Ursula K. Le Guin Die Amerikanische Originalausgabe von "Das Skorpionenhaus" wurde im Oktober 2002 mit dem "National Book Award", dem wichtigsten amerikanischen Literaturpreis, ausgezeichnet. Im Oktober 2004 wurde "Das Skorpionenhaus" mit dem "Buxtehuder Bullen" als bestes Jugendbuch des Jahres 2003 ausgezeichnet. Weitere Preise: - Michael L. Printz Award - Newbery Honor Award - ALA (American Library Association) Notable Books for 2003
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 540
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
KINDHEIT: 0 BIS 6 JAHRE
Am Anfang
In den Mohnfeldern
Eigentum der Familie Alacrán
María
Das Gefängnis
JUGEND: 7 BIS 11 JAHRE
El Patrón
Lehrerin
Der Mann im verdorrten Feld
Der Geheimgang
Neun Leben
Geschenke
Das Ding auf dem Bett
Der Lotosteich
Celias Geschichte
ALTER: 12 BIS 14 JAHRE
Ein verhungerter Vogel
Bruder Wolf
Die Migit-Pferche
Drachenhort
Die zersplitterte Stimme
Esperanza
Bluthochzeit
Der Treuebruch
14 JAHRE
Tod
Ein letztes Lebewohl
Die Farm-Patrouille
EIN NEUES LEBEN
Die verlorenen Jungen
Ein Pferd mit fünf Beinen
Plankton
Für Harold für all seine Liebe und Unterstützung und für Daniel, unseren Sohn.
Für meinen Bruder, Dr.Elmon Lee Coe, und meine Schwester, Mary Marimon Stout.
KINDHEIT:
0 BIS 6 JAHRE
AM ANFANG
Am Anfang waren es 36. 36Tröpfchen Leben – so winzig, dass Eduardo sie nur unter einem Mikroskop erkennen konnte. Er betrachtete sie besorgt in dem verdunkelten Raum.
Wasser sprudelte durch Schläuche, die sich an warmen, feuchten Wänden entlangringelten. Luft wurde in Brutkammern gesaugt. Ein schwaches rotes Licht beschien die Gesichter der Labortechniker, sooft sie sich über ihre gläsernen Plättchen beugten und sie in Augenschein nahmen. Ein jedes enthielt einen Tropfen Leben.
Eduardo schob seine Objektträger einen nach dem anderen unter das Mikroskop. Die Zellen waren perfekt – zumindest schien es so. Jede einzelne trug alles in sich, was sie benötigte, um zu einem Lebewesen heranzuwachsen. So viel Wissen war in diesem winzigen Kosmos verborgen! Selbst Eduardo, der dieses Verfahren nur zu gut kannte, empfand Ehrfurcht. Diese winzige Zelle wusste bereits, welche Haarfarbe das aus ihr entstehende Geschöpf haben und wie groß es werden würde und ob es Spinat oder Brokkoli bevorzugte. Selbst eine nebelhafte Vorliebe für Musik oder Kreuzworträtsel mochte es schon geben. All das versteckte sich in diesem Tröpfchen.
Schließlich erbebten die runden Umrisse; Linien erschienen und teilten die Zellen in zwei Hälften. Eduardo, der angespannt die Luft angehalten hatte, atmete aus. Es würde gut gehen. Er beobachtete, wie die Proben wuchsen, und dann schob er sie vorsichtig in den Inkubator.
Aber es ging nicht gut. Irgendetwas an der Nährlösung, der Temperatur, dem Licht war falsch – nur was? Sehr schnell starb mehr als die Hälfte der Proben ab. Jetzt waren es nur noch 15, und Eduardo spürte einen eisigen Klumpen in seinem Magen. Wenn er versagte, würde man ihn auf die Farmen schicken, und was sollte dann aus Anna und den Kindern werden, und aus seinem Vater, der schon so alt war?
„Es ist okay“, sagte Lisa – so nahe, dass Eduardo zusammenzuckte. Sie war eine der dienstältesten Technikerinnen. Sie arbeitete seit so vielen Jahren im Dunkeln, dass ihr Gesicht kreidebleich schimmerte und ihre blauen Venen durch die Haut zu sehen waren.
„Wie kann das okay sein?“, erwiderte Eduardo.
„Die Zellen wurden vor über 100Jahren eingefroren. Sie können gar nicht so gesund sein wie Proben, die man erst gestern entnommen hat.“
„So lang ist das schon her?“, staunte der Mann.
„Aber einige von ihnen sollten wachsen“, stellte Lisa klar.
Also begann sich Eduardo erneut zu sorgen. Einen Monat lief alles nach Plan. Der Tag kam, an dem er die winzigen Embryos in die Zuchtkühe implantierte. Die Kühe standen in Reih und Glied, sie warteten geduldig. Sie wurden über Schläuche gefüttert, und riesenhafte Metallarme hielten ihre Körper und Läufe gepackt und bewegten sie, gerade so, als streiften sie durch ein endloses Feld. Dann und wann schob eines der Tiere die Kiefer hin und her – ein armseliger Versuch wiederzukäuen.
Ob sie wohl von Löwenzahn träumen?, fragte sich Eduardo. Spürten sie einen Phantomwind, wie er ihnen hohes Gras gegen die Beine wehte? Schädel-Implantate füllten ihre Gehirne mit Bildern von Weiden und Wiesen. Waren sie sich der Kinder bewusst, die in ihrem Leib heranwuchsen?
Vielleicht hassten es die Kühe, was man ihnen angetan hatte; fest stand jedenfalls, dass ihre Körper die Embryos abstießen. Eines nach dem anderen starben die Kleinen – zu diesem Zeitpunkt nicht größer als eine Kinderhand.
Bis nur noch eines übrig war.
Eduardos Nächte waren voller Schrecken. Er schrie im Schlaf, und Anna fragte ihn nach dem Grund. Er konnte es ihr nicht sagen. Er konnte ihr nicht sagen, dass er seine Arbeit verlieren würde, wenn dieser letzte Embryo starb. Er würde auf die Farmen geschickt werden. Und sie, Anna, und ihre Kinder und seinen Vater würde man davonjagen – hinaus auf die heißen, staubigen Straßen.
Doch dieser eine Embryo wuchs, bis er ein Lebewesen mit Armen und Beinen und einem winzigen, verträumten Gesicht war. Eduardo beobachtete ihn auf den Monitoren der 3-D-Scanner. „Du hältst mein Leben in deinen Händen“, gestand er dem Kleinen. Als könne er ihn hören, bog und drehte sich der winzige Körper in der Gebärmutter, bis er dem Mann zugewandt war. Und Eduardo verspürte eine völlig unsinnige Regung – Zuneigung.
Als der Tag kam, reichte man ihm das Neugeborene, als sei es sein eigenes Kind. Seine Augen schwammen in Tränen; er legte es in ein Kinderbettchen und griff nach jener Spritze, die der Intelligenz des Kleinen jede Schärfe nehmen würde.
„Der hier wird nicht normiert“, rief Lisa hastig und fiel ihm in den Arm. „Es ist ein Matteo Alacrán. Sie werden immer intakt gelassen.“
Habe ich dir damit einen Gefallen getan?, dachte Eduardo, als er dem Baby zusah, wie es den Kopf drehte, hin zu den geschäftig umhereilenden Schwestern in ihren gestärkten weißen Kitteln. Wirst du mir dafür später einmal dankbar sein?
IN DEN MOHNFELDERN
Matt stand vor der Tür und breitete die Arme aus. Er wollte Celia davon abhalten zu gehen. In das kleine, voll gestopfte Wohnzimmer drang nur schwach das fahle Morgenlicht. Die Sonne hatte sich noch nicht über die Berge geschoben, die den fernen Horizont begrenzten.
„Was soll denn das?“, sagte die Frau. „Du bist doch schon ein großer Junge, fast sechs. Du weißt, ich muss arbeiten.“ Sie nahm ihn hoch – genau so, wie Erwachsene das immer tun, wenn sie Kinder aus dem Weg haben wollen.
„Nimm mich mit“, bettelte Matt und krallte sich an ihrer Bluse fest.
„Hör auf damit.“ Celia löste seine Finger sanft von dem Stoff. „Du kannst nicht mitkommen, mi vida. Du musst wie eine brave, kleine Maus im Nest versteckt bleiben. Da draußen gibt es Falken, die fressen kleine Mäuse.“
Mi vida nannte ihn Celia zärtlich – mein Leben. Doch das konnte Matt nicht besänftigen.
„Ich bin keine Maus!“, schrie er und kreischte, so laut es ging. Selbst wenn Celia nur bleiben würde, um ihm noch eine Standpauke zu halten – das war es wert. Er konnte es nicht ertragen, einen weiteren Tag allein gelassen zu werden.
Celia setzte ihn ab. „Sei still! Willst du, dass mir das Trommelfell platzt? Du schreist ja wie ein Verrückter. Da, wo andere ihren Verstand haben, staubt bei dir nur Maismehl herum!“
Matt warf sich mürrisch in den großen Sessel.
Celia kam zu ihm, kniete sich hin und nahm ihn in die Arme. „Nicht weinen, mi vida. Ich lieb dich mehr als irgendjemand anderen auf der Welt. Aber es geht nicht. Ich kann dich nicht mitnehmen. Ich werde dir alles erklären, wenn du alt genug bist.“
Aber das würde sie nicht. Sie hatte dieses Versprechen schon öfter gegeben. Plötzlich gab Matt sich geschlagen. Er war zu klein und zu schwach, um gegen das anzukämpfen, was Celia veranlasste, ihn Tag für Tag allein zu lassen.
„Bringst du mir ein Geschenk mit?“, fragte er und wich ihrem Kuss aus.
„Aber natürlich!“, rief die Frau lachend und streichelte ihm über den Kopf.
So erlaubte Matt ihr zu gehen, doch gleichzeitig war er wütend. Es war eine seltsame Art Wut, denn ihm war zugleich nach Weinen zu Mute. Das Haus war so einsam ohne Celia. Niemand sang, keine Töpfe klapperten, niemand sprach mit ihm. Selbst wenn Celia schlief – und sie schlief immer schnell ein nach den langen Stunden der Arbeit, wenn sie den ganzen Tag für die Leute im großen Haus gekocht hatte –, waren die Zimmer erfüllt von ihrer Gegenwart.
Als Matt noch jünger gewesen war, schien es darauf nicht anzukommen. Er hatte sich stundenlang mit seinen Spielsachen beschäftigt und ferngesehen. Er hatte aus dem Fenster geblickt – auf weiße Mohnblumenfelder, die sich endlos bis zu den Hängen der blauen Berge erstreckten. Das Weiß schmerzte ihn immer bald in den Augen, und so wandte er sich erleichtert wieder dem Dämmerlicht im Innern des Hauses zu.
Doch später hatte er es sich angewöhnt, gründlicher hinzusehen. Die Mohnfelder waren keine vollkommene Einöde. Ab und zu sah er Pferde – er kannte sie aus Bilderbüchern –, die zwischen den Reihen der weißen Blumen dahintrotteten. Es war schwer festzustellen, wer auf ihnen ritt, die strahlende Helligkeit war so allgegenwärtig. Doch die Reiter schienen keine Erwachsenen zu sein, sondern Kinder wie er.
Und mit dieser Entdeckung wuchs der Wunsch in ihm, sie aus der Nähe zu sehen.
Matt hatte die Kinder im Fernsehen beobachtet. Er hatte festgestellt, dass sie selten allein waren. Sie machten Dinge zusammen, zum Beispiel Burgen bauen oder Fußball spielen, oder sie stritten sich. Selbst streiten war interessant, solange es bedeutete, dass man andere Menschen um sich hatte. Matt sah außer Celia und, einmal im Monat, dem Arzt niemals irgendjemanden. Und der Arzt war ein unfreundlicher Mann und mochte Matt offenbar überhaupt nicht.
Matt seufzte. Um irgendetwas unternehmen zu können, musste er nach draußen – und Celia hatte ihm wieder und wieder eingeschärft, wie schrecklich gefährlich das war. Davon abgesehen waren Türen und Fenster fest verschlossen.
Matt setzte sich an einen kleinen hölzernen Tisch und nahm eines seiner Bücher zur Hand. Pedro el Conejo stand auf dem Titelbild. Matt konnte bereits ein wenig lesen – sogar Englisch und Spanisch. Er und Celia mischten die beiden Sprachen, aber das machte nichts. Sie verstanden einander.
Pedro el Conejo war ein ungezogenes kleines Kaninchen, das sich immer in Señor MacGregors Garten schlich und den Kopfsalat auffraß. Señor MacGregor wollte aus Pedro eine Pedro-Pastete backen, aber nach vielen Abenteuern kam Pedro gerade noch einmal davon. Es war eine spannende Geschichte.
Matt schlug das Buch zu und schlenderte in die Küche. Darin standen auch ein kleiner Kühlschrank und eine Mikrowelle. Auf der Mikrowelle klebte ein Schild mit der Warnung: GEFAHR!, außerdem hatte Celia überall gelbe Notizzettel befestigt, auf denen NEIN! NEIN! NEIN! NEIN! geschrieben stand. Um ganz sicherzugehen, hatte sie auch noch einen Gürtel um die Mikrowelle geschlungen und den Gürtel mit einem Vorhängeschloss gesichert. Sie lebte in der ständigen Angst, dass Matt eine Möglichkeit finden würde, die Mikrowelle aufzubekommen und, während sie bei der Arbeit war, seine kleinen Eingeweide zu kochen, wie sie es ausdrückte.
Matt hatte keine Ahnung, was Eingeweide waren, und er wollte es auch gar nicht wissen. Er machte einen Bogen um die gefährliche Maschine und öffnete den Kühlschrank. Das war eindeutig sein Hoheitsgebiet. Celia füllte den Kühlschrank jeden Abend mit Köstlichkeiten. Da sie für das große Haus kochte, gab es stets eine Menge zu essen. Matt förderte Sushi, Hummerkrabben, Pakoras und Burritos zu Tage – was die Leute im großen Haus eben so aßen. Und da stand immer auch ein großer Karton mit Milch und mehreren Flaschen Fruchtsaft.
Matt häufte sich einen Teller voll und ging in Celias Zimmer.
Auf der einen Seite stand ihr großes, durchhängendes Bett, das mit gehäkelten Kissen und Stofftieren überhäuft war. Am Kopfende hingen ein gewaltiges Kruzifix und ein Bildnis von Jesus Christus, dessen Herz von fünf Schwertern durchbohrt war. Matt fand das Bild Furcht einflößend. Doch das Kruzifix war noch schlimmer, denn es leuchtete im Dunkeln. Er hielt ihm stets den Rücken zugewandt, aber Celias Zimmer mochte er trotzdem.
Er krabbelte über die Kissen hinweg und tat so, als füttere er den Stoffhund, den Teddybären und das Kaninchen. Für eine Weile machte das Spaß, doch schließlich ergriff ein hohles Gefühl von Matt Besitz. Das waren keine richtigen Tiere, mit denen er da spielte. Er konnte mit ihnen reden, so viel er wollte. Sie würden nichts verstehen, würden nicht reagieren. Auf eine Art und Weise, die er nicht in Worte fassen konnte, waren sie nicht einmal da.
Matt drehte sie alle mit dem Gesicht zur Wand und bestrafte sie so dafür, dass sie nicht echt waren, dann tappte er in sein Zimmer hinüber. Es war viel kleiner und wurde zur Hälfte von seinem Bett ausgefüllt. Die Wände waren mit Bildern tapeziert, die Celia aus Zeitschriften herausgerissen hatte: Kinostars, Tiere, Blumen, Babys – von den Babys war Matt nicht sonderlich begeistert, aber Celia fand sie süß. Ein paar Zeitungsausschnitte berichteten von sensationellen oder verrückten Begebenheiten. Da gab es ein Foto von einer menschlichen Pyramide, bei der ein Akrobat auf dem anderen balancierte. 64!, verkündete die Schlagzeile. Ein neuer Rekord in der Lunearen Kolonie. Matt hatte diese merkwürdigen Worte schon so oft gelesen, dass er sie in- und auswendig kannte. Ein anderes Bild zeigte einen Ochsenfrosch, der zwischen zwei Toastscheiben eingeklemmt auf einem Salatblatt lag. LUST AUF EIN SAFTIGES STEAK?, stand in Großbuchstaben darüber. Matt wusste nicht, was daran komisch war, doch Celia lachte jedes Mal, wenn sie darauf schaute.
Er schaltete den Fernseher ein und zappte sich durch drei, vier, fünf Familienserien. Die Leute schrien sich ständig an in diesen Serien. Ihr Verhalten ergab kaum einen Sinn, und wenn, dann war es uninteressant. Es ist nicht echt, dachte Matt in einem Anflug von Zorn. Es war wie mit den Stofftieren. Er konnte reden und reden und reden, aber die Leute hörten ihn nicht.
Matt wurde von einem derart intensiven Gefühl von Einsamkeit überschwemmt, dass er glaubte, sterben zu müssen. Er schlang die Arme um sich, um nicht zu schreien. Er schluchzte; sein ganzer Körper zuckte und zuckte. Tränen strömten ihm über die Wangen.
Und dann – jenseits des Geplappers aus dem Fernseher, jenseits seiner eigenen Schluchzer – hörte Matt eine Stimme rufen. Hörte sie ganz klar und deutlich … eine Kinderstimme. Und sie war wirklich.
Matt rannte ans Fenster. Celia ermahnte ihn zwar unablässig, vorsichtig zu sein, wenn er hinausschaute, aber er war so aufgeregt, dass er sich jetzt kein bisschen darum kümmerte. Zuerst sah er nur das stets gleiche, alles überblendende Weiß der Mohnblumen. Dann huschte ein Schatten vor dem Fenster vorbei. Matt schreckte so heftig zurück, dass er das Gleichgewicht verlor und nach hinten fiel.
„Was ist das für eine Bruchbude?“, sagte draußen jemand.
„Eine von den Arbeiterhütten“, antwortete eine andere, hellere Stimme.
„Ich glaub nicht, dass es erlaubt ist, mitten in den Opiumfeldern zu wohnen.“
„Vielleicht ist es ein Lagerraum. Versuchen wir mal, ob wir die Tür aufkriegen.“
Der Türgriff bewegte sich; jemand rüttelte daran. Matt kauerte sich auf dem Boden zusammen, sein Herz raste. Ein Gesicht drückte sich gegen das Fenster, Handflächen wölbten sich links und rechts davon, schirmten die Helligkeit ab, um den Blick in das düstere Innere der Hütte zu ermöglichen. Matt fror. Er hatte sich Gesellschaft gewünscht, oh ja, aber das hier ging zu schnell.
„Hey, da drin ist ein Kind!“
„Was? Lass mal sehen.“ Ein zweites Gesicht presste sich gegen das Fenster – ein Mädchen. Sie hatte schwarze Haare und olivfarbene Haut, wie Celia. „Mach das Fenster auf, Kleiner. Wie heißt du?“
Doch Matt war so zu Tode erschreckt, dass er kein einziges Wort herausbekam.
„Vielleicht ist er ein Idiot“, stellte das Mädchen ganz sachlich fest. „Hey, bist du ein Idiot?“
Matt schüttelte den Kopf. Das Mädchen lachte.
„Ich weiß, wer hier wohnt“, entfuhr es dem Jungen plötzlich. „Das Foto da auf dem Tisch … ich kenne die Frau.“
Matt erinnerte sich an die Porträtaufnahme, die Celia ihm an seinem letzten Geburtstag geschenkt hatte.
„Es ist die fette, alte Köchin – wie heißt die noch …?“, grübelte der Junge. „Na, egal, jedenfalls wohnt die nicht bei den anderen Dienstboten. Das hier muss ihre Hütte sein. Ich wusste gar nicht, dass sie ein Kind hat.“
„Oder einen Mann“, bemerkte das Mädchen.
„Stimmt. Das erklärt eine Menge. Ob Vater wohl darüber Bescheid weiß? Ich werd es ihm erzählen müssen.“
„Das wirst du nicht!“, bestimmte das Mädchen entschieden. „Du bringst sie in Schwierigkeiten.“
„Hey, das hier ist die Farm meiner Familie, und mein Vater hat mir x-mal eingebläut, dass ich die Augen offen halten soll. Du bist nur zu Besuch da.“
„Ist doch egal! Mein Dad sagt, Dienstboten haben auch ein Recht auf Privatsphäre, und er ist Senator der Vereinigten Staaten, also zählt seine Meinung wohl mehr.“
„Dein Dad wechselt seine Meinungen öfter als seine Socken“, sagte der Junge und lachte.
Was das Mädchen darauf erwiderte, konnte Matt nicht mehr verstehen. Er hörte nur noch den entrüsteten Tonfall ihrer Stimme – die Kinder entfernten sich vom Haus. Matt zitterte am ganzen Leib, es war, als sei er einem jener Monster begegnet, die – wie Celia behauptete – die Welt draußen heimsuchten, dem Chupacabras vielleicht. Der Chupacabras saugte einem das Blut aus, und man vertrocknete und verschrumpelte wie die Haut einer alten Warzenmelone.
Matt atmete tief durch. Alles war zu schnell gegangen.
Aber das Mädchen hatte ihm gefallen.
Angst und Freude zugleich wirbelten in ihm – und so blieb es für den Rest dieses Tages. Celia hatte ihm so oft eingeschärft, sich nie, niemals am Fenster blicken zu lassen. Wenn jemand kam, sollte er sich verstecken. Doch die Kinder waren eine so wunderbare Überraschung gewesen, dass er nicht anders hatte reagieren können; er hatte losrennen, hatte sie sehen müssen. Sie waren älter als er. Wie viel älter, das konnte Matt nicht sagen. Trotzdem waren sie eindeutig keine Erwachsenen, und sie schienen auch nicht gefährlich zu sein. Celia allerdings würde ziemlich wütend werden, wenn sie diese Geschichte zu hören bekam. Matt beschloss, ihr nichts zu erzählen.
An diesem Abend brachte sie ihm ein Malbuch mit, das die Kinder des großen Hauses weggeworfen hatten. Nur die Hälfte davon war benutzt, und so verbrachte Matt vor dem Abendessen eine Stunde mit den kleinen Kreidestummeln, die Celia ihm bei einer anderen Gelegenheit geschenkt hatte. Der Duft von gebackenem Käse und Zwiebeln zog aus der Küche herüber, und Matt wusste, dass Celia ein Aztláno-Essen kochte. Dies war ein ganz besonderer Festschmaus. Abends war sie normalerweise so müde, dass sie nur Reste aufwärmte.
Matt malte eine ganze Wiese grün aus. Sein Kreidestummel war beinahe aufgebraucht, und er musste ihn am äußersten Ende halten, um ihn überhaupt noch verwenden zu können. Das Grün machte ihn glücklich. Wenn er nur auf eine solche Wiese hinaussehen könnte, anstelle der blendend weißen Mohnblüten. Er war davon überzeugt, dass Gras so weich wie ein Bett war und nach Regen duftete.
„Sehr hübsch, mi vida“, lobte Celia – sie schaute ihm über die Schulter.
Das letzte Stückchen der Kreide zerbröckelte zwischen Matts Fingern.
„Ich werde zusehen, dass ich dir aus dem großen Haus mehr grüne Kreide mitbringen kann. Diese Kinder sind so reich, sie würden’s nicht mal merken, wenn ich die ganze verdammte Schachtel stehlen würde.“ Celia seufzte. „Trotzdem werde ich nur ein paar mitnehmen. Die Maus ist am sichersten, wenn sie keine Fußspuren in der Butter hinterlässt.“
Es gab Quesadillas und Enchiladas zum Abendessen, die Matt satt und müde machten.
„Mama“, sagte er, ohne nachzudenken, „erzähl mir wieder was von den Kindern im großen Haus.“
„Du sollst mich nicht Mama nennen!“, fuhr Celia ihn an.
„Tut mir Leid“, murmelte Matt. Das Wort war ihm einfach so herausgerutscht. Celia hatte ihm schon vor langem gesagt, dass sie nicht seine richtige Mutter war. Aber die Kinder im Fernsehen hatten Mamas, und so war Matt in die Angewohnheit verfallen, in Celia genau das zu sehen … seine Mutter.
„Ich liebe dich mehr als alles andere auf der Welt“, beteuerte die Frau rasch. „Vergiss das nie. Aber du bist mir nur ausgeliehen worden, mi vida.“
Matt hatte Probleme damit, das Wort ausgeliehen zu verstehen. Es schien zu bedeuten, dass man für eine Weile etwas weggab. Wer auch immer ihn Celia ausgeliehen hatte, würde also irgendwann kommen und ihn wieder zurückverlangen.
„Jedenfalls sind die Kinder in dem großen Haus richtige Bälger, das kannst du mir glauben“, fuhr Celia fort. „Sie sind faul wie Faultiere und sehr undankbar. Ständig richten sie eine riesige Unordnung an, und dann befehlen sie den Dienstmädchen aufzuräumen. Und sie bedanken sich nie. Selbst wenn man stundenlang arbeitet, um ihnen einen ganz besonderen Kuchen mit Marzipanrosen und Schokoladentieren zu backen, kriegen sie kein Danke heraus, nicht um alles in der Welt. Sie stopfen sich ihre selbstsüchtigen Mäuler voll und behaupten, alles würde wie Matsch schmecken!“
Celia sah ziemlich wütend aus, gerade so, als sei dieser Vorfall jüngeren Datums.
„Steven ist nicht so schlimm. Aber Tom und Benito …“, fuhr Celia fort. „Benito ist ein richtiger Teufel! Er ist schon 17, und es gibt kein Mädchen auf den Farmen, das vor ihm sicher wäre. Aber das verstehst du noch nicht … Dieses Jahr muss er aufs College, und wir alle werden froh sein, wenn wir ihn von hinten sehen.“
„Und Steven?“, tastete sich Matt geduldig vor.
„Der ist nicht ganz so übel. Manchmal denke ich, er könnte eine Seele haben. Er ist oft mit den Mendoza-Mädchen zusammen. Sie sind eigentlich ganz nett.“
„Wie sieht Steven aus?“ Manchmal dauerte es ziemlich lange, bis Matt Celia zu den Themen bugsiert hatte, die ihn interessierten.
„Er ist 13. Groß für sein Alter. Sandfarbene Haare. Blaue Augen.“
Das muss der Junge gewesen sein, dachte Matt.
„Zurzeit sind die Mendozas auf Besuch da. Emilia, die älteste Tochter, ist auch 13, sehr hübsch, sie hat schwarze Haare und braune Augen.“
„Hm.“ Matt nickte. Emilia hieß das Mädchen also, das heute hier gewesen war.
„Wenigstens sie hat gute Manieren“, erzählte Celia weiter. „Ihre Schwester, María, ist etwa in deinem Alter und spielt meistens mit Tom. Na ja, so kann man’s nennen … spielen. Meistens endet es damit, dass sie weint.“
„Warum?“, fragte Matt, dem es gefiel, von Toms Missetaten zu hören.
„Tom ist Benito hoch zwei! Der kann jedem das Herz zum Schmelzen bringen, mit seinen großen, unschuldigen Augen. Alle fallen drauf rein, aber ich nicht. Heute hat er María eine Flasche Zitronenlimonade gegeben. ‚Das ist die Letzte‘, hat er gesagt. ‚Die ist richtig kalt, und ich hab sie extra für dich gerettet.‘ Weißt du, was in der Flasche war?“
„Nö“, sagte Matt, und eine Vorahnung ließ ihn ganz zappelig werden.
„Urin! Kannst du das glauben? Er hat sogar den Verschluss wieder draufgemacht. Oh, sie hat so geschrien, das arme kleine Ding. Sie lernt es nie.“
Celia verstummte und gähnte ausgiebig. Matt konnte sehen, wie die Erschöpfung sie überwältigte. Sie hatte vom Morgengrauen bis nach Einbruch der Nacht gearbeitet und zu Hause auch noch ein richtiges Essen für ihn gekocht. „Tut mir Leid, mi vida. Aber es war ein langer Tag.“
Matt stellte die Teller in die Geschirrspülmaschine, während Celia duschte. In ihren flauschigen Bademantel gehüllt, kam sie zurück und nickte schläfrig zu dem abgeräumten Tisch hin. „Du bist ein guter Junge“, lobte sie.
Sie nahm ihn auf die Arme und knuddelte ihn auf dem ganzen Weg zu seinem Bett. Ganz gleich, wie müde Celia auch war – und manchmal konnte sie sich kaum mehr auf den Beinen halten –, niemals überging sie dieses Ritual. Sie deckte Matt zu und zündete die geweihte Kerze vor der Statue der heiligen Jungfrau von Guadeloupe an, die sie aus ihrem Dorf in Aztlán mitgebracht hatte. Das Kleid der Madonna war ein wenig beschädigt, was Celia mit einem Strauß künstlicher Blumen tarnte. Die Füße der Jungfrau ruhten auf staubigen Gipsrosen, und ihr sternenbesetztes Gewand war mit Wachsflecken übersät, doch ihr Gesicht strahlte im Kerzenschein immer noch dieselbe Güte aus wie vor langer, langer Zeit in Celias Zimmer.
„Ich bin nebenan, mi vida“, wisperte die Frau und küsste Matt auf den Kopf. „Wenn du Angst kriegst, rufst du mich.“
Bald drang Celias Schnarchen durch die Dunkelheit. Für Matt jedoch war dieses Getöse so normal wie der Donner, der manchmal über den Bergen widerhallte. Es hielt ihn nicht im Geringsten davon ab einzuschlafen. „Steven und Emilia“, flüsterte er, kostete die Worte in seinem Mund. Er wusste nicht, was er zu den fremden Kindern sagen würde, wenn sie wieder auftauchten, doch er war fest entschlossen, mit ihnen zu reden. Er übte mehrere Sätze ein: „Mein Name ist Matt. Ich wohne hier. Wollt ihr mit mir Bilder ausmalen?“
Nein, das Malbuch oder die Malkreiden durfte er nicht erwähnen. Sie waren gestohlen.
„Habt ihr Hunger?“ Aber das Essen mochte ebenfalls gestohlen sein. „Wollt ihr spielen?“ – Gut. Steven und Emilia konnten dann ja etwas vorschlagen, und damit war er aus dem Schneider.
„Wollt ihr spielen? Wollt ihr spielen?“, murmelte er, bis ihm die Augen zufielen und das gütige Gesicht der heiligen Jungfrau von Guadeloupe im Kerzenschein zerfloss.
EIGENTUM DER FAMILIE ALACRÁN
Am Morgen ging Celia wieder fort, und Matt verbrachte den ganzen Tag damit, auf die Kinder zu warten. Er hatte die Hoffnung schon aufgegeben, als er kurz vor Sonnenuntergang Stimmen durch die Mohnfelder näher kommen hörte.
Er stellte sich ans Fenster.
„Da ist er! Schau, María, ich hab’s dir ja gesagt, ich hab nicht gelogen“, rief Emilia. Ihre Hand lag auf der Schulter eines viel kleineren Mädchens. „Er wollte nicht mit uns sprechen, aber du bist etwa in seinem Alter. Vielleicht fürchtet er sich vor dir nicht.“ Emilia schob das Mädchen vor, dann blieb sie zusammen mit Steven abwartend stehen.
María lächelte und trat ganz nahe an das Fenster heran. „Hey, du!“ Sie klopfte mit der Faust gegen die Scheibe. „Wie heißt du? Willst du mit mir spielen?“, schrie sie und stahl damit Matts sorgfältig zurechtgelegte Ansprache. Er starrte sie an; was sollte er jetzt sagen? Ihm fiel so schnell nichts ein.
„Und? Heißt das Ja oder Nein?“ María drehte sich zu den anderen um. „Er soll die Tür aufschließen.“
„Das liegt ganz bei ihm“, meinte Steven.
Matt wollte sagen, dass er den Schlüssel nicht hatte, doch er brachte die Worte nicht über die Lippen.
„Wenigstens versteckt er sich heute nicht“, meinte Emilia.
„Wenn du die Tür nicht aufschließen kannst, dann mach doch das Fenster auf“, schlug María vor.
Matt versuchte es, obwohl er wusste, dass es nicht funktionieren würde. Celia hatte das Fenster zugenagelt. Er hob die Hände und zuckte mit den Schultern.
„Er versteht, was wir sagen“, sagte Steven.
„Hey, Junge! Wenn du nicht schnell irgendwas unternimmst, gehen wir wieder“, drohte María.
Matt überlegte fieberhaft. Er brauchte etwas, das sie interessieren könnte. Er hob einen Finger, wie Celia es tat, wenn sie ihn warten hieß.
„Was bedeutet das?“, murmelte Emilia.
„Ist mir zu hoch. Vielleicht ist er stumm und kann gar nicht reden“, rätselte Steven.
Matt rannte in sein Zimmer. Er riss das Foto von dem Ochsenfrosch-Sandwich von der Wand. Das brachte Celia zum Lachen. Vielleicht brachte es auch diese Kinder zum Lachen. Er lief zurück und presste den Zeitungsausschnitt gegen die Scheibe. Die drei Kinder kamen näher und betrachteten das Ganze sorgfältig.
„Was steht da?“, wollte María wissen.
„Lust auf ein saftiges Steak?“, las Steven. „Kapierst du nicht? Es ist ein Ochsenfrosch, und er bläht sich auf, als könne er so ein richtiger Ochse werden, und er ist zwischen zwei Scheiben Toastbrot geklemmt. Das ist ziemlich lustig.“
Emilia kicherte, doch María wirkte verunsichert. „Die Leute essen keine Ochsenfrösche“, stellte sie klar. „Ich meine, zumindest nicht, solange die noch leben.“
„Es ist ein Witz, Blödmann.“
„Ich bin kein Blödmann! Es ist gemein und eklig, Ochsenfrösche zu essen! Ich finde das ü-ber-haupt nicht lustig.“
„Herr, bewahre mich vor Klugscheißer-Migits“, stöhnte Steven und verdrehte die Augen.
„Ich bin auch kein Klugscheißer-Migit!“
„Oh, hör auf, María!“, fauchte Emilia.
„Ihr habt mich hier rausgeschleppt, damit ich mir einen Jungen ansehe, und wir sind ewig weit durch die Felder gelaufen, und ich bin müde, und der Junge will nicht reden. Ich hasse euch!“
Matt sah voller Bestürzung, wie das Drama seinen Lauf nahm. Das hatte er nicht gewollt. María weinte, Emilia sah ziemlich wütend aus, und Steven hatte beiden demonstrativ den Rücken zugewandt. Matt klopfte an das Fenster. Als María aufsah, schwenkte er das Foto und knüllte es zu einer Kugel, die er dann mit aller Kraft quer durch das Zimmer warf.
„Seht ihr, er denkt genauso wie ich“, rief María unter Tränen.
„Das wird immer merkwürdiger“, brummte Steven. „Ich wusste, wir hätten den Migit nicht herbringen sollen.“
„Ich dachte, der Junge redet vielleicht eher mit einer Gleichaltrigen“, sagte Emilia. „Komm schon, María. Wir müssen zurück, bevor es dunkel wird.“
„Ich geh nirgends hin!“ Das kleine Mädchen setzte sich auf den Boden und verschränkte die Arme vor der Brust.
„Wie du meinst. Ich werde dich jedenfalls nicht tragen.“
„Lass sie einfach hier, Emilia“, sagte Steven. Er marschierte los, und nach kurzem Zögern folgte Emilia ihm.
Matt war entsetzt. Die beiden großen Kinder konnten María doch nicht einfach zurücklassen! Es wurde bald dunkel, und Celia kam erst in vielen Stunden heim. María würde allein da draußen sein, und um sie herum gab es dann nur noch die verlassenen Mohnfelder und den … den Chupacabras, der nach Einbruch der Dunkelheit umging und seine Opfer aussaugte und erst von ihnen abließ, wenn sie völlig verschrumpelt waren!
Plötzlich wusste Matt, was er zu tun hatte. María war ein paar Schritte weit vom Fenster weggegangen, bevor sie sich erneut hingesetzt hatte. Sie schrie Steven und Emilia Beleidigungen hinterher, obwohl beide inzwischen nicht mehr zu sehen waren. Matt rannte in die Küche und packte die große, eiserne Pfanne, in der Celia immer die Enchiladas zubereitete. Zurück im Wohnzimmer, schwang er sie hoch über seinen Kopf. Celia würde ziemlich wütend sein! Doch hier ging es darum, Marías Leben zu retten. Er zertrümmerte das Fensterglas. Es wirbelte in einer klirrenden, klimpernden Flut zu Boden. María sprang auf die Füße. Steven und Emilia tauchten blitzartig wieder aus dem Mohnblumenfeld auf, in dem sie sich versteckt hatten.
„Um Himmels willen!“, keuchte Steven. Alle drei standen mit offenem Mund da und starrten auf das klaffende Loch, das einmal ein Fenster gewesen war.
„Ich heiße Matt. Ich wohne hier. Wollt ihr spielen?“, sagte Matt, weil er sich auf die Schnelle nichts anderes hatte ausdenken können.
„Er kann reden“, stellte Emilia fest, nachdem sich der erste Schrecken gelegt hatte.
„Machst du dein Fenster immer so auf, Kleiner?“, brummte Steven. „Bleib stehen, María. Da liegt überall Glas.“ Er trat vorsichtig an die Öffnung heran und schlug die verbliebenen Scherben mit einem Stecken heraus. Dann beugte er sich herein und sah sich um. Matt musste an sich halten, um nicht hinter einem Sessel in Deckung zu gehen.
„Ziemlich unheimlich! Das Fenster ist zugenagelt. Was bist du, so eine Art Gefangener?“ Steven sah ihn fragend an.
„Ich wohne hier“, sagte Matt.
„Das hast du uns schon mal erzählt.“
„Willst du spielen?“
„Vielleicht ist er wie ein Papagei und kennt nur ein paar Wörter“, flüsterte Emilia.
„Ich will spielen“, erklärte María. Matt sah sie erfreut an. Das Mädchen wand sich in Emilias Armen, es war offensichtlich, dass sie zu ihm kommen wollte. Steven schüttelte den Kopf und drehte sich um. Dieses Mal sah es ganz danach aus, als würde er wirklich gehen.
Matt traf eine Entscheidung. Eine große Entscheidung, die ihm all seinen Mut abverlangte. Doch eine solche Gelegenheit hatte er noch niemals gehabt … und würde er vermutlich auch nie wieder bekommen. Er schob einen Stuhl an die Fensteröffnung, kletterte hoch und sprang.
„Nein!“, schrie Steven. Aber es war zu spät.
Ein grässlicher Schmerz durchfuhr Matts Füße. Er fiel nach vorn und landete auf Händen und Knien in einem Meer aus Scherben.
„Er trägt keine Schuhe! Oh Mann! Oh Mann! Was sollen wir jetzt machen!“ Steven zog Matt hoch und schüttelte ihn, um ihn dann auf sicherem Boden abzusetzen.
Blut tropfte von Matts Füßen und Händen – er starrte es nur verdutzt an. Seine Knie verwandelten sich in Rinnsale aus purem Rot.
„Zieh die Scherben raus, Steven!“, schrie Emilia mit schriller Stimme. „María, bleib weg!“
„Ich will es aber sehen!“, brüllte das kleine Mädchen zurück. Matt hörte das Klatschen einer Ohrfeige und Marías entrüstetes Kreischen. In seinem Kopf verschwammen die Geräusche und Farben, dann wurde alles schwarz.
Matt erwachte mit dem Gefühl, getragen zu werden. Er verspürte Brechreiz, aber weit schlimmer war, dass er am ganzen Leib heftig zitterte. Er schrie, so laut er konnte.
„Toll!“, japste Steven, der Matt an den Schultern gefasst hielt. Emilia hatte seine Beine. Ihr T-Shirt und ihre Hose waren mit Blut durchtränkt – seinem Blut. Matt schrie wieder.
„Sei still!“, kommandierte Steven. „Wir beeilen uns schon wie verrückt!“
Die Mohnblumen, jetzt blau in den langen Schatten der Berge, erstreckten sich in alle Richtungen. Steven und Emilia eilten einen Pfad entlang, der kaum mehr war als ein Streifen lockeres, nicht bepflanztes Erdreich. Matt gab schluchzende, erstickte Laute von sich. Er hatte das Gefühl, kaum noch Luft zu bekommen.
„Halt!“, schrie Emilia. „Wir müssen warten, bis María uns einholt.“ Die beiden Kinder setzten Matt behutsam ab und blieben niedergekauert bei ihm sitzen – froh darüber, sein Gewicht fürs Erste los zu sein. Schon bald hörte Matt das Tappen kurzer Schritte.
„Ich will auch ausruhen“, verlangte María. „Es ist so schrecklich weit. Und außerdem werd ich Dada sagen, dass du mich geschlagen hast.“
„Tu dir keinen Zwang an“, zischte Emilia verächtlich.
„Jetzt hört endlich auf zu streiten“, verlangte Steven. „Du blutest nicht mehr, Kleiner, also nehme ich an, dass du gar nicht in so großer Gefahr bist. Wie heißt du nochmal?“
„Matt“, antwortete María für ihn.
„Es ist nicht mehr weit bis zum Haus, Matt, und du hast Glück. Heute Abend ist der Doktor da. Tut’s sehr weh?“
„Ich weiß nicht“, hauchte Matt.
„Doch, tust du. Du hast geschrien“, sagte María.
„Ich weiß nicht, was sehr weh ist“, erklärte Matt. „Ich hab mich bisher noch nie so verletzt.“
„Okay, du hast Blut verloren – aber nicht allzu viel“, fügte Steven hinzu, als Matt erneut zu zittern begann.
„Es sieht aber ganz nach einer Menge aus“, stellte María klar.
„Halt die Klappe, du Migit!“
Die älteren Kinder richteten sich auf, nahmen Matt zwischen sich, sodass er sich auf ihre verschränkten Arme setzen konnte. María stapfte empört hinterher und beschwerte sich abwechselnd über den weiten Weg und darüber, Migit genannt zu werden.
Eine seltsame, schwere Schläfrigkeit überkam Matt, je weiter sie ihn schwankend und schaukelnd mit sich schleppten. Die Schmerzen waren wie weggeblasen.
Sie erreichten den Rand der Mohnfelder, als die letzten Sonnenstrahlen hinter den Bergen verschwanden. Der staubige Pfad endete und machte einer weiten Wiese Platz. Plötzlich war Matt umgeben von leuchtendem Grün, das im Dämmerlicht noch intensiver wurde. Er hatte noch nie in seinem Leben so viel Grün gesehen.
Das ist eine Wiese, dachte er schläfrig. Und sie duftet nach Regen.
Sie stiegen eine Flucht breiter, marmorner Stufen empor, die sich hell von der dämmrigen Umgebung abhoben. Zu beiden Seiten war die Treppe von roten Tontöpfen mit Orangenbäumen gesäumt, jetzt flammten zwischen den Blättern überall gleichzeitig kleine Lämpchen auf. Helles Licht umriss die weißen Wände eines riesengroßen Hauses mit Säulen und Statuen. In der Mitte eines Türbogens war ein Skorpion eingemeißelt.
„Oh!“, „Oh nein!“, „Um Himmels willen!“, erhob sich ein Durcheinander weiblicher Stimmen, und im nächsten Moment schon stürmten Frauen die Stufen herab und entrissen Matt Stevens und Emilias Armen.
„Wer ist das?“, fragten die Dienstmädchen. Sie trugen allesamt schwarze Kleider mit weißen Schürzen und frisch gestärkte weiße Hauben. Eine von ihnen, eine etwas ältere Frau mit tiefen Furchen auf beiden Seiten des Mundes, trug Matt. Die anderen eilten voraus, um Türen zu öffnen.
„Ich hab ihn in einem Haus in den Mohnfeldern entdeckt“, berichtete Steven.
„Das ist Celias Haus“, platzte eine junge Frau heraus. „Sie ist so hochnäsig, sie will nicht bei uns wohnen.“
„Wenn sie dort ein Kind versteckt hält, dann wundert mich das nicht. Wer ist dein Vater, Kleiner?“, sagte die Frau, die Matt trug. Ihre Schürze roch so frisch wie Sonnenlicht, genau wie Celias Schürze, wenn sie geradewegs von der Wäscheleine kam. Matt starrte eine Schmucknadel an, die am Kragen der Frau befestigt war: einen silbernen Skorpion mit drohend aufgerichtetem Stachel. Unter dem Skorpion prangte ein Schildchen, auf dem Rosa stand. Matt war zu benommen, um etwas zu sagen, und überhaupt, was spielte es schon für eine Rolle, wer sein Vater war? Er kannte die Antwort sowieso nicht.
„Er redet nicht viel“, kommentierte Emilia.
„Wo ist der Doktor?“, wollte Steven wissen.
„Wir müssen warten“, sagte Rosa. „Er behandelt deinen Großvater. Allerdings können wir das Kind schon einmal säubern.“
Die Dienstmädchen öffneten eine weitere Tür – zu dem schönsten Raum, den Matt jemals gesehen hatte. An der Decke verliefen mit Schnitzwerk verzierte Balken, und an den Wänden Tapeten, auf denen sich hunderte von Vögeln tummelten. Unter Matts huschenden Blicken schienen sie zum Leben zu erwachen. Er sah eine Couch mit Blumenmuster, dessen Farben von Lavendel über Grau bis hin zu einem zarten Rosaton reichten – wie die Federn eines Taubenflügels. Zu dieser Couch trug Rosa ihn.
„Ich bin zu dreckig“, hauchte Matt. Er war schon einmal ziemlich ausgeschimpft worden – nur, weil er mit schmutzigen Füßen auf Celias Bett geklettert war.
„Das kannst du laut sagen“, zischte Rosa. Die anderen Frauen entfalteten ein steifes weißes Leintuch und breiteten es über das Sofa, bevor Matt darauf gelegt wurde. Er nahm an, dass ihm Blutflecken auf diesem Tuch mindestens genauso viel Ärger einhandeln konnten.
Rosa ließ sich eine Pinzette bringen und machte sich daran, ihm Glassplitter aus Händen und Füßen zu ziehen. „Brav!“, lobte sie, als sie die ersten winzigen Stückchen auf einer Schale ablegte. „Es ist sehr tapfer von dir, nicht zu weinen.“
Doch Matt fühlte sich überhaupt nicht tapfer. Er fühlte gar nichts. Es war, als ob er alles aus der Ferne beobachten würde, und Rosa kam ihm vor, als sei sie nur eine Gestalt auf dem Fernsehbildschirm.
„Bestimmt weint er gleich ganz arg“, prophezeite María. Sie hüpfte immer um das Sofa herum und war darauf bedacht, nur ja nichts zu verpassen.
„Sei du bloß ruhig!“, wies Emilia sie zurecht. „Du schreist dir ja schon die Seele aus dem Leib, wenn du einen klitzekleinen Splitter im Finger hast.“
„Tu ich nicht!“
„Tust du doch!“
„Ich hasse dich!“
„Frag mich mal, ob mir das etwas ausmacht“, konterte Emilia. Sowohl sie als auch Steven beobachteten fasziniert, wie Matts Schnittwunden erneut zu bluten begannen. „Wenn ich groß bin, werde ich Ärztin“, verkündete Emilia. „Das hier ist eine sehr gute Erfahrung für mich.“
Die anderen Mädchen hatten Handtücher und einen Eimer mit Wasser herbeigebracht, doch sie unternahmen keinen Versuch, Matt zu waschen, bis Rosa es ausdrücklich anordnete.
„Seid vorsichtig. Vor allem der rechte Fuß ist übel zerschnitten“, sagte sie.
Die Luft summte in Matts Ohren. Er spürte das warme Wasser, und plötzlich kehrten die Schmerzen zurück. Sie brausten durch seinen Fuß und durch ihn hindurch und hoch hinauf, bis in seinen Kopf. Er riss den Mund auf, er wollte schreien, aber er brachte keinen einzigen Ton heraus. Der Schock schnürte ihm die Kehle zu.
„Oh Gott!“, rief Rosa. „Es müssen noch mehr Splitter in den Wunden stecken – tiefer im Fleisch.“ Sie packte Matt bei den Schultern und herrschte ihn an, keine Angst zu haben. Sie wirkte beinahe verärgert.
Matts Benommenheit klärte sich. Seine Füße, Hände, Knie pochten unter Schmerzen, die so ungeheuerlich waren, wie er es niemals für möglich gehalten hätte.
„Ich hab’s euch gesagt: Er weint bald“, sagte María.
„Sei still!“, sagte Emilia.
„Schau mal! Da steht was auf seiner Fußsohle“, rief das kleine Mädchen aus. Sie versuchte, näher heranzukommen, doch Emilia stieß sie weg.
„Ich bin diejenige, die mal Ärztin wird.“ Sie beugte sich über Matts Fuß. „Mist! Ich kann’s nicht lesen. Da ist zu viel Blut.“ Mit einem Waschlappen tupfte sie vorsichtig Matts Fuß sauber.
Dieses Mal waren die Schmerzen nicht mehr ganz so furchtbar, dennoch konnte er ein Stöhnen nicht unterdrücken.
„Du tust ihm weh!“, kreischte María.
„Warte! Jetzt kann ich es erkennen … Eigentum der – die Schrift ist so winzig! – Eigentum der Familie Alacrán.“
„Eigentum der Familie Alacrán?“, wiederholte Steven. „Das sind wir. – Das versteh ich nicht.“
„Was geht hier vor?“, polterte eine Stimme, die Matt bisher noch nicht gehört hatte. Ein hoch gewachsener, grimmig dreinschauender Mann platzte ins Zimmer. Steven richtete sich augenblicklich kerzengerade auf. Emilia und María zuckten zusammen.
„Vater, wir haben ein Kind in den Mohnfeldern gefunden“, sagte Steven. „Einen Jungen. Er hat sich verletzt, und ich dachte, der Doktor … der Doktor –“
„Du Idiot! Für das kleine Scheusal brauchst du einen Viehdoktor“, brauste der Mann auf. „Wie kannst du es wagen, dieses Haus zu besudeln?“
„Er hat geblutet –“, begann Steven.
„Ja! Vor allem auf dieses Tuch. Wir werden es verbrennen müssen. Und jetzt – schaff diese Kreatur raus!“
Rosa zögerte irritiert.
Der Mann beugte sich vor und flüsterte ihr etwas ins Ohr.
Ein Ausdruck von Entsetzen flackerte über Rosas Gesicht. Unverzüglich riss sie Matt hoch und rannte. Steven stürmte voraus, um ihr die Türen zu öffnen. Sein Gesicht hatte sich schneeweiß verfärbt. „Wie kann er es wagen, so mit mir zu reden“, fauchte er.
„Er hat’s nicht so gemeint“, sagte Emilia, die María hinter sich herzerrte.
„Oh doch, hat er“, widersprach Steven. „Er hasst mich.“
Rosa eilte die Stufen hinunter und setzte Matt grob auf dem Rasen ab. Ohne die geringste Erklärung machte sie kehrt und floh ins Haus zurück.
MARÍA
Matt sah auf. Hunderte von Sternen erstreckten sich funkelnd in weitem Bogen über einen samtigen schwarzen Himmel. Das war die Milchstraße – Celia hatte ihm erzählt, dass sie der Brust der Jungfrau entsprungen war, als sie das Jesus-Baby zum allerersten Mal gestillt hatte. Matt spürte das Gras an seinem Rücken. Es war nicht so weich, wie er sich das immer vorgestellt hatte, aber es roch frisch, und auch die kühle Luft tat gut. Er fühlte sich heiß und fiebrig.
Die furchtbaren Schmerzen waren zu einem einzigen dumpfen Druck abgeklungen. Matt war froh, wieder im Freien zu sein. Der Himmel kam ihm vertraut vor, er vermittelte ihm ein Gefühl von Sicherheit. Dieselben Sterne strahlten über dem kleinen Haus in den Mohnfeldern. Celia hatte ihn tagsüber niemals mit nach draußen genommen, doch manchmal waren sie nachts auf der Türschwelle des kleinen Hauses beieinander gesessen. Sie hatte ihm Geschichten erzählt und zeigte plötzlich auf einen fallenden Stern – eine Sternschnuppe. „Das ist ein von Gott erhörtes Gebet“, erklärte sie. „Einer seiner Engel schwebt zur Erde hernieder, um Gottes Befehle auszuführen.“
Jetzt betete Matt, Celia möge kommen und ihn retten. Sie würde böse sein, wegen des Fensters, aber damit konnte er leben. Ganz gleich, wie laut sie ihn auch schimpfte, sie hatte ihn trotzdem lieb. Er beobachtete den Himmel, doch kein Stern fiel hernieder.
„Schaut ihn euch an. Er liegt einfach nur da – ein bisschen wie ein kleines, verängstigtes Tier“, sagte Emilia nicht sehr weit entfernt. Matt zuckte zusammen – die Kinder hatte er ganz vergessen.
„Er ist ein Tier“, murmelte Steven nach einer kleinen Weile.
Sie saßen auf der untersten Treppenstufe. María pflückte eifrig Orangen von den Bäumen und ließ sie die Stufen hinunterkullern.
„Ich verstehe nicht ganz – was meinst du?“ Emilia sah Steven verwirrt an.
„Ich war bescheuert. Ich hätte wissen müssen, was er – was das da – ist, und zwar auf den ersten Blick. Einem Bediensteten würde man doch niemals gestatten, irgendwo abgesondert ein Kind aufzuziehen … oder überhaupt irgendein Lebewesen. Benito hat mir von dieser Sache erzählt, nur hab ich gedacht, es würde irgendwo anders leben. In einem Heim oder einem Zoo vielleicht. Eben da, wo diese Dinger normalerweise gehalten werden.“
„Von was redest du?“
„Matt ist ein Klon“, sagte Steven.
Emilia sog hörbar die Luft ein. „Das kann er nicht sein! Er kann nicht – ich hab Klone gesehen. Sie sind einfach nur abstoßend! Die sabbern und machen sich in die Hosen. Sie stoßen Tierlaute aus.“
„Der hier ist anders. Benito hat’s mir erzählt. Die Labortechniker haben die Anweisung, den Verstand eines jeden Klons zu zerstören – es ist gesetzlich vorgeschrieben. Aber El Patrón wollte, dass seiner wie ein richtiger Junge aufwächst. Er ist so reich und mächtig, er kann jedes Gesetz brechen, das er brechen will.“
„Das ist widerlich! Klone sind keine Menschen“, rief Emilia.
„Natürlich sind sie das nicht.“
Emilia schlang die Arme um ihre Knie. „Es macht mir Gänsehaut. Ich hab es doch auch angefasst. Ich hab sein Blut an den Händen gehabt – María, hör auf, uns mit diesen Orangen zu nerven!“
„Lass mich!“, schrie María.
„Ich werd gleich dich die Stufen runterrollen.“
Das kleine Mädchen streckte ihrer großen Schwester die Zunge heraus. Sie stieß eine Frucht so heftig an, dass sie über die letzte Stufe hinauskullerte und mit einem sanften Plumps im Gras landete. „Soll ich dir eine schälen, Matt?“, rief María.
„Das wirst du bleiben lassen“, sagte Emilia, und der Ernst in ihrer Stimme ließ das kleine Mädchen innehalten. „Matt ist ein Klon. Du darfst ihm nicht zu nahe kommen.“
„Was ist ein Klon?“
„Ein schlimmes Tier.“
„Wie schlimm?“, wollte María voller Neugierde wissen.
Bevor Emilia antworten konnte, tauchten der grimmige Mann und der Arzt am oberen Ende der Stufen auf.
„Sie hätten mich gleich rufen sollen“, sagte der Arzt. „Es gehört zu meinen Aufgaben sicherzustellen, dass das Biest bei guter Gesundheit bleibt.“
„Das ist mir erst wieder eingefallen, als ich das Wohnzimmer schon lange verlassen hatte. Da drin war alles voller Blut. Ich fürchte, ich habe den Kopf verloren – und Rosa angewiesen, das Ding rauszuwerfen.“ Der grimmige Mann wirkte jetzt nicht mehr so gefährlich, aber Matt versuchte dennoch wegzukriechen. Die Bewegung verursachte Höllenschmerzen in seinem Fuß.
Der Arzt runzelte die Stirn. „Wir müssen es irgendwo anders hinbringen. Ich kann auf dem Rasen nicht operieren.“
„In den Quartieren der Bediensteten gibt es einen Raum, der nicht benutzt wird“, sagte der grimmige Mann. Er rief nach Rosa, die alsbald die Stufen herabkam. Mit angewidertem Gesicht schleppte sie Matt in einen anderen Teil des Hauses, durch ein Labyrinth düsterer Korridore, in denen es nach Moder roch. Steven, Emilia und María wurden fortgeschickt.
Matt fand sich auf einer harten, unbezogenen Matratze wieder. Der Raum war lang und schmal. Am einen Ende war die Tür, am anderen ein Fenster mit einem schmiedeeisernen Gitter.
„Ich brauche mehr Licht“, verlangte der Arzt knapp. Der grimmige Mann brachte eine Lampe.
„Halt das Ding gut fest, damit es nicht zappeln kann“, wies der Arzt Rosa an.
„Bitte, Herr. Es ist ein Klon!“, protestierte die Frau.
„Wenn du weißt, was gut für dich ist, dann folgst du den Anweisungen des Doktors“, brummte der grimmige Mann. Rosa warf sich schnell über Matt und packte ihn bei den Fußknöcheln. Ihr Gewicht machte es ihm nahezu unmöglich zu atmen.
„Aufhören … bitte …“, flüsterte der Junge. Mit einer Pinzette tastete der Arzt in dem tiefsten Schnitt herum, und Matt schlug um sich und bettelte und sackte völlig in sich zusammen, als der erste Glassplitter herausgezogen wurde. Rosa hielt seine Knöchel unerbittlich fest, ihre Finger brannten wie Feuer. Erst als die Wunde endlich gesäubert und genäht war, ließ sie Matt los. Er rollte sich zu einer Kugel zusammen und starrte ängstlich zu seinen Peinigern empor.
„Ich habe ihm eine Tetanusspritze gegeben“, erläuterte der Arzt, während er seine Instrumente wegräumte. „Möglicherweise hat der rechte Fuß dauerhaften Schaden genommen.“
„Kann ich das Ding in die Mohnfelder zurückschicken?“, erkundigte sich der grimmige Mann.
„Zu spät. Die Kinder haben es gesehen.“
Die Männer und Rosa verließen den Raum. Matt lag allein auf der harten Matratze und starrte an die Wände. Was würde jetzt mit ihm geschehen? Wenn er ganz fleißig betete, würde bestimmt Celia kommen und ihn in die Arme nehmen und davontragen und ins Bett bringen. Und dann würde sie die geweihte Kerze vor der heiligen Jungfrau von Guadeloupe anzünden.
Doch die Jungfrau war weit weg, in dem kleinen Haus, und Celia wusste vermutlich nicht einmal, wo er steckte.
Rosa stieß die Tür so heftig auf, dass die Klinke gegen die Wand krachte, und breitete Zeitungspapier auf dem Fußboden aus. „Der Doktor behauptet, du bist stubenrein, aber ich gehe kein Risiko ein“, stellte sie klar. „Mach in den Kübel da, wenn du genügend Verstand dazu hast.“ Sie stellte einen Eimer neben das Bett und hob die Lampe auf.
„Warte“, bat Matt.
Rosa hielt inne. Sie sah unfreundlich aus.
„Kannst du Celia sagen, wo ich bin?“
Die Hausangestellte lächelte bösartig. „Es ist Celia nicht gestattet, dich zu sehen. Anweisung des Doktors.“ Sie eilte hinaus und schloss die Tür.
Der Raum wurde dennoch nicht völlig dunkel: Durch die Gitterstäbe des Fensters sickerte ein schwacher gelblicher Schein. Matt reckte den Hals, um festzustellen, woher diese Helligkeit kam. Er sah eine einzelne Glühbirne an einem Kabel vor dem Fenster baumeln. Sie war so klein wie die vielen Lichter, mit denen Celia den Christbaum immer schmückte, und doch schimmerte das kleine Licht tröstlich und vertrieb die Finsternis.
Außer dem Bett und dem Eimer konnte Matt nichts weiter sehen. Die Decke war hoch und voller Schatten, und die Enge des Raumes vermittelte ihm das Gefühl, in eine Schachtel gesperrt zu sein.
Er hatte nie, niemals allein zu Bett gehen müssen. Immer, und sollte es noch so spät werden, konnte er sich auf Celias Rückkehr verlassen. Wenn er nachts aufwachte, dann war sie da – er hörte sie im Zimmer nebenan schnarchen und fühlte sich sicher. Hier war gar nichts – es gab nicht einmal den Wind, der über die Mohnfelder strich, oder das Gurren der Tauben auf dem Dach.
Die Stille machte ihm Angst.
Matt fing an, leise zu weinen. Seine Hände, seine Füße, seine Knie – alles tat ihm weh. Und ließ der Schmerz nach, kamen die Gedanken an Celia zurück, und dann musste er auch wieder weinen. Aus tränenverschleierten Augen sah er zu dem kleinen gelben Licht auf, und es schien zu flackern wie eine Flamme. Plötzlich kam es ihm wie die geweihte Kerze zu Füßen der Jungfrau vor. Schließlich stand es der Madonna frei zu gehen, wohin sie wollte. Man konnte sie nicht einsperren wie irgendeinen Menschen. Sie konnte durch die Lüfte fliegen oder sogar Mauern einreißen, wie die Superhelden im Fernsehen – aber natürlich würde sie das nicht tun, denn sie war ja die Muttergottes. Vielleicht stand sie genau in diesem Moment draußen und sah zu seinem Fenster herüber. Etwas tief in Matt ließ los. Er atmete aus, und bald darauf war er fest eingeschlafen.
Als die Tür mit einem Knarren aufging, schreckte er zusammen. Matt versuchte, sich aufzusetzen, doch die Schmerzen loderten und tobten so sehr, dass er sich wieder zurücksinken ließ. Eine Taschenlampe blitzte auf; helles Licht blendete ihn.
„Gut! Ich hatte schon Angst, dies sei der falsche Raum.“ Eine schmale Gestalt kam zum Bett herangehuscht, nahm einen Rucksack von den Schultern und begann, Verpflegung auszupacken.
„María?“, sagte Matt fragend.
„Rosa hat gesagt, sie hätten dir kein Abendessen gegeben. Sie ist so gemein! Ich hab zu Hause einen Hund, und wenn er nicht gefüttert wird, dann heult er. Magst du Mangosaft? Trink ich am liebsten.“
Erst jetzt bemerkte Matt, wie durstig er war. Er trank die Flasche leer, ohne sie auch nur ein einziges Mal abzusetzen. Doch dann verzerrte er vor Schmerzen das Gesicht. Jede noch so kleine Bewegung tat ihm weh.
María hatte Peperoni und große Käsestücke mitgebracht. „Ich werd dich füttern – aber du musst versprechen, mich nicht zu beißen.“
Matt stellte entrüstet klar, dass er niemals irgendwelche Leute biss.
„Na ja, man kann nie wissen. Emilia sagt, Klone seien so tückisch wie Werwölfe. Hast du im Fernsehen den Film über den Jungen gesehen, dem bei Vollmond überall Haare gewachsen sind?“
„Ja!“ Matt war begeistert – jetzt hatten María und er etwas Gemeinsames. Nach diesem Film hatte er sich im Bad eingeschlossen, bis Celia nach Hause gekommen war.
„Dir wachsen keine Haare, oder?“, fragte María.
„Nie!“, schwor Matt.
„Gut“, sagte María und schob einen Happen nach dem anderen in Matts Mund, bis er nichts mehr runterbrachte.
Sie redeten über Filme und dann über Geschichten, die Celia ihm erzählt hatte – über die Gefahren, die nach Einbruch der Dunkelheit lauerten. Matt stellte fest, dass seine Wunden nicht so sehr wehtaten, wenn er ganz still lag. María zappelte allerdings ziemlich herum, und gelegentlich stieß sie ihn an – doch er schimpfte sie nicht. Er wollte sie nicht verärgern; er wollte nicht, dass sie ging.
„Celia hängt Talismane über die Tür, damit hält sie die Monster fern“, erzählte er María.
„Das funktioniert?“
„Klar!“
„Hier drin gibt’s keine Talismane“, stellte María nervös fest.
Dieser Gedanke war Matt auch schon in den Sinn gekommen, doch er wollte unbedingt, dass sie noch bei ihm blieb. „Im großen Haus brauchen wir keine Talismane“, erklärte er schnell. „Hier gibt’s so viele Leute, und das mögen die Monster nicht.“
Marías Interesse beflügelte Matt. Er redete wie im Fieber, er konnte nicht aufhören. Niemals zuvor in seinem Leben war ihm so viel Aufmerksamkeit zuteil geworden. Celia hatte sich alle Mühe gegeben, ihm zuzuhören, aber sie war immer sehr müde. Bei María war das etwas ganz anderes: Sie lauschte seinen Worten so gebannt, als hinge ihr Leben davon ab.
„Hast du schon vom Chupacabras gehört?“, fragte Matt.
„Was ist ein … Chupacabras?“, hauchte sie, und ihre Stimme klang ein bisschen hoch und atemlos.
„Du weißt schon. Der Ziegensauger.“
„Das hört sich schlimm an.“ María rückte näher an Matt heran.
„Das ist es auch! Er hat Stacheln auf seinem Rücken, und Klauen und orangegelbe Zähne, und er saugt Blut.“
„Du machst bloß Spaß!“
„Celia sagt, er hat das Gesicht eines Menschen, nur die Augen sind innen ganz schwarz. Wie tiefe Löcher“, sagte Matt.
„Ihh!“
„Ziegen mag er am liebsten, aber er würde auch Pferde oder Kühe aussaugen – oder ein Kind, wenn er wirklich hungrig ist.“
Jetzt presste sie sich ganz fest an ihn. Sie legte die Arme um ihn, und er biss die Zähne zusammen, um nicht vor Schmerz aufzustöhnen. Er bemerkte, dass ihre Hände eiskalt waren.
„Letzten Monat hat Celia gesagt, dass er sich einen ganzen Hühnerstall vorgenommen hat“, trumpfte Matt auf.
„Davon hab ich auch gehört – von Steven. Er meint, Illegale hätten die Hühner gestohlen.“
„Das ist das, was sie allen erzählen, damit sich die Leute nicht vor lauter Angst auf und davon machen“, sagte Matt und wiederholte die Worte, die Celia gebraucht hatte. „Aber in Wirklichkeit haben sie die Hühner in der Wüste draußen gefunden, und sie hatten keinen Tropfen Blut mehr in sich. Sie wurden herumgeweht wie vertrocknete Kakteen.“
Vor Steven und Emilia fürchtete Matt sich, aber bei María war das anders. Sie war so groß wie er, und er fühlte sich wohl in ihrer Nähe. Wie hatte Rosa ihn genannt? Einen Klon. Matt hatte keine Ahnung, was das war, allerdings erkannte er eine Beleidigung, wenn er eine zu hören bekam. Rosa hasste ihn, und der grimmige Mann und der Doktor auch. Sogar die beiden älteren Kinder waren wie ausgewechselt, seit sie wussten, was er war. Nur zu gerne hätte Matt María über Klone ausgefragt, doch er befürchtete, dass auch sie sich von ihm abgestoßen fühlte, wenn er sie daran erinnerte.
Inzwischen hatte er herausgefunden, welche wunderbare Macht von Celias Geschichten ausging. Sie hatten ihn in ihren Bann geschlagen, und nun beeindruckten sie María so sehr, dass sie praktisch an ihm klebte.
„Der Chupacabras ist nicht das einzige Monster, das in der Dunkelheit da draußen herumschleicht“, flüsterte Matt geheimnisvoll. „Auch La Llorona geht in der Nacht um.“
María murmelte etwas. Ihr Gesicht war gegen sein Hemd gepresst, sodass kaum zu hören war, was sie sagte.
„La Llorona ertränkte ihre Kinder, weil sie wütend auf ihren Freund war. Und dann war sie sehr traurig und hat sich selber ertränkt“, erzählte Matt weiter. „Sie kam an die Himmelspforte, und Petrus rief aus: ‚Du böses Weib! Für dich ist hier kein Platz. Ohne deine Kinder kommst du hier nicht rein!‘ Da fuhr sie zur Hölle hinab, aber der Teufel schlug ihr auch die Tür vor der Nase zu. Und so kommt es, dass sie jetzt Nacht für Nacht unterwegs sein muss, dass sie sich niemals hinsetzen, niemals schlafen kann. Sie jammert ‚Oooooh … Oooooh. Wo sind meine Kinder?‘ Du kannst sie hören, wenn der Wind weht. Sie kommt sogar ans Fenster. ‚Oooooh … Oooooh. Wo sind meine Kinder?‘ Sie kratzt mit ihren langen Fingernägeln an der Scheibe und –“
„Hör auf“, kreischte María. „Ich hab gesagt, hör auf! Hörst du eigentlich nie zu?“
Matt hielt verdutzt die Luft an. Was hatte sie bloß an dieser Geschichte auszusetzen? Er erzählte sie exakt auf dieselbe Art und Weise wie Celia.
„Deine La Llorona gibt es gar nicht! Du hast sie erfunden!“
Matt streckte die Hand aus und berührte Marías Gesicht. „Du weinst ja!“
„Tu ich nicht, du Blödmann! Ich hasse nur solche ekligen Geschichten!“
Matt war entsetzt. Er hatte María keine Angst machen wollen. „Tut mir Leid.“
„Sollte es auch“, brummte sie und zog den Naseninhalt hoch.
„Durch diese Gitter kann nichts hereinkommen“, beruhigte Matt sie. „Und es sind massenhaft Leute im Haus.“
„Aber auf den Fluren ist niemand“, widersprach María. „Wenn ich rausgehe, erwischen mich die Monster.“
„Vielleicht auch nicht.“
„Na, toll! Vielleicht auch nicht! Wenn Emilia merkt, dass ich nicht im Bett liege, bekomme ich wirklich riesigen Ärger. Sie wird’s Dada erzählen, und dann krieg ich tagelang Hausarrest, und das ist alles deine Schuld!“
Matt wusste nicht, was er sagen sollte.
„Ich werd bis morgen hier bleiben müssen“, beschloss María. „Dann kann mich wenigstens der Chupacabras nicht fressen. Rutsch rüber.“
Matt versuchte, Platz zu machen. Das Bett war sehr schmal, und obgleich er sich nur wenige Zentimeter bewegte, kehrten die Schmerzen zurück. Seine Hände und Füße pochten, als er sich an die Wand drückte.
„Mach dich nicht so dick“, beklagte sich María. „Gibt’s keine Decken?“
„Nein“, erwiderte Matt.
„Wart mal.“ María sprang aus dem Bett und sammelte die Zeitungen ein, die Rosa auf dem Fußboden verteilt hatte.
„Wir brauchen keine Decke“, nörgelte Matt, während sie mit dem Papier herumraschelte.
„So fühle ich mich sicherer.“ María kroch unter die Zeitungsseiten. „Das ist gar nicht so übel. Sonst darf immer mein Hund bei mir schlafen – bist du sicher, dass du nicht beißt?“
„Natürlich beiße ich nicht“, brummte Matt genervt.
„Also gut, okay“, meinte sie und kuschelte sich enger an ihn.
Matt schwirrte der Kopf; er sann über die Bestrafung nach, die María wohl bekommen würde, weil sie ihm Essen gebracht hatte. Er wusste nicht, was Hausarrest war, aber bestimmt etwas ziemlich Schreckliches.
Es war so viel in so kurzer Zeit geschehen, und Matt konnte nicht einmal die Hälfte davon verstehen. Warum hatte man ihn aus dem Haus geworfen, wo doch anfangs alle so wild darauf gewesen waren, ihm zu helfen? Warum hatte der grimmige Mann ihn ein kleines Scheusal genannt? Und warum hatte Emilia María erzählt, er sei ein schlimmes Tier?
Es hing irgendwie damit zusammen, dass er ein Klon war, und vielleicht auch mit der Schrift auf seiner Fußsohle. Vor langer Zeit hatte Matt Celia darüber ausgefragt und zur Antwort bekommen, dass alle kleinen Kinder so eine Aufschrift hätten, damit sie nicht verloren gingen. Aber nach Stevens Reaktion zu urteilen, war außer ihm keiner tätowiert.
María bewegte sich im Schlaf unruhig hin und her und seufzte und schlug um sich. Schon bald flatterten die Zeitungen zu Boden. Matt wich bis an die äußerste Bettkante aus, um nicht getroffen zu werden. Irgendwann schien sie einen schlimmen Traum zu haben, in dem sie nach ihrer Mama rief.
Im ersten blauen Licht der Morgendämmerung zwang Matt sich aufzustehen. Seine Füße bestanden aus purem Schmerz; es war noch schlimmer geworden.
Er ließ sich auf Hände und Knie nieder und krabbelte so leise wie möglich am Bett entlang zum Fußende hinunter; den Eimer zog er neben sich her. Er musste aufs Klo, und er wollte nicht, dass María ihn dabei beobachten konnte. Doch kaum hatte er, ganz leise, begonnen, drehte María sich herum. Das Geräusch, das sie dabei verursachte, ließ Matt zusammenzucken. Der Eimer kippte um. Matt raffte Zeitungspapier zusammen und wischte die ganze Schweinerei auf. Dann lehnte er sich sitzend gegen die Wand, er musste sich ein wenig erholen, denn seine Hände und Füße schmerzten unerträglich.
Rosas Schimpfen war bereits von weitem zu hören. „Böses Mädchen!“ Schon flog die Tür auf. In Rosas Gefolge wirbelte eine Schar Hausmädchen herein, und ein jedes reckte den Hals, um nur ja nicht zu versäumen, was hier geschah. „Wir haben das ganze Haus auf den Kopf gestellt auf der Suche nach dir“, zeterte Rosa. „Und die ganze Zeit über hast du dich bei diesem schmutzigen Klon versteckt, du kleines Biest. Du steckst in Schwierigkeiten! Man wird dich augenblicklich nach Hause verfrachten.“


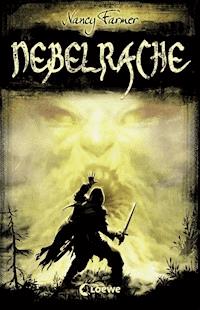













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)












