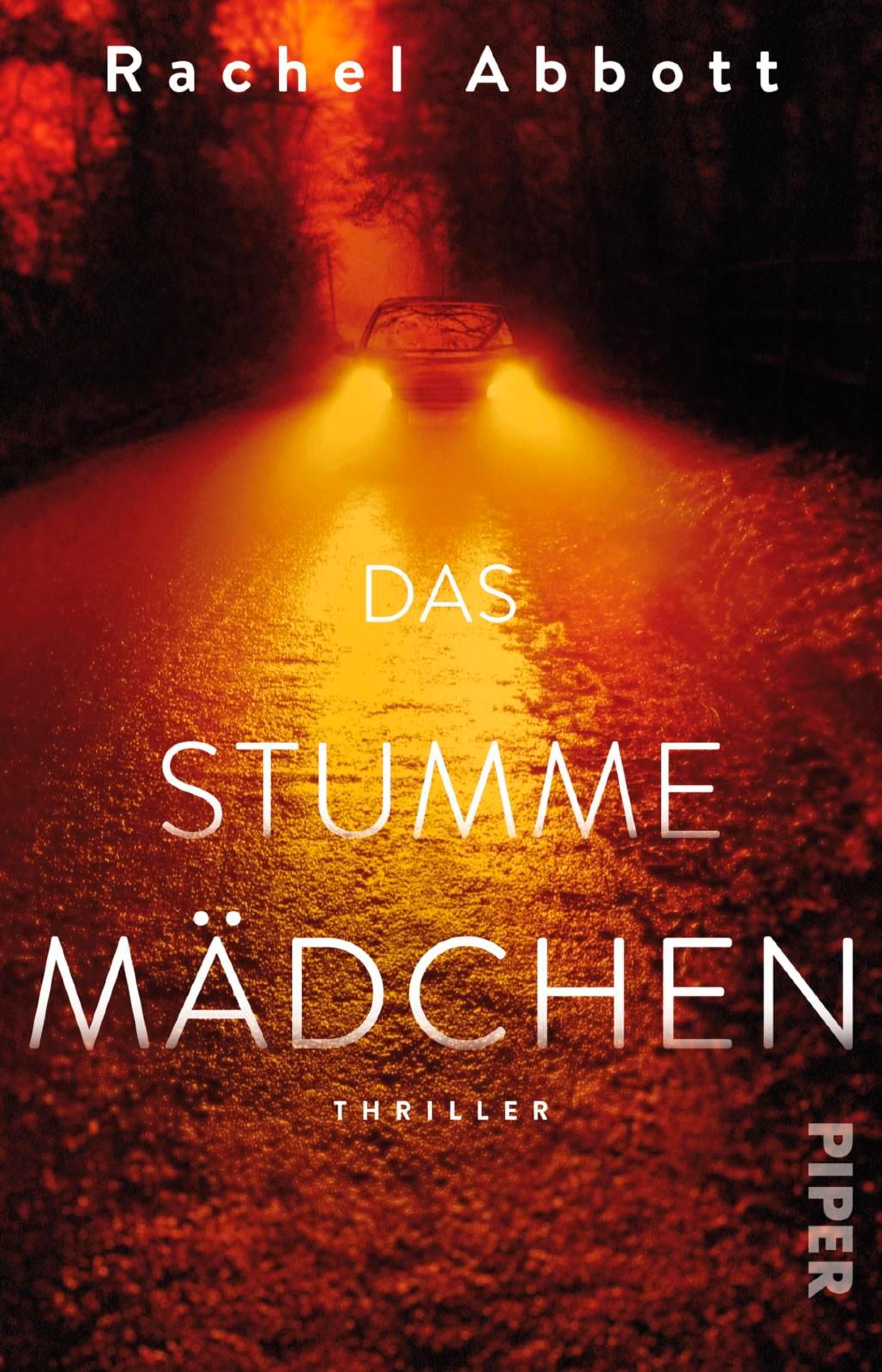
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Das Leben von Emma Joseph könnte perfekt sein. Sie hat ein entzückendes Baby und einen liebevollen Ehemann – David. Doch David hat eine dunkle Vergangenheit: Bei einem mysteriösen Autounfall starb seine erste Frau und seine kleine Tochter verschwand spurlos. Als das Mädchen sechs Jahre später wie aus dem Nichts wieder auftaucht, wird Emma das Gefühl nicht los, dass von dem Mädchen eine stumme Bedrohung ausgeht. Handelt es sich tatsächlich um Davids Tochter? Und wenn ja, was hat sie zu verbergen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:www.piper.de
Für Al Zwanzig Jahre zu spät – aber vielleicht besser als ein Schwertwal?
Übersetzung aus dem Englischen von Karin Dufner
ISBN 978-3-492-96590-3 Mai 2015 © Rachel Abbot 2015 Titel der englischen Originalausgabe: »Stranger Child«, Black Dot Publishing, London 2015 © der deutschsprachigen Ausgabe: Piper Verlag GmbH, München 2017 Covergestaltung: Network! Werbeagentur GmbH Coverabbildung: Roy Bishop/Arcangel Datenkonvertierung: CPI books GmbH, Leck
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
Prolog
Noch zehn Minuten und sie würde wohlbehalten zu Hause sein.
Caroline Joseph erschauderte vor Erleichterung, weil die lange Fahrt endlich vorbei sein würde. Sie war noch nie gern nachts gefahren, denn sie hatte dabei stets ein wenig das Gefühl, die Dinge nicht mehr richtig im Griff zu haben. Jedes sich nähernde Scheinwerferpaar schien sie anzuziehen; immer wieder erleuchtete weißes Licht das Wageninnere, während sie das Lenkrad umklammerte und sich bemühte, das Auto auf Spur zu halten.
Aber jetzt war es ja nicht mehr weit. Sie freute sich darauf, Natasha in die warme Badewanne zu stecken, ihr eine Tasse heiße Schokolade zu machen und sie ins Bett zu bringen. Dann konnte sie sich den Rest des Abends David widmen. Etwas belastete ihn, und Caroline glaubte, dass sie ihm, vor dem Kaminfeuer und bei einem Glas Wein, wenn Natasha fest schlief, das Problem vielleicht würde entlocken können. Es musste etwas mit der Arbeit zu tun haben.
Sie warf einen Blick in den Rückspiegel auf ihre wundervolle Tochter. Tasha war sechs – oder sechsdreiviertel, wie sie gern stolz betonte –, auch wenn sie wegen ihres zierlichen Körperbaus jünger wirkte. Das hellblonde Haar fiel ihr in weichen Wellen über die Schultern. Jedes Mal, wenn sie eine Straßenlaterne passierten, wurden ihre zarten Gesichtszüge in gelbes Licht getaucht. Sie hatte die Augen geschlossen und sah so friedlich aus, dass Caroline lächeln musste.
Wie immer war Tasha brav gewesen und hatte zufrieden mit ihren jüngeren Cousins gespielt, während die Erwachsenen herumhasteten, um Carolines Vater jeden Wunsch von den Augen abzulesen. Er hatte einen seiner Befehle erteilt – diesmal lautete er, dass Caroline und ihre Geschwister samt Familien sich zu einem vorweihnachtlichen Abendessen einzufinden hatten. Wie immer hatten alle gehorcht. Das hieß alle mit Ausnahme von David.
Die Abzweigung in die Seitenstraßen, die zu ihrem Haus führten, näherte sich rasch, und Caroline warf noch einen Blick auf Tasha. Sobald sie die Hauptstraße verlassen und sich von den hell erleuchteten Schaufenstern und dem gelblichen Schein der hohen Straßenlaternen entfernt hatten, würde der Rücksitz des Wagens in Dunkelheit liegen. Das Mädchen hatte den Großteil der Fahrt verschlafen, regte sich aber allmählich.
»Alles in Ordnung, Tasha?«, fragte Caroline. Das Kind murmelte nur eine schlaftrunkene Antwort, war noch nicht wach genug, um etwas zu sagen, und rieb sich mit den Fingerknöcheln die Augen. Caroline lächelte. Sie bremste leicht ab und schaltete herunter, um die Kurve zu umrunden. Jetzt musste sie nur noch die letzten Kilometer der Fahrt hinter sich bringen, durch enge, von Hecken gesäumte, stockfinstere Straßen. Dann hatte sie es überstanden. Sie war ein wenig ärgerlich auf David. Er wusste doch, wie ungern sie nachts fuhr. Also hätte er sich die Mühe machen können – für Natasha, wenn auch nicht für sie. Sie hatten ihn beide vermisst.
Plötzlich bemerkte Caroline eine Bewegung auf ihrer linken Seite und bekam Herzklopfen. Eine Eule sauste im Tiefflug über die Hecken. Der Strahl der Autoscheinwerfer fing sich hell in ihrer weißen Brust, die sich vom schwarzen Himmel abhob. Caroline atmete auf.
Der Mond schien nicht, und auf dem schwarzen Asphalt der schmalen Straßen, die zu ihrem Haus führten, glitzerte der Raureif. Es war so still, als wäre die Welt stehen geblieben. Nun, da die Eule fort war, war ihr Auto das Einzige, was sich rührte. Caroline wusste, dass außer dem leisen Brummen ihres Motors auch kein Geräusch zu hören sein würde, wenn sie das Fenster öffnete. Weder vor ihr noch hinter ihr war Licht zu sehen, und kurz drohte ihre beständige Angst vor der Dunkelheit sie zu überwältigen.
Sie beugte sich vor, stellte das Radio leiser und ließ sich von den fröhlichen, für diese Jahreszeit typischen Weihnachtsliedern beruhigen. Bald würde sie das Gedudel satthaben, doch im Moment empfand sie diese vergnügte Alltäglichkeit als Trost.
Sie lächelte, als neben ihr auf dem Beifahrersitz das Telefon läutete. Das war sicher David, der wissen wollte, wann sie zurück sein würde. Sie warf nur einen flüchtigen Blick auf das Display, bemerkte jedoch im letzten Moment, dass es sich um eine unterdrückte Nummer handelte. Also tippte sie aufs Display und drückte den Anruf weg. Wer immer es auch sein mochte, konnte warten, bis sie zu Hause war. Mit einer Hand steuerte sie um eine scharfe Kurve und legte mit der anderen das Telefon wieder auf den Sitz. Der Wagen geriet auf der glatten Straße leicht ins Schlittern. Kurz bekam sie es mit der Angst zu tun. Doch das Auto hielt die Spur, und sie atmete auf.
Vorsichtig nahm Caroline die nächsten Kurven, aber ihre angespannten Schultern lockerten sich erst, als sie das kurze gerade Stück Straße erreichte, wo hohe Hecken zu beiden Seiten die Sicht auf tiefe Gräben versperrten. Caroline beugte sich zur Windschutzscheibe vor und spähte in die Nacht hinaus. Die Scheinwerfer erfassten eine dunkle Kontur – etwas vor ihr auf der Straße. Sie bremste leicht ab und schaltete vorsichtshalber einen Gang herunter.
Im zweiten Gang näherte sie sich dem Hindernis und erkannte schließlich erschrocken, dass es sich um ein Auto handelte, das quer auf der Fahrbahn stand. Die Vorderreifen waren im Graben auf der rechten Straßenseite versunken. Sie glaubte, eine über dem Lenkrad zusammengesackte Gestalt im Wageninneren zu erkennen.
Langsam rollte Caroline auf das Auto zu. Als sie auf den Knopf drückte, um ihr Fenster herunterzulassen, bekam sie plötzlich Herzklopfen. Offenbar brauchte da jemand Hilfe.
Wieder läutete ihr Telefon.
Ihr erster Gedanke war, nicht darauf zu achten, doch wenn sich hier ein Unfall ereignet hatte, musste sie Hilfe holen. Rasch griff sie nach dem Telefon und nahm den Anruf an. Dabei bemerkte sie, dass ihre Hand zitterte.
»Hallo?«
»Caroline, bist du schon zu Hause?«
Die Stimme kam ihr bekannt vor, doch sie konnte sie nicht einordnen. Ihr Blick ruhte weiter auf dem Hindernis vor ihr, als sie stoppte und ihren Sicherheitsgurt öffnete.
»Noch nicht. Warum? Wer spricht da?«
»Hör mir einfach nur zu. Ganz gleich, was du auch tust, halt unter gar keinen Umständen an.« Der Mann sprach schnell und leise. »Fahr nach Hause. Fahr sofort nach Hause. Hörst du?«
Der panische Tonfall am Telefon spiegelte Carolines eigene wachsende Furcht wider. Sie zögerte.
»Aber da steht ein Wagen quer auf der Straße. Offenbar hatte jemand einen Unfall. Vielleicht ist er krank oder verletzt. Warum darf ich nicht anhalten? Was ist los?«
»Tu einfach, was ich dir sage, Caroline. Steig auf keinen Fall aus. Und jetzt gibst du Gas und fährst an dem Auto vorbei. Bleib unter keinen Umständen stehen, ganz gleich, was passiert. Tu es einfach.«
Die Stimme klang angespannt und drängend. Caroline spürte, wie ihr die Angst in der Kehle hochstieg. Was sollte das? Nach einem Blick in den Rückspiegel traf sie eine Entscheidung. Sie warf das Telefon auf den Beifahrersitz und umklammerte das Lenkrad mit beiden Händen. Der Kombi war lang und tiefergelegt, und das Heck blockierte den Großteil der Straße. Die Hinterreifen schwebten ein Stück über dem Boden, da die Motorhaube im Graben hing. Es war nicht viel Platz, um am Heck des Wagens vorbeizukommen. Aber sie würde es schaffen. Sie musste es schaffen.
Sie trat das Gaspedal kräftig durch. Die Reifen schlitterten auf der vereisten Fahrbahn. Doch dann griffen sie, und sie riss das Auto nach links. Die Reifen auf der Fahrerseite holperten entlang der Böschung unterhalb der Hecke, sodass der Wagen in eine gefährliche Schieflage geriet. Sie lenkte wieder nach rechts, und landete mit einem dumpfen Geräusch; das Auto zeigte nun auf die entgegengesetzte Straßenseite. Caroline lenkte erneut nach links, um das Fahrzeug auszurichten. Der Motor heulte auf, als sie beschleunigte.
Plötzlich spürte sie, dass sie zu rutschen anfing. Panisch lenkte sie erst in die eine, dann in die andere Richtung, doch was sie auch tat, das Auto reagierte nicht. Blitzeis, und sie fuhr viel zu schnell. Sie erinnerte sich, dass man ihr beigebracht hatte, in die Rutschbewegung hineinzusteuern, doch das fühlte sich irgendwie falsch an.
Ein Name schoss ihr durch den Kopf. Plötzlich war ihr klar, wer sie angerufen hatte. Aber warum er? Sie rief seinen Namen, wusste jedoch, dass er nichts mehr unternehmen konnte. Als ihr Blick durch den Rückspiegel in den hinteren Teil des Wagens fiel, sah sie das Weiße in Natashas entsetzt aufgerissenen Augen.
Sie trat heftig auf die Bremse, doch nichts geschah. Das Auto geriet ins Schleudern, prallte erneut gegen die Böschung, neigte sich auf eine Seite, fiel um, kippte aufs Dach, brach durch die Hecke und landete im Graben. Carolines zerschmetterter Körper hing halb aus dem offenen Fenster.
***
Der Polizist fuhr durch die schmalen Straßen und genoss den seltenen Moment der Ruhe, bevor das weihnachtliche Chaos ausbrechen würde. Ein anonymer Anrufer hatte gemeldet, irgendwo hier in der Nähe sei ein Auto von der Straße abgekommen. Doch laut Zentrale hatte der Mann keine Einzelheiten nennen können. Also hoffte der Polizist, dass nur irgendein Idiot seine Kiste hier abgestellt hatte, wegen einer Panne oder weil ihm der Sprit ausgegangen war. So kurz vor den Feiertagen hatte er genug davon, sich mit Betrunkenen herumärgern zu müssen, und ein verlassenes Fahrzeug würde ihn für eine Weile beschäftigen – vielleicht sogar bis zum Ende seiner Schicht.
Allerdings wurde ihm bald klar, dass er sich zu früh gefreut hatte. Es waren die Scheinwerfer, die seinen Verdacht erregten. Niemand ließ sein Auto mit eingeschalteten Scheinwerfern stehen, und dennoch sah er vor sich ein unbewegtes weißes Licht, das die kahlen Bäume am Straßenrand hell erleuchtete. Als er näher kam, blendete ihn der grelle Strahl der Scheinwerfer. Er hielt sich schützend den Handrücken vor Augen und rollte so langsam wie möglich heran, nur für den Fall, dass da jemand auf der Straße lag, den er nicht sehen konnte. Etwa zwanzig Meter vor dem Auto blieb er stehen und stellte den Motor ab.
Er erkannte auf den ersten Blick, dass die Lage ernst war. Das Auto lag auf dem Dach an der Böschung am Straßenrand. Jedoch war es der Lärm, der ihn bis ins Mark traf. Er durchschnitt die Stille der menschenleeren Landschaft. Das leise Schnurren eines teuren Motors bildete den Hintergrund zu den unverkennbaren Klängen von Bing Crosbys »White Christmas«. Die sanfte Musik wehte durch die offene Scheibe in die eisige Nacht hinaus. Und aus der Öffnung ragte der Kopf einer Frau in einem so bizarren Winkel, dass der Polizist nicht näher zu kommen brauchte, um zu wissen, dass sie tot war.
Langsam näherte er sich dem umgekippten Fahrzeug, um den Motor und damit auch die Musik abzustellen. Nun konnte er wieder atmen. Es handelte sich nur um einen Verkehrsunfall ohne Fremdverschulden, wenn auch um einen tragischen. Er griff zum Funkgerät.
Während er auf die Sanitäter wartete, obwohl er wusste, dass sie auch nichts weiter tun konnten, als seine Erkenntnis zu bestätigen, machte sich der Polizist daran, die Straße zu sperren, forderte ein Spurensicherungsteam an, damit dieses den Unfall untersuchte, und führte eine Halteranfrage durch, um festzustellen, wem der Wagen gehörte. Dann holte er eine Taschenlampe aus seinem Kofferraum und leuchtete Straße, Gräben und die Böschung ab, nur für den Fall, dass sich ein Verletzter aus dem Auto gerettet oder etwas auf der Straße den Wagen ins Schlingern gebracht hatte. Da war nichts. Die Straße war leer.
Der Polizist war erleichtert, als das Geräusch von sich nähernden Sirenen durch die Stille hallte. Wenige Minuten später traf der Krankenwagen ein. Seine Scheinwerfer fielen auf einen einsamen Radfahrer, der zögernd herankam.
Der Mann stieg vom Rad und blieb in einiger Entfernung stehen. Der Polizist ging auf ihn zu.
»Verzeihung, Sir, aber Sie müssen Abstand halten.«
»Okay, Officer, ich möchte nur nach Hause.«
»Ich verstehe. Doch im Moment kann ich Sie diesen Straßenabschnitt nicht passieren lasssen. Sicher sehen Sie das ein.«
»Wurde jemand verletzt? Das ist doch das Auto von Caroline Joseph, habe ich recht?«, fragte der Radfahrer.
»Das kann ich im Moment nicht bestätigen, Sir.«
Der Mann spähte an dem Polizisten vorbei.
»Ist sie das? Oh, mein Gott. Sie ist tot, oder?« Den Mund halb offen vor Schreck, musterte er den Polizisten. »Der arme David. Ihr Mann. Er wird völlig fertig sein.«
Der Polizist antwortete nicht. Er konnte nicht mehr tun, als den Mann so weit wie möglich auf Distanz zu halten, bis die Verstärkung eintraf. Doch selbst aus dieser Entfernung war der Kopf der Frau nur allzu deutlich auszumachen.
»Sie hatte doch nicht etwa Natasha bei sich, oder?«, fragte der Radfahrer mit zitternder Stimme. »Ihre kleine Tochter? Ein niedliches Mädchen.«
Ziemlich erleichtert schüttelte der Polizist den Kopf.
»Nein, Sir. Der Kindersitz ist zwar hinten festgeschnallt, aber zum Glück leer. Sonst war niemand im Fahrzeug.«
SUCHE NACH VERMISSTEM MÄDCHEN ZURÜCKGEFAHREN
Eine Polizeisprecherin hat bestätigt, dass die Suche nach der verschwundenen Natasha Joseph ab heute zurückgefahren wird.
Detective Inspector Philippa Stanley von der Greater Manchester Police gab die folgende Stellungnahme ab:
»Die Suchtrupps, bestehend aus Profis und Freiwilligen, haben die Umgebung mehr als zwei Wochen lang abgesucht. Wir glauben, dass jeder Zentimeter Landschaft in der Nähe des Unfallorts abgedeckt wurde. Zusätzlich zu den Trupps, die jeden erdenklichen Ort durchkämmt haben, wo sich ein kleines Mädchen hätte verkriechen können, um nicht zu erfrieren, haben wir auch Suchhunde und Helikopter mit Infrarotkameras eingesetzt. Bedauerlicherweise haben wir nichts gefunden.«
Natasha Joseph – von ihrer Familie Tasha genannt – verschwand, nachdem das Auto ihrer Mutter auf dem Rückweg von einer Familienfeier auf der Littlebarn Lane einen Unfall hatte. Caroline Joseph saß am Steuer, und es waren keine anderen Fahrzeuge beteiligt. Als die Polizei am Unfallort eintraf, fehlte von der kleinen Natasha jede Spur. Mrs Joseph wurde von den Sanitätern für tot erklärt.
Inzwischen sucht die Polizei nach weiteren Hinweisen. Insbesondere bittet sie Zivilpersonen, die sich in der Nähe des Unfallorts aufgehalten haben, sich zu melden.
»Ob die Menschen nun glauben, etwas zu wissen oder nicht, es führt immer wieder zu überraschenden Ergebnissen. Ein ums andere Mal sind wir erstaunt, wie die winzigste Information – die Sichtung eines bestimmten Fahrzeugs oder einer sich verdächtig verhaltenden Person – weiterhelfen kann, insbesondere dann, wenn man sie mit gesammelten Daten verknüpft. Hierzu greifen wir wenn nötig auf die automatische Nummernschilderkennung zurück und haben zudem Überwachungsvideos von Tankstellen und weiteren Kameras in der nahe gelegenen Ortschaft gesichert. Dennoch bitten wir jeden, der in jener Nacht in der fraglichen Umgebung unterwegs war, sich zu melden. Unsere ausgebildeten Vernehmer werden Sie darin unterstützen, jeden Moment jenes Abends zusammenzufügen. Und wir sind zuversichtlich, irgendwo da draußen die entscheidende Information zu finden, die uns weiterbringt.«
Die Polizei bestätigt, dass die Suche nach dem Mädchen zwar zurückgefahren wurde. Doch das mit dem Fall befasste Team von Detectives arbeitet unter Hochdruck weiter.
David Joseph, Ehemann von Caroline Joseph und Vater von Natasha, ist ein erfolgreicher Geschäftsmann in Manchester und hat letzte Woche im Fernsehen einen aufrüttelnden Appell an die Öffentlichkeit gerichtet.
»Jemand muss wissen, wo mein kleines Mädchen ist. Tasha hat ihre Mutter verloren und ist jetzt sicherlich verzweifelt, verwirrt und verängstigt. Bitte helfen Sie mir, sie zu finden. Ich brauche mein kleines Mädchen. Ich habe alles verloren.«
Wenn Sie sich vertraulich an jemanden wenden wollen, rufen Sie bitte unter der Nummer 08 00 6 12 57 36 oder 01 61 79 37 85 an.
1 Sechs Jahre später
DCI Tom Douglas ertappte sich dabei, dass er ein Liedchen vor sich hinsummte, als er den Flur entlang zu seinem Büro ging. Er hatte den ersten Arbeitstag nach den Feiertagen schon immer genossen, genau wie er damals in seiner Kindheit nach den langen Sommerferien gern in die Schule zurückgekehrt war. Es war ein Gefühl der Vorfreude, das Wissen, dass der Tag für ihn Herausforderungen bereithalten würde. Und er brannte darauf, sich ihnen zu stellen. Er freute sich über die Kameradschaft in seinem Team – sie waren zwar nicht unbedingt Freunde, aber Verbündete, die einander unterstützten und wussten, dass sie immer auf ihn zählen konnten. Es war nicht der leichteste Job der Welt, doch zumindest langweilte er sich nur selten, und das hatte etwas für sich.
Er schob die Tür zu seinem Büro auf und streckte den linken Fuß aus, um den Türstopper an seinen Platz zu befördern. Sein Fuß traf ins Leere. Als er nach unten schaute, fehlte von dem dicken Schwein, das sonst die Tür offen hielt, jede Spur. Er hängte seine Jacke an den Garderobenständer und ging in die Hocke, um unter dem Schreibtisch nachzusehen. Als er ein kurzes Klopfen an der Tür hörte, murmelte er »herein«.
Die Tür öffnete sich, und eine ihm wohlbekannte Stimme erklang. Offenbar musste sich die Person ihre Erheiterung verkneifen.
»Fühlen Sie sich wohl da unten?«
»Ich fühle mich prima, aber jemand hat, verdammt noch mal, mein Schwein geklaut.«
Tom erhob sich und klopfte sich den Staub von der Anzughose. »Wirklich. Man möchte doch meinen, dass man sich in einem Polizeipräsidium einigermaßen darauf verlassen kann, ausschließlich gesetzestreue Bürger anzutreffen, oder? Ich dachte, es sei irgendwie da runtergetreten worden oder so. Aber es hat sich in Luft aufgelöst.«
»Falls jemand Ihr Schwein getreten hätte, würde er jetzt wahrscheinlich mit einer gebrochenen Zehe herumhinken. Außerdem beklaut nur ein absoluter Idiot einen Detective Chief Inspector – obwohl wir auf dieser Grundlage einige Verdächtige in Erwägung ziehen könnten. Ich höre mich für sie um.«
Tom zog seinen Stuhl heran, setzte sich und bedeutete Becky, seinem Beispiel zu folgen. »Und wie war es bei Ihnen, Becky? Irgendetwas Spannendes, während ich weg war?«
»Im Großen und Ganzen nur der übliche Kram«, erwiderte Becky und nahm sich ebenfalls einen Stuhl. »Abgesehen von einer besonders brutalen Vergewaltigung. Anfangs dachten wir, es handle sich um eine Vergewaltigung durch einen Fremden. Stimmte aber nicht.«
»Wer war es dann?«
»Ihr Mistkerl von einem Freund. Er hat sich maskiert, mit allem Drum und Dran, und ihr auf dem Heimweg von der Arbeit aufgelauert. Er hat sie zu Brei geschlagen, sie übelst vergewaltigt und dann liegen gelassen.«
»Was hat ihn verraten?«
»Das Opfer. Als sie im Krankenhaus wieder zu sich kam, hat sie behauptet, sie hätte keine Ahnung, wer es war. Aber wir haben ihr angemerkt, dass sie uns etwas verschweigt. Wie sich herausstellte, hatte sie eine Todesangst, ihr Freund würde sie umbringen, wenn sie ihn belastet. Schließlich ist sie eingeknickt und hat es uns gesagt. Allerdings wollte sie keine Anzeige erstatten, da es keine Beweise gab.«
Becky lehnte sich zurück und verschränkte die Arme.
»Aber wir haben ihn drangekriegt. Er war zwar so schlau, ein Kondom zu benutzen, aber auch so blöd, es fünfzig Meter weiter in eine Mülltonne zu werfen. Behauptete, seine Freundin habe es nicht anders verdient, weil sie mit den Typen im Pub flirtet, wo sie arbeitet.«
Becky kräuselte angewidert die Lippen. Tom konnte sich gut vorstellen, mit welch eisiger Entschlossenheit sie den Kerl verhört hatte. Seine Mitarbeiterin war zwar ein verletzlicher Mensch, besaß jedoch eine ans Unheimliche grenzende Fähigkeit, Menschen die Wahrheit zu entlocken.
»Und wie war Ihr Urlaub?«, fragte Becky.
»Danke, gut. Leo und ich haben ein paar Tage in Florenz verbracht. Anschließend waren wir in meinem Wochenendhaus in Cheshire. Ich musste einige Papiere meines Bruders ordnen, und Leo hat für eine Prüfung gebüffelt. Es war eine dieser gleichförmigen Wochen, die wie im Fluge vergehen.«
Eigentlich sprach Tom nur ungern über sein Privatleben. Erst in letzter Zeit hatte er begonnen, Leo hin und wieder gegenüber seinen Kollegen zu erwähnen. Zu seiner Erheiterung hatten ein paar von ihnen nicht verstanden, dass es sich bei Leo um eine Abkürzung von Leonora handelte, was ihm einige verdatterte Seitenblicke eingebracht hatte. Doch Becky hatte die Sache richtiggestellt.
Nur wenige Menschen wussten von dem Haus in Cheshire, das Tom nach seinem Abschied von der Londoner Polizei gekauft hatte. Auch seinen Bruder Jack erwähnte er nur selten. Allerdings war Becky über den tragischen Unfall im Bilde, bei dem er vor einigen Jahren umgekommen war. Auch darüber, dass Jack Tom ein Vermögen aus dem Verkauf seiner Internet-Sicherheitsfirma vermacht hatte. Allerdings brachte sie das Thema nie zur Sprache, wenn Tom es nicht von selbst tat.
Toms Telefon unterbrach jedes weitere Urlaubsgeplauder.
»Tom Douglas«, meldete er sich. Er lauschte, als seine Vorgesetzte, Detective Superintendent Philippa Stanley, ihm die Art von Nachricht überbrachte, die er am allermeisten verabscheute. Seine gute Laune verflüchtigte sich schlagartig.
Er legte auf. »Holen Sie Ihre Jacke, Becky. Wir haben eine Leiche. Leider muss ich hinzufügen, dass es ein junges Mädchen ist, den Berichten zufolge kaum ein Teenager.«
2
Ausnahmsweise hatte Tom die Kontrolle abgegeben und es Becky überlassen, sie zum Tatort zu fahren. Allerdings bereute er diese Entscheidung schon wenige Minuten später. Beckys Fahrweise – mit einer Hand steuern und andere Autofahrer mit Nichtachtung strafen – war schon seit ihrer ersten Begegnung ein Streitpunkt zwischen ihnen. Er hatte versucht, sie zu einem Auffrischungskurs zu überreden, doch sie hielt das für überflüssig. Sie sagte, sie habe noch nie einen Unfall gebaut. Tom nahm an, dass die anderen Verkehrsteilnehmer sie kommen sahen und schlicht einen großen Bogen um sie machten.
Als sie mit quietschenden Bremsen auf einer langen, geraden Straße hinter einigen anderen Polizeifahrzeugen hielten, war er froh, aussteigen zu können.
Die Straße wurde von kräftigen Bäumen gesäumt, die den Blick auf einige große, zurückversetzt liegende Anwesen auf der rechten Seite versperrten. Links begrenzte eine dicke Mauer ein dicht bewaldetes Gebiet. In etwa fünfzig Metern Entfernung stand ein uniformierter Kollege Wache an einem altmodischen Schwinggatter. Dahinter führte ein schmaler unbefestigter Weg in den Wald hinein. Ein schmales Stück Absperrband war bereits gespannt.
Wortlos schlüpften sie in ihre Schutzkleidung und steuerten auf den Pfad zu.
Nach einer kurzen Unterredung mit dem Polizisten, um ihre Identitäten festzustellen, gingen die beiden im Gänsemarsch den morastigen Pfad entlang, wobei sich immer wieder wuchernde Brombeerranken an den Beinen ihrer Overalls verfingen, bis sie einen bogenförmigen Tunnel errreichten. Tom vermutete, dass darüber eine stillgelegte Bahnlinie verlief. Er sah Becky die Nase rümpfen, als sie die düstere Höhle betraten. Nach dem Geruch und dem am Boden herumliegenden Unrat zu urteilen, wurde der Tunnel regelmäßig für wenig gesundheitsförderliche Aktivitäten genutzt. Sie stiegen über zerbrochene Flaschen und Bierdosen und hielten sich in der Mitte des Weges, um dem ekelerregenden Müll auszuweichen, der sich an den Wänden auftürmte. Tom blickte sich um. Falls das Mädchen ermordet worden war, warum war sie dann draußen unter freiem Himmel und nicht hier drin getötet worden, wo eine Entdeckung weniger wahrscheinlich war? Diese Katakombe roch förmlich nach Tatort – wenn auch nicht dieses Verbrechens. Er war sicher, dass der Tunnel bereits einige Verderbtheiten gesehen hatte.
Hinter dem Tunnel wartete ein weiterer Polizist, um ihnen den Weg zu zeigen. Vor ihnen waren bereits zwei weiße Zelte zu erkennen, die zu beiden Seiten einer Eiche aufgebaut waren und mit Klebeband zusammengehalten wurden, um den dicken Baumstamm zu umschließen. Direkt vor dem Absperrband bemerkte Tom die massige Gestalt von Jumoke Osoba, besser bekannt unter dem Namen Jumbo. Tom war – aus unerklärlichen Gründen – froh, dass diese Leiche offenbar den besten Spurensicherungsexperten auf den Plan gerufen hatte, dem er je begegnet war. Ausnahmsweise zeichnete sich kein ansteckendes Grinsen auf Jumbos Gesicht ab. Tom nickte ihm zur Begrüßung zu.
»Was haben wir, Jumbo?«
»Junges Mädchen – meiner Schätzung nach ungefähr zwölf, könnte aber auch ein bisschen älter sein. Zum Glück war der Gerichtsmediziner bereits in der Gegend, weshalb wir nicht lange warten mussten. Er ist gerade bei ihr und kann Ihnen sicher bald mehr verraten. Übrigens ist es James Adams, und der weiß Gott sei Dank, was er tut. Noch bevor die Zelte standen, war mir klar, dass das Mädchen schon seit ein paar Tagen dort liegt – kein schöner Anblick.« Er betrachtete Tom mitfühlend. »Wollen Sie reingehen?«
Tom nickte, hob das Absperrband an, um sich darunter durchzuducken, und drehte sich zu Becky um.
»Ich glaube, wir werden nicht beide gebraucht, Becky. Sprechen Sie mit Jumbo. Er kann Ihnen alles erklären, was wir bis jetzt wissen.« Beckys erleichterte Miene war nicht zu übersehen. Ihr waren schon genug Leichen untergekommen, doch mit Kindern war es immer etwas anderes – vor allem dann, wenn sie schon seit einer Weile tot waren.
Als Tom das Zelt betrat, fiel sein Blick auf die Leiche. Von seinem Standort aus konnte er erkennen, dass die Verwesung schon weit fortgeschritten war. Wenn man bedachte, dass es Anfang März und kalt für diese Jahreszeit war, musste das Mädchen schon seit einer Weile hier liegen. An die Eiche gelehnt, zum Teil mit faulem Laub bedeckt und nur mit einem dünnen weißen Nachthemd bekleidet. An den Füßen trug sie Turnschuhe, grau vom Alter und mit brüchigen Sohlen. Einige Meter von der Leiche entfernt lag etwas, das wie ein blauer Anorak aussah. Der Ausschnitt des Nachthemds war eingerissen.
Tom schaute sich um, doch sonst war nichts auszumachen. Es würde Aufgabe von Jumbos Leuten und James Adams sein, die Indizien einzusammeln. Tom oblag es, herauszufinden, was der Toten zugestoßen war. Er wechselte kurz ein paar Worte mit dem Pathologen und überließ ihn danach seiner Arbeit.
Tom trat aus dem Zelt, atmete in tiefen Zügen die kalte, frische Luft ein, schloss für eine Sekunde die Augen und dachte an die Familie des Mädchens. Wenn die sie als vermisst gemeldet hatte, würde man sie sicher rasch identifizieren.
Er folgte dem Weg zurück, wobei er darauf achtete, nicht von den ausgelegten Trittplatten abzuweichen, um den Fundort nicht zu kontaminieren. An Beckys Körpersprache erkannte er, dass sie ihm etwas Dringendes zu sagen hatte. Hoffentlich hatte das Team im Präsidium seine Arbeit gemacht und konnte mit einem Namen des Opfers aufwarten.
»Was haben Sie rausgekriegt, Becky?«, fragte er.
»Nichts. Eine dicke, fette Null. Ich hatte gerade einen Anruf. In den letzten zwei Wochen ist kein Mädchen zwischen zehn und vierzehn Jahren vermisst gemeldet worden. Bis jetzt also gar nichts. Also müssen wir weiter zurückgehen und uns die Mädchen anschauen, die schon länger vermisst werden und auf die das Profil passt. Außerdem sollten wir die Suche auch auf die benachbarten Dienststellen ausweiten.«
»Lang kann sie noch nicht verschwunden sein. Ich glaube nicht, dass sie auf der Straße gelebt hat«, meinte Tom kopfschüttelnd. »Sie hat ein weißes Nachthemd an, verdammt. Wie viele Straßenkinder legen sich im Nachthemd schlafen? Was denken Sie, Jumbo?«
Jumbo hatte dem Gespräch schweigend gelauscht.
»Wir haben keine persönliche Habe entdeckt. Aber bevor die Leiche nicht abtransportiert worden ist, können wir die unmittelbare Umgebung nicht untersuchen. Es steckt auch kein Ausweis in den Taschen ihres Anoraks. Aber ich stimme Tom zu. Ein Straßenkind ist sie nicht.«
»Lag der Anorak auf dem Boden, ein Stück entfernt von der Leiche?«, erkundigte sich Tom.
»Genau dort, wo Sie ihn gesehen haben«, erwiderte Jumbo. »Natürlich wurde alles fotografiert, aber ich habe ihn trotzdem zurückgelegt, nachdem ich die Taschen durchsucht hatte, damit Sie ihn an Ort und Stelle vorfinden.«
Beckys Funkgerät piepste, und sie trat ein Stück beiseite, um Tom und Jumbo nicht zu stören, förderte ihr Notizbuch zutage und nahm den Funkspruch an.
»Falls sie in der letzten Woche oder so von zu Hause verschwunden ist, hat sich offenbar niemand die Mühe gemacht, das zu melden. Es widert mich an, dass wir von so vielen Ausreißern nie erfahren«, sagte Tom. »Offenbar rechnen die Eltern oder Aufsichtspersonen damit, dass sie nach ein paar Nächten auf der Straße wieder zurückkommen.«
»Ja, und die meisten Kinder haben keine Ahnung, wie viele Mistkerle da draußen lauern und nur auf ein schutzloses Opfer warten.«
Die beiden Männer verstummten, als Becky sich zu Wort meldete. Sie wandte sich um und kam auf sie zu.
»Wurde ihre ethnische Herkunft schon bestimmt? Sie haben eine Suchanfrage nach allen Mädchen gestartet, und wir haben einige Vermisste, die passen könnten.«
Tom sah Jumbo an.
»James war sich sicher, dass es sich um eine Weiße handelt – obwohl ich keine Ahnung habe, wie er das feststellen konnte. Schwebt euch jemand Bestimmtes vor?«
Wieder sprach Becky ins Funkgerät, und alle drei lauschten der Antwort.
»Wir sind die alten Fälle durchgegangen – Kinder, die seit Monaten oder sogar Jahren verschwunden sind. Und dabei sind wir auf drei Möglichkeiten gestoßen: Amy Davidson, Hailey Wilson und Natasha Joseph.«
3
Als Tom und Becky ins Präsidium zurückkehrten, war seine Urlaubsstimmung vollständig verflogen. Der Anblick, wie der Leichensack aus dem Zelt geschafft wurde, hatte ihn stärker getroffen als erwartet. Es war immer entsetzlich, wenn Kindern etwas zustieß, doch das Bild des Mädchens im weißen Nachthemd, an einen Baum gelehnt und die mageren Beine ausgestreckt, war besonders bestürzend. Tom dachte an seine Tochter Lucy und fragte sich, was sie wohl im Moment tat.
James Adams, der Pathologe, hatte telefonisch seinen vorläufigen Bericht durchgegeben.
»Meiner Ansicht nach handelt es sich um ein weißes Mädchen um die zwölf Jahre. Keine besonderen Merkmale. Naturblondes Haar, sehr zierlich gebaut, aber nicht unterernährt. Wir haben ihre Hände am Fundort eingetütet, doch ich bezweifle, dass wir brauchbare Fingerabdrücke kriegen. Nach der Obduktion sichern wir so viele Fragmente wie möglich. Meiner anfänglichen Schätzung nach liegt sie seit etwa einer Woche dort. Allerdings war es sehr kalt, insbesondere nachts, weshalb ich das vielleicht noch revidieren werde. Im Moment kann ich noch nicht mit einer Todesursache aufwarten, aber Sie erfahren sie als Erster. Sicher wollen Sie bei der Autopsie dabei sein?«
Tom stimmte zu und beendete gerade das Gespräch, als Becky mit der Hüfte die Tür aufschob. Sie balancierte zwei Tassen des dringend benötigten Kaffees und versuchte dabei, den Aktenstapel, der unter ihrem anderen Arm klemmte, nicht fallen zu lassen.
»Bitte sehr, Boss. Ich glaube, den brauchen wir jetzt«, verkündete sie, stellte die Tassen ab und zog sich einen Stuhl heran. »Die Kommandozentrale wird gerade erst eingerichtet. Aber ich habe schon einmal ein paar Aufzeichnungen zu den vermissten Mädchen mitgebracht.«
Tom griff nach seiner Kaffeetasse und trank einen Schluck, ohne sich darum zu kümmern, dass die kochend heiße Flüssigkeit ihm die Zunge verbrannte.
»Okay, werfen wir mal einen Blick darauf. Allerdings könnte eine beliebige Anzahl von Kindern in den letzten Wochen weggelaufen sein, ohne dass jemand es gemeldet hat«, erwiderte Tom. »Also wollen wir uns nicht auf diese drei beschränken. Ich kriege noch immer nicht zu fassen, was mich an diesem Nachthemd stört. Es ist, als hätte man sie direkt aus dem Bett geholt. Und wie viele Mädchen dieses Alters tragen weiße, bis zum Hals zugeknöpfte Nachthemden? Es gefällt mir auch nicht, dass es am Hals eingerissen ist. Die Knöpfe waren geschlossen. Jemand muss eine Hand in den Ausschnitt gesteckt und den Stoff mit Gewalt zerfetzt haben. Ich bin neugierig, ob James Hinweise auf sexuellen Missbrauch findet. Jedenfalls kommt mir die Sache reichlich merkwürdig vor.«
Becky nickte und konsultierte ihre Notizen.
»James sagte auch, es gebe keine offensichtlichen Hinweise auf Unterernährung. Also ist sie entweder erst vor Kurzem weggelaufen und in etwas verwickelt worden – zum Beispiel entführt von einem dieser Schweine, die sich über hilflose Kinder hermachen –, oder sie gehört zu den Langzeitvermissten, die wer weiß was haben durchstehen müssen. Eine können wir zumindest ausschließen. Hailey Wilson ist dunkelhaarig. Also bleiben nur noch Amy Davidson und Natasha Joseph übrig. Amy Davidson stand unter staatlicher Betreuung. Als sie etwa acht war, fing sie an wegzulaufen, anfangs nur für eine Nacht, doch dann wurde das häufiger, bis sie mit elf gar nicht mehr zurückkam. Das war vor anderthalb Jahren. Wir haben keine Vergleichs-DNA, und ich bin nicht sicher, was mit ihren Eltern los ist. Das müssen wir noch überprüfen.«
Becky legte eine der Akten neben ihren Stuhl auf den Boden und griff nach der nächsten. »Natasha Joseph – wissen Sie etwas über sie? Sie waren doch damals in Manchester, oder?«
Tom nickte. »Ich erinnere mich an den Fall, war aber nicht damit befasst.« Er beschloss, nicht zu erwähnen, dass er wenige Tage nach dem Verschwinden des Kindes wegen eines Trauerfalls Urlaub genommen hatte. »Ihre Mutter kam bei einem Autounfall um. Natasha hätte eigentlich auf dem Rücksitz sein müssen, war sie aber nicht. Es wurde nie eine Spur von ihr entdeckt. Auch kein plausibler Grund für den Unfall.«
»Jumbo erinnert sich daran«, meinte Becky. »Er wurde hinzugezogen, als man bemerkt hat, dass es sich nicht nur um einen Zusammenstoß handelte. Doch er sagt, es habe sich nichts Sachdienliches ergeben. Kein Hinweis darauf, dass ein Kind bei dem Unfall verletzt wurde – genau genommen auch kein Hinweis, dass das Mädchen überhaupt im Auto gewesen ist. Sie haben ein paar DNA-Spuren, doch er sagt, wir sollten sie mit Vorsicht behandeln. Sie stammen von einer Haarbürste und könnten mit den Haaren anderer Personen vermischt sein. Allerdings war der Vater überzeugt, dass niemand sonst die Bürste benutzt hat.«
»Warum spüren Sie nicht den Vater auf und erklären ihm den Stand der Dinge, Becky? Besorgen Sie sich eine DNA-Probe zu Vergleichszwecken, aber stellen Sie klar, dass wir Natasha nur ausschließen wollen. Das gleiche Prozedere bei Amy Davidson. Allerdings müssen wir in ihrem Fall das Jugendamt und ihre Pflegefamilie informieren. Und wir sollten Hailey Wilsons Familie mitteilen, dass wir sicher sind, dass sie es nicht sein kann, damit sie nicht in Panik geraten, wenn die Presse irgendetwas darüber bringt. Apropos: Ich möchte, dass die Sache intern bleibt, bis alle wichtigen Personen in Kenntnis gesetzt wurden. In Wahrheit wissen wir nichts über dieses Mädchen und dürfen es nicht riskieren, die Ermittlungen zu behindern, indem wir massenweise hysterischen Hinweisen nachgehen müssen, was geschehen wird, wenn es publik wird, bevor wir so weit sind.«
4 Tag eins
»Komm schon, du kleiner Knurrhahn. Jetzt bist du sauber und wieder ordentlich angezogen. Also lächle mal.«
Als Emma Ollies Bäuchlein kitzelte, fing er an zu kichern – ihr liebstes Geräusch auf der ganzen Welt. Er hatte es schon immer gehasst, angezogen zu werden. Als Baby hatte er so geschrien, dass Emma schon befürchtet hatte, etwas stimme nicht mit ihm – womöglich eine dieser schrecklichen Krankheiten, bei denen man Kinder nicht anfassen durfte, weil sonst ihre Knochen sofort brachen. Wochenlang hatte es ihr davor gegraut, ihn anzuziehen, bis ihr klar geworden war, dass er ansonsten nichts dagegen hatte, wenn sie seine Gliedmaßen bewegte. Er trug einfach nicht gern Kleidung. Inzwischen wehrte er sich sogar körperlich, wenn Emma versuchte, seine Beinchen in die Strampelhose zu stecken. Außerdem brüllte er vor Empörung so laut wie möglich – ein Trick, den er den Handwerkern abgeguckt hatte, die ihre neue Küche einbauten. Der Vorarbeiter rief »Ay«, sobald er etwas wollte. »Ay, Bill, reich mir mal den Hammer rüber.« Oder »Ay, Missus, gibt’s hier vielleicht irgendwo Kaffee?« Ollie hatte das nachgemacht, und nun war es sein Lieblingsgeräusch. Er beherrschte ein ärgerliches »Ay«, was anscheinend »sofort aufhören« bedeutete. Doch meistens rief er es nur, um Aufmerksamkeit zu erregen. Emma hoffte, dass sich das legen würde, wenn sich sein aktuell aus zehn Wörtern bestehender Wortschatz erweiterte.
Auf einen Ellbogen gestützt, lag sie neben ihm auf dem Bett, kroch mit den Fingern der anderen Hand Ollies Körper hinauf und sang dabei »Da kommt die Maus, da kommt die Maus, klingelingeling, ist der Herr im Haus?«. »Nein, nein!«, rief Ollie, der ahnte, was nun folgen würde.
»Was für ein kluger Junge du bist, Ollie.« Emma schmatzte ihm einen dicken Kuss aufs Bäuchlein. Ein Glücksgefühl überkam sie bei dem Gedanken, dass dieses wunderschöne Baby ihres war. Bei ihrer Hochzeit mit Ollies Vater war sie siebenunddreißig gewesen und hatte nicht mehr gewagt, auf Kinder zu hoffen, um nur nicht enttäuscht zu werden.
»Komm, lass dir von Mummy die Socken anziehen«, sagte sie und lächelte in sich hinein. Sie hatte sich stets geschworen, nie von sich selbst in der dritten Person zu sprechen – das war ihr wirklich schräg erschienen. Und jetzt tat sie es trotzdem.
Zehn Minuten später trug Emma Ollie die Treppe hinunter und blieb, wie sie es immer tat, wenn sie allein im Haus war, unten stehen, um das Porträt zu betrachten, das ihr vom anderen Ende des Flurs entgegenblickte.
Die erste Frau ihres Mannes war eine Schönheit gewesen. Daran bestand nicht der geringste Zweifel. Ihre zarten Gesichtszüge und die blasse, beinahe durchscheinende Haut waren perfekt getroffen. Ihr Vater hatte das Gemälde zu ihrem einundzwanzigsten Geburtstag in Auftrag gegeben. Emma strengte sich sehr an, keine Vergleiche zwischen der zerbrechlichen Schönheit dieser Frau und ihrem eigenen durchschnittlichen, wenn nicht gar unattraktiven Gesicht anzustellen. Doch es fiel ihr schwer. Allerdings hätte sie es nie über sich gebracht, David darum zu bitten, das Porträt abzuhängen.
Verärgert über die eigene Unfähigkeit, die letzten Reste von Unsicherheit zu vertreiben, öffnete sie die Tür ihrer fantastischen neuen Küche. Es hatte Emma einige Monate gekostet, sich durchzusetzen und in diesem Teil des Hauses etwas zu verändern. David hatte vor Emmas Einzug sieben Jahre lang hier gewohnt und meinte, ihm gefalle es so, wie es sei. Doch Emma hatte ihm erklärt, wie praktisch es wäre, den hinteren Teil des Hauses abzureißen und einen großen Raum anzubauen – Küche, Esszimmer und Wohnzimmer in einem.
Seit die Handwerker fort waren, war dies hier tagsüber Ollies und ihre Welt. Es gab genug Platz, damit ihr Sohn im Wohnzimmerbereich auf einer Decke spielen konnte. Dank der Fußbodenheizung war es sogar mitten im Winter warm genug für ihn. Wenn sie ehrlich mit sich war, hatte sie dem Haus außerdem ihren Stempel aufdrücken wollen. Sie wollte sich nicht länger wie ein Gast fühlen. Der Anbau war ihr ganz persönliches Terrain.
»London Bridge is falling down, falling down, falling down«, sang sie, als sie in die Küche trat und sich zum Spülbecken umdrehte, wo das Geschirr vom Mittagessen auf sie wartete. Ollie fing an, in ihren Armen herumzuwippen und ihr mit der Hand auf die Schulter zu schlagen.
»Ay, ay!«, rief er.
Emma lachte. »Möchtest du mitsingen, Schätzchen?« Sanft setzte sie ihn in sein Kinderstühlchen, aber er sah sie nicht an. »Du bist ein komischer kleiner Kerl, was?«, meinte sie und hauchte ihm einen Kuss ins dünne blonde Haar.
Sie blickte hinaus in den trüben Tag. Die dicken, vom Regen schweren Wolken verbreiteten eine solche Düsternis, dass man selbst mitten am Tag das Licht einschalten musste.
Sie betrachtete den Garten, der dringend der Pflege bedurfte. Die Handwerker hatten beim Herumtrampeln in ihren schweren Stiefeln wenig Rücksicht auf den Rasen und die Blumenbeete genommen. Aber das kümmerte sie nicht. Sie malte sich die Frühlingstage aus, die vor der Tür standen. Sie würde draußen im Sonnenschein sein, und Ollie würde auf seiner großen wasserdichten Decke spielen. Ihr Plan war, einen richtigen Bauerngarten mit vielen Rosen anzulegen. Rosen hatte sie schon immer geliebt.
Einen Moment lang stand Emma da wie in Trance, starrte ins Leere und sah den Sommer schon vor sich, wenn der Garten fertig sein würde. Die Beete würden von frisch gepflanzten Blumen strotzen. Fast konnte sie den Lavendel riechen, den sie in die Rabatten setzen wollte.
Sie war nicht sicher, wann genau es geschah. Es war kein bestimmter Augenblick, sondern eher eine sich langsam aufbauende Wahrnehmung. Doch während sie wie abwesend aus dem schwarzen Fenster schaute und von den glücklichen Monaten träumte, die vor ihr lagen, bemerkte sie etwas aus dem Augenwinkel. Ihr Blick wanderte vom Garten zur Glasscheibe. Die helle Küchenbeleuchtung sorgte dank der Dunkelheit draußen für einen ausgezeichneten Spiegeleffekt.
Jedes ihrer Nervenenden prickelte, und sie schnappte nach Luft, als sie endlich begriff, was sie da sah.
Es war ein Augenpaar, direkt hinter ihr.
Ganz nah.
In ihrer eigenen Küche.
5
Ein Sonnenstrahl brach durch die schwarzen Wolken, traf auf die Fensterscheibe und löschte das Spiegelbild aus, als wäre es nie dagewesen. Emma umklammerte die Kante des Spülbeckens. Hatte sie es sich nur eingebildet? Doch im nächsten Moment schob sich eine Gewitterwolke vor den Sonnenstrahl, und das Spiegelbild erschien wieder.
Starrende Augen mit einem gespenstischen Glitzern, das verschwand und erneut aufflackerte, als das Licht draußen von schwarz zu grau wechselte. Emma tastete das Abtropfbrett ab und suchte mit den Fingern nach einer Waffe. Aber da war nichts als ein Plastikschälchen. Sie spürte einen stechenden Schmerz beim Griff nach dem Messerblock, und warme Flüssigkeit rann ihr über die Finger, als sie die scharfe Klinge eines Filetiermessers berührte. Sie glitt die Klinge hinunter und umfasste den Griff mit feuchten, klebrigen Fingern.
Voller Furcht, den Blickkontakt abreißen zu lassen, für den Fall, dass die Person sich ihr oder Ollie nähern oder sich aus ihrem Sichtfeld hinaus in den Flur bewegte, holte Emma tief Luft, wirbelte herum und lehnte sich schwer an die Spüle, um sich abzustützen, weil ihr plötzlich die Knie weich wurden.
Ihr Herz klopfte, und ihre Kehle war vor Anspannung so zugeschnürt, dass sie nicht schreien konnte. Sie starrte auf die Gestalt vor sich, und das Adrenalin pumpte durch ihren Körper. Angriff oder Flucht?
Es war ein Mädchen, ja, fast noch ein Kind.
Sie war zierlich gebaut und hatte strähniges blondes Haar, das ihr über die Schultern eines schäbigen, dunkelgrauen Dufflecoats fiel. Die Hände hatte sie tief in die Manteltaschen gesteckt. Die Augen, die Emma im Fenster gesehen hatte, schlugen sie in den Bann. Groß, oval und so dunkelgrün wie die stürmische See. Sie zuckten leicht, als Emma das Messer hob. Doch das Mädchen rührte sich nicht.
Emma ließ das Messer auf den Küchenblock sinken, umfasste es jedoch weiter. Sie hatte keine Ahnung, was das Mädchen wollte. Doch so jung die Kleine auch sein mochte, Emma traute ihr nicht über den Weg.
»Was hast du in meiner Küche zu suchen?«, fragte sie. »Wenn du nicht sofort verschwindest, rufe ich die Polizei.«
Das Mädchen rührte sich nicht. Sie starrte Emma einfach nur an und ließ sie nicht aus den Augen. Emma glaubte, einen feindseligen Ausdruck in ihrem Blick zu erkennen. Vielleicht war es aber auch Verrwirrung oder Angst.
»Ay, ay«, rief Ollie, der es nicht gewohnt war, nicht im Mittelpunkt zu stehen. Niemand schaute auch nur eine Sekunde lang in seine Richtung.
»Ich wiederhole mich nur ungern. Entweder haust du jetzt sofort ab, oder du verrätst mir, wer du bist und was, zum Teufel, du in meiner Küche zu suchen hast.«
Schweigen.
Das Mädchen verharrte an Ort und Stelle und betrachtete Emma. Allerdings wurde ihr Ausdruck leicht argwöhnisch, als wolle sie sie abschätzen. Kurz sah sie das Messer in Emmas Hand an.
»Fürchtest du dich?«, fragte Emma. Sie konnte sich keinen Grund vorstellen, warum dieses Mädchen aus heiterem Himmel in ihr Haus eingedrungen war. Doch ihr kam der Gedanke, dass das Kind vielleicht vor etwas oder jemandem Angst hatte. War sie auf der Flucht? Wenn Emma sich entspannte, würde das Mädchen ihr möglicherweise etwas sagen.
Sie holte ein paarmal tief Luft und spürte, wie ihr Herzschlag langsamer wurde. Falls das Mädchen sie angreifen wollte, hätte sie es doch sicher schon getan.
Sie streckte die Hand nach hinten aus und schob das Messer zurück auf die Arbeitsfläche. Dann hob sie den verletzten Finger an den Mund, lutschte daran, holte ein Papiertaschentuch aus ihrem Ärmel und wickelte es um die schmerzende Wunde. Dabei ließ sie das Mädchen nicht aus den Augen.
»Ich heiße Emma. Niemand tut dir etwas.« Sie wusste nicht, warum sie das gesagt hatte, aber das Mädchen war trotz seines stumpfen Blicks dennoch nur ein Kind. Sicherlich führte sie nichts Böses im Schilde.
Langsam nahm das Mädchen die Hände aus den Manteltaschen. Emma bemerkte, dass sie zu festen Fäusten geballt waren. Sie hielt die Arme fest an die Seiten gepresst. Und sie trug Handschuhe. Emma zuckte zusammen – vielleicht bedeutete das, dass das Mädchen keine Spuren seines Besuchs hinterlassen wollte.
»Bitte, sag mir einfach, was du willst.«
Doch was Emma auch sagte, sie erntete nur Schweigen.
Das Mädchen starrte Emma noch einen Moment an. Dann huschte ihr Blick durch den Raum, als suche sie etwas. Emma nutzte die kurze Pause von dem hypnotischen Ausdruck dieser kalten Augen, um das Mädchen gründlicher zu mustern. Sie stellte fest, dass ihr Mantel mindestens zwei Nummern zu groß war – als hätte sie ihn von einer älteren Schwester oder sogar einem Bruder geliehen. Er reichte ihr bis weit über die Knie, und die Ärmel hingen ihr über die Hände. Sie trug dunkelblaue Jeans, die sich auf schmutzigen weißen Turnschuhen stauchten. Und dennoch besaß sie eine zarte Schönheit, die so gar nicht zu ihrem feindseligen Auftreten passen wollte.
»Pass auf, ich weiß nicht, wer du bist oder was du hier willst. Aber wenn du es mir nicht verrätst, kann ich wohl nicht anders, als die Polizei zu verständigen. Sicher wirst du von jemandem vermisst, der sich fragt, wo du steckst.«
Der Kopf des Mädchens schoss zu Emma herum. Ihre Augen waren weit aufgerissen. Sie schaute in Richtung Hintertür, und plötzlich befürchtete Emma, sie könnte davonlaufen. Noch vor zwei Minuten wäre sie erleichtert gewesen, wenn sie endlich verschwand. Aber offenbar war dem Kind etwas zugestoßen, sonst wäre es nicht hier aufgetaucht. Vielleicht hatte es einen Unfall gegeben, und sie war zu Fuß hergekommen? Oder hatte sie sich verirrt?
»Warum setzt du dich nicht? Wie heißt du denn? Ich bin Emma und das« – sie drehte sich lächelnd zu ihrem Sohn um, um ihn zu beruhigen – »ist Ollie.«
In den grünen Augen lag nicht eine Spur von Wärme, als sie sich auf Ollie richteten. Dieser betrachtete das Mädchen neugierig und schlug mit seinem Plastiklöffel auf das Tischchen des Kinderstuhls.
Emmas Mobiltelefon befand sich oben in ihrer Handtasche, und das Mädchen stand zwischen ihr und dem Küchentelefon. Obwohl Emma das Messer weggelegt hatte, wollte sie sich nicht zu nah an das Mädchen heranwagen, nur für den Fall, dass sie es falsch eingeschätzt hatte.
»Bitte – setz dich.« Emma hob den Arm und zeigte auf den Esstisch am anderen Ende des Raums. Das Mädchen rührte sich nicht von der Stelle. Emma schob sich, auf Abstand achtend, langsam an ihr vorbei, in der Hoffnung, das Telefon zu erreichen. Sie bemühte sich um einen ruhigen, gelassenen Tonfall.
»Okay, ich rufe jetzt die Polizei. Niemand wird dir etwas tun, und ich verständige sie nicht, weil ich möchte, dass du wegen des Eindringens in mein Haus verhaftet wirst. Ich will nur, dass dir nichts passiert und dass du wieder nach Hause kannst. Ich weiß ja nicht einmal, ob du mich überhaupt verstehst.«
Das Mädchen stürzte zum Telefon, riss es aus der Verankerung und schleuderte es durch den Raum. Dann wirbelte sie herum, rannte durch die Küche und packte das Messer, das Emma dort abgelegt hatte. Sie wich zur Wand zurück, die eine Hand zur Faust geballt, die andere umfasste das Messer, bereit zuzustoßen.
Emma unterdrückte einen Schreckensschrei. Sie durfte Ollie nicht ängstigen. Sie wischte sich die plötzlich feuchten Handflächen an der Jeans ab und umrundete den Küchenblock, bis sie zwischen dem Mädchen und ihrem Baby stand. Dabei sah sie das Mädchen weiter an. Alle Sorgen um das Wohlergehen des Kindes waren wie weggeblasen, als ihr klar wurde, dass sie in der Falle saß. Sie konnte die Küche nicht verlassen, um ihr Mobiltelefon zu holen. Selbst wenn es ihr gelang, sich an dem Mädchen vorbeizudrängen, durfte sie Ollie nicht allein lassen.
»Hau ab! Verschwinde sofort aus meinem Haus. Du machst meinem Baby Angst«, befahl Emma so selbstbewusst sie konnte. Das ist doch nur ein Kind, sagte sie sich. Du bist hier die Erwachsene.
Emma riskierte einen Blick auf Ollie, der tatsächlich verstört wirkte. Seine dunkelblauen Augen wanderten zwischen seiner Mummy und dem Mädchen hin und her und füllten sich allmählich mit Tränen, da auch er die Anspannung im Raum spürte. Emma streckte die Hand aus und streichelte mit dem Fingerknöchel sein Gesicht.
»Pssst. Alles in Ordnung, Schatz.« Obwohl sie das Mädchen nicht mehr anschreien wollte, wollte sie, dass es endlich ging. Auf die kleinste Bewegung des Mädchens achtend, nahm sie Ollies Schnabeltasse von der Arbeitsfläche und gab sie ihm. Inzwischen sah das Mädchen Emma nicht mehr an. Ihr Blick huschte durch den Raum, ihre Stirn war leicht gerunzelt. Suchte sie nach einem Fluchtweg?
Emma betrachtete Ollie, der in seinem Stühlchen saß und das Mädchen beobachtete. Beim Anblick seines blonden Flaumhaars und den von dem kurzen Tränenausbruch feuchten rundlichen Wangen spürte sie, wie sich Wut in ihr regte. Niemand durfte ihrem Baby etwas tun. Der Gedanke drohte sie zu überwältigen, dass sie ohne zu zögern und mit bloßen Händen gegen das Mädchen mit einem Messer kämpfen würde, sollte es Ollie zu nah kommen.
Sie war völlig ratlos. David kam erst Stunden später von der Arbeit zurück. Aber vielleicht wusste das Mädchen das ja nicht.
»Hör zu, ich habe keine Ahnung, warum du hier bist und was du willst. Doch mein Mann kommt jeden Moment nach Hause. Und ich warne dich …« Emma hielt inne, sie wollte ihr nicht drohen. Schließlich konnte dieses Mädchen genauso gut psychisch krank sein und würde womöglich ausrasten, wenn sie Gewalt erwähnte. »Bitte sprich mit mir.«
Emmas aufgewühlter Verstand ließ die Geschehnisse Revue passieren. Wenn das Mädchen sie hätte angreifen wollen, hätte es ausreichend Gelegenheit dazu gehabt, bevor Emma seine Anwesenheit überhaupt bemerkt hatte. Sie hatte schweigend und mit ausdrucksloser Miene dagestanden, bis sie geglaubt hatte, dass Emma die Polizei rufen würde. Offenbar wollte sie etwas von Emma, nur dass diese keine Ahnung hatte, worum es sich handelte.
»Mir ist klar, dass du nicht mit mir sprechen willst. Würdest du deinen Namen für mich aufschreiben, wenn ich dir einen Stift und Papier gebe?«, folgte Emma einer plötzlichen Eingebung. Vielleicht konnte das Mädchen ja gar nicht sprechen.
Vorsichtig rückte sie Ollies Stühlchen ein kleines Stück zurück und außer Reichweite des Mädchens, nahm einen Notizblock und einen Stift von einem Regal über der Arbeitsplatte und schob beides dem Mädchen über den Küchenblock hinweg zu.
»Bitte schreib mir deinen Namen auf. Ich weiß ja gar nicht, wie ich dich anreden soll, und wenn ich dir helfen soll, muss ich erfahren, wer du bist.«
Das Mädchen starrte Emma nur an und ignorierte Block und Stift, die vor ihr lagen.
Verzweifelt schloss Emma die Augen. Vielleicht würde David mehr Erfolg haben. Und wenn nicht, sollte sich die Polizei darum kümmern.
Als ob der Gedanke an ihren Mann ihn aus dem Nichts herbeigezaubert hätte, durchdrang das Dröhnen eines starken Motors die bedrückende Stille. Davids Range Rover bog in die Auffahrt ein. Sie spürte Erleichterung und fragte sich trotzdem, warum er so früh zurück war.
Ein paar Sekunden später knallte die Haustür zu. Wie gern wäre Emma in die Vorhalle hinausgelaufen, um ihn zu begrüßen. Doch sie befürchtete, das Mädchen würde verschwinden, wenn sie ihm den Rücken kehrte. Und dann würde ihr niemand glauben, dass es je hier gewesen war.
Ihre Erleichterung wurde von Überraschung abgelöst, als das Mädchen das Messer auf die Arbeitsfläche warf, den Notizblock zu sich heranzog und zu schreiben begann. Nach wenigen Buchstaben drehte sie das Papier zu Emma um.
»Emma?« Sie hörte, wie David seinen Schlüsselbund in der Schale auf dem Flurtischchen deponierte. »Emma? Es ist etwas Schreckliches geschehen. Wo bist du?«, rief er. Sie erkannte Furcht in seinem Tonfall, als er auf die Küche zusteuerte.
Sie starrte auf die Buchstaben, als ergäben sie keinen Sinn. Ein Schauder überlief sie, und Gänsehaut überzog ihre Arme.
Ich muss David warnen. Aber es war zu spät. Er öffnete die Küchentür. Sein Blick wanderte sofort zu Emma.
»Em, ich hatte eine entsetzliche …«, begann er. Sein Blick wanderte in die Küchenecke. Er betrachtete das Mädchen und runzelte zweifelnd die Stirn. Dann sah er wieder Emma an und durchquerte den Raum, den Kopf zur Seite geneigt, als stellte er ihr eine stumme Frage. Sie wusste, dass sie etwas sagen musste, fand aber nicht die richtigen Worte.
»Ay, Dada. Ay!«, rief Ollie.
Aber David achtete nicht auf seinen Sohn. Er wandte sich wieder zu dem Mädchen um und blieb jäh stehen, den Mund leicht geöffnet. Sprachlos starrte er sie an und erbleichte.
Das Mädchen erwiderte seinen Blick. Auf ihren Wangen blühten leuchtend rote Flecke auf. Sie verrieten Gefühle, die in ihren Augen fehlten. Das Schweigen war bedrückend, und plötzlich wusste Emma, dass ihr Leben von diesem Moment an nie wieder sein würde wie früher.
Endlich ergriff David das Wort, seine Stimme war kaum mehr als ein Flüstern.
»Tasha«, sagte er.
6
Sobald David diese beiden Silben ausgesprochen hatte, war der Bann des Schweigens gebrochen. Ein Keuchen entfuhr seiner Kehle, als er, fast rennend, die Küche durchquerte. Hilflos sah Emma zu, wie ihr Mann vor seiner Tochter stand, ihr mit den Handflächen über die Arme strich und ihr Gesicht musterte. Seine Miene wandelte sich von Verwirrung in Freude. Tränen traten ihm in die Augen und rannen ihm ungehindert die Wangen hinunter, während er versuchte, Tashas starren Körper an sich zu ziehen.
Emma war sich sicher, dass er an Caroline dachte und daran, wie es gewesen war, als er, Caroline und Tasha zusammengelebt hatten. Sie konnte sich die Szene bildlich ausmalen, wenn beide Eltern hier gewesen wären, um ihre verlorene Tochter in Empfang zu nehmen. Wie sehr hätten sie sich gemeinsam gefreut. Sie bemerkte, dass auch ihr die Tränen übers Gesicht liefen, und sie wischte sie rasch weg. Wie grausam, dass man David und Tasha so lange voneinander getrennt hatte.
Für Carolines Unfall hatte es nie eine Erklärung gegeben, und bis heute hatte von Tasha jede Spur gefehlt. David hatte Emma erzählt, die ganze Stadt sei die Umgebung des Unfallortes abgegangen. Helikopter hätten über ihren Köpfen geschwebt. In Presse und Fernsehen seien drängende Appelle veröffentlicht worden. Allerdings habe es keine Hinweise darauf gegeben, dass sonst noch jemand im Auto gesessen hatte. Nur Caroline.
Und nun war Natasha hier. In ihrer Küche.
David hatte sich Vorwürfe gemacht, weil er nicht mit zu der Familienfeier gekommen war. Obwohl er gewusst hatte, dass Caroline sich am Steuer unsicher fühlte, insbesondere bei Dunkelheit, hatte er nicht auf ihr Flehen gehört und getan, als müsse er arbeiten. Doch das hatte nicht der Wahrheit entsprochen. Der Grund war einfach, dass er keine Lust auf Carolines Vater gehabt hatte. Emma hatte über die Jahre viel Liebe und Geduld investiert, um ihn davon zu überzeugen, dass ihn keine Schuld an den Ereignissen traf.
Nun redete er ununterbrochen auf seine Tochter ein. Emmas Blick wanderte zu Natasha, die seine Worte überhaupt nicht zu berühren schienen. Ihr Blick war stumpf, und sie sah ihren Vater nicht an.
»Tasha, oh, Liebling.« David schüttelte den Kopf, als wisse er nicht mehr, was er noch sagen sollte. »Das ist unglaublich. Ich habe dich vermisst – viel mehr, als du es dir vorstellen kannst. Du bist so schön, deiner Mutter so ähnlich. Weißt du das?«
Bebend vor Rührung wollte er sie noch einmal in seine Arme ziehen, aber Emma bemerkte, dass Natasha sich noch mehr versteifte und ihn argwöhnisch ansah. Sie hätte schwören können, dass sich die Kiefer des Mädchens verkrampften.
Erst jetzt erkannte Emma, dass sie Caroline wie aus dem Gesicht geschnitten war. Die Rundung der Wangen, die trotz des blonden Haars dunklen Wimpern und die zartrosafarbenen Lippen. Caroline war ein dunkler Typ gewesen, doch das war nur ein oberflächlicher Unterschied. Unter der kastanienbraunen Mähne auf dem Porträt im Flur hatte die erste Frau ihres Mannes den gleichen undurchdringlichen Blick wie Tasha jetzt.
David murmelte noch immer Koseworte und versuchte, Natasha eine Reaktion zu entlocken.
»David«, sagte Emma leise. Sie ging zu ihm hinüber und legte ihm sanft die Hand auf den Rücken. »Sicher erscheint es dir merkwürdig, aber Tasha erinnert sich vermutlich nicht mehr sehr gut an dich. Ich glaube, sie ist ein wenig verängstigt.«
Davids Kopf fuhr zu Emma herum. »Natürlich ist sie nicht verängstigt. Sie weiß, dass ich ihr Dad bin. Warum sollte sie sonst hier sein?« Sie las in Davids grauen Augen, wie sehr ihn Tashas Zurückweisung kränkte. Emma erkannte ihn kaum als den in sich ruhenden und selbstbewussten Mann wieder, der heute Morgen das Haus verlassen hatte. Er war angespannt, seine Haut vor Besorgnis gerötet.
Seine Züge entspannten sich und formten ein Lächeln, als er sich zu Tasha umdrehte und die Hand hob, um ihr sanft das Haar aus dem Gesicht zu schieben. Aber sie schüttelte den Kopf, sodass es wieder nach vorne fiel, und starrte weiter stumpf auf den Tisch.
»Warum setzen wir uns nicht«, schlug Emma vor. »Dann können wir mit Tasha reden und rauskriegen, wie sie zu dir zurückgefunden hat und wo sie all die Jahre gewesen ist.«
»Sie ist wieder hier. Nur das spielt eine Rolle. Wo sie war, das kann warten.«
Emma sah ihren Mann entsetzt an. Das konnte auf gar keinen Fall warten. Was, wenn sie gefangen gehalten worden war? Oder missbraucht? Irgendein Mensch trug die Schuld am Verschwinden dieses Kindes. Sie konnten nicht so tun, als hätten die letzten sechs Jahre nicht stattgefunden.
David führte Tasha zum Esstisch am anderen Ende des Raums und rückte einen Stuhl für sie zurecht. »Ich wünschte, deine Mum wäre hier, Tasha. Sie hat natürlich nie erfahren, dass ich dich verloren habe, aber sie würde sich heute so sehr für uns freuen.«
Tasha hatte noch immer kein Wort von sich gegeben, doch Emma erschrak über den Blick, den sie ihrem Vater zuwarf. War das etwa Wut gewesen?
»Entschuldige, David, aber glaubst du, wir könnten kurz miteinander sprechen?« Sie lächelte Tasha zu, erntete jedoch nur ein kaltes Starren.
Plötzlich fühlte sich die Küche dunkel und eng an, obwohl alle Lichter brannten. Der Raum war ihr selbst an den kältesten und düstersten Tagen stets als Zufluchtsort erschienen. Doch der dunkle Himmel hatte endlich seine Schleusen geöffnet. Regen prasselte gegen die Oberlichter, die entlang der Wände verliefen.
David wandte sich um und sah Emma verwirrt an. Allerdings kannte er sie gut genug, um zu wissen, dass sie ihn nicht ohne Grund um ein Gespräch bitten würde. Er beugte sich über den Tisch und tätschelte Natashas Oberarm.
»Bin gleich zurück, Schätzchen.«
Während er, um den Küchenblock herum, auf Emma zusteuerte, überlegte sie, was sie jetzt sagen sollte.
»Falls Tasha bleibt, müssen wir ihr Kleidung besorgen und ein Zimmer für sie herrichten. Darum kann ich mich kümmern. Was meinst du?« Kurz schämte sich Emma wegen ihres verzweifelten Bedürfnisses, der bedrückenden Atmosphäre in der Küche zu entrinnen und Ollie an einen sicheren Ort zu bringen, wo sie sich beruhigen und wieder durchatmen konnten.
»Was soll das heißen, falls sie bleibt?«
»David, natürlich wollen wir sie hierbehalten. Doch ich habe keine Ahnung, wie diese Dinge funktionieren, und du auch nicht. Wir wissen ja nicht einmal, wie sie hergekommen ist. Ich frage mich nur, was das Jugendamt dazu sagen wird, mehr nicht.«
»Du hast das Jugendamt angerufen?«
»Nein.« Emma schluckte ihren Ärger hinunter. »Ich habe gar niemanden angerufen. Ich wollte die Polizei verständigen, aber …«
»Die Polizei?« Als David sich zu Emma umdrehte, zuckte sie angesichts seines Tonfalls leicht zusammen. »Warum wolltest du die Polizei verständigen?«
Emma schloss kurz die Augen.
»Da war ein Mädchen in meiner Küche. Ein Mädchen, das ich nicht kannte und das sich geweigert hat, mit mir zu sprechen. Ich nahm an, dass sie sich verlaufen hat oder in einen Unfall verwickelt war. Aber sie wollte mir nichts verraten. Natürlich fand ich es richtig, die Polizei anzurufen. Doch Tasha hat mir das Telefon weggerissen, also konnte ich es nicht.«
»Was hat sie getan?«
Emma brachte es nicht über sich, das Messer zu erwähnen, das so harmlos auf der Arbeitsfläche lag. Hatte sie überreagiert?
»Das ist jetzt nicht weiter wichtig. Allerdings müssen wir anrufen. Sie ist erst knapp dreizehn. Wir wissen nicht, ob ihr etwas angetan wurde. Wir haben keine Ahnung, wie sie heute hierhergekommen und was in dieser schrecklichen Nacht vor sechs Jahren mit ihr geschehen ist.«
David fuhr sich mit der Hand durchs blonde Haar und strich es sich aus der Stirn – ein klassisches Zeichen von Anspannung, das Emma von ihrem Mann nur zu gut kannte. »Ich brauche nur noch ein wenig mehr Zeit mir ihr, Em. Ist das zu viel verlangt?«
Emma wusste nicht mehr, was sie denken sollte. Vielleicht hätte sie ja genauso empfunden wie David, wenn Natasha ihr Kind gewesen wäre. Möglicherweise nahm sie es zu wichtig, die Hintergründe zu verstehen, anstatt einfach nur Natashas Rückkehr zu feiern. Allerdings galt sie bei der Polizei noch immer als vermisste Person.
»Sie ist ein Kind, Schatz, und die Polizei muss erfahren, dass sie wieder zu Hause ist. Sie werden uns helfen herauszufinden, was ihr zugestoßen ist, und uns sagen, wie wir ihr am besten helfen können.«
David zog Emma fest an sich.
»Du hast sicher recht. Ich habe nur Angst, dass die Polizei sie uns wegnimmt. Doch das werde ich nicht zulassen. Erledigst du den Anruf? Ich möchte bei Tasha sein.«





























