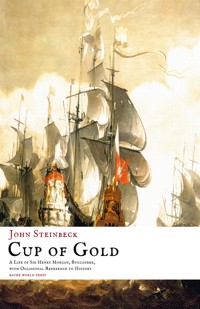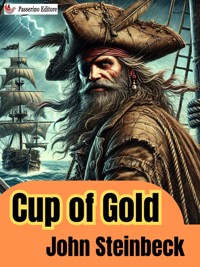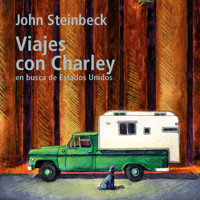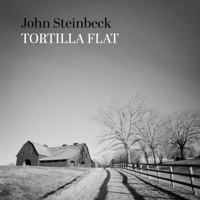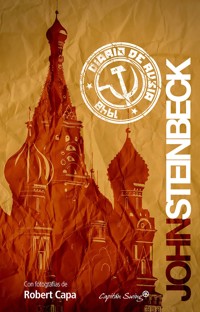Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Paul Zsolnay Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Abseits des Großstadtbetriebes und des schematisierten gesellschaftlichen Lebens im Süden Kaliforniens gelegen, beschreibt John Steinbeck 'Das Tal des Himmels' und das Schicksal einer Reihe von Menschen, die es bewohnen. In zwölf Episoden, die durch einzelne Figuren miteinander verknüpft sind, schildert er den Zustand einer Idylle, auf die ein drohender Schatten fällt. Hinter dem Dasein der Obstfarmer und der friedlichen Siedler tun sich Abgründe auf, spielen sich Tragödien ab - je stiller, desto unheimlicher. Und letztendlich erweist sich dieser von sanften Hügeln umgebene Landstrich trotz des Namens als Schauplatz irdischer Versuchung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 321
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Abseits des Großstadtbetriebes und des schematisierten gesellschaftlichen Lebens im Süden Kaliforniens gelegen, beschreibt John Steinbeck 'Das Tal des Himmels' und das Schicksal einer Reihe von Menschen, die es bewohnen. In zwölf Episoden, die durch einzelne Figuren miteinander verknüpft sind, schildert er den Zustand einer Idylle, auf die ein drohender Schatten fällt. Hinter dem Dasein der Obstfarmer und der friedlichen Siedler tun sich Abgründe auf, spielen sich Tragödien ab — je stiller, desto unheimlicher. Und letztendlich erweist sich dieser von sanften Hügeln umgebene Landstrich trotz des Namens als Schauplatz irdischer Versuchung.
John Steinbeck
Das Tal des Himmels
Roman
Aus dem Amerikanischen von Hans Ulrich Staub
Paul Zsolnay Verlag
I
Dies ist die Geschichte eines Tales, dessen Anblick für viele Menschen eine große Verheißung war. Manche träumten davon, einmal an diesen Ort zurückzukehren, dessen Schönheit sie einst geschaut hatten, um für immer dort zu bleiben.
Als um das Jahr 1776 die Carmelo-Mission von Alta California aufgebaut wurde, geschah es, daß eines Nachts sich etwa zwanzig kaum bekehrte Indianer gegen die neue Religion erhoben und am Morgen aus ihren Hütten verschwunden waren. Dieses kleine Schisma war nicht nur ein schlechtes Vorbild für die andern Bekehrten, sondern es drohte auch die Arbeitsdisziplin in den Lehmgruben der Mission zu beeinträchtigen, wo die luftgetrockneten Ziegel hergestellt wurden.
Nach kurzer gemeinsamer Beratung der kirchlichen und militärischen Behörden wurde ein spanischer Korporal mit einem Trupp Reiter ausgeschickt, um die verirrten Schäfchen in den Schoß der Kirche zurückzuführen. Die Reiter folgten den Abtrünnigen auf mühevollen Wegen das Carmeltal hinauf und in die Berge, die jenseits des Tales liegen. Die Suche war um so schwieriger, als die Flüchtlinge ihre Spuren meisterhaft zu verwischen wußten. Eine Woche verging, bis die Soldaten sie endlich in einem farnbewachsenen Canyon entdeckten, wo sie sich an einem Fluß auf dem Talboden niedergelassen hatten und noch immer in einem Schlaf der Erschöpfung lagen.
Das durch die lange Suche aufgebrachte Militär rüttelte die Schlafenden unsanft wach, band sie an eine lange dünne Kette und achtete nicht auf das Geheule und Wehklagen, das alsbald den Canyon erfüllte. Dann machte sich die Kolonne auf den Heimweg nach Carmel, wo die armen Ketzer Gelegenheit zu tätiger Reue in den Lehmgruben finden sollten.
Am späten Nachmittag des zweiten Tages ihrer Heimkehr geschah es, daß ein junges Reh von den Reitern aufgeschreckt wurde und in voller Flucht hinter einem Hügelkamm verschwand. Hatte der Korporal den vielen anderen Tieren, denen sie auf ihrer Expedition begegnet waren, kaum Beachtung geschenkt, so spürte er nun plötzlich ein eigenartiges Verlangen, dem Reh zu folgen. Er löste sich aus der Kolonne, und sein schweres Pferd kletterte mühsam den steilen Abhang hinauf. Stechpalmen und Kakteen zerstachen ihm Gesicht und Hände, aber eine wachsende Unruhe trieb ihn hinter seinem Opfer her. Nach ein paar Augenblicken kam er oben auf der Höhe des Kammes an und blieb vor Staunen wie angewurzelt stehen: Zu seinen Füßen lag ein langes Tal grünen Weidelandes, auf dem ganze Rudel von Rehen friedlich ästen. Prachtvolle Eichen warfen ihre Schatten auf die üppigen Auen, und ein Kranz sanfter Hügel schützte das Tal eifersüchtig gegen Wind und Nebel.
Der in harter Zucht geschulte Korporal vermochte angesichts solcher Schönheit seiner Ergriffenheit kaum Herr zu werden. Dieser bärtige, ungefüge Vertreter der Zivilisation, der braune Rücken blutig zu peitschen gewohnt war und mit gewalttätiger Männlichkeit eine neue Rasse für Kalifornien zeugte, dieser Mann glitt ganz benommen aus dem Sattel und nahm ehrfürchtig seinen Helm vom Haupt.
»Heilige Mutter Gottes«, flüsterte er, »das ist wahrhaftig das Tal des Himmels, das uns der Herr verheißen hat.«
Seine Nachkommen waren nun schon fast weißhäutig, und die heilige Ergriffenheit, welche sich des streitbaren Ahnherrn beim Anblick des neuen Landes bemächtigte, ist längst im Schatten der Legende versunken. Was aber blieb, ist der Name, den er dem lieblichen Tal zwischen den sanften Hügeln gegeben hat. Denn es heißt noch immer »Tal des Himmels«, bis auf den heutigen Tag.
Zufolge irgendeines königlichen Versehens blieb es lange unbekannt und wurde von keiner Landakte erfaßt. Längst waren alle umliegenden Gebiete als Faustpfand oder Heiratsgut in den Besitz spanischer Edelleute gelangt, als es noch immer vergessen und herrenlos hinter seinen schirmenden Hügeln lag. Nur der spanische Korporal, der es entdeckt hatte, konnte es nicht vergessen und träumte zeitlebens davon, einmal wieder hinzufinden. Denn wie alle gewalttätigen Männer sehnte er sich insgeheim nach ein wenig Frieden, bevor es zu Ende war, und nach einem Häuschen am Fluß und nach Vieh, das man nachts die Mäuler an den Mauern reiben hörte.
Nachdem ihn eine Indianerin mit der Beulenpest angesteckt hatte und sein Gesicht schon von den ersten Zeichen der Zersetzung heimgesucht worden war, schlossen ihn die Gefährten in eine finstere Scheune ein, um die weitere Verbreitung der Pest zu verhindern. Seine letzten Worte galten einem Tal von himmlischer Schönheit, als ob sein Geist schon die Schwelle zum Jenseits überschritten habe. Dann starb er eines friedlichen Todes, denn die Pest, welche das Äußere so furchtbar zerstört, ist ihrem Wirt am Ende ein guter Freund.
Viele Jahre nach seinem Tode zogen einige Siedlerfamilien in das »Tal des Himmels« und errichteten Zäune und pflanzten die ersten Obstbäume. Da das Land keinen Eigentümer hatte, gab es viel Streit bei der Verteilung. Hundert Jahre danach lebten schon an die zwanzig Familien dort auf zwanzig kleinen Höfen. In der Talmitte stand eine einfache Schenke, welche zugleich als Kaufladen und Postbüro diente. Und eine Meile weiter oben im Tal erhob sich ein Schulhaus, dessen Holzplanken durch Messerkerben gezeichnet waren.
So lebten die Familien glücklich und in Frieden. Der Boden war gut und mühelos zu bearbeiten, und die Früchte ihrer Felder und Gärten wurden als die schönsten und besten von ganz Kalifornien gepriesen.
II
Die Leute im »Tal des Himmels« waren überzeugt, daß auf der Battle-Farm ein Fluch liege, und die Kinder glaubten, das alte Haus sei voll von Gespenstern. Niemand begehrte den Hof, obgleich fruchtbares und gutbewässertes Land dazugehörte, und niemand wollte in dem alten Hause wohnen; denn Land und Häuser, die einmal geliebt und bebaut und bewohnt und dann am Ende verlassen worden sind, machen immer einen traurigen und bedrohlichen Eindruck. Die Bäume, die um ein verlassenes Haus herum wachsen, sind düster, und die Schatten, die sie auf die Erde werfen, haben unheimliche Formen.
Seit fünf Jahren hatte die Battle-Farm nun leergestanden. Das Unkraut wucherte mit Feiertagsenergie und ohne Furcht vor der Hacke und wurde allmählich so hoch wie kleine Bäume. Die Obstbäume rundum waren knorrig und ineinander verwachsen. Früchte trugen sie viele, aber die wurden kleiner und kleiner. Brombeerstauden rankten sich um die Wurzeln der Bäume und verschluckten die herabfallenden Früchte.
Und das Haus selber, ein viereckiges, solid gebautes, zweistöckiges Gebäude, war einmal recht ansehnlich gewesen, doch eine merkwürdige Vergangenheit hatte eine unerträglich einsame Atmosphäre darin hinterlassen. Unkraut warf die Dielen der Veranda auf, und die Mauern waren grau verwittert. Kleine Buben, jene Vortrupps im Feldzug der Zeit gegen die Werke des Menschen, hatten die Fensterscheiben herausgebrochen und die beweglichen Gegenstände weggetragen. Die Buben sind überzeugt, daß alle Arten und Sorten beweglicher Gegenstände, die nicht einem offensichtlichen Eigentümer gehören und die man deshalb nach Hause nehmen kann, zu irgendeinem nützlichen Zweck verwendet werden können. Und so hatten sie das Haus vollständig ausgeplündert, die Brunnen mit allen möglichen Abfällen und mit Unrat angefüllt und später, als sie heimlich auf dem Heuboden richtigen Tabak rauchten, sogar die alte Scheune bis auf den Grund niedergebrannt. Das Feuer wurde allgemein der Fahrlässigkeit von Landstreichern zugeschrieben.
Die verlassene Farm lag fast in der Mitte des engen Tales. Auf beiden Seiten grenzte sie an die besten und reichsten Gehöfte der Gegend. Es war ein unnützer, wüster Schandfleck zwischen zwei vorbildlich bebauten, schönen Grundstücken. Die Leute des Tales betrachteten die Battle-Farm als eine Stätte unermeßlichen Übels, denn die Erinnerung an ein schreckliches Unglück und ein unentwirrbares Geheimnis lastete darauf.
Zwei Generationen Battles lebten auf der Farm. George Battle kam im Jahre 1863 vom nördlichen Teil des Staates New York nach dem Westen; er war noch jung, als er in das Tal einwanderte, kaum der Militärpflicht entwachsen. Seine Mutter gab ihm das Geld, um das Land zu kaufen und das zweistöckige Haus zu bauen. Als das Haus fertig war, ließ George seine Mutter nachkommen. Die alte Frau, die geglaubt hatte, die Welt sei zehn Meilen außerhalb ihres Dorfes zu Ende, machte sich auf den Weg. Unterwegs sah sie sagenhafte Städte — New York, Rio, Buenos Aires —, und vor Patagonien starb sie. Eine Schiffswache nähte sie, mit drei Gliedern der Ankerkette zwischen den Füßen, in ein Stück Segeltuch und warf sie in den grauen Ozean. Dabei hatte sich Mutter Battle ihr Leben lang nach einem kleinen Plätzchen in der überfüllten Erde ihres heimatlichen Friedhofes gesehnt.
George Battle schaute sich nach einer Frau um. In Salinas fand er Miss Myrtle Cameron, mit ihren fünfunddreißig Jahren noch Jungfrau und mit einem kleinen Vermögen ausgestattet. Miss Myrtle war bis dahin verschmäht worden, da sie ein wenig zur Epilepsie neigte, einer Krankheit, die damals »fits« genannt und allgemein einer Abneigung seitens der Gottheit zugeschrieben wurde. George Battle nahm die Epilepsie in Kauf. Er wußte wohl, daß er nicht alles haben konnte. Myrtle wurde seine Frau und gebar ihm einen Sohn, und nachdem sie zweimal versucht hatte, das Haus anzuzünden, wurde sie in einem kleinen Privatgefängnis, genannt Lippman-Sanatorium, in San José interniert. Dort verbrachte sie den Rest ihres Daseins mit dem Häkeln eines symbolischen Lebens Christi aus Baumwollgarn.
In der Folge wurde das große Haus auf der Battle-Farm von einer Reihe übelgelaunter Haushälterinnen regiert — Haushälterinnen, von denen es im Zeitungsinserat heißt: »Wwe., 45, sucht Stellung als Haush. auf Farm. Gute Köchin. Zwecks Heir.« Eine nach der anderen zog ein; in den ersten Tagen waren sie sanft und ein wenig traurig, bis sie von Myrtle erfuhren. Auf der Stelle verwandelten sie sich in Furien mit zornsprühenden Augen, die im Hause herumtobten, aus dem Gefühl heraus, gleichermaßen betrogen und vergewaltigt worden zu sein.
Mit fünfzig war George Battle ein alter Mann, von der Arbeit gebeugt, starrköpfig und freudlos. Seine Augen schauten kaum von dem Boden auf, den er so geduldig hegte und pflegte. Seine Hände waren hart und schwarz und rissig wie die Fußsohlen eines Bären. Und seine Farm war schön. Die Obstbäume waren geputzt und gepflegt und glichen sich wie Brüder. Das Gemüse wuchs kräftig und saftig in schnurgeraden Reihen. Das Haus war außen und innen sauber. Das obere Stockwerk war unbewohnt; vor dem Haus blühten die schönsten Blumen. Dieser Hof war wie das Gedicht eines stummen Menschen. Mit unendlicher Geduld schmückte der Mensch seinen Garten und wartete auf eine Sylphide. Es kam nie eine Sylphide, aber der Garten war immer bereit und geschmückt. In den vielen Jahren, als sein Sohn heranwuchs, beachtete ihn George kaum. Einzig die Bäume und die grünen Gemüsereihen beachtete er; die waren wichtig. Als John, sein Sohn, in einem Wohnwagen als Missionar auszog, vermißte er ihn kaum. Er arbeitete weiter und beugte seinen Körper Jahr für Jahr tiefer über die Erde. Seine Nachbarn sprachen nicht mit ihm, weil er sie nicht anhörte. Seine Hände waren ewig gekrümmt, wie kleine Haken, die knapp um die Stiele der Geräte paßten. Er starb, als er fünfundsechzig Jahre alt war, an Altersschwäche und einem Husten.
Dann kam John Battle nach Hause und übernahm die väterliche Farm. Von seiner Mutter hatte er die Epilepsie und den frommen Wahnsinn geerbt. Johns Leben war ein ewiges Ringen mit Teufeln. In seinem Wohnwagen war er von Versammlung zu Versammlung gezogen, hatte mit den Händen herumgefuchtelt, Teufel heraufbeschworen und sie dann verflucht. Als er zu Hause war, ließen ihn die Teufel nicht in Ruhe. Nach wie vor verlangten sie seine volle Aufmerksamkeit. Die Gemüsereihen vereinsamten, wuchsen freiwillig noch ein paarmal und erlagen dann dem Unkraut. Langsam kehrte das Land zurück in den Urzustand, aber die Teufel wurden mächtiger und aufdringlicher.
Zum Schutz gegen sie stickte John Battle kleine Kreuze aus weißem Faden auf Kleider und Hut, und so gewappnet, führte er einen zähen, verbissenen Krieg gegen die schwarzen Legionen. In der grauen Dämmerung schlich er mit einem Stock bewaffnet im Hof herum. Er stürzte sich in das Unterholz, schlug mit dem Stock um sich und brüllte Schmähworte, bis die Teufel aus ihrem Versteck vertrieben waren. Nachts kroch er durch das Dickicht und belauschte seine Feinde; wo immer er ihnen begegnete, stürmte er furchtlos auf sie ein und schwang seine Waffe. Tagsüber schlief er im Haus, denn wenn es hell ist, wirken die Teufel nicht.
Eines Tages, im zunehmenden Zwielicht, schlich sich John vorsichtig an einen Fliederbusch heran. Der Busch stand im Hinterhof, und John hatte erfahren, daß er eine Versammlung von bösen Geistern beherberge. Als er so nahe war, daß die Dämonen nicht mehr entwischen konnten, sprang er auf und warf sich mit einem entsetzlichen Geheul in das harmlose Gebüsch. Von seinen Stockhieben gestört, klapperte schläfrig eine Schlange und hob den flachen, harten Kopf. John ließ den Stock fallen und begann zu zittern, denn der scharfe, trockene Warnruf der Klapperschlange ist ein lähmendes Geräusch. John warf sich auf die Knie und begann zu beten. Plötzlich schrie er auf: »Das ist die verdammte Schlange! Heraus, Teufel!« Und mit gierig greifenden Händen sprang er sie an. Die Schlange traf ihn am Hals, dreimal, dort, wo ihn keine Kreuze schützten. Er rührte sich kaum mehr, und nach ein paar Minuten war er tot.
Die Nachbarn fanden ihn erst, als die Bussarde anfingen, sich aus den Lüften niederzustürzen. Was sie fanden, erfüllte sie mit Grauen vor der Battle-Farm.
Dann lag der Hof zehn Jahre brach. Die Kinder sagten, das Haus sei voll von Gespenstern, und schlichen sich nachts hinaus, um das Gruseln zu lernen. Etwas Unheimliches, Lähmendes lag über dem alten Haus mit den leeren, glotzenden Fenstern. Der weiße Anstrich blätterte in langen Schuppen ab, und die Schindeln auf dem Dach krümmten sich und sprangen. Felder und Wiesen verwilderten vollständig. Die Farm gehörte einem entfernten Vetter der Battles, aber er hatte sie überhaupt nie gesehen.
Im Jahre 1921 übernahmen die Mustrovics die Battle-Farm. Ihr Kommen war unerwartet und wie von einem Geheimnis umwittert. Eines Morgens waren sie einfach da, ein alter Mann und eine alte Frau, skelettartige Leutchen mit zäher gelber Haut, die über den vorstehenden Backenknochen gespannt und glattgescheuert war. Weder der Mann noch seine Frau verstanden ein Wort Englisch. Die Verbindung mit dem Tal wurde durch ihren Sohn hergestellt, einen großgewachsenen Mann mit den gleichen vorstehenden Backenknochen und kurzgeschorenem Haar, das ihm weit in die Stirne wuchs, und mit sanften dunklen Augen. Er sprach gebrochen Englisch und sagte nur das Allernötigste.
Im Laden fragten ihn die Leute vorsichtig aus, aber sie erhielten keine Auskunft.
»Wie steht’s denn eigentlich mit den Gespenstern?« fragte T. B. Allen, der Ladenbesitzer. »Wir haben immer gedacht, in Eurem Hause spukt’s. Habt Ihr noch keine angetroffen?«
»Nein«, sagte der junge Mustrovic.
»Natürlich, der Hof ist ganz in Ordnung, wenn man das Unkraut los wird.«
Mustrovic kehrte ihm den Rücken und lief davon.
»Also, irgend etwas stimmt da nicht mit diesem Haus«, sagte T. B. Allen. »Alle, die drin wohnen, können nicht reden!«
Die alten Mustrovics sah man selten, der junge aber arbeitete von früh bis spät auf dem Felde. Ganz allein säuberte er das Land, pflanzte Gemüse und schnitt die Bäume. Zu jeder Tagesstunde konnte man ihn sehen; er arbeitete fieberhaft, rannte fast von einer Arbeit zur nächsten und machte ein Gesicht, als hätte er erwartet, die Zeit würde stillstehen, bevor die erste Ernte unter Dach war.
Die ganze Familie wohnte und schlief in der Küche des großen Hauses. Alle übrigen Zimmer waren abgeschlossen und leer. Die Fensterscheiben blieben zerbrochen, einzig die Löcher in den Küchenfenstern verklebten sie mit Fliegenpapier. Um das Äußere des Hauses kümmerten sie sich überhaupt nicht. Aber dank der verzweifelten Anstrengungen des jungen Mannes wurde das Land wiederum schön. Zwei Jahre lang rackerte er sich ab und kultivierte den Boden. Im ersten Grau der Morgendämmerung trat er aus dem Hause, und das letzte Abendlicht war am Erlöschen, wenn er wieder im Haus verschwand.
Eines Morgens bemerkte Pat Humbert, als er in den Laden fuhr, daß kein Rauch aus dem Schornstein des Mustrovicschen Hauses stieg. »Das alte Haus schaut wieder verlassen aus«, sagte er zu Allen. »Natürlich, außer diesem Burschen hat man nie jemanden gesehen, aber jetzt ist sicher wieder etwas geschehen. Es sieht ganz so aus, als ob das Haus leer wäre.«
Drei Tage lang schauten die Nachbarn besorgt auf den Schornstein der Battle-Farm. Sie wollten nichts überstürzen und sich am Ende lächerlich machen. Aber am vierten Tag gingen Pat Humbert und T. B. Allen und John Whiteside hinaus, um nachzuschauen. Das Haus war unheimlich still. Es schien wirklich verlassen. John Whiteside klopfte an die Küchentür. Das Haus blieb totenstill. John drückte auf die Klinke. Die Tür flog auf. Die Küche war peinlich sauber; der Tisch war für drei Personen gedeckt. Das Frühstück aus Haferbrei, Spiegeleiern und Brot war bereit. Die Speisen waren schimmelig. Ein paar Fliegen wanderten planlos im Licht umher, das durch die offene Tür eintrat. Pat Humbert rief: »Jemand da?« Er wußte, daß niemand antworten würde.
Dann durchsuchten sie das Haus von oben bis unten, aber es war leer. Möbel fanden sie nur in der Küche; alle anderen Räume waren nackt und kahl. Die Battle-Farm war verlassen, war plötzlich und unvermittelt verlassen worden.
Später, als der Sheriff benachrichtigt wurde, fand auch er nichts, was das Geheimnis hätte lüften können. Die drei Mustrovics hatten, als sie einzogen, bar bezahlt; und als sie wieder auszogen, hinterließen sie keine Spur. Niemand hatte sie gesehen, als sie weggingen, und niemand sah sie je wieder. Nicht einmal ein Verbrechen gab es im Lande, womit man sie hätte in Zusammenhang bringen können. Plötzlich, eines Morgens, als sie sich eben zum Frühstück setzen wollten, waren sie verschwunden. Viele, unzählige Male wurde der Fall Mustrovic im Laden besprochen, aber niemand konnte je eine einleuchtende Lösung vorbringen.
Und wiederum wurde das Land die Beute von wucherndem Unkraut. Abermals krochen die wilden Brombeerranken in die Äste der Obstbäume. In kürzester Zeit, als ob sie es durch Übung gelernt hätte, war die Farm allenthalben gänzlich verwildert. Man verkaufte sie an eine Immobiliengesellschaft in Monterey, und die Leute im »Tal des Himmels«, ob sie es zugaben oder nicht, waren überzeugt, daß auf der Battle-Farm ein Fluch lag. »Das Land ist nicht schlecht«, pflegten sie zu sagen, »aber ich würde es nicht annehmen, auch wenn es mir geschenkt würde. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber etwas an diesem Haus ist nicht geheuer; dort spukt’s.« Und manche von ihnen waren nicht weit davon entfernt, wirklich an Gespenster zu glauben.
Ein angenehmes Schaudern ging durch die Leute im »Tal des Himmels«, als sie vernahmen, daß die Battle-Farm wieder bewohnt werden sollte. Pat Humbert brachte das Gerücht in den Laden, nachdem er Automobile vor dem alten Haus gesehen hatte, und T. B. Allen, der Ladenbesitzer, verbreitete es weit herum. T. B. malte sich alle Einzelheiten über den neuen Besitzer aus und teilte sie seinen Kunden mit, als vertrauliche Mitteilungen selbstverständlich, die er alle mit »man sagt« eröffnete. »Man sagt, der Kerl, der die Battle-Farm gekauft hat, sei einer, der im Lande umherzieht und Gespenstern nachstöbert, um über sie zu schreiben.« Mit seinem »man sagt« deckte sich Allen den Rücken, wie die Zeitungen, wenn sie etwas als »es wird behauptet« melden.
Bevor Bert Munroe auf seinem neuen Hofe eingezogen war, zirkulierten ein Dutzend Geschichten über ihn im Tal. Als er dann kam, wußte er bald, daß ihm seine neuen Nachbarn nachstarrten, obgleich er sie nie dabei ertappte. Dieses heimliche Anstarren ist unter den Leuten auf dem Lande zu einer großen Kunst entwickelt. Und dabei entgeht ihnen nichts. Sie nehmen jedes sichtbare Flecklein wahr, mustern die Kleidung und lernen sie auswendig, stellen Augenfarbe und Nasenform, Gang und Haltung fest und einigen sich auf drei oder vier Adjektive, die unsere ganze Erscheinung und Persönlichkeit umschreiben — und die ganze Zeit sind wir der Meinung, sie hätten uns überhaupt noch gar nicht gesehen.
Bert Munroe kaufte also die Battle-Farm und begann unverzüglich den Hof zu säubern. Eine Schar Zimmerleute machte sich im Haus an die Arbeit, schleppte sämtliche Möbel ins Freie und verbrannte sie, riß Wände heraus und errichtete neue, solidere und deckte das Dach mit Asbestschindeln. Dann wurden alle Räume frisch tapeziert, und zuletzt erhielt die Außenwand einen sauberen Anstrich von hellgelber Farbe.
Bert selbst schnitt die Reben und Spalierbäume am Haus, dann die Obstbäume im Hof, um Licht und Sonne hereinzulassen. Nach drei Wochen hatte das alte Haus jede Spur seines spukhaften Aussehens verloren und sah aus wie hunderttausend andere Landhäuser im Westen.
Sobald die Farbe innen und außen trocken war, trafen die neuen Möbel ein: gepolsterte Stühle und ein Sofa, ein emaillierter Ofen, Eisenbetten (in Holzimitation gestrichen und höchsten Komfort bietend), Spiegel mit geschnitzten Rahmen, Wiltonteppiche und Reproduktionen von Gemälden eines modernen Künstlers, der offenbar dem Blau vor allen anderen Farben den Vorzug gab.
Mit den Möbeln kamen Mrs. Munroe und die drei jüngeren Munroes. Mrs. Munroe war eine rundliche Frau und trug einen randlosen Zwicker an einem Band um den Hals. Sie war eine gute Hausfrau. Sie ließ die neuen Möbel unzählige Male verschieben und umstellen, bis sie endlich befriedigt war; war sie aber befriedigt, nachdem sie einen Stuhl oder Tisch oder eine Kommode mit zugekniffenen Augen gemustert, dann zustimmend genickt und gelächelt hatte, dann blieb das Stück für immer genau so stehen. Einzig beim Frühjahrsputz durfte es von seinem Platz verschoben werden.
Ihre Tochter Mae war ein hübsches Mädchen mit weichen, runden Wangen und vollen Lippen. Mae war schön gewachsen, aber eine niedliche Wölbung unter dem Kinn deutete an, daß sie dereinst einmal, wie ihre Mutter, plump sein würde. Ihre Augen waren freundlich und unschuldig, nicht intelligent, aber keineswegs dumm. Allmählich würde sie das Ebenbild ihrer Mutter werden: eine gute Hausfrau, eine Mutter gesunder Kinder, eine brave, zufriedene Gattin.
In ihrem neuen Kämmerchen steckte sie alte Carnets de bal in den Spiegel. An die Wände hängte sie gerahmte Fotografien von ihren Freundinnen in Monterey, und auf das Nachttischchen legte sie das Fotoalbum und das Tagebuch. Das Tagebuch hatte ein kleines Schloß und barg völlig uninteressante Aufzeichnungen von Bällen, Parties, Rezepten für allerlei Zuckergebäck und harmlosen Schwärmereien für gewisse junge Herren. Mae wählte und schneiderte ihre eigenen Vorhänge: eine Bettgardine aus geblümter Kretonne und blaßrosarote Tüllvorhänge vor den Fenstern, um das Licht zu dämpfen. Auf dem Bettüberwurf aus gerafftem Satin breiteten sich fünf bunte Kissen aus neben einer langbeinigen französischen Stoffpuppe mit kurzgeschnittenen gelben Haaren und einer Zigarette aus Stoff zwischen den schlaffen Lippen. Diese Puppe war gleichsam ein Beweis dafür, daß Mae gewisse Dinge, welche sie nicht ganz billigte, großzügig zu dulden bereit war. Mae glaubte, daß die Puppe die Verkörperung ihrer Aufgeschlossenheit war. Und Mae liebte Freunde mit einer »Vergangenheit«. Denn dadurch, daß sie solche Freunde hatte und ihnen zuhören durfte, wurde in ihrem Herzen jedes Bedauern über ihr eigenes, tadelloses Leben erstickt. Mae war neunzehn Jahre alt und dachte ständig nur ans Heiraten. Wenn sie mit Jünglingen ausging, schwatzte sie mit einiger Rührung von Idealen. Was Ideale wirklich waren, wußte sie allerdings kaum; mit solch unbestimmbaren Dingen aber schien irgendwie die Art der Küsse auf der Heimfahrt von Parties zusammenzuhängen.
Jimmie Munroe war siebzehn und, da er soeben die High-School abgeschlossen hatte, ungemein zynisch. In Gegenwart seiner Eltern war er gewöhnlich mürrisch und verstockt. Er wußte, daß er ihnen seine Welterfahrung nicht anvertrauen durfte; sie hätten ihn nie verstanden. Sie gehörten zu einer Generation, welche von Sünden und Heldentaten nichts wußte. Jimmie war fest entschlossen, sein Leben der Wissenschaft zu widmen. Etwas anderes kam nicht in Frage. Aber den Eltern sagte er nichts davon, denn sie wären nicht sehr begeistert gewesen. Unter »Wissenschaft« verstand Jimmie Radioapparate, Flugzeuge und Archäologie. Er malte sich aus, wie er in Peru goldene Vasen ausgraben würde. Er träumte von einer zellenartigen Werkstatt, in welche er sich einschließen und woraus er eines Tages, nach Jahren stummen Leidens und allgemeiner Verkennung und Verachtung seitens der Außenwelt, auftauchen würde, um die Öffentlichkeit mit einem neuen Flugzeugtyp von revolutionärer Konstruktion und verheerender Geschwindigkeit zu überraschen.
Jimmies Zimmer im neuen Haus war denn auch von Anfang an ein entsetzliches Durcheinander von kleinen Maschinen und Apparaten: einem Radio mit Kopfhörer, einem handbetriebenen Dynamo, der ein Morsegerät mit Strom belieferte, einem Messingfernrohr und zahllosen Bestandteilen und Bruchstücken von allen möglichen anderen »Geräten«. Jimmie besaß eine geheime Schatzkiste, eine schwere eichene Kiste mit einem riesigen Vorhängeschloß. Darin hielt er eine halbe Büchse Dynamitkapseln verborgen, einen alten Revolver, eine Schachtel Melachrino-Zigaretten, drei Apparate, genannt »Lustige Witwe«, eine kleine Flasche Pfirsichschnaps, einen dolchähnlichen Brieföffner, vier Bündel Briefe von vier verschiedenen Verehrerinnen, sechzehn Lippenstifte, die er von Tanzpartnerinnen stibitzt hatte, und eine Kartonschachtel mit Andenken an laufende Liebschaften. In der Schachtel lagen kunterbunt durcheinander verdorrte Blumen, Taschentücher und Knöpfe und, am wertvollsten von allem, ein Strumpfband mit schwarzer Spitze. Wie er zu diesem Strumpfband gekommen war, hatte Jimmie vergessen. Nicht vergessen hatte er aber — und das war viel angenehmer —, bei welcher Gelegenheit er es gestohlen hatte. Bevor er seine Schatzkiste aufschloß, drehte er immer den Schlüssel der Zimmertür herum.
Auf der High-School war er nicht besser und nicht schlechter gewesen als manche seiner Altersgenossen. Bald nachdem er ins »Tal des Himmels« gezogen war, fand er, daß sein Sündenregister einmalig sei. Er begann, sich als eine Art bekehrten Wüstlings zu betrachten, allerdings nicht so bekehrt, daß er sich nicht dann und wann hätte einen Rückfall gestatten dürfen. Sein bewegtes Leben verschaffte ihm bei den jüngeren Mädchen des Tales einen gewaltigen Vorteil. Jimmie war ein hübscher, schlanker, gutgewachsener Junge mit dunklen Augen und Haaren.
Manfred, der jüngste Sohn — gewöhnlich Manny genannt —, war sieben Jahre alt und ein ernstes Kind, dessen Gesicht durch geschwollene Lymphdrüsen entstellt war. Man hatte davon geredet, sie entfernen zu lassen, und der Gedanke an die Operation jagte dem Kind eine panische Angst ein. Als seine Mutter dies sah, sprach sie von der Operation nur noch, wenn er nicht gehorchen wollte. Mr. und Mrs. Munroe betrachteten Manny als tiefsinniges Kind, vielleicht sogar als ein kleines Genie. Meist spielte er allein für sich, dann wiederum saß er stundenlang da und starrte ins Leere. Seine Mutter nannte es »Träumen«. Erst viele Jahre später fanden sie heraus, daß der Kleine nicht wie andere Kinder war. Die Lymphdrüsenschwellungen hatten seine geistige Entwicklung gehemmt. Manny war ein lieber, fügsamer Junge, den man leicht zum Gehorchen einschüchtern konnte. Wenn man ihn aber einmal zu sehr eingeschüchtert hatte, wurde er hysterisch und verlor jede Selbstbeherrschung. Einmal schlug er so lange die Stirn auf den Boden, bis ihm das Blut in die Augen rieselte.
Bert Munroe war in das »Tal des Himmels« gezogen, weil er des jahrelangen Kampfes gegen eine Macht, die ihn unweigerlich immer besiegt hatte, überdrüssig geworden war. Er hatte alles mögliche unternommen und jedesmal versagt, nicht etwa infolge eigener Unfähigkeit, sondern aufgrund von Mißgeschicken, deren Verhütung nicht in seiner Macht gestanden hatte. Es waren — einzeln betrachtet — ganz einfach unglückliche Zufälle gewesen; aber Bert, der sie als Glieder einer langen Kette sah, nannte sie Schläge eines Schicksals, das ihm den persönlichen Erfolg nicht gönnte. Und nun hatte er es satt, dieses namenlose Etwas, welches alle Straßen zum Erfolg verschloß, weiterhin zu bekämpfen. Bert war erst fünfundfünfzig, aber er wollte sich ausruhen; er war halbwegs überzeugt, daß ein Fluch auf ihm lag.
Vor Jahren einmal hatte er am Rande der Stadt eine Garage eröffnet. Das Geschäft blühte; das Geld floß nur so herein. Als er sich sicher wähnte, wurde die Staatsstraße verlegt, und er stand im Leeren. Etwa ein Jahr später verkaufte er die Garage und erwarb einen Kolonialwarenladen. Wiederum war er anfänglich erfolgreich. Er konnte die Schulden abzahlen und begann Geld auf die Bank zu tragen, aber ein Warenhaus eröffnete einen Preiskrieg gegen ihn, und das war das Ende dieses Geschäftes. Bert war ein empfindsamer Mann, und solche Vorfälle waren ihm ein dutzendmal zugestoßen. Immer dann, wenn der Erfolg sicher schien, traf ihn der Fluch. Sein Selbstvertrauen schwand. Als der Krieg ausbrach, war sein Mut fast gebrochen. Er wußte, daß man am Krieg Geld verdienen konnte, aber er zögerte, nachdem er so oft vom Mißerfolg betroffen worden war.
Er mußte sich lange zureden, bevor er sich in ein Geschäft mit Bohnen einließ, die der kriegsbedingten Versorgungslage wegen bald im Preise steigen würden. Im ersten Jahr verdiente er fünfzigtausend Dollar, im zweiten hunderttausend. Im dritten Jahr schloß er über Tausende von Morgen Verträge ab, bevor die Bohnen überhaupt gesteckt waren. Er garantierte zehn Cent für das Pfund. Für achtzehn Cent hätte er sie weiterverkaufen können. Im November war der Krieg zu Ende, und Bert verkaufte die ganze Ernte für vier Cent das Pfund.
Danach war er überzeugt, daß sein Fluch Wirklichkeit sei. Er war so abgeschlagen, daß er sich kaum mehr unter die Leute wagte. Er arbeitete im Garten, pflanzte ein wenig Gemüse und brütete über die Gemeinheit des Schicksals nach. Langsam, während mehrerer Jahre des Stillstands, wuchs in seinem Herzen eine starke Sehnsucht nach der Scholle. Dort lag, überlegte er, die einzige Hoffnung. Als Bauer war ihm vielleicht vergönnt, etwas aufzubauen, das ihm sein Schicksal nicht mißgönnen konnte. Auf einer kleinen Farm, dachte er weiter, konnte er vielleicht doch noch ein wenig Frieden und Sicherheit finden.
Eine Immobiliengesellschaft in Monterey bot die Battle-Farm zum Verkauf an. Bert schaute sie an, erkannte, was sich daraus machen ließ, und kaufte sie. Seine Familie war anfänglich nicht einverstanden, aber als Bert den Hof gesäubert, elektrisches Licht und das Telefon eingerichtet und das Haus mit neuen Möbeln ausgestattet hatte, waren Mrs. Munroe und die Kinder nahezu begeistert. Mrs. Munroe war froh über jede Neuerung, die Berts Niedergeschlagenheit ein Ende bereitete.
Kaum hatte Bert die Battle-Farm gekauft, war er ein ganz anderer Mensch. Seine trüben Gedanken waren verflogen. Der Fluch war weggewischt. Bert fühlte sich befreit und erlöst. Der gequälte Ausdruck verschwand aus seinem Gesicht, und er ging wieder aufrecht. Er wurde ein leidenschaftlicher Bauer. Er studierte unzählige Bücher über landwirtschaftliche Fragen, stellte einen Knecht an und arbeitete von früh bis spät. Jeder Tag brachte Neues, dessen er sich herzlich freute. Jedes neue Pflänzlein, das aus dem Boden schaute, war eine Bestätigung seiner Genesung. Bert war zufrieden und zuversichtlich, und weil er wieder Vertrauen hatte, fiel es ihm leicht, sich mit den Männern des Tales anzufreunden und ihre Achtung zu gewinnen.
Es ist nicht leicht, sich rasch in einer ländlichen Gemeinde einzuleben. Die Leute im Tal hatten der Ankunft der Munroes mit gemischten Gefühlen entgegengesehen. In der Battle-Farm spukte es. Daran hatten sie immer geglaubt, auch jene, die nach außen hin darüber lächelten. Und jetzt kam ein Mann und zeigte ihnen, daß sie sich getäuscht hatten. Noch mehr, dieser Mann verlieh der ganzen Gegend ein neues Gesicht, indem er den unseligen Hof in ein harmloses, fruchtbares Stück Land umwandelte. Die Leute hatten sich an die Gespenster ebenso gewöhnt wie an den Fluch und das Unkraut auf dem dürren Boden. Insgeheim ärgerten sie sich über die Veränderung.
Aufgrund seines Taktgefühls und seiner zuversichtlichen Freundlichkeit belehrte sie Bert in kurzer Zeit eines Besseren. In drei Monaten hatten sie ihn als rechtschaffenen Mann, als Nachbarn, der borgte und verlieh, anerkannt. Und nach sechs Monaten wurde er in den Schulbeirat gewählt. Seine Beliebtheit beruhte weitgehend auf seiner Zufriedenheit, die ihn wie ein sonniger Tag erfüllte, seitdem er sich vor den bösen Geistern sicher wußte. Hinzu kam, daß er freigebig und gütig war. Es freute ihn, wenn er seinen Nachbarn helfen durfte, und — was viel wichtiger ist — er zögerte nicht, sie um die vielen kleinen täglichen Freundesdienste zu bitten.
Kurz nach seinem Einzug ins Tal verriet er einigen Bauern den Grund, weshalb er gekommen war, und sie bewunderten die Offenheit, mit der er von sich erzählte. Im Laden hatte T. B. Allen die übliche Frage gestellt.
»In Eurem Haus haben sich merkwürdige Dinge ereignet, und wir haben eigentlich immer geglaubt, es ist verflucht. Seid Ihr noch keinem Gespenst begegnet?«
Bert lachte. »Nimm das Futter aus dem Haus, so ziehn die Ratten aus!« sagte er. »Ich habe die Düsterkeit und den Modergeruch herausgenommen — von dem leben ja die Gespenster, nicht wahr?«
»Also, das muß ich sagen«, gab T. B. zu, »Ihr habt ein hübsches Haus daraus gemacht. Es gibt kaum ein schöneres im Tal …«
Dann verfinsterte sich Berts Stirn, als ihm ein Gedanke durch den Kopf ging, und er sagte: »Ich habe viel Pech gehabt. Ich habe manche Geschäfte ausprobiert, aber jedesmal ohne Erfolg.« Dann plötzlich lachte er über einen neuen Gedanken. »Und was tu’ ich? Ich kaufe mir ausgerechnet ein Haus, auf dem ein Fluch liegen soll. Und jetzt habe ich gedacht, vielleicht haben mein Fluch und der Fluch des Hauses sich am Kragen genommen und umgebracht. Weg sind sie jedenfalls, dessen bin ich sicher.«
Die Männer lachten mit, und T. B. Allen schlug mit der Hand auf den Ladentisch und rief: »Ausgezeichnet! Aber wißt Ihr was? Vielleicht haben Euer Fluch und der Fluch des Hauses geheiratet und sich in ein Erdloch verzogen, wie zwei Klapperschlangen. Und wer weiß, bevor wir etwas Böses ahnen, tauchen auf einmal haufenweise junge Flüchlein auf und kriechen auf den Weiden herum!«
Alle Anwesenden brachen in schallendes Gelächter aus, und T. B. prägte sich die Szene Wort für Wort ein, so daß er sie in anderer Gesellschaft wiederholen konnte. Es ist beinahe wie der Dialog in einem Theaterstück, dachte er.
III
Edward Wicks wohnte in einem kleinen, düsteren Häuschen am Rande der Überlandstraße im »Tal des Himmels«. Hinter seinem Haus lagen ein Pfirsichgarten und ein Gemüsefeld. Edward Wicks besorgte die Pfirsiche, und seine Frau und seine schöne Tochter kümmerten sich um das Gemüse und machten die Erbsen, Bohnen und frühen Erdbeeren für den Markt in Monterey bereit.
Edward Wicks hatte ein derbes, braunes Gesicht und kleine, kalte Augen ohne Wimpern. Er war bekannt als der schlaueste Mann im ganzen Tal, der gewagte Geschäfte abschloß und nie zufriedener war, als wenn er ein paar Cents mehr als die Nachbarn aus seinen Pfirsichen herausschlagen konnte. Ab und zu, wenn es ging, handelte er mit Pferden und betrog dabei ein wenig. Seines Scharfsinns wegen hatte er sich die Achtung der Mitbürger erworben, aber seltsamerweise wurde er nicht reicher. Allein, es machte ihm Spaß, so zu tun, als würde er öfters Geld anlegen. In den Schulbeiratsitzungen fragte er die anderen Mitglieder um Rat über Aktien und Dividenden und erweckte dadurch den Eindruck, als hätte er bedeutende Ersparnisse. Die Leute im Tal nannten ihn »Shark«.
»Shark?« sagten sie. »Oh, ich glaube, der hat seine zwanzigtausend, vielleicht noch mehr. Shark ist nicht auf den Kopf gefallen!«
Und die Wahrheit war, daß Shark im Leben nie mehr als fünfhundert Dollar auf einmal besessen hatte.
Aber er galt als ein wohlhabender Mann, und das gefiel ihm über alles. Es machte ihm so viel Vergnügen, daß er mit der Zeit seinen imaginären Reichtum als Wirklichkeit betrachtete. Er einigte sich auf fünfzigtausend Dollar und führte ein dickes Hauptbuch, in welchem er Zinsen errechnete und in das er seine diversen Kapitalanlagen eintrug. Und diese Eintragungen waren die größte Freude seines Lebens.
In Salinas wurde eine Ölgesellschaft gegründet mit dem Zweck, im südlichen Teil von Monterey Erdöl zu bohren. Als Shark Kunde von der neugegründeten Gesellschaft erhielt, ging er hinüber zu John Whiteside und unterhielt sich mit ihm über den Wert ihrer Aktien. »Ich interessiere mich für diese South County Ölgesellschaft«, sagte er.
John Whiteside, der als eine Art Experte in solchen Angelegenheiten galt, sagte: »Der Bericht der Geologen klingt nicht schlecht. Es war ja schon lange bekannt, daß es in dieser Gegend Öl geben soll. Natürlich, gar zuviel würde ich nicht hineinstecken.«
Shark strich sich mit Daumen und Zeigefinger die Unterlippe und dachte einen Augenblick nach. Dann sagte er: »Ich habe da zehntausend herumliegen, die nicht eintragen, was sie sollten. Und jetzt habe ich mir überlegt … die Sache macht einen guten Eindruck. Es scheint, daß es sich lohnt, wenn ich sie etwas gründlicher anschaue. Ich wollte bloß vorher sehen, was Ihr davon haltet.«
Aber Shark war bereits entschlossen. Als er nach Hause kam, holte er das Hauptbuch hervor und hob zehntausend Dollar von seinem Bankkonto ab. Dann trug er eintausend Aktien der South-County-Ölgesellschaft in die Effektenkolonne ein. Von jenem Tage an verfolgte er fieberhaft die Börsenberichte. Wenn der Preis seiner Aktien ein wenig stieg, war er zufrieden und aufgeräumt, und wenn der Preis fiel, setzte sich ihm ein würgender Klumpen in den Hals. Einmal, als die South-County-Aktien plötzlich stark in die Höhe gingen, war Shark so überglücklich, daß er in den Laden ging und eine schwarze Marmoruhr kaufte, mit Onyxsäulen zu beiden Seiten des Zifferblattes und einem bronzenen Pferd darüber. Die Männer im Laden tuschelten untereinander, Shark führe offenbar etwas Großes im Schilde.
Eine Woche später verschwand die Gesellschaft von der Bildfläche. Als Shark davon hörte, eilte er nach Hause, schlug sein Hauptbuch auf und trug unter dem Datum des Vortages den Verkauf sämtlicher Aktien mit zweitausend Dollar Profit ein.
Pat Humbert fuhr an jenem Tag von Monterey zurück und hielt auf der Straße vor Sharks Haus an. »Wie ich höre, seid Ihr mit der South County hereingefallen«, bemerkte er beiläufig.
Shark lächelte gutmütig. »Aber Pat, für was haltet Ihr mich denn eigentlich? Vor zwei Tagen habe ich verkauft. Ihr solltet doch wissen, daß ich kein Anfänger bin! Ich wußte schon, daß diese Aktien faul waren. Aber ich wußte auch, daß sie steigen würden, damit die Gesellschafter ohne Verlust auflösen konnten. Als sie verkauften, wußte ich, was ich zu tun hatte.«
»Donnerwetter«, sagte Pat voll Bewunderung und Ehrfurcht. Und als er im Laden die Nachricht verbreitete, nickten die Männer und fragten sich, wie hoch wohl Sharks Vermögen gestiegen sein konnte. Und sie sagten, sie wollten nicht gern in ein Geschäft gegen ihn verwickelt sein.
Um diese Zeit borgte Shark vierhundert Dollar von einer Bank in Monterey und kaufte einen alten Fordson-Traktor.
Allmählich wurde sein Ruf als weitsichtiger Mann mit gesundem Urteil so groß, daß niemand im »Tal des Himmels« daran dachte, Aktien oder ein Stück Land oder auch nur ein Pferd zu kaufen, ohne vorher Shark Wicks um Rat zu fragen. Auf alle Probleme ging er ein, und am Ende, nach sorgfältigster Prüfung, erteilte er verblüffend gute Ratschläge.
In einigen Jahren wies sein Hauptbuch ein Vermögen von hundertfünfundzwanzigtausend Dollar auf, das er in klugen und kühnen Transaktionen erworben hatte. Wohl bemerkten seine Nachbarn, daß er wie ein armer Mann lebte; um so mehr aber achteten sie ihn, denn der Reichtum hatte ihm den Kopf nicht verdreht. Natürlich, denn Shark war kein Narr. Seine Frau und seine schöne Tochter besorgten weiterhin das Gemüse für den Markt in Monterey, und Shark nahm sich der tausend Pflichten im Pfirsichgarten an.