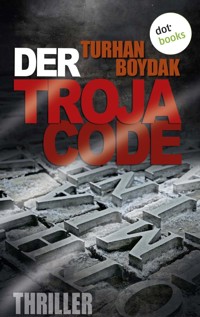Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Jason Bradley ermittelt
- Sprache: Deutsch
Action, Todesgefahr und Hochspannung: "Das Todes-Memorandum" von Turhan Boydak jetzt als eBook bei dotbooks. Ein gläserner Kubus – eine Todesfalle. Hier würde er also sterben. Nach dem Warum muss er nicht fragen. Denn er weiß es nur zu gut. Und er weiß, es wird ein qualvoller Tod. Es sollte der schönste Tag seines Lebens sein. Endlich bekommt der New Yorker Journalist Jason Bradley den lange ersehnten Pulitzer-Preis verliehen. Doch dann wird sein Freund Michael Robards entführt und dessen Frau mit einer gigantischen Lösegeldforderung konfrontiert. Fieberhaft ermittelt Jason, um den Aufenthaltsort seines Freundes ausfindig zu machen. Doch Michaels Entführer haben ihn längst ins Visier genommen – und ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt … Jetzt als eBook kaufen und genießen: "Das Todes-Memorandum" von Turhan Boydak. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 723
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Ein gläserner Kubus – eine Todesfalle. Hier würde er also sterben. Nach dem Warum muss er nicht fragen. Denn er weiß es nur zu gut. Und er weiß, es wird ein qualvoller Tod.
Es sollte der schönste Tag seines Lebens sein. Endlich bekommt der New Yorker Journalist Jason Bradley den lange ersehnten Pulitzer-Preis verliehen. Doch dann wird sein Freund Michael Robards entführt und dessen Frau mit einer gigantischen Lösegeldforderung konfrontiert. Fieberhaft ermittelt Jason, um den Aufenthaltsort seines Freundes ausfindig zu machen. Doch Michaels Entführer haben ihn längst ins Visier genommen – und ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt …
Über den Autor:
Turhan Boydak, 1974 in Damme geboren, war nach seinem Studium in leitenden Funktionen bei verschiedenen namhaften eCommerce-Unternehmen tätig. Heute lebt und arbeitet er mit seiner Familie in München und Zürich als Buchautor und Angestellter der führenden Schweizer Top-Manager-Community.
Turhan Boydak veröffentlichte bei dotbooks bereits Der Troja-Code und Die Janus-Protokolle.
Die Website des Autors: www.turhanboydak.de/autor
Der Autor im Internet: www.facebook.com/turhanboydak.de
***
Originalausgabe November 2015
Copyright © 2015 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Maria Seidel, atelier-seidel.de
Titelbildabbildung: Thinkstockphoto/Vladimir Floyd
E-Book-Herstellung: Open Publishing GmbH
ISBN 978-3-95824-327-9
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weiteren Lesestoff aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort Todes-Memorandum an: [email protected]
Gerne informieren wir Sie über unsere aktuellen Neuerscheinungen und attraktive Preisaktionen – melden Sie sich einfach für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.twitter.com/dotbooks_verlag
http://instagram.com/dotbooks
http://blog.dotbooks.de/
Turhan Boydak
Das Todes-Memorandum
Thriller
dotbooks.
Prolog
New York,wenige Wochen zuvor
Hier würde er also sterben.
Der Gedanke schoss ihm unvermittelt durch den Kopf, als er vor dem großen Eingangstor stand und zum ersten Mal in das Innere der heruntergekommenen Halle blickte. Die Erkenntnis hätte ihn eigentlich nicht unvorbereitet treffen dürfen. Schließlich hatte er viel Zeit gehabt, sich mit seiner ausweglosen Situation auseinanderzusetzen. Sie traf ihn dennoch.
Er spürte, wie sich seine Nackenhaare aufrichteten, als ihm der Mann, der ihn an diesen verlassenen Ort gebracht hatte, für einen kurzen Augenblick die Hand auf die Schulter legte. In der Berührung lag kein größerer Druck. Sie war beinahe schon zärtlich, wenn auch bestimmend. Dennoch wusste er, was es bedeutete. Es war an der Zeit, weiterzugehen.
Sein erster Schritt hinein ins Gebäude war wie fremdgesteuert, und es kam ihm vor, als würde er sich in Zeitlupe bewegen. Der Geruch von altem Maschinenöl wehte ihm entgegen. Erneut stockte er in seiner Bewegung und überlegte, ob er sich umdrehen sollte. Sein Puls raste und pochte in seinen Ohren. Für einen kurzen Moment dachte er darüber nach, hinauszurennen. Aber er wollte dem Mann seine Furcht auf keinen Fall zeigen. Stattdessen schloss er die Augen und atmete tief durch. Er zwang sich, sich auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren und den Gedanken an das, was mit ihm passieren würde, aus seinem Kopf zu verbannen.Noch geht es mir gut, dachte er.
Wenige Momente später verstummte das Rauschen des Blutes in seinen Ohren. Er öffnete die Augen und wischte sich die Schweißperlen von der Stirn. Der Mann hinter ihm gab ihm die Zeit, die er brauchte, und drängte ihn nicht weiter. Fast schon feierlichen Schrittes nahm er anschließend wieder den Weg ins Halleninnere auf. Den Oberkörper so aufrecht wie möglich, um selbstbewusster zu wirken, als er es in diesem Moment war. Im Vorbeigehen nahm er nun den Ort seines bevorstehenden Todes genauer in Augenschein.
Es war ein trostloser Ort. Vermutlich hatte er in früheren Zeiten als Lagerhalle oder Produktionsstätte gedient. Doch diese Zeiten mussten schon weit zurückliegen. Gerätschaften oder Möbel, die auf den ursprünglichen Zweck der Halle hätten schließen lassen, gab es keine mehr. Der vordere Teil der Halle lag nahezu im Dunkeln. Die untergehende Sonne über der amerikanischen Ostküstenmetropole warf nur noch ein schwaches Licht durch das große Eingangsportal. Die Fensterreihen, die die Halle links und rechts meterhoch säumten, waren allesamt mit schweren Holzbrettern vernagelt. Sein Blick ging hinauf zum Hallendach. Auch dieses hatte bereits mit Altersschwäche zu kämpfen und war offensichtlich an gleich mehreren Stellen notdürftig ausgebessert worden.
Trotz ihres gemächlichen Tempos hallten die Schritte hinter ihm bedrohlich laut in der sonst leeren Fabrikhalle. Der Mann folgte ihm in geringem Abstand und ließ ihn keine Sekunde aus den Augen. Um das zu wissen, musste er sich gar nicht erst zu ihm umdrehen. Er spürte es auch so überdeutlich.Wie ein Schatten, dachte er, der jede meiner Bewegungen mitmacht. Als er bereits das erste Drittel der Halle durchschritten hatte, blickte er kurz an sich hinab. Auf dem unebenen Betonboden erzeugten seine abgetretenen Sneaker nahezu keinerlei Geräusche – im Gegensatz zu den eleganten Schuhen seines Schattens. Bis auf das Knirschen winziger Steinchen, die hier und da den Boden bedeckten und unter dem Druck seiner Schuhe über den harten Boden schabten. Ihm war kalt und die Luft war zunehmend staubig.
Er richtete seinen Blick wieder nach vorn. Den hinteren Teil der Halle hatte er aufgrund der diffusen Lichtverhältnisse bisher nur schemenhaft erkennen können. Mit jedem weiteren Schritt nahmen die Konturen nun an Schärfe zu, und er konnte die Ausmaße des etwa hundert Meter langen Gebäudes genauer einschätzen. Ganz hinten an der gegenüberliegenden Hallenwand erkannte er eine geschlossene Metalltür. Aber sein Blick wurde nur wenige Augenblicke später magisch von einem anderen Objekt angezogen. Es stand ein paar Meter vor dem Ende der Halle. Mitten im Raum.
Man hätte den gläsernen Kubus bei den schwachen Lichtverhältnissen auch leicht übersehen können. Aber nun, da er ihn entdeckt hatte, konnte er sich auf nichts anderes mehr konzentrieren. Ein gläserner Würfel, der augenscheinlich viel zu modern war, als dass er zum einstigen Inventar der Halle gehört haben könnte. Die Kantenlänge des Würfels betrug etwa drei Meter, und nach oben war er mit einer durchsichtigen Abdeckung verschlossen. Erst als er nur noch wenige Schritte von dem überdimensionalen Würfel entfernt war, konnte er im Halbdunkel eine Öffnung an der ihm abgewandten Seite entdecken. Die Tür war nur einen Spalt weit offen, wies jedoch keinerlei Türklinke oder Knauf auf. Erneut keimte Angst in ihm auf. Seine Beine begannen zu zittern.Schwindel überkam ihn. Und für eine Sekunde glaubte er, sich auf denBoden setzen zu müssen.
Im selben Moment erfüllte ein laut widerhallendes Geräusch die Halle. Er blieb abrupt stehen und schaute verängstigt zu der sich öffnenden Tür am Hallenende. Ein immer breiter werdender Lichtkegel, der sich aus der Türöffnung den Weg ins Halleninnere bahnte, erleuchtete den schmutzigen Boden. Um sich vor dem blendenden Licht zu schützen, hob er seine Hand an die Stirn und versuchte mit zusammengekniffenen Augen, etwas zu sehen. Doch mehr als die Silhouette eines Mannes, der durch die Tür auf ihn und seinen Schatten zukam, konnte er zunächst nicht erkennen. Es handelte sich um einen relativ großen schwarzen Mann, der einen Anzug trug. Plötzlich bemerkte er eine Bewegung in seinem Rücken. Zum ersten Mal verließ sein Schatten die Position als Beobachter, trat an ihm vorbei, den Blick auf den Mann am Ende der Halle gerichtet, und hob abwehrend seine rechte Hand. Der Mann vor der Tür blieb umgehend stehen. Nach einem kurzen Zögern nickte er, ging dann zurück zur Tür und verschwand aus ihrem Blickfeld.
Seine Kehle fühlte sich trocken an, und er hatte wieder begonnen zu schwitzen. Augenblicke später wurde es hell. Unweigerlich wanderte sein Blick am Schatten vorbei zum Kubus, der plötzlich von zwei großen Deckenspots hell erleuchtet wurde. Wie ein futuristisches Objekt aus einer anderen Welt zog der würfelförmige Raum in der alten Fabrikhalle alle Aufmerksamkeit auf sich.
Dann spürte er wieder die Hand des Schattens auf seiner Schulter und zuckte zusammen. Zum ersten Mal trafen sich ihre Blicke. Es waren warme braune Augen, die seinem vor Furcht geweiteten Blick problemlos standhielten. Nun hatte er seinem Gegenüberseine Angst also doch gezeigt, stellte er resigniert fest. Wortlos forderte ihn der Schatten mit einer Handbewegung auf, weiter zum Kubus zu gehen.
Er legte seine Hand an die offene Tür des Kubus, verharrte jedoch davor und blickte über seine Schulter. Der Schatten nickte ruhig und trat einen kleinen Schritt zurück, als wollte er ihm einen Augenblick Privatsphäre schenken. Wieder schloss er die Augen, nahm all seinen Mut zusammen und betrat den Glaskasten.
Die Atemluft im Würfel war frischer als in der Halle und ein leichtes Summen erfüllte den Raum. Man musste schon sehr aufmerksam hinhören und still sein, um es wahrzunehmen. Aber es war still. Totenstill. An der gläsernen Decke entdeckte er eine 50 Zentimeter große Öffnung, in der eine Apparatur angebracht war. Ein metallisches Rohr von gleichem Durchmesser stieg von dieser bis zur hohen Hallendecke empor.Eine Lüftungsanlage, dachte er und schaute sich anschließend im Raum um.
Das Erste, was auffiel, war der Boden. Der Betonboden war augenscheinlich aufgebrochen worden. An seiner statt war ein planierter Erdboden zu finden, in den die Wände des Würfels eingelassen waren. Auf der rechten Seite stand ein besseres Feldbett. Jedoch fehlte eine Matratze, ebenso Decken und Kissen. Das war alles. Kein Stuhl. Kein Tisch. Keine Lampe. Als er plötzlich das Zischen hinter sich hörte, drehte er sich ruckartig um und blickte zur Tür. Sie war geschlossen. Der Schatten stand auf der anderen Seite und hielt einen Gegenstand in der Hand. Es sah aus wie ein kleiner Pager. Er vermutete, dass er den Türmechanismus steuerte und sein Schatten ihn damit eingeschlossen hatte. Beklommenheit ergriff ihn, als ihm bewusst wurde, dass er in diesem Glaswürfel eingesperrt war. Während er weiterhin seinem Schatten direkt in die Augen blickte, wurde ihm immer klarer, dass sein Gefängnis – hell erleuchtet und aus Glas – keinerlei Privatsphäre zuließ – jedes Tier im Zoo hatte mehr davon. Er wandte sich erneut dem Raum zu und versuchte sich wieder unter Kontrolle zu bringen. Wenige Momente später gelang es ihm irgendwie, erneut Herr über seine Beine zu werden. Er ging zur Seitenwand des Würfels und stellte sich mit dem Rücken zur Wand. Anschließend begann er den Raum abzumessen, indem er langsam mit großen Schritten zur anderen Seite ging. Knapp vier Schritte. Er hatte mit seiner Schätzung also recht gut gelegen. Trost schenkte ihm das nicht. Wieder drehte er sich zur Raummitte.
Von einer Sekunde auf die andere bemerkte er den Schatten. Dieser musste in der Zwischenzeit um den Kubus herumgegangen sein und starrte ihn nun an. Gleich danach schaute der Schatten erst auf seine auffällig blaue Uhr und dann zum großen Eingangstor der Halle, wo die untergehende Sonne die letzten rotgoldenen Strahlen des Tages mit ihnen teilte. Anschließend zeigte der Schatten zum Bett.
Er drehte sich um und entdeckte zwei Gegenstände darunter. Langsam ging er darauf zu und kniete sich auf den sandigen Boden. Er griff nach dem ersten Gegenstand und holte eine Metallschüssel mit Wasser hervor. Das zweite Objekt, das er zum Vorschein brachte, war weicher und in Papier eingewickelt. Nachdem er den kleinen Gebetsteppich von der Verpackung befreit hatte, schaute er ihn sich genauer an und fühlte wenigstens ein bisschen innere Wärme. Sein Blick wanderte zurück zum Schatten. Zum Lächeln war ihm nicht zumute, aber er nickte seinem Schatten dankend zu. Gleich danach trat sein Schatten ein paar Schritte zurück, und wurde kurz darauf von der Dunkelheit der Halle verschluckt.
Er schaute erneut auf die untergehende Sonne, drehte sich dann um und breitete den kleinen Teppich auf dem Boden aus. Zurück am Bett zog er seine Schuhe und Strümpfe aus, krempelte seine Hemdsärmel hoch und begann mit der rituellen Waschung. Zunächst wusch er sich sein Gesicht, dann Hände und Unterarme, strich sich mit feuchten Händen über den Kopf und wusch sich abschließend auch seine Füße. Erneut sagte ihm sein Instinkt, dass sein Schatten ihn aus der Dunkelheit, die den erleuchteten Kubus umhüllte, beobachtete. Er bemerkte, dass er noch nicht völlig frei war im Kopf. Unentwegt kreisten seine Gedanken um seine nahe Zukunft, während er sich aufrecht auf den Gebetsteppich stellte und seine Arme bis zu den Ohren anhob. »Allahu akbar.«
Hier wirst du also sterben, hörte er seine innere Stimme erneut sagen. Das Wo war somit geklärt. Sein nächster Gedanke erinnerte ihn an das Wie. Und dieser Gedanke machte ihm noch mehr Angst, als die Gewissheit, dass er bald sterben würde. Es war alles andere als ein schneller, schmerzfreier Weg, der ihn in den Tod führen würde. Das wusste gerade er nur zu gut. So oft hatte er es schon miterlebt. In seiner Gebetshaltung hoffte er, dass Gott ihm seine Sünden vergeben würde. Dass sein Leben doch einem höheren Zweck gedient haben würde. Vielleicht sogar sein Tod. Dass Gott ihm die Kraft geben würde, seinen letzten Gang in Würde gehen zu können. Dass sein Geist über seinen Körper siegen würde. Kurz hoffte er sogar, dass er doch lebend aus der Sache herauskommen würde. Aber er verbannte diese haltlose Hoffnung rasch aus seinem Kopf. Er musste sich mit seiner Situation abfinden. Hoffnung würde sein Leid nur noch unerträglicher machen. Das brachte ihn zum Warum. Aber darüber musste er nicht eine Sekunde rätseln. Denn warum er sterben musste, war für ihn die am leichtesten zu beantwortende Frage. Eine unerwartete Ruhe erfüllte ihn innerlich, während er sich auf die erste Sure des Korans, die Fatiha, konzentrierte. Nur eine Sache wusste er noch nicht, bevor er mit dem rituellen Gebet fortfuhr. Das Wann.
»Bismillahi rahmani rahim …«
Kapitel 1
New York,am Vortag
Als Conor Gleeson die Unternehmenszentrale der Gleeson Transnational durch die Drehtür verließ, wehte ihm ein kräftiger Abendwind entgegen. Einen Moment lang hielt der Vorstandsvorsitzende des eigenhändig aufgebauten Firmenimperiums inne. Er schloss die Augen und atmete die kühle New Yorker Stadtluft tief ein. In diesem kurzen Augenblick konnte er sogar den lauten Straßenlärm, das Hupen der Taxis und das chaotische Stimmengewirr der vorbeieilenden Fußgänger in seinem Kopf ausschalten. Nur Sekunden später öffnete er seine Augen wieder und erspähte bereits seinen Chauffeur, der vor der imposanten Mercedes-Limousine stand und ihm zunickte. Gleeson nahm wieder sein gewohnt zügiges Schritttempo auf und steuerte auf sein Fahrzeug zu.
»Guten Abend, Sir«, begrüßte ihn sein Fahrer und öffnete ihm die hintere Wagentür.
»Guten Abend, Chris«, erwiderte Gleeson nüchtern und stieg ein. »Wir fahren heute nicht direkt nach Hause. Bringen Sie mich bitte vorher noch zu Paddy’s.«
»Sehr gerne, Sir. Gibt es wieder etwas zu feiern, wenn ich fragen darf?«
»Allerdings, Chris«, bestätigte Gleeson mit versteinerter Miene. »Allerdings.«
Bereits wenige Minuten später fuhren sie in Richtung Upper East Side. Gleeson zückte sein Telefon und informierte seine Frau kurz darüber, dass sie mit dem Essen nicht auf ihn warten sollte. Er beendete das Gespräch auf die gleiche Weise, wie er es bei seinen Mitarbeitern tat: ohne Verabschiedung oder Worte des Grußes, sondern indem er einfach auflegte. Anschließend betätigte er den Knopf an der Tür, wartete bis die getönte Trennscheibe zum vorderen Teil des Fahrzeugs heruntergefahren war und suchte im Rückspiegel Augenkontakt zu seinem Fahrer.
»Fahren Sie mich bitte zum Hintereingang des Paddy’s, Chris.«
»Sehr wohl, Sir.«
Gleeson wollte gerade wieder die Trennscheibe hochfahren, als er sich spontan dazu entschloss, entgegen seiner Gewohnheit an diesem Abend mehr als nur ein Bier zu trinken. Diesen Luxus gönnte er sich nur alle paar Monate.
»Und Sie können sich anschließend den restlichen Abend frei nehmen, Chris«, rief er in die Fahrerkabine. Danach schloss er die Trennscheibe schnell wieder, so dass er das anbiedernde Dankeschön seines Angestellten kaum noch hörte und nur mit einem mürrischen Kopfnicken quittierte. Gleesons Leben war seit jeher gekennzeichnet von höchster Disziplin. Sowohl im Privat- als auch im Berufsleben. Wohl auch deshalb hatte er es mit gerade mal 50 Jahren in den Olymp der Geschäftswelt geschafft und wurde bereits von diversen namhaften Wirtschaftsmagazinen und -verbänden zum »CEO des Jahres« gewählt.
Sein Tagesablauf war immer klar strukturiert, und Gleeson hasste es, wenn er davon abweichen musste. Jeden Morgen stand er um fünf Uhr auf, um in seinem eigenen Fitnessraum seine Übungen zu absolvieren. Auch an Wochenenden. Weniger als sechs Stunden Schlaf zu bekommen, vermied er ebenso konsequent. Er verzichtete auch trotz seiner einnehmenden Beschäftigung nie auf eine ausgewogene Mahlzeit. Selbst zu offiziellen Anlässen, die er mehr hasste als alles andere, trank er keinen Alkohol. Nur einmal im Jahr, am Neujahrstag, gönnte er sich eine sündhaft teure Zigarre und an Tagen wie diesem ein Bier. Denn wenige Stunden zuvor hatte ihm sein Finanzchef die Quartalsergebnisse der Gleeson Transnational vorgelegt. Wieder einmal hatte Gleeson mit gierigem Blick das Zahlenwerk studiert und einen erneuten Umsatzrekord zur Kenntnis genommen. Die Umsatzprognosen für das Jahr ließen ihn hoffen, die 20-Milliarden-Dollar-Marke zu knacken. Und dabei würden vermutlich knapp zwei Milliarden Gewinn übrig bleiben, von dem ein nicht unbeträchtlicher Teil Gleeson selbst zustehen würde. Diese beruflichen Erfolge pflegte Gleeson fast ausnahmslos allein zu feiern. Er war grundsätzlich kein sehr sozialverträglicher Charakter und sprach außerhalb seiner Arbeit ohnehin nur ungern mit anderen Menschen. Und so zog es ihn, wie seit vielen Jahren schon, auch dieses Mal zum Feiern in Paddy’s Ale House.
Eine halbe Stunde später bemerkte Gleeson, dass der Wagen verlangsamte und in eine schmale Gasse einbog. Er blickte aus dem Seitenfenster heraus und erkannte wenige Meter hinter ein paar überfüllten Mülltonen den rückwärtigen Eingang des irischen Pubs. Gleeson freute sich schon auf den Abend und öffnete zeitgleich mit seinem Fahrer die Tür.
»Machen Sie sich keine Mühe, Chris«, sagte er eilig und erntete einen überraschten Gesichtsausdruck von seinem Fahrer, der wie angewurzelt neben der Fahrertür stehen geblieben war. »Ich komm schon zurecht.«
»Wie Sie wünschen, Sir. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.«
Gleeson hob zur Verabschiedung wortlos seine Hand und machte sich auf den Weg zur Eingangstür. Kaum dass er die schwere Metalltür geöffnet hatte, strömte ihm der typische Essensduft des Paddy’s aus der an der Gaststube angrenzenden Küche entgegen. Auch diesen Duft, der in Gleeson stets aufs Neue Kindheitserinnerungen weckte, sog er tief in seine Lungen ein. Die tiefe Verbundenheit zur Heimat seiner Vorfahren war abgesehen von seinem Aussehen das einzig typisch Irische an ihm. Und nur hier im Paddy’s ließ der schwerreiche Topmanager ein kleines bisschen Menschlichkeit durchscheinen.
»Conor!«, hallte es ihm im gleichen Augenblick entgegen. »Was für eine schöne Überraschung.«
Gleeson lächelte unweigerlich, als er den Besitzer und Namensgeber der Bar aus dem Gästebereich auf sich zukommen sah.
»Hallo Paddy«, sagte Gleeson strahlend. »Ich hoffe, du hast wieder ein kleines Plätzchen für mich, obwohl ich nicht reserviert habe.«
»Für dich doch immer«, gab ihm Patrick O’Kelly zur Antwort. »Willst du heute vorne sitzen – oder doch lieber in der Küche?«
»Die Küche wäre großartig, wenn ich euch nicht störe.«
»Unsinn. Du störst nie. Du kommst viel zu selten.«
Gleeson hob entschuldigend die Arme, und umarmte gleich darauf seinen Gastgeber freundschaftlich. Jeder, der mit Gleeson nur geschäftlichen Kontakt pflegte, hätte in diesem Moment geglaubt, einen anderen Menschen vor sich zu haben. Das freundliche Wesen, das Gleeson in diesem Lokal an den Tag legte, hätte nicht weiter entfernt sein können von seiner bei Konkurrenten und Mitarbeitern gefürchteten Totschlägermentalität, die ihn im Job auszeichnete. Profitmaximierung war im Beruf seine oberste Maxime. Und dieser folgte er erbarmungslos und ohne jegliche moralische Skrupel.
»Komm mit«, sagte O’Kelly und wies Gleeson den Weg.
Wenige Minuten später saß Gleeson bereits in der kleinen Küche an einem eigens für ihn aufgestellten Tisch und nahm einen großen Schluck von seinem ersten Pint Guinness. Entspannt betrachtete er das hektische Treiben der beiden jungen Köche, die sich von seiner Anwesenheit nicht stören ließen und munter schlüpfrige Witze austauschten. Gleeson hatte in den vergangenen Jahrzehnten schon so oft in der Küche gegessen, dass er beinahe schon zum Inventar gehörte.
»Also, Conor«, sagte O’Kelly, als er in die Küche kam. »Was darf ich dir heute bringen?«
Gleeson lachte entgegen seiner sonstigen Art laut auf. »Was meinst du wohl, was ich will?«, fragte er.
O’Kelly erwiderte das Lächeln und drehte sich dann zu seinen Köchen um. »Also Jungs, einmal Paddy’s Shepherd’s Pie für unseren Ehrengast.«
Anschließend wandte er sich wieder Gleeson zu. »Willst du denn nicht einmal was anderes von der Karte probieren?«, fragte er mit gespielter Entrüstung.
»Tut mir leid, Paddy. Aber nichts könnte besser sein als dein Shepherd’s Pie.«
O’Kelly lachte. »Da hast du recht, Conor. Und wer was anderes behauptet, ist hier nicht willkommen.«
Anschließend klopfte er Gleeson auf die Schulter und eilte geschäftig in den Barraum zurück, aus dem laute irische Musik in die Küche drang.
Zwei Stunden und zwei Pints später klopfte Gleeson dreimal auf die Tischplatte, stand auf und steckte den beiden Köchen ein großzügiges Trinkgeld zu.
»Vielen Dank für das Essen. Es war mal wieder ein Genuss für mich.«
»Danke, Conor. Immer wieder gerne«, sagten die beiden Iren wie aus einem Mund und widmeten sich dann wieder ihren dampfenden Pfannen und Töpfen.
Nachdem Gleeson sein Jackett angezogen und sich herzlich von O’Kelly verabschiedet hatte, verließ er das Paddy’s erneut über den Hinterausgang. Als er im Freien tief einatmete, bemerkte er, dass er vom Guinness schon etwas wacklig auf den Beinen war. Langsam ging er durch die schmale Gasse in Richtung Straße und pfiff gut gelaunt die Melodie von Seven Drunken Nights. Er war nur noch wenige Schritte von der Straße entfernt, als er auf seine Uhr schaute. Gleeson hoffte, dass er zu dieser Stunde nicht allzu lange auf ein Taxi würde warten müssen. Im gleichen Augenblick schoss ein schwarzer Van in die Einfahrt der Gasse und bremste mit quietschenden Reifen ab. Gleeson wusste gar nicht, wie ihm geschah, als im selben Moment bereits die Seitentür des Lieferwagens aufgeschoben wurde. Zwei mit Skimasken vermummte Männer stürzten aus dem Wagen heraus, griffen sich Gleeson und stülpten ihm einen Jutesack über den Kopf. Gleeson versuchte sich zu wehren, aber er war zu betrunken, um sich aus dem Griff der beiden Angreifer zu befreien. Angsterfüllt wollte er gerade zu einem Hilfeschrei ansetzen, als er auch schon unsanft in den Van gehievt wurde und wenig später auf dem kalten Fahrzeugboden lag. Sekundenbruchteile danach hörte er von Panik ergriffen bereits, wie die Tür des Fahrzeugs zugeworfen wurde und sie mit durchdrehenden Reifen davonfuhren.
Kapitel 2
New York,Gegenwart
Jason Bradley saß in der ersten Stuhlreihe der Low Memorial Library und schaute sich zu Beginn der feierlichen Zeremonie im weiten Rund des Verwaltungszentrums der Columbia University um. Hinter ihm waren die Stuhlreihen bereits ausnahmslos mit Familienangehörigen und Freunden der Preisträger gefüllt. Erwartungsvoll und freudig erregt, blickten alle Zuschauer zum weitläufigen Podest, auf dem die letzten Vorbereitungen für die Preisverleihung abgeschlossen wurden. Der Universitätspräsident trat hinter das hölzerne Rednerpult, auf dessen Frontseite der Name der ehrwürdigen Institution eingraviert war, und begann mit seiner Begrüßungsansprache.
Bradleys Blick wanderte hoch zur über 30 Meter über ihm aufragenden Rundkuppel. Gerade an ihr konnte man gut erahnen, dass sich die Architekten der ehemaligen Bibliothek von der Architektur der Antike hatten inspirieren lassen. Bradley musste unweigerlich an das Pantheon in Rom denken, das augenscheinlich als Vorbild für das neoklassizistische Gebäude gedient hatte. An den Seiten der Rotunde säumten insgesamt 16 Säulen aus irischem grünem Marmor den großen Zeremoniensaal. Jeweils vier der Säulen stützten hoch über dem Boden angebrachte Podeste. Auf dem Podest der Nordseite waren vier Statuen angebracht, die auf die anwesenden Besucher hinabzuschauen schienen. Es waren Bildnisse der griechischen und römischen Philosophen Demosthenes, Euripides, Sophokles und Augustus Caesar. Als Grundriss der Low Memorial Library diente den Erbauern die Form eines griechischen Kreuzes, bei dem alle Kreuzarme gleich lang waren. Bradley entdeckte hoch über sich jeweils einen sogenannten »Punkt des Wissens«, der die vier Kreuzenden markierte. Sie repräsentierten die Wissensgebiete Recht, Philosophie, Medizin und Theologie.
Nervös spielte er mit dem unteren Ende seiner Krawatte und wippte mit dem Fuß auf und ab, während er sich auf die Rede des Universitätspräsidenten zu diesem alljährlich stattfindenden Anlass zu konzentrieren versuchte. Gerade mal in den Mittvierzigern, sollte dieser Tag die Krönung seiner bisherigen journalistischen Karriere werden, und beinahe alle Menschen, die ihm etwas bedeuteten, waren zugegen. Bradley blickte zu seiner Linken und betrachtete die gut gelaunten Gesichter seiner Begleiter. Seine Exfrau Natalie mit ihren beiden Kindern, die unruhig auf den Stühlen hin und her rutschten. Sein ehemaliger Boss und Chefredakteur bei der New York Times, Richard Hutton, und dessen Assistentin Rose Patrick, die jeden immer nur »Schätzchen« nannte. Und Michael Robards. Mit ihm verband ihn seit den dramatischen Ereignissen, die sich erst wenige Jahre zuvor zugetragen hatten, eine enge Freundschaft. Dennoch wurde Bradley wehmütig, als er jenen Sommer im Jahr 2011 Revue passieren ließ. Nichts war mehr so wie zuvor. Für keinen der Beteiligten.
So viel Gewalt, dachte er und rieb sich mit der Hand über seine rechte Schulter. Die Schussverletzung war längst verheilt, aber hin und wieder bildete er sich ein, doch noch Schmerzen zu spüren. Es war nicht das einzige Mal gewesen, dass Bradley seinerzeit mit dem Tod konfrontiert worden war.
Dabei hatte er noch Glück gehabt. Anderen war während seiner Recherchen in Geheimdienstkreisen weitaus Schlimmeres widerfahren. Ganz zu schweigen von all den Toten, die auf das Konto der Verschwörer gingen, denen Bradley mit Hilfe seiner Freunde auf die Schliche gekommen war. Bei diesem Gedanken wanderte Bradleys Blick zu Michael Robards. Ihm hatten die dramatischen Geschehnisse zweifelsohne am übelsten mitgespielt. Und Bradley bewunderte Robards dafür, wie souverän und demütig zugleich der Millionärssohn mit all seinen Schicksalsschlägen umging. Ohne Frage hätte es eine Vielzahl an Menschen gegeben, die an den einschneidenden Erlebnissen zerbrochen wären. Was hatte dieser junge Mann nur alles verkraften müssen!, dachte Bradley.
Dass Bradley an diesem Mittag hier saß, war ebenfalls eine Folge dieser schrecklichen Wochen, die sie gemeinsam durchlebt hatten. Hutton hatte ihn ausdauernd darum gebeten, zur Times zurückzukehren. Ebenso hartnäckig, wenn auch durchaus dankbar, hatte Bradley jedoch immer wieder abgelehnt. Schließlich hatten sie sich auf einen Kompromiss geeinigt, und Bradley hatte seine Enthüllungsgeschichte in Form einer wöchentlichen Artikelreihe als freier Journalist für die bedeutendste Tageszeitung der Stadt verfasst. Nur aus diesem Grund saßen sie heute hier. Um ihn zu feiern.
Im vergangenen Monat, seit er wusste, dass er den Preis erhalten würde, hatte Bradley viel Zeit damit verbracht, über die Vergangenheit nachzudenken. Der Preis, den sie für die Wahrheit hatten zahlen müssen, war sehr hoch gewesen. Zu hoch, wie Bradley meinte. Erneut sah er seine sechs Begleiter reihum an. Sie alle beobachteten, wie nach und nach die ersten Preisträger der insgesamt 17 Kategorien nach vorne gingen und unter Applaus ihre Preise entgegennahmen.
Beim Anblick seiner Familie und Freunde legte sich Bradleys anfängliche Aufregung. Er genoss es, seinen größten beruflichen Erfolg mit ihnen teilen zu können. Besonderes Glück schenkte ihm die Tatsache, dass Natalie und die Kinder dabei waren. Das Verhältnis zu seiner Exfrau war nach der Scheidung, die nun bereits mehr als zehn Jahre zurücklag, alles andere als freundschaftlich gewesen. Das hatte sich inzwischen jedoch grundlegend geändert. Seitdem Bradley sein zeitweise aus den Fugen geratenes Leben wieder in den Griff bekommen hatte, hatten Natalie und er es geschafft, wieder vertrauensvoll miteinander umzugehen. Das war eine der wenigen positiven Entwicklungen, die die turbulenten Geschehnisse von damals mit sich gebracht hatten. Eine Renaissance ihrer Liebe würde es jedoch nicht geben. Im Gegenteil. Natalie hatte sich erst wenige Monate zuvor neu verlobt. Bradley freute sich für sie. Er mochte ihren neuen Partner Thomas. Sehr sogar. Und, was noch wichtiger war, seine Kinder auch, was Bradley eifersuchtsfrei akzeptieren konnte.
»Jason«, flüsterte Natalie fordernd und stieß ihm dabei sanft mit dem Ellenbogen in die Seite.
Bradley löste sich irritiert aus seiner Gedankenwelt und blickte seine Exfrau fragend an.
»Träumst du etwa?«, fragte sie schmunzelnd. »Deine Kategorie ist jetzt dran.«
Bradley schaute überrascht zum Podium. Der Präsident der Universität begab sich gerade wieder ans Rednerpult.
»Der Preis in der Kategorie ›Investigativer Journalismus‹ geht in diesem Jahr an Jason Bradley. Seine in der New York Times erschienene Reihe Die Janus-Protokolle hat der Weltöffentlichkeit auf außergewöhnliche Art und Weise die undurchsichtigen Verstrickungen amerikanischer Geheimdienste in großen Unternehmen des digitalen Zeitalters nähergebracht und somit einen wichtigen Beitrag zu Themen wie Datenmissbrauch und Eingriff in die Privatsphäre jedes einzelnen Bürgers durch staatliche Behörden geleistet.«
Bradley schenkte Natalie ein dankbares Lächeln und eilte leichtfüßig zum Podium, um unter tosendem Beifall der anwesenden Zuschauer seinen Pulitzer-Preis entgegen zu nehmen.
Kapitel 3
Istanbul, einige Monate zuvor
Er war überrascht, wie klein das Ladengeschäft im Istanbuler Stadtteil Bebek war. Die kunstvoll verzierte Holzoptik der Schaufensterfassade hob sich deutlich vom restlichen Gebäude und den Nachbarhäusern ab. Über der Fensterfront stand in großen weißen Lettern der Name des Spezialitätenshops. Meshur Bebek Badem Ezmesi. Während er durch die schmale Eingangstür eintrat, musste er über eine gescheckte Katze steigen, die sich von der Mittagshitze und dem hektischen Hin und Her der türkischen Millionenmetropole nicht stören zu lassen schien und friedlich schlief.
Das Ladeninnere war relativ dunkel. Auf dem kleinen Tisch gleich hinter dem Eingang stand ein billiger Aschenbecher, aus dem der Rauch einer Zigarette einsam nach oben stieg. Der Verkaufstresen auf der rechten Seite des Ladens war höchstens einen Meter breit und wie die Außenfassade aus dunklem Holz gezimmert. In den dahinter angebrachten Verkaufsregalen entdeckte er die in edlem Schwarz gehaltenen Verkaufsschachteln, in die die berühmten Mandelspezialitäten verpackt waren.
Im diesem Moment kam eine junge Verkäuferin aus dem hinteren Teil des Ladens und begrüßte ihn freundlich. Er erwiderte er die Begrüßung ebenso freundlich und erkundigte sich anschließend nach dem Mann, den er suchte. Er hatte ihn noch nie persönlich getroffen. Wie der Mann aussah, wusste er nicht. Niemand wusste das. Auch den echten Namen des Mannes kannte er nicht. Es hieß, dass er sich selbst Den Schweizer nannte. Und unter diesem Pseudonym wurde er auch auf allen Erdteilen der Welt von Ermittlungsbehörden geführt, die seit Jahren vergeblich nach ihm fahndeten. Viel Hoffnung, dass ausgerechnet er ihn hier finden würde, hatte er nicht. Aber es war seine einzige Spur. Und er wollte sie nicht ungenutzt lassen. Die nette Verkäuferin konnte ihm allerdings nicht weiterhelfen und bot ihm stattdessen eine Kostprobe ihrer an Marzipan erinnernden Köstlichkeiten an. Um nicht unhöflich zu sein, probierte er ein pralinengroßes Stück der Süßigkeit und bedankte sich, bevor er das Geschäft wieder verließ.
Einen wirklichen Plan, wie er weiter vorgehen sollte, hatte er nicht. Es war die sprichwörtliche Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Also begann er die Bars und Restaurants in den benachbarten Straßen abzuklappern und sich nach dem Mann durchzufragen. Nach weiteren drei Stunden gab er die Suche entnervt auf und schlenderte verschwitzt und durstig zum angrenzenden Bosporus.
Direkt neben einem Fähranleger entdeckte er ein kleines Café mit Blick auf die Meerenge, die den europäischen Teil Istanbuls vom asiatischen trennte. Er bestellte sich einen Salat und ein großes Glas Cola, um sich gleich darauf zum ersten Mal der Schönheit dieses Ortes bewusst zu werden. Die Aussicht auf den Bosporus, auf die Schiffe und Tanker, die sich ihren Weg durch die Wasserstraße bahnten, und die Jachten, die in der kleinen Bucht vor dem Café vor Anker lagen, war atemberaubend. Es wunderte ihn nicht, dass Bebek zu den wohlhabendsten Stadtteilen Istanbuls gehörte und die höchsten Quadratmeterpreise für Immobilien der boomenden Metropole aufwies. Auf der linken Seite des Cafés erspähte er eine kleine Moschee. Auf der anderen Seite einen weiteren im Jugendstil gehaltenen Prachtbau. Ein paar Kinder spielten auf der vorgelagerten Uferpromenade Fußball und übertönten mit ihrem Torjubel immer wieder das Plätschern der Wellen, die auf die Kaimauer trafen.
Wenig später, nachdem er sein eiskaltes Getränk fast in einem Zug geleert hatte, fühlte er sich bereits wieder etwas frischer. Sein Blick war starr auf die kurz aufblitzenden Lichtreflexionen gerichtet, die die Sonne auf den kleinen Wellen der berühmten Wasserstraße erzeugte. Es war heiß an diesem Tag, und er fächelte sich mit der kleinen Speisekarte ununterbrochen Luft zu. Wie unter Hypnose dachte er wieder an den eigentlichen Zweck seines Türkei-Besuchs.
Ihm blieb nur wenig Zeit, den Mann in Istanbul doch noch zu finden. Nur noch ein Tag, dann musste er wieder zurück nach Rom. Es war nahezu aussichtslos. Schließlich wusste er nicht einmal, ob sich der Mann tatsächlich hier aufhielt. Ja, nicht mal, ob der Mann noch lebte. Er rief sich das erste und einzige Mal, dass er vom Schweizer gehört hatte, wieder in Erinnerung. Über drei Jahre lag dieser Abend nun schon zurück, an dem er Stephen Palmer begegnet war.
Sein Beruf brachte es mit sich, dass er immer wieder auch in Gebiete reisen musste, in denen die Sicherheitslage für Ausländer kritisch war. Und aus diesem Grund war es durchaus üblich, dass sich westliche Besucher in einer überschaubaren Anzahl von Hotels einquartierten, die als vermeintlich sicher galten. So auch an jenem Abend in Bagdad, als er sich nach dem Abendessen mit Kollegen noch ein Bier an der Hotelbar hatte gönnen wollen. Palmer musste seinem redseligen Zustand nach zu urteilen bereits länger an der Bar gesessen haben. Sie kamen beide recht schnell ins Gespräch. Wäre ihm nicht langweilig gewesen, hätte er sich nach dem ersten Bier bereits verabschiedet. Er hatte sofort erkannt, dass Palmer ein Großmaul war. Ein Aufschneider, dessen detailreich ausgeschmückten Geschichten wahrscheinlich noch nicht mal zur Hälfte der Wahrheit entsprachen. Aber obwohl er Palmer nicht alles geglaubt hatte, hatte er sich doch an dessen kurzweiligem Erzählstil erfreut. Der schwer übergewichtige Texaner hatte ihm erzählt, dass er in früheren Jahren auch für das FBI gearbeitet hätte. Inzwischen jedoch sei er freiberuflich in der Welt unterwegs. Er hatte behauptet, als Berater für Familien von Entführungsopfern tätig zu sein. Und natürlich würde er damit ein Vermögen verdienen und nur ganz selten würde einer seiner »Kunden« nicht lebend zurückkehren. Er konnte sich noch gut daran erinnern, wie Palmer letztere Bemerkung mit einem zynischen Lächeln quittiert hatte. Im Verlauf des weiteren Abends hatte Palmer ihm eine abenteuerliche Geschichte nach der anderen aufgetischt.
Entführungsfälle. Frauengeschichten. FBI-Einsätze. Den meisten dieser durchaus spannenden Anekdoten hatte er keinen Wahrheitsgehalt beigemessen. Einer jedoch schon. Und zwar allein deshalb, weil Palmer eingestanden hatte, diesen einen Fall nie aufgeklärt zu haben. Demnach wurde eine ganze Reihe von ungeklärten Entführungen, mit denen sich auch das FBI beschäftigte, einem einzigen Mann zugeschrieben: dem Schweizer.
Keine Polizeibehörde hatte laut Palmer nur den Hauch einer Ahnung, wer der Schweizer wirklich war. Seine Opfer waren vor allem vermögende Unternehmer, die auf der ganzen Welt verstreut ihre Millionen scheffelten. Palmer hatte ihm berichtet, dass der Schweizer immer erfolgreich gewesen sei und stets seine Opfer unversehrt wieder freigelassen hätte. Selbstverständlich erst, nachdem er eine stattliche Summe an Lösegeld erhalten hatte. Beinahe bewundernd hatte Palmer von einigen der Entführungsfälle des Schweizers gesprochen. Als würde er ihn für eine Art genialen Superverbrecher halten. Es war bereits kurz vor Mitternacht gewesen, als Palmer ihm erzählt hatte, dass natürlich er derjenige gewesen wäre, der die heißeste Spur zum Schweizer verfolgt hätte. Die heißeste und einzige Spur. Die Spur, die auch ihn an diesem Tag nach Istanbul geführt hatte.
Demnach hatten zwei unabhängig voneinander entführte Opfer des Schweizers bei der späteren polizeilichen Vernehmung ähnliche Beobachtungen zu Protokoll gegeben. Sie hätten beide an den Orten, an denen sie während ihrer Entführung festgehalten worden waren, Pralinenschachteln mit dem gleichen Schriftzug gesehen. Wie spätere Ermittlungen ergeben hatten, war sich eines der beiden Entführungsopfer sicher, dass es eben der gleiche Schriftzug war, der über dem kleinen Spezialitätenshop zu lesen stand: Meshur Bebek Badem Ezmesi.
Auch Palmers Kollegen hätten sich seinerzeit hier in Bebek nach dem Schweizer erkundigt, die Suche aber nach kurzer Zeit als wenig erfolgversprechend beendet.
Wenige Wochen zuvor hatte er sich wieder an dieses Gespräch mit Palmer in Bagdad erinnert. Es war zu der Zeit gewesen, als er sich dazu entschieden hatte, seinen Plan in die Tat umzusetzen. Dass die Spur nach Bebek mehr als dünn war, war ihm bewusst. Aber er hatte keine Wahl. Also hatte er die alte Visitenkarte, die ihm Stephen Palmer seinerzeit stark angetrunken zum Abschied an der Hotelbar gegeben hatte, wieder aus seinen Unterlagen rausgekramt und ihn angerufen. Unter dem Vorwand, ein typisch türkisches Geschenk in Istanbul besorgen zu wollen, hatte er Palmer nach dem Namen des Süßwarenladens gefragt und bereitwillig Auskunft erhalten. Zur Verabschiedung hatte Palmer ihn noch hörbar amüsiert gebeten, den Schweizer dingfest zu machen, falls er ihm zufällig über den Weg laufen sollte. Aber er hatte diese Bemerkung einfach ignoriert und aufgelegt.
Als der Kellner des Cafés mit einem vollgepackten Tablett an seinem Tisch vorbeisauste, bat er ihn mit Handzeichen darum, zahlen zu dürfen. Während der junge Türke die Rechnung zusammenschrieb, dachte er, dass er nichts zu verlieren hätte, wenn er auch ihn nach dem Schweizer fragte.
»Schweizer?«, entgegnete der unrasierte junge Kellner und blickte grinsend auf ihn hinab. »Gute Schokolade. Sehr gute«, fuhr er fort und überreichte ihm die Rechnung.
»Ja, ja, gute Schokolade«, sagte er beiläufig und gab ihm zwei Scheine, auf denen das Antlitz des Republikgründers Atatürk abgedruckt war.
Auch wenn der wie auf Speed dauergrinsende Kellner wohl nicht verstand, was er ihm zu sagen versuchte, reichte er ihm seine Visitenkarte, auf der er zuvor den Namen seines Hotels vermerkt hatte. So wie er es in allen Lokalitäten im Umkreis von einem Kilometer in den vergangenen Stunden gemacht hatte.
»Falls Sie doch jemandem mit diesem Namen begegnen sollten, wäre es sehr nett, wenn Sie mich anrufen könnten«, sagte er, obwohl er sicher war, nie wieder von diesem Mann zu hören.
Der Kellner wedelte mit der Karte und grinste erneut. »Sehr gute Schokolade.«
»Ja, ja«, sagte er mit einer abwehrenden Handbewegung, schaute auf seine blaue Uhr und verließ kurz darauf das Lokal.
***
Er war gerade an der kleinen Moschee um die Ecke gebogen und aus dem Blickfeld des Kellners verschwunden, als dieser bereits sein Mobiltelefon aus der Hosentasche gefischt hatte und eine Nummer wählte.
»Ich bin’s. Emre. Jemand war gerade hier und hat nach dir gefragt … Nein, keine Polizei, glaube ich. Sah eher nach einem Amateur aus.«
Anschließend lauschte der junge Türke aufmerksam in sein Telefon. Er blickte gleichzeitig hinüber zu der acht Meter messenden Jacht, die wenige Meter vor dem Café im leichten Wellenspiel des Bosporus auf und ab wippte. Als der dunkelhäutige, hochgewachsene Mann mit dem Telefon am Ohr aus dem Inneren der Jacht an Deck kam, winkte er ihm zu.
»In Ordnung. Ich komme gleich rüber.«
Kapitel 4
New York, Gegenwart
»Noch ein Glas Champagner, Schätzchen?«
Bradley drehte sich nach Rose Patrick um, die ihm die dunkelgrüne Flasche zum Einschenken bereits entgegenhielt.
»Langsam, langsam«, erwiderte Bradley heiter.»Es ist gerade mal Nachmittag, Rose. Und ich will noch heil nach Hause kommen.«
Er mochte die beleibte Assistentin der Wirtschaftsredaktion der New York Times sehr. Als er fast 15 Jahre zuvor seinen Job bei der Times aufgenommen hatte, hatten sie sich auf Anhieb verstanden und waren immer noch freundschaftlich miteinander verbunden.
»Schätzchen«, fuhr Rose Patrick unbeirrt mit ihrer typischen Anrede fort, während sie Bradleys Glas eigenmächtig erneut mit dem edlen Getränk auffüllte.»Heute ist dein großer Tag. Und das wird gefeiert. Egal, ob du willst oder nicht. Also, mach dir mal keine Sorgen, wie du nach Hause kommst.«
Bradley lachte und beschloss, seiner resoluten Freundin nicht zu widersprechen. Anschließend hob er sein Glas und prostete ihr und seinen anderen Begleitern freudestrahlend zu.
Sie standen ganz oben auf den Stufen, die zur Low Memorial Library hinaufführten, und blickten auf den sonnendurchfluteten Morningside Heights Campus der Universität hinab. Hinter ihnen bildeten zehn hohe Säulen in ionischer Ordnung die Eingangsfassade des ehrwürdigen Gebäudes. Es war ein beliebter Treffpunkt unter Studenten, die auf den unzähligen Stufen saßen, diskutierten, auf ihre Smartphones starrten oder Bücher lasen.
Inzwischen hatte sich Richard Hutton zu Bradley gesellt, um ihm erneut zuzuprosten. Gleich danach legte der Chefredakteur ihm die Hand auf den Arm und nahm Bradley beiseite.
»Scheiße, Jason«, sagte Hutton.»Der verdammte Pulitzer!« Er lächelte ihm anerkennend zu.
Bradley amüsierte sich nach all den Jahren immer noch über die wenig gesellschaftsfähige Ausdrucksweise seines ehemaligen Vorgesetzten.
»Ich gratuliere dir, Jason«, sagte Hutton ruhig und legte ihm die Hand auf die Schulter.»Ganz ehrlich. Du hast ihn dir wahrlich verdient.«
»Danke, Richard«, entgegnete Bradley, vom Alkohol bereits beseelt.»Ohne eure Hilfe hätte ich das aber sicher nicht geschafft. Ganz sicher nicht einmal überlebt.«
Hutton schüttelte vehement den Kopf.»Nein, nein, Jason«, sagte er.»Natürlich hast du Hilfe gehabt. Scheiße, jeder braucht Hilfe. Aber die Wahrheit ist, dass du einfach ein verflucht guter Journalist bist. Vielleicht der beste, mit dem ich je zusammengearbeitet habe.«
Bradley lächelte verlegen, aber dankbar. Er schätzte Hutton sehr. Vor allem Huttons Gespür für gute Storys hatte bei ihm bereits als junger Journalist nachhaltig Eindruck hinterlassen.
»Danke, Richard. Es bedeutet mir viel, das von dir zu hören.«
Nach einem kurzen Moment des Schweigens, setzte Hutton erneut an.»Ich vermute, es macht nicht viel Sinn, dich noch mal zu fragen, ob du zu uns in die Redaktion zurückkommen willst?«
Bradley fühlte sich durchaus geehrt, dass Hutton ihn immer wieder förmlich bekniete, erneut für die Times zu arbeiten. Aber er wusste selbst noch nicht genau, welchen beruflichen Weg er in Zukunft einschlagen wollte. Und er wollte sich gegenüber Hutton nicht zu einer leichtfertigen Zusage hinreißen lassen, ohne sicher zu sein, ihn nicht nach einigen Monaten mit einer Kündigung zu enttäuschen.
»Ich weiß das wirklich zu schätzen, Richard. Aber da du mich schon so oft gefragt hast, macht es momentan leider gar keinen Sinn. Sei mir nicht böse. Ich muss erst mal selbst herausfinden, was ich eigentlich will.«
Hutton nickte verständnisvoll.
»Also gut, du Mistkerl«, sagte er schließlich.»Dann werde ich nicht weiter nerven. Die Tür steht dir auf alle Fälle jederzeit offen. Das weißt du ja. Aber glaube bloß nicht, dass du mehr Gehalt fordern kannst, nur weil du jetzt Pulitzer-Preisträger bist.«
»Guter Punkt«, erwiderte Bradley lauthals lachend.»Darauf bin ich noch gar nicht gekommen. Danke für den Tipp, Richard. Vielleicht erinnere ich dich doch noch mal daran.«
Anschließend tranken sie beide bei Smalltalk ihre Gläser aus und gesellten sich wieder zu den anderen.
Wenige Minuten später kam auch Michael Robards auf Bradley zu und reichte ihm sein Mobiltelefon.
»Hier«, sagte Robards geheimnisvoll.»Da will dir noch jemand gratulieren.«
Bradley nahm das Telefon zögerlich an sich und das Gespräch entgegen.
»Hallo?«
»Hi Jason«, tönte Bradley die vertraute Stimme aus dem Handy entgegen.
»Helen«, stieß Bradley überglücklich und einen Tick zu laut hervor. Robards schmunzelte ihm zu und begab sich wieder zu den anderen Feiernden.
Als Bradley kurz zuvor seinen Pulitzer-Preis in Empfang genommen hatte, war er selbst überrascht gewesen, dass der erste Mensch, an den er gedacht hatte, nicht einer seiner anwesenden Freunde gewesen war. Nicht Hutton oder Rose Patrick. Nicht Michael Robards und auch nicht seine Exfrau Natalie. Es war Helen Miller gewesen. Trotz seiner euphorischen Gemütslage, hatte es ihn ein wenig betrübt, dass sie nicht hatte dabei sein können.
»Ist die Überraschung gelungen?«, fragte Miller.
»Allerdings«, antwortete Bradley und bekam sein Dauergrinsen gar nicht mehr unter Kontrolle.»Wo treibst du dich gerade rum?«
»Ich bin in Rom. Tut mir leid, dass ich nicht mit dir feiern kann, aber ich wollte dir zumindest zu deiner Ehrung gratulieren.«
»Vielen Dank, Helen. Das ist wirklich lieb von dir. Und mach dir keinen Kopf deswegen. So bedeutend ist das Ganze nun auch wieder nicht.«
Bradley wunderte sich über sich selbst. Er war ganz plötzlich ungewöhnlich nervös.
»Wann sehen wir uns denn mal wieder?«, fragte Bradley.»Ist ja schon eine Ewigkeit her. Geht’s dir gut?«
»Alles bestens. Ja, ich würde euch auch alle gerne mal wieder treffen«, sagte Miller.»Aber mein Trip um die Welt ist gerade mal zur Hälfte um. Ein bisschen müsst ihr euch also noch gedulden.«
»Verstehe«, sagte Bradley und versuchte sich seine Enttäuschung nicht anmerken zu lassen.
»Also dann«, hörte er kurze Zeit später wieder die Stimme seiner jungen Freundin.»Feiert noch schön. Und in ein paar Monaten holen wir das dann gemeinsam nach.«
»Gerne. Wo reist du denn als Nächstes hin?«, fragte Bradley.
»Asien, glaube ich. Aber ich entscheide das spontan. Tut mir leid, Jason, aber ich muss jetzt los. Ich bin noch mit einem Freund verabredet.«
»Natürlich«, sagte Bradley und verabschiedete sich.
Ungläubig betrachtete er das Display des Mobiltelefons. Helen Miller hatte er ebenso wie Robards während der Jagd auf die Janus-Protokolle kennengelernt. Die junge Frau war schon Jahre zuvor den Verschwörern auf die Spur gekommen und nach einer schicksalhaften Begegnung hatten die drei sich verbündet. Trotz ihres Altersunterschieds von über 15 Jahren hatte der Sommer 2011 Bradley und Miller zusammengeschweißt. Sie waren seitdem Freunde. Sehr gute Freunde. Miller war ein Computergenie, eine Hackerin, die damals ebenfalls durch eine emotionale Hölle gegangen war, und sich im Anschluss für eine Weltreise entschieden hatte. Sie wollte Abstand von der Geschichte gewinnen und ihren Platz in der Welt finden, hatte sie Bradley erklärt.
Robards stand inzwischen wieder bei Bradley und nahm sein Telefon an sich.
»Das war Helen«, sagte Bradley immer noch sichtlich perplex.
»Ich weiß«, lächelte Robards.»Jetzt müssen wir aber los. Ich habe noch eine Überraschung für dich.«
»Was denn für eine Überraschung?«, fragte Bradley.
»Du wirst schon sehen.«
Robards grinste und nahm Bradley das leere Glas ab. Er reichte es Rose Patrick und winkte dann in die Runde.
»Also dann, Freunde«, sagte Robards.»Ich entführe Jason mal für ein paar Stunden.«
Bradley blickte verwirrt in die Gesichter seiner Freunde, die ihm allesamt zum Abschied zuprosteten und verschwörerisch zulächelten.
»Viel Spaß noch«, sagte Natalie und gab Bradley einen Kuss auf die Wange.»Wir sind wirklich sehr stolz auf dich, Jason.«
Bradley überlegte noch, was er seiner Exfrau erwidern sollte, als ihm Robards bereits den Arm um die Schulter legte und ihn sanft drängte, die Treppen hinunterzugehen.
»Komm schon«, sagte Robards.»Wir sind spät dran.«
»Wofür denn?«, fragte Bradley und blickte überrumpelt zurück zu seinen Begleitern, die ihm vom Eingang der ehemaligen Bibliothek aus zuwinkten. Robards grinste lediglich unaufhörlich vor sich hin.
»Sei nicht so neugierig«, sagte er.»Es wird dir schon gefallen. Vertrau mir!«
»Das hast du neulich auch gesagt«, entgegnete Bradley,»als du mich mit dieser Dame in der Bar verkuppeln wolltest.«
»Autsch«, sagte Robards und schüttelte amüsiert den Kopf.»Ja, das war blöd. Aber dieses Mal ist es was anderes. Versprochen.«
Bradley hatte Mühe, mit Robards zügigem Tempo mitzuhalten. Und der Champagner machte es nicht gerade einfacher. Als sie die Alma-Mater-Skulptur der Göttin Athena auf halber Höhe der Treppenstufen passierten, blieb Bradleys Blick kurz an der kleinen im ausufernden Gewand der griechischen Gottheit versteckten Bronze-Eule hängen. Die Eule war unter den Studenten eine wahre Berühmtheit. Ihr entsprangen auch verschiedenste abergläubische Theorien, die an der Universität kursierten. So sollte etwa der erste Student eines neuen Jahrgangs, der die Eule entdeckte, dazu auserwählt sein, die begehrte Abschlussrede an der Universität zu halten.
Während Bradley noch über die Eule schmunzelte, verlor er beinahe das Gleichgewicht und kam ins Straucheln. Robards reagierte geistesgegenwärtig und stütze seinen Freund.
»Vorsicht, Kumpel«, sagte Robards erleichtert.
Bradley nickte, nachdem er den ersten Schreck verwunden hatte.»Danke.«
Anschließend gab Robards wieder das Tempo vor und eilte mit Bradley weiter hinab. Unten angekommen bogen sie in Richtung des Haupteingangs der Columbia University nach rechts ab und erreichten wenig später den Broadway Ecke 116. Straße West. Bradley blieb abrupt stehen und starrte Robards an.
»Eine Limousine?«
»Na, ich kann einen Pulitzer-Preisträger ja schlecht mit dem Taxi durch Manhattan fahren lassen«, antwortete Robards, während ein in klassischer Chauffeuruniform gekleideter Mann die Tür öffnete.»Na, komm schon. Wir müssen uns wirklich sputen.«
Zögerlich ging Bradley auf die offene Fahrzeugtür zu, grüßte den freundlich lächelnden Fahrer und nahm auf der Rückbank der schwarzen Luxuslimousine Platz.
»Rutsch mal rüber«, sagte Robards und folgte Bradley ins Heck des Fahrzeugs.»Und das mit neulich tut mir wirklich leid«, ergänzte er verschmitzt.»Die Frau hat auf mich einen wirklich tugendhaften Eindruck gemacht.« Er versuchte, nicht zu lachen.
»Sie war eine Prostituierte«, sagte Bradley und musste dabei selbst lachen.
»Das war Julia Roberts in Pretty Woman auch«, sagte Robards.
»Aber Richard Gere musste sich nicht nach fünf Minuten die Preisliste für diverse sexuelle Praktiken anhören.«
Erneut verkniff sich Robards loszulachen.
»Aber du musst zugeben, dass die Preise fair waren«, sagte er.
»Haha. Du hast leicht reden. Du musstest das Missverständnis ja auch nicht inmitten einer vollbesetzten Bar aufklären und dich dann anschreien lassen, dass du ihre wertvolle Zeit verschwendet hättest.«
Die Erinnerung daran, wie Bradley von der Frau angefahren worden war, war zu viel für Robards. Er fing lauthals an zu lachen und wischte sich kurz darauf Tränen aus den Augen.
»Ich habe mich doch schon dafür entschuldigt«, sagte Robards, nachdem er sich wieder etwas beruhigt hatte.»Glaub mir. Heute wirst du deinen Spaß haben. Guten, sauberen Spaß«, ergänzte er noch und erntete daraufhin ein schwaches Lächeln von Bradley.
Im gleichen Moment setzte sich die Limousine in Bewegung. Robards beugte sich hinüber zu dem kleinen Kühlschrank schräg vor ihm und kramte zwei Bierdosen hervor.
»Hier«, sagte er und reichte Bradley ein Bier.»Ich dachte mir, dass du das hier dem Champagner vorziehen würdest.«
Bradley nahm die eisgekühlte Getränkedose entgegen, öffnete sie und prostete Robards zu.
»Das ist zumindest schon mal ein guter Anfang«, sagte er, nachdem er den ersten Schluck genommen hatte.
Die Limousine war in der Zwischenzeit auf den Henry Hudson Parkway abgebogen und fuhr nun entlang des Hudson Rivers in den südlichen Teil Manhattans. Wenige Augenblicke später unterhielten sich Bradley und Robards bereits so angeregt, dass sie den schwarzen Chrysler, der ihnen dicht folgte, nicht bemerkten.
Kapitel 5
Istanbul, einige Monate zuvor
»Und er hat wirklich nichts weiter gesagt?«, fragte Jacques Magras.
Der hochgewachsene Franzose stand an Deck seiner Jacht und betrachtete aufmerksam die Visitenkarte, die ihm sein junger türkischer Freund wenige Minuten zuvor ausgehändigt hatte.
»Nein. Er hat nur nach dem Schweizer gefragt«, sagte Emre Uzun ernst. »Und, dass ich mich bei ihm melden soll, wenn dieser mir begegnen würde.«
Magras starrte gedankenversunken weiter auf das Logo in der Ecke der Visitenkarte. Eine blaue Weizenähre, eingekreist von drei großen Buchstaben.
»Ich hab doch alles richtig gemacht, Jacques Abi, oder?«
Abi war die türkische Bezeichnung für einen älteren Bruder. Aber auch wenn die beiden augenscheinlich nicht miteinander verwandt waren, war es in der Türkei durchaus üblich, einem Älteren gegenüber diese Anrede zu verwenden.
Ohne seinen Kopf zu heben, blickte Magras kurz hoch und lächelte herzlich.
»Natürlich, mein Junge«, sagte er mit seiner tiefen Baritonstimme. »Das hast du sogar hervorragend gemacht.«
Anschließend ging Magras auf Uzun zu, legte seinen Arm um dessen Schulter und drückte ihn väterlich an sich. Natürlich wusste Uzun nicht, wer Jacques Magras wirklich war. Schon gar nicht, womit dieser sein stattliches Vermögen angehäuft hatte. Auch nicht, was sich hinter dem Pseudonym verbarg. Uzun hatte nichts mit Magras’ Arbeit zu tun. Uzun erledigte zwar in unregelmäßigen Abständen kleinere Botengänge für ihn, aber darüber hinaus hatten sie geschäftlich nichts miteinander zu tun. Magras mochte seinen jungen Freund einfach. Es war eine willkommene Abwechslung, mit dem lebensfrohen Türken über banale Alltäglichkeiten zu sprechen. Über Themen, die nicht über Leben und Tod entschieden. Ganz normale Sachen eben, die Magras kurzzeitig seinen Beruf vergessen ließen und ihm das Gefühl gaben, ein ganz normaler Mensch zu sein.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!