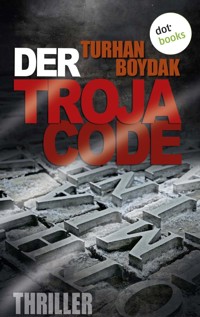Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Er sucht Antworten – und gerät in tödliche Gefahr: Der Thriller-Sammelband »Die Janus-Protokolle & Das Todesmemorandum« von Turhan Boydak als eBook bei dotbooks. Wie lange kann man auf Messers Schneide tanzen? Jason Bradley ist mehr als nur ein Journalist: Er ist ein Mann, der die Gefahr anzieht wie ein Magnet – und ein unerschrockener Ermittler, der sich jedem Risiko stellt. Doch nun geraten zwei seiner Freunde ins Fadenkreuz von Geheimdiensten und mächtigen Hintermännern, die skrupellos jeden aus dem Weg räumen, der ihnen im Weg steht. Aber welche Rolle spielen dabei ein geheimnisvoller Hacker, dessen Verschwörungstheorien im Internet immer wieder für Aufsehen sorgen, und eine rätselhafte Entführungsserie? Jason spürt, dass ihm nicht viel Zeit bleibt, um seine Freunde zu retten – denn auch sein Name scheint bereits auf einer Abschussliste zu stehen … Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der fesselnde Sammelband »Die Janus-Protokolle & Das Todesmemorandum« von Turhan Boydak. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1309
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Wie lange kann man auf Messers Schneide tanzen? Jason Bradley ist mehr als nur ein Journalist: Er ist ein Mann, der die Gefahr anzieht wie ein Magnet – und ein unerschrockener Ermittler, der sich jedem Risiko stellt. Doch nun geraten zwei seiner Freunde ins Fadenkreuz von Geheimdiensten und mächtigen Hintermännern, die skrupellos jeden aus dem Weg räumen, der ihnen im Weg steht. Aber welche Rolle spielen dabei ein geheimnisvoller Hacker, dessen Verschwörungstheorien im Internet immer wieder für Aufsehen sorgen, und eine rätselhafte Entführungsserie? Jason spürt, dass ihm nicht viel Zeit bleibt, um seine Freunde zu retten – denn auch sein Name scheint bereits auf einer Abschussliste zu stehen …
Über die Autorin:
Turhan Boydak, 1974 in Damme geboren, war nach seinem Studium in leitenden Funktionen bei verschiedenen namhaften eCommerce-Unternehmen tätig. Heute lebt und arbeitet er mit seiner Familie in München und Zürich als Buchautor und Angestellter der führenden Schweizer Top-Manager-Community.
Die Website des Autors: www.turhanboydak.de/autor
Der Autor im Internet: www.facebook.com/turhanboydak.de
Bei dotbooks erschien bereits Turhan Boydaks Thriller »Der Troja-Code«.
***
Sammelband-Originalausgabe Dezember 2021
Copyright © der Sammelband-Originalausgabe 2021 dotbooks GmbH, München
Copyright © der Originalausgabe von »Die Janus-Protokolle« 2014 dotbooks GmbH, München
Copyright © der Originalausgabe von »Das Todes-Memorandum« 2015 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: dotbooks GmbH, München
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ae)
ISBN 978-3-98690-979-6
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html (Versand zweimal im Monat – unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieses eBook gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Deception – Die Todesprotokolle« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Turhan Boydak
Die Janus-Protokolle & Das Todes-Memorandum
Zwei Thriller in einem eBook
dotbooks.
Die Janus-Protokolle
Nach dem vermeintlichen Unfalltod seines Freundes stößt der New Yorker Journalist Jason Bradley in dessen Hinterlassenschaften auf eine für ihn bestimmte Nachricht. Sie führt ihn zu einem von der Bundespolizei gesuchten Computerhacker, der unter dem Pseudonym Veritas Verschwörungstheorien im Internet veröffentlicht. Diesen Theorien zufolge arbeiten mehrere große Internet- und Softwareunternehmen mit den amerikanischen Nachrichtendiensten zusammen. Durch seine Nachforschungen gerät Bradley zunehmend ins Fadenkreuz amerikanischer Geheimdienste und muss schließlich sogar um sein Leben fürchten.
Prolog
4. Oktober 1957
»… o´er the land of the free
and the home of the brave?«
Der kleine Frank Junior hatte die letzte Zeile der amerikanischen Nationalhymne kaum zu Ende gesungen, als er schon ungeduldig zu seinem Vater aufblickte. Die zarten Finger seiner rechten Hand ruhten noch immer auf seiner Brust. Direkt über dem Herzen.
In den Tagen zuvor hatte er die Hymne auswendig gelernt und seiner Mutter vorgesungen. Er wollte seinem Vater an diesem Tag unbedingt eine Freude machen. Denn heute war ein ganz besonderer Tag für Frank Junior. Es war sein fünfter Geburtstag. Und sein Vater hatte ihm erzählt, dass auch er als kleiner Junge seinem eigenen Vater an Geburtstagen die Nationalhymne vorgesungen hatte.
Frank Junior hatte seinen Großvater nie kennengelernt. Er war im Kampf gegen die Japaner als Pilot der Air Force im Zweiten Weltkrieg irgendwo über dem Pazifik mit seiner Maschine abgestürzt.
Ein kühler Herbstwind wehte durch den kleinen Vorgarten im Washingtoner Vorort. Frank Junior stand zwischen seinen Eltern auf dem Rasen hinter dem kleinen Wohnhaus. Alle drei waren der amerikanischen Flagge zugewandt, die neben der Verandatür seines Elternhauses unruhig im Spiel der Windböen flatterte.
»Das hast du sehr schön gesungen«, sagte seine Mutter.
Sie beugte sich zu ihm hinunter und gab ihm einen sanften Kuss auf den Kopf.
Während sie sich wieder aufrichtete, schaute sie ihren Mann lächelnd an. Frank Miller lächelte müde zurück und nickte.
»Jetzt darfst du die Geschenke auspacken«, sagte er. Wie von der Tarantel gestochen sprintete Frank Junior zur Verandatür und rannte weiter zum Küchentisch.
Auf dem Tisch stand eine selbstgebackene Torte. Fünf Kerzen brannten darauf und umkreisten den Schriftzug aus Schokoguss: »Happy Birthday«.
Frank Miller nahm seine Frau in den Arm. Gemeinsam folgten sie ihrem Sohn ins Haus.
»Schön, dass du dir heute frei nehmen konntest«, sagte seine Frau und schmiegte sich an ihn.
Nachdem der vor Freude strahlende Junge die Kerzen ausgepustet hatte, machte er sich auch schon über die buntverpackten Geschenke auf dem Tisch her. Mit ungeschickten Handgriffen versuchte er das größte Geschenk als Erstes von dem dicken Geschenkpapier zu befreien.
Miller setzte sich ans Kopfende des kleinen Küchentischs und beobachtete amüsiert seinen Sohn, während seine Frau die Geburtstagstorte anschnitt.
»Wow«, entfuhr es Frank Junior.
Mit weit aufgerissenen Augen betrachtete er das Modellflugzeug in seinen Händen von allen Seiten. Dann rannte er zu seinem Vater und umarmte ihn ungestüm.
»Das ist eine Boeing B-52 Stratofortress«, sagte Miller. »Ich bin dieses Jahr auch schon mal auf einem Testflug mitgeflogen«, ergänzte er und erntete ein noch begeisterteres Lächeln auf dem Gesicht seines Sohnes.
Als sich Frank Junior kurz darauf gerade sein erstes Stück Kuchen in den Mund schieben wollte, wurde er vom schrillen Klingeln des Telefons unterbrochen.
»Das ist bestimmt Oma«, rief er freudig aus. »Ich geh ran.«
Frank Junior stürmte aus der Küche hinaus in den angrenzenden Flur, wo das schwarze Telefon auf der kleinen Kommode stand.
Miller blieb mit seiner Frau allein am Küchentisch zurück und trank seinen Kaffee.
»Du bist doch zum Abendessen da, oder?«, fragte seine Frau. »Heather und Bob kommen nachher noch vorbei.«
Miller nickte halbherzig. Er tat sich immer schwer, mit seiner Schwägerin und deren Mann einen ganzen Abend zu verbringen. Miller war noch nie der gesellige Typ gewesen. Und die Tatsache, dass er bei Familientreffen dieser Art als Einziger nicht über seine Arbeit sprechen durfte, limitierte zusätzlich die Themen, über die er sich mit anderen austauschen konnte. Das belastete vor allem seine Frau. Miller war sich dessen bewusst. Aber so war das nun mal, wenn man für die Regierung arbeitete. Und da außerhalb seiner einnehmenden Arbeit nur wenig Zeit für andere Bereiche des Lebens übrig blieb, stellte er sich wieder auf einen langweiligen Abend ein, an dem ihn Bob mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit stundenlang mit seinen Ansichten zu Baseball ermüden würde.
Am liebsten hätte er auf diese Treffen ganz verzichtet. Aber er ließ sie seiner Frau und seinem Sohn zuliebe hin und wieder über sich ergehen. Gemeinsame Stunden mit seiner Familie waren eher eine Seltenheit, und das schlechte Gewissen nagte an ihm.
»Dad, Onkel Pete ist am Telefon.«
Gedankenversunken schaute Miller zur Küchentür, wo sein Sohn im Türrahmen stand. Pete Hunter war sein Arbeitskollege und ein guter Freund von Miller. Eigentlich sein einziger Freund. Er arbeitete in Millers Abteilung und war auch oft Gast in seinem Haus.
Während Miller von seinem Platz aufstand, verharrte sein Blick für einen kurzen Moment auf dem flehenden Gesichtsausdruck seiner Frau.
»Vielleicht ist es nichts Wichtiges«, versuchte er seine Frau zu besänftigen.
Aber er wusste es besser. Pete Hunter war im Bilde, dass Millers Sohn heute Geburtstag hatte, und würde nicht wegen einer Nichtigkeit zu Hause anrufen. Offenbar dachte Millers Frau das Gleiche. Denn ihr gezwungenes Lächeln verriet, dass Millers Worte wirkungslos geblieben waren.
»Was gibt´s, Pete?«, fragte Miller, nachdem er den Telefonhörer in die Hand genommen hatte.
»Hallo, Frank«, ertönte die vertraute Stimme seines Freundes. »Tut mir leid, dass ich dich störe. Aber wir haben hier leider eine besondere Situation.«
Miller sah, dass sein Sohn immer noch im Türrahmen zwischen Küche und Flur stand und ihn beobachtete. Er presste die Lippen zusammen und versuchte sich ein Lächeln abzuringen. Dann aber wandte er seinem Sohn den Rücken zu, nahm seine Brille ab und setzte das Gespräch mit geschlossenen Augen fort. »Kein Problem. Schieß los.«
»Du hattest Recht, Frank. Die Sowjets haben nicht nur geblufft. Wir haben vorhin das Signal empfangen.«
Miller öffnete seine müden Augen wieder und seufzte kaum hörbar. »Wann?«, fragte er einsilbig.
»Vor einer knappen Stunde erst. Wir vermuten, dass die Sowjets ihn vor ein paar Stunden von Baikonur aus gestartet haben. In der kasachischen Steppe.«
Miller dachte kurz nach und sprach anschließend mit gedämpfter Stimme. »Ist es bereits an die Öffentlichkeit gedrungen?«
»Noch nicht. Aber das dürfte nicht mehr lange dauern. Darum werden auch gerade alle Abteilungen zusammengetrommelt. Deswegen rufe ich an.«
»Wann?«, fragte Miller und strich sich mit seiner freien Hand durchs kurzgeschorene Haar.
»Ich bin schon im Pentagon und habe dir bereits einen Wagen geschickt. Er müsste in etwa 15 Minuten bei dir sein.«
»Verstehe. Dann sehen wir uns gleich.«
»Tut mir leid. Ich meine, dass es ausgerechnet heute sein musste.«
»Mach dir keine Gedanken, Pete. Du kannst ja nichts dafür. Die Jungs im Kreml hatten noch nie ein Gespür für gutes Timing.«
Miller hörte seinen Freund am anderen Ende der Leitung kurz auflachen.
»Da hast du recht. Gib Frank Junior einen Kuss von mir und Helen natürlich auch.«
»Mach ich. Also dann, bis gleich.«
Nachdenklich legte Miller den Hörer zurück auf die Gabel. Im selben Moment spürte er hinter sich eine Bewegung. Im Türrahmen stand immer noch sein Sohn. Dahinter seine Frau. Ihre Hände ruhten auf den schmalen Schultern des kleinen Frank Junior. Miller bemerkte die Tränen in den Augen seines Sohnes. Er wollte gerade mit einer bedauernden Geste auf ihn zu gehen, als Frank Junior weinend die Treppe hochstürmte und kurz darauf die Tür seines Kinderzimmers zuknallte.
Miller löste seinen traurigen Blick von der leeren Treppe und sah zu seiner Frau. »Es tut mir leid«, sagte er, um Sachlichkeit bemüht. »Ich muss leider doch ins Büro.«
Helen Miller schüttelte unmerklich den Kopf. »Spar dir das für ihn«, sagte sie sichtlich verärgert und deutete ins obere Stockwerk, von wo das Schluchzen ihres Sohnes leise zu ihnen drang.
»Helen, es ist wirklich etwas Wichtiges passiert. Es tut mir leid, aber ich muss da hin.«
»Es passiert immer etwas Wichtiges, Frank.« Helen Millers Stimme zitterte deutlich vor Wut. Es entstand ein kurzer Moment des Schweigens, in dem sich beide nur hilflos anschauten. Dann schien Helen ihren Frust runterzuschlucken und ging auf ihren Mann zu.
»Mach schon, dass du rauskommst«, sagte sie verständnisvoll, wenn auch mit einem enttäuschten Unterton, gab Miller einen Kuss und richtete den Hemdkragen ihres Mannes. »Ich kümmere mich um ihn. Aber vergiss nicht, dass zu Hause auch etwas Wichtiges auf dich wartet.«
»Danke«, war das Einzige, was Miller seiner Frau entgegnen konnte. Sie lächelte ihm resigniert zu und ging langsam die Treppe hoch.
Wenige Minuten später, nachdem Miller ein Jackett angezogen, seinen Hut aufgesetzt und seine Aktentasche genommen hatte, stand er draußen vor der Eingangstür seines Hauses und zündete sich eine filterlose Zigarette an. Eines Tages wird er es hoffentlich verstehen, dachte er, während er den Rauch genüsslich in die Luft blies.
Miller dachte an seine Kindheit zurück, daran, dass auch sein Vater zu wenig Zeit für seine Familie gehabt hatte. Als kleiner Junge hatte er das auch noch nicht verstanden und war oft traurig gewesen. Sein Vater war Soldat bei der Air Force. Bis zum Eintritt der USA in den Zweiten Weltkrieg war Miller immer stolz auf den Beruf seines Vaters gewesen. Wie viele der anderen Nachbarskinder konnten schon damit angeben, dass ihr Vater Militärjets flog und das Vaterland verteidigte? Sein Vater war für Miller ein Held. Vor allem in seiner Kindheit.
Nach Ausbruch des Krieges aber hatte er seinen Vater immer seltener zu Gesicht bekommen. Ständig hatte dieser zu Übungen und Manövern gemusst. Schließlich auch nach Übersee, um gegen die Feinde der Freiheit, wie sein Vater ihm erklärt hatte, zu kämpfen. Er hatte sehr darunter gelitten. Vor allem auch, weil er bemerkt hatte, wie sehr seine Mutter die Abwesenheit des Vaters belastete – er hatte sie immer wieder weinen sehen. Sie hatte ihm wiederholt zu erklären versucht, dass sein Vater das für ihn mache. Damit er in einer freien, friedlichen Welt leben könne. Aber Miller konnte damals noch nicht verstehen, was seine Mutter damit meinte. Fast vier Jahre ging das so. Und sein Vater war in der ganzen Zeit nur noch dreimal bei ihnen zu Hause gewesen. Immer nur für wenige Tage.
Miller hatte in jenen Jahren versucht so viel wie möglich über den Verlauf des Krieges zu erfahren. Er wusste, dass viele amerikanische Soldaten gefallen waren. Dass aber auch sein Vater im Krieg ums Leben kommen könnte, dieser Gedanke war ihm in seiner jugendlichen Naivität nie in den Sinn gekommen. Bis zu dem Tag, an dem der Brief eintraf.
Miller hatte schon viele Briefe wie diesen gesehen. In der Nachbarschaft hatte es kaum eine Familie gegeben, die nicht mindestens einen Sohn oder Ehemann und Familienvater hatte, die in Europa, Afrika oder im Pazifik für ihr Vaterland kämpften. Einige von ihnen hatten dabei ihr Leben auf den weit entfernten Schlachtfeldern gelassen. In diesen Fällen kam ein Brief wie der, den seine Mutter an jenem Tag weinend in Händen gehalten hatte, als Miller aus der Schule kam.
Erst einige Jahre später war in Miller der Entschluss gereift, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten. Zumindest indirekt. Denn abgesehen von seiner extremen Kurzsichtigkeit, hatten die Ärzte bei seiner Musterung auch ein unheilbares Rückenleiden diagnostiziert, das zu einer zunehmenden Versteifung der Wirbelsäule führte. Zu diesem Zeitpunkt war er erst Ende 20, aber er hatte den Rücken eines 60-Jährigen. Somit war die Laufbahn eines Kampfpiloten für Frank Miller schon zu Ende gewesen, bevor er sie überhaupt in Angriff hatte nehmen können.
Da Miller aber schon immer zu den Jahrgangsbesten in der Schule gehört hatte, hatte ihm doch noch eine Möglichkeit offen gestanden, seinem Vaterland zu dienen. Auch wenn seine Front nur aus einem Schreibtisch und stickigen Büroräumen bestand.
Aus diesem Grund hatte er nach seinem Studienabschluss an der Elite-Universität Harvard beim Verteidigungsministerium angeheuert. Dort hatte man sehr schnell seine analytischen Fähigkeiten erkannt. Nach nur wenigen Monaten wurde er der NSA zugeteilt. Die National Security Agency, Amerikas wichtigster Militärnachrichtendienst, hatte den Auftrag, ausländische Nachrichtenverbindungen abzuhören.
Der Öffentlichkeit war von der NSA nicht viel bekannt. Restriktive PR lag in der Natur eines Nachrichtendienstes, bei dem sich alles um Geheimnisse drehte. Daher sprachen einige von Millers Kollegen auch scherzhaft von No Such Agency, wofür das Dreibuchstabenkürzel NSA stehen würde.
Miller leitete in der NSA einen kleinen Bereich aus der Sektion Ost-Europa. Dies war vor dem Hintergrund des angespannten Verhältnisses zwischen den beiden Supermächten USA und Sowjetunion eine der spannendsten Aufgaben innerhalb der Nachrichtendienste. Gleichzeitig aber auch eine der sensibelsten.
Im Wettstreit mit der Sowjetunion stand in den vergangenen beiden Jahren eine neue Disziplin ganz oben auf der Liste: der Wettlauf ins All. Bis zum heutigen Tag hatte aber kaum ein Amerikaner daran gezweifelt, dass die USA bei diesem Wettstreit als erster durchs Ziel gehen würden. Man sah sich technologisch weit voraus und konnte sich nicht vorstellen, dass die Sowjets auch nur den Hauch einer Chance hätten, den ersten Satelliten ins Weltall zu schicken. Schließlich konnte die Sowjetunion einen Großteil ihrer Bevölkerung nicht einmal mit moderner Alltagstechnik wie Fernsehgeräten, geschweige denn Automobilen versorgen. Miller war sich in diesem Punkt schon seit ein paar Monaten nicht mehr so sicher gewesen. Und seit wenigen Minuten gab es keine Zweifel mehr. Pete Hunter hatte es Miller soeben bestätigt. Die Sowjetunion hatte das Undenkbare wahr gemacht und diesen Wettstreit für sich entschieden. Sie hatten noch vor dem vermeintlichen Technologievorreiter USA den ersten Satelliten ins All befördert.
Miller beobachtete gedankenverloren den schwarzen Wagen, der vor seinem Haus zum Stehen kam. Wenige Stunden später saß er mit hochgekrempelten Hemdsärmeln in einem der zahlreichen, fensterlosen Besprechungsräume des Pentagons.
In den folgenden Stunden diskutierte ein Dutzend weiterer Mitarbeiter mit ihm über die aktuellen Entwicklungen. Im Minutentakt öffnete sich die Tür des Konferenzzimmers, und einer der Assistenten brachte Memos mit neuen Nachrichten herein. Hunter nahm die jüngste Meldung entgegen.
»Es ist raus«, sagte er ruhig.
Das Gesprächswirrwarr im Raum verstummte umgehend, und alle Blicke richteten sich auf ihn.
»Ein Heinz Kaminski hat die Funksignale des Satelliten abgefangen. Volkssternwarte Bochum. In Deutschland. Schon vor ein paar Stunden.«
Jedem war klar gewesen, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis der Satellitenstart der Sowjets publik würde. Dennoch schienen alle Anwesenden für einen kurzen Moment geschockt. Die betretene Stille hielt nur wenige Sekunden, bevor mit einem Schlag das laute Durcheinander von Diskussionen wieder einsetzte.
Miller und seine Kollegen hatten zuvor die Nachricht erhalten, dass der amerikanische Präsident Eisenhower ziemlich ungehalten war. Nicht nur, weil die Sowjets den Amerikanern zuvor gekommen waren. Sondern vor allem, weil die amerikanischen Geheimdienste allesamt vom Start des Satelliten überrascht worden waren.
Gegen Ende der Besprechung stellte ein Mitarbeiter ein Radio in der Ecke des Besprechungszimmers auf. Die gesamte Runde lauschte dem amerikanischen Sender NBC. Sie hörten sekundenlang das Funksignal des russischen Satelliten. Es waren nur kurze Pieptöne, die sich in einer endlosen Schleife wiederholten. Wie ein Herzschlag. Und doch klangen sie in Millers Ohren bedrohlich.
Im Morgengrauen schloss Miller die Tür seines Hauses auf und ließ seine Aktentasche erschöpft auf den Boden fallen. Da die Nacht schon fast vorbei war, entschloss er sich, gar nicht erst schlafen zu gehen. In der Küche stand ein Teller mit einem Stück der Geburtstagstorte seines Sohnes. Daneben ein von Kinderhand gemaltes Bild eines Flugzeugs. Und vier Wörter, die Miller den letzten Rest Müdigkeit raubten.
»Ich liebe dich, Dad.«
Miller lächelte wehmütig und fing an, langsam das Stück Torte zu essen. Wieder einmal hatte er den Geburtstag seines Sohnes verpasst. Miller ging raus auf die Veranda im Garten und zündete sich eine Zigarette an. Er hatte nicht gezählt, wie viele er während der Krisensitzung bereits geraucht hatte. Aber es mussten mindestens zwei Päckchen gewesen sein.
Sein Rücken schmerzte, während er sich auf den Stuhl setzte. In Gedanken ging er die vergangenen Stunden noch einmal durch. Die Zeitungen hatten inzwischen ebenfalls ihre Sonderausgaben gedruckt und dem Satelliten den Namen »Roter Mond über Amerika« verliehen. Die Sowjets selber hatten in der Zwischenzeit ihren Erfolg öffentlich gefeiert, und nun kannte die ganze Welt auch den wahren Namen des Satelliten. Sputnik.
Miller musste zugeben, dass ihm der Name gefiel. Kurz, einprägsam und irgendwie auch ein wenig bedrohlich. Vor allem aber ärgerte er sich über die Tatsache, dass die amerikanischen Nachrichtendienste versagt hatten. Sie hatten alle miteinander keinen Schimmer von Sputnik gehabt. Eisenhower hatte seiner Meinung nach jedes Recht dazu, sauer zu sein.
Wozu sind wir eigentlich gut, wenn wir fast nichts über unsere Feinde wissen?, dachte Miller.
Natürlich war ihm klar, dass das Beschaffen geheimer Informationen aus der Sowjetunion keine leichte Aufgabe war. Einen eigenen Spion in den Reihen der Sowjets zu platzieren war eine langwierige und oftmals wenig erfolgversprechende Aktion. Und so viele Spione konnten die Sowjetunion gar nicht infiltrieren, als das man über jeden Zug des Feindes rechtzeitig informiert wäre.
Während der vergangenen Stunden im Konferenzraum hatten einige seiner Mitarbeiter auch spekuliert, ob es unter den Wissenschaftlern in Amerika solche geben könnte, die ein doppeltes Spiel spielten. Ob vielleicht amerikanische Technologie an die Sowjets weitergegeben wurde, und diese daher den technologischen Rückstand so schnell hatten aufholen können.
Miller glaubte in diesem Fall nicht an Verrat. Ausschließen konnte er diese Möglichkeit aber auch nicht. Im Grunde konnte jeder in ihren Reihen ein Verräter sein, dachte Miller. Einer seiner Kollegen, einer ihrer internationalen Wissenschaftler, selbst sein Nachbar könnte mit den Roten sympathisieren, ohne dass er davon wusste.
Miller drückte seine Zigarette in einem alten Marmeladenglas aus. Er kam sich schon beinahe paranoid vor und rechtfertigte das mit seiner schlaflosen Nacht. Dennoch musste es doch einen Weg geben, schneller an geheime Pläne und Informationen des Feindes zu kommen und mögliche Verräter in den eigenen Reihen zu identifizieren.
Ohne Vorwarnung schoss ihm eine Erinnerung aus Kindheitstagen in den Kopf. Während sein Vater im Krieg gewesen war, hatte ihm seine Mutter nur wenig von den Briefen erzählt, die sein Vater ihr geschickt hatte. Von unbändiger Neugier getrieben hatte Miller daher in der Wäscheschublade seiner Mutter nach den Briefen gesucht. Er hatte gewusst, dass sie die Briefe dort aufbewahrte. Er hatte auch gewusst, dass es eigentlich falsch war, hinter dem Rücken seiner Mutter die Briefe zu lesen. Aber er konnte nicht anders.
Neben den Briefen hatte er auch das Tagebuch seiner Mutter gefunden. Wann immer er allein zu Hause war, hatte er sich die Aufzeichnungen seiner Mutter durchgelesen. Jeder Gedanke seiner Mutter, ihre Angst um ihren Ehemann, die Sorge, Frank allein erziehen zu müssen, alle Geheimnisse seiner Mutter hatten in dem Tagebuch offen ausgebreitet vor ihm gelegen.
»Wenn wir doch nur über alle Menschen und ihre Geheimnisse so gut Bescheid wüssten«, sagte er leise.
Ein weiterer Gedankenblitz folgte kurz darauf. Miller ging zügig zum Telefon. Er wählte hastig die Nummer und wartete ungeduldig, bis abgehoben wurde.
»Ja?«
»Hallo, Pete. Gut, dass du noch da bist.«
»Frank? Ich dachte, du bist schlafen gegangen. Was gibt´s?«
»Ich muss dich um was bitten. Erinnerst du dich noch an den Professor vom MIT in Cambridge? Der, der uns vor ein paar Monaten diesen futuristischen Vortrag gehalten hat. Über das Zusammenspiel von Menschen und Computern.«
»Ja. Hab zwar damals kein Wort verstanden, aber ich weiß, wen du meinst. Worum geht´s denn?«
»Ich will ein Treffen mit ihm. Am besten gleich morgen. Also heute. Kannst du das für mich in die Wege leiten?«
»Natürlich. Kein Problem. Soll ich ihm eine Agenda nennen?«
»Nein, nein. Sag ihm einfach, es handele sich um ein informelles Treffen. Sag ihm, ich hätte ein paar Fragen zu seinem Arbeitsgebiet.«
»Okay. Wird gemacht, Boss.«
Miller schmunzelte. Hunter nannte ihn nur »Boss«, um ihn zu necken.
»Danke. Wir sehen uns dann in ein paar Stunden.«Miller legte auf. Er verharrte mit der Hand auf dem Telefonhörer.
Vielleicht war es ja doch einen Versuch wert, dachte er. Vielleicht lohnte es sich doch, genauer zu verstehen, welche Möglichkeiten diese monströsen Computer noch boten? Gleich danach ging er hinauf ins Schlafzimmer und legte sich, ohne sich zu entkleiden, aufs Bett.
Kapitel 1
Nahe Paris, Frankreich, 1995
Die schwarze Limousine bog in rasantem Tempo auf den kleinen Flugplatz westlich von Paris ab. Philippe Beaumont saß auf der Rückbank und blätterte hektisch in seiner Rede, die er etwa eine halbe Stunde später vor Tausenden seiner Pariser Mitbürger halten würde. Er war spät dran. Die beiden Wahlkampfreden am Vormittag hatten länger gedauert als vorgesehen.
Seine anstehende Rede sollte die bedeutendste des Tages werden, und so ging er sie wieder und wieder durch. Immerhin würden ihm 40.000 potentielle Wähler zuhören. Es war seine Idee gewesen, eine Rede im Parc des Princes zu halten. Seine PR-Manager hatten versucht, ihn davon abzubringen. Ihrer Meinung nach war das Risiko zu groß, dass nicht genügend Zuschauer in das Fußballstadion kommen würden. Sie fürchteten, dass die Bilder eines angehenden Bürgermeisters vor halbleeren Rängen sein Image als aufgehender Stern über dem Pariser Polithimmel beschädigen würden. Aber Beaumont war sich seiner charismatischen Wirkung auf die Pariser Bürger sehr bewusst. Er zweifelte nicht an ihrer Unterstützung.
Erst wenige Monate zuvor hatte er sich als Vertreter der Sozialistischen Partei für das Amt des Pariser Bürgermeisters aufstellen lassen. Zu dem Zeitpunkt hatte fast niemand den jungen Politiker gekannt. Er war mit Anfang 40 ein noch unbeschriebenes Blatt in Politkreisen gewesen. Und so hatte die französische Presse ihm nicht die leiseste Chance auf das Amt eingeräumt. Auch seine politischen Gegner waren davon ausgegangen, leichtes Spiel mit Beaumont zu haben, und planten bereits für ihre nächste Amtszeit im Pariser Rathaus.
Doch es war gerade seine jugendliche Art und sein gutes Aussehen, die Beaumont in kürzester Zeit zum neuen Superstar in Paris machten. Viele der weiblichen Wählerinnen bewunderten ihn und seine schöne Frau für ihr elegantes Auftreten bei öffentlichen Anlässen. Einem königlichen Glamour-Paar gleich hatten sie die Titelblätter nahezu aller Zeitschriften und Tageszeitungen in den Monaten zuvor geziert. Der Großteil der männlichen Wähler wiederum respektierte Beaumonts wirtschaftlichen Aufstieg. In eine klassische Arbeiterfamilie hineingeboren, war Beaumont aus eigener Kraft zu einem erfolgreichen Unternehmer avanciert.
Seine pressewirksamen Auftritte steigerten seine Bekanntheit und seine Sympathiewerte auf nie zuvor gekannte Weise. So sehr, dass er in jüngsten Umfragen die Führung übernommen und entgegen aller Erwartungen gute Aussichten auf den Wahlsieg hatte.
Für Beaumont selber waren seine Auftritte nur Mittel zum Zweck. Hinter der glitzernden Fassade verbarg sich ein kühl berechnender Geist. Das Pariser Rathaus war für ihn nicht mehr als eine Zwischenstation auf dem Weg zu seinem eigentlichen Ziel. Dem Élysée-Palast. Dem Sitz des französischen Staatspräsidenten.
Auch über seine eigentliche politische Gesinnung wusste die Öffentlichkeit im Grunde nur wenig. Der glamouröse Schein, der in den Vordergrund seiner Kampagne gerückt wurde, sollte zunächst völlig ausreichen, um genügend Stimmen zu sichern.
Die Limousine war inzwischen vor dem kleinen Hangar zum Stehen gekommen. Ein Bodyguard öffnete die Tür des Wagens. Beaumont beugte sich zu seiner Frau, die neben ihm saß, und gab ihr einen Kuss auf die Wange.
»Wir sehen uns dann gleich im Stadion«, sagte er.
»Viel Glück«, rief ihm seine Frau noch hinterher, als er voller Elan aus der Limousine stieg und zum Hangar eilte.
Dort reichte ihm einer der Mitarbeiter des Flugplatzes die Ausrüstung und das Gurtzeug für den Fallschirmsprung. Beaumont behielt seinen maßgeschneiderten Anzug an und zog sich den Overall und die Ausrüstung darüber.
Die Genehmigung für einen Fallschirmsprung über Paris zu bekommen, war schon schwer genug gewesen. Dass Beaumont zu allem Überfluss auch noch im Fußballstadion landen wollte, hatte die Pariser Behörden nahezu überfordert. Doch Beaumont konnte sich auch in diesem Punkt auf sein Wahlkampfteam verlassen. Er hatte sich bereits in der frühesten Phase seiner Kandidatur mit den besten PR-Köpfen des Landes umgeben. Und sie hatten sich ihr üppiges Gehalt verdient und die Genehmigung schließlich eingeholt.
Beaumont war ein erfahrener Fallschirmspringer. Der anstehende Sprung war für ihn reine Routine. Unzählige Male war er schon an diesen Flugplatz gekommen. Unzählige Sprünge hatte er bereits absolviert. Dennoch verspürte er ein Kribbeln, als er daran dachte, dass er ein paar Minuten später in ein voll besetztes Stadion hinab segeln würde. Seine größte Angst war, die Landung zu vermasseln und auf dem Hosenboden über den frischgemähten Stadionrasen zu rutschen.
Während er sich noch das Gurtzeug anlegte, wandte er sich an den Flugplatzmitarbeiter.
»Sagen Sie dem Piloten, er soll die Maschine schon mal starten. Ich bin in einer Minute da.«
Der Mann lief daraufhin aus der Halle und ließ Beaumont alleine zurück. Im hinteren Teil des Hangars entdeckte Beaumont einen weiteren Angestellten des Flugplatzes. Er war mit dem typischen grauen Overall bekleidet, den alle Mitarbeiter hier trugen. Im Halbdunkeln der Halle konnte Beaumont sein Gesicht nicht genau erkennen. Zumal der Mann auch noch eine Baseballkappe trug, die er tief ins Gesicht gezogen hatte. Beaumont wusste aber, dass es sich nur um Nicolas, den Sprunglehrer des Platzes, handeln konnte. Nicolas war auch derjenige, der sich immer um Beaumonts Schirme kümmerte, wenn er selber keine Zeit dafür hatte. So auch an diesem Tag. Dies widersprach zwar einer der Grundregeln des Fallschirmspringens, die besagte, dass man sich stets um seinen eigenen Schirm zu kümmern hatte. Aber als Politiker, der im Wahlkampf einen 16-Stunden-Tag verfolgte, konnte Beaumont darauf keine Rücksicht nehmen.
»Nicolas«, rief Beaumont lächelnd. »Schaust du dir den Sprung im Fernsehen an?«
Der Mann auf der anderen Seite der Halle drehte sich zu ihm, und hob den rechten Daumen. Anschließend verschwand er wortlos in einem der hinteren Lagerräume.
Bereits zwei Minuten später saß Beaumont mit einem seiner Mitarbeiter in der kleinen Maschine und rollte über die Startbahn.
»1800 Meter sollten heute reichen«, schrie Beaumont unaufgeregt ins Cockpit der kleinen Propellermaschine. »Ich bin schon überfällig und will nicht unnötig Zeit verlieren.«
Der Pilot im Cockpit nickte.
Wenig später betrachtete Beaumont aus der Flugzeugkabine heraus die Stadt unter sich. Schon nach wenigen Minuten erkannte er das Stadion im 16. Arrondissement der französischen Hauptstadt.
»Hat Nicolas den Schirm zusammengelegt?«, fragte Beaumont seinen Kabinennachbar.
»Ja«, antwortete dieser. »Das hat er gestern vor seinem Urlaub noch als Letztes gemacht.«
Beaumont schaute sein Gegenüber irritiert an.
»Urlaub? Ich habe ihn doch vorhin noch gesehen.«
Der Flugplatzmitarbeiter zuckte mit den Schultern.
»Kann schon sein. Vielleicht hatte er noch was im Büro vergessen und ist kurz reingekommen.«
Beaumont dachte nicht weiter darüber nach, denn in diesem Moment erhielt er vom Piloten das Zeichen, dass sie die Absprunghöhe erreicht hatten.
Der Mitarbeiter öffnete die Seitentür der Flugzeugkabine und signalisierte Beaumont, dass alles bereit war. Ohne zu zögern ging Beaumont zur Tür, blickte hinaus und sprang durch die schmale Öffnung in den sonnendurchfluteten Pariser Himmel.
Kaum, dass er aus dem Flugzeug gesprungen war, nahm Beaumont die klassische Freifallhaltung in Bauchlage ein. Schon nach wenigen Sekunden stürzte er mit 180 km/h dem Pariser Erdboden entgegen. Er sah auf seinen Höhenmesser. Soeben hatte er die 1300-Meter-Marke passiert und warf gleich danach seinen Hilfsschirm in den Luftstrom. Der Hilfsschirm öffnete durch den starken Zug umgehend den Hauptcontainer auf Beaumonts Rücken, in dem der Hauptschirm steckte. Sekundenbruchteile später wurde der Hauptschirm herausgezogen und verlangsamte Beaumonts Fallgeschwindigkeit.
Beaumont bemerkte sofort, dass etwas nicht stimmte. Die bremsende Wirkung des Schirms war kaum spürbar. Er blickte hinauf und stellte fest, dass der Hauptschirm völlig verheddert war und sich nicht richtig geöffnet hatte. Beaumont reagierte gedankenschnell und zog ruckartig ein paar Mal an den Leinen. Vergeblich. Dennoch wurde er nicht panisch.
Ausgerechnet heute, dachte er und ärgerte sich, dass er den Reserveschirm in Anspruch nehmen musste.
Er hatte schon viele Sprünge hinter sich und spulte für Störfälle wie diesen sein erlerntes Wissen ab. Mit einer einstudierten Bewegung trennte er den Hauptschirm vom Container. Unmittelbar danach versuchte er den Reserveschirm zu öffnen. Aber es tat sich nichts.
Beaumont blickte auf seinen Höhenmeter. Jetzt ergriff ihn doch Angst. Er versuchte immer wieder, den Reserveschirm zu öffnen, während er den todbringenden Erdboden unaufhaltsam auf sich zurasen sah. Panisch schaute Beaumont auf seinen Höhenmeter. Er hatte bereits die Höhe unterschritten, bei der auch der Öffnungsautomat den Schirm von alleine hätte auslösen müssen. Wild zog er an dem Griff des Reserveschirms. Das Stadion mit der Zuschauermenge, die Autos auf den Straßen von Paris, alles rückte rasend schnell und bedrohlich nah an ihn heran. Beaumont fing an zu schreien und war kurz davor, das Bewusstsein zu verlieren.
Nur wenige Sekunden später beobachtete die gerade noch jubelnde Menge im Stadion, wie der Fallschirmspringer über ihnen ohne geöffneten Schirm auf sie zustürzte. Gleich danach zerschmetterte Beaumonts Körper auf dem Asphalt des mehrspurigen Boulevard Périphérique, der direkt am Stadion entlang führte. Beaumonts kometenhafter Aufstieg zum neuen Rockstar der französischen Politik endete an diesem Tag, noch ehe er richtig begonnen hatte.
Während die Menschenmenge im Stadion schockiert zu den Ausgängen stürmte, stieg einige Kilometer entfernt ein Mann in sein Auto und fuhr in ruhigem Tempo vom Parkplatz des kleinen Flugplatzes. Zuvor hatte er den Overall mit dem Namensschild »Nicolas« auf der Brust zurück in den Spind gelegt, aus dem er ihn entnommen hatte.
Kapitel 2
New York, 2000
»Bringen Sie uns doch bitte noch eine Flasche hiervon.«
Jason Bradley wedelte mit der leeren Champagnerflasche und grinste dem Kellner breit zu. Die Tische des italienischen Nobel-Restaurants in der Upper East Side waren bis auf den letzten Platz ausgebucht. Unter normalen Umständen hätte man Wochen im Voraus auf einen der begehrten Plätze warten müssen. Dass Bradley und seine drei Begleiter so kurzfristig eine Reservierung hatten ergattern können, hatten sie einem von Bradleys Kollegen aus dem Lokalteil der New York Times zu verdanken. Dieser kannte den Inhaber des Restaurants aus seiner jahrelangen Tätigkeit als Journalist, und diese Beziehung hatte sie ganz nach oben auf der Warteliste katapultiert.
»Schatz, du lallst schon«, sagte Bradleys Frau Natalie und tätschelte belustigt den Arm ihres Mannes.
»Lass ihn doch, Natalie«, entgegnete Matthew Scott und kippte den letzten Rest Champagner in seinem Glas hinunter.
»Heute ist doch wirklich ein besonderer Tag zum Feiern. Vor dir sitzen die beiden größten Enthüllungsjournalisten seit Woodward und Bernstein«, ergänzte er theatralisch.
Scotts Frau Julie, die die heutige Runde komplettierte, lachte laut auf. »Naja, ganz so groß wie Watergate ist das Ganze ja nicht. Außerdem hat Natalie nur zur Hälfte Recht. Denn du lallst auch schon, Liebling.«
Scott griff sich mit beiden Händen an die Brust und verzog, wie von Schmerzen verzerrt, das Gesicht. »Oh. Das tut weh«, gab er schließlich übertrieben theatralisch von sich.
Alle vier lachten und beobachteten kurz darauf, wie der inzwischen herangeeilte Kellner die nächste Flasche Champagner öffnete.
Bradley und Scott kannten sich schon seit über einem Jahrzehnt. Seit ihrer gemeinsamen Zeit an der Uni. Dort hatten sie auch Julie und Natalie kennengelernt und waren seitdem ein unzertrennliches Team. Die beiden Journalisten arbeiteten zusammen in der Wirtschaftsredaktion der Times. Mit Mitte 30 war das allein schon ein achtbarer Karriereweg. Aber in den vergangenen Monaten waren sie auf eine Story gestoßen, von der jeder Journalist träumte, dass sie ihm zumindest einmal im Leben über den Weg laufen würde.
»Ein Toast«, stieß Jason Bradley angetrunken hervor und erhob sein frisch gefülltes Glas. »Auf meine bezaubernde Frau, Natalie. Und unseren nächsten Bradley.«
Er strich dabei mit seiner freien Hand über den weit hervorragenden Bauch seiner schwangeren Frau. Sie erwarteten in Kürze ihr drittes Kind. »Und auf meine besten Freunde«, fuhr Bradley freudestrahlend fort. »Julie und Matt.«
Er prostete beiden zu, und sein Lächeln wurde immer breiter. »Matt, wir haben wirklich schon einiges durchgemacht. Und ich will dir nur sagen. Ich liebe dich, Mann.«
»Gott, Jason. Du bist wirklich betrunken«, sagte seine Frau lachend.
»Ignorier Sie einfach«, winkte Scott ab. »Ich liebe dich auch, Bruder.«
Wieder verfielen sie in ansteckendes Gelächter.
»Na, dann braucht ihr beiden Hübschen uns ja wohl gerade nicht«, sagte Julie und stand auf. »Natalie, willst du mich kurz begleiten? Ich will mich etwas frisch machen, und ich denke, wir sollten den beiden Turteltäubchen hier ein wenig Zeit für sich gönnen.«
»Ja, ich komm mit. Ach und eh ich´s vergesse. Ich liebe dich, Julie.«
Julie Scott tat gerührt und umarmte ihre schwangere Freundin. »Ich liebe dich auch, meine Süße«, sagte sie.
Beide schauten neckisch zu ihren Männern.
»Hahaha«, sagte Bradley. »Macht euch nur lustig über uns. Wenn wir erst mal berühmt sind, werdet ihr ja sehen, was ihr davon habt.«
Er stand ebenfalls auf, gab seiner Frau einen Kuss und setzte sich dann etwas wacklig neben seinen Freund. Einen kurzen Moment schauten sie ihren besseren Hälften hinterher, wie diese auf die Toiletten des Restaurants zusteuerten.
»Weißt du? Ich habe nachgedacht«, wandte Bradley sich schließlich Scott zu und krempelte die Ärmel seines Hemdes hoch.
»In deinem Zustand?«, sagte Scott.
Bradley lächelte und legte die Hand auf die Schulter seines Freundes. »Im Ernst. Was hältst du davon, wenn wir als Nächstes ein Buch schreiben? Ich meine, die Story gibt genug her für ein Buch. Und wenn das dritte Kind erst mal da ist, könnte ich eine kleine Auszeit von der Arbeit in der Redaktion vertragen.«
Scott schaute Bradley konzentriert an. »Ja. Eine gute Idee. Lass uns das machen. Die Recherche ist ja schon abgeschlossen. Wir müssen also nur noch alles im Detail zusammenschreiben. Und einen Verlag zu finden, dürfte ab morgen nicht allzu schwierig sein. Wenn die Story erst mal raus ist, werden wir so heiß begehrt sein wie Julia Roberts.«
»Auf Julia Roberts«, sagte Bradley und prostete seinem Freund zu.
»Auf das Buch«, sagte dieser und trank anschließend das Glas in einem Zug aus.
»Schatz, trink wirklich etwas langsamer«, sagte Julie, die mit Natalie in diesem Moment wieder zurück an den Tisch kam.
Scott ließ sich von der Fürsorge seiner Frau nicht beirren und führte das kleine Toastspielchen einfach weiter. »Auf die beiden schönsten Frauen in ganz New York«, sagte er und nahm jetzt das gefüllte Glas seiner Frau in die Hand.
Bradley machte ebenfalls weiter, und so folgte in den nächsten Minuten ein alberner Trinkspruch dem anderen.
»Auf den Pulitzer-Preis.«
»Auf den netten Kellner mit der schwarzen Fliege.«
»Auf den Erfinder von Champagner.«
»Auf italienisches Essen.«
Schließlich hatten die beiden auch diese Flasche im Rekordtempo geleert, und eine halbe Stunde später hatte sich eine angenehme Müdigkeit in der heiteren Runde eingestellt.
Während sie noch auf die Rechnung warteten, klingelte Scotts Mobiltelefon. Aufgrund seines stark angeheiterten Zustands dauerte es ein paar Sekunden bis er es aus seiner Jackentasche gefischt hatte. Er blickte zunächst aufs Display, dann grinsend zu Bradley.
»Das ist Richard«, sagte er und bedeutete seinen Freunden, ruhig zu sein, während er das Gespräch mit seinem Chefredakteur entgegennahm.
»Komitee zur Vergabe des Pulitzer-Preises für besondere journalistische Leistungen. Was kann ich für Sie tun?«, sagte er ernst, grinste aber anschließend stumm.
Bradley musste sich zusammenreißen, um nicht laut loszulachen. Er lauschte amüsiert dem Telefonat seines Freundes.
»Tut mir leid, Richard«, sagte Scott kurz darauf. »Ich sitze hier gerade mit Jason und unseren Frauen beim Essen. Was gibt´s denn?«
Wenige Augenblicke später verflog das Lächeln auf seinem Gesicht. Er blickte ungläubig zu Bradley. Dieser bemerkte, dass etwas nicht stimmte, konnte aber nur Scotts Part des Telefonats hören.
»Was? Wieso? … Aber das ist doch Blödsinn. Wir haben beide Quellen mehrfach abgesichert. Die Story ist wasserdich… Ich glaube das einfach nicht. Du kannst doch nicht einfach … Jetzt? … Ja … Ja, wir sind in einer halben Stunde in der Redaktion.«
Scott beendete das Telefonat und blickte wie unter Schock auf das Display.
»Und? Was ist denn los?«, fragte Bradley ungeduldig, erhielt aber zunächst keine Antwort. »Matt? Was wollte Richard denn? Ist alles in Ordnung?«
Scott löste endlich seinen starren Blick vom Handy und blickte seinen Freund fassungslos an. Jegliche Freude war schlagartig aus seinem Gesicht verschwunden. Er machte den Eindruck, von einer Sekunde auf die andere nüchtern geworden zu sein.
»Gar nichts ist in Ordnung«, sagte er mit eisigem Blick. »Sie wollen die Story nicht bringen.«
»Was?«
Auch Bradley schien urplötzlich nüchtern.
»Du meinst morgen? Warum nicht?«
»Nein, nicht nur morgen. Sie bringen sie überhaupt nicht. Richard sagt, die Story sei geplatzt.«
»Wem darf ich die Rechnung überreichen?«, erkundigte sich der Kellner, der in diesem Moment an den Tisch herantrat.
Bradley und Scott schauten verwirrt zu ihm hoch, dann zu ihren Frauen, die ebenfalls wie paralysiert auf ihren Plätzen saßen. Zögerlich holte Bradley sein Portemonnaie hervor und zückte seine Kreditkarte. Er reichte sie dem Kellner, ohne den Blick von Scott abzuwenden. Sichtlich verunsichert durch das unbehagliche Schweigen, nahm der Kellner die Karte entgegen und bedankte sich leise.
Kapitel 3
Harvard University, 2000
Michael Robards saß unruhig auf der Bettkante in seinem Wohnheimzimmer auf dem Campus der Harvard University. Er war allein und schaute sich auf dem kleinen Bildschirm die Wiederholung des Spiels vom Vorabend an.
Es war das entscheidende siebte Spiel der Halbfinalserie der amerikanischen Basketballmeisterschaften. Die Mannschaft der Miami Heat hatte die New York Knicks zum Showdown empfangen. Die Knicks waren Michaels Lieblingsteam. Schon seit seiner frühesten Kindheit, als ihn sein Vater, sein leiblicher Vater, zu den Spielen im New Yorker Madison Square Garden mitgenommen hatte.
Michael versuchte, sich auf die Endphase des Spiels zu konzentrieren. Seine Knicks lagen kurz vor Spielende noch mit einem Punkt zurück. Dann kam der entscheidende Pass zum New Yorker Urgestein und Superstar der Knicks, Patrick Ewing. Ewing mit der Trikotnummer 33 tippte den Ball einmal auf, drehte seinen wuchtigen Körper links herum, um seinem Gegenspieler Alonzo Mourning auszuweichen, und versenkte den Ball mit einem Dunk zum entscheidenden 83-82. Die Knicks hatten es tatsächlich geschafft. Sie standen im Finale.
Michael begleitete den letzten Korb der Knicks wie üblich mit einem akustischen »Wusch«. Sein Vater hatte das immer so gemacht und so das Geräusch, das der Ball beim Passieren des Netzes erzeugte, imitiert.
Nervös wippte Michael mit dem Fuß auf und ab. Nicht wegen des Spiels. Das hatte er sich bereits am Abend zuvor mit ein paar Kommilitonen live in einer Bar angeschaut. Er war nervös, weil er bereits seit über zwei Stunden darauf wartete, weitere Instruktionen zu bekommen. Immer wieder blickte er erwartungsvoll zum Telefon auf dem Schreibtisch vor dem Fenster. Schon seit Monaten hatte er sich auf diesen Moment vorbereitet und gehofft, dass er die Einladung bekommen würde. Es war inzwischen schon nach Mitternacht, und auf den Fluren des Studentenwohnheims herrschte absolute Stille.
Michael fragte sich, ob sein Vater, als dieser noch in Harvard studiert und ebenfalls eine Einladung bekommen hatte, genauso lange warten musste wie er an diesem Abend. Bei dem Gedanken an seinen Vater lächelte Michael wehmütig. Der Verkehrsunfall, bei dem seine Eltern ums Leben gekommen waren, hatte sich mittlerweile zum neunten Mal gejährt.
Michael war damals erst elf Jahre alt gewesen. Er konnte sich noch genau daran erinnern, wie ihn sein Kindermädchen in der Nacht geweckt hatte. Sie hatte geweint, und Michael hatte trotz seines jungen Alters gemerkt, dass etwas Schlimmes passiert sein musste. Das Kindermädchen hatte ihn mit tränenerstickter Stimme gebeten, sich anzuziehen, und war dann mit ihm ins Erdgeschoss gegangen. Während sie beide die weitläufige Treppe hinabgegangen waren, hatte Michael in der Eingangshalle seines Elternhauses bereits die zwei uniformierten Polizisten bemerkt. Einer der beiden Polizisten hatte sich zu ihm hinunter gebeugt. Es wäre etwas Schreckliches passiert, und er müsse jetzt ganz tapfer sein, hatte ihm der Polizist gesagt. Anschließend hatten sie Michael und das Kindermädchen mit auf die Wache genommen.
Die beiden Polizisten hatten ihm nur etwas von einem Verkehrsunfall erzählt. Dass seine Eltern tot waren und er nun Vollwaise war, hatte Michael zu diesem Zeitpunkt noch nicht erfahren. Michael hatte eine halbe Stunde auf der Wache verbracht, als John Peterson den kleinen Raum der Polizeistation betreten hatte. Michael kannte Peterson sehr gut. Er war der beste Freund seines Vaters und dessen Geschäftspartner. Die beiden Familien hatten auch privat viel Zeit miteinander verbracht. Als Einzelkind hatte sich Michael immer gefreut, wenn er die Petersons besuchen durfte. John Peterson und seine Frau Candice hatten zwei Kinder. Brian, der ein Jahr älter war als Michael, und seine zwei Jahre jüngere Schwester Kate. Die drei waren schon vor dem Verkehrsunfall, als die Welt noch in Ordnung war, wie Geschwister gewesen. Und sie sollten es in den darauffolgenden Jahren auch auf dem Papier werden.
Peterson war es schließlich auch gewesen, der Michael die traurige Nachricht vom Tod seiner Eltern überbracht hatte. Michael erinnerte sich, wie er sich an der Brust des großgewachsenen Freundes seines Vaters ausgeweint hatte.
Der Tod seiner Eltern hatte bereits ein paar Wochen zurückgelegen, als ihm Candice und John Peterson am Esstisch ihres Hauses das Konzept einer Adoption zu erklären versucht hatten. Sie hatten ihm erklärt, dass sie nicht seine Eltern ersetzen könnten, aber dass sie sich wünschten, Michael wie einen eigenen Sohn in ihrer Familie aufzunehmen. Sofern er damit einverstanden war.
Das war alles gewesen, was Michael verstehen musste. Er war überglücklich, nicht allein zu sein, und fühlte sich bei den Petersons auf Anhieb geborgen und heimisch. Candice und John, wie Michael seine Adoptiveltern nannte, hatten ihr Versprechen in den folgenden Jahren gehalten. Sie hatten Michael tatsächlich nie spüren lassen, nur adoptiert zu sein. Sie hatten sich um ihn gekümmert und ihm die gleiche Liebe zukommen lassen wie ihren eigenen Kindern. Und auch Michael liebte seine neue Familie wie seine eigene. Zumindest soweit das möglich war.
Mit seinen beiden neuen Geschwistern verband ihn ein Zusammenhalt, der seinesgleichen unter leiblichen Geschwistern gesucht hätte. Sie waren ein unzertrennliches Trio und stets füreinander da. So stand für Michael auch außer Frage, seinem Bruder Brian, der ein Jahr zuvor sein Studium in Harvard aufgenommen hatte, hierher zu folgen und seinerseits ein Jurastudium zu beginnen. Mit ihm teilte er sich auch seit wenigen Monaten das WG-Zimmer, in dem er gerade wartete. Harvard lag in der Tradition beider Familien. Sowohl sein leiblicher als auch sein Ziehvater hatten an der Elite-Uni studiert. Kate war noch zu Hause in New York, aber sie besuchten sich gegenseitig so oft es nur ging.
Finanzielle Sorgen hatte Michael nicht. Nicht nur wegen seines Adoptivvaters, der eines der gewichtigsten Internetunternehmen der Welt leitete. Peterson und sein Vater waren früher im gehobenen Management eines Telekommunikationsriesen tätig gewesen, und beide hatten bereits in dieser Zeit ein stattliches Vermögen angehäuft. Das Erbe, das Michael nach seiner Volljährigkeit zugesprochen worden war, machte ihn selber zu einem wohlhabenden, jungen Mann.
Michael war noch tief in den Gedanken an sein bisheriges Leben versunken, als ihn das laute Klingeln des Telefons unsanft in die Gegenwart zurückholte. Angstschweiß trat ihm schlagartig auf die Stirn, und sein Mund fühlte sich trocken an. Er reduzierte rasch die Lautstärke des Fernsehers und nahm das Mobilteil seines Festnetztelefons aus der Station. In den Fensterscheiben, durch die er hinaus auf den Innenhof blickte, spiegelte er sich wider. Einen kurzen Moment betrachtete er sein eigenes Spiegelbild und sprach dann mit zittriger Stimme.
»Hallo?«
Er erhielt keine Antwort. Lediglich ein unstetes Rauschen drang aus dem Hörer zu ihm. Michael wartete zwei Sekunden, bevor er es noch einmal versuchte.
»Hallo? Ist da jemand?«, fragte er und versuchte, seine Nervosität nicht durscheinen zu lassen.
Für einen kurzen Moment dachte Michael, dass die Verbindung abgebrochen sein könnte, und nahm das Mobilteil vom Ohr, um aufs Display zu blicken.
Doch noch bevor er den Hörer ganz senken konnte, nahm er aus dem Augenwinkel einen dunklen Schatten in seinem Rücken wahr. Michael setzte gerade dazu an, sich umzudrehen, als er von mehreren Händen gepackt wurde. Er hatte noch nicht mal realisiert, was gerade passierte, als ihm schon ein Sack über den Kopf gestülpt wurde.
Michael geriet in Panik und wollte sich zur Wehr setzen, als er eine vertraute Stimme vernahm.
»Sei ruhig. Und tu, was wir dir sagen!«
Das Letzte, was Michael noch hörte, bevor er unsanft aus dem Zimmer geschoben wurde, war die Baritonstimme von Patrick Ewing, der dem TV-Sender ein Interview gab.
Kapitel 4
Nachdem sich Scott und Bradley vor dem Restaurant von ihren Frauen verabschiedet und ihnen ein Taxi besorgt hatten, stiegen sie selber ins nächste Taxi ein und fuhren zu den Büros der New York Times.
Eine halbe Stunde später betraten sie das Büro ihres Chefredakteurs Richard Hutton, der dort bereits mit einem der Mitarbeiter der Rechtsabteilung auf sie wartete. Die restlichen Redaktionsbüros waren zu dieser Abendstunde nahezu verwaist. Eine gespenstische Stille lag über der gesamten Abteilung.
»Na, da habt ihr ja schöne Scheiße gebaut«, begrüßte Hutton seine beiden Mitarbeiter augenscheinlich verärgert.
Hutton saß erst seit einem Jahr auf dem Stuhl des Chefredakteurs. Aber er war ein Zeitungsmann mit Leib und Seele. Bradley schätzte Huttons journalistisches Gespür sehr, obgleich dessen derber Umgangston nicht gerade von hoher literarischer Qualität zeugte.
Bradley setzte sich kommentarlos auf den zweiten Stuhl vor dem Schreibtisch des Chefredakteurs, direkt neben Paul Vargas aus der Rechtsabteilung. Scott blieb in Ermangelung weiterer Sitzgelegenheiten nichts anderes übrig, als zu stehen. Also lehnte er sich an eine Regalwand im Seitenbereich des Büros und verschränkte die Arme.
»Ich weiß überhaupt nicht, was hier los ist, Richard. Matt sagt mir, dass du die Story plötzlich nicht mehr bringen willst?«, fragte Bradley und blickte abwechselnd zu Vargas und Hutton. »Was geht hier vor?«
»Und welche Story soll das deiner Meinung nach sein, Jason?«, blaffte Hutton zurück.
Immer wenn er wütend war trat eine Vene auf seiner Stirn hervor. So auch in diesem Moment.
»Was meinst du? Das ist die beste Geschichte, die die Times seit zehn Jahren rausbringen wird.«
Bradley versuchte, sich von der Wut seines Chefs nicht anstecken zu lassen. Er zwang sich, sachlich zu bleiben, obwohl er innerlich aufgewühlt war.
»Wirklich? Dann erkläre mir doch mal bitte, warum Paul hier zwei Erklärungen vorliegen hat, aus denen hervorgeht, dass ihr beiden die ganze Geschichte erfunden habt.«
Hutton schob die Mappe, die vor ihm auf dem Tisch lag, zu Bradley. Bradley lachte kurz auf und schaute zu Scott, der das Gespräch stumm beobachtete.
»So ein Blödsinn«, sagte er anschließend. »Wir haben uns die ganze Story von zwei unabhängigen Quellen absichern lassen. Nur weil jetzt jemand behauptet, die Story wäre erfunden, willst du einen Rückzieher machen? Du wirst wohl ängstlich auf deine alten Tage, was?«
Bradley lächelte über seinen flapsigen Spruch, erntete aber nichts weiter als ernste Mienen von Hutton und Vargas.
»Wer hat denn die Erklärungen überhaupt abgegeben?«, fragte Bradley, immer noch in der Gewissheit, alles klar stellen zu können. »Jemand von findaa.com?«
Er grinste und schaute die anderen Anwesenden selbstsicher an.
Findaa.com war die weltweit führende Internet-Suchmaschine mit Sitz in New York. Ihr phänomenaler Aufstieg hatte aus dem Nichts heraus inmitten des Internet-Hypes der 90er-Jahre begonnen. Ursprünglich von ein paar Studenten ins Leben gerufen, hatte findaa.com sich innerhalb weniger Jahre zu einem Multi-Milliarden-Dollar-Unternehmen entwickelt. In den meisten Ländern der Welt verfügte es über eine vorherrschende Marktstellung. Wollte man nach etwas im Internet suchen, nutzte man fast ausschließlich findaa.com.
»Paul, erkläre du doch bitte unserem Chefredakteur hier, dass wir in jeder Hinsicht abgesichert sind.«
Paul Vargas runzelte die Stirn. Er fühlte sich sichtlich unwohl. Vargas war ein Aktenfresser und stand nicht gerne im Mittelpunkt von Besprechungen.
»Vielleicht solltest du doch erst einen Blick in die Unterlagen werfen«, antwortete er.
Bradley seufzte genervt, zögerte noch einen Moment und beugte sich anschließend widerwillig über den Schreibtisch, um sich den Inhalt der Mappe anzuschauen. Er überflog die Seiten, konnte jedoch nichts feststellen, was er nicht ohnehin schon erwartet hatte.
»Und?«, sagte er kurz. »Ist doch klar, dass die Jungs von findaa.com alles dementieren. Das überrascht mich nicht. Was soll´s? Das ändert nichts an unserer Story.«
Nun war es Hutton, der zum ersten Mal lächelte, auch wenn es offensichtlich nur aufgesetzt war.
»Ach ja, du Klugscheißer? Das Problem ist nur, dass das Dementi nicht von findaa.com stammt. Schau dir doch mal bitte die Namen unter den beiden Erklärungen an.«
Bradley war immer noch verwundert über die Reaktion seines Chefs. Er konnte nach wie vor nicht nachvollziehen, warum Hutton auf einmal ihre Recherchen in Frage stellte. Mit einem gelangweilten Ausdruck blätterte er dennoch ans Ende der beiden Erklärungen und betrachtete die Unterschriften der Dokumente.
Urplötzlich verflog sein Lächeln und er schaute bestürzt zu Scott rüber.
»Das … das kann nicht sein. Das muss ein Fehler sein«, stammelte er nervös und blätterte hastig weiter in der Mappe.
»Ja. Ganz recht. Ist der Groschen jetzt gefallen?«, sagte Hutton wütend. »Eure beiden großartigen Quellen, die außer euch beiden niemand kennen oder treffen durfte. Nicht mal mir habt ihr erlaubt, mit ihnen zu sprechen. Nur die Namen habt ihr mir genannt, damit ich der Story zustimmen konnte.«
Scott verstand gar nichts mehr und konnte auch dem sprachlosen Gesichtsausdruck seines Freundes nichts entlocken. Er ging langsam zu Bradleys Platz und nahm die Mappe an sich. Auch er erstarrte, als er die beiden Namen las. Die Erklärungen wurden abgegeben von Joshua Stanton und Thomas Parker, den beiden Informanten, auf denen die ganze Story aufbaute.
Es hatte vor gut einem Jahr begonnen. Eigentlich hatten Bradley und Scott lediglich einen Artikel zum fünfjährigen Bestehen von findaa.com recherchieren sollen. Doch im Zuge ihrer Nachforschungen waren sie eher zufällig auf einige Ungereimtheiten im Lebenslauf von John Peterson, dem Vorstandsvorsitzenden von findaa.com, gestoßen.
Sie hatten den Jubiläumsartikel wie geplant herausgebracht, hatten aber beschlossen an Peterson dran zu bleiben. Wenige Monate zuvor hatten sie schließlich den anonymen Tipp erhalten, sich mit Joshua Stanton zu unterhalten. Stanton war ebenso wie ihre zweite Quelle Parker ein ehemaliger Regierungsangestellter im Pentagon. Nach endlosen Interviews und Gesprächen in runtergekommenen Bars und dunklen Hinterhöfen hatten ihnen letztlich beide unabhängig voneinander bestätigt, dass Peterson und noch mindestens ein weiteres Vorstandsmitglied von findaa.com auf der Gehaltsliste des Verteidigungsministeriums standen.
Diese Story wäre ein echter Skandal gewesen. Das war Bradley und Scott sofort klar gewesen. Wenn es tatsächlich so war, dass zwei Mitarbeiter der US-Regierung an der Spitze der weltgrößten Internet-Suchmaschine standen, hätte das die Welt des Internets, aber auch die Schaltzentralen der Politik in Washington, einem Erdbeben gleich erschüttert.
Der logische Schluss lag nahe, dass alle Kundendaten und Suchanfragen von findaa.com ohne Zweifel auch den amerikanischen Geheimdiensten zur Verfügung gestellt würden. Dass dies in der Öffentlichkeit einen weltweiten Aufschrei nach sich gezogen hätte, war vorauszusehen. Datenschutz und Privatsphäre im Internet waren ohnehin schon heiß diskutierte Themen. Findaa.com als verlängerten Arm einer Regierungsorganisation zu enttarnen, hätte diese Diskussion in ungeahnte Sphären gehoben und das Image der amerikanischen Nachrichtendienste nachhaltig beschädigt.
Scott fing sich als erster wieder und schüttelte ungläubig den Kopf.
»Ich kann mir das wirklich nicht erklären, Richard. Die beiden kennen sich doch auch gar nicht. Sie wissen nichts voneinander. Da muss irgendwer Druck gemacht haben.«
»Und wer soll das gewesen sein?«, fragte Hutton scharf.
»Na, wer schon. Das Pentagon. Das Verteidigungsministerium. Irgendjemand in Washington halt.«
»Aber außer uns dreien wusste doch niemand, dass Parker und Stanton mit euch gesprochen haben. Das habt ihr mir selber gesagt.«
»Richard, wir sprechen hier von der Regierung. Vielleicht sogar von der CIA. Irgendwie müssen die was rausgekriegt haben. Das ist doch klar. Warum sonst sollten die beiden ihre Aussagen jetzt plötzlich ändern? Und das zeitgleich am Vorabend der Veröffentlichung.«
»Kannst du das auch beweisen, Matt?«, fragte Hutton genervt. »Na, also«, sagte er ohne auf eine Antwort zu warten.
»Aber wir haben doch noch die Bänder mit den Interviews mit Stanton und Parker. Die müssen als Beweis ausreichen, oder nicht?«, fragte Bradley.
»Nun. Das ist leider nicht ganz so einfach«, sagte Vargas. »Beide, Parker und Stanton, geben in ihren Erklärungen ja zu, dass sie diese Interviews mit euch geführt haben. Allerdings geben sie beide auch an, dass du, Jason, ihnen dafür jeweils 10.000 Dollar gezahlt hast, und dass du ihnen die Antworten vorformuliert hättet.«
»So ein Unsinn. Ich habe denen nie irgendwelches Geld gegeben. Woher sollte ich denn, bitte schön, 20.000 Dollar haben? Das ist doch Wahnsinn.«
»Wie auch immer«, fuhr Vargas in ruhigem Ton fort. »Beide geben an, dass sie nun doch ein schlechtes Gewissen plagen würde, und dass sie daher die ganze Geschichte wieder richtig stellen wollen. Auch das Geld haben sie inzwischen zurück an die Times überwiesen.«
»Zurück überwiesen?«
Bradley hielt es nicht mehr auf seinem Stuhl. Er stand auf und tigerte im Büro des Chefredakteurs hin und her.
»Die können doch gar nichts zurück überweisen, weil sie nie Geld von mir bekommen haben.« Er schleuderte sein Jackett in die Ecke des Büros.
»Richard, wenn ich´s dir doch sage. Die beiden müssen von Washington aus unter Druck gesetzt worden sein. Du kennst uns doch. Du weißt, dass wir so nicht arbeiten würden. Wir haben sauber recherchiert und die Story stimmt. Punkt. Aus.«
Hutton lehnte sich in seinem großen Bürostuhl zurück und betrachtete nachdenklich seine beiden Mitarbeiter.
»Ihr seid gute Jungs«, sagte er schließlich sanft, aber bestimmend. »Aber ihr habt hier einfach Mist gebaut, Jason. Wenn ihr außer den widersprochenen Aussagen von Stanton und Parker keine weiteren Beweise in der Hand habt, dann gibt es einfach keine Story. Das ist zu heiß. Paul kann dir bestätigen, was für Klagen uns entgegen geschmettert würden, wenn wir mit der Geschichte an die Öffentlichkeit gingen. Und wir reden hier nicht nur von einem der größten und mächtigsten Internetunternehmen der Welt, sondern auch vom Verteidigungsministerium. Tut mir leid, Jungs. Wenn ihr mir mehr bringen könnt als eure versiegten Quellen, dann stehe ich auch weiterhin hinter euch. Andernfalls ist die Story tot.«
Bradley blickte flehend zu Scott, der ihn aber seinerseits nur hilflos anschaute. Anschließend zog er sein Mobiltelefon aus der Hosentasche. Er wollte nicht so schnell klein beigeben.
»Ich rufe Stanton an und kläre das jetzt«, sagte er.
Hutton schüttelte mitleidig den Kopf.
»Wenn du meinst. Nur zu. Versuch´s«, sagte er.
Bradley wählte die Nummer von Stanton und wartete. Da lediglich die Mailbox antwortete, probierte er es gleich darauf bei Parker. Aber auch dessen Telefon schien ausgeschaltet zu sein. Langsam ging Bradley zurück zu seinem Platz und sank resigniert auf den Stuhl.
»Das gibt´s doch nicht.«
Er war verzweifelt und lockerte seinen Krawattenknoten.
»Also, gut. Es ist schon spät«, sagte Hutton nach einigen Sekunden. »Es gibt im Moment ohnehin nichts mehr, was wir tun können. Machen wir also Schluss für heute. Wir sehen uns dann morgen früh.«
Hutton bemerkte, dass Bradley und Scott im Gegensatz zu Vargas keine Anstalten machten zu gehen, sondern ihn nur weiterhin auffordernd anschauten.
»Worauf wartet ihr noch?«, sagte er daher mit etwas mehr Nachdruck. »Ich will endlich nach Hause. Also raus mit euch. Hopp, hopp.«
Frustriert erhob sich Bradley schließlich, schnappte sich sein Jackett und verließ mit Scott die Redaktionsbüros. Die Stimmung zwischen beiden war gereizt. Keiner sprach den anderen an, als sie in den Fahrstuhl stiegen. Während sich die Kabine des Fahrstuhls schloss, spürte Bradley, dass Scott ihn anstarrte.
»Was?«, fragte er aggressiv.
»Sag mal. Du hast denen doch nicht wirklich Geld gegeben, oder?«, fragte Scott zaghaft.
Bradley schaute seinen Freund aus verengten Augen an.
»Ich kann nicht glauben, dass du das wirklich gerade gefragt hast.«
»Ich meine ja nur. Mit Natalie und bald dem dritten Kind. Ich weiß ja, wie eng es finanziell zurzeit bei euch aussieht. Du würdest mir das doch sagen, richtig?«
»Ach. Und weil ich so knapp bei Kasse bin, habe ich mal eben 20.000 Dollar übrig, damit ich mir eine gute Story ausdenke? Du bist ja ein wahrer Meister-Journalist. Weißt du was, Matt? Leck mich doch einfach.«
Die Fahrstuhltüren öffneten sich im Erdgeschoss, und Bradley stürmte eiligen Schrittes hinaus. Scott hatte Mühe, ihn einzuholen.
»Heh. Nun warte doch«, rief er ihm hinterher. »Ich hab´s nicht so gemeint. Sorry. Ich bin einfach wütend, dass die ganze Sache so gelaufen ist. Und die Treffen mit den beiden hattest du ja überwiegend vereinbart. Außerdem muss ja jemand was gesagt haben. Wie sonst hätten die auf die Spur von Stanton und Parker kommen sollen?«
Bradley blieb stehen und sog die kühle Abendluft vor dem Bürogebäude ein. Augenblicke später drehte er sich zu Scott.
»Ganz genau. Jemand muss was gesagt haben. Und ich weiß nur so viel, dass ich es nicht war«, sagte Bradley wutentbrannt.
»Was soll das denn jetzt heißen? Willst du damit sagen, dass ich es ausgeplaudert habe?«
»Ich weiß nicht. Sag du´s mir. Hast du?«
Wie zwei Boxer, die sich vor dem ersten Schlag mit Blicken abtasteten, standen sich beide regungslos gegenüber.
»Auf so ´ne Scheiße muss ich nicht antworten«, sagte Scott schließlich, drehte sich um und marschierte davon.
»Na, fein«, schrie ihm Bradley hinterher und fügte noch ein leises »Arschloch« hinzu, bevor er in die entgegengesetzte Richtung ging.
Kapitel 5
Sein Gesicht war schweißgebadet. Im Sekundentakt rannen weitere Schweißtropfen an beiden Schläfen herab.
Unter dem Sack, der immer noch über Michael Robards Kopf gestülpt war, war es unerträglich heiß. Offenbar von altem, abgestandenen Angstschweiß anderer getränkt, roch es im Inneren des Sacks schlecht und muffig. Michaels Puls raste, und sein Atem ging schnell.
Die Männer, die ihn an diesen Ort entführt hatten, ließen ihn nun los. Zuvor hatten sie ihn aus dem Wohnheim hinaus zu einem Auto gebracht. Er vermutete, dass sie etwa eine Viertelstunde hierher gefahren sein mussten, war sich aber gleichzeitig nicht ganz sicher, ob ihn sein Zeitgefühl nicht doch trog. Anschließend hatte man ihn über einen Kiesschotterweg zu einem Gebäude geführt und ihn eine endlos lang erscheinende Treppe hinab geleitet.
Michael konnte durch den Stoff des Sacks hindurch nichts erkennen. Nur ein diffuses Licht durchdrang inzwischen das engmaschige Gewebe. Michael drehte seinen Kopf nach allen Seiten, aber es war ihm völlig unmöglich zu erkennen, wo er sich momentan befand. Er hörte laute Schritte von schweren Schuhen, die auf dem steinernen Boden auf ihn zukamen. Augenblicke später wurde er erneut von mehreren Händen gepackt. Man zog ihm die Schuhe und die Hose aus. Dann hörte Michael, wie der Stoff seines T-Shirts zerschnitten wurde. Sekunden später stand er bis auf seine Unterwäsche entkleidet fast nackt da. Er wehrte sich nicht dagegen.
Ihm wurde kalt, und die blonden Härchen auf seinen Unterarmen stellten sich kerzengerade auf. Seine Entführer ließen wieder von ihm ab. Orientierungslos lauschte Michael den Geräuschen der sich entfernenden Schritte. Im gleichen Moment vernahm er eine kräftige Stimme. Sie schien ganz nah zu sein. Michael drehte seinen Kopf nach vorne, wo er den Ursprung der Stimme vermutete.
»Michael Bartholomew Robards«, hörte er seinen vollständigen Namen.
Aufgrund des Widerhalls der Stimme vermutete Michael, dass er sich in einem größeren Raum befand.
»Knie nieder!«, befahl die Stimme.