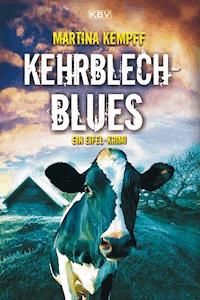8,99 €
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Starke Frauen, dunkle Zeiten
- Sprache: Deutsch
Europa zu Beginn des 15. Jahrhunderts: während zwischen Frankreich und England der Hundertjährige Krieg tobt, werfen die Auseinandersetzungen auch ihre Schatten auf die Niederen Lande. Jakoba von Bayern, Erbtochter Wilhelms II. von Bayern und letzte Vertreterin des niederländischen Zweigs der Wittelsbacher, muss nach dem frühen Tod ihres Vaters schnell erwachsen werden und ihr Erbe als jüngste Fürstin ihrer Zeit antreten. Schon als junges Mädchen wird sie verheiratet, um ihre Position zu festigen und die Macht über Holland zu erhalten. Doch es herrschen schwierige Zeiten, ihr Land liegt in jahrelangem Krieg, die Bevölkerung ist ausgezehrt und Jakoba scheint gegen ihre einflussreichen Verwandten einen aussichtslosen Kampf zu führen. Verzweifelt wehrt sie sich gegen Verrat und Intrigen und sucht ihr Heil in Ehen, Magie und Kriegen –, aber die Rettung kommt von ganz anderer Seite …
Dieser historische Roman erschien vormals unter dem Titel "Die Schattenjägerin".
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 508
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Informationen zum Buch
Europa zu Beginn des 15. Jahrhunderts: während zwischen Frankreich und England der Hundertjährige Krieg tobt, werfen die Auseinandersetzungen auch ihre Schatten auf die Niederen Lande.
Jakoba von Bayern, Erbtochter Wilhelms II. von Bayern und letzte Vertreterin des niederländischen Zweigs der Wittelsbacher, muss nach dem frühen Tod ihres Vaters schnell erwachsen werden und ihr Erbe als jüngste Fürstin ihrer Zeit antreten.
Schon als junges Mädchen wird sie verheiratet, um ihre Position zu festigen und die Macht über Holland zu erhalten. Doch es herrschen schwierige Zeiten, ihr Land liegt in jahrelangem Krieg, die Bevölkerung ist ausgezehrt und Jakoba scheint gegen ihre einflussreichen Verwandten einen aussichtslosen Kampf zu führen.
Verzweifelt wehrt sie sich gegen Verrat und Intrigen und sucht ihr Heil in Ehen, Magie und Kriegen –, aber die Rettung kommt von ganz anderer Seite …
Dieser historische Roman erschien vormals unter dem Titel »Die Schattenjägerin«.
Über Martina Kempff
Martina Kempff ist Autorin, Übersetzerin und freie Journalistin. Sie war unter anderem als Redakteurin bei der Berliner Morgenpost und als Reporterin bei Welt und Bunte tätig, bevor sie beschloss sich künftig dem Schreiben von Büchern zu widmen. Ihre historischen Romane zeichnen sich durch hervorragende Recherche und außergewöhnliche Heldinnen aus. Martina Kempff lebt im Bergischen Land.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Martina Kempff
Das Verhängnis der Fürstin
Das Leben der Jakoba von Bayern
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Newsletter
Personen
1. KAPITEL. Die Kindsbraut
2. KAPITEL. Intrigen
3. KAPITEL. Ehehölle
4. KAPITEL. Im Exil
5. KAPITEL. Hexerei
6. KAPITEL. Niederlagen
7. KAPITEL. Der Kuss von Delft
8. KAPITEL. Begegnungen
9. KAPITEL. Die Krönung
10. KAPITEL. Marjan
11. KAPITEL. Der Herbstwald
12. KAPITEL. Die weiße Dame
Nachwort
Impressum
Jakobas Familie
Wilhelm von Bayern, Jakobas Vater, Sohn von Herzog Albrecht von Bayern, Enkel des deutschen Kaisers Ludwig, Verfechter der feudalen Ordnung
Marguerite von Burgund, Jakobas Mutter, Tochter Philipps des Kühnen, Enkelin von König Johann II. von Frankreich und Schwester des Herzogs von Burgund
Beatrix, Jakobas illegitime Schwester
Johann von Bayern (Johann der Unbarmherzige), jüngerer Bruder von Jakobas Vater, Bischof von Lüttich, später Jakobas Gegenspieler
Die Burgunder
Herzog Johann von Burgund (Johann ohne Furcht), Bruder von Jakobas Mutter
Philipp von Burgund (Philipp der Gute), einziger Sohn Herzog Johanns, Jakobas Lieblingscousin und später ihr wichtigster Gegner
Michaela, erste Gemahlin von Philipp dem Guten, Tochter des französischen Königs
Bona von Artois, zweite Gemahlin Philipps des Guten
Isabella von Portugal, dritte und letzte Gemahlin Philipps des Guten
Herzog Anton von Brabant, Johann ohne Furchts Bruder, fällt in Azincourt
Jan von Brabant, Sohn von Herzog Anton, Jakobas zweiter Ehemann
Anna von Burgund, Philipps Schwester, heiratet John von Bedford
Französisches Königshaus
Karl VI., König von Frankreich, zuzeiten umnachtet
Isabella von Bayern, machtbewusste Königin von Frankreich
Ludwig, Kronprinz von Frankreich
Jean von Touraine, Kronprinz von Frankreich, Jakobas erster Gemahl
Karl, Kronprinz von Frankreich, späterer König Karl VII.
Der englische Königshof
Heinrich V., König von England
Katharina, Königin von England, Tochter des französischen
Königs Heinrich VI., König von England, später auch König von Frankreich, Jakobas Patensohn
Humphrey von Gloucester, Bruder von Heinrich V., Jakobas dritter Gemahl
John von Bedford, Bruder von Heinrich V., später Regent von Frankreich
Henry Beaufort, Bischof von Winchester, Kanzler und Onkel von König Heinrich V.
Eleanor Cobham, Jakobas englische Hofdame, später Humphreys Gemahlin, in Zauberkünsten bewandert
Weitere Personen
Elisabeth Görlitz von Luxemburg, zweite Gemahlin von Herzog Anton von Brabant, heiratet nach dessen Tod in Azincourt Johann den Unbarmherzigen und befindet sich oft in Geldnot
Frank von Borsselen, Seeländischer Adliger, Vertrauter Philipps des Guten, Jakobas vierter Ehemann
Marjan, Jakobas Kinderfrau
David, Hofnarr
Jan von Vliet, Ritter Jakobas und Ehemann ihrer Schwester Beatrix
Dirk von der Merwede, Jakobas treuster Ritter
Willem van den Berg, Herzog Jan von Brabants Oberschatzmeister
1. KAPITELDie Kindsbraut
1406–1415
Es war noch dunkel, als Jakoba aufwachte. Mit Hagel durchsetzter Gewitterregen peitschte gegen die Fenster und wie ein Klageweib heulte der Sturmwind um das alte Gemäuer von Schloss Le Quesnoy. Zitternd setzte sich das Kind auf, zog die Beine an und wickelte sich in seine Decken ein. Ein Blitz erhellte für einen Augenblick das Zimmer. Vor dem Bett stand eine fremde Frau in einem weißen Nachtgewand. Ihr Gesicht war hohnverzerrt und in der Hand hielt sie etwas Rotes aus Stoff. Jakoba wich zurück und schrie. Ein Donnerschlag erstickte den Ruf. Beim nächsten Blitz war die Erscheinung verschwunden.
Mit den Decken um die Schultern kroch Jakoba aus dem Bett und tastete sich zum Lager ihrer Kinderfrau vor. Als sie mit den Füßen gegen einen umgestürzten Bierkrug stieß und das pfeifende Schnarchen Mechthilds vernahm, wusste Jakoba, dass sie hier vergeblich Schutz suchte. Wo konnte sie hin? Natürlich zum Vater. Wenn er nur nicht wieder die Nacht bei einer der anderen Frauen verbrachte! Jakoba mochte diese Frauen nicht, die so viel Aufmerksamkeit ihres Vaters einforderten und ihm einen Sohn nach dem anderen gebaren. Sie brauche nicht eifersüchtig zu sein, hatte der Vater ihr oft versichert. Die Bastarde habe er zwar auch ein bisschen lieb, aber sie sei und bleibe seine einzige Erbin. Dereinst werde sie Gräfin von Holland, Seeland und dem Hennegau sowie Herrin von Friesland sein und wahrscheinlich auch noch einen schönen Titel ihres künftigen Gemahls führen.
Auf dem kalten, zugigen Gang vor ihrem Zimmer blieb Jakoba unschlüssig stehen, bis sie zwischen den Donnerschlägen gedämpftes Stimmengewirr hörte. Eilig lief sie den von nur einer Fackel erleuchteten Gang entlang bis zur Empore, von der aus sie den Rittersaal überblicken konnte.
Das Gelage war noch im Gange, auch wenn die Spielleute bis auf eine dunkelhaarige Harfenspielerin ihre Instrumente schon niedergelegt hatten. Jakoba sah nur noch einen Hund, der unter den Tischen nach Essbarem fahndete. Die anderen Tiere lagen dicht aneinander gedrängt vor dem geflochtenen Ofenschirm an der großen Feuerstelle. Am fernen Ende des Saals stritten sich zwei Ritter um eine Frau, der das Brusttuch bereits abhanden gekommen war und die nur noch halbherzige Anstrengungen unternahm, die Hände der Männer von sich abzuhalten. Viele von Wein oder Bier schwer gewordene Köpfe ruhten zwischen Schüsseln auf den bekleckerten Tischen, manch ein Zecher war von der Bank gerutscht, und aus unbeleuchteten Ecken drang unterdrücktes Kichern. Zu kurz zuckten die Blitze, als dass Jakoba hätte erkennen können, was die bewegten Leiber dort trieben.
Direkt unter ihr stand der erhöhte Tisch ihrer Eltern. Sie traute sich nicht, den Kopf übers Geländer der Empore zu halten, da sie nicht wusste, wie weit der Schein der Kerzen in den hohen Ständern und der Fackeln in den geschmiedeten Haltern reichte. Sie sah nur das Ende der langen Tafel, wo sich der winzige Tischhund ihrer Mutter auf die Hinterbeinchen gestellt hatte und versuchte an die Speisereste im silbernen Almosenschiff heranzukommen. Der Aufschneider säbelte am Tranchiertisch ein Stück vom Hirschkuhbraten ab und hielt es dem Hündchen hin. Jakoba verzog das Gesicht, als er sich danach in die Hand schnäuzte. Er nahm dafür nicht, wie es sich gehörte, die Hand, die das Messer hielt, sondern die, mit der er aß.
Ihr war schon öfter aufgefallen, dass sich Erwachsene offensichtlich nicht an die zehn Tischregeln zu halten hatten, die ihrer Mutter Marguerite als eine wichtige Erziehungsgrundlage galten. Sie hatte mit eigenen Augen gesehen, wie Würdenträger ihre Zähne am Tischtuch gesäubert hatten! Sogar ihr Vater tunkte Bissen ins Salzfass und spuckte zerkaute Fleischstücke aus. »Quod licet jovi, non licet bovi«, bemerkte Marguerite kühl, wenn Jakoba sie darauf hinwies. Gut, ihr Vater war vielleicht so etwas wie ein Gott, aber das machte seine Tochter doch nicht zum Rindvieh!
Diener sammelten von einigen Tischen die Essunterlagen ein, jene saucengetränkten Brotscheiben, auf denen noch Fleisch- und Geflügelreste klebten und die zusammen mit dem Inhalt des Almosenschiffes an die wartenden Armen der Umgebung vor dem Tor des Schlosses verteilt wurden. Jakoba gruselte sich jeden Tag aufs Neue vor diesen dunklen abgerissenen Gestalten mit wirren Haaren, wilden Augen und widerlichen Hautkrankheiten, die sich um diese Krumen von den Tischen der Reichen rissen.
Ihren Vater, der mit dem Rücken zum Kamin am Kopfende saß, konnte sie nicht sehen, aber sie horchte auf, als er in seinem etwas hölzernen Französisch rief: »Meine Tochter ist also Teil eines Kuhhandels! Ihr habt Jakoba verkauft!«
Jakoba erstarrte. Verkaufen hieß nie wieder sehen. Das hatte sie gelernt, als ihr Lieblingspferd verkauft worden war. Und jetzt hatte man sie selbst verkauft! Was bedeutete das? War sie dann doch eine Art Rindvieh? Ihr Vater konnte nicht zulassen, dass sie verkauft wurde, er war Herzog Wilhelm, Graf von Holland, Seeland und dem Hennegau, der mächtigste Mann im Land, hatte ihre Bastardschwester Beatrix behauptet. Jakoba dachte nicht mehr an die Kerzen, die sie verraten könnten, sie blickte über das Geländer auf die Köpfe darunter.
»Das ist das Los von Fürstentöchtern«, bemerkte der Bruder ihrer Mutter, Herzog Johann von Burgund, dem zu Ehren dieses Fest gegeben wurde. Jakoba erkannte ihn an seiner Stimme und der extravaganten Kleidung aus Goldtuch und violetter Seide. Sein Gesicht lag im Schatten der kompliziert gebundenen üppigen Kopfbedeckung aus rotem Samt mit Rosen aus Rubinen.
»Natürlich musst du deine Tochter weggeben!« Das war Johann von Bayern, der Bruder ihres Vaters, der mit diesen Worten seinen Platz als Lieblingsonkel bei Jakoba verspielte. Sein Vater, Jakobas Großvater, der im vergangenen Jahr gestorbene Herzog Albrecht von Bayern, hatte seinem jüngsten Sohn die kirchliche Laufbahn vorgeschrieben und dessen Wahl zum Bischof von Lüttich geregelt. Johann von Bayern wollte aber keine höhere Weihe als die zum Subdiakon empfangen. Er war gewissermaßen Bischof im Wartestand. Damit hielt er sich die Möglichkeit offen, aus dem Kirchendienst auszuscheiden, falls sich ihm etwas Interessanteres bieten sollte.
»Wenn man bedenkt …«, die klangvolle, aber kalte Stimme ihrer Mutter Marguerite ließ Jakoba erschauern, »… dass du sie gleich nach der Geburt am Tag des Heiligen Jakob am liebsten ertränkt hättest …«
»Verständlich«, meldete sich wieder Johann von Bayern, »wenn die Ehefrau nach sechzehnjähriger Ehe nur mit einer Tochter dienen kann. Jetzt ist Jakoba beinahe fünf. Wo bleibt der Erbe?«
Ein Blitz tauchte die Gesellschaft für einen Augenblick in grelles Licht. Mitten im Rittersaal sah Jakoba wieder die fremde Frau im weißen Gewand mit dem roten Stoff in der Hand. Ihre Füße schienen den Boden nicht zu berühren. Die Frau blickte zur Empore hinauf und fletschte die Zähne wie ein Hund, der gleich zubeißen würde. Jakoba floh. Sie rannte den Gang zurück zu ihrem Zimmer, riss die Tür auf, stürzte auf Mechthild zu und rüttelte die Kinderfrau wach.
»Lass das, Jakoba«, murrte Mechthild. »Geh ins Bett, sonst rufe ich den schwarzen Ritter, damit er dich holt.«
Noch eine Bedrohung! War sie denn nirgendwo sicher? Gab es niemanden, der sie beschützen konnte? Jakoba lief im Zimmer auf und ab, hatte Angst, ins Bett zu gehen und einzuschläfern Wenn sie wieder aufwachte, würde man sie wie ihr Lieblingspferd an einer Leine aus dem Schloss führen. Sie war verkauft worden und konnte gar nichts dagegen unternehmen. Wirklich nicht? Wenn sie nun weglief …
Sie stellte sich ans Fenster und sah hinaus. Das Gewitter hatte sich verzogen, und in der Ferne, hinter der dunklen Linie des Waldes, rötete sich der Himmel. »Hinter dem Wald fängt die Welt an«, hatte ihre fünf Jahre ältere Bastardschwester Beatrix gesagt.
»Was ist die Welt?«, hatte Jakoba wissen wollen. Sie erinnerte sich noch, wie Beatrix die Schultern gehoben und fragend »England?« gemurmelt hatte. Engelland, das klang nach Schutz, nach Höherem, da musste sie hin. Irgendjemand würde sie dort unter die Fittiche nehmen. Vor ihrer Familie war sie nicht sicher.
Während Mechthild wieder gleichmäßig schnarchte, zog sich Jakoba einen Umhang über ihr Nachthemd, öffnete die Tür und schlich auf den Gang. Es gelang ihr, unbemerkt das Gebäude zu verlassen, den Schlossplatz zu überqueren und durch die Pferdeställe hinaus auf die Weide zu kommen. Sie begann zu rennen.
Am Ende der Weide fingen die Sümpfe an. Noch nie hatte sich Jakoba allein so weit vom Schloss entfernt. Sie rannte, so schnell sie konnte, und versuchte nicht an die dunkle Linie des Waldes zu denken, den sie durchqueren musste, um in die Welt nach Engelland zu gelangen. Der Wald ohne Gnade, wie er in den Märchen hieß, der Wald, in dem Strauchritter ihr Unwesen trieben, erschien ihr jetzt viel weniger bedrohlich als die Aussicht, verkauft zu werden. Wer immer sie erwerben wollte, würde wahrscheinlich wenig für sie zahlen müssen. »Ein Mädchen ist nichts wert.« Oft genug hatte sie diesen Spruch gehört. Sie hoffte, die Kobolde, Feen, Elfen und anderen Waldgeister schliefen noch oder waren ihr freundlich gesinnt. Hexen hielten ihre Zusammenkünfte bekanntermaßen auch im Wald ab, wo sie dem Teufel oder ihrer Göttin kleine Kinder opferten. Aber Hexen scheuten das Licht und würden Jakoba wohl kaum im Morgengrauen auflauern.
Einmal stolperte sie über eine Wurzel, fiel und schlug sich das Knie auf. Sie setzte sich auf den feuchten Boden und begann bitterlich zu weinen. Es war kalt und sie erwog zurückzukehren, aber als sie sich umwandte, schien das Schloss weiter entfernt zu sein als der Wald. Und dahinter begann die Welt …
Sie stand auf, konnte jetzt aber nur langsam vorwärts kommen, weil ihre Füße im Schlamm schwer wurden. Solange sie sich erinnern konnte, hatte man sie vor den Sümpfen gewarnt, und wenige Minuten später verstand sie, warum. Sie konnte den rechten Fuß nicht mehr aus dem Schlamm ziehen und spürte, wie auch ihr linker immer tiefer einsank. Als ob irgendeine große Macht unter der Erde sie zu sich hinabsaugen wollte.
»Hilfe!«, schrie Jakoba. »Papa! Hilfe!« Ein paar Vögel flogen hoch und irgendwo krächzte ein Rabe. Ein schlechtes Zeichen. Würde ihr Vater wirklich zu Hilfe kommen? Hatte er sie bei der Geburt nicht ertränken wollen? Jakoba stieß gellende Laute aus.
Inzwischen war sie bis zu den Oberschenkeln eingesunken. Sie beugte sich vor, suchte Halt an einem Grasbüschel und weinte laut, als sie es mitsamt seinem Wurzelwerk in der Hand hielt. Das Gesicht ihres Cousins Philipp erschien vor ihr, aber es war nur ein Trugbild, denn er lächelte zufrieden. Philipp, Herzog Johann von Burgunds Sohn, war ihr Lieblingscousin, er würde sie nicht untergehen lassen. Aber er schlief jetzt im Schloss und konnte nicht wissen, dass sie von der Erde verschluckt wurde. Eine winzige Hoffnung stieg in Jakoba auf: Philipp hatte in der Vergangenheit schon oft ihre Gedanken erraten, ihr lachend versichert, er habe Zugang zu den geheimen Kammern in ihrem Kopf. Sie glaubte ihm, denn mit niemandem – nicht einmal mit ihrem Vater – fühlte sie sich enger verbunden. Verzweifelt versuchte sie ihren Gedanken Flügel zu verleihen, sie durch die dicken Wände des Schlosses und in Philipps Kopf dringen zu lassen.
»Philipp!«, rief sie verzweifelt. Aber wie sollte er so schnell zu ihrer Rettung kommen können? Der Schlamm hatte schon ihre Mitte erreicht, als sie plötzlich eine Stimme hörte: »Bleib still, strample nicht so, sonst versinkst du noch schneller.« Sie wandte den Kopf. Der Körper des Sprechers schien weiter entfernt zu sein als seine Stimme. Erst als sie genauer hinsah, erkannte sie, dass ein Zwerg zu ihr sprach. Sie atmete tief durch. Dieser Waldgeist schien ihr gewogen zu sein. Er legte sich auf den Bauch, rutschte langsam zu ihr hinüber und hielt ihr einen langen Ast hin.
»Zieh dich daran hoch!«
Er war fast so groß wie sie, stellte sie fest, als sie nach ihrer Rettung zitternd neben ihm stand. »Dank dir, guter Waldgeist«, sagte sie höflich. Sie wusste nicht genau, was die Etikette im Umgang mit Geistern verlangte.
Er lachte fröhlich. »Ich bin kein Geist, sondern David vom Jagdforst Mormal, ein ganz normaler Sterblicher, nur eben ein bisschen kürzer als die meisten. Das hat den Vorteil, dass ich nicht tief falle, wenn ich stolpere.«
»Aber ich habe dich noch nie gesehen«, wunderte sich Jakoba.
»Du kannst nicht jeden in der Grafschaft kennen«, erwiderte er und reichte ihr wie einer erwachsenen Dame den Arm. »Ich bringe dich zu meiner Mutter. Du musst gewaschen werden und andere Kleidung anziehen.«
Am Arm des Zwerges verlor Jakoba jede Angst, als sie den Wald betrat. Zum ersten Mal seit jener fürchterlichen Nachricht fühlte sie sich sicher. Es gab keinen Pfad, aber David schien sich an Bäumen und Büschen zu orientieren. Nach einem kurzen Marsch erreichten sie eine Lichtung. Hier stand eine kleine Lehmhütte mit weit heruntergezogenem Erddach, umgeben von dem ordentlichsten Kräutergarten, den Jakoba je gesehen hatte. Eine Frau in einem einfachen braunen Kleid, das mit einem Stoffgürtel in der Mitte zusammengehalten wurde, öffnete die Tür. Ihr Kopf war unbedeckt und blonde Locken fielen ihr über die Schultern. So schön und hoch gewachsen hatte sich Jakoba die Mutter des Zwergs nicht vorgestellt.
Ohne Fragen zu stellen zog sie das Mädchen ins Haus.
»Geh zum Brunnen, hol Wasser und bleib dann draußen«, sagte sie zu ihrem Sohn.
»Ich bin Marjan«, erklärte sie, während sie Jakoba mit gewandten Händen auskleidete und dann auf einen Schemel setzte. »Und du bist des Herzogs Tochter, auch wenn ich keine Ähnlichkeit zu deiner Frau Mutter feststellen kann. Wir richten dich wieder her und dann bringe ich dich zurück zum Schloss.«
»Nein, bitte nicht!«, entfuhr es Jakoba.
Während Marjan eine in Wein getränkte Kräuterpackung um ihr Knie band, erzählte das Kind seine Geschichte.
Marjan lachte. »Du arme Kleine!«, rief sie. »Natürlich wirst du nicht verkauft. Deine Familie hat einen Gemahl für dich gefunden, das ist gar nicht so schlimm, denn den wirst du brauchen, wenn du später über dieses Land herrschen willst. Du hast das falsch verstanden, Jakoba, und das kommt davon, wenn man heimlich lauscht.«
Jakoba ließ den Kopf hängen. »Aber da ist noch was«, flüsterte sie, »eine unheimliche weiße Frau. Ich habe sie bei mir im Zimmer gesehen und später im Rittersaal. Sie stand nicht auf dem Boden und sie hatte etwas Rotes in der Hand.«
»Eine weiße Frau?«, fragte Marjan betroffen. Weiße Frauen waren Vorboten des Todes.
»Ja«, erwiderte Jakoba, und ihre Augen, die Marjan an die Nordsee bei heftigem Sturm erinnerten, weiteten sich: »Ich habe sie ganz deutlich gesehen. So wie Philipp vorhin im Sumpf. Aber er war gar nicht da. Er ist mit seinem Vater zu Besuch bei uns. Im Schloss.«
Marjan zog das Kind an sich und streichelte ihm sanft über den Kopf.
»Passiert das öfter, dass du Dinge siehst, die gar nicht da sind?«, fragte sie langsam.
»Für mich sind sie da, auch wenn sie oft kleiner und heller aussehen als in Wirklichkeit«, erwiderte Jakoba. »Aber wenn ich sie anfassen will, dann sind sie weg. Wie Monchou.«
Sie begann zu weinen, und nachdem ihr Marjan einen Becher Wasser gereicht hatte, erzählte sie von ihrem Hündchen. Monchou hatte vor wenigen Wochen zu ihren Füßen gespielt, und plötzlich hatte sie eine Szene gesehen, wie das Hündchen unter den Hufen eines schwarzen Hengstes zerdrückt wurde. Sie hatte Monchou in ihre Arme genommen und über das Bild geweint. Drei Tage später geschah das Unglück, genau wie sie es vorhergesehen hatte.
»Und dann habe ich wieder geweint«, schloss sie.
»Hast du irgendjemandem davon erzählt?«, fragte Marjan.
»Pater Lukas. Er hat das Kreuz gemacht und mir gesagt, dass ich mich vor Dämonen hüten soll, sonst nimmt es ein schlechtes Ende mit mir. Dass ich den Teufel nicht versuchen darf. Einen ganzen Tag lang musste ich ohne Pause ein Gebet sprechen.« Tränen stiegen Jakoba in die Augen, als sie mit monotoner Stimme zitierte: »Forsachistu diabolae? Ek forsacho diabolae. End allum diabolgelde? Ek forsacho allum diabolgelde. End allum diaboles werkum? End ek forsacho allum diaboles werkum and wordum.« (Entsagst du dem Teufel? Ich entsage dem Teufel. Und dem ganzen Teufelspack? Ich entsage dem ganzen Teufelspack. Und allen Werken des Teufels? Und ich entsage allen Werken und Worten des Teufels.)
Jakoba stampfte mit einem Fuß auf. »Aber ich habe doch gar nichts getan!«
Marjan stand auf und durchquerte die Hütte. Zwei kleine Fenster ließen nur wenig Tageslicht ein, aber die Feuerstelle mitten im Raum verbreitete behagliche Wärme. Durch ein Loch im Dach zogen Rauch und Dampf ab. Jakoba sah sich neugierig um. Es stimmte also, dass arme Leute nur ein Zimmer und keine Wandbehänge hatten! Aber wo bewahrte Marjan Kleidung, Wäsche, Tischgerät und andere Gegenstände des täglichen Bedarfs auf? Die kleine Truhe neben dem grob gezimmerten Küchentisch würde höchstens Platz für zwei der juwelenbesetzten Kleider ihrer Mutter bieten. Es gab noch eine Bank, zwei Schemel und ein großes Bett neben der Feuerstelle, auf der in einem eisernen Topf eine wohlriechende Suppe brodelte. Büschel getrockneter Kräuter hingen von der Decke, und auf einem Regal waren harte Käselaiber aufgereiht. Jetzt erst merkte Jakoba, dass sie Hunger hatte. Aber durfte sie Essen zu sich nehmen, das in dieser Hütte ohne Küchenmeister zubereitet worden war? Vielleicht würde es solche Geschwüre in ihrem Gesicht hervorrufen, wie sie sie bei einigen Armen gesehen hatte. Vielleicht würde ihr eine Hand abfallen. Oder sie würde aufhören zu wachsen, wie der Sohn dieser Frau. Aber vielleicht war das sogar ihre Rettung. Beschädigte Ware würde ihr Käufer nicht annehmen wollen.
»Ich habe Hunger!«, übertönte sie das Meckern der Ziege, die an einem der Bettpfosten angebunden war.
»Nimm dir von der Suppe«, forderte Marjan sie auf. »Schüssel und Löffel findest du auf dem Tisch. Aber pass auf, dass dein Verband nicht verrutscht.« Jakoba blieb sitzen. Sie hatte Angst, sich dem Feuer zu nähern, und wusste nicht, wie sie die heiße Suppe in eine Schüssel befördern sollte.
Marjan hob einen schweren Tonkrug vom Boden, drehte ihn um und entnahm ihm einen kleinen ovalen weißen Stein, der rötlich schimmerte. Er war ganz glatt, als ob er vom Wasser der Jahrtausende geschliffen worden wäre.
»Nimm diesen Stein, Jakoba, und bewahre ihn gut. Jedes Mal, wenn sich eines der Gesichte zeigen will, schau auf den Stein und drehe ihn dann in deiner Hand. Die Seele des Steins wird das Bild zum Verschwinden bringen.«
Jakoba ließ den Stein fallen und starrte Marjan entsetzt an. »Du bist eine Hexe! Pater Lukas hat gesagt, dass Hexen an die Macht von Steinen, Bäumen und Pflanzen glauben! Ek forsacho diabolae …«
Marjan bückte sich und hob den Stein wieder auf.
»Natürlich haben Bäume und Pflanzen Macht. Wie könnten sie sonst wachsen? Sogar Steine verändern sich, wenn auch langsamer. Und wer, denkst du, hat in all diese Dinge die Macht gesteckt?«
»Gott?«, fragte Jakoba flüsternd.
»Genau. Dein Pater Lukas hat Recht, wenn er sagt, dass die alten Gebräuche, die heidnischen Sitten verwerflich sind, wenn sie sich gegen Gottes Gesetze richten. Sei unbesorgt, Jakoba, ich bin eine Dienerin Gottes.«
Sie dachte flüchtig an den Tag, an dem sie ihr Gelübde gebrochen und mit dem Zwerg aus dem Kloster geflohen war. Aber auch dies hatte sie zu Ehren Gottes getan. Es konnte nicht in seinem Sinne sein, dass das missgestaltete Wesen ertränkt wurde, so wie es von hoher irdischer und vorzüglich bezahlender Stelle angeordnet worden war. Sie drückte Jakoba den Stein in die Hand. Wie von selbst schlossen sich die Finger des Kindes um das glatte Objekt. Es fühlte sich gut an.
»Du solltest in jedes Kleid eine kleine Tasche nähen lassen, damit du ihn immer bei dir hast«, schlug Marjan vor. Mit einem großen hölzernen Löffel füllte sie eine Suppenschüssel und reichte sie Jakoba.
»Wenn du dich gestärkt hast, brechen wir auf. Deine Eltern werden sich sorgen.«
»Kann ich nicht lieber bei dir bleiben?«, fragte Jakoba und setzte die Schüssel an den Mund. Sie strahlte Marjan an. Noch nie hatte ihr eine Suppe so gut geschmeckt.
Es kam anders. Marjan und David blieben bei Jakoba auf dem Schloss. Herzog Wilhelm jagte Mechthild davon, als Jakobas Fehlen entdeckt wurde, und bot Marjan die frei gewordene Stelle als Kinderfrau an. Marjan wusste, dass ein solches Angebot ein Befehl war. Trotzdem versuchte sie Einwände geltend zu machen. Sie müsse sich um David kümmern. Herzog Wilhelm fand auch hier eine Lösung: David habe eine schöne Stimme, sei klug und amüsant. Mit entsprechender Ausbildung könne er sich zu einem hervorragenden Troubadour und Hofnarren entwickeln. Zwerge seien zu kostbar, als dass man sie verstecken dürfe! Er werde ihm die Laute überlassen, die der Herzog von Burgund von seinem letzten Kreuzzug mitgebracht habe. – Sie könne ihren Kräutergarten und ihre Ziegenherde nicht im Stich lassen, argumentierte Marjan. Herzog Wilhelm gab augenblicklich Befehl, sämtliche Kräuter auszugraben und im Küchengarten des Schlosses einzupflanzen. Die Ziegenherde werde auf seinen Weiden besser gedeihen als im Wald, versicherte er. Und ließ eine Drohung mitschwingen: Das Häuschen im Wald sei ohne seine Genehmigung errichtet worden, und er könne sich nicht erinnern, dass irgendein Forstbewohner jemals Abgaben bezahlt hätte. Wenn er ihr die Rechnung präsentierte, würde ihr nur noch ein Leben als Tagelöhnerin bleiben.
Marjan gab nach. Sie hatte im Laufe ihres Lebens genügend verödete Höfe gesehen und die Bauern bedauert, die ihren Besitz im Stich hatten lassen müssen und sich als Knechte verdingten. Seitdem die Geldrente die Steuer in Form von Naturalien abgelöst hatte, der Ernteertrag also nicht mehr maßgeblich für die Abgaben war, flüchteten in schlechten Jahren immer mehr Bauern von ihren Höfen. Die teilweise Aufhebung der Leibeigenschaft hatte eine andere Form der Sklaverei hervorgerufen.
Herzogin Marguerite betrachtete die neue Kinderfrau mit Argwohn. Nicht, weil sie befürchtete, der Herzog könne der Schönheit Marjans erliegen. Es war ihr nur recht, wenn er seine Freuden – ebenso wie sie – anderswo suchte und sie in Ruhe ließ. Aber irgendetwas an Marjan kam ihr bekannt vor, schien sie an einen unangenehmen Vorfall zu gemahnen, und es ärgerte sie, dass sie nicht dahinter kam, was dies war. Auf ihre Frage, ob sie einander schon einmal begegnet wären, hatte Marjan erwidert, dass sich die Wege vieler Menschen kreuzten, die Herzogin aber auf der Falkenjagd nie in die Nähe ihres Häuschens gekommen sei.
Den Zwerg hatte Marguerite sofort ins Herz geschlossen und sie ernannte ihn augenblicklich zu ihrem persönlichen Pagen.
»Eine bessere Ausbildung als in der Kemenate meiner Schwester kann sich ein künftiger Hofnarr kaum wünschen«, meinte Johann von Burgund beim Abendessen und fügte schnell hinzu, als sich Wilhelms Stirn umwölkte: »Sie ist die Meisterin der zarten Worte, der Zwischentöne und des feinen Stichs.«
»Du meinst also, meine Frau hat die Gabe der burgundischen Diplomatie in unser barbarisches Land gebracht?«, fragte Wilhelm. »Wenn dein Sohn sie auch geerbt hat, dann soll er doch meiner Tochter deine Pläne mitteilen. Es bricht mir das Herz, dass sie glaubte, ich wollte sie ertränken! Und dass wir sie verkaufen würden!«
»Das waren deine Worte«, erinnerte ihn Johann von Burgund und wischte sich den Mund mit dem weiten Ärmel ab, ehe er zu seinem Pokal griff.
»Du hast mit dem französischen Hof verhandelt, nicht ich, ihr Vater. Ich würde meine Tochter lieber einem holländischen, seeländischen oder hennegauischen Edelmann anvertrauen, der weiß, wie es um unsere Länder steht. Der den Kabeljauen zeigt, was ein echter Haken ist! So ein verweichlichtes Knäblein vom französischen Hof passt nicht zu uns. Außerdem könnte er die Krankheit seines Vaters geerbt haben …«
Johann von Burgund schlug mit der flachen Hand auf den Tisch. »Oder den bayerischen Dickschädel seiner Mutter Isabella! Dann würde er hier doch vorzüglich gedeihen!« Er verzog kurz das Gesicht, deutete auf den Schweinebraten und wandte sich an den Truchsess: »Zu wenig Ingwer, mein Lieber, und saure Äpfel wären besser gewesen.« Der Truchsess nickte bekümmert. »Aber dafür ist das Blancmanger außerordentlich gut gelungen«, lobte der Herzog. »Weißfleisch von Kapaunen ist eben schmackhafter als das von Hühnern! Mein Küchenmeister Gilles Paraille hätte die Speise allerdings noch mit gerösteten Mandeln und Granatapfelkernen serviert.«
Wilhelm von Bayern biss sich auf die Lippen. Es konnte offenbar keine Mahlzeit ohne den Hinweis auf Johanns berühmten Koch vergehen. Zahlreiche Fürstenhäuser hatten sich um die Dienste des begnadeten Küchenmeisters gerissen und auch Wilhelm hatte ihm fürstliche Entlohnung und Güter versprochen. Aber Gilles Paraille hatte sich für den Hof in Dijon entschieden, da er dort – wie der Herzog von Burgund nicht müde wurde zu zitieren – seine Kunst mit den feinsten Zutaten der Welt in der am besten ausgestatteten Küche der Christenheit – sieben Schornsteine! – ausüben könne.
»Übrigens hat mir der gefüllte Hammelbug bei meinem letzten Besuch auch vorzüglich gemundet«, fuhr Johann fort.
»Wird morgen wieder serviert«, beeilte sich Marguerite zu versichern. Sie erntete einen strafenden Blick ihres Bruders.
»Fleisch am Mittwoch, Marguerite?« Er wandte sich an seinen Schwager Johann von Bayern: »Mich dünkt, du solltest diesen Haushalt in christlichem Brauchtum unterweisen.«
Herzog Wilhelm erwog eine scharfe Bemerkung. Was sollte er sich noch alles von dem arroganten Burgunder gefallen lassen! Dessen neunjähriger Sohn Philipp meldete sich zu Wort.
»Meine verehrte Tante hat sich wohl im Wochentag geirrt«, sagte er versöhnlich.
Am nächsten Morgen machte sich Philipp daran, Jakoba Unterricht im Schachspiel zu erteilen. Mit dem Brett und einem Sack voller fein geschnitzter Figuren setzte er sich zu seiner Cousine in die Fensterbank des blauen Zimmers, dessen Bezeichnung von den vielen, meist in Blautönen angefertigten Wandteppichen herrührte, die den Steinmauern die Kälte nahmen.
»Du hast in deinem Traum wirklich gehört, wie ich dich gerufen habe?«, fragte Jakoba aufgeregt und blickte Philipp eindringlich in die schönen hellgrauen Augen.
»Ich war gerade dabei, mich in den Vogel Greif zu verwandeln und dich zu erretten«, versicherte Philipp, »als plötzlich eine schöne Hexe …«
»Marjan ist keine Hexe!«, unterbrach ihn Jakoba mit funkelnden Augen.
Wenn sie ihr Naschen rümpft, sieht sie niedlich aus, dachte Philipp. Er wünschte, seine vier Schwestern würden ihn ebenso anhimmeln wie seine Cousine. Aber die Mädchen nahmen ihm übel, dass er als einziger Sohn und Erbe von den Eltern bevorzugt wurde.
»Ich erzähle dir von meinem Traum. Du musst die Dinge nicht durcheinander bringen«, sagte Philipp strafend und tippte ihr auf die Nasenspitze. »Mondgesicht«, setzte er hinzu.
»Pferdekopf!«, gab Jakoba zurück. Aber insgeheim neidete sie Philipp den langen schmalen Burgunderkopf mit der hohen Stirn. Sie hatte leider den runden bayerischen Schädel und tiefen Haaransatz ihres Vaters geerbt und würde sich später Stirn und Schläfen rasieren müssen. Ihre Mutter hatte das nicht nötig. Die gebürtige Burgunderin entsprach von Natur aus dem Schönheitsideal der Zeit. Der sanfte Aprikosenduft, der sie umwehte, stammte von dem mit Essenzen angereicherten Zuckerwasser, mit dem sie ihre Hennin-Frisur zu kunstvoller Höhe türmen ließ.
»Du wirst dich im nächsten Monat mit dem Sohn des französischen Königs verloben«, sagte Philipp, als er die Figuren auf dem Brett verteilte. »Das«, er hielt eine schön geschnitzte Holzfigur hoch, »ist der weiße König und hier ist seine Königin, das ist die weiße Dame.«
»Werde ich dann Königin von Frankreich?«
»Nein, du Dummerchen, das wird meine Schwester Margarete. Sie wird den französischen Kronprinzen Ludwig heiraten. Jean ist der zweite Sohn. Er wird hier mit dir leben und sich darauf vorbereiten, über deine Länder zu herrschen. Dein Vater wird sein Lehrer sein. Und Pater Lukas und Dirk Potter auch. Es ändert sich also gar nicht so viel, du wirst eben einen neuen Spielkameraden haben. Er ist bestimmt ein guter Schachspieler, also pass jetzt auf, damit du dich nicht blamierst.«
Während er ihr die Figuren erklärte, erwähnte er nebenbei, dass er selbst Jeans Schwester Michaela heiraten werde.
Jakoba jubelte. »Dann wirst du ja mein Bruder sein!«
»Das bin ich sowieso beinahe«, lachte er, stand auf, nahm sie an den Händen und schwang sie im Kreis herum, dass ihre Röcke nur so flogen. »Dein Vater und meine Mutter sind Geschwister und deine Mutter und mein Vater auch, wie du weißt. Sonst haben nur Geschwister die gleichen Großelternpaare.«
»Am liebsten würde ich dich heiraten!«
Philipps schönes Gesicht wurde ernst. »Das wird der Papst nie erlauben, dazu sind wir viel zu nahe miteinander verwandt.«
»Welcher Papst?«, fragte Marguerite vergnügt, als sie ins Zimmer trat. David trug ihre Schleppe. »Der in Rom oder der in Avignon?«
Philipp verbeugte sich vor seiner Tante. »Es ist immer gut, eine Auswahl zu haben, verehrte Tante. Wenn es nach mir ginge, hätte man einen dritten Papst, da bekanntlich aller guten Dinge drei sind.«
»Der wird schon noch kommen«, meinte Marguerite, »und dann fragen wir immer den, der uns am meisten gewogen ist.«
»Neigungen können sich ändern«, erwiderte der Neunjährige, »aber an Prunk gewöhnt man sich. Ich würde den Papst meiner Wahl verwöhnen. Dann tut er, was ich will.«
Nachdenklich betrachtete Marguerite ihren Neffen, den Enkel ihres Vaters Philipps des Kühnen. Hier wächst jemand heran, der gefährlich werden kann, dachte sie. An jenem lauen Sommermorgen des Jahres 1406 im blauen Zimmer des Schlosses Le Quesnoy nahm sich Marguerite vor, niemals Philipps Feindin zu werden.
In späteren Jahren nach ihrem Verlobungsfest in Compiègne befragt, konnte sich Jakoba nur an weniges erinnern. Daran, dass die perlenbesetzte Kappe gedrückt und das Brokatkleid schwer auf ihrem schmächtigen Leib gewogen hatte. Dass ein kohlenhäutiger Musiker mit einem Äffchen und ein deutscher Waldmensch mit einem tanzenden Bären aufgetreten waren. Von den vielen nahen Verwandten um sie herum kannte sie kaum einen. Auch der französische Königssohn Jean von Touraine war ihr Cousin, aber der Papst in Rom hatte nach fürstlicher Entlohnung dieser Ehe die Dispens erteilt.
Jakoba mochte Jean auf Anhieb. Wahrscheinlich, weil ihr der zartgliedrige blonde Prinz bei jedem Treffen und jeder Festveranstaltung in spannender Fortsetzung die Abenteuer des französischen Königssohns Lothar und seines Gesellen Maller erzählte. Die Liebesgeschichte zur schönen Zormerin gefiel ihr, aber sie verstand nicht, warum die Männer dauernd Krieg führen mussten. Am schlimmsten fand sie, dass Lothar von seinem Cousin Otto verraten, eingesperrt und beinahe umgebracht worden war.
»Lothar hat Otto doch geliebt!«, klagte sie.
Jean nahm ihre Hand und küsste sie. Schnell zog sie die Finger weg. Er lachte. »Daran wirst du dich gewöhnen müssen«, sagte er und meinte den Handkuss. Jakoba aber verband von jenem Zeitpunkt an jeden Handkuss mit dem Gedanken an Verrat, an den man sich gewöhnen müsste.
Die erste Begegnung mit ihrer künftigen Schwiegermutter Königin Isabella, die wie Jakobas Vater aus Bayern stammte, war sehr kühl.
»Vielleicht wird sie ja mal schön«, sagte Isabella, als ihr am Vorabend der Verlobung im großen Saal des Schlosses in Compiègne Jakoba vorgestellt wurde. Sie blieb auf dem eigens für ihre enorme Leibesfülle angefertigten Sessel sitzen und musterte Jakoba wie eine Stute auf dem Pferdemarkt. »Bayern und Burgund haben zumindest bei Philipp eine ansehnliche Kombination ergeben.« Als sie beim Lachen die Zähne zeigte, erschrak Jakoba. Ohne sich um das Protokoll zu kümmern, drehte sie sich um und rannte zu ihrem Vater. Zitternd schmiegte sie sich an ihn.
»An der Erziehung muss dringend gearbeitet werden«, bemerkte Isabella.
Herzog Wilhelm gab seiner Tochter einen kleinen Schubs.
»Verneigung«, murmelte er, »und entschuldige dich!«
»Sie hat Angst vor ihr«, flüsterte Jean, der neben ihm stand. »Das verstehe ich gut.« Dankbar blickte die Fünfjährige ihren neunjährigen Verlobten an und machte einen Hof knicks, ohne der Königin ins Gesicht zu sehen.
Nur Marjan vertraute Jakoba am Abend an, was ihr Angst gemacht hatte: »Sie war die weiße Frau! Ganz bestimmt! Ich habe sie deutlich erkannt!«
»Dann ist dein Gesicht jetzt erklärlich«, meinte Marjan. »Du hast deine künftige Schwiegermutter gesehen, weiter nichts. Das ist doch nicht schlimm?«
»Sie hatte einen roten Stoff in der Hand!«
»Auch das ist nichts Besonderes, mein Kind!«
»Und den König habe ich gar nicht gesehen!«
Marjan schwieg. Jakoba würde schon früh genug erfahren, dass König Karl VI. seit Jahren an Anfällen geistiger Umnachtung litt und seine Frau die eigentliche Herrscherin Frankreichs war. Sie hoffte, Jakoba würden nie die Gerüchte zu Ohren kommen, denen zufolge die jüngeren der zwölf Kinder Isabellas nicht von Karl, sondern von seinem Bruder Ludwig, dem Herzog von Orléans, gezeugt worden waren.
Obwohl er ihn etwas zu verzärtelt fand, schloss Herzog Wilhelm seinen künftigen Schwiegersohn Jean von Touraine ins Herz. Jakoba, die sich Marguerites Erziehung weitgehend entzog, war ein Wildfang, ein freches, selbstbewusstes Mädchen, das sich öfter im Ton vergriff. Und dessen Benehmen nicht nur am französischen Königshof Anlass zur Klage gab. Wilhelm hoffte, dass es Jean gelingen könnte, seine Braut mit sanftem Druck zu zähmen.
Er gab sich selbst die Schuld, seine Tochter zu sehr verwöhnt zu haben. Anfangs hatte er ihr aus einer gewissen Gleichgültigkeit heraus zu viele Freiheiten gelassen. Es hatte ihn geärgert, dass seine Frau ihm nur einen weiblichen Erben geboren hatte. Um die Herzogin dafür zu strafen, hatte er Jakoba vieles durchgehen lassen. Er war der Herr im Haus, ließ er Marguerite wissen, und da wegen ihrer Unfähigkeit, ihm einen Sohn zu schenken, Jakoba seine Alleinerbin sei, bestimme er über ihre Erziehung. Das Kind dankte es ihm mit bedingungsloser Liebe und entschiedener Abkehr von der Mutter.
Das Band zwischen Vater und Tochter wurde enger, als das Kind heranwuchs. Inzwischen war Herzog Wilhelm sogar froh über das Ausbleiben eines männlichen Erben. Die wenigsten Fürstensöhne hatten ein so inniges Verhältnis zu ihren Vätern wie Philipp zu Johann von Burgund. In dieser Zeit konnten männliche Erben den Vätern lebensgefährlich werden, weil sie oft nicht die Geduld aufbrachten, auf den natürlichen Tod des Erzeugers zu warten. Das galt auch für Schwiegersöhne, aber in dieser Hinsicht war Herzog Wilhelm beruhigt. Jean von Touraine strahlte Güte und Milde aus und fand größeren Gefallen an alten Schriften als an modernen Intrigen. Ein ungewöhnlicher Zug an Fürstenkindern zu Beginn des 15. Jahrhunderts – vor allem wenn sie vom französischen Königshof stammten.
Zwei Jahre später konnte Jakoba nicht mehr begreifen, weshalb sie in jener Gewitternacht aus dem Schloss geflüchtet war.
»Trotzdem bin ich froh darüber«, sagte sie zu Marjan, »und Mutter und Vater sind es auch. Weil ihr jetzt bei uns seid.«
Ihre Mutter lachte oft, seitdem David im Haus war, und es geschah jetzt sogar, dass sie ihrer Tochter einen freundlichen Blick schenkte. Herzog Wilhelm war Marjan näher gekommen, wenn auch nicht auf jene Weise, in der er sonst attraktiven Frauen zu begegnen pflegte. Nach dem ersten Versuch, sie auf ein Lager zu ziehen, hatte Marjan dem Herzog unmissverständlich zu verstehen gegeben, eine weitere Gunstbezeugung dieser Art würde sie aus dem Schloss vertreiben.
»Es wäre nicht meine erste Flucht«, versicherte sie. Das war alles, was über ihre Vergangenheit zu erzählen sie bereit war. Herzog Wilhelm, der an Weigerungen, noch dazu in so wohlgesetzten Worten, nicht gewöhnt war, versuchte sie über ihre Familie auszufragen. Marjan beharrte darauf, David sei ihre ganze Familie.
»Wo hast du lesen und schreiben gelernt?«, wollte Herzog Wilhelm wissen. »Woher stammen deine Kenntnisse über Heilkunst, Latein, Kirchenlehre und Astrologie? Gib zu, du bist von hoher Geburt!«
Sie schwieg und Herzog Wilhelm dachte sich seinen Teil. Wahrscheinlich hatte sie sich einst mit einem Troubadour oder einem anderen wertlosen Gesellen abgegeben und war von ihrer Familie verstoßen worden, als sie David gebar. Als Unverheiratete hätte sie sich nicht so leicht darauf berufen können, dass sich ein Inkubus an ihr vergriffen habe, ein Dämon, der einsame Frauen im Schlaf befruchtete. Diese Monster bestiegen meist nur verheiratete Frauen, deren Mann sich zum Beispiel auf einem Kreuzzug befand.
Nun, es freute Wilhelm, dass Marjan vielseitig gebildet war, konnte sie so doch auch Jakoba eine Lehrerin sein und Pater Lukas sowie den gräflichen Schreiber Dirk Potter entlasten, die genug damit zu tun hatten, Prinz Jean auf die Zukunft vorzubereiten. Aber wenn sie ihm schon ihren Körper versagte, so wollte er sich wenigstens an ihrem Geist erfreuen. So kam es, dass er sie immer häufiger um ihre Meinung bat und ihr Urteil zu schätzen lernte – sofern es nicht gerade um den jahrzehntelangen Krieg zwischen den adligen Geschlechtern und Städten in seinen Ländern ging. Marjan fand, dass Herzog Wilhelm diesen blutigen Auseinandersetzungen, die das Land zerrissen, ein Ende machen sollte.
»Unmöglich«, erklärte der Herzog und setzte sich auf die harte Bank neben dem Webstuhl, an dem Marjan arbeitete. »Ich werde nicht ruhen, ehe nicht jedem Kabeljau der Kopf abgeschlagen ist! Es sind alles Verräter, und du tätest gut daran, Jakoba zu lehren, ein echter Haken zu werden!«
Marjan kannte die Geschichte.
Dieser so genannte Zwist der Kabeljaue und Haken war entfacht worden, als Herzog Wilhelms Großmutter Margarete, die Ehefrau des deutschen Kaisers Ludwig von Bayern, ihren Sohn Wilhelm einsetzte, um die Erbländer im Norden zu verwalten. Wilhelm wollte aber nicht verwalten, sondern selbstständig regieren und Wilhelm V. heißen. Krieg gegen die eigene Mutter erschien ihm das geeignetste Mittel. Seine Anhänger, nach den blaugrauen schuppenartigen Rauten auf seinem Wappen Kabeljaue genannt, wünschten mehr Unabhängigkeit. Sie wehrten sich dagegen, als Hausmacht an einen arroganten deutschen Fürsten verschachert zu werden. Mit Speck fängt man Mäuse und mit Angelhaken Kabeljaue. Mutter Margaretes Getreuen bezeichneten sich flugs als Haken. Es wurde ein sehr blutiger Fischfang. Schlachten, in denen auch Mönche die Schwerter schwangen, Straßenkämpfe, Verschwörungen und Meuchelmord waren an der Tagesordnung. Der Riss ging durch alle adligen Familien in Holland und Seeland. Wilhelm V siegte, aber ihn traf der Fluch seiner Mutter: Er wurde wahnsinnig und starb kinderlos. Sein Bruder Albrecht erbte Wilhelms Länder und die Treue der Kabeljaue. Die wussten, wie man einen Fürsten an sich bindet. Sie führten ihm die schöne Aleida von Poelgeest zu, die als offizielle Mätresse bald mehr Macht über ihren Grafen hatte als dessen vor kurzem verstorbene Frau. Das war Grund genug für den legitimen Sohn, den heutigen Herzog Wilhelm und Grafen von Holland, zu den Haken überzulaufen und die Geliebte des Vaters heimtückisch zu erstechen. Natürlich musste er danach Hals über Kopf ins Exil flüchten. Aber in diesen bewegten Zeiten brauchte der Vater den Sohn für einen Feldzug gegen die Friesen und so versöhnte man sich wieder. Nach dem Tod seines Vaters wurde Wilhelm Herzog von Niederbayern. Aber er blieb ein holländischer Haken und verlangte von Marjan, seine Tochter Jakoba zu lehren, dass man sich den Erzfeind Kabeljau einzuverleiben habe.
»Ich widersetze mich den Befehlen des Herrn nur ungern«, sagte Marjan in einem Ton, der ihre Worte Lügen strafte, »aber man sagt, dass sich nach den Ereignissen in Lüttich Euer hochwohlgeborener Bruder Johann von Bayern den Kabeljauen annähert. Wollt Ihr einen Bruderkrieg?«
Wilhelm sprang auf und warf mit einer Handbewegung den Webstuhl um.
»Was fällt dir ein, du Hexe!«, fuhr er sie an. »Meinen Bruder zu verdächtigen! Er ist Bischof von Lüttich!«
»Aber immer noch ungeweiht«, gab Marjan ungerührt zurück. Sie sah den Herzog nicht an, als sie den Webstuhl wieder aufrichtete. »Und ein häufiger Gast in den Badehäusern. Ein Mann der Kirche, der ihre Gesetze nicht achtet, der Tausende bei dem Aufstand in Lüttich ums Leben hat bringen lassen.«
»Halt!«, unterbrach sie Wilhelm. »Da wagst du dich auf gefährliches Gebiet! Es geht nicht, dass die städtische Bevölkerung und die Gilden ihren regierenden Bischof einfach absetzen und selbst einen Regenten bestimmen! Wohin kommen wir denn, wenn wir den Bürgern Selbstverwaltung zugestehen!? Mein Bruder musste den Aufstand niederschlagen, und er musste Exempel statuieren und zeigen, dass eine harte Hand wichtig ist. Mein Schwager Johann von Burgund und ich fühlten uns verpflichtet ihm dabei zu helfen. Was du für Unsinn sprichst, Marjan – es sind doch gerade die Kabeljaue, die Selbstverwaltung der Städte wünschen, die zum Aufruhr gegen die rechtmäßigen Herrscher anstacheln, gegen die von Gott eingesetzten Herrscher! Gott hat das Volk in Stände eingeteilt, wie auch die Engel im Himmel in Gruppen unterteilt sind …« Er blickte auf Marjans Scheitel und zitierte: »Der Bauer muss für Pfarrer und Ritter seinen Acker bearbeiten, der Pfarrer Ritter und Bauern vor der Hölle bewahren, der Ritter Pfarrer und Bauern vor denen schützen, die ihnen übel wollen. So steht es geschrieben.«
»Einige kämpfen, einige beten, einige arbeiten«, nickte Marjan.
»Und die Kabeljaue wollen dieses Gottesgesetz brechen!«, rief Wilhelm. »Mein Bruder Johann würde sich eher mit dem Teufel verbünden!«
»Genau«, erwiderte Marjan friedfertig, aber innerlich erschauernd beim Gedanken an das Massaker in Lüttich, »der Bischof, der sich bei dem Aufstand den schönen Namen Johann der Unbarmherzige verdient hat, steht …«, sie machte eine Pause, »… natürlich außer Verdacht, seiner unmittelbaren Familie Arges zufügen zu wollen …« Sie beugte sich über den Webrahmen, um den Schaden zu begutachten. »Fäden ziehen ist nicht einfach«, sagte sie mit leicht verzagter Stimme und sah dabei so schön aus, dass Wilhelms Zorn augenblicklich verrauchte. »Ich kann es Jakoba nicht beibringen.«
Im Gegensatz zur Kräuterkunde. Hier erwies sich Jakoba als vorzügliche Schülerin. Marjan, die im Stillen oft fürchtete, Wilhelms Lust am Kriegführen und Marguerites Freude am Intrigieren würden sich in Jakoba zu unberechenbaren Kräften bündeln, war beruhigt, wenn sie beobachtete, wie ihr Zögling Freude am Wachstum der Pflanzen zeigte und dabei viel Geduld an den Tag legte. Auch die Tatsache, dass sich Jakoba allmählich zu einer ausgezeichneten Schachspielerin entwickelte, ließ hoffen. Vielleicht würde es ihr zusammen mit Jean einst gelingen, Frieden ins Land zu bringen. Vielleicht würde die neue Generation mit neuen Einsichten Versöhnung statt Spaltung herbeiführen können. Aber noch zeigten die beiden Kinder mehr Interesse am Spiel mit der Armbrust.
Damit waren sie auch an jenem Mittag beschäftigt, als ein paar Reiter mit einer vermummten Gestalt in der Mitte in den Hof einritten, ans Tor klopften und Einlass begehrten.
»Wir kommen im Auftrag von Johann von Burgund!«, rief einer. »Wir haben eine wichtige Botschaft!«
Jakoba ließ ihre Armbrust fallen und lief auf die kleine Gruppe zu. Sie deutete auf die vermummte Gestalt und rief begeistert: »Schau, Jean, Philipp ist hier!«
Philipp zog sich die Kapuze vom Kopf. »Wie hast du mich erkannt?«, wollte er wissen.
Jakoba verstand die Frage nicht. »Ich weiß es eben«, sagte sie, und erst jetzt fiel ihr ein, dass sie die Szene im Hof schon ein paar Tage zuvor gesehen und sich gefragt hatte, warum Philipp vermummt und ohne seinen Vater zu ihnen kommen würde. Diese Fragen konnte sie ihm jetzt stellen.
»Mein Vater heißt jetzt …«, er schwieg verheißungsvoll und sah Jakoba stolz an, »… Johann ohne Furcht! Das ist doch ein schöner Name für einen Fürsten!«
»Und warum heißt er jetzt so?«, fragte Jean, der näher getreten war und Philipp beim Absitzen half.
Philipp blickte Jean herausfordernd in die Augen. »Weil er deinen Onkel umgebracht hat, den verräterischen Herzog von Orléans.«
»Ein feiger Mord also«, sagte Jean tonlos. Der Onkel, von dem gemunkelt wurde, er sei der Vater seiner Geschwister, stand ihm nicht nahe, aber Jean war jede Form von Gewalt ein Graus.
»Ganz im Gegenteil!«, rief Philipp. »Mein Vater hat sich jetzt ganz ohne Furcht dem Gericht deines Vaters gestellt. Und deshalb bin ich hier. Er möchte mich in Sicherheit wissen, falls es der Bande von Orléans einfällt, an mir Rache nehmen zu wollen.«
»Und wenn sie ihn hängen?«, fragte Jakoba entsetzt. In ihren Ländern kam kein Mörder mit dem Leben davon.
Philipp lachte. »Sei ohne Furcht, Cousinchen. Einen Fürsten hängt man nicht. Außerdem verteidigt ihn Anwalt Jean Petit. Es gibt schließlich so etwas wie gerechten Tyrannenmord. Der Herzog von Orléans hat sich als Herrscher aufgespielt, Steuern erhöhen lassen, Gelder, die für Burgund bestimmt waren, veruntreut, Hexerei betrieben und sich überhaupt sittenlos verhalten. Das weißt du doch auch, Jean! Das war der Mann, der in einer einzigen Nacht die französische Kriegskasse verspielt hat! Deinen Vater, den König, wird Petit mühelos davon überzeugen, meinem Vater zu verzeihen.«
Jean sah zu Boden. Seinen Vater konnte jedermann von allem überzeugen, denn lichte Augenblicke gab es im Leben des Königs kaum noch. Und dass er dem Herzog von Burgund den Mord an seinem Nebenbuhler verzeihen würde, war auch zu erwarten. Auf Königin Isabella, seine Mutter, kam es an. Der Herzog von Orléans war ihr Spielzeug gewesen, vielleicht war sie seiner müde geworden und begrüßte diese Lösung ihres Problems. Jean wagte nicht daran zu denken, dass sein Onkel möglicherweise der alternden und immer korpulenter werdenden Isabella Adieu gesagt haben könnte und sie selbst dem Burgunder aus Rache den Mord nahe gelegt hatte. Vielleicht hatte sie ihn auf die berüchtigte Gemäldegalerie hingewiesen, die der Herzog von Orléans von seinen weiblichen Eroberungen unterhielt und in der Johann von Burgund seine eigene Gemahlin, Margarete von Bayern, wieder finden konnte. Da gebot allein schon die Familienehre den Mord.
»Orléans und Burgund, Haken und Kabeljaue, in allen Ländern herrscht Krieg im Inneren«, sang David, der jetzt mit seiner Laute vor die Tür trat. »Wehe uns, wenn einst der Feind von außen kommt!«
Hinter David sprang Jakobas Bastardschwester Beatrix in den Hof. Als sie Philipp erkannte, versank sie in einen Hofknicks.
»Steh auf, du dummes Mädchen, ich bin doch dein Cousin!«, lachte er und reichte ihr galant die Hand. David, der gerade sein Lied »Im falschen Bett gezeugt« hatte anstimmen wollen, verstummte, als ihm auffiel, dass Beatrix Philipp mit dem gleichen Blick bedachte wie der Lieblingsrüde Herzog Wilhelms seinen Herrn.
Für Jakoba brach eine wunderbare Zeit an, obwohl ihre Mutter missbilligend bemerkte, es könne dem Mädchen nicht gut bekommen, so viel männliche Gesellschaft um sich zu haben. Aber nichts hätte Jakoba davon abbringen können, mit Jean und Philipp über die Weiden und durch den Wald zu reiten, die Hügel des Hennegaus zu erkunden und den Knaben bei Übungsgefechten und beim Stechen zuzusehen. Sie war bei ihren Lernstunden zugegen, wobei sie sich am meisten über Jeans Gefecht mit der Aussprache des Holländischen amüsierte. Philipp, der nicht nur im burgundischen Dijon, sondern auch in Flandern erzogen worden war, beherrschte Jakobas Vatersprache perfekt, wenn auch mit dem weicheren Akzent der Flamen. Nur mit Mühe war Jakoba davon abzuhalten, selbst ein Schwert oder eine Lanze in die Hand zu nehmen.
»Sie braucht mehr weiblichen Umgang«, beklagte sich Marguerite bei ihrem Mann. Sie hatte ihn in ihre Kemenate gebeten, ein Aufruf, dem der Herzog nur zu gern nachkam. Er hätte seiner schönen Frau mit dem scharfen Burgunderverstand gern öfter den Hof gemacht. Es ärgerte ihn, dass ihn die Herzogin seit Jakobas Geburt nicht mehr in ihr Bett gelassen hatte. Aber als er sah, dass sie ihre, wie er es nannte, undurchdringliche Kleidung trug, es also bei einem Gespräch bleiben würde, befiel den Herzog augenblicklich schlechte Laune.
»Gut«, erklärte er, »Beatrix kann ihre Hofdame werden.«
Marguerite zuckte zusammen. Beatrix’ Mutter war ihre eigene Hofdame gewesen, bis Wilhelm sie in sein Bett geholt hatte. Damit hatte er die Abmachung verletzt, sich von ihren persönlichen Damen fern zu halten.
»Nur unter der Auflage, dass sie mir aus den Augen bleibt«, murmelte Marguerite. »Es reicht, dass ich zusehen muss, wenn du wieder einmal einen deiner Bastardsöhne zum Ritter schlägst.«
»Ich würde lieber einen legitimen Sohn zum Ritter schlagen«, entgegnete er böse und verließ das Gemach. Er schlug die Tür so laut hinter sich zu, dass die Kinder im Raum darunter aufhorchten.
»Schachmatt«, sagte Philipp dann und machte seinen letzten Zug.
Jakoba sprang auf und wischte mit einer Handbewegung alle Figuren vom Brett. Sie funkelte Philipp an. »Warum kann ich dich nie schlagen!«
Philipp hob die Schultern. »Du musst eben mehr üben!«
»Daran liegt es nicht.« Jakoba stampfte mit den Füßen auf. »Du bist einfach zu gut, Philipp, zu gut!«
Der junge Burgunder hob die fein geschwungenen Brauen über seinen schönen hellgrauen Augen und winkte David zu sich. »Spiel ein Lied«, forderte er ihn auf, »ein Lied von Philipp dem Guten!« Der Zwerg lachte und nahm seine Laute auf. Aber bevor er in die Saiten griff, fragte er Philipp mit der Vertraulichkeit, die ihm die Narrenfreiheit gewährte: »Willst du wirklich einst so erinnert werden, mein Freund? Der Enkel von Philipp dem Kühnen, der Neffe von Johann dem Unbarmherzigen, der Sohn von Johann ohne Furcht soll einen so milden Beinamen erhalten? Die Guten finden selten Eingang in die Geschichte.«
»Nicht die, die ihren Auftrag gut erledigen«, erwiderte Philipp.
»Und was ist dann dein Auftrag?«, erkundigte sich Jakoba. »Mich beim Schach zu schlagen?«
»Ja«, erwiderte Philipp, »ich habe mir selbst den Auftrag gegeben, alles, was ich anfange, gut zu erledigen.«
Jakoba schrie kurz auf, griff dann hastig in die kleine Seitentasche. Ihre Finger schlossen sich um den glatten Stein. Sie atmete tief durch.
»Was ist los?«, fragte Jean beunruhigt.
»Nichts, ein kurzer stechender Kopfschmerz«, murmelte Jakoba, froh, dass das Bild so schnell verblasst war. Noch nie hatte sich ihr eine so scheußliche Szene gezeigt. Sie hatte ein ihr unbekanntes junges Mädchen mit schmerzverzerrtem Gesicht auf einem Scheiterhaufen gesehen, die hochzüngelnden Flammen hatten bereits den geschorenen Kopf erreicht. Das Opfer stand zu hoch auf dem Blutgerüst, als dass ihm der Scharfrichter den Gnadenstoß hätte versetzen können. Eine Hexe, dachte Jakoba, wahrscheinlich eine Warnung, dass ich niemandem mein fürchterliches Geheimnis verrate. Bei Marjan ist es sicher.
Jakoba war jetzt acht Jahre alt und quälte sich oft mit der Frage, wann sich ihr die Traumgesichte erstmals gezeigt hatten. Wenn sie den Auslöser kannte, würde sie den Fluch vielleicht bannen können. Aber als kleines Kind hatte sie zwischen Wirklichkeit und Traumgesichten noch nicht unterscheiden können. Alles war real und gleich unverständlich und selbstverständlich gewesen. Erst später verstand sie, dass sich die schnellen kleindimensionalen Szenen, die wie ein Blitz vor ihr aufleuchteten, über die Wirklichkeit legten. Sie wusste nicht, was die Bilder bedeuteten, und sie hatte Angst vor ihnen. Manchmal fürchtete sie wirklich, vom Teufel besessen zu sein, denn wenn ihr Gott Warnungen schickte, warum lieferte er nicht auch die Erklärung dazu? Warum waren die Traumgesichte stumm? Marjan kannte die Antwort auch nicht, sie empfahl Gebete, bestimmte Kräutersäfte, das Wenden des ovalen Steins und absolutes Schweigen gegenüber allen anderen.
Philipp behielt Recht. Sein Vater wurde bei dem Mordprozess in Paris freigesprochen und ließ sich von seinen Anhängern feiern. Kein Troubadour im Land, der jetzt nicht Johann ohne Furcht huldigte, dem Herzog, der sich öffentlich eines Mordes aus dem Hinterhalt rühmen konnte, ohne dafür bestraft zu werden. Seine Feinde gelobten Rache. Johann ohne Furcht lachte darüber.
»Ich werde sie alle zertreten«, erklärte er beim Abendmahl im Rittersaal zu Le Quesnoy und ließ dabei seine Füße sehen, »und zwar mit diesen Schuhen! Schau mal, Jakoba, wie schön sie sich der Form der Füße anpassen! Man muss natürlich darauf achten, rechts und links nicht zu verwechseln. In Paris trägt man das jetzt.«
Jakoba beugte sich herunter und befühlte das Schuhwerk. »Kann man denn damit laufen?«, fragte sie.
»Besser als mit den Polaines!«, sagte er und wies mit einer Hand auf die langen Spitzen an den Schnabelschuhen eines Dieners. »Diese Schuhe wurden vielen Rittern bei der Schlacht von Nicopolis zum Verhängnis. Flüchten konnte nur, wer sich die Schuhspitzen rechtzeitig abgeschnitten hatte.« Er selbst hatte nicht dazu gehört. Johann von Burgund war in türkische Kriegsgefangenschaft geraten und erst zwei Jahre später nach Zahlung eines enormen Lösegeldes in die Heimat zurückgekehrt. Auf Herzogin Marguerites Frage nach anderen Neuerungen lachte Johann ohne Furcht leicht verlegen. »Ich habe selbst eine erfunden, aber dafür gibt es offensichtlich keinen Bedarf.«
Aus den Falten seines Gewands zog er einen kleinen Zweizack hervor, spießte ein Stück Fleisch aus der Schüssel damit auf und führte es zum Mund. Jakoba stieß einen Schrei aus: »Er wird sich die Zunge durchbohren!«
»So ein gefährlicher Unsinn!«, brummte Herzog Wilhelm. »Wozu soll das gut sein?«
»Ich habe meinem Schmied den Auftrag gegeben, ein Esswerkzeug zu erfinden, bei dem die Finger und somit auch die Kleider sauber bleiben. Man sollte allerdings nicht sprechen, wenn man das Eisen in den Mund nimmt.«
»Zum Essen hat man die Hände«, erklärte Wilhelm. Allgemeines Kopfschütteln sorgte dafür, dass Johann ohne Furcht sein gefährliches Gerät wieder wegsteckte. Er wandte sich an den Truchsess.
»Für die Sauce Cameline«, sagte er freundlich, »verwendet Gilles Parailles nur Klarettwein bester Qualität. Euer Küchenmeister hat sich zu sehr an minderwertigen Essig gehalten.«
Nicht nur Jakoba bedauerte, dass Philipp an den Hof von Burgund zurückgerufen wurde. Beatrix, die inzwischen ihre Stelle als Hofdame angetreten hatte, wäre am liebsten mit der burgundischen Reisegesellschaft mitgeritten. Sie verfluchte das Schicksal, das sie als Bastardtochter Wilhelms an den Hof in Le Quesnoy band. In ihren Tagträumen versetzte sie sich an den Burgunder Hof und verwandelte sich in eine wunderschöne edle Dame, deren Farben Philipp auf allen Turnieren trug. Mochte er doch aus dynastischen Gründen die französische Königstochter Michaela heiraten müssen, sie war die Dame, deren Herz er begehrte. Die Kunde von seiner Liebe zu ihr trugen Minnesänger in alle Lande …
Wenn sie aus solchen Träumen in die Wirklichkeit zurückkatapultiert wurde, dachte sie über reale Möglichkeiten nach, in Philipps Nähe zu kommen. Dafür stand ihr nur ein Weg offen: Sie musste einem Ritter angetraut werden, der an den Höfen von Philipps Vater lebte. Leider hielten sich keine Edlen aus Burgund lange genug im Hennegau auf. Aber nahe Verwandte wechselten ihre Getreuen gelegentlich aus, und es gab keinen Grund, weshalb ein hennegauischer, seeländischer oder holländischer Ritter nicht einst an einem der burgundischen Höfe dienen sollte. Sie dachte an die beiden jungen Edelleute, die Herzog Wilhelm Jean zur Seite gestellt hatte und mit denen auch sie daher regelmäßig Umgang pflegte. Dirk von der Merwede, der Ritter mit dem feuerroten Lockenkopf, kam nicht infrage. Er war Jean und Jakoba zu verbunden und viel zu charakterfest, als dass sie ihm etwas hätte einreden können. Jan von Vliet hingegen, ein sanfter, scheuer Edelmann, könnte Wachs in ihren Händen sein. Ihr war nicht entgangen, dass er Jakoba oft Blicke zuwarf, die auf heimliche Bewunderung schließen ließen. Nun, sie ähnelte Jakoba, fand sich aber erheblich schöner, da sie im Gegensatz zu ihr bereits über ausgeprägte weibliche Rundungen verfügte.
Beatrix verlor ihr Ziel in den darauf folgenden fünf Jahren nicht aus den Augen. Während sich in Paris der Adel bekämpfte, in England König Heinrich V und im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation Kaiser Sigismund gekrönt wurden, während inzwischen tatsächlich drei Päpste um den Heiligen Stuhl stritten, spann Beatrix geduldig ihr Netz.
Noch am selben Tag, an dem Marjan die Eltern informierte, dass Jakoba jetzt Kinder gebären könne, wurden Boten nach Paris geschickt, um den Hochzeitstermin auszuhandeln. Jakoba selbst lag mit Kopfschmerzen in ihrem abgedunkelten Zimmer und wusste nicht, ob es sie freute, jetzt zu den Erwachsenen zu gehören, oder betrübte, dass die Zeit des Spielens vorbei war.
»Du kannst von Glück sagen, dass du die Gelegenheit gehabt hast, deinen künftigen Mann so gut kennen zu lernen«, sagte Marjan, die an Jakobas Bett saß und besorgt auf die geschlossene Hand blickte, die den kleinen Stein schon seit Tagen nicht losgelassen zu haben schien.
»Sind es schlimme Visionen?«, fragte sie leise. Sie hatte gehofft, Jakobas Gesichte würden mit dem Beginn des weiblichen Zyklus verschwinden, aber dies schien nicht der Fall zu sein. Jetzt konnte nur noch die Hochzeitsnacht Abhilfe schaffen. Aus eigener Erfahrung wusste Marjan, dass nur Jungfrauen derartigen Visionen ausgesetzt waren.
Jakoba drehte sich auf die Seite. »Wieder Königin Isabella im Nachthemd«, murmelte sie. »Mit dem roten Stoff in der Hand.«
»Die Königin wird bei eurer Hochzeit anwesend sein, weiter wirst du sie wohl nicht zu Gesicht bekommen«, tröstete Marjan. »Du bist kein kleines Kind mehr, das sich vor ihr fürchten muss. Schon gar nicht, wenn sie ein Nachthemd trägt!«
Sie stand auf, zog die Vorhänge zur Seite und blickte auf die herannahenden dunklen Wolken. »Ein Gewitter zieht auf. Das ist etwas, wovor sich Königin Isabella fürchtet«, bemerkte Marjan und freute sich über das kleine Kichern, das vom Bett kam.
»Sie hat einen Donnerwagen machen lassen«, gluckste Jakoba, »ganz dick ausgepolstert, damit der Krach gedämpft wird. Bei jedem Gewitter verschwindet sie sofort in ihrem Donnerwagen.« Jean hatte ihr dies erzählt und der Erscheinung damit tatsächlich etwas von ihrem Schrecken genommen. Jakoba konnte sich nämlich noch gut daran erinnern, dass sich ihr das Bild der Königin zum ersten Mal in einer Gewitternacht gezeigt hatte, eine Nacht, die die Königin bestimmt in ihrem Donnerwagen verbracht hatte.
»Und Angst vor Holzbrücken hat sie auch«, fuhr Marjan fort. »Findest du immer noch, dass sie eine Frau zum Fürchten ist?« Jakoba schüttelte den Kopf.
»Und vor der Ehe brauchst du auch keine Angst zu haben. Prinz Jean ist ein sanfter Mann. Du hast ihn doch lieb?«
Jakoba nickte. Jean war ihr lieb, obwohl sie ein wenig bedauerte, dass sie in seiner Gegenwart nicht jenes Herzklopfen verspürte, von dem die Minnesänger so schwärmten. Aber das würde vielleicht noch kommen.
»Es wird sich gar nicht so viel für dich ändern«, fuhr Marjan fort, »nur, dass Jean natürlich seine Räume im anderen Flügel aufgeben und zu dir ziehen wird. Du solltest dir überlegen, wie du die Zimmer einrichten lassen willst. Als französische Prinzessin darfst du dir für dein erstes Kind sogar ein grünes Zimmer erlauben. Das ist sonst nicht einmal Gräfinnen gestattet.«
»Und ein gemeinsames Schlafzimmer für ihn und mich?«
»Das ist so üblich«, lächelte Marjan.
»Nicht bei meinen Eltern.«
»Deine Eltern«, entgegnete Marjan, »… haben sich arrangiert.«
»Und deswegen habe ich wohl so viele Halbgeschwister?«
»Siehst du, du kannst schon wieder lachen!«
Jakoba wurde sofort wieder ernst. »Ich würde sterben, wenn Jean einer anderen Frau ein Kind machte!«