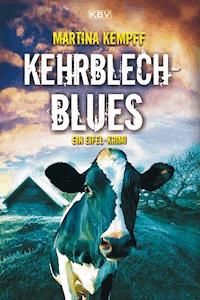8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein mitreißender historischer Roman um Ludwig den Frommen und seine Frau Judith - der Abschluss der Trilogie rund um die Frauen der Karolinger! Schön soll sie sein, noch Jungfrau und kleine Füße haben: Auf einer Brautschau will Kaiser Ludwig der Fromme, der Sohn Karls des Großen, eine neue Gemahlin finden. Er entscheidet sich für die kluge und eigenwillige Welfentochter Judith, die schon bald die Geschicke des Reichs entscheidend beeinflusst. Damit macht sie sich Ludwigs erwachsene Söhne zum Feind, und ein heftiger Kampf um das Erbe Karls beginnt – ein Kampf, der Judith das Leben kosten kann. »Die Welfenkaiserin« ist nach »Die Königsmacherin« und »Die Beutefrau« der Abschluss der Trilogie um die Karolinger-Frauen von Martina Kempff, ist aber als eigenständiger Roman verständlich.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Für Anja
© dieser Ausgabe, Piper Verlag GmbH, 2019 © 2008 Martina Kempff © der deutschsprachigen Ausgabe: Piper Verlag GmbH, München (2008, 2009, 2012) Covergestaltung: FAVORITBÜRO, München Covermotiv: Bilder unter Lizenzierung von Shutterstock.com genutzt Datenkonvertierung: CPI books GmbH, Leck
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben. In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
Inhalt
Cover & Impressum
Prolog
Buch 1: Die Brautschau
1. Kapitel: Im Jahr des Herrn 814
2. Kapitel: Im Jahr des Herrn 818
3. Kapitel: Im Jahr des Herrn 819
4. Kapitel: Im Jahr des Herrn 821
Buch 2: Des Kaisers Herrin
5. Kapitel: Im Jahr des Herrn 823
6. Kapitel: Im Jahr des Herrn 826
7. Kapitel: Im Jahr des Herrn 829
8. Kapitel: Im Jahr des Herrn 830
9. Kapitel: In den Jahren des Herrn 831 und 832
Buch 3: Bruderkrieg
10. Kapitel: Im Jahr des Herrn 833
11. Kapitel: In den Jahren des Herrn 835 bis 840
12. Kapitel: In den Jahren des Herrn 841 und 842
Epilog
Karte
Stammbaum
Nicht im Stammbaum aufgeführte Personen
Glossar
Quellen
Guide
Prolog
Juli 833
Der bewegliche Wall aus Leibern und Pferden versperrte ihr die Sicht auf die Landschaft. Die Männer achteten sorgsam darauf, dass die Gefangene auf dem kleinen Ross nicht aus dem Kreis ausscherte. Sie rissen untereinander derbe Scherze, sprachen aber zu ihr kein Wort. Judith wusste weder, wo sie sich befand, noch kannte sie das Ziel der Reise. Der fünfzehnte Tag war angebrochen, und der Stand der Sonne verriet ihr, dass der Weg weiterhin beharrlich nach Süden führte. Jeden Morgen, wenn sie sich auf ihrem Lager die Fesseln abnehmen ließ, die verhindern sollten, dass sie sich nachts davonstahl, wunderte sie sich darüber, noch zu leben. Warum war sie nicht gleich getötet worden, nachdem man sie von der Seite des Kaisers und ihres Sohnes gerissen hatte? Was hatte man mit der Frau vor, von der Erzbischof Agobard von Lyon behauptete, sie wäre die Wurzel des Übels, das dieses einstmals so blühende Reich befallen hatte? In welches Kloster brachte man sie?
Die Mittagssonne brannte durch das schwere dunkle Tuch alle weiteren Gedanken aus ihrem Kopf heraus. Nur vereinzelte Bilder schwirrten noch darin herum. Die verzweifelte Miene ihres Gemahls Kaiser Ludwig, als er auf dem Lügenfeld von Colmar die Niederlage gegen seine drei ältesten Söhne eingestehen musste; der verständnislose Blick ihres zehnjährigen Sohnes Karl, dem man nicht einmal gestattet hatte, sich von der Mutter zu verabschieden; das triumphierende Grinsen ihres Stiefsohnes Lothar, der endlich am Ziel seiner Wünsche angelangt war, und die unverhohlen hämische Freude seiner Gemahlin, ihrer ärgsten Feindin. Und dann war da noch die Verachtung in den eisgrauen Augen jenes abseits stehenden Mannes, den sie einst zu lieben geglaubt und der sie verraten hatte.
Judith griff sich an die juckende Nase. Angewidert betrachtete sie die hellroten Hautschiefern, die auf ihr braunes Kleid herabregneten.
»Da ist es!«
Einer ihrer Bewacher streckte den Arm aus und wies nach vorn. Judith reckte das Haupt, konnte zunächst aber nur einen dunklen Steinturm ausmachen. Als die Reiterschar anhielt und die Männer abstiegen, sah sie unterhalb des Turms einen niedrigen Bau aus mächtigen ungleichen Gesteinsbrocken, den ein breiter Graben voll schlammigen Wassers umgab. Sie erstarrte. Dies war kein Kloster. In der Ferne, hinter sommerbraun verbrannten Feldern flimmerte die Silhouette einer Ansiedlung.
Zwei Männer traten aus dem Turmportal, ein hochgewachsener Bartträger und ein kleiner runder Glattgesichtiger. Sie überquerten die schmale Holzbrücke und blickten mit unverhohlener Neugier zu der Frau auf, die immer noch nicht abgestiegen war.
»Die abgesetzte Kaiserin?«, fragte der Größere, und als die Männer nickten, riss er Judith mit einem Ruck vom Pferd, stieß sie in den Staub und rümpfte die Nase.
»Sie stinkt erbärmlich!«
»Das ist noch ihr geringster Fehler«, rief der Anführer über seine Schulter. Er war an den Wassergraben getreten und urinierte hinein. Die anderen Wachen folgten ihm.
»Und im Gegensatz zu allen andern lässt sich der beheben. Gönnen wir ihr doch ein Bad in der frisch aufgewärmten Brühe!«
Judith wehrte sich nicht, als grobe Hände nach ihr griffen und sie mit Schwung in den Graben schleuderten. Sie hielt die Luft an, als das Wasser über ihrem Kopf zusammenschlug. Dankbar für die dunkle Kühle, die sie in der Tiefe umgab, wäre sie gern ertrunken. Aber die Männer, die sie viele Tagesreisen mit sich geführt hatten, würden nicht zulassen, dass sie am Ziel wie ein Kätzchen ersoff. Sie hatten geschworen, sie heil abzuliefern. Ihren Henkern etwa? Als ihre Füße Halt im schlammigen Untergrund fanden, erhob sie sich widerwillig. Das Wasser reichte ihr bis zum Kinn. Ihr langes Blondhaar hatte sich gelöst und trieb jetzt wie ein seltsames Farngewächs um ihren Kopf herum. Mit seiner Lanze fischte eine der Wachen ihr dunkles Umschlagtuch aus dem Graben. Als er sich bückte und es ihr hinhielt, damit sie sich daran aus dem Wasser ziehen konnte, hätte sie sich beinahe bei ihm bedankt.
Das Kleid klebte ihr am Leib, doch die Gnade, sich in der Sonne trocknen zu dürfen, wurde ihr nicht gewährt. Obwohl sie bereitwillig mitging, zerrten die beiden Torwächter sie an den Armen in das steinerne Gebäude.
»Wo bin ich hier?«, wollte sie fragen, brachte aber nur unverständliche krächzende Laute hervor. Nach mehreren vergeblichen Anläufen in den ersten Tagen des Ritts hatte sie es irgendwann aufgegeben, ihren Wächtern Worte zu entlocken, und war schließlich selbst verstummt.
»Man darf mit ihr nicht reden«, wies der hinter ihnen gehende Anführer die beiden Männer an: »Befehl vom Kaiser!«
»Kaiser!« Voller Verachtung spie sie das Wort aus. Lothar war kein Kaiser, sondern ein abgesetzter Mitkaiser. Der wirkliche Kaiser, ihr Gemahl, war sein Gefangener, dem eigenen Sohn so ausgeliefert wie sie jetzt diesen fremden Männern.
»Sie kann offenbar gar nicht sprechen«, sagte der größere Torwächter und strich sich über den dunkelblonden Vollbart. Er ließ seinen Blick über den vor Kälte zitternden Frauenleib gleiten, um dessen Konturen sich die nasse Kleidung anschaulich schmiegte.
»Und was darf man sonst nicht?«, fragte er gedehnt.
»Sie freilassen«, erwiderte ihr Wächter lachend. »Im Übrigen könnt ihr mit ihr machen, was ihr wollt. Und sollte sie unter eurer Obhut sterben, dann ist das eben ihr Schicksal. Niemand wird euch im Heimatland des Kaisers deswegen anklagen.«
Lothars Heimatland war Italien. Er hatte sie also in das frühere Langobardengebiet verschleppen lassen, den einzigen ihm vom Vater noch überlassenen Reichsteil. »Und lasst niemanden zu ihr in den Kerker, der sich nicht als Abgesandter des Kaisers ausweisen kann.«
Kerker? Sie traute ihren Ohren kaum. Seit Jahrhunderten wurden vom Thron gestoßene unliebsame Verwandte in recht gemütliche Klöster abgeschoben. Das hatte sie selbst ja auch schon einmal überlebt. Was für einen Sinn hätte es, sie in einen Kerker zu werfen? Sollte sie da wie ein gefangenes Tier verrecken? Sie begann heftiger zu zittern. In einem abgelegenen italischen Verlies würde keiner ihrer Getreuen nach ihr suchen.
Der kleinere Torwächter kniete auf dem Boden und machte sich an einer hölzernen Falltür zu schaffen.
»Schaut her, das Schloss der Kaiserin!«, stieß er meckernd aus und hielt ein angerostetes Fallriegelschloss hoch. Er wuchtete die Bodentür zur Seite und legte ein Kellerloch frei, aus dem modriger Geruch stieg.
Der vollbärtige Torwächter versetzte Judith einen Schlag auf die Schulter. Wie aus Versehen rutschte seine Hand ab und blieb kurz auf ihrer Brust liegen. Mit der anderen Hand deutete er in das Loch. Judith beugte sich vor, da sie aber weder eine Leiter sehen noch in der Dunkelheit die Tiefe abschätzen konnte, zuckte sie ratlos mit den Schultern.
»Wenn sie selbst springt, bricht sie sich vielleicht nichts«, schlug der Bartträger vor.
Rasch setzte sich Judith auf den Rand des Lochs, schloss die Augen und sprang. Im Fallen dachte sie nur: Wofür?
Erstes Buch
Die Brautschau
1
Aus den Chroniken der Astronoma
Im Jahr des Herrn 814
Lasst mich, ich sterbe besser ohne eure Heilmittel, sagt der Kaiser zu seinen Ärzten und schließt die Augen.
Karl der Große, der ein mächtiges Reich befriedet hat, geht in der dritten Stunde des 28. Januar selbst in den ewigen Frieden ein. Eine Lungenentzündung hat den mächtigen Mann gefällt. An seinem Totenbett spricht keiner aus, was jeder denkt: Dieses Ereignis war nicht vorgesehen.
Die Tatsache, dass Karl ein Sterblicher war, haben alle verdrängt, vermutlich sogar der Kaiser selbst. Warum sonst hat er die vor Langem angekündigte Änderung seines persönlichen Testaments immer wieder hinausgezögert? Nicht eingebaut, dass auch seine außerehelichen Kinder und deren Mütter gut versorgt und die Lebensgefährten seiner Töchter in ihren Ämtern bleiben sollen? Das Eheverbot für seine Töchter nicht aufgehoben? Nicht aufschreiben lassen, dass er in seinem Aachen beerdigt werden wollte?
Vielleicht hat sich der Kaiser aus Sorge, wirklich sterben zu müssen, wenn alles geregelt war, nicht an eine endgültige Abfassung seines Testaments gewagt. Doch jetzt hat der Tod den Sieg über jenen Mann davongetragen, der sechsundvierzig Jahre lang die Geschicke der westlichen Christenheit gelenkt hat. Die Ratlosigkeit der Trauernden, die Furcht vor einer ungewissen Zukunft ohne Karl wird auf die nächstliegende Frage verlagert: Wohin mit dem Leichnam des Kaisers?
Natürlich gehört er in die Aachener Pfalzkapelle, die er auf eigene Kosten hat erbauen lassen! Verzweiflung, Bestürzung und Schwermut entladen sich in hektische Betriebsamkeit. Der Kirchenboden im Atrium wird augenblicklich aufgebrochen und ein Marmor-Sarkophag herbeigeschafft, dessen Reliefs den Raub der Persephone darstellen. Darin wird Karl wenige Stunden nach seinem Tod beerdigt, noch vor der Samstagsvigil. Warum die Eile? Aus Angst, Saint Denis könnte den Leichnam beanspruchen, weil Karl vor fünfundvierzig Jahren in einem Testament niedergeschrieben hat, dort neben seinen Eltern liegen zu wollen? War diese Verfügung durch den Bau seiner eigenen prächtigen Pfalzkapelle nicht hinfällig geworden? Und warum wird der Sarg mit den kostbaren Reliefs in die Erde versenkt? Angst vor der Zurschaustellung heidnischer Bilder? Angst vor Diebstahl oder Entweihung der Stätte durch des Kaisers Feinde?
Wie ein gestrenger liebender Vater hatte Karl über alle seine Hand gehalten, und jetzt, da seine Sterblichkeit nicht mehr zu leugnen ist, geht allenthalben die Angst um. Auch in der Stadt Aachen scheint das Leben erloschen zu sein. In den Gassen herrscht gespenstische Stille. Als ahnten die Menschen der Karlstadt, dass sie sich nach dem Ende einer zuletzt sehr friedlichen Epoche auf ein ungewisses und unheilschwangeres Zeitalter vorbereiten müssen.
Karls Sohn, Mitkaiser und Nachfolger, König Ludwig von Aquitanien, schickt eine Vorhut nach Aachen, um Ordnung zu schaffen. Man sperrt sofort seine Schwestern in jene Klöster, die der Vater ihnen geschenkt hat. Ihre Liebhaber sollen auf Ludwigs Befehl festgenommen werden. Ludwig will ihnen wegen erwiesener Unzucht selbst den Prozess machen. Alle flüchten, bis auf den Waffenmeister Hedoin. Der wird im Kampf von Ludwigs Schergen niedergestreckt. Aus Kummer darüber stürzt sich Hedoins Lebensgefährtin, Ludwigs Schwester Hruodhaid, vom Dach des Palatiums in den Tod.
Ludwigs Stoßtrupp dringt ins Frauenhaus ein, schlägt dem Eunuchen Achmed, der auch nach dem Tode Karls das Gebäude zu verteidigen sucht, den Kopf ab, treibt die Friedelfrauen des toten Kaisers mit Peitschenhieben auf die Straße, plündert die prächtig ausgestatteten Gemächer und setzt das gesamte Gebäude in Brand. Karls uneheliche Kinder werden in Verliese geworfen. Aus Angst, zu den verderbten Dirnen gezählt zu werden, nach denen Ludwigs Häscher Ausschau halten, rennen weibliche Hofbedienstete davon oder verschmieren sich die Gesichter mit Asche. Die Hütten aller Freimädchen werden niedergebrannt.
Als der neue Kaiser einen Monat nach dem Tod des Vaters in Aachen einreitet, weist er den Vorwurf von sich, den Schwur gebrochen zu haben, den er bei der Krönung zum Mitkaiser geleistet hat: sich um alle Familienangehörigen liebevoll zu kümmern. Genau das tue er, versichert Ludwig, die Kaiserfamilie werde endlich mit gutem Beispiel vorangehen. Alle Welt solle wissen: Gott stehe auf seiner Seite.
Im Jahr 818
Das Pochen an der Pforte zur Haupthalle wurde vom grellen Krachen des Donners verschluckt. Unmittelbar über dem Hauptsitz des Grafen Welf in Altdorf tobte ein gewaltiges Novembergewitter und sandte in rascher Folge Blitze aus. Diese drangen jedoch nicht in den fensterlosen Raum des Mittelbaus, in dem die Familie schweigend an der Abendtafel saß. Der Donner war Botschaft genug; Angst um die hölzernen Hofgebäude, um die Ernte, die Tiere und das eigene Leben zeichnete sich in den blassen Gesichtern ab. Angst auch um die Mutter, Gräfin Heilwig, die sich am Mittag aufgemacht hatte, einer Gebärenden in Weingarten beizustehen, und von der noch keine Nachricht gekommen war.
Die Angst wandelte sich in Entsetzen, als für einen Augenblick blendende Helligkeit den Saal erfüllte. Erst beim Zucken des nächsten Blitzes erkannte Graf Welf, dass beide Flügel der hohen Eingangspforte aufgesprengt worden waren. Knapp vor der Abendtafel sprangen drei durchnässte Menschen von ihren Pferden. Ein Windstoß ließ die meisten Lichte erlöschen. Die hastig herbeieilenden Bediensteten schlugen im Schein der beiden wild flackernden Wandfackeln die doppelflüglige Tür wieder zu, schoben den Riegel davor und hielten dann wie alle anderen im Raum den Atem an.
Graf Welf trat auf die Fremden zu.
»Was ist Euer Begehr?«, fragte er scharf und musterte die Eindringlinge, von denen einer eine Frau war.
»Wir kommen von des Kaisers Hof«, verkündete ein Mann. Er ließ seinen schweren nassen Reisemantel zu Boden gleiten und zog aus seinem Wams eine in Ölhaut verpackte Rolle, die er mit einer angedeuteten Verbeugung dem Grafen überreichte. »Es ist eine eilige Angelegenheit«, setzte der Mann hinzu, da Graf Welf keine Anstalten machte, die Schrift ihrer Schutzhülle zu entnehmen.
»Königsboten seid ihr nicht«, stellte er fest. Misstrauen schwang in seiner Stimme mit. Was wollte der ferne Kaiser von ihm?
»Viele Boten sind in dieser Angelegenheit in alle Richtungen des Reichs ausgesandt worden«, erwiderte der Mann ausweichend.
»Was für eine Angelegenheit?«
»Eine Angelegenheit des Herzens.«
Graf Welf hätte beinahe laut herausgelacht. Wer hat Kaiser Ludwig wohl geraten, einen Kriegszug derartig zu bezeichnen? Oder verlangt er gar von mir, mich an der Niederschlagung eines neuerlichen Aufstands zu beteiligen?
Peinlich frisch war noch die Erinnerung an die letzte Erhebung, die der Kaiser ein halbes Jahr zuvor mit Blendung des Königs Bernhard von Italien hatte ahnden lassen. Dass Bernhard, der Neffe des Kaisers, Sohn seines Bruders Pippin, an dieser Tortur gestorben war, hatte große Teile des Adels gegen Ludwig aufgebracht. Es rumorte deswegen noch immer im Land.
Die durchnässten Pferde schnaubten und schüttelten sich so heftig, dass es wie ein Sprühregen in die Schüsseln auf dem Abendtisch spritzte. Graf Welf befahl einem Knecht, die Tiere zu versorgen, und einer Magd, die triefenden Mäntel der Gäste einzusammeln. Dann begleitete er die Fremden zur Feuerstelle. Während sie ihre kalten Hände wärmten, zog er das Pergament aus der Hülle und überflog im Schein der Flammen das Geschriebene. Leise lächelnd wollte er es an den Wortführer zurückreichen, doch der lehnte ab.
»Euer Haus ist das letzte auf unserer Liste. Ihr dürft die Schrift behalten. Wir reiten morgen zurück. Mit dem Gewünschten, falls es der Maßregel entspricht. Woran ich keinen Zweifel habe, auch wenn Frau Stemma noch die erforderlichen Untersuchungen vorzunehmen hat.«
Er nickte vielsagend zur Abendtafel hin, an der Graf Welf soeben noch mit seinen fünf Kindern gesessen hatte. Sein Blick blieb an Judith hängen, die als älteste Tochter die Hausfrau vertrat. Nachdem deutlich geworden war, dass die Fremden nicht in böser Absicht ins Haus gestürmt waren, bedeutete sie jetzt mit anmutigen Gesten dem taubstummen Bediensteten, mehr Wein und Speise aufzutragen. Ihr hüftlanges Haar, schien wie von Goldfäden durchwirkt zu sein, und ihr zart gezeichnetes Profil hätte einem Engelsbild als Vorlage dienen können.
»Meine Gemahlin ist derzeit abwesend«, bemerkte Graf Welf. »Ihr begreift, dass ich mich mit ihr über die Angelegenheit beraten muss.«
Er bat die Gäste, denn als solche hatten sie jetzt betrachtet zu werden, sich mit ihm an der Abendtafel niederzulassen.
»Eine Beratung ist gar nicht erforderlich«, wandte der Sprecher des Grüppchens ein, als er auf der Bank neben Welfs Sohn Konrad Platz nahm. »Da hier ja nur ein einziges Mädchen infrage kommt.«
Mit Unbehagen wandte er den Blick von des Grafen jüngster Tochter Hemma ab, deren Augen sich wild bewegten, jedes in eine andere Richtung. Dhuoda, die uneheliche Tochter Welfs, die ebenfalls zum Haushalt gehörte, nahm er nicht einmal wahr. Das schien ihr Schicksal zu sein, und sie wusste es. Sie war weder schön noch hässlich, weder klein noch groß, weder dick noch dünn, weder hell noch dunkel; sie war im wirklichen Sinn des Wortes unscheinbar. Selbst wer längere Stunden in ihrer Gegenwart verbrachte, hätte nicht vermocht, sie zu beschreiben, da es an ihr nichts zu beschreiben gab.
»Die da!«, meldete sich die ältere Frau erstmals zu Wort und deutete mit einem knochigen Finger auf Judith, die sich wieder an das Kopfende des Tischs gesetzt hatte. Die Frau stand auf, zog aus ihrer Rocktasche ein Band und einen ungeschmückten kleinen Schuh aus steifem Leder. »Wir sollten gleich Maß nehmen, um sicherzugehen. Dann kann sich die Jungfer auf die morgige Abreise vorbereiten. Komm, Kind.«
Judith blieb sitzen.
»Darf ich fragen, wohin du mich diesmal verkaufen willst?«, wandte sie sich an ihren Vater. Ihre seltsam tiefe Stimme klang belustigt, doch ihre Augen funkelten kalt wie Saphire.
Der Graf unterdrückte einen Seufzer. Er mochte gar nicht mehr daran denken, wie viele Bewerber Judith in den vergangenen vier Jahren ausgeschlagen hatte. Nie hätte er es für möglich gehalten, dass eine seiner Töchter so viel Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen und ihm derartiges Kopfzerbrechen bereiten könnte wie Judith. Söhne mussten geformt und sorgsam ausgebildet werden, um ihre Aufgaben in der Welt zu bewältigen; Töchter mussten nur anständig verheiratet werden. Von einer Tochter, die sich dieser Bestimmung widersetzte, hatte er noch nie gehört. Und jetzt lebte solch ein Geschöpf unter seinem Dach! Sie wolle keinesfalls Magd eines Mannes werden, hatte sie stets erklärt, und sie denke nicht daran, sich auszuliefern. Drohungen halfen auch nichts. Wenn man sie zur Hochzeit zwinge, würde sie davonlaufen und ihrer Familie Schande machen. Nun, dachte er befriedigt, diesen Bewerber wird selbst mein querköpfiges Kind nicht ausschlagen können.
»Kaiserin Irmingard ist vor wenigen Wochen gestorben. Gott sei ihrer Seele gnädig«, sagte der Graf, sah Judith in die Augen und verkündete: »Jetzt sucht der Kaiser eine neue Gemahlin.«
Seinen anderen Kindern stockte der Atem, doch Judith schien gänzlich unberührt.
»Mit dem Maßband?«, fragte sie spitz und deutete auf die Stoffschlange, die Frau Stemma ungeduldig durch die Finger schnellen ließ. Den kleinen Schuh hatte sie auf den Tisch gestellt.
»Füße und Leib müssen gewissen Anforderungen entsprechen«, antwortete die Abgesandte des Kaiserhofs unwirsch.
»Wie steht es mit dem Kopf?«, erkundigte sich Judith.
»Der ist schön genug.«
»Könnt Ihr denn ermessen, ob auch sein Inhalt den gewissen Anforderungen entspricht? Oder gibt es dafür keine?«
Empört wandte sich Frau Stemma an den Grafen.
»Teilt Eurer vorwitzigen Tochter mit, dass sie sich zu fügen habe!«
»Liebe Frau Stemma, für die Erziehung meiner Tochter und ihre Vorwitzigkeit bin nicht ich verantwortlich, sondern der kaiserliche Hof.« Mit Genugtuung führte er kurz aus, dass Judith erst seit vier Jahren bei ihrer Familie lebe. »Kaiser Karl hat sie nach dem letzten Sachsenaufstand – meine Frau ist nämlich die Tochter des Sachsenführers Widukind – als Geisel in seinem Haushalt aufgenommen und mit seinen Kindern und Enkeln erziehen lassen. Damals war sie erst acht Jahre alt. Als ich sie mit Kaiser Ludwigs gnädiger Erlaubnis vom Aachener Hof holte, war sie bereits achtzehn. Da gab es nicht mehr viel zu erziehen«, setzte er grimmig hinzu.
»Sie hielt sich als Achtzehnjährige noch an Kaiser Karls Hof auf?«, fragte Frau Stemma ungläubig und blickte ihre beiden Begleiter vielsagend an. »Dann, Herr Welf, ist eine ganz bestimmte gründliche Untersuchung Eurer Tochter unumgänglich! Ihr versteht, was ich meine?«
Graf Welf verstand nur zu gut. Genau darum hatte auch er sich sehr gesorgt, als er Judith in Aachen abgeholt hatte. Im ganzen Reich schwirrten damals Gerüchte über die Lebensumstände am Kaiserhof umher. Gerüchte, die jeden ehrenwerten Mann, der ein keusches Weib heimführen wollte, abschrecken konnten. Zweifel an Judiths Jungfernschaft waren also durchaus angebracht, vor allem auch, da das Mädchen von ihrer wunderlichen Tante Gerswind erzogen worden war, immerhin der letzten Kebse des Kaisers.
»Es herrschten damals gänzlich andere Sitten am Hof als jetzt unter unserem guten und frommen Kaiser Ludwig«, bestätigte der Wortführer. »Da kann man gar nicht vorsichtig genug sein. Zumal Eure Tochter für eine Braut schon sehr alt ist. Wieso ist sie nicht schon längst verheiratet?«
»Weil ihr kein Mann gut genug ist«, platzte Judiths Bruder Konrad heraus. »Und jetzt will der Kaiser sie wirklich zur Braut nehmen?«
»Das bleibt abzuwarten«, erklärte Graf Welf und tippte auf das Pergament neben sich. »Hier steht, dass er seine neue Gemahlin aus einer Familie der Großen des Landes erwählen wird.«
Der Großen des Landes! Bei diesen Worten lächelte Graf Welf ein wenig verärgert in sich hinein. Er verfügte zwar über beträchtlichen Besitz im ostrheinischen Gebiet, doch war das einstmals so hoch geschätzte Welfenhaus zwei Generationen zuvor in der politischen Bedeutungslosigkeit verschwunden. Welfs Großvater Ruthard hatte es unter dem Hausmeier und späteren König Pippin, dem Vater des verstorbenen Kaisers Karl, nach dem Blutgericht von Cannstatt zu hohem Ansehen gebracht. Damals, als Pippins Bruder Karlmann sämtliche wehrlose Alemannenfürsten hatte niedermetzeln lassen, war Ruthard beauftragt worden, im führerlosen Alemannien Ordnung zu schaffen. Was ihm vorzüglich gelang und ihn wahrlich nicht ärmer machte – ganz im Gegenteil. Und später hatte Ruthard gemeinsam mit dem berühmten Abt Fulrad von Saint Denis König Pippin nach Rom begleitet, wo das Bündnis zwischen Papst und Frankenkönig begründet worden war. Was dem Ansehen und dem Vermögen der Familie auch zugute gekommen war. Doch als Karl, der inzwischen »der Große« genannt wurde, nach dem Tod seines Vaters Pippin den Thron bestieg, wollte er sich der Verdienste der Welfenfamilie nicht mehr erinnern und schloss sie aus dem Kreis der Berater und Hofangehörigen aus. Genau wie sich Kaiser Ludwig nach dem Tod des eigenen Vaters auch der alten Berater Karls größtenteils entledigt hatte. Ein neuer Herrscher braucht neue Leute.
Kurz ging dem Grafen durch den Kopf, zu welch ungeahntem Ansehen jener kommen konnte, der gar mit dem Kaiser selbst verschwägert war. Er sah eine glänzende Zukunft für seine Söhne Konrad und Rudolf voraus und sich auf angenehmste Weise der Schwierigkeiten mit seiner störrischen ältesten Tochter enthoben. Es würde jetzt nicht nötig werden, sie ins Kloster zu stecken, wie er eigentlich schon geplant hatte. Er wandte sich an den Wortführer, der bereits den dritten Pokal des hauseigenen Weins geleert hatte.
»Wie viele Mädchen werden nach Aachen reisen, um sich der Brautschau zu stellen?«
Der Mann wischte sich mit dem Ärmel den Mund ab und zuckte mit den Schultern. »Wie ich schon sagte, sind mehrere Boten ausgesandt worden. Wir haben vier Mädchen für würdig befunden; sie sind bereits auf dem Weg. Eure Tochter wäre unsere fünfte, wenn ihre Reinheit gewährleistet ist. Insgesamt könnten es zwanzig oder mehr Mädchen sein.«
»Und warum diese Eile?«
»Weil Kaiser Ludwig Anfang des Jahres Hochzeit halten will.«
»Und darum komm jetzt, Kind!«, drängte Frau Stemma. Sie wollte nach Judiths Hand greifen, um ihrer Aufforderung Nachdruck zu verleihen.
Judith rückte ab.
»Mich rührt niemand an!«, verkündete sie mit eisiger Stimme. Sie erhob sich, bat ihre Schwester Dhuoda, den Gästen Schlafplätze zuzuweisen, wünschte allen eine gute Nacht und verließ den Raum. Sie wusste, dass sie niemand zurückhalten würde. Schließlich hatte sie am Kaiserhof unter anderem gelernt, wie man sich Autorität verschafft.
Entrüstet wandte sich Frau Stemma an den Grafen.
»Haltet sie auf! Sie kann sich doch nicht dem Kaiser widersetzen!«
Der Graf zuckte mit den Schultern.
»Das bleibt abzuwarten«, wich er mit jenem Satz aus, den er auf Fragen nach Judiths Zukunft grundsätzlich benutzte. Sein Blick fiel auf Hemma, die den kleinen Schuh vom Tisch genommen hatte und nun vergeblich versuchte, einen ihrer Füße hineinzuzwängen.
Mit boshaftem Lächeln hielt Konrad ihr das Fleischmesser hin. »Wenn du dir die Zehen absäbelst, passt du vielleicht hinein«, bemerkte der Bruder und setzte hinzu: »Judith hat winzige Füßchen. Sie könnte mühelos hineinschlüpfen.«
»Auch sonst erscheint es nicht erforderlich zu sein, die Maße zu nehmen«, meinte der Wortführer der Gruppe. »Das Mädchen ist ausnehmend liebreizend, bei Weitem die Schönste, die wir gesehen haben. Und was die andere Untersuchung angeht…«, er wandte sich an den Grafen, stotterte ein wenig herum und brachte schließlich fast verschämt hervor: »Reitet Eure Tochter viel?«
»Sie ist auf dem Pferderücken zu Hause«, versicherte der Vater.
Der Bote nickte erleichtert. Wer die künftige Kaiserin an den Hof bringen würde, dem war eine hohe Belohnung in Aussicht gestellt worden. Unvorstellbar, dass seine Konkurrenten ein schöneres Mädchen als diese Judith auftreiben würden. Mit freundlichem Lächeln wandte er sich an seine Begleiterin: »Sagtet Ihr nicht selbst, Frau Stemma, dass erschöpfendes Reiten gelegentlich der Reinheit… abträglich sein könne?«
Frau Stemma brummte. Nach den Strapazen der langen Reise ärgerte es sie, um das Vergnügen gebracht zu werden, sich mit dem weichen Körper des Mädchens zu befassen und ihn eingehend zu untersuchen.
Zuversichtlich, dass den anderen der innere Aufruhr entgangen war, den die Nachricht der kaiserlichen Boten in ihr ausgelöst hatte, begab sich Judith in die Kammer, die sie sich mit Dhuoda und Hemma teilte. Angekleidet ließ sie sich auf ihr Lager fallen und stieß einen kleinen Jubelschrei aus. Eine Rückkehr nach Aachen! Endlich war das Wunder geschehen, auf das sie seit vier Jahren gehofft hatte, seit jenem Tag, da sie ihren tränenreichen Abschied vom Kaiserhof genommen hatte.
Damals hatte sie geglaubt, die Trennung von allem, was ihr lieb war, vor allem von ihrer Tante Gerswind, nicht verwinden zu können. Vergeblich hatte sie versucht, sich gegen ihre Entfernung vom Hof zu wehren, sich sogar bemüht, mit Zauberkünsten ihr Bleiben zu erwirken. Doch Gerswind selbst hatte sie dem Vater anvertraut und ihn aufgefordert, die Tochter schleunigst fortzubringen. Es würden fürchterliche Dinge am Hof geschehen, derer Judith nicht Zeugin werden dürfe.
Also hatte Graf Welf seine widerstrebende Tochter kurz nach dem Tode Karls des Großen heimgebracht. Ein Heim, das Judith weder kannte noch wollte. In früheren Jahren hatte sie wiederholt Kaiser Karls Angebot, zu ihren Eltern zurückzukehren, von sich gewiesen. Ihr Zuhause war der Aachener Hof. Sie hatte sich dort nie als Geisel gesehen, sondern als geschätztes Mitglied des kaiserlichen Haushalts, als Zögling Gerswinds, der letzten Geliebten des alten Kaisers. Der hatte Judith liebevoll »unsere kleine Welfin« genannt und ihr manches Mal versonnen über das Goldhaar gestrichen. Einhard, der Leiter der Hofschule, hatte sich stets lobend über ihre geistigen Leistungen und schreiberischen Fähigkeiten geäußert, und ihre Schönheit hatte bei Töchtern und Enkelinnen des Kaisers – anders als bei den beiden von der Natur wenig begünstigten Schwestern im dumpfen Altdorf – keinen Neid erregt. Ach, wie viel Schönheit es in Aachen doch gegeben hatte! An den Gebäuden, in den Schriften der Dichter und Philosophen, in den Kunstwerken, der Musik, in der ganzen Umgebung überhaupt, in den Gedanken und der Sprache der Hofangehörigen und in der allgemeinen Freude am Leben. In der Rückschau schien ihr der gesamte Aachener Karlshof von Licht, Fröhlichkeit und Geist durchdrungen zu sein; ein beständiges Wachsen und Gedeihen, in dem es sich trotz der gelegentlich stinkigen Luft der Schwefelquellen so frei atmen ließ, wie es ihr im guten Klima nahe dem Bodensee nicht möglich war.
Aus Sehnsucht nach ihrem alten Leben wollte Judith den Gerüchten über betrübliche Veränderungen nach Kaiser Karls Tod am angeblich freudlosen Hof Kaiser Ludwigs keinen Glauben schenken. Sie träumte unentwegt von einer Rückkehr.
Genau deshalb hatte sie sich den Heiratsplänen ihres Vaters widersetzt. Denn nach vier Jahren im Elternhaus wusste Judith ganz genau, was sie nicht wollte. Sie erschauerte bei dem Gedanken, ein Leben wie ihre Mutter führen zu müssen, und das wäre zweifellos der Fall gewesen, hätte sie einen ihrer zahlreichen Bewerber in Betracht gezogen. Heilwig war unablässig mit Angelegenheiten beschäftigt, denen Judith nicht die geringste Freude abgewinnen konnte. So gern sie Wein trank und Wildbret aß, so wenig interessierte sie sich für den Zustand der Reben oder den des Küchenhauses. Sie würde Auseinandersetzungen zwischen Mägden schlichten und abends über Abrechnungen oder feiner Handarbeit sitzen müssen, anstatt aus Briefen der Gelehrten zu lernen, mit klugen Köpfen über Politik zu reden oder in anregender Gesellschaft das Psalterium zu zupfen und an geistreichen Ratespielen teilzunehmen. Es grauste ihr bei der Vorstellung, dass ihr Leben nach einem klar umrissenen Plan ablaufen würde, den sie zu erfüllen hatte und an dem sie selbst nie etwas würde ändern können. Sie würde einen Sohn nach dem anderen gebären und ihre Töchter auf das gleiche farblose Leben vorbereiten müssen, das man ihr jetzt als so erstrebenswert ausmalte. Entscheidungen über Haus und Hof würde sie nur dann eigenständig fällen können, wenn ihr Gemahl in höherem Auftrag unterwegs war, in den Krieg zog oder starb. Und das viele Wissen, mit dem sie ihren Kopf an Karls Hof gefüllt hatte, würde sie dabei kaum einbringen können.
Sie wusste, dass ihr Vater es für einen Fehler hielt, sie nicht früher vom Kaiserhof geholt zu haben. Nach seiner Ansicht war der Unterricht an der Hofschule für Mädchen gänzlich ungeeignet. Der Umgang mit den zügellosen unverheirateten Töchtern des alten Kaisers sowie die seltsame Erziehung seiner Schwägerin Gerswind hätten seine Tochter für ein vernünftiges Leben verdorben, meinte er. Wenn sie schon nicht einem Mann dienen wolle, dann eben dem Herrn im Himmel, hatte er einige Wochen zuvor übellaunig erklärt und sich auf Anraten seiner Gemahlin Heilwig im Kloster Chelles nach den Aufnahmebedingungen erkundigt. Heilwig fühlte sich diesem Kloster sehr verbunden, da es ihre heidnische Mutter Geva aufgenommen und sie vor deren Tod im vergangenen Sommer zur gläubigen Christin bekehrt hatte. Wem es gelungen war, den Willen dieser verbitterten alten Sächsin zu brechen, der würde auch seiner Tochter die Flausen austreiben können, hatte ihr Vater gehofft.
Nun, jetzt war in Altdorf keine Botschaft aus Chelles eingetroffen, sondern eine aus Aachen.
Der Kaiser suchte eine Braut.
Judith fuhr erschrocken auf. Mit dem nächsten Donnerschlag drang erst wirklich zu ihr durch, weshalb sie nach Aachen reisen sollte. Bisher hatte sie ausschließlich daran gedacht, wieder in die Stadt ihrer Träume heimkehren zu können. Um dann vor Ort Mittel und Wege zu finden, die ihr Verbleiben am Hof sicherten. Notfalls durch eine geeignete Heirat. Aber gleich mit dem Kaiser?
Ein alter Mann, dachte sie betroffen. Er musste um die vierzig sein, denn sie selbst war genauso alt wie sein ältester Sohn Lothar. Mit dem hatte sie früher gespielt, wenn Kaiser Karl seinen Sohn König Ludwig und dessen Familie aus Aquitanien zu sich nach Aachen bestellt hatte. Ein gewitzter und recht hübscher Knabe mit ziemlich langer Nase, erinnerte sie sich, den kann ich mir schon eher als Heiratskandidat vorstellen, wenn es denn sein muss. Dabei fiel ihr ein, dass der Aachener Bote auch sie soeben als alt bezeichnet hatte. Beruhigt atmete sie aus, denn wenn der Kaiser, wie sein Vater selig, vor allem Mädchen in der ersten Blüte ihres Lebens schätzte, würde er kaum sie erwählen, sondern eher eine niedliche Vierzehnjährige.
Ja, wollte sie denn nicht Kaiserin werden?
Genau diese Frage stellte ihr die Mutter, die am nächsten Morgen heimkehrte und mit der großen Neuigkeit überfallen wurde. Müde nach einer durchwachten Nacht, aber glücklich, dass Gebärende und Neugeborenes im kleinen Grubenhaus am Leben geblieben waren, ritt Gräfin Heilwig im Morgengrauen in den Altdorfer Hof ein. Auch wenn sie keine Hebamme war, so wurde sie doch oft zu Geburten gerufen, weil man auf gewisse Kräfte der Gräfin hoffte. Niemand hätte gewagt, es auszusprechen, aber die Tatsache, dass Heilwig als heidnische Sächsin geboren worden war, rückte sie in den Augen vieler einfacher Menschen in die Nähe einer weisen Frau. Dahinter steckte der Argwohn, das Christentum unterdrücke altbewährte Kenntnisse, über die nur noch wenige Menschen aus der alten Zeit verfügten. Sachsen, zum Beispiel. Heilwig hätte sich empört gegen solche Andeutungen verwahrt, wären sie ihr zu Ohren gekommen. Sie sah ihre Aufgabe darin, den armen Frauen mit kräftigenden Nahrungsmitteln, warmer Kleidung und fürsorglicher Umsicht beizustehen und, wenn die Sache hoffnungslos erschien, die Fürsprache des Herrn zu erbitten. Anders als ihre Schwester Gerswind, die noch immer heidnischen Bräuchen anhing und Judith sogar darin unterrichtet hatte, vertraute Heilwig bedingungslos auf das Wort Gottes. Als Judith in den Schoß der Familie zurückgekehrt war, hatte sie der Tochter strengstens untersagt, sich in den alten Bräuchen zu üben oder gar irgendwelchen Zauber einzusetzen. Sie wusste nicht, ob sich Judith an ihr Verbot hielt. So wie sie überhaupt nur sehr wenig von der Tochter wusste, die sie zwar geboren, aber im Alter von acht Jahren verloren hatte. Sie gestand sich ein, dass ihr das eigene Kind fremder war als die Frau, der sie in der Nacht zuvor beigestanden hatte. Das war nicht Judiths Schuld, sondern Heilwig selbst hatte dies heraufbeschworen, als sie im Jahr 804 mit dem kleinen Kind gen Norden gereist war, um ihre eigene Mutter vom Kriegshandwerk abzubringen. Der Anblick ihrer wohlgeratenen Enkelin sollte Geva davon abhalten, weitere Sachsenaufstände gegen Karl den Großen anzuführen. Heilwigs Plan scheiterte. Mit Geva und Judith wurde sie von den Mannen Karls in Hollenstedt festgenommen und nach Aachen verbracht. Der Kaiser gab Heilwig die Freiheit zurück und schickte ihre Mutter ins Kloster Chelles. Judith aber behielt er als Geisel am Hof – genau wie zwanzig Jahre zuvor Heilwigs Schwester Gerswind, die Beutefrau, wie sie später oft genannt wurde. Die Sünde, ihr Kind als Mittel zum Zweck benutzt zu haben, lastete schwer auf Heilwig. Sie suchte diese abzutragen, indem sie Judith ein Heim bot und sie vor den Heiratsplänen des Vaters, so gut sie es vermochte, schützte. Doch das gab ihr die verlorene Tochter nicht zurück.
»Willst du denn nicht Kaiserin werden?«, fragte sie, nachdem sie erfahren hatte, dass sich Judith gegen das Maßnehmen und die Untersuchung durch Frau Stemma verwahrt hatte.
»Wäre denn eine derart beschämende Prüfung einer künftigen Kaiserin würdig?«, wich Judith aus, da sie diese Frage auch für sich selbst noch nicht beantwortet hatte. »Außerdem liegt die Entscheidung beim Kaiser. Was ich will, spielt dabei wohl keine Rolle. Ich stelle mich in Aachen vor, dann sehen wir weiter.« Ihr fiel ein, wie bestimmt sich ihre Mutter vor sie gestellt hatte, wenn der Vater sie wieder mal einem Ehemann zuführen wollte. »Danke, dass du mich im Gegensatz zu allen anderen wenigstens gefragt hast«, sagte sie und schenkte ihr einen Blick, bei dem Heilwig das Herz aufging.
Bereits wenige Stunden später war Judith reisebereit. Ihr Vater hatte zwar angeboten, sie eine Woche später mit einem kleinen Reisezug selbst nach Aachen zu begleiten, doch Judith zog es vor, noch am selben Tag gen Norden zu ziehen. Dafür hatte sie einen ganz bestimmten Grund. Sie hatte sich nämlich bei Frau Stemma nach der Reiseroute erkundigt und erfahren, dass ein Halt in Prüm geplant war. Dort sollte der Reisezug einer anderen Bewerberin zu ihnen stoßen. Und in Prüm lebte Gerswind. Für ein Wiedersehen mit der geliebten Tante war Judith bereit, die Begleitung der grässlichen Frau Stemma zu ertragen. Sie hoffte, der andere Reisezug möge sich verspäten, denn sie wollte so viel Zeit wie möglich mit Gerswind verbringen, von der sie zehn Jahre lang am Kaiserhof betreut worden war. Sie machte sich Sorgen um die Tante, denn in den vergangenen vier Jahren hatte sie aus Prüm nur ein einziger Brief erreicht.
Begleiten sollten sie nicht nur die kaiserlichen Boten, eine Magd aus dem Haushalt des Grafen und zwei seiner Männer, sondern auch ihr Bruder Konrad. Der war zwar zum Schutz der Schwester abgestellt worden, sollte sich aber auch in Aachen selbst nach einer Braut umsehen.
»Der Kaiser kann schließlich nur eine einzige der edlen Jungfrauen heiraten«, erklärte Graf Welf, »aber alle anderen gehören zu den Schönsten des Landes und stammen von den besten Familien ab. Eine günstigere Gelegenheit zu einer guten Einheirat kann es gar nicht geben. Nicht nur viele schöne Mädchen machen sich also derzeit auf den Weg nach Aachen, meine Lieben, sondern auch anspruchsvolle junge Männer aus allen Reichsteilen. Ich verspreche euch, dass keines der erwählten Mägdelein ohne Freier bleiben wird. Nicht einmal unsere Judith!«, setzte er triumphierend hinzu und wandte sich an seinen ältesten Sohn. »Ich vertraue deinem Urteil, Konrad«, sagte er. »An Vaters statt kannst du deine Schwester irgendeinem würdigen Edlen versprechen, der sie haben will.«
Konrad grinste. Judith erschrak. Wenn Männer aus allen Reichsteilen um ihre Hand anhalten konnten, wäre es nicht ausgeschlossen, dass sie in einen entfernt gelegenen Winkel verschleppt werden und genau dem Leben entgegensehen würde, das ihre Mutter führte und dem sie in den vergangenen Jahren so erfolgreich ausgewichen war. Sie sah sich als Herrin eines ähnlichen Hofes wie ihres Elternhauses. Grauenvoll. Damit verlor der Gedanke, auf den alten Kaiser einen günstigen Eindruck zu machen, mit einem Mal sehr viel von seinem Schrecken.
Im Eifelgau lag Anfang Dezember schon tiefer Schnee. Die Pferde kamen zwar nur langsam voran, doch Frau Stemma zeigte sich erleichtert.
»Auf gefrorenem Boden reitet es sich besser«, sagte sie zu Judith und berichtete von den verschlammten Wegen, die sie auf der Hinreise behindert hatten, von Flüssen, die über die Ufer getreten waren und ihnen Umwege aufgezwungen hatten und von Dauerregen, der ihnen die Sicht genommen und sie derart durchnässt habe, dass die Angst vor todbringender Erkältung zum ständigen Begleiter geworden war. Schnee und klirrende Kälte seien solchen Unbillen doch entschieden vorzuziehen. Judith hüllte sich tiefer in ihren Pelz ein und blickte auf die Männer, die schweigend vor sich hin ritten. An Bärten und Augenbrauen hatten sich Eisklümpchen gebildet.
Die Welfentochter versuchte ihre steifgefrorenen Zehen innerhalb der Fellstiefel zu bewegen, um das Blut anzuregen. Ihre Kopfhaut, die unter dem dicken Tuch und der Pelzkapuze unerträglich juckte, schien außerhalb der Reichweite ihrer klammen Finger zu sein. Ihr Rücken schmerzte, ihre Beine waren nahezu gefühllos, und der Körperteil, der dem Pferd am nächsten war, musste inzwischen gänzlich aufgerieben sein. Sich davon überzeugen konnte sie nicht, auch wenn sie Frau Stemmas Rat nicht folgte, sich keine Erleichterungspause zu gönnen, sondern es einfach fließen zu lassen, was sie kurzzeitig wärmen würde. Sie bestand darauf, zum Verrichten der Notdurft abzusteigen. Und konnte danach oft nur mithilfe anderer wieder aufsteigen. Das war sehr demütigend. Den bisher zweiwöchigen Ritt, der nur durch kurze Schlafspannen unterbrochen wurde – gelegentlich sogar ohne Dach über dem Kopf in den Reisepelz gehüllt –, empfand sie als die härteste Prüfung ihres Lebens.
»Warum hätte der Kaiser nicht bis zum Frühling warten können!«, murrte sie. »Normalerweise macht sich doch kein Mensch im Winter auf so einen weiten Weg!«
»Auch kein Räuber«, erwiderte Frau Stemma. »Man muss immer die Vorteile sehen.«
Als hätte er die Worte gehört, trabte jetzt der einheimische Führer, den sie für dieses Teilstück der Reise angeworben hatten, auf die Frauen zu und erklärte fröhlich: »Wir werden noch vor Einbruch der Dunkelheit in der Abtei ankommen. Da gibt es ein gut gewärmtes Gästehaus mit richtigen Betten, hervorragendes Bier und ein Stück ordentlich gebratenes Wildbret. Herz, was willst du mehr!«
»Vielleicht etwas für die Seele?«, fragte Frau Stemma scharf. »Eine kleine Kirche? Damit wir Gott danken können, dass wir es bis hierher lebendig und gesund geschafft haben.«
»Sogar eine große Kirche!«, versicherte der Einheimische. »Die schönste weit und breit! Gewiss noch schöner als die Kirche von Aachen. Hier in Prüm hat König Pippin vor über einem halben Jahrhundert die Goldene Kirche gestiftet und ihr die kostbarste Reliquie des Erdkreises geschenkt – die Sandale Jesu!«
Beim Gedanken an nackte Füße in dünnen Riemenschuhen zitterte Judith noch mehr. So eine Kälte wie hier kannte sie weder aus Aachen noch aus Altdorf. Was mochte Gerswind bloß bewogen haben, sich in einer derart unwirtlichen Gegend niederzulassen!
»Kennt Ihr die Bewohner Prüms?«, fragte sie den Einheimischen. Er musterte sie verblüfft und brach in Gelächter aus. »Natürlich! Ich wohne doch dort. Da gibt es nicht viel zu kennen. Vater Dankrad, ein paar Mönche, ein paar Hufebauern, etliche Unfreie, ein paar Handwerker, ein paar alte Männer und die Frauen, die in der Tuchmacherei arbeiten. Eben, was sich so alles in einer Abtei aufhält und sich um sie herum ansiedelt. In Prüm kennt jeder jeden, und, von den Mönchen mal abgesehen, sind fast alle miteinander verwandt.«
»Sagt Euch der Name Gerswind etwas?«
Der Mann starrte sie verblüfft an. »Ja«, knurrte er abweisend. »Mit der bin ich nicht verwandt. Die Frau aus Aachen. Die Verrückte.«
»Was ist mit ihr?«, fragte Judith erschrocken. »Ich bin mit ihr verwandt«, setzte sie schnell hinzu. »Sie ist die Schwester meiner Mutter.«
»Ja, dann…«, sagte er etwas hilflos, als erklärte das Gerswinds Verrücktheit.
»Es geht ihr gut«, setzte er seufzend hinzu. »Vielleicht zu gut. Sonst hätte sie Vater Dankrad doch nie davon überzeugen wollen, in der Abtei eine Schule einzurichten!« Er begann sich vor Lachen zu schütteln.
»Was ist daran so komisch?«, wollte Judith wissen. »In vielen Klöstern werden Kinder unterrichtet.«
»Aber doch nicht Mädchen! Wenn das nicht verrückt ist, was dann?«
Judith fiel die kaiserliche Hofschule ein. Die Mädchen waren zwar getrennt unterrichtet worden, hatten aber zumeist erheblich bessere Leistungen im Lesen und Schreiben aufgewiesen als die Knaben. Kaiser Karl hatte höchstselbst zugegeben, dass seine Töchter wesentlich gelehriger als seine Söhne waren. Judith dachte an ihren Vater, der zwar lesen, aber nur mit Mühe und Not ein paar Buchstaben zu Pergament bringen konnte. Ihre Mutter hingegen setzte in schöner Sprache die feinsten Minuskeln auf; ihre Schwester Dhuoda hatte gar angefangen, eine eigene Schrift mit religiösen und philosophischen Gedanken anzufertigen, und Hemma hatte eine Geschichte niedergeschrieben, in der ein schielendes Mädchen zur Königin gemacht wurde, weil sie einen Blick für das hatte, was anderen verborgen blieb. Judiths eigene Dichtkunst hatte Einhard, der Leiter der kaiserlichen Hofschule, einst gar mit Strophen von Homer verglichen. Weshalb Judith übrigens die heimliche Vermutung hegte, dass sich hinter dem Namen des Homer eine Frau verbarg.
»Kaiser Ludwig hat jedenfalls alle Mädchenschulen schließen lassen«, erklärte Frau Stemma zustimmend. »Woran er recht getan hat! Es ist widernatürlich, wenn Frauen ihre Zeit mit Lesen und Schreiben verplempern, anstatt zu kochen, zu spinnen, zu gebären oder auf dem Feld zu arbeiten.«
Der Mann nickte. »So ist es. Ich jedenfalls habe meiner Tochter verboten, zu dieser Frau zu gehen. Sie soll jetzt angeblich in ihrem eigenen Haus Mädchen unterrichten, aber ich kenne keine Familie, die ihre Tochter dahin schicken würde.« Er wandte sich zögerlich fragend an Judith.
»Ihr sagt, sie sei Eure Tante. Im Dorf heißt es, sie sei eine heidnische Sächsin. Was ist denn nun wahr?«
»Sie ist meine Tante«, beschied ihm Judith in höchster Besorgnis. Sie begriff, dass Gerswind einen noch tieferen Einschnitt in ihr Leben erfahren haben musste als sie selbst, die immerhin wohl behütet auf einem Herrensitz lebte. »Und sie hat eine hohe Stellung am Hof Kaiser Karls bekleidet«, fügte sie steif hinzu, hoffend, dass er jetzt nicht Konrad befragen würde, der ihm mitteilen könnte, dass die Tante schlichtweg eine Bettgespielin des Herrschers gewesen sei. Eine üble Verzerrung der Wahrheit, denn kaum jemand wusste besser als Judith, welch wichtige Rolle Gerswind im Leben des Kaisers gespielt hatte. Aber da er vor der geplanten Hochzeit mit seiner letzten Geliebten gestorben war, konnte sie nicht nur keine Ansprüche geltend machen, sondern war ohne Mittel und Rechte vom Kaiserhof vertrieben worden. Ich muss auf jeden Fall heiraten, dachte Judith betroffen, eine solche Schutzlosigkeit könnte ich nicht ertragen. Sie riss sich zusammen.
»Sagt doch, wo wohnt meine Tante?«, fragte sie freundlich.
»Im Hurenhaus«, brummte der Mann.
»Im Hurenhaus!«, wiederholte Judith entsetzt. Die Aussichten wurden immer übler.
»So hieß es früher«, seufzte der Mann. »Als die Mönche noch mit Frauen umgehen durften und sie dafür bezahlten. Jetzt ist so etwas natürlich verboten, und da sind die Huren verschwunden. Aber niemand wollte in das böse Haus am Ufer der Prüm ziehen. Bis eben die Frau aus Aachen kam und es für sich herrichtete.« Neugierig fragte er: »Was für eine Stellung hat sie denn an Kaiser Karls Hof bekleidet?«
»Eine sehr bedeutende«, erwiderte Judith ausweichend, weil ihr keine andere Antwort einfiel.
Die Frau, die im Aachener Palatium kaiserliche Gemächer bewohnt, Karl den Großen in seinen privatesten Augenblicken umsorgt und in seiner letzten Stunde bei ihm gewacht hatte, sollte in diesem kleinen hölzernen Schuppen hausen? Judith starrte auf die schneebedeckte windschiefe Hütte im Schatten hoher Fichten am Ufer der zugefrorenen Prüm. Rauch stieg aus einem Loch im Dach empor. Judith trat einen Schritt näher, um anzuklopfen.
Da öffnete sich die Tür. Der Schwall von Schmutzwasser, der schwungvoll aus einer Schüssel ins Freie befördert wurde, hätte sich fast über Judiths Füße ergossen. Sie sprang im gleichen Augenblick zur Seite, wie die irdene Schüssel zu Boden fiel. Und dann lagen sich die beiden Frauen in den Armen.
»Judith! Wie kommst du hierher!«, rief Gerswind, als sie ihre Nichte an der Hand ins Innere der Hütte zog und die Tür wieder schloss.
»Ich bin auf dem Weg nach Aachen«, erwiderte Judith strahlend, zupfte sanft an dem dicken weißblonden Zopf, der Gerswind über die Brust hing und setzte übermütig hinzu: »Wo ich Kaiser Ludwig heiraten werde!«
Gerswind wurde aschfahl. Sie ließ die Hand ihrer Nichte los, suchte Halt an der Wand und stieß heiser hervor: »Niemals! Das werde ich verhindern.«
2
Aus den Chroniken der Astronoma
Im Jahr des Herrn 818
Am Gründonnerstag des Vorjahres bricht der hölzerne Gang zwischen Hofkirche und Palast zusammen. Ein Mann stirbt, und viele werden schwer verletzt, darunter auch Kaiser Ludwig höchstselbst. Knapp dem Tod entronnen, beschließt er, seine Nachfolge zu regeln, und erlässt ein Vierteljahr später die Ordinatio imperii: Er teilt sein Reich unter seinen drei ehelichen Söhnen auf. Die beiden jüngeren, Ludwig, genannt Ludo, und Pippin von Aquitanien, sollen nach dem Tod des Vaters ihrem älteren Bruder Lothar, den Ludwig jetzt zum Mitkaiser erhoben hat, als Unterkönige dienen und dürfen nur mit seiner Zustimmung heiraten. Die illegitimen Söhne Karls des Großen schließt der Kaiser aus der Erbfolge aus. Er lässt seine Halbbrüder Drogo, Hugo und Theoderich scheren und in Klöster einweisen. König Bernhard von Italien, den Sohn seines Bruders Pippin, übergeht er in der Ordinatio imperii. Stattdessen schreibt er Italien seinem eigenen Sohn Lothar zu. Damit hat Kaiser Ludwig das Versprechen gebrochen, das er seinem Vater, dem Großen Karl, im Jahre des Herrn 813 gegeben hat. Bernhard, hinter dem ein bedeutender Teil des Adels steht, pocht auf sein verbrieftes Recht. Er erhebt sich gegen seinen Oheim Kaiser Ludwig und besetzt die Alpenpässe. Kaiserin Irmingard greift zu einer List und sendet ihm einen Brief: Alles solle vergeben und vergessen sein, wenn er sich an einem neutralen Ort zu einem Aussöhnungstreffen mit Ludwig bereit erkläre. Bernhard willigt ein, wird aber bei seiner Ankunft in Chalon-sur-Saône als Hochverräter festgenommen und nach Aachen verschleppt. An diesem Osterfest, genau ein Jahr nach dem Einsturz des Holzganges, verurteilt der Kaiser seinen Neffen zum Tode und begnadigt ihn dann zur Blendung. An deren Folgen stirbt König Bernhard am 17. April. Damit bringt Ludwig den größten Teil des Adels gegen sich auf. Der hatte ihm bereits die Vertreibung der klugen Berater seines Vaters, vor allem des Grafen Wala, übel genommen. Als ein halbes Jahr später Kaiserin Irmingard stirbt, wird dies von manchen als Strafe des Himmels gesehen. Auch der Kaiser fürchtet nun den Zorn des Herrn und will sich als Mönch in ein Kloster zurückziehen. Doch die Männer, denen er als Berater an seinem Hof zu hohem Ansehen, Reichtum und viel Macht verholfen hat, allen voran sein Milchbruder, der in Unfreiheit geborene Ebbo Bischof von Reims, beschwören ihn, im Amt zu verbleiben und schnell wieder zu heiraten. Sie wünschen, ihn mit den schönsten Mädchen des Reichs zu verlocken, und wollen seinen Sinn auf ein edles Kind lenken, dessen Vater in keinerlei Verbindung zum Hof Karls des Großen gestanden hat. Sie glauben, mit einem solchen neuen Vasallen den Einfluss der Gegner des Kaisers beschneiden zu können. Anders als Kaiserin Irmingard, die große Macht auf den Kaiser ausgeübt hat, soll die neue Gemahlin demütig und fügsam sein, jedoch im Sinne der Berater auf den Kaiser einwirken. Nach byzantinischem Muster wird in Aachen eine Brautschau abgehalten. Die ersten Jungfrauen sind bereits in der Karlstadt eingetroffen.
Im Jahr 818
Judith blickte ihre Tante überrascht an, doch ehe sie sich erkundigen konnte, was sie zu dieser seltsamen Äußerung getrieben hatte, erklang eine Kinderstimme: »Wer ist die Frau, Mutter?«
Gerswind fing sich und schob Judith ein kleines Mädchen mit langen hellroten Zöpfen und wasserblauen Augen zu.
»Umarme deine Base, Adeltrud«, forderte sie ihr Kind auf. »Das ist Judith, die Tochter meiner Schwester Heilwig.«
Judith hatte den Pelz und das Tuch abgenommen und schüttelte jetzt ihre Haare aus, die im Schein der Herdflammen golden aufblitzten und ihr Haupt wie einen Heiligenschein umschimmerten. Sie bückte sich zu der etwa Siebenjährigen hinunter und streichelte ihr die mit Sommersprossen übersäte Wange.
»Bist du ein Engel?«, fragte das Kind murmelnd. Es legte seine dünnen Ärmchen um Judiths Hals und strich mit den Fingern vorsichtig über das seidige Goldgespinst ihres Haars.
Judith küsste das Kind auf den Scheitel. »Ja, kennst du mich denn gar nicht mehr, Adeltrud?«, fragte sie sanft. »Erinnerst du dich nicht mehr daran, wie ich am Kaiserhof mit dir gespielt habe?«
»Sie war noch sehr klein«, sagte Gerswind schroff. »Wie sollte sie sich da an irgendwen erinnern?« Die Bitterkeit verschwand aus ihrer Stimme, als sie ihre Tochter bei der Hand ergriff und versetzte: »Komm, Adeltrud, ich bringe dich jetzt ins Genitium. Da wirst du heute übernachten. Du weißt doch, Großmutter Gislind braucht deine Augen.«
»Großmutter Gislind?«, fragte Judith überrascht.
»Die Witwe Gislind hat uns sehr beigestanden, als wir vor vier Jahren hierher flüchten mussten«, antwortete Gerswind. »Eine andere Großmutter kennt mein Kind nicht.«
»Aber das Genitium…«, Judith brach ab, sah Gerswind vielsagend an und setzte leise hinzu: »Solche Frauen…«
Ihre Mutter Heilwig hatte die Arbeiterinnen im Altdorfer Genitium stets als »lose Dirnen« bezeichnet, die vom Glauben abgefallen seien und denen man mit strenger Zucht begegnen müsse.
»Ehrenwerte Frauen«, erwiderte Gerswind mit einer Stimme, die keinen Widerspruch duldete. »Die schwer zu arbeiten verstehen. Es schadet Adeltrud nicht, ihnen zur Hand zu gehen. Ich selbst war kaum älter, als ich dort meinen Lebensunterhalt verdienen musste.«
Judith schwieg. Es gab so vieles aus Gerswinds Leben, von dem sie nichts wusste.
»Warum musstest du vom Hof flüchten?«, fragte sie fast unhörbar.
»Weil Kaiser Ludwig alle Buhlen seines Vaters vertrieben und deren Kinder in Verliese geworfen hat«, erwiderte Gerswind. »Vor diesem Schicksal konnte ich uns bewahren. Und Ruadbern auch, Hruodhaids Sohn, falls du dich an ihn noch erinnern kannst.«
Judith nickte nachdenklich und fragte sich, ob sie am Hof noch viele ihrer alten Freunde wiedertreffen würde.
»Ein lustiger kleiner Knabe, dieser Ruadbern«, erinnerte sie sich, »der mir Kämme, Spangen und Fibeln gestohlen hat.«
»Und sie wie Reliquien hütete«, setzte Gerswind hinzu. »Er war zwar nur so alt wie Adeltrud, aber einen hartnäckigeren Verehrer hättest du wohl kaum finden können.«
Gerswind warf sich einen Mantel aus Schaffell über, reichte Adeltrud ihren Filzumhang und legte noch ein paar Scheite aufs Feuer.
»Komm, Kind, lass uns gehen, bevor es dunkel wird. Und du, Judith, bedienst dich an allem, wonach dir gelüstet. Vielleicht möchtest du dich nach deinem langen Ritt auch hinlegen.« Sie nickte zum Bett neben der Feuerstelle in der Mitte des Raumes. »Wir reden später weiter.«
Nachdem Gerswind ihre Tochter bei der Witwe Gislind abgegeben hatte, eilte sie den Hang zur Abtei hinunter. Wie erwartet war der Reisezug, mit dem Judith gekommen war, dort abgestiegen.
Gerswind stellte sich ihrem Neffen Konrad vor und erfuhr von ihm nähere Einzelheiten über den Ritt nach Aachen und die Brautschau des Kaisers. Die Weiterreise war für den übernächsten Tag geplant, da man den Zug mit den beiden Töchtern des Grafen von Tours in Prüm abwarten wollte. Gerswind teilte Konrad mit, dass Judith bei ihr nächtigen werde, und lud ihn nach kurzer Überlegung ein, sie gleichfalls zu besuchen. Sie war sicher, dass er von diesem Angebot keinen Gebrauch machen würde. Ihr war nicht entgangen, dass er eine ebenso herzliche Abneigung zu ihr gefasst hatte wie sie ihm gegenüber. Er hatte einen verschlagenen Blick, spielte sich den Mitreisenden und dem gastfreundlichen Abt gegenüber auf und schien von der Aufgabe, Judith an irgendeinen würdigen Edlen zu verschachern, sehr angetan zu sein. Offensichtlich ging er nicht davon aus, dass Ludwig Judith erwählen würde. Seine anzügliche Bemerkung, Gerswinds frühere Aufgaben am Kaiserhof ließen ihren Zögling, seine Schwester, als künftige Kaiserin gänzlich ungeeignet erscheinen, hätte sie ihm gern um die Ohren geschlagen, aber sie wollte den guten Abt nicht in Verlegenheit bringen.
Die sternenklare Nacht war bereits angebrochen, als Gerswind die Abtei verließ. Obwohl sie es kaum erwarten konnte, zu Judith zurückzukehren, schritt sie nur langsam aus. Es gab so viel zu überdenken. Als sie am Gottesacker vorbeikam, hielt sie inne. An jener Ecke nahe der Kirche, wo die verstorbenen Mönche des Klosters zur letzten Ruhe gebettet waren, sah sie die Holzkreuze fast gänzlich von Schnee bedeckt. Sie stapfte hinüber und begann mit bloßen Händen eines der Kreuze freizuschaufeln. Währenddessen sprach sie laut: »Habe ich dir je von meiner letzten Begegnung mit deinem Bruder Ludwig erzählt, Pippin? Wie er mich mit seinem Schwert töten wollte und dann mit einem Mal in Tränen ausbrach? Da tat er mir plötzlich leid! Der Mann, der so viele Menschen auf dem Gewissen hat, wie vermutlich auch dich, rührte mich! Der Mann, der mich bei der Jagd geschändet hat! Der mich unentwegt gedemütigt hat! Nie habe ich einen Menschen mehr gehasst. Und doch war ich nahe daran, ihm aus lauter Mitleid alles zu vergeben, so wie es dein christlicher Gott empfiehlt, stell dir vor, mein guter alter Freund!« Ihre Hände brannten wie Feuer, dennoch schob sie jetzt auch noch Schnee von der Grabstelle. »Aber nur nahe dran. Denn der Gedanke an Rache, Pippin, der war viel stärker als die Liebe zu meinem Feind. Mein ist die Rache, spricht der Herr. Doch er hat Ludwig nicht gerichtet, sondern zum Kaiser befördert. Der Tod seiner Gemahlin sei Strafe genug gewesen, meinst du? Er hat dieses Weib nie geliebt, nur benutzt wie alle Menschen, die er für seine Zwecke einspannen konnte. Jetzt ist sie weg, und er greift sich die Nächste. Aber nicht unsere Judith!«
Sie hielt inne, rieb sich heftig die schmerzenden Hände, steckte sie unter ihren Mantel, um sie zu wärmen, und drückte sie an die Brust. Dabei spürte sie den Diamantring, den sie schon seit so vielen Jahren um den Hals hängen hatte. Und da schoss ihr ein Gedanke durch den Kopf. Ja, dachte sie, ja. Jetzt weiß ich es. Jetzt weiß ich, wie ich Ludwig seine bösen Taten heimzahlen kann! Mit einem Mal stand ihr die vollkommene Rache klar vor Augen.
Gerswind verabschiedete sich von ihrem Freund Pippin, Kaiser Karls erstgeborenem Sohn, den man zu Lebzeiten den Buckligen genannt und um sein Erbe betrogen hatte. Der ihr das Leben gerettet und als Mönch im Kloster Prüm gestorben war. Jetzt hatte sie es sehr eilig, zu Judith zurückzukehren und ihren Plan auszuführen. Skrupel, sich des geliebten Mädchens als Werkzeug zu bedienen, hatte sie keine, denn sie war überzeugt, dass Judith gerade durch diese wundersame Form der Vergeltung selbst am meisten Beistand bekäme. Sie wäre ihr ganzes Leben lang hervorragend geschützt, bräuchte nicht mehr zu befürchten, von ihrem Bruder an irgendeinen würdigen Edlen verschachert zu werden, und würde über eine größere Unabhängigkeit verfügen als sonst eine Frau im Reich.
Gerswind drückte die Tür zu ihrer Hütte behutsam auf. Das Feuer auf der Kochstelle in der Mitte des Raums war fast gänzlich heruntergebrannt. Auf dem Bett daneben lag Judith lang ausgestreckt mit geschlossenen Augen. Im Licht der Glut schimmerte ihr Antlitz, als wäre es aus durchscheinendem rosa Marmor gemeißelt. Eine schlafende Göttin, dachte Gerswind versonnen, als sie mit einem großen Holzlöffel etwas Glut in ein Schälchen häufte. Aus den Kräuterbüscheln von der Decke zupfte sie ein paar zusammengerollte Blättchen Weihrauch, etwas Myrrhe, ein paar Nadeln Rosmarin und eine Spur Eisenhut. Sie zerkrümelte die Kräuter zwischen den Fingern, streute sie auf die Glut in der Schale und schabte etwas Engelwurz darüber.
Dann kniete sie sich vor Judith hin, zog sich die Kette über den Kopf, nestelte den Diamantring von der Goldschnur und wollte ihn auf das Häufchen Kräuter legen, das bereits zu glimmen begonnen hatte.
Judith begann sich zu regen. Sie sog hörbar die Luft ein.
»Die gute alte Zauberei?«, fragte sie. Ihre Stimme klang spöttischer, als sie beabsichtigt hatte. »Entschuldige bitte«, fügte sie hinzu. Sie setzte sich auf, wischte sich den Schlaf aus den Augen und berührte Gerswind sanft an der Schulter.
»Ich weiß schon«, erwiderte Gerswind freundlich und pustete in die Schale. Eine schmale Rauchsäule stieg empor, »Du hast mir ja schon vor über vier Jahren mitgeteilt, dass du damit nichts mehr zu schaffen hast.«
Nicht mit deiner Naturmagie, dachte Judith, die habe ich längst hinter mir gelassen. Weil ich Kräfte entdeckt habe, die weit darüber hinausgehen, großartige Kräfte, die mir aber so viel Angst machen, dass ich es kaum wage, sie einzusetzen.
»Schade«, fuhr Gerswind unbekümmert fort. »Du warst so viel begabter als ich. Das habe ich schon gemerkt, als du noch ganz klein warst.«
Gerswind griff nach Judiths linker Hand und ließ den Ring über ihren Mittelfinger gleiten. Er passte mühelos.
Sprachlos starrte Judith auf den großen Diamanten.
»Er gehört dir«, sagte Gerswind.
Judith zog den Ring ab und drückte ihn Gerswind wieder in die Hand.
»Das kann ich nicht annehmen«, wehrte sie ab. »Er ist viel zu wertvoll. Damit kannst du dir doch ein erheblich besseres Leben leisten als…«, sie machte eine hilflose Gebärde, die den kargen Raum und alles, was sich in ihm befand, einschloss. Schnell versuchte sie ihre Unhöflichkeit mit einer Frage zu vertuschen: »Woher hast du diesen Ring?«
»Er ist mir vor vielen Jahren auf den Kopf gefallen«, antwortete Gerswind wahrheitsgemäß. »Vermutlich hat ihn ein Vogel verloren, weil er ihm zu schwer wurde.«
Das hatte sie damals wirklich geglaubt. Als aber niemand den Verlust des kostbaren Rings meldete und sie später die ihm innewohnende Kraft entdeckt hatte, war eine andere Vermutung in ihr aufgestiegen. War es wirklich reiner Zufall gewesen, dass sie dieser Ring genau an jenem Tag am Kopf getroffen hatte, als König Karl endlich von der Leiche seiner Gemahlin Fastrada abgelassen hatte? Sie entsann sich, wie ihr Mentor Teles, der sich vorzüglich auf Zauber verstanden hatte, damals zu Hilfe gerufen worden war, um den König zu Verstand zu bringen. Vielleicht hatte die tote Fastrada den Ring noch getragen, Teles ihn ihr abgenommen, aus dem Fenster geworfen und Karl damit dem Bann entzogen? Der Gedanke, der damalige König sei nicht abartig gewesen, sondern nur kurzzeitig Opfer eines Dämons geworden, hatte sie getröstet, als sie sehr viele Jahre später seine Geliebte wurde.
»Pass gut auf«, sagte Gerswind und legte den Ring auf die glimmenden Kräuter in der Schale. Judith kniff die Augen zusammen, um noch schärfer sehen zu können, und blickte konzentriert auf den goldenen Reif. Einen kurzen Augenblick lang glaubte sie zu sehen, dass er sich bewegte, wie eine zusammengerollte Schlange, die sich aufrichtet und die Zunge herausschnellen lässt. Der Diamant schien Feuer zu sprühen. Es ging jedoch so schnell vorüber, dass sie vermutete, jener Sinnestäuschung erlegen zu sein, die ein intensiver Blick auf Feuer und Rauch mit sich bringen kann. Mit Sinnestäuschungen kannte sie sich aus.
»Was sagst du da?«, fragte sie Gerswind, die etwas vor sich hingemurmelt hatte.
»Nichts von Bedeutung«, erwiderte Gerswind, nahm mit bloßen Fingern den Ring aus der Schale und legte ihn behutsam auf den steinernen Rand der Feuerstelle.
Misstrauisch beäugte Judith ihre Tante. »In solch einer… Verfassung sagst du nichts ohne Grund, ich kenne dich doch!«
»Also gut, ich habe dir den Ring geweiht. Jetzt darfst du ihn nicht mehr ablehnen.«
Judith erhob sich vom Bett, ging ein paar Schritte durch die Kammer und breitete die Arme aus.
»Gerswind! Dieser Ring ist eine große Kostbarkeit. Sein Verkauf würde dich von allen Sorgen befreien!«
»Ich habe keine Sorgen und alles, was ich brauche.«
»Du könntest eine Schule für Mädchen einrichten!«
Gerswind lachte bitter. »Die ist hier weder für Geld noch für gute Worte durchzusetzen.«
»Eine Mitgift für Adeltrud!«
»Er ist deine Mitgift, Judith. Von mir.« Sie hob den inzwischen erkalteten Ring vom Stein und griff wieder nach Judiths Hand.
»Ich kann dir nicht das einzig Kostbare in deinem Besitz abnehmen«, sagte Judith, als ihr Gerswind den Ring abermals überstreifte. Ihre Stimme klang nicht mehr so überzeugt wie zuvor.
»Das tust du nicht. Ich gebe dir den Ring. Weil du jetzt eine bessere Verwendung für ihn hast als ich. Das wirst du später schon merken. Trage ihn immer, und gehe klug mit ihm um. Versprichst du mir das?«