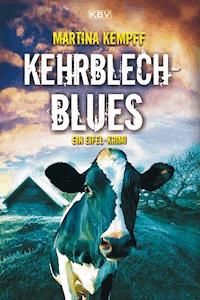7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
In der Feuerstelle wird bei der Sanierung von Katja Kleins Bruchsteinhaus auf der Kehr eine Leiche gefunden – oder vielmehr das, was von ihr übrig blieb: Knochen. Wer war dieser geheimnisvolle Mann, der schon in den Fünfzigerjahren dort eingemauert wurde? Ein Schmuggler? Ein Zöllner? Ist er etwa von Katjas Vater ermordet worden? Während Polizeiinspektor Marcel Langer diesen Fragen nachgeht, gibt es eine weitere Leiche. Diesmal aber eine ganz frische.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Für Alfred Heintges, den Freund für alle Fälle, insbesondere für die schrägen
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe
1. Auflage 2013
ISBN 978-3-492-95890-5
Deutschsprachige Ausgabe:
© 2013 Piper Verlag GmbH, München
Umschlaggestaltung: semper smile Werbeagentur GmbH, München
Umschlagabbildung: Christoph Sagel/Corbis, mauritius images/Prisma, flgraphics/stock.xchng
Datenkonvertierung E-Book: Kösel, Krugzell
Ernst Moritz Arndt über die Eifel:
Vergangen ist nicht manches Jahr,
Da Eif’ler sein, nicht ruhmvoll war;
Sein Land, wie Petrus einst den Herrn,
Verleugnete der Eif’ler gern.
Denn Eifel hieß, was rauh und kalt,
Was öd und arm, von Sitten alt,
Was nicht geweckt, und was nicht fein;
Drum wollte niemand Eif’ler sein.
Die Zeiten haben sich geändert. Im Zeichen der Regionalmarke Eifel nennen sich heute selbst Zugezogene schnell Eifeler. Dennoch verleugnet eine Person in dieser Geschichte ihre Eifeler Herkunft …
Prolog oder Der Anfang vom Ende
Der Dezembernebel hat die Grenze zwischen Deutschland und Belgien verwischt. Dennoch kann ich in der diffusen Beleuchtung vor der Einkehr drei fremde Fahrzeugeausmachen. Ich widerstehe der Versuchung, mich mit dem geliehenen Allradmonster an diesem frühen Abend meines freien Tages danebenzustellen. Was mir sehr schwerfällt. Nicht, weil ich nachsehen will, ob Gudrun, David und Regine tatsächlich drei Wagenladungen voller Gäste bedienen, was bei solch garstigem Wetter zu so früher Stunde gar nicht schlecht wäre, sondern weil ich ganz gern die Stimmung zwischen ihnen peilen würde. Die war in den vergangenen Wochen nämlich ziemlich angespannt. Irgendetwas ist zwischen diesem Trio vorgefallen, das mehr als zwei Jahre lang reibungslos und freundschaftlich mit mir in meinem Laden zusammengearbeitet hat.
Nicht, dass plötzlich Streit ausgebrochen wäre, ganz im Gegenteil. Man geht ausgesucht höflich miteinander um, ein sehr bedenkliches Zeichen. Die üblichen Sticheleien bleiben aus. Ich vernehme keine dem Stress geschuldeten Bissigkeiten mehr, niemand knallt dem anderen irgendetwas hin oder vor, keiner tobt in der Küche, nicht einmal über Gäste wird gelästert, und alle tischen kommentarlos auf, was ich komponiere. Gerade das beunruhigt mich außerordentlich. Also ließ ich bei der letzten Menübesprechung einen Versuchsballon steigen und wurde sehr nachdenklich, als nicht ein Einziger Zeter und Mordio schrie. Ich hatte vorgeschlagen, unser – man beachte das beschwörende Gemeinschaftswort – Formenkünstler David solle ein Stück Schweinefleisch in Form eines erlegten Mannes mit Hut als Jägerschnitzel zurechtschnippeln, das man hübsch angerichtet mit Pilz-Ketchup-Soße und einem Karottengewehr an Petersilienmoos servieren könne.
David hat deutsch-englisch herumgestottert und Gudrun mir allen Ernstes erläutert, dass die Fasern des Fleisches keine Möglichkeiten zu solch künstlerischer Entfaltung böten. Regine merkte entschuldigend an, wenn ein totes Tier auf dem Teller wie ein toter Mensch aussähe, würde niemand einen Bissen runterkriegen, und dann müssten wir alles wegwerfen, was doch unserer Philosophie der Bewahrung entgegenstünde. Das letzte Fünkchen Humor ist wie weggefegt und das Lächeln meiner Bedienung so künstlich wie überall dort, wo ich nicht sein mag.
Alarmstufe Rot also. Was nur hat mein Dreierteam so aus der Fassung gebracht? Es gelingt mir nicht einmal, von der treuen Gudrun, die ansonsten nie etwas für sich behalten kann, ins Vertrauen gezogen zu werden. »Alles okay«, antwortet sie ständig; ein deutlicher Hinweis, dass überhaupt nichts okay ist. Meine Versuche, das vermutlich finstere Geheimnis dieser angespannten Freundlichkeit zu lüften, prallen an einer Wand des Entgegenkommens ab.
Die Atmosphäre in meinem kleinen Eifeler Gasthof an der Grenze zu Belgien erinnert mich an das Berlin, in das ich hineingeboren worden bin: Es herrscht Kalter Krieg, und zwischen den Menschen ist eine Mauer errichtet worden. Jeder geht seinen alltäglichen Verrichtungen nach, aber keiner scheint sich in seiner Haut wohl und sicher zu fühlen. Man belauert sich gegenseitig; fragt sich, ob man einfach abhauen kann oder ob der andere einen etwa im Stich lassen wird, weil er nicht auf neue Rosinenbomber vertrauen mag, die, wie man ja heute weiß, auch Napalm abwerfen könnten. Aber immerhin ist der Ami noch da, nämlich David. Der wird schon nicht zulassen, dass das Böse das neu Zusammengewachsene entzweit; er ist das Bindeglied zwischen den beiden Frauen, was eine vielleicht unglückliche, aber dadurch nicht weniger zutreffende Formulierung ist.
Da in meiner Gegenwart nichts ausgesprochen wird, bastele ich mir eine eigene Erklärung zurecht: David erwägt die Flucht aus einem Eifeler Leben, das er sich anfangs wohl angenehmer vorgestellt hat, Regine neidet ihm diese Freiheit und hat vielleicht gar Ansprüche angemeldet, während sich Gudrun vermeintlich behaglich eingerichtet hat, die Bedürfnisse der beiden anderen ignoriert und betet, dass sich bloß nichts ändern möge.
Mit Engelszungen habe ich vor zwei Jahren auf die drei eingesäuselt, um ihnen das Zusammenziehen auszureden. Es schaffe doch nur Unfrieden, Berufliches und Privates derart zu vermischen, hatte ich gesagt und musste mir dann gefallen lassen, ausgelacht zu werden. Was sie bei mir verdienten, reichte selbst in diesem abgelegenen kostengünstigen Teil der Schnee-Eifel, kurz Schneifel genannt, nicht für eigene Wohnungen. Warum sollte man sich den Kopf über ein anderes Dach machen, wenn man ein geräumiges leer stehendes Haus zur Verfügung habe – zugegeben, ein Haus mit einer sehr bösen Geschichte. Aber Gudrun ist darin aufgewachsen, und ihr Lebensgefährte David hat es geerbt. Regine, die Mutter seines Sohnes, der gerade in den USA das Studium der Tiermedizin aufgenommen hat – oder aufgeholt, wie sie als Eifelerin sagt –, kann darin auch noch ihren neuen Freund unterbringen; falls sich dieser je dazu aufraffen könnte, die Wohngemeinschaft mit seiner resoluten älteren Schwester Frieda in Buchet aufzugeben. Die im Übrigen darin auch noch Platz finden könnte, aber dann bestimmt das Kommando übernehmen würde. Schwer vorstellbar, dass sich Gudrun sagen lassen würde, wann die Fenster geputzt werden sollten.
Das Haus sei groß genug, um sich darin aus dem Weg gehen zu können, hatte David gesagt, als sie noch zu dritt waren. Und Regine hatte darauf hingewiesen, dass sie nur so ihr Geld zusammenhalten könnten. Unvorsichtigkeit bei privaten Ausgaben kann zu Mord und Totschlag führen. Das haben wir alle vor zwei Jahren hautnah miterlebt, vor allem Hein und Jupp. Die beiden sind erst heute Mittag von ihrem langen Mykonosaufenthalt zurückgekehrt und werden über den allgemeinen Stimmungsumschwung bestimmt genauso erschrocken sein.
Womöglich haben sie den sogar schon mitbekommen, als sie heute Mittag vor der Einkehr Heins Rote Zora abgeholt haben. Der Sportwagen, den sie mir während ihres Urlaubs wegen der Unzuverlässigkeit meines eigenen Uraltgefährts zur Verfügung gestellt haben, eignet sich allerdings nicht zum Transport von Weinkartons aus Cochem. Deshalb war ich zwar durchaus dankbar, als mir Karl-Heinz Jenniges gestern das Ungetüm zum mehrtägigen Probefahren vor die Tür gestellt hat, aber ich sagte ihm gleich, dass ich dieses Angeberauto nie im Leben kaufen würde. Karl-Heinz blieb unbeeindruckt. Vierradantrieb brauche man in diesem Teil der Eifel nicht zum Angeben, beteuerte er, sondern zum Durchkommen. Ich würde schon sehen. Für die nächsten Tage seien schließlich heftige Schneefälle angekündigt. Er könne es nicht mehr mit seinem Gewissen vereinbaren, meinem dem Tod geweihten alten Auto mit ständig neuen Ersatzteilen künstlich das Leben zu verlängern.
Zugegeben, in diesem Wagen ist die Fahrt nach Cochem so komfortabel gewesen, dass ich meinen Plan, dort zu übernachten, spontan über den Haufen geworfen habe. Auch weil Marcel nicht mitgekommen und Herbert in seinem Hotel mit einer Hochzeitsfeier zu beschäftigt gewesen ist, um Zeit für ein Schwätzchen zu haben. Ich lenkte also gleich nach meiner Einkaufstour das Monster wieder heimwärts.
Und biege jetzt links von der B 265 auf belgisches Hoheitsgebiet ein. Vor meinem alten Bruchsteinhaus stelle ich den Motor ab; imer noch unschlüssig, ob ich nicht doch die Bundesstraße überqueren und in Deutschland nach dem Rechten sehen sollte.
Dann fällt mir wieder ein, was mir Marcel gestern gesagt hat, als ich Zweifel äußerte, ob ich mir angesichts des unerfreulichen Betriebsklimas heute wirklich freinehmen sollte: »Du musst mal lernen, nicht immer alles kontrollieren zu wollen.«
Er hat recht. Den Wein aus Cochem kann ich auch morgen im Restaurant abladen; er braucht nach der langen Fahrt vermutlich genauso viel Ruhe wie Linus Auslauf. Der schwarze Riesenhund beginnt schon ungeduldig zu bellen. Während der ganzen Fahrt hat der Labrador mit den zusätzlichen Staffordshireterrier-Genen höchstens fröhlich gefiept, weil er neben mir sitzen durfte, womit ich fünfzig Euro Bußgeld und drei Punkte in der Verkehrssünderkartei Flensburg riskiert habe, dafür aber im Kofferraum mehr Weinkartons unterbringen und Linus beglücken konnte.
Während ich für den Privatgebrauch eine Flasche aus einem Karton ziehe, hebt der Hund kurz das Bein an meiner neu eingepflanzten Birke. Dann rennt er mir voraus, stößt mit der Schnauze die Tür auf und verschwindet im Haus. Ich schicke einen wütenden Blick über die Straße. Wer hat da wieder einmal nicht abgeschlossen? Und schlimmer noch, die Tür nicht einmal richtig zugezogen! Das ist ja wohl das Mindeste, was ich verlangen kann, wenn jemand in meiner Abwesenheit mein Haus betritt! Oder sollte der Ofenbauer doch gekommen sein und am Kamin arbeiten? Aber wo hat er sein Auto gelassen? Außerdem müsste dann im Haus Licht brennen.
Laut bellend stürmt Linus wieder hinaus. Er stößt mich fast um, als er wie vom Teufel gejagt über die Bundesstraße zur Einkehr hetzt. Was ist mit dem Tier los? Seit wann stürzt es sich nach einer Fahrt des Darbens nicht als Erstes auf die in der Küche bereitstehenden Leckerlis?
Noch beschleicht mich keine böse Ahnung. Die kommt erst auf, als ich sehe, dass die Wohnzimmertür sperrangelweit offen steht. Wegen der staubigen kleinen Baustelle halte ich sie jetzt immer verschlossen.
Ungehalten knipse ich das Licht an.
Schock überwältigt mich. Die Flasche rutscht mir aus der Hand und schlägt polternd auf die Holzdielen auf. Ich sinke ebenfalls zu Boden. Meine zitternden Knie können den Doppelzentner meines Leibes nicht mehr tragen. Ich versuche, mich aufzurichten, schaffe es aber nur auf alle viere, recke den Kopf weit vor und schnappe nach Luft.
Diese Schuhe, denke ich nur, warum müssen es ausgerechnet diese Schuhe sein?
Ich kann meinen Blick nicht von diesen Schuhen lösen. Sie lugen unter meiner großen weißen Mohairdecke hervor. Diese ist um einen menschlichen Körper gewickelt, mit Paketband fest verklebt und am Kopfende blutrot eingefärbt. Darunter gibt es kein Leben mehr.
Das tote Bündel liegt transportbereit vor dem Loch in der Wand. Da, wo mein Kamin hinkommen soll, da, wo wir vor vielen Wochen einen grausigen Fund gemacht, die Überreste eines Menschen entdeckt haben, der vor über einem halben Jahrhundert nach seiner Ermordung dort eingemauert worden ist.
Ich starre auf die Schuhe. Die hat kein fremder Unbekannter getragen. Einer von uns ist ermordet worden, einer aus meinem engsten Kreis. Ich kenne diese Schuhe.
Wie auch die Stimme aus dem Flur, die durch die Stille des Hauses peitscht: »Katja! Nicht in Cochem? Was machst du denn schon hier?«
Ich will schreien, aber ich bringe keinen Ton hervor.
BUCH 1_VORHER
Kapitel 1
Hühnersuppe
mit Karotten, feinen Lauchringen, Ingwer, Zitronengras, klein gehackten Zwiebeln, Koriander, Chilischoten, einem Hauch Knoblauch, braunem Zucker, Sherry, Kokosmilch, einer Prise Kreuzkümmel, Kurkuma und frischen Orangen
Oktober
Niemand weiß, wo die Gans hergekommen ist. Sie ist einfach da, steht frühmorgens keck erhobenen Hauptes auf den Stufen meines Restaurants und schnappt nach jedem, der sich der Tür nähert. Linus hat schon beim ersten Zischlaut seine Kampfhundgene vergessen und das Weite gesucht.
»Freches Biest«, beschimpft Gudrun den Entenvogel und wagt beherzt einen weiteren Vorstoß. Doch auch die landwirtschaftlich Geschickteste unter uns muss sich wieder zurückziehen. Unter dem Triumphgeschnatter einer Gans, die weiß ist und viel wilder als all ihre grauen Artgenossen, die uns Konrad Lorenz nahegebracht hat.
»Wir sollten den Jäger anrufen«, schlägt Hein vor, was Jupp zum Glück nicht hört, da er mit dem Handy am Ohr zur Seite getreten ist, um sich bei den Bauern der Nachbarschaft nach einer abgängigen Gans zu erkundigen.
»Hol lieber einen Besen!«, schnauzt ihn Gudrun an.
»In zwei Monaten ist Weihnachten«, fährt Hein fort. »Wir könnten sie einfrieren …«
»Mit einer Kugel im Kopf?«, fragt Regine empört. »Wir müssen geduldig sein. Die Gans kann nichts dafür, dass sie eine Gans ist. Sie glaubt, dass sie dieses Haus bewachen muss.«
»Wir sind hier doch nicht im alten Rom«, werfe ich ein.
»Was hat das damit zu tun?«, fragt Regine.
»Da haben Gänse das Kapitol bewacht.« Meine Allgemeinbildung trägt zwar nicht dazu bei, unser praktisches Problem zu lösen, untermauert aber hoffentlich meine Autorität. Diese wird von dem Federvieh vor dem Eingang auf eine harte Probe gestellt. Also setze ich noch einen drauf: »Und für die alten Ägypter war die Gans ein Bote, der zwischen Himmel und Erde vermittelte.«
»Was du alles weißt.« Gudrun erbleicht. »Vielleicht will uns Heins Vater aus dem Jenseits etwas ausrichten lassen?«, flüstert sie erschauernd. »Dass hier wieder was Schlimmes passieren wird? Vielleicht ist die Gans ein schlechtes Zeichen?«
»Wir sind hier nicht im alten Ägypten«, sagt David und legt ihr schützend einen Arm um die Schulter.
»Die Zeiten sind zum Glück vorbei«, erkläre ich und meine damit nicht das alte Ägypten. »Heute steht die Gans für Harmonie; sie symbolisiert friedliches Zusammenleben unter Freunden.«
Das habe ich zwar gerade erst erfunden, aber Zeichen entstehen bekanntlich durch ihre Deutung. Es kann nicht schaden, meinen Mitarbeiterfreunden ein friedliches Zusammenleben zu prophezeien.
»Ganz lieb sein«, säuselt Regine plötzlich. Sie hat sich in respektvollem Abstand vor die drei Stufen hingehockt und leise zu singen begonnen. »Schöne Nicolina, feine Nicolina, brave Nicolina.«
»Die spinnt, die Regine!«, bemerkt Hein anerkennend, als die Frau mit dem feurigen Haar immer weiter singend näher an die Gans heranrückt. Wir sind alle ganz still.
»Keine Gans bei niemand weg!«, ruft Jupp uns plötzlich laut zu.
»Psscht!«, fahren wir ihn an. Regine befindet sich jetzt auf gefährlicher Augenhöhe mit der Gans. Die hat das Schnattern eingestellt, sieht Regine aus ihren Knopfaugen geradezu treuherzig an und beginnt sich leicht im Takt zu wiegen.
»Schöne Nicolina, süße Nicolina, weiße Nicolina, treue Nicolina …«
Regine streckt die Arme langsam aus. In der Hocke nimmt sie erst die drei Stufen und dann sehr behutsam die Gans auf den Arm.
»… meine Nicolina!«, beendet sie ihr Lied und streichelt das weiße Tier. Es sieht jetzt so harmlos aus, dass wir uns alle in Grund und Boden schämen.
»Du hast ihr einen Namen gegeben«, bemerkt Hein vorwurfsvoll. »Jetzt können wir sie nicht mehr essen. Warum Nicolina?«
»Klingt nach Gans.«
»Vielleicht ist es ja ein Ganter?«
»Schau doch nach.«
Regine hält ihm die Gans hin.
Hein lehnt dankend ab.
»Was machen wir jetzt mit ihr?«, frage ich und deute auf die Straße. »Wir können sie nicht frei rumlaufen lassen, sonst wird sie von rasenden Belgiern plattgemacht.«
Jupp bietet sich an, in dem abgezäunten Teil hinter meinem Haus einen kleinen Unterstand für Nicolina zu bauen und eine Zinkwanne herbeizuschaffen.
»Gänse brauchen Wasser. Lass jetzt bloß immer den Deckel auf deinem Whirlpool.«
»Gänse sind wie Schwäne«, sagt Gudrun später in der Küche. »Sie bleiben einander bis zum Tode treu.«
»Und die einsam Hinterbliebene sucht sich ausgerechnet mein Restaurant aus, um ihr Klagelied anzustimmen.«
»Es ist schlimm, wenn der Partner stirbt.« Gudrun drückt bedeutungsvoll die Finger in den Teig für die Dattel-Roquefort-Pizza mit Speck. »Wahrscheinlich ist sie vor Kummer fortgeflogen. Sonst hätten wir ja zwei Gänse. Aber es ist schon ein großes Glück, überhaupt einen Mann gehabt zu haben, Regine.«
»Unsinn«, widerspricht die. »Ich zum Beispiel brauche keinen Mann.«
»Doch. Du willst es nur nicht zugeben. Es ist nicht gut, wenn der Mensch allein ist. Das gilt auch für dich, Regine. Du musst deinem Glück auf die Sprünge helfen. Manchmal kommt es nicht von allein.«
Sie nickt beseligt zum Küchenfenster hinüber, vor dem sich David immer noch vergeblich müht, meinem uralten Wagen auf die Sprünge zu helfen. Mit dem wage ich mich schon gar nicht mehr in die Werkstatt von Karl-Heinz, weil er mir inzwischen jedes Mal zu einem Allradmonster rät, das mich garantiert nicht im Stich lassen, sondern zuverlässig durch den kommenden Eifelwinter schleusen würde. Aber so ein Ding kommt mir nicht vors Haus.
»Der Richtige«, fährt Gudrun fort, »schneit eben nicht jedem so wie mir einfach ins Haus.«
Sie klatscht den Teig auf die Anrichte, greift zur Nudelrolle und walkt die Masse, was das Zeug hält.
Gefährliches Terrain, denke ich, schließlich muss Regine David einst auch für den Richtigen gehalten haben. Bis er sich vor sehr vielen Jahren aus dem Eifeler Staub wieder nach Texas aufgemacht hat, allerdings ohne zu wissen, dass Regine sein Kind erwartete, den inzwischen erwachsenen Daniel.
Als die feuerhaarige Regine vor mehr als zwei Jahren bei uns auf der Kehr auftauchte, war allerdings schon viel Wasser die Kyll hinuntergeflossen. Sie stellte David seinen Sohn vor und weiter keinerlei Ansprüche an den Mann, der damals mit Gudrun in einer Hinterkammer meines Restaurants lebte. Er übernahm Verantwortung für Daniel und schickte ihn nach den fürchterlichen Ereignissen rund um den einstigen Gnadenhof auf der Kehr zur Großmutter nach Texas. Dort hat der Junge auf dem College seinen Schulabschluss gemacht und widmet sich jetzt dem Studium der Tiermedizin, um aus seiner Leidenschaft irgendwann einen Beruf zu machen.
Jene dramatischen Ereignisse haben Regine, David, Gudrun, Hein, Jupp und mich damals zusammengeschweißt. Die Arbeit in meinem Restaurantverschaffte uns allen ein bescheidenes Auskommen, und alles war gut. So gut, dass sich Gudrun, David und Regine in dem frei gewordenen Hof von Davids Vorfahren, der übrigens auch einmal Gudruns Vater gehört hatte, zu einer Wohngemeinschaft zusammenschlossen.
Zwei Frauen und ein Mann. Der sich mit der einen ein Kind und mit der anderen das Bett teilt. Bei aller Freundschaft hielt ich das für eine bedenkliche Konstellation und mit meiner Meinung nicht hinter dem Berg.
»So kleinkariert sind wir nicht«, zwitscherte Gudrun unter dem Beifall der beiden anderen. Die zwei Frauen, die nie aus der Schneifel herausgekommen waren, und der Mann aus dem Herzen von Texas musterten mich wie das konservierte Relikt einer versunkenen Werterepublik und versicherten, keiner von ihnen hätte mit dieser Situation auch nur das geringste Problem. Also wurde, wie in solchen Fällen üblich, ein gewichtiges hervorgerufen: Für Regine musste ein Mann her, fand Gudrun, und zwar schnell.
Aus Gründen des Proporzes oder der Prophylaxe? Das frage ich mich, aber natürlich nicht sie. Gudrun würde niemals zugeben, sich ihres Texaners so lange nicht sicher zu sein, wie sich das Wörtchen Heirat seinem Deutsch verweigert. Da es Regine aber ablehnt, Trierer, Prümer oder Bitburger Discos sowie Floh-, Wochen- und Mittelaltermärkte abzugrasen, hat Gudrun eine eigene Frau-sucht-Bauern-Castingshow eröffnet. Seitdem scheucht sie alle willigen Junggesellen im näheren Umkreis in die Einkehr. Was den Umsatz kaum mehr steigert als Regines Lust. Keiner der Kandidaten – ganz gleich, wie groß Hof, Mann oder Begeisterung für das Projekt – hat ihr bislang ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern vermocht. Ihre Widerborstigkeit verschlägt jedem den Appetit, und so bleibt es bei einem hastig heruntergestürzten Bier und einer in ihrer Mission gescheiterten Gudrun.
»Wenn ein Mann Glückssache ist, bleibe ich doch lieber solo«, spricht mir jetzt Regine aus dem Herzen. Ich selbst bin zwar nur eingeschränkt solo, aber mit der Massenware, zu der die Sache Glück inzwischen am Bahnhofsbuchständer verkommen ist, hat meine Beziehung zu Marcel nichts zu tun.
»Keine Männer mehr, Gudrun!«, schnaubt Regine. »Den nächsten jage ich gleich vom Hof!« Drohend hebt sie das Messer, mit dem sie gerade Kalbsleber in Streifen schneidet. Ein blutiger Schnitz fällt ab, als sie zum Fenster blickt und überrascht ruft: »Nanu, wer ist das denn?«
Wir folgen ihrem Blick. Ein fremder grauhaariger Mann redet neben der offenen Motorhaube eindringlich auf David ein.
»Viel zu alt für dich«, antwortet Gudrun automatisch.
»Aber nicht für unseren Mittagstisch.« Regine wirft das Messer auf die Anrichte und rückt näher ans Fenster heran. »Schaut mal, er hat sogar eine ganze Reisegruppe mitgebracht! Ist wohl der Fahrer und will was mit David aushandeln.«
Zu meinem Entsetzen sehe ich David bedauernd die Schultern heben und den Kopf schütteln. Dann beugen sich beide Männer wieder über den Motorraum meines alten Autos. Ich reiße rasch das Fenster auf.
»Warte!«, rufe ich. »Das regele ich!«
David richtet sich auf und sieht mich rätselnd an. Seine seltsame Bemerkung: »Wir haben doch gar kein Diesel!« registriere ich kaum, dafür aber die herrliche Tatsache, dass einem kleinen mintgrünen Oldtimer-Reisebus, der vor der Einkehr haltgemacht hat, ganz langsam vergleichbar bejahrte Passagiere entsteigen. Umständlich, aber stetig.
Hühnersuppe.
Senioren lieben Hühnersuppe am Mittag. Von meiner werden sie begeistert sein, allerdings sollten Gudrun und Regine vor dem Servieren sicherheitshalber die hauchdünn geschnittenen Orangenscheiben herausfischen. Das Auge isst mit. Obstschalen im herzhaften Allheilmittelgericht kann man nur wenigen Menschen in einer gewissen Lebensphase mit dem Begriff Bio schmackhaft machen.
Auf diesen Tag hat die extra angeschaffte Kühltruhe im Nebenraum gewartet. Bis oben hin ist sie mit Würfeln tiefgefrorener Hühnersuppe vollgestopft. Die ich vor ziemlich langer Zeit in einem Anfall von Notwendigkeit und Trauerbewältigung gekocht habe. Die Schar mir persönlich bekannter namenloser Hühner habe ich nicht selbst umgebracht. Ich habe das Gemetzel ausgesourct, wie man neudeutsch sagt, meine Hühner aber nach ihrer Enthauptung voller Ehrfurcht gerupft, abgeflämmt, überbrüht, von Häuten befreit und ihnen auf würdevolle Weise das letzte Geleit gegeben. Mit Ingwer, Zitronengras, Karotten, Lauchringen, Zwiebeln, braunem Zucker, Koriander, Chili, einem Hauch Knoblauch, Sojasoße, Sherry, Kokosmilch, einer Prise Kreuzkümmel, Kurkuma sowie ebenjenen Orangenscheiben und einer großen Liebe, die gar nichts mit Glück, sondern mit dem zu tun hat, was geschehen kann, wenn man es mit ihm verwechselt. Aber das ist eine ganz andere Geschichte, die ich den Gästen bestimmt nicht erzählen werde, die jetzt auf die Einkehr zustreben. In ihren Gesichtern lese ich freudige Erwartung. Die ist möglicherweise auf den wundervollen neuen Internetauftritt zurückzuführen, den Hein für unser Restaurant gestaltet hat.
Dass heutzutage jedes vernünftige Unternehmen auf einer eigenen Homepage seine Unverwechselbarkeit propagieren sollte, habe ich eingesehen. Ein Bekenntnis zu Facebook, wie es mir Hein auch aufdrängen wollte, lehne ich allerdings kategorisch ab. Nicht mit mir.
»Wer sich in den Achtzigern gegen die Volkszählung aufgelehnt hat, verwirkt jedes Recht auf Glaubwürdigkeit, wenn er sich Facebook ausliefert«, habe ich ihm gesagt und nur Kopfschütteln geerntet.
»Wir sind inzwischen ein Jahrtausend weiter, Katja. Heute geht es um Präsenz. Das ist doch gut fürs Geschäft. Wir erfinden tolle Namen für deine schrägen Gerichte. Deine Followers werden in Scharen herströmen. Um auszuprobieren, ob man wirklich essen kann, was du da aufschreibst. Das glaubt dir doch keiner. Außerdem kannst du selbst bestimmen, was du von dir preisgibst.«
»Und ich muss mir gefallen lassen, was sogenannte Freunde und Followers von mir preisgeben. Nein danke.«
»Mensch, Katja, was hast du denn schon zu verbergen?«
Dieser blöde Satz. Den hat meine Mutter damals auch geäußert und mich gedrängt, bloß nicht dadurch aufzufallen, dass ich mich der Befragung durch den Staat verweigere. »Ich habe nichts zu verbergen«, hatte sie erklärt. Was übrigens eine eklatante Lüge war, wie ich bei meiner Ankunft in ihrer heimatlichen Eifel drastisch erfahren durfte. Es wäre sehr hilfreich gewesen, wenn sie früher weniger verborgen gehalten hätte. Nicht vor der Welt, sondern vor mir, ihrer Tochter. Selbst wenn es damals schon Facebook gegeben hätte und sie dort Mitglied gewesen wäre, hätte ich mit Bestimmtheit keinen Deut mehr über ihr Vorleben erfahren, nur alles über ihre Vorlieben, die ich ohnehin kannte. Bis auf die nicht ganz Unwesentliche für den verheirateten Mann in der Eifel, den ich nie kennengelernt habe, aber dessen Tochter ich bin und dessen Haus mir heute gehört. Dessen Existenz schon erloschen war, als ich von ihr erfahren hatte. Was ich nicht wusste, als ich in Vor-Facebook-Zeiten meinen Erzeuger in der Eifel aufsuchen wollte und über die Leiche eines Mannes gestolpert bin, der mein Halbbruder gewesen sein soll. Fürchterliche Erinnerungen prägen meine Ankunft in der Eifel. Wie hätte ich damals ahnen können, dass die Pflanze meiner Zukunft auf dem Dung der alten Zeit so wohl gedeihen würde! Auch wenn ich später unter Tränen Hühnersuppe brauen sollte. Die heute ihren Auftritt haben wird.
Ich trete vor die Tür und brauche kein künstliches Lächeln aufzusetzen. Ich bin in Hochstimmung. Ein Reisebus! Wenn sich erst mal rumgesprochen hat, wie phantasievoll wir hier fast im Verborgenen kochen, werde ich mich mit Parkplatzproblemen konfrontiert sehen! Wie viel würde es wohl kosten, den Vorhof meines Privathauses auf der belgischen Seite zu einem Parkgelände umzubauen?
»Guten Tag«, begrüße ich eine stämmige weißhaarige Dame, die erheblich flotter als die hinter ihr Gehenden bereits bei den Stufen angekommen ist und sehr ausgehungert aussieht.
»Ist das ein Gasthaus?«, fragt sie knapp und öffnet den obersten Knopf ihrer grünen Lodenjacke.
»Sie sind herzlich willkommen.« Ich breite die Arme zu einer einladenden Geste aus.
Ein Strahlen fliegt über ihr faltiges Puppengesicht.
»Gott sei Dank! Dann habt Ihr wenigstens eine Toilette.«
Bevor ich diese Bemerkung verdaut habe, ist sie schon an mir vorbei ins Haus gestürmt. Drei weitere Frauen sind ihr auf den Fersen, dahinter ein Mann mit gequältem Gesicht.
»Der Bus hat eine Panne«, sagt David.
»Panne?«
Meine Stimme klingt mir sehr schrill in den Ohren.
»Ja, entschuldigen Sie bitte«, meldet sich der Grauhaarige neben ihm und deutet auf die Schar der Strömenden. »Ich bin der Busfahrer, und meinem Setra ist leider der Diesel ausgegangen. Wir sitzen fest.«
»Hier?«
»Ja.«
Er nickt zum Bus hinüber, aus dem gerade sehr umständlich ein Rollator herausgehievt wird. »Genau vor Ihrer Tür, und jetzt wollte ich fragen …«
»Nur ein Damenklo!«, gellt eine klagende Stimme aus dem Haus. »Ich halte das nicht mehr aus!«
»Dann geh eben auf Männer«, dröhnt ein Bass, »da ist auch eine Kabine.«
»Und noch peinlichere Keramik, ogottogott … Herbert, das geht wirklich nicht, nein …«
Eine andere Stimme: »Schnell! Ich muss wirklich dringend.«
»Nun mach schon!«
Der Grauhaarige mit den witzigen Doppelgrübchen im Kinn schüttelt verzweifelt den Kopf. »Tut mir so leid, junge Frau! Dass ich Ihnen solche Umstände mache. Ausgerechnet auf meiner ersten Kaffeefahrt …«
»Kaffeefahrt!«, töne ich voller Verachtung. »Arme alte Leute stundenlang herumfahren, um ihnen bei einer Plörre namens Kaffee überteuerte Heizdecken und Migränebrillen anzudrehen! Wundermittel gegen Harndrang haben Sie wohl nicht im Angebot?«
Er hört, was ich höre; den Mann, der am Eingang zur Einkehr umstandslos fragt: »Wo ist Ihr Garten?«
Gudrun: »Wieso?«
Regine: »Danke, aber unser Gemüse düngen wir schon selbst! Warten Sie bitte, bis Sie an der Reihe sind. Setzen Sie sich erst mal. Möchten Sie was trinken?«
»Kein Busch, nirgendwo?«
»Hühnersuppe!«, trällert Gudrun. »Beruhigt die Nerven. Hilft beim Zusammenreißen!«
»Wo ist Ihr Animateur?«, belle ich den Busfahrer an. »Irgendjemand muss das hier doch koordinieren. Eine Kaffeefahrt …«
»Nein, nein.« Abwehrend hebt er die Hände. »Das ist was anderes. Wir sind eine anständige Kaffeefahrt. Wir wollen in Belgien Kaffee kaufen. Den Grenzmarkt besuchen, die Krippana und die Eisenbahnausstellung. Alles ganz ehrlich. Kein Aminatör mit Heizdecken oder so.«
»Diese Wasserrechnung wird mich ruinieren!«
»In Belgien ist Diesel billiger«, wirft David ein.
»Ich muss knapp kalkulieren«, vertraut mir der Fremde an, »und da dachte ich, dass ich es bis zur Tankstelle gerade noch schaffe …«
Aus dem Inneren meines Restaurants dringen Stöhnen und Eifeler Flüche, die ich inzwischen verstehen kann. Es drängt bei allen. Aber es gibt nur zwei Toiletten. Und eine ganze Kühltruhe voller herrlicher Hühnersuppe …
»Wir führen keinen Sprit. Jedenfalls keinen, der Ihren Bus antreiben könnte.«
»Ja, ja, deswegen habe ich gerade mit Ihrem Mechaniker gesprochen.« Er nickt unglücklich zu David hin, der diese unzutreffende Berufsbezeichnung unwidersprochen lässt. »Es sind ja nur noch ein paar Hundert Meter bis zur Zapfsäule. Ob ich mit Ihrem Wagen meinen Kanister …«
»Der Wagen geht nicht, und deshalb gehen Sie lieber«, verkünde ich so hochnäsig, wie es einer Frau eben möglich ist, die Essen an Leute bringen will, die sehr hörbar anderswo Verzehrtes bei ihr loswerden wollen.
»Geht doch«, murmelt David.
»Geht doch?«, wiederhole ich verwirrt.
»Geht doch!«, ruft uns Regine fröhlich zur Tür hinaus zu. »Alles unter Kontrolle. Die Herrschaften wünschen Hühnersuppe.«
»Der Mann versteht was von Lichtmaschinen«, sagt David. »Dein Wagen geht wieder, Katja. Dafür könnten wir Herrn …«
Er sieht den Grauhaarigen fragend an.
»Kerschenbach«, stellt der sich eilig vor und kratzt sich am Zwillingsgrübchen, »Kerschenbach, Hermann.«
»… Herrn Kerschmann doch entgegenkommen, oder?«
Tellerklappern und Besteckklirren übertönen jetzt das Schlagen der Toilettentüren. Das ist Musik in meinen Ohren.
»Geh schon«, sage ich zu David. »Fahr den Mann runter zur Tankstelle.«
Ich umarme ihn und flüstere ihm ins Ohr: »Lasst euch Zeit. Alte Leute essen langsam. Außerdem möchten sie bestimmt einen Nachtisch. Komm also bloß nicht in Lichtgeschwindigkeit zurück.«
Mit einer solchen stürzt Linus über die Straße. Jupp hinterher.
»Katja«, japst er. »Dein Takenschaaf, da haben wir was gefunden.«
Wie auf Kommando legt Linus einen Knochen vor mir ab.
Hermann Kerschenbach beugt sich vor.
»Da sind noch mehr«, ächzt Jupp. »Der Kaminbauer hat so was noch nie gesehen. Ich auch nicht. Marcel soll sofort herkommen. Ruf ihn an, Katja. Mach schon! Das ist ganz furchtbar!«
Ich verstehe überhaupt nichts. Linus buddelt dauernd Dinge aus und hat mir schon unendlich viele unansehnliche graue Knochen vorgesetzt. Er lässt zu, dass der Busfahrer den für mich bestimmten aufhebt.
»Ich könnte mich irren«, sagt Hermann Kerschenbach langsam, »aber …«
»Aber was?!«
Er reicht mir das Stück so vorsichtig, als bestünde es aus Porzellan. »Für mich sieht das nach einem Unterschenkelknochen aus.«
»Na und? Von was für einem Tier? Sitz, Linus!«
Der Busfahrer wechselt einen Blick mit Jupp.
»Kein Tier«, sagt Jupp heiser und ringt die riesigen Hände, ohne die weder mein Restaurant in Deutschland noch mein Privathaus in Belgien auskommen können.
»Den Schädel haben wir auch gefunden. Im Schutt von der Wand, Katja, da, wo du deinen Kamin hinhaben willst.«
»Was sagst du da?«
»Hier schwimmt eine Apfelsinenschale«, höre ich es aus dem Restaurant greinen und gleich darauf Regines beschwichtigende Stimme: »Die können Sie essen. Die hebt das Aroma.«
»Eierlikör«, meldet sich eine Frauenstimme. »Haben Sie denn keinen Eierlikör?«
Jupps Antwort hebt meine Stimmung nicht.
»Ein Skelett, Katja. In deiner Wand. Jemand ist da begraben worden.«
»Offenbar eingemauert«, sagt der Busfahrer finster.
Ich weiche zurück. Vor dem Knochen, vor dem Fremden, vor der ungeheuerlichen Behauptung, die da aufgestellt worden ist. Und vor dem Gedanken, jahrelang mit einer Leiche zusammengelebt zu haben.
Kapitel 2
Wildfond vom Knochen
mit Knollensellerie, Möhren, Zwiebeln, Knoblauch, Johannisbeergelee, Sternanis, Piment, Sojasoße, Zartbitterschokolade und Portwein bei schwacher Hitze köcheln lassen
Eine Woche später
»Du hast wirklich geglaubt, dass die Knochen beim Bau des Hauses aus Versehen mit eingemauert wurden?«, fragt mich Hein fassungslos. Wir alle haben uns an diesem frühen Morgen um den großen runden Tisch im Gastraum versammelt und löchern Marcel mit Fragen.
Vor genau einer Woche haben Jupp und der Kaminbauer die Überreste eines Menschen in der Wand meines Wohnzimmers gefunden. Die Knochen lagen zwischen dem Bauschutt in jenem ehemaligen Hohlraum, durch den einst die Herdwärme von der Küche, abgetrennt durch die eiserne Takenplatte, in die gute Stube geleitet wurde. Von der Existenz dieses sogenannten Takenschranks, oder, wie Jupp sagt, Takenschaafs in der Wand hatten wir keine Ahnung gehabt, als wir planten, unter dem alten Schornstein meinen neuen Kamin zu bauen. Auf den ich jetzt gar keine Lust mehr habe.
Wie sollte vor ihm jemals Gemütlichkeit aufkommen können? Es würde mich eher frösteln, in romantisch flackerndes Feuer auf genau jenes Loch zu blicken, in dem einst ein Mensch eingemauert worden war. Und zwar leider nicht vor mehr als hundert Jahren, wie ich gehofft, was aber der belgische Gerichtsmediziner nach nur einem Blick schon bezweifelt hatte. Aus den Überresten konnte er sogar schon herauslesen, dass dem armen Opfer zuvor der Schädel mit einem breiten, stumpfen Gegenstand eingeschlagen worden war. Möglicherweise mit einer kleinen gusseisernen Bratpfanne, sagte er, aber darauf wollte er sich noch nicht festlegen.
Letzte Woche hat der belgische Polizeiinspektor Marcel Langer also gleich nach seinem Eintreffen den Fundort abgesichert, das heißt, mein Wohnzimmer mit hässlichem Absperrband unzugänglich gemacht und die Staatsanwaltschaft, die FKP – die Föderale Kriminalpolizei Belgiens – sowie den Gerichtsmediziner aus Lüttich herbeigerufen.
Mich scheuchte er ins Restaurant zurück, wo unter den Kaffeefahrern große Aufregung herrschte. Die Sache mit den Knochen hatte sich auf mir unbegreifliche Weise schnell herumgesprochen. Allerdings dezimierte die Nachricht vom aktuellen Leichenfund und die verblüffend lang dauernde Abwesenheit des Busfahrers unseren Vorrat an Eifeler Bränden erfreulich schnell. Auch Regine und Gudrun hatten sich auf den Schreck bereits je ein Glas Williamsbirne genehmigt. Mindestens. Ich widerstand der Versuchung, mir zur Nervenberuhigung gleichfalls einen Klaren zu schütten, wie der Eifeler sagt. Irgendjemand würde bei der Abrechnung schließlich einen klaren Kopf behalten müssen.
»Das muss man erst mal verdauen«, hörte ich nicht nur an allen Tischen, sondern vor allem von den Fenstern, vor denen eine große Gästeschar den freien Blick über die Straße nach Belgien genoss. Außer sanft geschwungenen Hügeln mit Feldern, Wäldern, Windrädern und meinem ererbten Gebäude gab es da eigentlich nichts zu sehen, da noch nicht einmal Marcel mit dem Polizeijeep aus Sankt Vith eingetroffen war. Aber mein schäbiges Eifeler Bruchsteinhaus war quasi vor aller Augen zum gruseligen Beinhaus mutiert und somit in den Rang einer Sehenswürdigkeit aufgestiegen.
Zu meinem Entsetzen sah ich, wie an einem dieser Logenplätze der Knochen, den mir Linus vor die Füße gelegt hatte, von Hand zu Hand wanderte. Der Hund selbst hatte sich mit dem Verlust seiner Beute abgefunden und sie gegen den Knochen einer Kuh ausgetauscht. Die hatte erst vor wenigen Tagen ihr friedliches Grasen auf der Weide nebenan einstellen müssen, weil sie keine Milch mehr hergab. Einen ihrer Knochen hatte Regine aus der kalten Rinderbrühe gefischt – es wurde tatsächlich nur Hühnersuppe bestellt – und Linus damit beglückt. Angesichts des aktuellen Geschehens hatte ich den Gästen die nicht ganz geleerten Suppenteller nachgesehen und mir die alte Gastwirtregel ins Gedächtnis gerufen: Sie essen dich arm, und sie trinken dich reich.
Aber Nachsicht hat ihre Grenzen.
Ich schob mich durchs Lokal zu den Fenstern hin und wollte einem alten Herrn mit schütterem Haar und wachen blauen Augen den Knochen entreißen. Er hielt ihn so fest, dass die Knöchel seiner Hand weiß hervortraten.
»Das ist Beweismaterial!«
Er lächelte mich freundlich an.
»Natürlich«, sagte er. »Sehr interessant. Dies ist eindeutig ein menschlicher Unterschenkelknochen. Kann ich als Medizinstudent sofort erkennen. Ja, da staunen Sie, was? Ich mache demnächst mein Erstes Staatsexamen. Man muss im Alter nicht nur Karten spielen, Kreuzworträtsel oder Sudokus lösen und mit dem Bus herumfahren, das werden Sie irgendwann auch noch erfahren. Bitte, darf ich Ihnen eine sehr persönliche Frage stellen?«
»Geben Sie mir jetzt den Knochen!«
»Da habe ich meine Frage aber höflicher gestellt«, sagte er vorwurfsvoll, starrte auf die Finger meiner rechten Hand, die den Knochen umklammerten, und stellte mit freudiger Stimme fest: »Wie schön, Sie sind nicht verheiratet!«
Der Knochen fiel zu Boden. Von der Bemerkung erschreckt, war mir entgangen, dass auch der Mann das Beweisstück losgelassen hatte. Der bejahrte Medizinstudent bückte sich erstaunlich schnell, hob ihn auf und reichte ihn mir mit einer tiefen Verbeugung. »Konrad Meissner. Ich stehe Ihnen jederzeit zu Diensten, schöne Frau. Wollen Sie sich nicht ein wenig zu mir setzen, damit wir einander besser kennenlernen können? Vielleicht stellt sich ja heraus, dass wir Gemeinsamkeiten haben.«
Ich biss mir auf die Unterlippe, um ihr Zucken nicht sichtbar werden zu lassen. Mit Anfang fünfzig muss man sich wohl gefallen lassen, von Greisen angemacht zu werden, dachte ich. Vielleicht müsste ich sogar dankbar sein, dass mich überhaupt noch einer als Sexualobjekt wahrnimmt – zu einer Zeit, in der uralte Schriftsteller die moderne Literatur mit Geschichten über die mir unverständliche Leidenschaft blutjunger geiler Frauen zu Großvaterfiguren bereichern.
Mit hoch erhobenem Knochen stürmte ich zu Jupp zurück.
»Wie kommt der Knochen ins Restaurant?«, fuhr ich den vierschrötigen Mann an, der unglücklich an die Wand gelehnt stand und dessen zitternde Hände ausnahmsweise mal zu nichts zu gebrauchen waren. »Der ist doch Beweismaterial, den müssen wir der Polizei aushändigen!«
»Liegen doch noch genug Knochen drüben rum«, murmelte er, griff dann aber doch nach dem grauen Beweisstück und schob von dannen.
Ich atmete tief durch, sah und hörte mich um. Schlecht gelaunt und unter mächtigem Druck hatte diese Reisegruppe mein Lokal gestürmt; jetzt, nachdem sie sich erleichtert und den Knochen der Endlichkeit herumgereicht hatte, erfüllte sie die Einkehr mit Leben.
Gudrun verteilte emsig Dessertkarten, und Regine wollte ihr hingehaltene Gläser gerade wahlweise mit einer neuen Ladung Schlehenlikör oder Eifelbrand füllen. Da nahm ihr die stämmige alte Dame mit dem faltigen Puppengesicht sanft die Flaschen ab und stellte sie hinter sich auf den Tisch.
»Es reicht«, sagte sie laut.
Gehorsam wurden die Gläser zurückgezogen. Offenbar akzeptierten alle, dass diese Frau in Ermanglung eines Animateurs und des Busfahrers die Leitung übernahm. Sie forderte die Herrschaften höflich auf, sich ab jetzt zurückzuhalten, da man ja noch ein Programm in Belgien zu absolvieren habe. Und dieses möglichst nüchtern.
Dass Gaststätten dem Alkoholismus Vorschub leisten, ist nicht meine Erfindung. Aber unter anderem bestreite ich davon meinen Lebensunterhalt, so wie die Ärzte in Suchtkliniken den ihren ja auch. Deshalb schritt ich ein.
»Es kann noch eine Weile dauern, bis Herr Kerschenbach mit dem Diesel zurück ist«, erklärte ich laut, hob aufmunternd die Flaschen und setzte hinzu: »Uns geht der Sprit eben nicht so schnell aus. Der Kaffee übrigens auch nicht, falls jemand noch eine Tasse bestellen will. Herr Kerschenbach wird vor der Weiterfahrt bestimmt auch einen haben wollen.«
»Er trinkt grundsätzlich nur Tee.«
Ich sah die Dame fragend an.
»Ich bin Frau Kerschenbach.«
»Ach, Ihr seid seine Mutter!«, erklärte Regine überrascht.
Der schmale Mund wurde noch ein bisschen schmaler, entließ aber Worte in einem überaus herzlichen Ton: »Nein, nein, ich bin seine Schwester.«
»Entschuldigung«, stotterte Regine.
»Ich weiß, mein Kind«, Frau Kerschenbach tätschelte ihr die Wange, »Hermann war ein Nachzügler. Es ist an mir, mich zu entschuldigen. Weil ich es nicht lassen kann, mich für meinen kleinen Bruder verantwortlich zu fühlen. In diesem Fall für sein neues Reiseunternehmen.« Sie hob die Stimme: »Bitte keinen Alkohol mehr. Es geht gleich weiter.«
Dann wandte sie sich wieder mir zu.
»Eure Hühnersuppe ist ausgezeichnet, Frau …«
»Klein«, nannte ich meinen Namen, der mir selten zuvor so passend erschienen war. Schon gar nicht in meinem eigenen Herrschaftsbereich.
»Frau Klein. Nicht das, was man sonst darunter versteht, aber sie hat eine aparte schmackhafte Würze. Aus frischen Zutaten bereitet, ohne künstliche Aromen und Zusatzstoffe, nicht wahr?«
»Selbstverständlich!«, versicherte ich eilig.
»Sehr bekömmlich. Darauf muss man in unserem Alter achten. Wir sollten bei unserer nächsten Tour hier wieder haltmachen. Können Sie uns vielleicht ein Arrangement anbieten?«
Ich hätte das faltige Puppengesicht küssen können. Und vergaß zumindest einen schönen Augenblick lang, welche Entdeckung diesem Angebot vorausgegangen war.
Ende der Leseprobe