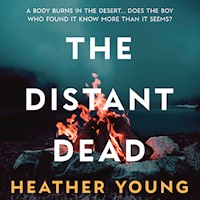6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Minnesota 1935: Die Familie Evans verbringt ihren Sommerurlaub mit ihren drei kleinen Töchtern Emily, Lucy und Lilith in einem Haus am See. Was paradiesisch beginnt, endet in einer Katastrophe: Die sechsjährige Emily verschwindet eines Tages spurlos. 64 Jahre später: Ihr ganzes Leben hat Lucy das Geheimnis um Emily mit sich herumgetragen. Doch als sie stirbt, hinterlässt sie ihrer Großnichte Justine ein Notizbuch mit Hinweisen, was damals geschah. Justines älteste Tochter Melanie ist von der Geschichte geradezu besessen. Um jeden Preis will sie die ganze Wahrheit erfahren. Aber manchmal ist es besser, die Toten ruhen zu lassen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 548
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Buch
Minnesota 1935: Die Familie Evans verbringt den Sommerurlaub mit ihren drei kleinen Töchtern Emily, Lucy und Lilith in einem Haus am See. Was paradiesisch beginnt, endet in einer Katastrophe: Eines Tages verschwindet die sechsjährige Emily spurlos. Emilys Mutter hofft bis zu ihrem Tod darauf, dass ihre jüngste Tochter wiederkommt, und die ganze Familie wohnt von nun an im Ferienhaus. Doch die beiden Schwestern wissen, dass Lucy nicht wiederkommen kann.
Vierundsechzig Jahre später: Lilith und ihre Eltern sind verstorben, nur Lucy lebt immer noch im Haus am See. Ihr ganzes Leben hat sie das Geheimnis, was mit Emily an diesem schrecklichen Tag passierte, mit sich herumgetragen. Nun, da sie merkt, dass sie nicht mehr lange zu leben hat, schreibt sie die Geschichte in ein Notizbuch. Dieses vererbt sie zusammen mit dem Haus am See ihrer Großnichte Justine. Zusammen mit ihrer Tochter Melanie rollt Justine die Geschichte von damals wieder auf. Doch die beiden stellen bald fest, dass sie die Toten besser ruhen gelassen hätten …
Autorin
Heather Young hat Creative Writing studiert. Sie lebt mit ihrem Mann und ihren Kindern in der San Francisco Bay Area. »Das verlorene Mädchen« ist ihr erster Roman.
Mehr zu Heather Young unter: www.heatheryoungwriter.com
HEATHER YOUNG
Das verlorene Mädchen
Roman
Aus dem Amerikanischen
von Marie-Luise Bezzenberger
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2016 unter dem Titel
»The Lost Girls« bei William Morrow, an imprint of
HarperCollins Publishers, New York.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
1. Auflage
Deutsche Erstveröffentlichung September 2017
Copyright © der Originalausgabe 2016 by Heather Young
Published by Arrangement with Heather Young
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2017 by
Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Dieses Werk wurde vermittelt durch die
Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München
Umschlagmotiv: FinePic®, München
Redaktion: Friederike Arnold
KS · Herstellung: ik
ISBN: 978-3-641-19137-5V001
www.goldmann-verlag.de
Besuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz
Für meinen Vater – meine Inspiration.
Und meine Mutter – meine Heldin.
Wie aber, Unglückselige, steht es so, vermag
ich aufzuheben oder mehr zu gründen dies?
Sophokles, Antigone
1
Lucy
Gestern habe ich dieses Buch im Sekretär gefunden. Ich wusste gar nicht, dass ich noch welche von diesen Büchern habe, die ich immer bei Framers gekauft habe, mit dem schwarz-weiß marmorierten Einband und den leeren linierten Seiten, die darauf warteten, gefüllt zu werden. Als ich es aufschlug, knisterte der Bindeleim, und ich musste mich setzen.
Auch wenn die Ränder der Seiten vergilbt und gewellt waren, leuchteten sie mir in der Stille des Wohnzimmers entgegen. Vor langer Zeit habe ich diese Bücher mit Geschichten gefüllt, mit simplen Erzählungen, die den Kindern Freude machten, dieses hier jedoch verlangte nach etwas anderem. Es war, als hätte es unter Stapeln alter Weihnachtskarten und verblichenem Briefpapier auf der Lauer gelegen, bis jetzt, da mein Leben gemeinsam mit dem Jahrtausend zur Neige geht und meine Gedanken sich mehr und mehr der Vergangenheit zuwenden.
Es ist vierundsechzig Jahre her. Das kommt mir gar nicht so lange vor, so seltsam Dir das auch erscheinen mag, aber Mutter ist tot und Vater und Lilith auch; ich bin die Letzte. Wenn ich tot bin, wird es den Anschein haben, als hätte es diesen Sommer nie gegeben. Darüber denke ich nach, wenn ich in meinem Sessel auf der Veranda sitze, wenn ich meinen Abendspaziergang zur Brücke mache oder wach liege und auf das Geräusch des Wassers im Dunkeln lausche. Ich schlafe jetzt sogar in Liliths und meinem früheren Zimmer, in dem schmalen Bett, das damals meins war. Gestern Nacht habe ich das Mondlicht an der Decke betrachtet und an die vielen Nächte gedacht, in denen ich hier gelegen habe: als Kind, als junges Mädchen und jetzt als alte Frau. Ich habe darüber nachgedacht, wie leicht es wäre, das alles von der Erde verschwinden zu lassen.
Als es Morgen wurde, machte ich mir Buttertoast und legte ihn auf den geblümten Teller, aber ich aß ihn nicht. Stattdessen saß ich am Küchentisch, und das Buch lag aufgeschlagen vor mir. Ich hörte dem Wind zu und spürte, wie das Haus atmete. Mit dem Finger zeichnete ich die Kratzer und Kerben in dem Tisch aus Ulmenholz nach, den mein Urgroßvater in dem Jahrhundert vor meiner Geburt für seine junge Ehefrau gezimmert hatte. Er war das Herzstück der Hütte, die er auf ihrer beider Stück Land errichtete, und des Hauses, das sein Sohn später in der Stadt baute. Ihr Enkel jedoch fand ihn primitiv und eher in sein Sommerhaus passend. Die Narben des Tisches sind nur noch schwer auszumachen, die Jahre haben sie zu dunklen Wellenlinien in dem hellen Holz geglättet.
Wie gesagt, ich bin die Letzte. Seit Liliths Tod vor drei Jahren gehört die Geschichte von jenem Sommer mir allein, es ist an mir, sie zu bewahren oder sie zu erzählen. Das ist eine Macht, die ich erst ein einziges Mal besessen habe, und ich bin mir jetzt weit weniger sicher als damals, was ich damit anfangen soll. Ich hüte Geheimnisse, die mir nicht gehören, Geheimnisse, die die Namen der wehrlosen Toten beschmutzen würden. Die Namen von Menschen, die ich einst geliebt habe. Besser nicht daran rühren, sage ich mir.
Dieses Buch jedoch erinnert mich daran, dass es doch nicht so einfach ist. Ich schulde anderen noch etwas. Ich habe noch andere Versprechen gegeben. Und nicht alle wehrlosen Toten, geliebt oder ungeliebt, sind tugendsam. Trotzdem, ich zweifele nicht daran, dass ich stumm geblieben wäre, auf meinen Tod gewartet hätte, auf dass er diese Angelegenheit entscheide, hätte ich das Buch nicht gefunden. Seine leeren Seiten bieten mir einen Kompromiss an, den ich, die nur selten die Kraft hatte, unwiderrufliche Entscheidungen zu treffen, anzunehmen gedenke.
Also werde ich die Geschichte meiner Familie niederschreiben, in diesem Buch, das so trefflich auf den richtigen Zeitpunkt gewartet hat. Ich werde sie so gut wie möglich wiedergeben, auch wenn mir manches Kummer bereitet. Wenn ich fertig bin, werde ich es Dir hinterlassen, Justine, zusammen mit allem anderen. Du wirst Dich fragen, wieso ich Dich ausgewählt habe und nicht Deine Mutter, und meine Antwort lautet, dass Du die Einzige bist, für die die Vergangenheit vielleicht von Bedeutung sein könnte. Wenn dem so ist, wirst Du herkommen, wenn ich tot bin, und Arthur wird Dir dies hier geben, und ich werde darauf vertrauen, dass Du damit so verfährst, wie Du es für richtig hältst. Doch vielleicht kommst Du nicht – was durchaus sein kann, denn ich habe Dich ja nur so kurz gekannt, und Du warst damals auch noch ein Kind. Du wirst Dich damit zufriedengeben, die Anwälte und die Makler ihre Arbeit tun zu lassen, Dein Leben weiterzuleben, und dieses Haus und den See nicht wiedersehen. In diesem Fall werde ich Arthur anweisen, das Buch ungelesen zu verbrennen. Denn ich glaube, dann ist es das Richtige, diesen Sommer hinter sich zu lassen, und Emily mit ihm. Wie all die anderen Geisterschatten verlorener Dinge.
Es war der Sommer 1935. Ich war elf, Lilith dreizehn und Emily sechs. Damals wohnte unsere Familie in der Stadt, in dem braunen Haus, das mein Großvater gebaut hatte; die Sommer aber verbrachten wir hier, in unserem gelben Haus am See. Am Tag nach dem Ende des Schuljahres packte Mutter unsere Koffer, unsere Sommerkleider, Badeanzüge und Sonnenhüte, und Vater fuhr uns jene dreißig Kilometer, die die uns bekannte Welt umfasste. Lilith, Emily und ich saßen hinten in dem Plymouth, ich wie immer in der Mitte. Ich presste den Fuß gegen den von Lilith, sie erwiderte den Druck.
Du hast Lilith nur so kurz kennengelernt, in jenem einen Sommer vor zwanzig Jahren, als Du und Deine Mutter zu Besuch kamt, und ich nehme an, für Dich waren wir einfach nur zwei alte Frauen, die ihren Lebensabend auf einer rundum von Fliegengittern geschützten Veranda verbrachten. Ich wollte, Du hättest sie richtig gekannt, weil nämlich jede Geschichte, an der Lilith beteiligt war, zu ihrer Geschichte wurde, und mit der meinen ist es nicht anders. Meine früheste Erinnerung ist, wie sie mich meine Füße in ihre Spuren im Sand setzen hieß, und ich musste Schlangen- und Schnörkellinien vollführen, bis ich hinfiel. Das war nur ein Spiel, aber so verbrachten wir unsere Kindheit: Ich folgte ihr überallhin und tat alles, was sie tat, wenn auch nie so schnell und nie so gut wie sie.
Und dann, im Frühling 1935, veränderte sich irgendetwas. Noch immer gingen wir überall zusammen hin, aber sie wollte nicht mehr zum Seward’s Pond gehen oder in das Baumhaus hinaufsteigen, das Vater in unserem Garten gebaut hatte, und sie wollte auch nicht mehr Hüpfekästchen spielen oder auf der Schaukel schaukeln. Stattdessen verbrachte sie viel Zeit damit, in den Spiegel zu schauen und ihre dunklen Locken zu bürsten, die ihr bis zur Taille reichten. Sie hatte ein merkwürdiges Gesicht, mit einer zu langen Nase und einem zu breiten Mund, die sich mit ihren zarten Wangenknochen verbündeten, um etwas Unbeschreibliches, Faszinierendes zu schaffen. Sie studierte ihr Gesicht, als sei es eine Maschine, die sie zu verstehen versuchte.
Größer war sie auch geworden, und obgleich sie noch immer die Kleider vom letzten Jahr trug, mit herausgelassenen Säumen, veränderte sich ihr Körper. Im April zog sie mich in das Badezimmer, das wir beide uns teilten, um mir die kleinen Knospen auf ihrer Brust zu zeigen. Im Mai kaufte Mutter ihr einen Büstenhalter. Zuerst brauchte sie meine Hilfe, um ihn hinter dem Rücken zuzuhaken; die winzigen Krallen rutschten in die zarten Ösen. Wenn sie dann die Schultern straffte und das Kinn reckte, sah sie wie die jungen Frauen in dem Katalog von Sears & Roebuck, wie ein anderer Mensch, aus.
Natürlich besteht zwischen elf und dreizehn ein großer Unterschied. Damals jedoch sah ich nur, dass ich auf einem Weg zurückblieb, den ich nicht verstand und den ich gar nicht einschlagen wollte. Und als der Frühling sich in den Sommer verwandelte, beschloss ich, dass ich in den drei Monaten, die meine Familie am See zubrachte, alles Menschenmögliche unternehmen würde, um Lilith zurückzugewinnen. Wenn wir im Wald unsere Spiele spielten, auf der Brücke saßen, die über den Bach verlief, und nachts in unseren Betten lagen und flüsterten, würde sie bestimmt diesen seltsamen Anflug von Erwachsensein ablegen. Als sie ihren Fuß im Auto gegen meinen drückte, machte ich mir immer größere Hoffnungen, je schmaler die Straße wurde.
Wir kamen am Nachmittag an, um die Zeit, wenn sich das Sonnenlicht von Weiß zu Gold wandelt und das Wasser von tiefstem Blau ist. Das winterfest gemachte Haus war kalt und dunkel. Doch als wir die Vorhänge öffneten und die Fenster hochschoben, atmete es die warme Brise ein und schüttelte die Düsternis der langen kalten Jahreszeit ab. Das Haus kam mir immer vor wie ein lebendiges Wesen, und ich spürte, wie seine Stimmung sich hob, als es sich mit unseren Stimmen und dem Trappeln unserer Schuhe auf seinen Kieferndielen füllte.
Lilith und ich trugen unseren großen Koffer in unser luftiges grünes Zimmer. Wir liebten das alljährliche Ritual, unsere Sommerkleider in den Schrank und unsere Hüte auf den Haken darüber zu hängen. In der Stadt schliefen wir in getrennten Zimmern, daher war das Auspacken für uns hier mehr, als einfach nur Schränke und Schubladen einzuräumen; es glich einem zeremoniellen Zurückfordern eines gemeinsamen Territoriums. Als wir an jenem Tag auspackten, war Lilith ganz wie früher. Sie erzählte, dass sie zum Hundertbaum wolle, als wir Laken über die Betten breiteten und die Steppdecken ausschüttelten, die den Winter über im Wäscheschrank im Flur gelegen hatten. Derweil brachte Mutter Emily in ihr kleines Zimmer auf der anderen Seite des Flurs, und Vater lud die restlichen Koffer und Kisten aus, die jedes Jahr zahlreicher zu werden schienen. Draußen, überall auf der ungepflasterten Straße entlang des Sees, begrüßten sich unsere Nachbarn, die ihre Häuser ebenfalls der Sonne öffneten.
Es gibt hier sieben Häuser, alle zwischen 1905 und 1910 gebaut. Das war die Zeit, als unsere selbst ernannten Minnesota-Aristokraten es den Vanderbilts und Rockefellers New Yorks nachmachten und sich Sommerhäuser bauten, während einfache Bürger in der Stadt schwitzten. Die Familie Jones, der der Krämerladen gehörte, waren die Ersten. Dann kamen die Pughs, in zweiter Generation die Ärzte der Stadt. Die Familie Davies, deren Großvater Bezirksrichter war. Die Familie Lewis, deren Vater unser Zahnarzt war, und die Williams-Familie, die unsere Testamente verfasste und der Stadt ihren Namen gegeben hatte. Mein Vater leitete Evans Pharmacy, die Apotheke, die sein Großvater gegründet hatte. Das größte Haus gehörte Robert Lloyd, dem auch fast alles andere gehörte und der Bürgermeister der Stadt war wie sein Vater und sein Großvater vor ihm. Wir alle stammten von einer kleinen Schar Männer ab, die den Kohlebergwerken von Wales entflohen war, um vor ungefähr achtzig Jahren Williamsburg zu gründen, und wir hielten unseren Wohlstand und unsere gehobene gesellschaftliche Stellung für unser Geburtsrecht.
Heute sind diese Häuser verfallen, aber gewiss kannst Du erkennen, wie schön sie einst waren. Im Sommer 1935 begann ihr Niedergang gerade erst: Die Farbe verblasste und wurde nicht erneuert, das eine oder andere zerrissene Fliegenfenster wurde nicht ersetzt. Als Kind war ich mir über das Ausmaß der schweren Zeiten nicht im Klaren, obgleich ich Mutters kleine Sparmaßnahmen bemerkte und mich darüber ärgerte – die ausgelassenen Säume, die neu besohlten Schuhe. Schon im nächsten Jahr würden die Familien Jones und Davies gar nicht mehr an den See kommen. Ihre Häuser würden verrammelt sein, bis sie an Familien aus Minnesota verkauft wurden, die eine Woche hier verbrachten und sie den Rest der Saison über vermieteten. Im Laufe weniger Jahre taten die anderen Familien vom See es ihnen gleich, bis nur noch Lilith, Mutter und ich übrig waren.
Wenn ich nun zurückschaue, dann bekommt dieser erste Tag des letzten gemeinsamen Sommers meiner Familie etwas Melancholisches. Damals jedoch fand ich diesen Tag wunderbar, so wie ich jeden ersten Tag des Sommers immer wunderbar gefunden habe. Es war eines der wenigen Male, an denen ich das Gefühl hatte, dass wir uns durch nichts von anderen Familien unterschieden, nicht nur nach außen hin. Vater war weniger streng als sonst und richtete sich beim Auspacken und Einziehen nach Mutter, während in Mutters Stimme etwas Beschwingtes lag, das ich sonst nie vernahm. Emily, für gewöhnlich immer so ernst, hüpfte herum wie eine typische Sechsjährige – etwas, das ich so oft vergaß. Und am meisten freute mich, dass Lilith plapperte und lachte, als wäre sie wieder zwölf. Eine fröhliche Familie in den Ferien, und ich lächelte, bis meine Wangen schmerzten.
An jenem ersten Abend überredeten die Familien vom See wie jedes Jahr die Millers – eine Chippewa-Halbblut-Familie, der die Lodge gehörte –, für uns zu kochen. Während wir unsere Betten bezogen und unsere Kleider in mit frischem Papier ausgelegten Schubladen verstauten, brieten die Millers Hühner, kochten Mais und backten Brot. Zweifellos schufteten sie tagelang, um uns alle zu verköstigen, über sechzig Personen, doch die Zeiten waren auch für sie schwer; bestimmt waren sie froh über das Geld, das wir ihnen zahlten.
Abe und Matthew, die Söhne der Millers, trugen Tische und Stühle zu den drei Picknicktischen auf dem sandigen Rasen zwischen der Straße und dem schmalen Strand. Die Frauen fanden sich zu kleinen Grüppchen zusammen. Vom Auspacken hatten sie gerötete Wangen und strichen sich ihr Haar zurecht, während die Männer mit dem Eis in ihren Cocktailgläsern klapperten und Mutmaßungen darüber anstellten, wie viele Barsche wohl dieses Jahr gefangen werden würden. Sie trugen Strickjacken und leichte Jacketts; im Juni waren die Abende kühl, obwohl die Sonne hoch über den Hügeln hing, die sich am Westufer des Sees drängten. Als es Zeit zum Essen war, sprach mein Vater – er erinnerte noch am ehesten an einen Pfarrer – das Tischgebet mit einer Feierlichkeit, die nur von kurzer Dauer war. Dann begann das Festmahl; die Kinder futterten so schnell, wie ihre Mütter es erlaubten, damit sie wieder auf dem Steg und zwischen den Bäumen herumrennen konnten. Sogar Lilith und ich, die sich normalerweise abseitshielten, machten stets beim Fangenspielen und Blechbüchsenkicken mit, die den Beginn des Sommers einläuteten.
Dieses Jahr jedoch saß Lilith mit im Schoß gefalteten Händen am Picknicktisch, während die anderen Kinder die Mannschaften wählten. Ich saß neben ihr und bohrte mit der Fußspitze im Gras, während vor Beklommenheit das Essen in meinem Bauch rumorte. Ich brachte es nicht über mich, ohne sie mitzumachen – sie war die Verbindung zwischen mir und den anderen, ihre gebieterische Selbstsicherheit ebnete mir und meiner immer wieder auftretenden Verlegenheit den Weg.
»Willst du denn nicht mitspielen?«, fragte ich sie.
»Wir sind keine Kinder mehr, Lucy«, antwortete sie.
Ich wollte erwidern, dass doch alle großen Jungen mitspielten, sogar Stuart Davies, der gerade die Highschool abgeschlossen hatte, doch mir war klar, dass sie von den älteren Mädchen sprach, die ganz in der Nähe saßen und miteinander flüsterten, während sie zusahen, wie die Jungen auf der sandigen Straße herumrannten. Also sagte ich nichts und gab mir Mühe, daran zu denken, dass wir morgen zum Hundertbaum gehen würden. Das hatte sie mir versprochen.
Von einem der Picknicktische hinter uns hörte ich Bürgermeister Lloyds Stimme herüberdröhnen. »Wenn Sie weiter alles herschenken, Hugh, dann steht bald mein Name über Ihrer Tür.« Rasch warf ich einen Blick über die Schulter. Bürgermeister Lloyd lächelte Mr Jones an, und Mr Jones’ verzagtes kleines Gesicht war ganz rot. Vater hatte uns erzählt, er treibe die Schulden der Familien nicht ein, die Mühe hatten, etwas zu essen auf den Tisch zu bringen. Mr Jones war ein wahrer Christ, meinte Vater. Bürgermeister Lloyd nahm noch ein Brötchen aus dem Brotkorb.
Mutter und Vater saßen mit den Familien Williams und Lewis an einem anderen Tisch. Vater und Mr Williams waren zusammen aufgewachsen, die Söhne bester Freunde, und Mutter und Mrs Williams hatten sich im Laufe der Zeit angefreundet. Wie gewöhnlich dominierte Mrs Williams die Unterhaltung. Sie sprach sehr schnell und lachte viel, während Mutter nickte und Vater die Ellenbogen auf den Tisch stützte. Ruhig blickte er sie aus seinen dunklen Augen an. Wie wir hatte er als Kind die Sommer an diesem See verbracht, und die Anspannung, die stets in ihm zu brodeln schien, ließ nach, wenn er hier war.
Emily saß zwischen Mutter und Vater; ihre Füße reichten nicht ganz bis aufs Gras hinunter. Auch sie spielte nur selten mit den anderen Kindern. Sie war ein ernstes Kind und hatte keine Lust auf die Spiele, die Kinder in diesem Alter spielen. Und selbst wenn, sie war Mutters Hätschelkind, und Mutter behielt sie immer bei sich in der Nähe. Tatsächlich glaube ich, sie hat in den ersten sechs Jahren mit niemandem Freundschaft geschlossen. Deswegen waren wohl auch Mutter, Lilith und ich bald die Einzigen, die sie nicht als unnahbar im Gedächtnis behielten. Abgesehen von Abe Miller natürlich, obgleich der niemals mit uns über sie sprach.
Als die Kinder begannen, Büchsen herumzukicken, verließ Emily ihren Platz bei Mutter und Vater und setzte sich neben Lilith auf die Bank. Sie vergötterte Lilith, obgleich diese ihr so gut wie keine Beachtung schenkte, und wenn, dann war sie stets unfreundlich zu ihr. Jetzt saß Emily da und hoffte, dass Lilith sie bemerken würde. Lilith und ich weigerten uns, sie auch nur eines Blickes zu würdigen.
Die Büchse rollte nahe an uns heran, und Charlie Lloyd mit dem breiten Gesicht kam hinterhergesaust. Er war fünfzehn und hatte das gewichtige gute Aussehen seines Vaters, jedoch nichts von dessen lockerem Politikerauftreten. Im vorigen Sommer hatte er Lilith einen Liebesbrief geschickt, den wir im Küchenspülbecken verbrannt und dabei voll Befriedigung zugesehen hatten, wie die wehleidigen Phrasen zu Asche zerfielen. Jetzt warf er Lilith über die Schulter hinweg einen scheuen Blick zu und stürzte sich von Neuem in das Spiel. Ich rechnete damit, Verachtung in ihrer Miene zu entdecken, zu meiner Verblüffung jedoch lächelte sie ihn an, dabei zog sie einen Mundwinkel nach oben. Charlie lief feuerrot an und stolperte über seine eigenen Füße.
Jeannette Lewis, eines der Mädchen, das in unserer Nähe saß, bemerkte es und sagte etwas zu Charlies Zwillingsschwester Betty. Die lächelte Lilith mit ihrem rosigen runden Gesicht mit neuer, berechnender Wertschätzung an, was mir nicht gefiel. Lilith schaute unverwandt geradeaus; das Lächeln lag noch immer auf ihrem Gesicht, und ihre langen seidigen Locken schimmerten. Alle halbwüchsigen Mädchen trugen ihr Haar kurz, als Bob, der sich über den Kragen ihrer Kleider wölbte. Ich wusste, dass Lilith sich ihres unbedingt abschneiden lassen wollte und dass Vater ihr das niemals erlauben würde, aber ich fand lange Haare viel hübscher als die gekappten Frisuren der anderen. Und in meinen Augen sah sie in diesem Moment älter aus als die anderen Mädchen, mit ihrem merkwürdigen Lächeln und ihren ausgeprägten Zügen. Mit meinem störrischen sandfarbenen Haar und den schmutzigen Füßen kam ich mir vor wie Emily: eine unerwünschte kleine Schwester, ein lästiges Anhängsel.
Ich beugte mich an Lilith vorbei zu Emily. Hoffnungsvoll schaute sie mich an. »Geh weg«, herrschte ich sie so giftig an, wie es mir nur möglich war. Sie wurde blass, rutschte von der Bank und rannte zu Mutter und Vater zurück. Ich verspürte jene glatte, kalte Befriedigung, die ich immer empfand, wenn ich sie kränkte, und schielte zu Lilith hinüber, hoffte auf ein beifälliges Lächeln. Doch sie sah immer noch Charlie an. Hinter uns nahm Vater Emily auf den Schoß. Über ihren dunklen Lockenkopf hinweg beobachtete auch er Charlie.
Wahrscheinlich kommen wir Dir, so wie ich uns an jenem ersten Sommertag beschreibe, gar nicht ungewöhnlich vor. Eine heranwachsende große Schwester und eine jüngere Schwester, die ins Hintertreffen geriet. Und eine kleine Schwester, die dazugehören wollte. Ein Vater, der zusah, wie ein Junge mit seiner Tochter flirtete. Nichts, was einem nicht in unzähligen anderen Familien begegnen würde. Doch wenn ich Dir davon erzählen soll, was mit uns geschehen ist, muss ich am Anfang beginnen. Denn in diesen Begebenheiten, so normal sie auch scheinen mögen, liegen die Anfänge von allem, was danach passierte.
2
Justine
Sie dachte nicht daran, ihn zu verlassen. Wieso sollte sie? Er war doch alles, was sie wollte, alles, was Francis, der Vater ihrer Töchter, nie gewesen war. Er war treu. Zuverlässig. Kam jeden Abend um halb sechs nach Hause. Und sie fühlte sich bei ihm sicher. Vor allem nach dem Einbruch. Sie konnte von Glück sagen, einen Mann wie ihn zu haben, wenn dort draußen Menschen mit Dietrichen unterwegs waren, die Verbrechen planten. Zumindest redete sie sich das ein, als sie in der Nacht, nachdem es passiert war, neben ihm wach lag.
Die Polizei meinte, die Einbrecher hätten den Wohnblock bestimmt ausgespäht, denn ihr Timing war perfekt. Justine hatte Melanie und Angela wie gewöhnlich auf dem Heimweg aus dem Grundschulhort abgeholt. Dann, fünf Minuten nachdem sie die Wohnung betreten hatten, verkündete Angela, dass sie alles Mögliche für ein Schulprojekt bräuchte – Pappe und bunte Pfeifenreiniger. Patrick war noch nicht zu Hause, also hatte Justine ihm einen Zettel hingelegt, auf dem stand, dass sie um sechs zurück sein und Abendessen mitbringen würde. Sie fuhren zum Drogeriemarkt und zum In-N-Out und kamen um Punkt sechs Uhr zurück.
Als sie durch die Tür kamen, blieb Justine stehen und schob die Mädchen instinktiv zurück. Die Wohnung war vollkommen verwüstet. Das Sofa war nach hinten gekippt, und die Polster waren heruntergefallen. Beide Lampen lagen auf dem Boden. Der Couchtisch war umgekippt, und Zeitschriften lagen überall herum. In der Küche standen die Türen der Schränke offen, ihr Inhalt war auf dem Küchentresen verstreut, Töpfe und Pfannen bedeckten den Linoleumboden.
Patricks schwarze Umhängetasche lag im Flur vor Justines Füßen, doch er war weder in der Küche noch im Wohnzimmer. »Patrick?«, rief sie halb im Flüsterton. Keine Antwort. Sie bekam Panik. »Lauft!«, zischte sie den Mädchen zu. »Geht zu Mrs Mendenhall! Sagt ihr, sie soll die Polizei rufen.«
Melanie und Angela flohen hinaus auf den Flur und die Treppe hinunter. Behutsam stellte Justine die Einkaufstüten auf den Teppich. Jeden Muskel angespannt trat sie ins Wohnzimmer. Wieder rief sie nach Patrick. Wieder kam keine Antwort. Den Rücken an die Wand gepresst schlich sie den Flur hinunter zum Schlafzimmer. Mit angehaltenem Atem spähte sie hinein. Die Decke war vom Bett gerissen und Kleider und Wäsche aus den Schubladen gezerrt worden, doch es war niemand hier. Im Kinderzimmer auf der anderen Seite des Flurs war es genauso. Es war niemand in der Wohnung.
Nunmehr in heller Panik rannte Justine zurück ins Wohnzimmer. Wo war er? War er zu Hause gewesen, als die Einbrecher gekommen waren? Bestimmt, sonst wäre er doch jetzt hier. Sie presste die Hände gegen den Kopf. Irgendetwas hatten sie mit ihm gemacht. Sie hatten ihn entführt. Oder er hatte sie verfolgt, und sie hatten ihm etwas angetan. Sie hörte das ferne Heulen einer Polizeisirene. Die Polizei würde ihn finden. Sie würde unten auf dem Parkplatz auf sie warten.
Sie wandte sich zur Tür und fuhr zusammen, einen Schrei in der Kehle. Patrick stand im Türrahmen und sah sie an.
»Patrick! Oh mein Gott!« Justine taumelte vor Erleichterung. Er war unversehrt, er hatte keinerlei Verletzungen, ihm war nichts passiert. Sie stürzte auf ihn zu, stolperte über die Sofapolster, trat gegen eine der Lampen, fiel gegen seine Brust. Patrick umschlang sie, und sie atmete den Geruch seines Schweißes und den scharfen Dunst von Tinte und Toner ein, während sie in sein weißes Office-Pro-Hemd schluchzte. Er hielt sie fest, als wollte er sie nie wieder loslassen.
»Ist ja gut«, sagte er leise in ihr Haar.
»Ich hab solche Angst gehabt.«
»Ich auch.« Seine Stimme klang gepresst. »Ich bin nach Hause gekommen, und du warst weg.«
Sie hob den Kopf und bemerkte sein angespanntes, blasses Gesicht. Wie immer war er um halb sechs nach Hause gekommen, hatte die Wohnung verwüstet vorgefunden, und sie war nicht da gewesen. Da ihr Zettel unter all der Unordnung begraben worden war, hatte er nicht gewusst, dass sie und die Mädchen sich in Sicherheit befanden und gerade im Drogeriemarkt Pfeifenreiniger kauften. Dieser Einkauf hatte ihnen vielleicht das Leben gerettet, doch er musste einen Schock erlitten haben, als er in die zerstörte, leere Wohnung gekommen war. Er hatte gedacht, sein schlimmster Albtraum wäre wahr geworden.
»Patrick, es tut mir so leid.« Sie umarmte ihn abermals, diesmal sehr zärtlich. Er sackte gegen sie. Lange standen sie so da, seinen schweren Körper gegen sie gelehnt. Als ihr Rücken zu schmerzen begann, schob sie ihn sachte weg und küsste ihn. Seine Wangen waren so weich wie die eines Babys.
Nachdem die Polizei gekommen war, sich alles aufgeschrieben und nach Fingerabdrücken gesucht hatte, machten Justine und Patrick Ordnung und listeten auf, was alles verschwunden war: der Fernseher, der Videorekorder, Justines wenige Halsketten und Ohrringe. Während Justine die Mädchen von Mrs Mendenhall abholte und ihnen die kalten Burger von In-N-Out vorsetzte, fuhr Patrick zu einem Baumarkt, der rund um die Uhr aufhatte, und kaufte ein neues Türschloss, das er selbst einbaute. Es dauerte lange, bis die Mädchen einschliefen, doch dann liebten Patrick und Justine sich in den zerwühlten Laken ihres Bettes wie zwei Überlebende.
Danach lag Justine da, Patricks Arm ruhte schwer auf ihrer Taille, starrte auf die roten Ziffern des Digitalweckers und sah zu, wie lautlos die Zeit verstrich. Sie fühlte sich sicher bei ihm. Aber irgendetwas an dem Einbruch machte ihr zu schaffen. Einerseits war es das schiere Ausmaß der Verwüstung. Wieso sollte ein Einbrecher das Sofa umschmeißen und die Laken vom Bett reißen? Doch es war nicht nur das. Endlich, als der Himmel sich aufhellte und es dämmerte, kam sie darauf: Auch wenn jemand äußerst brutal vorgegangen war, schien sich dahinter eine Ordnung zu verbergen. Die Lampenschirme waren noch auf den Lampen gewesen, obwohl sie auf dem Boden gelegen hatten. Die Töpfe und Pfannen hatten aufgestapelt auf dem Linoleumboden gestanden, als wären sie eher dort hingestellt als -geschmissen worden. Es fehlte das eine oder andere, kaputt jedoch war nichts.
Außerdem hatte sie den Zettel nicht auf den Küchentresen gelegt, sondern auf den Küchentisch, der eigentlich gar nicht in der Küche stand, sondern praktisch im Wohnzimmer, wo Patrick ihn vielleicht nicht gleich gefunden hatte. Justine zog die Beine an und schlang die Arme um die Knie. Patrick wollte immer wissen, wo sie war, er bestand sogar darauf. Das war eins der Dinge, die ihr nach Francis’ schmerzhaftem Desinteresse der letzten vier Jahre an ihm am besten gefallen hatten. Sie starrte auf das graue Licht, das durch die Lücke zwischen den beigefarbenen Vorhängen sickerte. Wo war Patrick gewesen, als sie zurückgekommen war? Als sie seinen Namen gerufen und ihre Stimme vor Furcht gezittert hatte? Wie lange hatte er in der Tür gestanden und sie beobachtet?
Draußen begannen Vögel zu zwitschern. Patricks Körper, an ihren geschmiegt, war warm und fest und verlässlich wie immer. Was dachte sie eigentlich? Dass er den Einbruch vorgetäuscht hatte, nur damit sie fühlte, was er empfunden hatte, als er nach Hause gekommen war und sie nicht angetroffen hatte? Um zu sehen, ob sie genauso empfand? Das wäre nämlich verrückt. Hier ging es um Patrick. Der zuverlässige, gründliche Patrick, der keinerlei Unordnung ertragen konnte und ihr gegenüber nie laut wurde, geschweige denn handgreiflich. Sie dachte genau wie ihre Mutter, für die jeder Mann ein Traumprinz war – bis er sich dann als Lügner, Perverser oder Spinner entpuppte und sie aus der Stadt wegziehen musste. Sie war nicht ihre Mutter. Sie hatte einen guten Mann gefunden. Sie spürte seinen Atem auf ihrer Schulter und zwang ihren Argwohn, den Mund zu halten.
Doch am nächsten Tag verließ sie ihn.
Der Tag begann wie jeder andere, seit er vor zehn Monaten hier eingezogen war. Justine stand als Erste auf, obwohl sie kaum geschlafen hatte, und saß eine halbe Stunde am Küchentisch. Die Arme hatte sie um die Knie geschlungen, und sie hielt die Augen geschlossen. Das hatte sie als junges Mädchen jeden Morgen getan. Sie hatte allein dagesessen, während ihre Mutter schlief, und Stille getankt, um sich für den bevorstehenden Tag zu wappnen. Wenn sie lauschen würde, könnte sie die leisen Stimmen des Paares nebenan hören, doch das tat sie nicht. Sie lauschte nur auf die Stille ihrer eigenen Wohnung im blassen Morgenlicht.
Als Patricks Wecker ertönte, weckte sie ihre Töchter und machte Frühstück. Um Punkt acht Uhr erschien Patrick, zauste Angela das Haar und sagte Melanie Guten Morgen. Justine stellte sich auf die Zehenspitzen, um ihm einen Kuss zu geben, und er roch nicht nach Schweiß und Toner, sondern nach Irischer Frühling und Walmart-Waschpulver, jenem frisch-bitteren Geruch, den sie mit ihm assoziierte. Bei Tageslicht, in der ordentlichen Küche, die jetzt keinerlei Spuren des Einbruchs aufwies, kam ihr ihr nächtlicher Verdacht sogar noch lächerlicher vor.
Er aß einmal gewendete Spiegeleier, wie üblich, und wie üblich meinte er, sie wären fantastisch. Sie hatte gelernt, sie so zu machen, wie er sie gern mochte. Seine Spiegeleier mussten genau richtig gebraten sein, weil er doch bei Office Pro Büromaschinen verkaufte, meistens Drucker und andere Kleingeräte. Wenn er sich bewährte, könnte er Kopierer verkaufen, und da war das große Geld zu machen, weil man dann nämlich auch noch das Papier und den Toner und die Tinte mit verkaufen konnte. Doch sein Boss erlaubte ihm das nicht, solange seine Quartalszahlen nicht besser wurden, und um das hinzukriegen, brauchte er Spiegeleier, die nicht zu hart und nicht zu weich waren. Nach dem Essen umarmte und drückte er sie und schmiss beim Hinausgehen seinen Schlüssel in die Luft. Genau wie an jedem anderen Tag.
Auf dem Weg zur Arbeit setzte sie ihre Töchter vor der Grundschule ab. Melanie trottete auf die blaue Schultür zu, und sie fragte sich, ob sie heute Nachmittag wohl wieder einen Anruf von der Schulleiterin bekommen würde. Ihre Älteste war mürrischer als sonst gewesen, sogar ungehorsam, und letzte Woche hatte es ein Gerangel auf dem Schulhof gegeben, wobei der Rucksack einer anderen Fünftklässlerin im Dreck gelandet war. Die Schulleiterin hatte gesagt, wenn das nicht aufhöre, müsse sie mit Melanie zur sozialpädagogischen Beratung, vielleicht bekomme sie sogar Sonderunterricht. Stirnrunzelnd sah Justine zu, wie Melanie mit hochgezogenen Schultern die Stufen hinaufstieg. Dann fuhr sie zu Dr. Fishbaums Praxis, wo sie Rezeptionistin war. Kurz vor der Mittagspause klingelte plötzlich ihr Handy, und alles wurde anders.
Sie nahm an, dass es einer von Patricks Kontrollanrufen war. Deswegen hatte er ihr ja das Handy geschenkt, 1999 ein teurer Luxus. Stattdessen jedoch vernahm sie die trällernde Stimme ihrer Mutter aus Arizona oder aus New Mexico oder wo immer sie gerade war und mit ihrem neuesten Freund durch warme Regionen reiste. Justine hatte sie seit drei Jahren nicht gesehen, aber Maurie rief alle paar Monate an, und natürlich schickte sie Postkarten – mit Bildern von Städten am Meer, Städten in den Bergen und Städten in der Wüste und kritzelte hinten einen Einzeiler drauf: »Mesa ist wunderbar!«, »Austin muss man einfach lieben!« Justine schmiss sie immer sofort weg. Jetzt rieb sie sich die linke Augenbraue, wo die Kopfschmerzen bei einem Anruf ihrer Mutter stets erwachten.
Zuerst plauderte Maurie wie immer über Phil-den-Lover, den Wohnmobilpark und dass sie gerade Golfspielen lerne, und Justines Aufmerksamkeit schweifte zu einem Stapel Patientenakten auf ihrem Schreibtisch. Eigentlich durfte sie sie nicht lesen, doch ihr gefielen die kleinen, ganz gewöhnlichen Geschichten, die die Akten erzählten, und sie schlug die oberste auf. Edna Burbank, 94. Arthritis, Bursitis, ein Rezept für Xanax.
Und dann sagte Maurie: »Erinnerst du dich noch an meine Tante Lucy? Oben am See?«
Justine klappte Ednas Akte zu und beugte sich auf ihrem Stuhl vor. Seit Jahren hatte sie nicht mehr an Lucy gedacht, beim Klang ihres Namens jedoch kam mit einem Mal ein ganzer Schwall Erinnerungen hoch. Als sie neun gewesen war, war Maurie mit ihr zu einem See im Norden Minnesotas gefahren, wo es grüne Bäume und klares Wasser gegeben hatte. Die blauen Nächte waren von Grillenzirpen erfüllt gewesen. Sie hatten in einem gelben Haus mit einer Fliegengitterveranda gewohnt, zusammen mit drei Frauen: Tante Lucy, Grandma Lilith und Liliths und Lucys Mutter, Justines Urgroßmutter. »Ja. Ja, ich erinnere mich an sie.«
»Na ja, sie ist gestorben. Gott sei Dank habe ich diesmal einen Nachsendeantrag gestellt.« Eis klirrte in Mauries Glas. »Sie hätte nie allein in dem Haus wohnen bleiben sollen. Nachdem Mutter gestorben war, hab ich ihr gesagt, sie soll in das Seniorenheim drüben in Bemidji ziehen, aber sie wollte nicht. Gott allein weiß, wie sie die Winter da überstanden hat.«
Justine hatte diesen See heiß und innig geliebt. Nicht nur weil er schön war, sondern auch weil Maurie dort ganz anders lachte. Anstelle des spröden kurzen Lachens, das Justine in den Imbisslokalen und den billigen Cafés gehört hatte, konnte man bei Mauries See-Lachen bis in ihren Rachen schauen. Sie war ihr so anders vorgekommen, so entspannt. Sie war nicht wie sonst immer aufs nächste große Abenteuer aus gewesen. Eine Zeit lang hatte Justine sogar gedacht, sie würden vielleicht bleiben, dass sie vielleicht länger hier wohnen würden als nur ein paar Monate. Doch im September hatten sie ihre Sachen in den rostigen Fairmont gestopft und waren davongefahren. Nach Iowa City oder vielleicht nach Omaha. Sie wusste es nicht mehr. Eine neue Wohnung, ein neuer Job, ein neuer Freund, eine neue Schule.
Trotzdem hatte Justine das ganze nächste Jahr gehofft, sie würden wieder hinfahren. Womöglich würde es ja zu einer Tradition werden, dass sie jeden Sommer am See verbrachten. Andere Leute hatten auch solche Traditionen. Doch sie sprach das Thema nie an, und als der Sommer kam und ging, ohne dass der See erwähnt wurde, war Justine nicht überrascht. Schließlich kehrte Maurie niemals irgendwohin zurück. Wenn sie eine Stadt verließen, durfte Justine nicht einmal zurückschauen. »Schüttle den Staub ab«, sagte sie immer. »Schüttle den Staub dieser Stadt von deinen Füßen.« Dann ging sie vom Gas und schüttelte beide Füße, und Justine tat es ihr nach, obwohl sie niemals weggehen wollte, ganz gleich, wo sie gewohnt hatten.
Sie fragte sich, was Maurie wohl getan hatte, als ihre Mutter gestorben war. War sie damals wieder hingefahren? Hätte sie ihre Regel gebrochen, um zu sehen, wo ihre Mutter begraben war? »Wann ist Grandma Lilith eigentlich gestorben? Das hast du mir nie erzählt.«
Maurie ignorierte ihre Frage. »Der Brief war von irgend so einem Anwalt. Offenbar hatte Lucy irgendwelchen Schmuck von Mutter, den sie mir hinterlassen wollte. Und deine Telefonnummer wollte er auch haben.«
»Warum denn das?«
»Tja. Anscheinend hat sie dir das Haus vermacht.«
»Sie hat was?« Justine umklammerte das Handy, damit sie es nicht fallen ließ.
»Nicht, dass es viel wert wäre, da oben mitten im Nirgendwo.« Wieder klirrte das Eis. »Sie hat immer gewollt, dass ich zurückkomme. Deine Mutter vermisst dich, hat sie gesagt. Aber, mein Gott, es war grauenvoll, da aufzuwachsen. Dort hat doch niemand gewohnt, nur die Sommergäste, die haben sich einen Scheiß für ein Mädchen von da oben interessiert. Ich bin abgehauen, sobald ich meinen Führerschein hatte.«
Justine war nie auf den Gedanken gekommen, dass ihre Mutter in dem Haus am See aufgewachsen war. Maurie sprach nur selten über ihre Kindheit, und als Erwachsene war sie so ganz und gar ein Geschöpf der Straße, dass Justine sich immer vorgestellt hatte, wie sie irgendwo in einem Wohnwagen brüllend das Licht der Welt erblickt hatte, eine Zigeunerin der Moderne. »Minnesota« war alles, was sie antwortete, wenn jemand fragte, wo sie her sei; irgendwie hörte sich dann ein ganzer Bundesstaat immer an wie eine Bushaltestelle. Justine dachte daran, wie sie auf der Hollywoodschaukel auf der Veranda des Hauses am See gelegen hatte, während das dunstige goldene Sonnenlicht durch die Fliegenfenster auf die Kieferndielen fiel. Das Haar trug sie zu einem losen Pferdeschwanz gebunden, ihr Gesicht war jung, und sie lachte mit weit offenem Mund.
Und nun hatte Lucy ihr das Haus vermacht.
»Mom, ich muss Schuss machen«, sagte Justine. »Hast du die Nummer von dem Anwalt?« Sie schrieb sie sich auf und schob gerade das Handy wieder in ihre Handtasche, als Phoebe die Bürotür öffnete. »Angela ist krank«, sagte sie zu ihr, ohne ihr in die Augen zu sehen. Sie hatte noch nie darum gebeten, früher gehen zu können.
Phoebe seufzte. Sie mochte Justine nicht besonders, doch sie hatte selbst ein Kind, das ohne Vater aufwuchs, und antwortete, sie werde den Empfang besetzen. Justine ging hinaus, ohne sich noch einmal umzuschauen.
In der Wohnung tigerte sie auf und ab, das Telefon in der einen Hand und die Telefonnummer des Anwalts in der anderen. Schließlich setzte sie sich an den Küchentisch, zog die Knie hoch und schloss die Augen. Nur konnte sie diesmal die Stille nicht hören. Stattdessen vernahm sie das leise Summen des Kühlschranks und das Ticken der Uhr an der Wand.
Das Apartment war schäbig. Die Wände waren zerschrammt, der Teppich verfilzt, und die Schiebetür wurde mit Klebeband zugehalten. Trotzdem, es war die einzige Wohnung, in der sie je gelebt hatte. Damals war Francis neunzehn und sie achtzehn und schwanger gewesen. Justine hatte ihrer Mutter, die es dieses Mal mit Portland versuchen wollte, eröffnet, dass sie in San Diego bleiben würde. Sie und Francis hatten die Wohnung genommen, weil sie die einzige war, die sie sich leisten konnten und die am nächsten zum Meer lag. Acht Blocks, so nahe also auch wieder nicht, doch wenn sie nachts mit Melanie auf dem Arm auf dem Balkon stand, konnte Justine das Flüstern auf der anderen Seite ihres Wohnviertels hören, das aus niedrigen Gebäuden bestand. An dem Abend, an dem sie hier eingezogen waren, hatten sie in dem leeren Wohnzimmer aus Pappbechern Champagner getrunken. Der abgetretene Teppichflor fühlte sich weich an Justines Schultern an, als sie sich liebten, und sie hatte sich geschworen, dass sie niemals von hier weggehen würde. Dass ihr Kind an ein und demselben Ort wohlbehalten aufwachsen würde.
Sie öffnete die Augen. Patricks halb leere Kaffeetasse stand auf dem Tisch.
Justine wählte die Nummer des Anwalts. Um herauszufinden, was eigentlich los war, ob ihre Mutter das alles richtig verstanden hatte.
Der Anwalt hieß Arthur Williams. Er sagte, er und vor ihm sein Onkel hätten sich seit Jahrzehnten um die juristischen Angelegenheiten der Evans-Schwestern gekümmert. Lucy sei vor drei Wochen ganz plötzlich im Schlaf gestorben, und ihr Nachbar habe sie am nächsten Tag gefunden. Seine Stimme war leise, die Konsonanten, die sich mit den lang gezogenen Vokalen abwechselten, klangen hart.
Justine drückte den Hörer ans Ohr. »Meine Mutter hat gesagt, Sie wollten über Lucys Testament sprechen?«
»Ja. Sie sind Alleinerbin.« Das bedeutete, erklärte er, dass Lucy Justine alles vermacht hatte, was sie besaß, abgesehen von dem Schmuck, den sie Maurie hinterlassen hatte. Das Haus war alt und musste auf den neuesten Stand gebracht werden, doch es war mit keinerlei Hypotheken belastet. Lucy hatte ein Girokonto und auch ein Aktienportfolio, er würde ihr die Details zufaxen.
»Wie viel ist denn auf dem Konto?«, erkundigte sich Justine und wünschte sich im selben Augenblick, sie könnte die Frage zurücknehmen. So etwas würde ihre Mutter fragen.
Der Anwalt antwortete, als sei das eine vollkommen akzeptable Frage. Auf dem Girokonto befanden sich ungefähr 2700 Dollar, und die Aktien waren etwa 150.000 Dollar wert. »Vielleicht sollten Sie herkommen und alles persönlich regeln«, sagte er, »vielleicht wollen Sie bestimmte Sachen behalten. Oder Sie können sich auch in ihrem Heimatort mit einem Anwalt in Verbindung setzen, und wir regeln das mit dem Erbschein per Fax. Dann kann ich Ihnen einen Makler empfehlen, der das Haus für Sie verkauft.«
Er hielt inne. Justine war klar, dass sie etwas sagen sollte, doch ihr Kopf fühlte sich an, als würde er senkrecht emporsteigen und davonschweben, wenn sie ihn nicht festhielt. Irgendwo in Minnesota lagen 150.000 Dollar in einem Aktienportfolio. Sie und Patrick hatten 1328 Dollar auf ihrem Konto. Das Haus am See hatte die Farbe von goldgelber Butter gehabt.
»Kann ich Sie zurückrufen?«, fragte sie. »Selbstverständlich«, erwiderte er.
Als sie aufgelegt hatte, trug sie Patricks Tasse zum Spülbecken. Sie wusch sie aus, trocknete sie ab und stellte sie in den Schrank. Dann holte sie die ausgeblichene blaue Reisetasche aus dem Schrank im Keller, die sie aus der Zeit aufbewahrt hatte, als sie noch die Tochter ihrer Mutter gewesen war. Sie packte ihre Jeans hinein und die drei Sweatshirts, die sie besaß. Zwei Paar Schuhe, keine Sandalen. BHs, Slips, Socken, Schlafanzug. Zahnbürste, Shampoo, Haarbürste. Sie zog den Reißverschluss der Tasche zu und stellte sie neben die Haustür.
Unter dem Spülbecken holte sie einen Stapel Supermarkt-Papiertüten hervor. Darin verstaute sie die Fotoalben mit den Bildern von damals, als die Mädchen noch Babys gewesen waren, und die Schnappschüsse jüngeren Datums, die mit Magneten an die Kühlschranktür geheftet waren. Aus dem Kühlschrank holte sie Brot, Erdnussbutter und Marmelade. Aus der Speisekammer Cracker, Chips und Frühstücksflocken. Um halb drei rief Patrick sie auf ihrem Handy an. Justine stand regungslos in der Küche, während er triumphierend von seinem Tag berichtete: Zwei Faxgeräte und einen Drucker hatte er noch vor der Mittagspause verkauft. Als er fragte, was es zum Abendessen gebe, sagte sie, Spaghetti von gestern. Er bat sie, auf dem Nachhauseweg das Knoblauchbrot zu besorgen, das er so gern aß. Sie versprach es.
Nachdem sie aufgelegt hatten, rief sie den Anwalt an. »Wir kommen«, verkündete sie. Er klang erfreut, beschrieb ihr den Weg und sagte, Lucys Nachbar Matthew Miller hätte einen Hausschlüssel.
Ihre Töchter besaßen keine Koffer, also zog Justine ihre Kopfkissen ab und steckte in die Kissenbezüge ihre wärmsten Kleidungsstücke und Schuhe. Dann nahm sie noch mehr Papiertüten für ihre Schmuckkästchen mit winzigen Ballerinas darin, Stofftiere, Plastikpferdchen, Puppen mit wirren Haaren, Spangen und Haarbänder, Malpapier und Filzstifte. Sie stellte die Tüten zu den anderen neben die Haustür. Eigentlich sah es gar nicht nach so viel aus, aber die Ladefläche ihres Wagens war voll.
Nachdem sie das Auto vollgepackt hatte, war es halb fünf. Um fünf musste sie ihre Töchter aus dem Hort abholen. Um halb sechs würde Patrick zu Hause sein.
Justine legte ihren Wohnungsschlüssel auf den Küchentresen und das Handy daneben. Dann nahm sie einen gelben Klebezettel. Der Uhrzeiger kroch eine Minute weiter, während sie überlegte, was sie schreiben sollte. Auf Francis’ Zettel hatte gestanden, dass es ihm leidtäte. Sie wusste nicht, ob es ihr leidtat. Sie wusste nicht, was sie fühlte, abgesehen von einer diffusen Beklommenheit. Im schwindenden Licht dieses Novembernachmittags sahen die Wohnzimmermöbel, die sie und Francis auf Ratenzahlung gekauft hatten, dunkel und fremd aus, als hätten sie niemals ihr gehört. Ein Schauer rann über ihre Schulterblätter. Sie hatte vergessen, wie leicht es war, sich aus einem Leben davonzuschleichen.
Lieber Patrick, schrieb sie, die Spaghetti stehen im Kühlschrank. Sie legte den Zettel auf den Tresen, strich ihn glatt und ging hinaus.
Als sie leichtfüßig die Stufen hinabging, hörte sie leise ihr Handy klingeln.
Später würde sie sich nicht mehr daran erinnern, dass sie zur Schule gefahren war. Doch sie wusste noch, dass sich ihr Gesicht angefühlt hatte wie getrockneter Zuckerguss, als sie mit ihren Töchtern zu dem Picknicktisch auf dem Schulhof gegangen war und ihnen gesagt hatte, dass sie ein Haus an einem See geerbt hätten, mit einer Veranda und einer Hollywoodschaukel. Und das Haus sei in Minnesota, aber das sei okay, denn sie würden unterwegs alles Mögliche sehen, die Rocky Mountains zum Beispiel und Las Vegas, und das Ganze sei ein Abenteuer.
Die Mädchen blieben stumm, bis sie zu Ende gesprochen hatte. Dann wurden Melanies Augen schmal. »Moment mal. Ziehen wir etwa da hin?«
Melanie war kein hübsches Kind. Mit elf hatte sie ihren Babyspeck längst verloren; strenge, ausgeprägte Züge waren zum Vorschein gekommen und eine zu lange Nase, die weit aus ihrem Gesicht ragte und ihr etwas Hochmütiges verlieh. Argwöhnisch runzelte sie die Stirn. Sie sah verschlagen aus wie ein Fuchs.
Justine zwang sich, ruhig zu klingen. »Ein Haus, Schätzchen. Wir werden ein großes, tolles Haus haben, nur für uns drei, mit einem See direkt davor. Umsonst.«
»Für uns drei? Und was ist mit Patrick?«
»Ich dachte, es wäre vielleicht gut, mal eine Weile allein zu sein, nur wir Mädels.«
Die Furchen auf Melanies Stirn wurden tiefer. Angela sah völlig entgeistert aus. Die dünnen Arme der Mädchen in den kurzärmeligen Blusen waren braun gebrannt von der Sonne San Diegos. Die anderen Eltern, die ihre Kinder abholten, brachten sie nach Hause, um zu Abend zu essen, dann Hausaufgaben am Küchentisch, vielleicht noch ein bisschen fernsehen vorm Schlafengehen. »Ich habe all unsere Sachen im Auto.«
»Wir fahren jetzt gleich?« Melanies Stimme wurde eine halbe Oktave höher.
»Ich weiß, das kommt sehr plötzlich. Aber es ist besser so. Ein klarer Schnitt.«
»Und was ist mit Daddy?«, wollte Angela wissen.
Justine öffnete den Mund und machte ihn wieder zu. Francis war seit einem Jahr weg, und seitdem hatten sie nichts von ihm gehört. Seit Monaten hatte keins der beiden Mädchen mehr nach ihm gefragt. Nachdem Patrick eingezogen war, war das Foto von Francis und den Mädchen am Coronado Beach aus dem Kinderzimmer verschwunden. Justine hatte gedacht, das bedeute, dass sie ihn wie Staub von ihren Füßen geschüttelt hatten, so wie Maurie es sie immer geheißen hatte, so wie sie es versuchte. Doch das Stocken in Angelas Stimme sprach Bände.
»Daddy kommt nicht zurück, du Idiotin«, sagte Melanie. Mit ausdruckslosen Augen sah sie Justine an. Justine unterdrückte ihren aufwallenden Zorn. Sie fühlte sich oft von dem mürrischen Wesen und der brüsken Art ihrer Ältesten abgestoßen, weswegen sie sich schämte und Schuld empfand. Außerdem wusste sie doch, dass sie diesmal nicht auf Melanie sauer sein sollte. Am Schluss war Francis kaum noch nach Hause gekommen, aber das hatte die Liebe seiner Töchter nicht geschmälert. Im Gegenteil.
Justine legte Angela die Hand auf den Arm. »Ich sage Mrs Mendenhall, wo wir hinfahren, und wenn Daddy uns suchen kommt, kann sie’s ihm sagen.« Das war gelogen. Sie würde Mrs Mendenhall überhaupt nichts sagen. Mrs Mendenhall mochte Patrick.
Angelas Augen füllten sich mit Tränen. »Und was ist mit Lizzie und Emma?« Das waren ihre beiden besten Freundinnen, die drei waren die beliebtesten Mädchen in der zweiten Klasse.
Justines Zunge schmeckte nach Metall. Sie erinnerte sich daran, wie sie aus der Schule gekommen war und ihre Mutter am Küchentisch vorgefunden hatte, mit ihrer Zigarette und ihrer Bierdose. »Setz dich«, hatte Maurie dann immer gesagt, und Justine hatte gewusst, dass sie wegziehen würden.
»Wir können ihnen Postkarten schicken, wenn wir ankommen, Schätzchen«, sagte sie, genau wie ihre Mutter es getan hatte.
Angela drehte sich um und schaute zur Schule. Durch die offene Tür des Horts konnte Justine Kinder malen und mit Legosteinen spielen sehen. Angelas Gesicht zog sich schmerzlich zusammen, und Justines Beklommenheit schlug in helle Panik um. Es war halb sechs. Jetzt in diesem Augenblick betrat Patrick die leere Wohnung. Würde er zur Schule fahren? Wahrscheinlich. Ein vertrautes, klaustrophobisches Gefühl des Versagens mischte sich in ihre Panik, und die Welt fühlte sich klein und eng an. Was dachte sie sich denn eigentlich? Sie hätte bis morgen warten sollen. Dann hätten ihr die Mädchen beim Packen geholfen. So wäre es leichter für sie gewesen. Und für sie wäre es leichter gewesen, sie ins Auto zu kriegen.
Dann stand Melanie auf. »Angie, weißt du was? Das hört sich lustig an, an einem See zu wohnen. Und Lizzie und Emma können uns ja besuchen kommen.« Justine sah sie erstaunt an, und sie fuhr fort: »Außerdem kommst du in eine neue Schule und findest neue Freundinnen. Du bist bestimmt das beliebteste Mädchen in der ganzen Klasse, weil du so hübsch bist. Und vielleicht …« Rasch warf sie Justine aus ihren dunklen Augen einen Blick zu. »… kriegst du ja auch ein Kätzchen.«
Justine beugte sich vor. »Na klar. Wir können uns Katzen anschaffen, Hunde – alles, was wir wollen.«
Sie bemerkte Angelas jammervollen Gesichtsausdruck. Seit sie ganz klein gewesen war, hatte sie eine Katze haben wollen, aber Francis war allergisch, und Patrick, der Farmerssohn, fand, Katzen gehörten nicht ins Haus.
»Komm schon, Angie.« Melanie streckte die Hand aus. Einen Moment lang stand alles auf der Kippe, dann schluckte Angela Rotz und Tränen hinunter und ergriff sie. Justine versuchte, sich ihre unendliche Erleichterung nicht anmerken zu lassen, als sie aufstand und den beiden folgte.
Eine Stunde später waren sie auf dem Highway 15. Keiner von ihnen sagte ein Wort, als sie aus der Dämmerung Kaliforniens in die Nacht Nevadas hineinfuhren. Im Geist konnte Justine die Stimme ihrer Mutter hören, die dröhnend den Wind übertönte, der durch die offenen Fenster des Fairmont pfiff: »Siehst du irgendwas, wo’s dir gefällt, Schatz?« Im Rückspiegel ballte sich das aus ihrer Wohnung Geborgene, ragte wie eine Abraumhalde über den kleinen Gestalten ihrer Töchter auf. Sie zwang sich, den Blick nach vorn zu richten, auf das gelbe Band, das sich vor ihnen entrollte.
3
Lucy
Es fällt mir schwer, mich daran zu erinnern, wie Mutter damals aussah. Sie war schlank, das weiß ich noch, hatte blaue Augen und lockiges hellbraunes Haar, das sie in einem Haarnetz trug. Manchmal hörte ich die Leute sagen, ich sehe aus wie sie, und manchmal hörte ich sie sagen, dass sie hübsch sein könne, wenn sie sich ein bisschen Mühe gebe. Aber ich wollte nicht so aussehen wie sie, und ich glaubte nicht, dass sie jemals hübsch sein könnte. Obwohl ich ja zugebe, dass sie einen zarten Körperbau hatte. Jahre später formten ihr Kiefer und ihre Wangenknochen unmerkliche Krater, in die die Haut ihres Gesichts einsank. Am besten erinnere ich mich an ihre Hände, die hackten, kneteten, wuschen, stopften, kämmten. Wie die Sehnen hervortraten, wenn sie stickte oder wenn sie an der Steppdecke herumzupfte, als sie im Sterben lag.
In der Küche an jenem Morgen nach unserer Ankunft waren ihre Hände nass und seifig, während sie den Topf schrubbte, in dem sie immer unseren Haferbrei machte. Vater angelte, und nur wir Mädchen waren zum Frühstück da. Lilith und ich füllten unsere Schalen und setzten uns an den Tisch. Auf Liliths Gesicht lag ein leidvoller Ausdruck, und meins war bestimmt das sorgfältig einstudierte Spiegelbild. Wir wussten, was uns erwartete: Jedes Jahr mussten wir den ganzen ersten Tag des Sommers damit zubringen, das Haus zu putzen. Dieses Jahr jedoch mischte sich bei mir eine leise Freude in unser gemeinsames Elend, weil dieses Elend uns nämlich ganz allein gehörte. Emily musste nie beim Putzen helfen. Sie musste überhaupt niemals im Haushalt mit anpacken, eine Bevorzugung, die uns schon seit Jahren gewaltig wurmte. Sie an diesem Morgen nur anzuschauen, so makellos in ihrem rosa geblümten Kleid mit passenden Haarschleifen, reichte schon aus, dass uns die Galle hochkam.
Lilith nahm sich einen großen Löffel von Emilys Haferbrei. Emily sah zu Mutter, die uns den Rücken zukehrte, sagte aber nichts. Lilith und ich lachten.
Nach dem Frühstück machten wir uns an die Arbeit. Wir wuschen die Vorhänge, klopften die Teppiche aus und wischten die zusammengekrümmten Insekten aus den Schränken, die im Laufe des Winters dort gestorben waren. Wir schrubbten, kehrten unter Sekretären, Betten und Wohnzimmermöbeln und staubten die Oberkanten der Bilderrahmen ab. Vater war sehr auf Reinlichkeit bedacht, deshalb hielt Mutter das Haus damals sehr sauber. Sie überprüfte unser Werk, fand Staub, den wir übersehen hatten, und wies uns an, es noch einmal zu putzen. Doch das sagte sie ganz freundlich und versprach uns ein Eis.
Zuerst schlich Emily hinter uns her, den Blick stets auf Lilith geheftet, doch als wir uns über das obere Badezimmer hermachten, schob Lilith sie so heftig weg, dass sie beinahe hingefallen wäre. »Hör auf, uns nachzulaufen«, herrschte sie sie an und machte ihr die Badezimmertür vor der Nase zu. Danach gab Emily auf und ging zurück zu Mutter. Liliths Stimmung hob sich, und sie tat eins der Dinge, die ich am meisten an ihr liebte: Sie machte aus allem einen großen Spaß. Sie veranstaltete einen Wettbewerb, wer die Schlafzimmerfenster am schnellsten putzen konnte (sie gewann) und wer das Haus der Familie Lewis mit dem Schmutzwasser traf, das wir aus unseren Eimern zum Fenster hinauskippten. Wir taten so, als wären wir Cinderella, und schufteten nach Kräften in Erwartung unserer Prinzen. Lilith mimte die böse Stiefmutter und sprach mit einem urkomischen britischen Akzent, und ich bekam vor Lachen kaum noch Luft. So hatten wir schon eine ganze Weile nicht mehr gespielt, und während wir schrubbten, spürte ich die Freude, die das Haus dabei zu empfinden schien, den Winterschmutz loszuwerden. Wenn wir mit unserem Putzdienst fertig waren, würden wir zum Hundertbaum gehen, und der Sommer würde richtig anfangen.
Wir wischten gerade den Boden unseres Zimmers, als wir Vater zurückkommen hörten. Beim Klang seiner Stimme hielten wir beide inne und lauschten, wie er mit leichten Schritten die Treppe heraufkam, auf jene leise Art, die so typisch für ihn war. Als er oben ankam, blieb er kurz in unserer Tür stehen.
Mir Mutters längst vergangenes Äußeres ins Gedächtnis zu rufen mag mir schwerfallen, an Vater jedoch erinnere ich mich, als hätte ich ihn erst gestern gesehen. Anders als bei Mutter ist meine Erinnerung an Vater in seiner Jugend nämlich nicht durch das Bild von ihm im Alter verdrängt worden. Außerdem vergaß man Vater nicht, wenn man ihm einmal begegnet war. Nicht, dass er besonders ansehnlich gewesen wäre. Er hatte ein schmales Gesicht und war kleiner als die meisten anderen Männer und recht knochig. Es waren seine Augen; sie lagen tief in den Höhlen, und die Iris war tiefschwarz, sodass sie unnatürlich groß erschien wie die von einem Baby. Und wie die eines Kindes pflegten sie einen auch länger anzublicken, als es einem behagte, und schienen Dinge zu sehen, die andere nicht wahrnahmen. Früher mochte ich es sehr, wenn er mich ansah.
An diesem Vormittag jedoch sah er nur Lilith an und runzelte die Stirn. Sie hatte sich einen Rock um den Kopf gebunden, der über ihren Rücken hing – das gehörte zu ihrem Cinderella-Kostüm –, und dieser behelfsmäßige Schleier verlieh ihren fein gemeißelten Wangenknochen und den gewölbten Brauen eine stolze Resolutheit, die sie für mich ganz und gar wie die wunderschöne Dienstmagd aussehen ließ, der es bestimmt war, Königin zu werden.
»Nimm das ab«, befahl er.
Liliths Schultern zuckten unmerklich, als sie zusammenfuhr. Ich weiß nicht, warum Vater verärgert war; wir spielten doch nur, und unser Spiel stellte genau jenen unschuldigen Zeitvertreib dar, von dem er immer gesagt hatte, Gott sähe ihn mit Wohlgefallen. Lilith schlug die Augen nieder, zog sich den Rock vom Kopf und machte sich wieder ans Wischen. Ihr langes Haar fiel nach vorn und verbarg ihr Gesicht.
Ich erwartete, dass Vater jetzt gehen würde, doch stattdessen huschte sein Blick zu mir hinüber. Er sah mich nicht oft an, und die ungewohnte Last seiner Aufmerksamkeit löste meine Finger, sodass mein Wischmopp klappernd zu Boden fiel. Mein Gesicht brannte, als ich mich bückte, um ihn aufzuheben. Als ich mich aufrichtete, war er fort, war in sein Schlafzimmer gegangen, um sich umzuziehen. Lilith und ich putzten weiter, doch wir spielten nicht mehr.
Als wir fertig waren, wollte ich gleich in die Lodge gehen und unser Eis holen. Doch Lilith musste sich vorher umziehen. Sie schlüpfte in ein blau kariertes Kleid und bürstete sich das Haar. Erst nachdem sie sich zum vierten Mal im Spiegel begutachtet hatte, gingen wir in die Küche, wo Mutter gerade die Barsche ausnahm, die Vater gefangen hatte. Ihre blutigen Finger hantierten flink mit dem Messer, und ein Haufen abgetrennter Köpfe starrte mit trüben Augen vom Küchentresen herüber. Emily stand auf einem Stuhl und sah ihr zu.
Mutter fuhr sich mit dem Handrücken über die Stirn und schenkte uns ein müdes Lächeln. »Holt euch euer Eis, und bringt mir das hier mit. Nehmt Emily mit.« Sie deutete auf den Tisch, wo ein Fünfdollarschein neben einer Einkaufsliste lag. Lilith steckte beides in das kleine blaue Handtäschchen, das sie zu ihrem Kleid ausgesucht hatte, und wir gingen zur Hintertür hinaus.
Natürlich wollten wir Emily nicht mitnehmen, und wir fanden auch, dass sie kein Eis verdient hatte, also gingen wir schneller, sodass sie nicht mit uns Schritt halten konnte. Lilith schaute immer wieder zu den Häusern der Nachbarn hinüber, und ich empfand Schadenfreude, weil niemand sich draußen aufhielt, um sie in all ihrer Sommerpracht vorbeispazieren zu sehen. Die Glückseligkeit, die ich während unseres Putzdienstes verspürt und die selbst Vater mit seiner Missbilligung wegen Liliths Kostüm nicht hatte vertreiben können, zerstob in dem Staub, der um unsere Füße aufstieg – Liliths steckten in schmucken weißen Sandalen und meine in schmutzigen Turnschuhen. Als sie sich umgezogen hatte, war mir sofort klar gewesen, dass wir nicht zum Hundertbaum gehen würden.
Da die Lodge der einzige Betrieb am See war, erfüllte sie vielerlei Funktionen. Im ersten Stock waren Zimmer für die Angler, die aus den Countys weiter südlich anreisten, wo es keine Seen gab. Im Erdgeschoss zog sich eine mit Fliegengitter geschützte Veranda über die ganze Front, mit Sofas, Sesseln und zwei Flipperautomaten. Dahinter befand sich ein großer, hoher Raum mit einer Bar, einem Billardtisch, einem alten Klavier, einem halben Dutzend Tischen sowie Regalen in der hintersten Ecke, auf denen eine Ansammlung staubiger Souvenirs und ein paar einfache Lebensmittel zu finden waren.
Der Raum war leer, als wir hereinkamen, doch als wir unsere Einkäufe zusammensuchten, stieß Abe Miller die Tür zur Küche auf. Gestern Abend, als uns die Millers unser Abendessen am See serviert hatten, hatte ich nicht weiter auf ihn geachtet, jetzt jedoch sah ich, wie sehr er sich seit dem letzten Sommer verändert hatte. Er muss damals fünfzehn gewesen sein. Er war in die Höhe geschossen und jetzt größer als Vater. Seine langen Arme ragten etliche Zentimeter aus seinen Ärmeln hervor. Sein schwarzes Haar war kurz geschnitten. Sein Gesicht hatte die kindliche Weichheit verloren und war kantiger geworden. Er hatte eine gerade Nase und volle Lippen. Zu meinem Entsetzen lächelte Lilith ihn an – das gleiche schiefe Lächeln, mit dem sie Charlie Lloyd bedacht hatte.
Abes dunkles Gesicht lief rot an. »Kann ich euch helfen?« Seine Stimme klang schleppend, die Konsonanten kamen mühsam hervor, so wie es schon immer gewesen war, doch es war die tiefe Stimme eines Mannes.
Die Küchentür ging abermals auf und prallte gegen seine Schulter. Matthew, der jüngere der beiden Brüder, ließ beinahe ein schweres Tablett fallen, auf dem Kaffeetassen gestapelt waren. Dabei entfuhr ihm ein Wort, das ich bisher immer nur von erwachsenen Männern gehört hatte, wenn sie glaubten, die Kinder könnten sie nicht hören. Abe nahm das Tablett und trug es mühelos zur Bar; das Spiel seiner Schultermuskeln war unter seinem weißen Hemd deutlich zu erkennen.