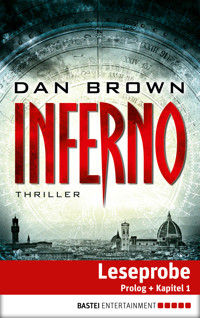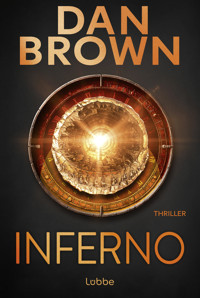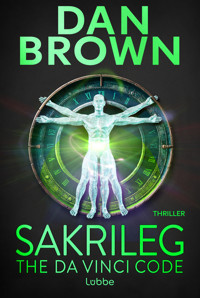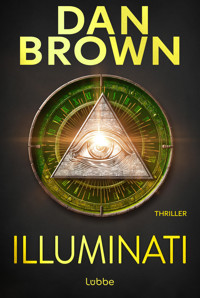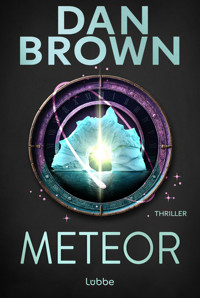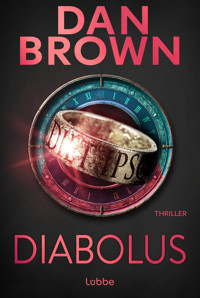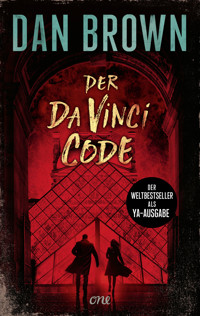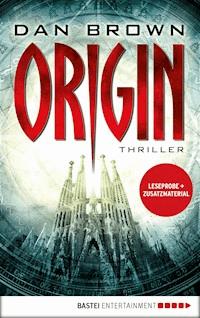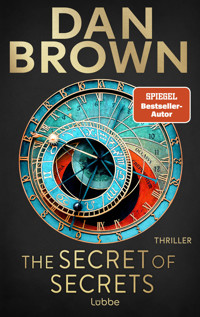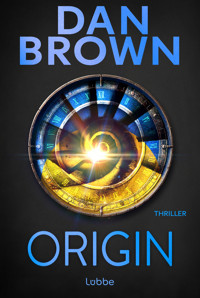11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Robert Langdon
- Sprache: Deutsch
Robert Langdon ist zurück
Washington, D.C.: In der amerikanischen Hauptstadt liegt ein sorgsam gehütetes Geheimnis verborgen, und ein Mann ist bereit, dafür zu töten. Aber dazu benötigt er die Unterstützung eines Menschen, der ihm freiwillig niemals helfen würde: Robert Langdon, Harvard-Professor und Experte für die Entschlüsselung und Deutung mysteriöser Symbole.
Nur ein finsterer Plan ermöglicht es, Robert Langdon in die Geschichte hineinzuziehen. Fortan jagt der Professor über die berühmten Schauplätze der Hauptstadt. Doch er jagt nicht nur - er wird selbst zum Gejagten. Denn das Rätsel, das nur er zu lösen vermag, ist für viele Kreise von größter Bedeutung - im Guten wie im Bösen. Danach wird die Welt, die wir kennen, eine andere sein.
Das verlorene Symbol ist der dritte Roman aus der Thriller-Reihe um Robert Langdon, die Dan Brown zu einem weltweit gefeierten Bestsellerautor machte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 832
Veröffentlichungsjahr: 2010
Sammlungen
Ähnliche
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Widmung
Danksagungen
Motto
Fakt
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
63. Kapitel
64. Kapitel
65. Kapitel
66. Kapitel
67. Kapitel
68. Kapitel
69. Kapitel
70. Kapitel
71. Kapitel
72. Kapitel
73. Kapitel
74. Kapitel
75. Kapitel
76. Kapitel
77. Kapitel
78. Kapitel
79. Kapitel
80. Kapitel
81. Kapitel
82. Kapitel
83. Kapitel
84. Kapitel
85. Kapitel
86. Kapitel
87. Kapitel
88. Kapitel
89. Kapitel
90. Kapitel
91. Kapitel
92. Kapitel
93. Kapitel
94. Kapitel
95. Kapitel
96. Kapitel
97. Kapitel
98. Kapitel
99. Kapitel
100. Kapitel
101. Kapitel
102. Kapitel
103. Kapitel
104. Kapitel
105. Kapitel
106. Kapitel
107. Kapitel
108. Kapitel
109. Kapitel
110. Kapitel
111. Kapitel
112. Kapitel
113. Kapitel
114. Kapitel
115. Kapitel
116. Kapitel
117. Kapitel
118. Kapitel
119. Kapitel
120. Kapitel
121. Kapitel
122. Kapitel
123. Kapitel
124. Kapitel
125. Kapitel
126. Kapitel
127. Kapitel
128. Kapitel
129. Kapitel
130. Kapitel
131. Kapitel
132. Kapitel
133. Kapitel
Epilog
Aus dem amerikanischenEnglisch übersetzt und entschlüsseltvom Bonner Kreis
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2009 by Dan Brown
Titel der englischen Originalausgabe:
»The Lost Symbol«
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© 2009 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Wolfgang Neuhaus
Umschlaggestaltung: HildenDesign, München
Umschlagmotiv: © HildenDesign unter Verwendung eines Motivs von velora / shutterstock
E-Book-Produktion: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
ISBN 978-3-8387-0594-1
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Für Blythe
DANKSAGUNGEN
Mein tiefempfundener Dank gilt drei guten Freunden, mit denen ich zusammenarbeiten durfte: meinem Lektor Jason Kaufman, meiner Agentin Heide Lange und meinem Berater Michael Rudell. Außerdem geht ein herzliches Dankeschön an Doubleday und an meine Verlage in aller Welt – und natürlich an meine Leser.
Ohne die großzügige Unterstützung zahlreicher Menschen, die mich an ihrem Wissen und ihren Kenntnissen teilhaben ließen, hätte dieser Roman nicht geschrieben werden können. Ihnen allen spreche ich meine tiefe Wertschätzung aus.
In der Welt zu leben, ohne sich ihrer Bedeutung bewusst zu werden, ist wie in einer großen Bibliothek herumzuirren, ohne die Bücher anzurühren.
Die Geheimen Lehren aller Zeiten
FAKT
Im Jahre 1991 wurde ein Dokument im Safe des CIA-Direktors eingeschlossen. Dieses Dokument befindet sich heute noch dort. Sein kryptischer Text enthält Hinweise auf ein altes Portal und einen unbekannten Ort im Untergrund. Außerdem enthält das Schriftstück den Satz: »Irgendwo da draußen liegt es vergraben.«
Die Organisationen, die in diesem Roman eine Rolle spielen, existieren tatsächlich, einschließlich der Freimaurer, des Unsichtbaren Collegiums, des Office of Security, des SMSC und des Instituts für Noetische Wissenschaften.
Sämtliche Rituale, die geschildert werden, sind authentisch, und die aufgeführten wissenschaftlichen Fakten entsprechen den Tatsachen.
Die im Roman genannten Kunstwerke und Monumente sind real.
PROLOG
Haus des Tempels20.33 Uhr
Das Geheimnis liegt darin, wie man stirbt.
So ist es seit Anbeginn der Zeit.
Der vierunddreißigjährige Anwärter blickte auf den menschlichen Schädel, den er in Händen hielt. Der Totenkopf war hohl wie eine Schale und gefüllt mit blutrotem Wein.
Trink, sagte er sich. Du hast nichts zu befürchten.
Wie die Tradition es verlangte, hatte der Anwärter seine Reise im rituellen Gewand eines mittelalterlichen Ketzers angetreten, der zum Galgen geführt wird, mit weit aufklaffendem Hemd, sodass die blasse Brust zu sehen war; das linke Hosenbein bis zum Knie aufgerollt, den rechten Ärmel bis zum Ellbogen. Um seinen Hals hatte eine schwere geknüpfte Schlinge gelegen – ein »Kabeltau«, wie die Brüder es nannten. Heute jedoch trug der Anwärter – ebenso wie die Bruderschaft, die das Geschehen bezeugte – die Kleidung eines Meisters.
Die versammelten Brüder, die den Anwärter umstanden, trugen volles Ornat: Schurz, Schärpe und weiße Handschuhe. Um den Hals trugen sie Bijous, zeremonielle Schmuckabzeichen, die in dem gedämpften Licht wie geisterhafte Augen funkelten. Viele dieser Männer hatten außerhalb der Loge bedeutende Ämter und Machtpositionen inne, und doch wusste der Anwärter, dass ihr weltlicher Rang innerhalb dieser Mauern nichts bedeutete. Hier waren alle gleich – eine verschworene Gemeinschaft, vereint durch ein mystisches Band.
Als der Blick des Anwärters über die beeindruckende Versammlung schweifte, fragte er sich, wer in der Welt außerhalb des Tempels wohl glauben würde, dass eine solche Gruppe von Männern tatsächlich zusammenkam – zumal an einem Ort wie diesem, der wie ein antikes Heiligtum aus einer versunkenen Welt erschien.
Die Wahrheit jedoch war noch unglaublicher.
Ich bin nur ein paar Hundert Meter vom Weißen Haus entfernt.
Dieses machtvolle Gebäude an der Sechzehnten Straße NW, Nr. 1733, in Washington, D.C., war die Nachbildung eines vorchristlichen Heiligtums, des Tempels König Mausolos II., des ursprünglichen Mausoleums – ein Tempel der Toten. Vor dem Haupteingang bewachten zwei siebzehn Tonnen schwere Sphingen das bronzene Portal. Das Innere war ein reich verziertes Labyrinth von Ritualkammern, Sälen, verschlossenen Räumen und Bibliotheken; eine hohle Wand barg die Überreste zweier menschlicher Körper. Jede der Kammern und jeder der Säle in diesem Gebäude enthielte ein Geheimnis, hatte man dem Anwärter anvertraut.
Die größten Mysterien jedoch barg jener riesige Saal, in dem er nun kniete, den Totenschädel in den Händen.
Der Tempelsaal.
Dieser Saal war von quadratischem Grundriss – die vollkommene Form – und hatte gewaltige Ausmaße. Die Decke, gestützt von monolithischen Säulen aus grünem Granit, befand sich hundert Fuß über dem Boden. Eine mehrstufige Galerie mit dunklem Gestühl aus russischem Walnussholz und Schweinsleder, von Hand punziert, zog sich an den Wänden entlang. Ein dreiunddreißig Fuß hoher Thron beherrschte die westliche Wand; auf der gegenüberliegenden Seite erhob sich eine verdeckte Orgel. Die Wände waren ein Kaleidoskop uralter Symbole – ägyptische und hebräische Zeichen, astronomische und alchimistische Symbole sowie Darstellungen noch unbekannter Natur.
Am heutigen Abend wurde der Tempelsaal von einer Reihe genau ausgerichteter Kerzen erhellt. Ihr matter Schein vermischte sich mit einem bleichen Lichtstrahl, der durch das Deckenfenster in den Tempelraum fiel und dessen eindrucksvollstes Element beleuchtete: einen mächtigen Altar aus poliertem schwarzem Marmor, der genau im Zentrum des Saales stand.
Das Geheimnis liegt darin, wie man stirbt, rief der Anwärter sich ins Gedächtnis.
»Es ist Zeit«, flüsterte eine Stimme.
Der Anwärter richtete den Blick auf die ehrwürdige, weiß gekleidete Gestalt, die vor ihm stand. Der oberste Meister vom Stuhl. Dieser Mann, Ende fünfzig und mit silbergrauem Haar, war eine amerikanische Ikone – beliebt, bodenständig und unermesslich reich. Auf seinen Gesichtszügen, die in den Vereinigten Staaten jeder kannte, spiegelten sich ein Leben voller Macht und ein kraftvoller Geist.
»Sprechen Sie den Eid«, sagte der Meister vom Stuhl, und seine Stimme war weich und sanft wie Schnee, der zu Boden rieselt. »Vollenden Sie Ihre Reise.«
Die Reise des Anwärters hatte mit dem ersten Grad begonnen, wie alle derartigen Reisen. Damals, bei einem ähnlichen abendlichen Ritual wie diesem, hatte der Meister vom Stuhl ihm mit einer samtenen Binde die Augen verbunden, hatte ihm einen zeremoniellen Degen an die bloße Brust gehalten und ihm die Frage gestellt: »Erklären Sie aufrichtig bei Ihrer Ehre, unbeeinflusst von Gewinnstreben oder anderen unwürdigen Motiven, dass Sie aus freiem Entschluss und Willen Aufnahme in diese Bruderschaft begehren?«
»Ja«, hatte der Suchende gelogen.
»Dann möge dies ein Stich für Ihr Gewissen sein«, hatte der Meister ihn gewarnt, »und desgleichen sofortiger Tod, sollten Sie je die Geheimnisse verraten, die man Ihnen anvertrauen wird.«
Damals hatte er keine Furcht verspürt. Sie werden meine wahre Absicht niemals erkennen.
Am heutigen Abend jedoch glaubte er eine düstere, bedrohliche Stimmung im Tempelsaal wahrzunehmen, einen ahnungsvollen Ernst. Schaudernd musste er an die grausamen Strafen denken, die ihm auf seiner bisherigen Reise angedroht worden waren für den Fall, dass er eines der uralten Geheimnisse verriet, die man ihm anvertraut hatte: Der Hals durchschnitten von Ohr zu Ohr … die Zunge bei der Wurzel ausgerissen … die Eingeweide herausgerissen und verbrannt … in die vier Winde des Himmels zerstreut … das Herz aus der Brust gerissen und streunenden Tieren zum Fraß vorgeworfen …
»Bruder«, sagte der grauäugige Meister und legte dem Anwärter die linke Hand auf die Schulter. »Sprechen Sie den letzten Eid.«
Der Anwärter wappnete sich für den abschließenden Schritt seiner Reise, straffte seine kräftige Gestalt und wandte seine Aufmerksamkeit wieder dem Totenkopf zu, den er noch immer in Händen hielt. Der rote Wein in der Schädelhöhle sah im matten Kerzenlicht fast schwarz aus. Tiefes Schweigen hatte sich über den Tempelsaal gesenkt. Der Anwärter spürte beinahe körperlich, wie die aufmerksamen Blicke sämtlicher Zeugen auf ihm ruhten, wie diese darauf warteten, dass er den letzten Eid ablegte und sich ihren Reihen hinzugesellte, den Reihen der Auserwählten.
Heute Abend, ging es ihm durch den Kopf, wird in diesen Mauern etwas geschehen, was es in der Geschichte dieser Bruderschaft noch nie gegeben hat, nicht ein einziges Mal in all den Jahrhunderten …
Er wusste, es würde der entscheidende Funke sein und es würde ihm unermessliche Macht verleihen.
Mit neuem Mut holte er tief Atem und sprach laut dieselben Worte, die zahllose Männer vor ihm in allen Ländern der Erde gesprochen hatten:
»Möge dieser Wein, den ich nun trinke, mir ein tödliches Gift werden … sollte ich je wissentlich oder willentlich meinen Eid verletzen.«
Seine Worte hallten von den hohen Wänden wider. Dann breitete sich tiefe Stille aus.
Mit ruhigen Händen hob der Anwärter den Schädel an den Mund und spürte, wie seine Lippen das trockene Gebein berührten. Er schloss die Augen, hob den Schädel an und trank in langen, tiefen Schlucken. Als der letzte Tropfen getrunken war, ließ er den Totenschädel sinken …
… und bekam plötzlich keine Luft mehr, während sein Herz wild zu pochen begann und seine Hände zitterten. Für einen Moment wurde ihm schwarz vor Augen.
Mein Gott, sie wissen Bescheid!
Dann schwand das beängstigende Gefühl so schnell, wie es gekommen war.
Eine angenehme Wärme durchströmte den Körper des Anwärters. Er atmete aus und lächelte in sich hinein, als er zu dem grauäugigen Mann aufblickte, der so arglos gewesen war, ihn in die allergeheimsten Ränge der Bruderschaft aufzunehmen.
Bald wirst du alles verlieren, was dir lieb und wert ist.
1. KAPITEL
Im Otis-Aufzug an der Südseite des Eiffelturms drängten sich die Touristen. In der beengten Kabine blickte ein seriös gekleideter Herr auf den Jungen neben ihm hinunter. »Du siehst blass aus. Du hättest lieber unten bleiben sollen.«
»Mir geht’s gut …«, antwortete der Junge, bemüht, seine Angst in den Griff zu bekommen. »Ich steig auf der nächsten Etage aus.«
Der Mann beugte sich tiefer zu dem Jungen. »Ich dachte, du hättest deine Angst überwunden.« Er strich dem Kind zärtlich über die Wange.
Der Junge schämte sich, weil er seinen Vater enttäuscht hatte, doch durch das Klingeln in seinen Ohren konnte er kaum etwas hören.
O Gott, ich krieg keine Luft! Ich muss hier raus!
Der Fahrstuhlführer sagte irgendetwas Beruhigendes über Pendelschaftkolben und Puddeleisenkonstruktion, doch der Junge blickte voller Furcht auf die Straßen von Paris, die sich tief unter ihnen in sämtliche Richtungen erstreckten.
Wir sind fast da, sagte er sich im Stillen, legte den Kopf in den Nacken und blickte hinauf zur Ausstiegsplattform. Halt durch!
Als die Kabine sich steil auf die obere Aussichtsplattform zubewegte, verengte sich der Schacht. Die massiven Stützen wuchsen zu einem engen, senkrecht in die Höhe führenden Tunnel zusammen.
»Dad, ich glaub nicht …«
Plötzlich ein Knall. Dann noch einer. Der Aufzug ruckte, schwankte, neigte sich gefährlich zur Seite. Zerrissene Kabel peitschten um die Kabine, zuckend wie gereizte Schlangen. Der Junge griff Hilfe suchend nach der Hand seines Vaters.
»Dad!«
Ihre Blicke trafen sich eine Schrecksekunde lang.
Dann sackte der Fußboden unter ihren Füßen weg, und der Lift schoss in die Tiefe.
Mit einem Ruck schreckte Robert Langdon in seinem weichen Ledersitz aus dem Halbdämmern seines Tagtraums. Er saß ganz allein in dem großzügig bemessenen Passagierraum eines Falcon-2000EX-Firmenjets, der soeben von Turbulenzen durchgeschüttelt wurde. Im Hintergrund summten im Gleichklang die zwei Pratt-&-Whitney-Triebwerke.
»Mr. Langdon?« Der Lautsprecher unter der Decke knisterte. »Wir setzen jetzt zur Landung an.«
Langdon richtete sich auf und schob seine Vortragsnotizen zurück in die lederne Umhängetasche. Er war mit einer Rekapitulation freimaurerischer Symbolik beschäftigt gewesen, als seine Gedanken abgedriftet waren. Der Traum über seinen verstorbenen Vater war, so vermutete er, auf die unerwartete Einladung durch seinen langjährigen Mentor Peter Solomon zurückzuführen.
Der andere Mann, den ich niemals enttäuschen will.
Der achtundfünfzigjährige Philanthrop, Historiker und Wissenschaftler hatte Langdon vor nahezu dreißig Jahren unter seine Fittiche genommen und damit in mancher Hinsicht die Leere gefüllt, die nach dem Tod von Langdons Vater entstanden war. Wenngleich Solomon einer einflussreichen Familiendynastie angehörte und über immensen Reichtum verfügte, hatte Langdon in den sanften grauen Augen dieses Mannes Demut und Wärme gefunden.
Draußen war die Sonne bereits untergegangen, doch durch das Fenster konnte Langdon noch die schlanke Silhouette des größten Obelisken der Welt ausmachen, der wie der Zeiger einer riesigen Sonnenuhr am Horizont aufragte. Das 555 Fuß hohe Monument markierte das Herz der Nation. Um den Obelisken herum erstreckten sich die geometrischen Kraftlinien der Straßen und Bauwerke der Stadt.
Selbst aus der Luft strahlte Washington, D.C., eine beinahe mystische Macht aus.
Langdon liebte diese Stadt. Als der Jet auf der Landebahn aufsetzte, spürte er eine wachsende Erregung bei dem Gedanken daran, was vor ihm lag. Die Maschine rollte zu einem privaten Terminal auf der ausgedehnten Fläche des Dulles International Airport und kam zum Stehen.
Langdon packte seine Sachen, dankte den Piloten und trat aus dem luxuriösen Innern des Falcon hinaus auf die Gangway. Die kalte Luft war eine Wohltat.
Tief durchatmen, Robert, sagte er sich und nahm erleichtert die Weite der Umgebung in sich auf.
Weiße Nebelschwaden zogen über den Boden. Langdon hatte das Gefühl, sich einem Sumpf zu nähern, als er die Rolltreppe hinunterstieg.
»Hallo!«, rief eine singende Stimme mit britischem Akzent. »Hallo! Professor Langdon?«
Langdon blickte auf und sah eine Frau mittleren Alters mit einem Abzeichen und einem Klemmbrett auf ihn zueilen, wobei sie freudig winkte. Lockiges blondes Haar lugte unter einer modischen Strickmütze hervor.
»Willkommen in Washington, Sir.«
Langdon lächelte. »Vielen Dank.«
»Mein Name ist Pam, Sir, vom Passagierservice!« Die Frau sprach mit einem Überschwang, der beinahe schon auf die Nerven ging. »Wenn Sie bitte mit mir kommen wollen, Sir, Ihr Wagen steht bereit.«
Langdon folgte ihr über die Rollbahn zum Signature-Terminal, der von funkelnden Privatjets umgeben war. Ein Taxistand für die Reichen und Berühmten.
»Verzeihen Sie, wenn ich Ihnen lästig falle, Professor«, sagte die Frau, »aber sind Sie der Robert Langdon, der die Bücher über Symbole und Religion schreibt?«
Langdon zögerte und nickte dann.
»Hab ich’s mir doch gedacht!«, sagte die Frau strahlend. »Mein Lesekreis hat Ihr Buch über das göttlich Weibliche und die Kirche verschlungen. Hat ja für einen schönen Skandal gesorgt! Es macht Ihnen wohl Spaß, den Fuchs im Hühnerstall zu spielen?«
Langdon lächelte. »Das war nie meine Absicht.«
Die Frau schien zu spüren, dass Langdon nicht in der Stimmung war, über sein Werk zu diskutieren. »Entschuldigen Sie, ich wollte Sie nicht vollquatschen. Ich kann mir denken, dass Sie es leid sind, erkannt zu werden, aber das ist ja Ihre eigene Schuld.« Neckisch wies sie auf seine Kleidung. »Ihre Uniform hat Sie verraten.«
Meine Uniform? Langdon blickte an sich hinunter. Er trug seinen gewohnten anthrazitfarbenen Rollkragenpullover, ein Harris-Tweed-Jackett, eine Kakihose und Halbschuhe aus Korduanleder – seine übliche Kleidung für den Hörsaal, Vortragsreisen, Autorenfotos und gesellschaftliche Anlässe.
Die Frau lachte. »Ihr Rolli ist völlig aus der Mode. Außerdem würde eine Krawatte Ihnen viel besser stehen!«
Nur über meine Leiche, dachte Langdon. Bloß kein Galgenstrick.
An der Phillips Exeter Academy, die er besucht hatte, waren Krawatten Pflicht gewesen, und trotz der romantischen Vorstellungen des Direktors, der Ursprung dieser Halszierde ginge auf die seidenen fascalia zurück, die von römischen Rednern getragen wurden, um ihre Stimmbänder zu wärmen, wusste Langdon, dass das Wort Krawatte sich etymologisch von einer brutalen Horde »kroatischer« Söldner herleitete, die sich Halstücher umgeknüpft hatten, bevor sie in die Schlacht gestürmt waren. Bis heute wurde diese alte Kriegstracht Tag für Tag von modernen Bürokriegern angelegt, um ihre Feinde beim Kampf an den Konferenztischen einzuschüchtern.
»Vielen Dank für den Hinweis«, sagte Langdon mit einem Glucksen. »Ich werde es mir für die Zukunft merken.«
Zum Glück stieg in diesem Augenblick ein elegant gekleideter Mann in dunklem Anzug aus einem funkelnden Lincoln Town Car, der nahe dem Terminal parkte, und hob den Finger. »Mr. Langdon? Ich bin Charles von Beltway Limousine.« Er öffnete die hintere Beifahrertür. »Guten Abend, Sir. Willkommen in Washington.«
Langdon drückte Pam für ihre Freundlichkeit ein Trinkgeld in die Hand und stieg ins feudale Innere des Town Car. Der Fahrer zeigte ihm den Temperaturregler, die Mineralwasserflaschen und das Körbchen mit heißen Muffins. Sekunden später rauschte Langdon auf einer privaten Zufahrtsstraße davon. Schön, mal wieder wie einer von den oberen Zehntausend zu leben.
Als der Fahrer den Wagen den Windsock Drive hinauf beschleunigte, konsultierte er seinen Auftragszettel und tätigte einen kurzen Anruf. »Hier Beltway Limousine«, sagte er in geschäftsmäßigem Tonfall. »Ich sollte bestätigen, dass mein Passagier gelandet ist …« Er machte eine Pause. »Ja, Sir. Ihr Gast ist angekommen. Ich setze Mr. Langdon um neunzehn Uhr am Capitol Building ab … gern geschehen, Sir.«
Langdon konnte sich ein Schmunzeln nicht verkneifen. Nichts dem Zufall überlassen. Peter Solomons Aufmerksamkeit fürs Detail war eine seiner größten Stärken; sie allein machte es ihm möglich, seine nicht unwesentliche Macht mit scheinbarer Mühelosigkeit auszuüben. Ein paar Milliarden Dollar auf der Bank schaden dabei allerdings auch nicht.
Langdon ließ sich in den weichen Ledersitz sinken und schloss die Augen, als die Geräusche des Flughafens hinter ihm verklangen. Das U.S. Capitol war eine halbe Stunde entfernt, und er war froh, dass ihm ein wenig Zeit blieb, seine Gedanken zu ordnen. Alles war heute so schnell gegangen, dass er erst jetzt in Ruhe über den unglaublichen Abend nachdenken konnte, der vor ihm lag.
Ankunft unter dem Siegel der Geheimhaltung, ging es ihm durch den Kopf. Die Vorstellung erheiterte ihn.
Sechzehn Kilometer vom Kapitol entfernt traf eine einsame Gestalt ungeduldig die letzten Vorbereitungen für Robert Langdons Ankunft.
2. KAPITEL
Der Mann, der sich Mal’akh nannte, drückte die Nadel gegen seinen rasierten Kopf und seufzte befriedigt, als die scharfe Spitze rhythmisch in sein Fleisch stach. Das leise Summen des elektrischen Werkzeugs machte süchtig … so wie der Stich der Nadel, die sich in seine Dermis bohrte und dort Farbpartikel hinterließ.
Ich bin ein Meisterwerk.
Das Ziel des Tätowierens war niemals Schönheit. Das Ziel war Veränderung. Von den narbengeschmückten nubischen Priestern des dritten vorchristlichen Jahrtausends über die tätowierten Akolythen des Kybele-Kults im alten Rom bis hin zu den modernen Maori mit ihren Moko-Narben hatten Menschen die Tätowierung als einen Weg betrachtet, ihren Körper als partielles Opfer darzubieten, den physischen Schmerz der Prozedur zu erdulden und als veränderte Wesen daraus hervorzugehen.
Trotz des ominösen Gebots in Levitikus 19, Vers 28, sich keine Zeichen auf dem Körper einritzen zu lassen, waren Tattoos für Millionen von Menschen im modernen Zeitalter Mutprobe und Ritus zugleich geworden – für adrette Teenager über verdreckte Junkies bis hin zu gelangweilten Hausfrauen.
Der Akt des Sich-Tätowieren-Lassens war eine machtvolle Transformation und zugleich eine Botschaft an die Welt: Siehe, ich bin Herr meines eigenen Fleisches. Das berauschende Gefühl der Kontrolle, das sich aus der körperlichen Wandlung speist, hatte Millionen süchtig gemacht nach Veränderungen des eigenen Körpers: kosmetische Chirurgie, Piercing und Branding, Bodybuilding und Steroide, selbst Bulimie und Geschlechtsumwandlung. Der menschliche Geist verlangt nach Herrschaft über seine fleischliche Hülle.
Ein Glockenschlag ertönte von Mal’akhs Standuhr, und er blickte auf. Halb sieben. Er legte das Tätowierwerkzeug beiseite, hüllte seinen nackten, ein Meter neunzig großen Körper in einen Badeumhang aus japanischer Seide und trat hinaus auf den Flur. Die Luft in dem großräumigen Wohnhaus war geschwängert vom beißenden Geruch der Tätowierfarbe und dem Rauch der Bienenwachskerzen, mit denen Mal’akh seine Nadeln sterilisierte. Vorbei an wertvollen italienischen Antiquitäten – einer Radierung von Piranesi, einem Savonarolastuhl, einer silbernen Bugarini-Öllampe – ging der hochgewachsene junge Mann über den Flur.
Im Vorübergehen warf er einen Blick durch ein wandhohes Fenster und bewunderte die klassische Skyline in der Ferne. Die angestrahlte Kuppel des Kapitols hob sich machtvoll und majestätisch vor dem dunklen Winterhimmel ab.
Das ist der Ort des Geheimnisses, ging es Mal’akh durch den Kopf. Irgendwo da draußen liegt es vergraben.
Wenige Menschen wussten von seiner Existenz … und noch weniger kannten seine beeindruckende Macht oder waren darin eingeweiht, auf welch raffinierte Weise es versteckt worden war. Bis heute blieb es das größte unerforschte Rätsel des Landes. Die wenigen, die die Wahrheit kannten, hielten sie hinter einem Schleier von Symbolen, Legenden und Allegorien verborgen.
Jetzt haben sie ihre Türen für mich geöffnet, dachte Mal’akh.
Vor drei Wochen war er in einem dunklen Ritual im Beisein einiger der einflussreichsten Männer Amerikas in den 33. Grad erhoben worden, die höchste Stufe der ältesten noch existierenden Bruderschaft der Welt. Trotz Mal’akhs neuem Rang hatten die Brüder ihm nichts erzählt. Und das werden sie auch nicht, dachte er. So läuft das nun mal nicht. Es gab Kreise innerhalb von Kreisen … Bruderschaften innerhalb von Bruderschaften. Selbst wenn Mal’akh Jahre wartete – ihr letztes Vertrauen würde er vielleicht nie gewinnen.
Zum Glück brauchte er ihr Vertrauen nicht, um an ihr tiefstes und kostbarstes Geheimnis zu gelangen.
Meine Erhebung hat ihren Zweck erfüllt.
Mal’akh ging zum Schlafzimmer, angespornt von dem, was vor ihm lag. Im ganzen Haus drangen betörende Klänge aus den Lautsprechern: die seltene Aufnahme einer Kastratenstimme, die das »Lux Aeterna« aus dem Verdi-Requiem sang – eine Erinnerung an ein früheres Leben. Mal’akh drückte auf eine Fernbedienung, um zu dem majestätischen »Dies Irae« zu gelangen. Begleitet von donnernden Pauken und parallelen Quinten sprang er sodann die breite Marmortreppe hinauf, dass die Robe sich um seine muskulösen Beine bauschte.
Während er rannte, knurrte protestierend sein leerer Magen. Seit zwei Tagen hatte Mal’akh nun gefastet, hatte nur Wasser getrunken und nichts gegessen, um seinen Körper gemäß den alten Vorschriften bereit zu machen. Bei Sonnenaufgang wird dein Hunger gestillt sein, sagte er sich. Und dein Schmerz gelindert.
Mal’akh betrat das Allerheiligste seines Schlafgemachs und schloss hinter sich die Tür. Als er zum Ankleidebereich schritt, hielt er inne. Er fühlte sich hingezogen zu dem großen, von einem Goldrahmen eingefassten Spiegel; die Versuchung, sein eigenes Spiegelbild zu betrachten, war zu stark. Langsam, als würde er ein Geschenk von unschätzbarem Wert auspacken, öffnete Mal’akh seine Robe und enthüllte seine nackte Gestalt. Der Anblick verschlug ihm die Sprache.
Ich bin ein Meisterwerk.
Sein massiger Körper war rasiert und glatt. Mal’akh schaute zuerst auf seine Füße, die mit den Schuppen und Klauen eines Falken tätowiert waren; dann bewegte sein Blick sich hinauf zu seinen muskulösen Beinen, die als gemeißelte Säulen gestaltet waren – das linke Bein spiralförmig tätowiert, das rechte mit vertikalen Streifen. Boas und Jachin. Seine Lenden und sein Magen bildeten einen verzierten Torbogen, und seine mächtige Brust war mit dem doppelköpfigen Phönix geschmückt … jeder der zwei Köpfe im Profil zur Seite gewandt, sodass Mal’akhs Brustwarzen das jeweilige Auge bildeten. Schultern, Hals, Gesicht und der rasierte Kopf waren vollständig mit einem verschlungenen Muster von uralten Symbolen und Zeichen bedeckt.
Ich bin ein Artefakt … ein sich entfaltendes Bild.
Es gab nur einen sterblichen Menschen, der Mal’akh jemals nackt gesehen hatte – achtzehn Stunden zuvor. Der Mann hatte vor Angst geschrien: »O Gott, Sie sind ein Dämon!«
»Wenn Sie mich als solchen betrachten«, hatte Mal’akh kühl geantwortet. Für die Menschen der Antike waren Engel und Dämonen ein und dasselbe gewesen – zwei Seiten einer Münze, alles eine Sache der Polarität: Der Schutzengel, der deinen Feind im Kampf besiegte, wurde von deinem Feind als dämonischer Zerstörer betrachtet.
Mal’akh senkte das Haupt, um im riesigen Spiegel einen Blick auf die Oberseite seines Kopfes werfen zu können. Dort, innerhalb eines kronengleichen Strahlenkranzes, leuchtete ein kleiner Kreis blassen, nicht tätowierten Fleisches. Diese sorgfältig ausgesparte Fläche war Mal’akhs einziges Stück jungfräulicher Haut. Diese geweihte Stelle hatte geduldig gewartet, und heute Nacht würde sie gefüllt werden. Auch wenn Mal’akh noch nicht besaß, was er zur Vollendung seines Meisterwerks benötigte, so wusste er doch, dass es sehr bald so weit sein würde.
Erregt von seinem eigenen Spiegelbild spürte er bereits, wie seine Macht wuchs. Er schloss seine Robe, trat ans Fenster und blickte noch einmal hinaus auf die mystische Stadt.
Irgendwo da draußen liegt es vergraben.
Mal’akh konzentrierte sich wieder ganz auf die vor ihm liegende Aufgabe. Er ging zum Frisiertisch und trug sorgfältig eine Schicht von deckendem Make-up auf Gesicht, Kopfhaut und Hals auf, bis seine Tattoos davon bedeckt waren. Dann legte er die vorbereitete Kleidung und einige andere Dinge an, die er zuvor sorgfältig für diesen Abend zusammengestellt hatte. Als er fertig war, überprüfte er noch einmal sein Äußeres im Spiegel. Zufrieden strich er sich mit der Hand über den blanken Schädel und lächelte.
Es ist da draußen, dachte er. Und heute Nacht wird mir jemand helfen, es zu finden.
Als Mal’akh sein Haus verließ, bereitete er sich geistig auf jenes Ereignis vor, das sehr bald das Kapitol erschüttern würde. Er hatte weder Kosten noch Mühen gescheut, um das Spielbrett für den heutigen Abend auszubreiten und die Figuren aufzustellen.
Und jetzt endlich war seine letzte Figur ins Spiel gekommen.
3. KAPITEL
Robert Langdon war mit dem Studium seiner Karteikarten beschäftigt, als das Surren der Reifen auf dem Asphalt heller wurde. Erstaunt hob er den Kopf, um zu sehen, wo er sich befand.
Schon auf der Memorial Bridge?
Er legte seine Karteikarten beiseite und blickte nach draußen, wo die trägen Wasser des Potomac unter der Brücke hindurchflossen. Dichter Dunst hing über der ausgedehnten Fläche. Foggy Bottom, wie man diesen Landstrich so treffend nannte, war ihm stets als eine merkwürdige Gegend erschienen, um hier die Hauptstadt der Vereinigten Staaten zu errichten. In der riesigen Neuen Welt hatten die Gründerväter ausgerechnet eine sumpfige Uferlandschaft auserkoren, um den Grundpfeiler ihrer utopischen Gesellschaft zu setzen.
Langdon blickte nach links über das Tidal Basin hinweg auf die anmutige Silhouette des Jefferson Memorial, des amerikanischen Pantheon, wie es von vielen genannt wurde. Direkt voraus, am Ende der Brücke, erhob sich mit unnachgiebiger, erhabener Strenge das Lincoln Memorial, dessen orthogonale Linien eine unverkennbare Reminiszenz an den Parthenon in Athen darstellten. Noch ein Stück weiter entfernt erblickte Langdon das Herzstück der Stadt – die gleiche Spitze, die er schon aus der Luft gesehen hatte. Die architektonische Inspiration dieses Monuments reichte viel weiter in die Vergangenheit als bis zu den Römern oder Griechen.
Amerikas ägyptischer Obelisk.
Direkt vor ihm ragte das hell angestrahlte monolithische Gebilde des Washington Monument in den Himmel wie der majestätische Mast eines gigantischen Schiffes. Aus Langdons schrägem Blickwinkel wirkte es wie losgelöst, schwankend vor dem düsteren Firmament wie auf unruhiger See. Langdon fühlte sich ähnlich losgelöst. Sein Besuch in Washington war vollkommen unerwartet. Als ich heute Morgen aufgewacht bin, habe ich mich auf einen ruhigen Sonntag zu Hause gefreut … und jetzt bin ich bloß ein paar Hundert Meter vom Kapitol entfernt.
Langdon hatte den Tag begonnen wie jeden anderen: Er war um Viertel vor fünf ins Wasser des einsamen Schwimmbads von Harvard gesprungen und hatte fünfzig Bahnen absolviert. Seine Kondition war nicht mehr ganz so gut wie zu seinen College-Zeiten – damals hatte er in der amerikanischen Nationalmannschaft Wasserball gespielt –, doch er war immer noch schlank und durchtrainiert und in beachtlicher Form für einen Mann Mitte vierzig. Der einzige Unterschied war der Aufwand, den er mittlerweile betreiben musste, damit es so blieb.
Gegen sechs Uhr kam Langdon nach Hause und begab sich sogleich an sein morgendliches Ritual, Sumatra-Kaffeebohnen von Hand zu mahlen. Er genoss den exotischen Duft, der sich in seiner Küche ausbreitete. An diesem Morgen jedoch stellte er zu seinem Erstaunen fest, dass das rote Licht seines Anrufbeantworters blinkte. Wer ruft an einem Sonntag um sechs Uhr morgens an? Er drückte den Abspielknopf und lauschte der gespeicherten Nachricht.
»Guten Morgen, Professor Langdon. Es tut mir schrecklich leid, Sie zu so früher Stunde zu stören.« Die höfliche Stimme des Anrufers besaß einen schwachen Südstaatenakzent und klang merklich zögernd, als der Mann fortfuhr: »Mein Name ist Anthony Jelbart. Ich bin der persönliche Assistent von Peter Solomon. Mr. Solomon hat mir verraten, dass Sie Frühaufsteher sind … er muss Sie unbedingt sprechen. Wenn Sie so freundlich wären, Mr. Solomon direkt anzurufen, sobald Sie diese Nachricht hören? Wahrscheinlich sind Sie im Besitz seiner neuen Privatnummer. Falls nicht – sie lautet 202-329-5746.«
Sorge um seinen alten Freund stieg in Langdon auf. Peter Solomon gehörte nicht zu den Leuten, die sonntags in aller Herrgottsfrühe anriefen, wenn nicht irgendetwas furchtbar schiefgegangen war.
Langdon ließ den halb fertig gemahlenen Kaffee stehen und eilte ins Arbeitszimmer, um den Rückruf zu tätigen.
Hoffentlich ist Peter nichts passiert.
Solomon war ein Freund, ein Mentor und – obwohl nur zwölf Jahre älter – seit ihrer ersten Begegnung an der Princeton University eine Vaterfigur für Langdon gewesen. Während des Studiums hatte Langdon eine abendliche Gastvorlesung des damals schon weithin bekannten jungen Historikers und Philanthropen besuchen müssen. Solomon hatte mit ansteckender Begeisterung vorgetragen und eine verblüffende Vision von Semiotik und Urgeschichte abgeliefert, die in Langdon den Funken für seine spätere lebenslange Leidenschaft für Symbole und deren verborgene Bedeutungen entzündet hatte. Doch es war nicht Peter Solomons strahlende Aura gewesen, sondern die Bescheidenheit in seinen sanften grauen Augen, die Langdon damals den Mut fassen ließ, ihm einen Dankesbrief zu schreiben. Der junge Student hätte sich nicht träumen lassen, dass Solomon, einer der faszinierendsten jungen Intellektuellen Amerikas, jemals auf seinen Brief antworten würde. Doch genau das hatte Solomon getan. Es war der Beginn einer tiefen Freundschaft gewesen.
Peter Solomon, dessen ruhiges, bescheidenes Auftreten über seine wahre Herkunft hinwegtäuschte, entstammte einem wohlhabenden Familienclan, dessen Name überall in den Vereinigten Staaten auf Bauwerken und Universitätsgebäuden zu lesen stand. Wie bei den Rothschilds in Europa war der Name Solomon von einer geheimnisvollen Aura aus Vornehmheit und Erfolg umgeben. Alter Geldadel. Peter hatte den Mantel in jungen Jahren übergestreift, nach dem frühen Tod seines Vaters. Heute, mit achtundfünfzig Jahren, hatte er zahlreiche Ämter und Funktionen inne, die ihm Macht und Einfluss bescherten. Derzeit war er Vorsitzender der Smithsonian Institution. Gelegentlich pflegte Langdon seinen Freund damit aufzuziehen, der einzige Makel in seinem ansonsten blütenreinen Lebenslauf sei das Diplom an einer zweitklassigen Universität – Yale.
Als Langdon nun sein Arbeitszimmer betrat, stellte er zu seiner Überraschung fest, dass ein Fax von Peter gekommen war:
Peter Solomon
Office of the Secretary
Smithsonian Institution
Guten Morgen Robert,
ich muss dringend mit dir reden. Bitte ruf mich schnellstmöglich unter 202-329-5746 an.
Peter
Langdon wählte die Nummer und lehnte sich gegen die Platte seines handgeschnitzten Eichentisches, während er darauf wartete, dass die Verbindung zustande kam.
»Büro von Peter Solomon«, meldete sich die vertraute Stimme des Sekretärs. »Anthony Jelbart am Apparat. Was kann ich für Sie tun?«
»Hier Robert Langdon. Sie haben mir vorhin eine Nachricht hinterlassen …«
»Ah, Professor Langdon!« Der junge Mann klang erleichtert. »Danke, dass Sie so schnell zurückrufen, Sir. Mr. Solomon muss Sie dringend sprechen. Darf ich ihm melden, dass Sie in der Leitung sind? Kann ich Sie solange in die Warteschleife legen?«
»Selbstverständlich.«
Während Langdon darauf wartete, dass Solomon an den Apparat kam, fiel sein Blick auf Peters Namen über dem Briefkopf der Smithsonian. Er musste lächeln. Es gibt nicht viele Müßiggänger im Clan der Solomons. Peters Stammbaum war gefüllt mit den Namen erfolgreicher Geschäftsleute und Politiker sowie einer Anzahl bedeutender Wissenschaftler, darunter sogar Mitglieder der Londoner Royal Society. Die einzige noch lebende direkte Angehörige, Peters jüngere Schwester Katherine, hatte offensichtlich das Wissenschaftsgen geerbt und war zu einer führenden Persönlichkeit in der neuen Disziplin aufgestiegen, die sich Noetische Wissenschaften oder kurz Noetik nannte.
Das alles kommt mir spanisch vor, dachte Langdon erheitert, als er sich an Katherines erfolglose Bemühungen erinnerte, ihm auf einer Party im Haus ihres Bruders im Jahr zuvor das Wesen der Noetik zu erklären. Langdon hatte Katherine aufmerksam zugehört und anschließend gemeint: »Das klingt eher nach Magie als nach Wissenschaft.«
Katherine hatte ihm neckisch zugezwinkert. »Magie und Wissenschaft ähneln einander mehr, als du dir vielleicht vorstellen kannst, Robert.«
Peters Sekretär war wieder in der Leitung. »Es tut mir leid, Sir, Mr. Solomon versucht gerade, sich aus einem Konferenzgespräch zu verabschieden. Hier geht es heute Morgen ein wenig chaotisch zu.«
»Kein Problem, ich kann jederzeit zurückrufen.«
»Er hat mich gebeten, Sie über den Grund seines Anrufs zu informieren, Sir, falls Sie nichts dagegen haben.«
»Selbstverständlich nicht.«
Der Assistent atmete tief durch. »Wie Sie sicherlich wissen, veranstaltet der Vorstand der Smithsonian Institution jedes Jahr eine private Gala hier in Washington, um den großzügigsten Förderern zu danken. Viele bedeutende Persönlichkeiten des Landes sind als Gäste zugegen.«
Langdons eigenes Bankkonto wies zu wenig Nullen auf, als dass er zu den bedeutenden Persönlichkeiten des Landes gehört hätte, doch er fragte sich, ob Solomon ihn trotzdem einladen wollte.
»Wie üblich soll dem Dinner auch dieses Jahr eine Grundsatzrede vorausgehen«, fuhr der Sekretär fort. »Wir hatten das Glück, uns für diesen Anlass die National Statuary Hall zu sichern.«
Der beste Saal in ganz D.C., dachte Langdon und rief sich einen politischen Vortrag ins Gedächtnis, den er in dem beeindruckenden einstigen Sitzungssaal des Repräsentantenhauses besucht hatte. Den Anblick von fünfhundert Klappstühlen, in perfektem Kreisbogen aufgestellt und umgeben von achtunddreißig lebensgroßen Statuen, vergaß man nicht so schnell.
»Das Problem ist Folgendes«, fuhr der Sekretär fort. »Unsere Rednerin ist erkrankt und hat uns eben erst informiert, dass sie ihren Vortrag nicht halten kann.« Er zögerte verlegen. »Das bedeutet, wir brauchen dringend einen Ersatzredner. Mr. Solomon hofft, dass Sie vielleicht einspringen könnten.«
Langdon blinzelte überrascht. »Ich?« Damit hatte er ganz und gar nicht gerechnet. »Ich bin sicher, Peter findet einen besseren Ersatz als mich.«
»Sie sind zu bescheiden, Sir. Sie sind Mr. Solomons erste Wahl. Die Gäste wären fasziniert, sich Ihren Vortrag anhören zu dürfen. Mr. Solomon dachte an den gleichen Vortrag, den Sie vor einigen Jahren bei Bookspan TV gehalten haben. In diesem Fall müssten Sie kaum etwas vorbereiten. Er sagt, in Ihrer Rede sei es um die Symbole in der Architektur unserer Hauptstadt gegangen – was sich für den gegebenen Anlass wie geschaffen anhört.«
Langdon war sich da nicht so sicher. »Wenn ich mich recht entsinne, hatte der Vortrag mehr mit der freimaurerischen Geschichte der Stadt zu tun …«
»Ganz recht, Sir. Wie Sie wissen, ist Mr. Solomon Freimaurer, genau wie viele seiner anwesenden Geschäftsfreunde, die sich bestimmt sehr freuen würden, Ihren Vortrag zu diesem Thema zu hören.«
Es wäre nicht allzu schwierig für mich … Langdon hatte die Unterlagen sämtlicher Vorträge aufbewahrt, die er je gehalten hatte. »Gut, ich lasse es mir durch den Kopf gehen. Wann soll die Sache stattfinden?«
Der Assistent räusperte sich und klang mit einem Mal unbehaglich. »Nun ja, Sir, da liegt das Problem. Heute Abend.«
Langdon lachte ungläubig auf. »Heute Abend?«
»Deshalb geht es bei uns heute Morgen ja so hektisch zu. Die Smithsonian Institution ist in einer peinlichen Notlage …« Der Assistent redete gehetzt weiter. »Mr. Solomon wäre bereit, einen Privatjet nach Boston zu schicken, um Sie abholen zu lassen. Der Flug dauert nur eine Stunde, und Sie wären noch vor Mitternacht wieder zu Hause. Sie kennen sich aus im privaten Terminal des Logan Airport von Boston?«
»Ja«, räumte Langdon zögernd ein. Kein Wunder, dass Peter immer seinen Willen bekommt.
»Wunderbar! Könnten Sie gegen … sagen wir, siebzehn Uhr dort sein?«
»Sie lassen mir keine große Wahl, oder?« Langdon kicherte.
»Ich möchte nur, dass Mr. Solomon rundum zufrieden ist, Sir.«
Ich weiß, ging es Langdon durch den Kopf. Peter hat diese Wirkung auf andere Menschen. Er dachte einen Augenblick nach, sah aber keinen Ausweg. »Also schön. Sagen Sie ihm, ich bin einverstanden.«
»Großartig, Sir!«, stieß der Assistent erleichtert hervor. Er nannte Langdon die Registriernummer des Jets und versorgte ihn mit einigen weiteren Informationen.
Als Langdon auflegte, fragte er sich, ob Peter Solomon jemals ein Nein zur Antwort bekommen hatte.
Er ging in die Küche zurück und gab ein paar Bohnen extra in die Kaffeemühle. Ein bisschen zusätzliches Koffein kann nicht schaden, sagte er sich. Vor mir liegt ein anstrengender Tag.
4. KAPITEL
Das U.S. Capitol Building erhebt sich majestätisch am östlichen Ende der National Mall auf einem Plateau, das der Stadtplaner Pierre L’Enfant als einen »Sockel« beschrieb, »der auf sein Monument wartet«. Das gewaltige Bauwerk misst etwa zweihundertdreißig Meter in der Länge und über einhundert Meter in der Breite. Auf einer Wohnfläche von fast fünfundsechzigtausend Quadratmetern gibt es die erstaunliche Zahl von fünfhunderteinundvierzig Zimmern. Die neoklassizistische Architektur spiegelt die Erhabenheit des alten Rom wider, dessen Ideale den amerikanischen Gründervätern Inspiration für die Formulierung der Gesetze und Maßstäbe der neuen Republik waren.
Die Sicherheitskontrollpunkte für Besucher des Kapitols befinden sich tief im Innern des im Jahre 2008 fertiggestellten unterirdischen Besucherzentrums unter einem gewaltigen Glasdach, das die Kuppel des Kapitols einzurahmen scheint.
Alfonso Nuñez, der neue Sicherheitsmann, musterte aufmerksam den männlichen Besucher, der sich dem Kontrollpunkt näherte. Der Mann mit dem kahl geschorenen Kopf hatte sich einige Zeit im Eingangsbereich aufgehalten und telefoniert. Sein rechter Arm steckte in einer Schlinge, und er humpelte. Er trug einen verschlissenen Armeemantel, was Nuñez in Verbindung mit dem rasierten Schädel zu der Annahme führte, einen Ex-Militär vor sich zu haben. Ehemalige Angehörige der Streitkräfte gehörten mit zu den häufigsten Besuchern von Washington, D.C.
»Guten Abend, Sir«, begrüßte Nuñez den Fremden gemäß den Vorschriften, nach denen jeder männliche Besucher, der das Gebäude allein betrat, direkt anzusprechen war.
»Hallo«, antwortete der Fremde mit einem flüchtigen Blick in den nahezu verlassenen Raum. »Ruhiger Abend heute.«
»Die Play-offs«, erwiderte Nuñez. »Alles sitzt vor den Flimmerkisten und schaut sich das Spiel der Redskins an.« Auch Nuñez hätte das Spiel gerne gesehen, doch es war sein erster Monat im neuen Job, und er hatte das kurze Streichholz gezogen. »Metallgegenstände bitte in die Schale, Sir.«
Unter Nuñez’ aufmerksamen Blicken kramte der Besucher umständlich mit seiner gesunden Hand in den Taschen des langen Mantels. Der menschliche Instinkt neigt zu Nachsicht gegenüber Verletzten und Behinderten, doch Nuñez war ausgebildet, diesen Instinkt zu ignorieren.
Er wartete, als der Besucher das übliche Sammelsurium von Kleingeld und Schlüsseln und zwei Mobiltelefone aus den Manteltaschen kramte. »Verstaucht?«, fragte Nuñez, wobei er die Hand des Mannes musterte, die in einen dicken elastischen Verband eingewickelt war.
Der Kahlköpfige nickte. »Bin vor einer Woche auf dem Eis ausgerutscht. Tut immer noch höllisch weh.«
»Das tut mir leid, Sir. Bitte, gehen Sie durch den Detektor.«
Als der Besucher durch den Torbogen humpelte, summte protestierend der Metalldetektor.
Der Mann runzelte die Stirn. »Das hatte ich befürchtet. Ich trage einen Ring unter dem Verband und konnte ihn nicht abziehen, weil der Finger zu dick geschwollen ist. Der Arzt hat den Verband darüber gewickelt.«
»Kein Problem«, sagte Nuñez. »Ich nehme den Handdetektor.«
Er strich mit dem Gerät über die verbundene Hand des Besuchers. Wie erwartet war das einzige Metall ein großer Klumpen am verletzten Ringfinger. Nuñez nahm sich Zeit und strich über jeden Quadratzentimeter des Verbands und der Schlinge. Er wusste, dass sein Vorgesetzter wahrscheinlich im Sicherheitszentrum saß und ihn über die Kameras beobachtete, und Nuñez brauchte den Job. Lieber Vorsicht als Nachsehen, sagte er sich. Behutsam schob er den Detektor hinauf in die Schlinge.
Der Besucher zuckte schmerzerfüllt zusammen.
»Oh, das tut mir leid, Sir.«
»Schon gut«, sagte der Besucher. »Man kann heutzutage nicht vorsichtig genug sein.«
»Wahre Worte, Sir.« Der Mann war Nuñez sympathisch. Eigenartigerweise zählte das in diesem Job eine Menge. Menschlicher Instinkt war Amerikas erste Verteidigungslinie gegen den Terrorismus. Es ist erwiesen, dass kein elektronisches Gerät ein so treffsicherer Detektor für Gefahren ist wie die menschliche Intuition – die Gabe der Angst, wie es in einem der Handbücher für Sicherheitsleute heißt.
In diesem Fall spürte Nuñez nichts, was Angst in ihm geweckt hätte. Die einzige Merkwürdigkeit, die ihm bewusst wurde – jetzt, wo er und der Besucher einander so nah gegenüberstanden –, war die Selbstbräunungscreme oder Abdeckschminke, die dieser hart aussehende Bursche im Gesicht aufgetragen hatte. Nun ja, wer läuft schon gerne leichenblass durch den Winter.
»Alles in Ordnung«, sagte Nuñez, als er mit der Überprüfung fertig war und den Detektor beiseitelegte.
»Danke.« Der Mann machte sich daran, seine Habseligkeiten aus der Schale einzusammeln.
Dabei fiel Nuñez auf, dass die zwei Finger, die unten aus dem Verband lugten, tätowiert waren: Die Kuppe des Zeigefingers wies eine Krone auf, die des Daumens einen Stern. Anscheinend hat heutzutage jeder Tattoos, dachte Nuñez, auch wenn ihm die Fingerkuppen als besonders schmerzhafte Stellen für Tätowierungen erschienen. »Hat das nicht wehgetan?«
Der Besucher blickte auf seine Hand und schmunzelte. »Weniger, als Sie wahrscheinlich glauben.«
»Glück gehabt«, sagte Nuñez. »Ich hätte schreien können vor Schmerz, als ich mir im Ausbildungslager eine Meerjungfrau auf den Rücken habe stechen lassen.«
»Eine Meerjungfrau?« Der Kahlköpfige lachte leise.
»Ja«, gestand Nuñez. »Jugendlicher Leichtsinn.«
»Oh, den kenne ich«, entgegnete der Kahlköpfige. »Auch ich habe in meiner Jugend einen Fehler gemacht. Heute wache ich jeden Morgen mit ihr auf.«
Beide lachten; dann entfernte der Besucher sich ins Innere des Gebäudes.
Ein Kinderspiel, dachte Mal’akh, als er an Nuñez vorbeiging und die Rolltreppe hinauf in Richtung Kapitol fuhr. Die Kontrollen waren leichter zu überwinden gewesen, als er angenommen hatte. Mal’akhs gekrümmte Haltung und der ausgepolsterte Bauch hatten den Sicherheitsmann über seine wahre körperliche Verfassung hinweggetäuscht, und das Make-up im Gesicht und die Verbände hatten die Tattoos verborgen, die seinen ganzen Körper bedeckten. Das wirklich Geniale jedoch war die Schlinge, die den gefährlichen Gegenstand verhüllte, den Mal’akh nun ins Gebäude schmuggelte.
Ein Geschenk – für den einen Menschen auf der Welt, der mir helfen kann, das zu finden, wonach ich suche.
5. KAPITEL
Das größte und technologisch fortgeschrittenste Museum der Welt ist zugleich eines ihrer bestgehüteten Geheimnisse. Es beherbergt mehr Ausstellungsstücke als die Eremitage, die Vatikanischen Museen und das New York Metropolitan … zusammen. Trotz dieser einzigartigen Sammlung erhält die Öffentlichkeit praktisch keinen Zutritt in die streng bewachten Mauern.
Das Museum befindet sich in der Silver Hill Road 4210, unmittelbar außerhalb von Washington, D.C. – ein gewaltiges, zickzackförmiges Gebilde aus fünf ineinander verschachtelten Magazinen, jedes einzelne größer als ein Fußballfeld. Die blau schimmernde metallene Fassade des Gebäudes verrät so gut wie nichts über das Fremdartige in seinem Innern – eine mehr als fünfzigtausend Quadratmeter große unirdische Welt, die eine »Todeszone«, ein »Feuchtbiotop« – das Präparatelager – und fast zwanzig Kilometer Lagerregale und -schränke enthält.
An diesem Abend war Katherine Solomon von innerer Unruhe erfüllt, als sie sich in ihrem weißen Volvo dem Sicherheitstor des Gebäudes näherte.
Der Wachmann lächelte. »Kein Football-Fan, Miss Solomon?« Er drehte die Lautstärke herunter. Das Vorprogramm lief; die Übertragung des eigentlichen Spiels hatte noch nicht begonnen.
Katherine zwang sich zu einem Lächeln. »Es ist Sonntagabend.«
Der Wachmann wurde ernst. »Ja, richtig. Ihr Meeting.«
»Ist er schon da?«, fragte sie nervös.
Der Wachmann warf einen Blick auf seine Liste. »Im Journal ist nichts eingetragen.«
»Ich bin früh dran.« Katherine winkte freundlich und fuhr über die gewundene Zufahrtsstraße bis zu ihrem gewohnten Platz im Untergeschoss des kleinen zweistöckigen Parkhauses. Dort sammelte sie ihre Sachen ein und warf einen raschen Blick in den Innenspiegel, um ihr Make-up zu überprüfen – mehr aus alter Gewohnheit als aus irgendeinem anderen Grund.
Katherine Solomon war mit der straffen Haut ihrer mediterranen Vorfahren gesegnet, und ihre bronzefarbenen Gesichtszüge waren trotz ihrer fünfzig Jahre noch glatt und jugendlich. Sie benutzte kaum Schminke und trug das dichte schwarze Haar lang und offen. Wie ihr älterer Bruder Peter besaß sie graue Augen und eine schlanke, patrizierhafte Eleganz.
Ihr könntet Zwillinge sein, hatten die Leute oft zu ihr und Peter gesagt.
Katherines Vater war an Krebs gestorben, als sie gerade sieben Jahre alt gewesen war, und ihre Erinnerungen an ihn waren blass und nebelhaft. Ihr Bruder, acht Jahre älter und damals kaum fünfzehn, hatte das schwere Erbe angetreten und war viel früher zum Patriarchen des Solomon-Clans herangereift, als irgendjemand sich je hätte träumen lassen. Wie nicht anders zu erwarten, war Peter mit jener Kraft und Würde in diese Rolle geschlüpft, die einem Solomon angemessen war. Außerdem wachte er bis zum heutigen Tag so aufmerksam über seine Schwester, als wären sie immer noch Kinder.
Obwohl nie ein Mangel an Bewerbern geherrscht hatte – und trotz gelegentlicher Aufmunterungen durch Peter –, hatte Katherine nie geheiratet. Die Wissenschaft war ihr Lebenspartner geworden, und ihre Arbeit hatte sich als erfüllender und faszinierender erwiesen, als ein Mann es je hätte sein können. Katherine bedauerte nichts.
Ihr gewähltes Fachgebiet, die Noetik, war so gut wie unbekannt gewesen, als sie zum ersten Mal davon gehört hatte, doch in den vergangenen Jahren hatte diese Wissenschaft neue Türen aufgestoßen und zum Verständnis der Kraft des menschlichen Geistes beigetragen.
Unser brachliegendes Potenzial ist wahrhaft atemberaubend.
Katherine hatte zwei Bücher über Noetik verfasst und sich als führende Persönlichkeit auf diesem obskuren Gebiet etabliert, doch ihre jüngsten Entdeckungen versprachen, die Noetischen Wissenschaften zu einem der wichtigsten Gesprächsthemen weltweit zu machen, sobald die Forschungsergebnisse veröffentlicht waren.
Doch an diesem Abend hatte Katherine alles andere als die Wissenschaft im Kopf. Im Lauf des Tages waren ihr höchst beunruhigende Informationen über ihren Bruder bekannt geworden. Sie hatte den ganzen Nachmittag an nichts anderes denken können.
Ich kann immer noch nicht glauben, dass es wahr ist.
Katherine nahm ihre Tasche und wollte aussteigen, als ihr Handy summte. Sie warf einen Blick auf das Display und atmete tief ein.
Dann schob sie sich die Haare aus der Stirn und nahm das Gespräch entgegen.
Zehn Kilometer entfernt bewegte Mal’akh sich durch die Flure des Kapitols, ein Mobiltelefon am Ohr, während er geduldig darauf wartete, dass am anderen Ende abgenommen wurde.
Endlich meldete sich eine Frauenstimme. »Ja?«
»Wir müssen uns wieder treffen«, sagte Mal’akh.
Eine lange Pause entstand. »Ist alles in Ordnung?«
»Ich habe neue Informationen«, sagte Mal’akh.
»Sprechen Sie.«
Mal’akh atmete durch. »Das, wovon Ihr Bruder glaubt, dass es in Washington verborgen ist …«
»Ja?«
»Es kann gefunden werden.«
Katherines Stimme klang ungläubig. »Heißt das, es ist … real?«
Mal’akh grinste in sich hinein. »Manchmal überdauert eine Legende Jahrhunderte, und sie überdauert diese lange Zeit aus einem ganz bestimmten Grund.«
6. KAPITEL
»Näher kommen Sie nicht heran?« Robert Langdon wurde nervös, als sein Fahrer in der First Street hielt, gut fünfhundert Meter vom Kapitol entfernt.
»Ich fürchte nein«, sagte der Fahrer. »Sperrgebiet. In der Nähe bekannter Bauwerke sind keine Fahrzeuge erlaubt. Tut mir leid, Sir.«
Langdon blickte auf die Uhr und stellte erstaunt fest, dass es bereits zehn vor sieben war. Eine Baustelle auf der National Mall hatte sie aufgehalten. Sein Vortrag sollte in zehn Minuten beginnen.
»Das Wetter wird schlecht«, meinte der Fahrer, stieg aus und öffnete Langdon die Tür. »Sie sollten sich beeilen.« Langdon griff nach seiner Brieftasche, doch der Mann winkte ab. »Ihr Gastgeber hat mir bereits ein großzügiges Trinkgeld auf den Fahrpreis draufgelegt.«
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!