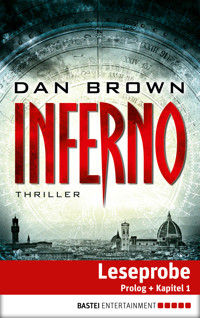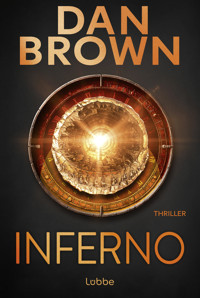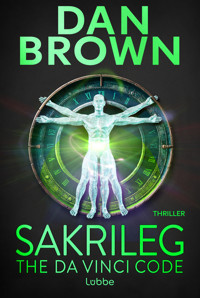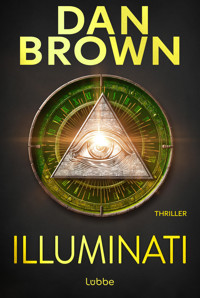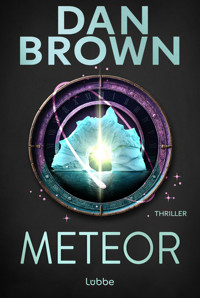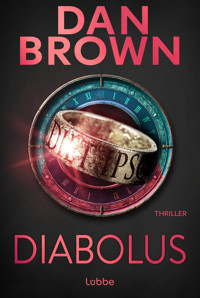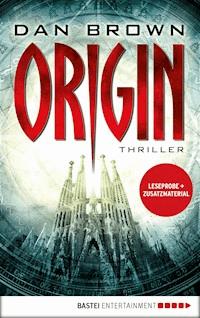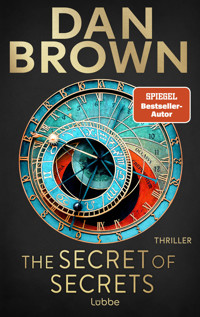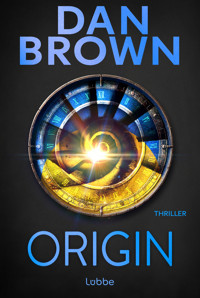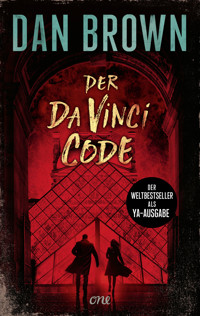
11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ONE
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Auf der Suche nach dem Da Vinci Code ...
Robert Langdon ist Symbolforscher und lehrt als Professor an der Harvard Universität in Cambridge. Als er beruflich nach Paris reist, wird er dort in einen seltsamen Fall verstrickt. Mitten in der Nacht erhält er einen Anruf, dass der Museumsdirektor des Louvre, mit dem er für diesen Abend verabredet war, ermordet wurde. Zwar bittet die Polizei Langdon um seine Unterstützung, da sich am Tatort seltsame Symbole und Zeichen befinden, allerdings ist er selbst schon mitten ins Fadenkreuz der Ermittler geraten. Zusammen mit der Verschlüsslungsexpertin Sophie Neveu entkommt er der Polizei und folgt Saunières versteckten Hinweisen, die auf eine noch viel größere Verschwörung deuten. Schon längst ist ihm nicht mehr nur die Polizei auf den Fersen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 484
Veröffentlichungsjahr: 2017
Sammlungen
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über dieses Buch
Über den Autor
Titel
Impressum
Trigger
Widmung
Liebe Leserin, lieber Leser
Fakten und Tatsachen
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
63. Kapitel
64. Kapitel
65. Kapitel
66. Kapitel
67. Kapitel
68. Kapitel
69. Kapitel
70. Kapitel
71. Kapitel
72. Kapitel
73. Kapitel
74. Kapitel
75. Kapitel
76. Kapitel
77. Kapitel
78. Kapitel
79. Kapitel
80. Kapitel
81. Kapitel
82. Kapitel
83. Kapitel
Epilog
Danksagung
Tafelteil
Bildrechte
Inhaltsinformation
Über das Buch
Auf der Suche nach dem Da Vinci Code ... Robert Langdon ist Symbolforscher und lehrt als Professor an der Harvard Universität in London. Als er beruflich nach Paris reist, wird er dort in einen seltsamen Fall verstrickt. Mitten in der Nacht erhält er einen Anruf, dass der Museumsdirektor des Louvre, mit dem er für diesen Abend verabredet war, ermordet wurde. Zwar bittet die Polizei Langdon um seine Unterstützung, da sich am Tatort seltsame Symbole und Zeichen befinden, allerdings ist er selbst schon mitten ins Fadenkreuz der Ermittler geraten. Zusammen mit der Verschlüsslungsexpertin Sophie Neveu entkommt er der Polizei und folgt Saunières versteckten Hinweisen, die auf eine noch viel größere Verschwörung deuten. Schon längst ist ihm nicht mehr nur die Polizei auf den Fersen ... Der Megabesteller SAKRILEG – THE DA VINCI CODE ist immer noch Dan Browns erfolgreichster Roman im deutschsprachigen Raum mit einer Gesamtauflage von 18 Millionen Exemplaren. Der zugehörige Blockbuster lockte 2006 Millionen Menschen in die deutschen Kinos. Zusammen mit Illuminati spielten die beiden Filme weltweit insgesamt 1,2 Milliarden US Dollar ein. Es ist an der Zeit, der nächsten Generation den Roman näherzubringen, den die New York Times zu Recht als »blockbuster perfection« betitelte.
Über den Autor
Dan Brown ist Autor zahlreicher Thriller, die allesamt über Monate die Bestsellerlisten angeführt haben und darüber hinaus erfolgreich verfilmt wurden. Mit seinem in über 40 Ländern erschienenen und mit Tom Hanks in der Hauptrolle verfilmten Buch Sakrileg (Originaltitel: The Da Vinci Code) wurde er zu einem der erfolgreichsten Schriftsteller der letzten Jahrzehnte. Dan Browns Thriller werden in 54 Sprachen übersetzt. Nach solch erfolgreichen Auflagen ließen auch die Verfilmungen der Robert Langdon Thriller nicht lange auf sich warten.
Dan Brown wurde 1964 in Exeter, New Hampshire (USA) geboren. Als Sohn eines Mathematikprofessors und einer Kirchenmusikerin wuchs er in einem Umfeld heran, in dem Religion und Wissenschaft Hand in Hand gingen, was sich auch in seinen Thrillern wiederspiegelt. Nach dem Besuch der Privatschule, an der auch sein Vater unterrichtete, studierte Dan Brown Englisch und Spanisch am Amherst College in Massachusetts (USA) und später Kunstgeschichte in Sevilla.
Im Anschluss an seinen Hochschulabschluss brachte er sich das Komponieren bei und startete seine Karriere als Sänger und Liedermacher. Zunächst komponierte er Kinderlieder und später Musik für Erwachsene. In dieser Zeit lernte er auch seine Frau Blythe kennen. Nachdem er der Musik den Rücken gekehrt hatte, arbeitete Dan Brown als Englisch- und Spanischlehrer.
Ab Mitte der 1990er widmete er sich schließlich vermehrt dem Scheiben und veröffentlichte einige Bücher, die er gemeinsam mit seiner Frau bewarb. Der Erfolg seiner Werke trat aber erst ab 2003 mit dem Roman The Da Vinci Code (Doubleday Group) ein, der über zwei Jahre den ersten Platz der New York Times Bestseller-Liste belegte. Das Buch sorgte weltweit für Furore und wurde aufgrund der kritischen Inhalte im Hinblick auf die katholische Kirche in einigen Ländern verboten.
Im Jahr 2004 erklommen seine beiden Titel Sakrileg und Illuminati auch die Bestseller-Listen in Deutschland und wurden zu den Jahresbestsellern in der Kategorie Hardcover und Taschenbuch. Mit seiner Robert Langdon Buchreihe, die durch ihre Mischung aus Action, Wissenschaft und Geschichte besticht, beherrscht er seither die internationalen Bestsellerlisten.
Dan Brown lebt mit seiner Frau, einer Kunsthistorikerin, in Neuengland.
Dan Brown
DERDA VINCICODE
Aus dem Amerikanischenvon Piet van Poll
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Gekürzte Jugendbuchausgabe
der bei Bastei Lübbe erschienenen Ausgabe »Sakrileg – The Da Vinci Code«
Übersetzung aus dem Amerikanischen von Piet van Poll
Titel der englischsprachigen Originalausgabe:
»The Da Vinci Code«
Copyright © 2003 by Dan Brown
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2017/2025 by Bastei Lübbe AG, Schanzenstraße 6–20, 51063 Köln, Deutschland
Vervielfältigungen dieses Werkes für das Text- und Data-Mining bleiben vorbehalten.
Die Verwendung des Werkes oder Teilen davon zum Training künstlicher Intelligenz-Technologien oder -Systeme ist untersagt.
Covergestaltung: © Johannes Wiebel | punchdesign unter Verwendung von Motiven von stock.adobe.com
eBook-Erstellung: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-7325-4933-7
Sie finden uns im Internet unter one-verlag.de
Bitte beachten Sie auch luebbe.de
Trigger
Liebe Leser:innen,
dieses Buch enthält potenziell triggernde Inhalte. Dazu findet ihr genauere Angaben am Ende des Buches. ACHTUNG: Sie enthalten Spoiler für das gesamte Buch. Wir wünschen uns für euch alle das bestmögliche Leseerlebnis.
Euer Team vom ONE-Verlag
Für Blythe … wieder einmal und mehr denn je.
Liebe Leserin, lieber Leser,
ich habe schon immer Geheimnisse und Codes geliebt.
Es hat etwas Magisches an sich, wenn man plötzlich entdeckt, was dahintersteckt, und man die Lösung vor Augen hat.
Als ich zehn Jahre alt war, bin ich auf meinen ersten Code gestoßen. Dabei handelte es sich um eine Reihe von seltsamen Symbolen, die jemand in einer krakeligen Handschrift auf ein Stück Papier geschrieben hatte, das an unserem Weihnachtsbaum hing. Als ich die Symbole schließlich entschlüsselt hatte, entdeckte ich, dass es eine Nachricht von meinen Eltern an mich war. Sie besagte, dass wir in wenigen Stunden zu einem Überraschungsausflug aufbrechen würden.
Seit jenem Morgen faszinieren mich Codes – geheimnisvolle Botschaften, die man erst entschlüsseln muss, bevor man sie verstehen kann. Ich habe mein Leben damit zugebracht, diese kryptische Welt zu erforschen, und vor ein paar Jahren traf ich auf den seltsamsten Code, den ich je gesehen hatte. Der Code war uralt und … verwirrend. Und das Beste daran war, dass er die ganze Zeit vor aller Leute Nasen hing.
Der Legende zufolge hütete er ein unfassbares Geheimnis. Manche sagten, dass das Geheimnis so schockierend sei, dass, wenn man die Wahrheit wüsste, man die Welt für immer in einem anderen Licht sähe. Andere wiederum behaupteten, dass dieses Geheimnis nur ein Mythos sei … nichts als leere Worte.
Egal auf wessen Seite du stehst, das Buch in deinen Händen erzählt die Geschichte eines Mannes und einer Frau, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, diesen Code zu entschlüsseln und die Wahrheit ans Licht zu bringen. Ob du sie nun glaubst oder nicht: Ich hoffe, die bevorstehende Reise inspiriert dich dazu, nach deiner eigenen Wahrheit zu suchen, wie auch immer sie aussehen mag.
Ohne Wachs und Siegel,
Dan Brown
FAKTEN UND TATSACHEN
Die Prieuré de Sion, der Orden der Bruderschaft von Sion, wurde im Jahr 1099 gegründet und ist eine Geheimgesellschaft, die bis heute existiert. Im Jahr 1975 wurden in der Pariser Nationalbibliothek Dokumente entdeckt, die unter der Bezeichnung Dossiers Secrets bekannt geworden sind und aus denen hervorgeht, dass eine Reihe berühmter Männer der Prieuré angehörten, darunter der Wissenschaftler Sir Isaac Newton, der Künstler Sandro Botticelli, der Schriftsteller Victor Hugo und der Künstler und Erfinder Leonardo da Vinci.
Opus Dei gilt als ultrakonservative katholische Sekte. Die Organisation ist in jüngster Zeit durch Medienberichte über Gehirnwäsche, Zwangsausübung und die gesundheitsgefährdende Praxis der Selbstkasteiung ins Zentrum kontroverser Diskussionen geraten. An der 243 Lexington Avenue in New York City hat Opus Dei unlängst eine siebenundvierzig Millionen Dollar teure US-amerikanische Zentrale eröffnet.
Sämtliche in diesem Roman erwähnten Werke der Kunst und Architektur und alle Dokumente sind wirklichkeits- bzw. wahrheitsgetreu wiedergegeben.
PROLOG
Der Louvre, Paris
22.46 Uhr
In der Grande Galerie stürzte Jacques Saunière, der Museumsdirektor, zu einem der kostbaren alten Meister, einem Caravaggio, klammerte sich an den schweren Goldrahmen und hängte sich mit seinem ganzen Gewicht daran, bis sich das Gemälde aus dem siebzehnten Jahrhundert von seiner Aufhängung löste. Die Leinwand beulte sich aus, als sie den rückwärts fallenden siebenundsechzigjährigen Gelehrten unter sich begrub.
Augenblicke später fuhr ganz in der Nähe mit dröhnendem Krachen das stählerne Sicherheits-Trenngitter herunter. Der Parkettboden bebte unter der Wucht des Aufpralls. Irgendwo in der Ferne schrillte eine Alarmglocke.
Saunière rang keuchend nach Atem. Wenigstens bist du noch am Leben … Er kroch unter der Leinwand hervor, ließ den Blick schweifen, suchte in der höhlenartigen Galerie nach einem Versteck …
»Bleiben Sie, wo Sie sind!« Die Stimme war eiskalt und erschreckend nahe.
Der Direktor hielt inne und drehte langsam den Kopf. Noch immer kauerte er auf allen vieren am Boden.
Keine fünf Meter entfernt spähte sein Angreifer durch die stählernen Gitterstäbe zu ihm hinein, ein Hüne mit gespenstisch blasser Haut, schütterem weißen Haar, rosa Augen und dunkelroten Pupillen. Er zog eine Pistole aus der Manteltasche. Der Albino richtete die Waffe durch die Gitterstäbe auf den Direktor. »Sie hätten nicht wegrennen dürfen«, sagte er. Sein Akzent war schwer einzuordnen. »Sagen Sie mir jetzt, wo es ist.«
»Ich … ich habe Ihnen doch schon gesagt, dass ich nicht weiß, wovon Sie reden!«, stieß der Direktor hervor, der hilflos auf dem Boden kniete, dem Fremden schutzlos ausgeliefert.
»Sie lügen!« Der Mann starrte Saunière an. Er stand völlig unbewegt da. In seinen Augen loderte ein gefährliches Feuer. »Sie und Ihre Bruderschaft besitzen etwas, das Ihnen nicht gehört.«
Dem Direktor brach der Schweiß aus. Wie kann der Mann das wissen?
»Heute Nacht werden die wahren Wächter wieder ihr Amt übernehmen. Sagen Sie mir, wo es versteckt ist, wenn Sie am Leben bleiben wollen.« Der Albino legte auf Saunière an. »Lohnt es sich, für dieses Geheimnis zu sterben?«
Saunière stockte der Atem.
Den Kopf schief gelegt visierte der Mann über den Lauf seiner Waffe.
Saunière hob abwehrend die Hände. »Warten Sie …«, sagte er zögernd. »Ich werde Ihnen verraten, was Sie wissen wollen.« Die nächsten Sätze des Direktors waren bedächtig und wohl formuliert. Das Lügenkonstrukt, das er nun ausbreitete, hatte er immer wieder eingeübt – und jedes Mal gebetet, nie Gebrauch davon machen zu müssen.
Der Mann quittierte die Geschichte mit einem zufriedenen Lächeln. »Genau das haben die anderen mir auch erzählt.«
Saunière zuckte zusammen. Die anderen?
»Ich habe sie alle aufgespürt«, sagte der hünenhafte Fremde selbstgefällig. »Alle drei. Sie haben mir bestätigt, was Sie mir gerade erzählt haben.«
Unmöglich! Die wahre Identität des Museumsdirektors und seiner drei Seneschalle wurde nicht weniger streng geheim gehalten als das uralte Geheimnis, das sie hüteten. In strikter Befolgung des verabredeten Protokolls hatten die Seneschalle vor ihrem gewaltsamen Tod die gleiche Lüge aufgetischt.
»Wenn Sie tot sind, werde ich als Einziger die Wahrheit kennen«, sagte der Albino und richtete die Pistole auf Saunières Kopf.
Die Wahrheit. Schlagartig begriff der Direktor, wie schrecklich verfahren die Situation wirklich war. Wenn du stirbst, ist die Wahrheit für immer verloren. Instinktiv versuchte er, sich in Sicherheit zu bringen.
Die Waffe dröhnte. Der Museumsdirektor spürte eine sengende Hitze in der Magengegend, als die Kugel ihn traf. Der Schmerz riss ihn von den Füßen. Er fiel vornüber. Langsam rollte er sich auf die Seite. Sein Blick suchte den Angreifer außerhalb der Gitters.
Der Mann legte auf Saunières Kopf an.
Saunière schloss die Augen. In seinem Hirn tobte ein Wirbelsturm aus Angst und Reue, Trauer und Bitterkeit.
Ein metallisches Klicken hallte durch die Grande Galerie, als das Magazin leer geschossen war. Saunière riss die Augen auf.
Der Hüne betrachtete die Waffe mit einem beinahe erheiterten Blick. Er wollte ein neues Magazin aus der Manteltasche ziehen, zögerte aber plötzlich. »Nein«, sagte er mit einem höhnischen Blick auf die Magengegend seines Opfers. »Ich glaube, ich bin hier fertig.«
Saunière sah an sich herunter. Eine Handbreit unter dem Brustbein hatte das Projektil ein Loch in seine blütenweiße Hemdbrust gestanzt, dessen Ränder sich rasch rot verfärbten. Der Magen. Grausamerweise hatte die Kugel das Herz verfehlt. Aus seiner Zeit als Soldat im Krieg wusste er, dass er noch fünfzehn Minuten zu leben hatte.
»Meine Arbeit hier ist getan«, sagte der hünenhafte Albino.
Dann war er verschwunden.
Jacques Saunière betrachtete das Stahlgitter. Er saß in der Falle. Es war unmöglich, das Gitter innerhalb der nächsten zwanzig Minuten zu öffnen. Bis jemand hereinkommen konnte, war er längst tot. Gleichwohl bedrängte ihn eine weitaus größere Angst als die vor dem eigenen Ende.
Du darfst nicht zulassen, dass das Geheimnis verloren geht!
Er mobilisierte das letzte bisschen Kraft, das ihm blieb, um aufzustehen. Währenddessen hielt er sich das Bild seiner ermordeten Mitbrüder vor Augen. Er dachte an die vielen Generationen, die ihnen vorangegangen waren … und an die ihnen anvertraute Sendung.
Eine lückenlose Kette des Wissens.
Trotz aller Vorkehrungen, trotz aller Vorsichtsmaßnahmen war Jacques Saunière unvermutet zum letzten Glied der Kette geworden, der letzte Wahrer eines der mächtigsten Geheimnisse, die es je gegeben hat.
Er schauderte. Du musst dir etwas einfallen lassen.
Es gab nur einen Menschen auf der Welt, an den er die Fackel weiterreichen konnte, während er hier in der Grande Galerie in der Falle saß. Saunière betrachtete die Wände seines prächtigen Gefängnisses. Die weltberühmten Gemälde schienen auf ihn herabzulächeln wie alte Freunde.
In einem immer dichteren Nebel aus Schmerz mobilisierte er die letzten Kräfte. Die schwierige Aufgabe, die vor ihm lag, würde jede Sekunde der wenigen Zeit beanspruchen, die ihm noch blieb.
1. KAPITEL
Robert Langdon erwachte nur langsam.
Ein Telefon klingelte schrill. Im Dunkeln tastete Langdon nach dem Schalter der Nachttischlampe. Das Licht flammte auf. Blinzelnd ließ er den Blick durch das herrschaftliche Schlafzimmer aus dem achtzehnten Jahrhundert schweifen, über die antiken Möbel, das mächtige Mahagoni-Himmelbett und das handgemalte Fresko an der Wand.
Wo bist du?
Am Bettpfosten hing ein Jacquard-Bademantel mit der Aufschrift Hotel Ritz, Paris.
Langsam lichtete sich der Nebel um Langdons Hirn.
Langdon hob den Hörer ab. »Hallo?«
»Monsieur Langdon?«, sagte eine männliche Stimme. »Ich habe Sie hoffentlich nicht geweckt?«
Langdon schaute benommen auf die Uhr neben dem Bett. Zweiunddreißig Minuten nach zwölf. Er hatte erst eine Stunde geschlafen und war todmüde.
»Hier ist die Rezeption. Ich bedaure die Störung, Monsieur, aber Sie haben Besuch. Der Herr sagt, es sei äußerst dringend.«
Langdon war immer noch nicht richtig wach. Besuch?
Sein Blick fiel auf ein zerknittertes Blatt Papier mit einer Programmankündigung auf dem Nachttisch.
DIE AMERIKANISCHE UNIVERSITÄT IN PARIS
lädt ein zu einem Vortragsabend mit
PROFESSOR ROBERT LANGDON
Dozent für religiöse Symbolologie
an der Harvard-Universität
Langdon stöhnte auf. Sein heutiger Diavortrag über heidnisches Symbolgut in den Steinmetzarbeiten der Kathedrale von Chartres war ein paar konservativen Geistern offenbar gegen den Strich gegangen. Vermutlich hatten sie ihn ausfindig gemacht und wollten ihm jetzt zeigen, was eine Harke ist.
»Tut mir leid«, sagte Langdon, »ich bin todmüde …«
»Gewiss, Monsieur«, sagte der Mann am Empfang, um dann in beschwörendem Flüsterton fortzufahren: »Aber bei Ihrem Besucher handelt es sich um eine wichtige Persönlichkeit! Außerdem befindet sie sich bereits auf dem Weg zu Ihrem Zimmer.«
Langdon war auf einen Schlag hellwach. »Sie haben den Herrn zu meinem Zimmer geschickt?«
»Ich bitte um Entschuldigung, Monsieur, aber der Herr … Meine Befugnisse reichen nicht so weit, dass ich ihn aufhalten könnte.«
»Um wen handelt es sich denn?«
Doch der Mann am Empfang hatte bereits aufgelegt.
Beinahe im gleichen Augenblick pochte eine Faust an Langdons Tür.
Langdon rutschte aus dem Bett. Seine Zehen versanken in der Tiefe des Bettvorlegers. Er warf den Hotelbademantel über und ging zur Tür. »Wer ist da?«
»Monsieur Langdon, ich muss mit Ihnen reden!« Der Mann sprach Englisch mit ausgeprägtem Akzent. Seine Stimme war laut, abgehackt und befehlsgewohnt. »Ich bin Leutnant Jérome Collet, Direction Centrale Police Judiciaire.«
Langdon schluckte. Die Staatspolizei? Was konnte das DCPJ, das in etwa dem amerikanischen FBI entsprach, um diese Uhrzeit von ihm wollen?
Langdon öffnete die Tür einen Spalt, ließ die Kette aber vorgelegt. Er sah ein schmales, ausgezehrtes Gesicht. Es gehörte einem ungewöhnlich hageren Mann in einer amtlich aussehenden blauen Uniform.
»Lassen Sie mich bitte eintreten!«
Langdon zögerte. »Worum geht es?«
»Mein Capitaine wünscht in einer Privatangelegenheit Ihren fachlichen Rat einzuholen.«
»Jetzt?«, wandte Langdon müde ein. »Es ist schon nach Mitternacht!«
»Bin ich recht informiert, dass Sie mit dem Direktor des Louvre heute Abend eine Verabredung hatten?«
Langdon fühlte sich plötzlich sehr unbehaglich. Er war nach dem Vortrag mit dem hoch geachteten Museumsdirektor Jacques Saunière auf einen Drink verabredet gewesen, doch Saunière war nicht erschienen. »Ja, das stimmt. Woher wissen Sie das?«
»Wir haben Ihren Namen in seinem Terminkalender gefunden.«
»Ist ihm etwas zugestoßen?«
Mit einem Unheil verkündenden Seufzer schob der Beamte einen Polaroid-Schnappschuss durch den Türspalt. Als Langdons Blick auf das Foto fiel, erstarrte er.
»Dieses Bild wurde vor knapp einer Stunde aufgenommen. Im Louvre.«
Langdon betrachtete das erschreckende, bizarre Foto. Sein anfänglicher Schock und der Ekel wichen einem jäh aufwallenden Zorn. »Wer ist zu so einer Scheußlichkeit fähig?«
»Wir haben gehofft, Sie könnten uns bei der Beantwortung dieser Frage helfen, zumal Sie sich mit Symbolen bestens auskennen und mit Saunière verabredet waren.«
Langdon konnte den Blick nicht von dem Foto wenden. Zu seinem Entsetzen gesellte sich panische Angst.
»Dieses Symbol hier und die Haltung der Leiche, diese merkwürdige …«
»Verrenkung?«, vollendete der Beamte den Satz.
Langdon nickte und hob den Blick. Er fröstelte. »Ich kann mir nicht vorstellen, wie jemand einem anderen Menschen so etwas antun kann.«
Der Beamte schaute Langdon finster an. »Monsieur Langdon, Sie haben noch immer nicht begriffen. Was Sie hier sehen«, er zögerte und deutete auf das Foto, »ist das Werk von Monsieur Saunière selbst.«
2. KAPITEL
Knapp zwei Kilometer entfernt humpelte der riesenhafte Albino mit Namen Silas durch die Eingangstür eines luxuriösen Sandsteingebäudes in der Rue La Bruyère. Die Stachel des Bußgürtels, den er um den Oberschenkel trug, bohrten sich in sein Fleisch, doch seine Seele jubelte vor freudiger Genugtuung, weil er dem HERRN dienen durfte.
Leise stieg Silas die Treppe hinauf, um keinen der Mitbewohner zu wecken. Seine Zimmertür war unverschlossen – Schlösser waren hier verpönt. Er betrat sein Zimmer und schob die Tür hinter sich wieder zu.
Der Raum war spartanisch eingerichtet: Parkettboden, eine schlichte Kommode aus Fichtenholz, in einer Ecke eine Segeltuchmatte als Liegestatt. Silas war diese Woche hier zu Gast, doch in New York hatte er lange Jahre mit Freuden in einer ähnlichen Unterkunft gehaust.
Der HERR hat dir Unterschlupf gewährt und deinem Leben einen Sinn gegeben.
Heute Nacht konnte Silas endlich damit beginnen, seine Schuld abzutragen. Er zog die Schubfächer der Kommode auf. In der untersten Schublade fand er das Handy, unter ein paar Kleidungsstücken versteckt, und wählte die Nummer.
»Ja?«, meldete sich eine männliche Stimme.
»Verehrter Lehrer, ich bin wieder zurück.«
»Reden Sie«, forderte die Stimme ihn auf – nicht ohne einen zufriedenen Unterton, dass Silas sich gemeldet hatte.
»Sie sind alle vier beseitigt. Die drei Seneschalle und der Großmeister.«
Eine kurze Pause entstand, als würde der Angerufene ein Stoßgebet zum Himmel schicken. »Dann gehe ich davon aus, dass Sie die Information bekommen haben.«
Silas wusste, dass die Information, die er seinen Opfern entlockt hatte, wie ein Schock wirken würde. »Alle vier haben mir die Existenz des clef de voûte bestätigt, des legendären Schlusssteins.« Silas hörte, wie der Lehrer nach Luft schnappte. Er spürte förmlich seine Erregung.
»Der Schlussstein.«
Nach der Überlieferung hatte die Bruderschaft eine Art steinerne Landkarte geschaffen – einen clef de voûte, einen Stein mit dem eingravierten Wegweiser zum größten Geheimnis der Bruderschaft, ein Geheimnis von solcher Brisanz, dass die Bruderschaft überhaupt nur zu seinem Schutz existierte.
»Wenn wir uns in den Besitz dieses Steins gebracht haben«, sagte der Lehrer, »brauchen wir nur noch den letzten Schritt zu tun.«
»Wir sind dem näher, als Sie denken. Der Stein liegt hier in Paris.«
»In Paris?«
Silas berichtete dem Lehrer, was an diesem Abend geschehen war … wie alle vier Opfer wenige Augenblicke vor ihrem Tod das Geheimnis ausgeplaudert hatten, um ihr gottloses Leben zu retten. Alle hatten Silas genau das Gleiche erzählt: dass der Stein an einem bestimmten Ort in einer alten Pariser Kirche versteckt sei, der Église de Saint-Sulpice.
»Auch noch in einem Gotteshaus!«, empörte sich der Lehrer. »Sie treiben ihre Scherze mit uns.«
»Wie seit Jahrhunderten schon.«
Der Lehrer verfiel in Schweigen. Er schien den Triumph des Augenblicks bis zur Neige auskosten zu wollen. »Sie haben Gott einen großen Dienst erwiesen«, sagte er schließlich. »Wir haben Jahrhunderte auf diesen Augenblick gewartet. Sie müssen mir sofort den Stein herbeischaffen. Noch heute Nacht. Sie wissen, was auf dem Spiel steht.«
Das wusste Silas nur zu gut, doch was der Lehrer jetzt von ihm verlangte, war schlichtweg unmöglich. »Aber die Kirche ist wie eine Festung, zumal bei Nacht. Wie soll ich da hineinkommen?«
Mit der zuversichtlichen Stimme eines Mannes, der sich in einflussreichsten Kreisen bewegt, erklärte der Lehrer das weitere Vorgehen.
3. KAPITEL
Die frische Luft des April pfiff durch das offene Seitenfenster des Polizeiwagens, der mit Robert Langdon auf dem Beifahrersitz durch Paris raste. Langdon versuchte, seine Gedanken zu ordnen. Eine kurze Dusche und eine schnelle Rasur hatten einen halbwegs vorzeigbaren Menschen aus ihm gemacht, aber wenig dazu beigetragen, seine ängstliche Unruhe zu dämpfen. Das grässliche Bild der Leiche des Museumsdirektors hatte sich in sein Gehirn eingebrannt.
Jacques Saunière … tot!
Langdon empfand den Tod des Museumsdirektors als schweren Verlust. Saunière galt zwar als Einzelgänger, doch als anerkannter Gelehrter und Liebhaber der Kunst konnte er sich über mangelnde Ehrungen nicht beklagen. Langdon hatte sich sehr darauf gefreut, ihn zu treffen.
Draußen legte sich allmählich der Trubel der Stadt. Fliegende Händler schoben ihre Verkaufswagen nach Hause, Kellner schafften volle Müllsäcke an den Straßenrand, ein Liebespaar hielt sich eng umschlungen, um im Nachtwind, der nach Jasmin duftete, nicht zu frösteln. Der Citroën fuhr mit hoher Geschwindigkeit sicher durch das Gewühl, das sich vor dem schrillen Zweiklanghorn spaltete wie Butter unter einem heißen Messer.
»Le Capitaine hat mit Zufriedenheit festgestellt, dass Sie noch in Paris sind«, sagte der Beamte und jagte die Limousine mit Vollgas durch den nördlichen Eingang der berühmten Tuileriengärten. Langdon hatte die Tuilerien immer für geheiligten Boden gehalten – hatte nicht der Künstler Claude Monet in diesen Gärten als Geburtshelfer des Impressionismus mit Form und Farbe experimentiert?
Der Citroën bog nach links in die Hauptallee auf der Zentralachse der Parkanlage ein. Nachdem der Fahrer um einen großen Brunnen gekurvt war, steuerte er den Wagen nach Überquerung einer breiten, verlassenen Avenue auf einen weitläufigen rechteckigen Platz. Langdon erkannte den großen steinernen Torbogen, der das Ende der Tuilerien bildete.
Der Arc du Carrousel.
Dieser Platz wurde von Kunstkennern aus einem ganz besonderen Grund geschätzt: Von der Esplanade am Ende der Tuilerien hatte man einen Blick auf vier der großartigsten Museen der Welt, je eines in jeder Himmelsrichtung.
Zum rechten Seitenfenster hinaus sah Langdon im Süden jenseits der Seine am Quai Anatole France die dramatisch beleuchtete Fassade eines ehemaligen Bahnhofs, der heute das berühmte Musée d’Orsay beherbergte. Wenn er sich nach links wandte, konnte er die ultramoderne Dachpartie des Centre Pompidou erkennen, in dem das Museum für Moderne Kunst untergebracht war. Hinter ihm im Westen ragte der berühmte Obelisk des Ramses über die Wipfel der Bäume und bezeichnete den Standort des Musée de Jeu de Paume.
Und genau vor sich erblickte Langdon jetzt durch den Torbogen hindurch den klotzigen Renaissancepalast, der die Heimstätte der berühmtesten Gemäldegalerie der Welt geworden war.
Der Louvre.
Auf der gegenüberliegenden Seite eines Platzes von atemberaubenden Ausmaßen ragte die imposante Fassade des Museums wie ein Bollwerk in den Pariser Nachthimmel. Der Louvre mit seinem Grundriss eines gigantischen Hufeisens war das längste Gebäude Europas und erstreckte sich über eine größere Länge als drei aneinander gelegte Eiffeltürme. Nicht einmal die Tausende von Quadratmetern messenden Freiflächen zwischen den Museumsflügeln konnten die Wucht der Fassade beeinträchtigen. Langdon hatte einmal einen Spaziergang um den Louvre unternommen. Es war ein Fußmarsch von knapp fünf Kilometern geworden.
Um sämtliche 65300 Ausstellungsstücke des Louvre gebührend zu bewundern, brauchte der Besucher angeblich fünf Tage, doch die meisten Touristen wählten ein abgekürztes Verfahren, das Langdon als »Louvre light« zu bezeichnen pflegte. Dabei wurden die drei berühmtesten Stücke des Museums im Schweinsgalopp abgeklappert: allen voran das Ölgemälde der Mona Lisa, sowie die Marmorskulpturen Venus von Milo und die geflügelte Nike von Samothrake.
Der Fahrer zog ein kleines Sprechfunkgerät heraus und rief zwei knappe Sätze auf Französisch hinein. »Monsieur Langdon est arrivé. Deux minutes.«
Er wandte sich an Langdon. »Der Capitaine erwartet Sie am Haupteingang.«
Dann gab der Fahrer Gas und jagte den Citroën über den Bordstein auf den großen Platz. Der Haupteingang des Louvre kam in Sicht.
La Pyramide.
Der neue Eingang des Pariser Louvre war inzwischen fast schon berühmter als das Museum selbst. Doch die knapp 22 Meter hohe, modernistische Glaspyramide des chinesischstämmigen amerikanischen Architekten Ieoh Ming Pei war auch höchst umstritten.
»Wie gefällt Ihnen unsere Pyramide?«, wollte der Beamte wissen.
Langdon zog die Stirn kraus. Die Franzosen schienen Freude daran zu haben, Amerikanern mit dieser Frage zu Leibe zu rücken. Es war natürlich eine Fangfrage. Gab man zu, dass einem die Pyramide gefiel, stempelte man sich zum geschmacklosen Amerikaner ab, lehnte man die Pyramide ab, hatte man etwas gegen die Franzosen.
»Mitterand hat Mut bewiesen«, meinte Langdon diplomatisch. Der verstorbene französische Staatspräsident, der den Auftrag zum Bau der Glaspyramide erteilt hatte, hatte angeblich unter einem »Pharaonenkomplex« gelitten, weil er Paris mit ägyptischen Obelisken, Kunstwerken und Artefakten vollgestellt hatte.
»Wie heißt Ihr Captain eigentlich?«, erkundigte sich Langdon, um das Thema zu wechseln.
»Bezu Fache«, gab der Fahrer Auskunft, während er auf die Eingangspyramide zusteuerte. »Wir nennen ihn le Taureau.«
Langdon sah zu ihm hinüber. »Der Bulle?«
Der Mann hob die Brauen. »Ihr Französisch ist besser, als Sie zugeben, Monsieur Langdon.«
Mein Französisch ist das Letzte, dachte Langdon, dafür kenne ich die Tierkreiszeichen umso besser. Taurus war immer schon – und auf der ganzen Welt – das astrologische Zeichen für den Stier.
Der Beamte bremste ziemlich abrupt und deutete zwischen zwei Fontänen hindurch auf eine große Drehtür in der Seite der Glaspyramide.
»Ich habe den Befehl, Sie hier abzusetzen. Auf mich warten andere Aufgaben.«
Langdon stieg mit einem Seufzer aus dem Wagen.
Der Beamte trat aufs Gas und jagte davon. Langdon schritt auf den Haupteingang zu. Im schwach beleuchteten Foyer dahinter war keine Menschenseele zu sehen.
Ob man hier anklopfen muss?
Langdon fragte sich, ob einer seiner geschätzten Harvardkollegen aus dem Fachbereich Ägyptologie jemals an einer Pyramide angeklopft hatte, in der Hoffnung, dass jemand herauskam. Als er die Hand hob, um gegen das Glas zu pochen, kam eine Gestalt aus der Dunkelheit die geschwungene Treppe heraufgeeilt, ein untersetzter dunkelhaariger Mann, dessen dunkler Zweireiher sich über den breiten Schultern spannte. Er winkte Langdon herein.
»Bezu Fache«, stellte er sich vor, als Langdon durch die Drehtür trat, »Capitaine der Direction Centrale Police Judiciaire.« Die Stimme passte zu dem Mann – ein tiefes, kehliges Grollen, das sich wie ein aufziehendes Unwetter anhörte.
Langdon hielt ihm grüßend die Hand entgegen. »Robert Langdon.«
Seine Hand verschwand in Faches Pranke wie in einer hydraulischen Presse.
»Mr Langdon«, der Captain sah ihn mit seinen ebenholzschwarzen Augen an. »Kommen Sie.«
4. KAPITEL
Captain Bezu Fache gefiel sich in der Haltung eines gereizten Stiers – breites Kreuz mit weit zurückgenommenen Schultern, das Kinn in Angriffshaltung auf die Brust gedrückt.
Langdon folgte dem Captain über die berühmte Marmortreppe ins Untergeschoss unter der Glaspyramide. Auf halber Höhe der Treppe standen zwei mit Maschinenpistolen bewaffnete Beamte Wache. Die Botschaft war eindeutig: Ohne Captain Faches Segen kam hier niemand hinein oder hinaus.
Langdon kämpfte gegen ein wachsendes Unbehagen. Faches Verhalten war alles andere als einladend, und der Louvre hatte um diese Tages- oder besser Nachtzeit die verlockende Aura einer Gruft. Der Treppenabgang wurde von den Trittleuchten, die in die Stufen eingelassen waren, nur notdürftig erhellt. Langdon hörte das Echo seiner Schritte von den schrägen Scheiben widerhallen. Beim Blick nach oben konnte er feine, lichtdurchwirkte Wasserschleier an der transparenten Dachkonstruktion vorüberwehen sehen.
»Was halten Sie davon?«, wollte Fache wissen und wies mit dem Kinn nach oben.
Langdon seufzte. Für Spielchen war er zu müde. »Ich finde die Pyramide großartig.«
»Das Ding ist ein Pickel auf dem Antlitz von Paris«, stieß Fache mürrisch hervor.
Die erste Pleite. Langdon spürte, dass mit seinem Gastgeber nicht gut Kirschen essen war. Er fragte sich, ob der Captain wusste, dass man auf Präsident Mitterands ausdrückliche Anordnung die Pyramide aus genau 666 Glasdreiecken zusammengesetzt hatte. Diese ungewöhnliche Vorgabe war für Verschwörungstheoretiker ein gefundenes Fressen gewesen, hieß es doch, die 666 sei die Zahl des Satans.
Langdon hielt es allerdings für klüger, dieses Thema nicht zur Sprache zu bringen.
Während sie tiefer in das Zwielicht eintauchten, wurden allmählich die gewaltigen Ausmaße des unterirdischen Foyers erkennbar. Der gut zweiundzwanzig Meter unter Straßenniveau angelegte neue Eingangsbereich des Louvre erstreckte sich wie eine endlose Grotte über mehr als 9300 Quadratmeter. Passend zum honigfarbenen Stein der Fassade hatte man Marmor in warmen Ockertönen als Baumaterial gewählt. Der bei Tage vom Sonnenlicht durchflutete unterirdische Raum wimmelte für gewöhnlich von Besuchern, doch heute Nacht war er düster und verlassen und besaß eher die Atmosphäre einer Krypta.
»Wo ist denn das museumsinterne Wachpersonal?«, wollte Langdon wissen.
»En quarantaine«, gab Fache zur Antwort. Es klang, als hätte Langdon seine Entscheidungen infrage gestellt. »Heute Abend hat sich jemand Zutritt verschafft, der hier nichts zu suchen hatte. Das Wachpersonal der Nachtschicht wird zurzeit verhört. Für heute Nacht haben meine Beamten den Sicherheitsdienst übernommen.«
Langdon nickte und legte einen Schritt zu, um an Faches Seite zu bleiben.
»Wie gut haben Sie Jacques Saunière gekannt?«, wollte Fache wissen.
»Eigentlich gar nicht«, sagte Langdon. »Ich habe ihn nie persönlich kennengelernt.«
Fache blickte ihn überrascht an. »Sie beide hätten sich heute Abend das erste Mal gesehen?«
»Ja. Wir hatten verabredet, uns nach meinem Vortrag beim Empfang der Amerikanischen Universität zu treffen, aber er ist nicht gekommen.«
Fache kritzelte etwas in sein Notizbuch. Beim Weitergehen erspähte Langdon den Umriss einer weniger bekannten Pyramide des Louvre – La Pyramide Inversée –, ein großes Oberlicht, das wie ein Stalaktit von der Decke hing.
»Von wem kam der Vorschlag, sich heute Abend zu treffen?«, erkundigte Fache sich unvermutet, während er Langdon eine kurze Treppe hinaufgeleitete. »Von Ihnen oder von Saunière?«
Was für eine merkwürdige Frage! »Von Monsieur Saunière«, sagte Langdon, während sie den Durchgang zum Denon-Flügel betraten, die bekannteste der drei Abteilungen des Louvre. »Seine Sekretärin hat vor einigen Wochen per E-Mail Kontakt mit mir aufgenommen. Sie teilte mir mit, Direktor Saunière habe gehört, dass ich diesen Monat in Paris einen Vortrag halte. Er würde anschließend gern etwas mit mir besprechen.«
»Und was?«
»Ich habe keine Ahnung. Vermutlich irgendetwas aus dem Bereich der Kunst. Wir haben ein paar gemeinsame Interessensgebiete.«
Fache sah Langdon skeptisch an. »Und Sie haben keine Ahnung, um was es bei Ihrem Treffen gehen sollte?«
Langdon wusste es wirklich nicht. Er war zwar gleich neugierig geworden, hatte es aber für unpassend gehalten, eingehend nachzufragen. Angesichts der Zurückgezogenheit des hochverehrten Jacques Saunière hatte Langdon allein schon die Tatsache, dass der Museumsdirektor ihn zu treffen wünschte, als schmeichelhaft empfunden.
»Haben Sie wenigstens eine Vermutung, Mr Langdon, was unser Mordopfer am Abend seines Todes mit Ihnen besprechen wollte? Es könnte sich als sehr hilfreich erweisen.«
Die Direktheit der Frage ließ Unbehagen in Langdon aufsteigen. »Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe auch nicht nachgefragt. Ich empfand es als Ehre, von Monsieur Saunière angesprochen zu werden. In meinen Vorlesungen benutze ich seine Veröffentlichungen als Lehrmaterial für meine Studenten.«
Fache vertraute die Information seinem Notizbuch an.
Die beiden Männer hatten inzwischen die Hälfte der Eingangspassage des Denon-Flügels hinter sich gebracht. Langdon sah die beiden Rolltreppen am Ende des Ganges. Sie standen still.
»Wir nehmen den Lift«, sagte Fache. »Wie Sie bestimmt wissen, ist es zu Fuß noch ein ziemliches Stück bis zur Galerie.« Er fuhr sich mit seiner Pranke über das Haar.
»Sie hatten also gemeinsame Interessensgebiete?«, fragte er noch einmal nach.
»Ja. Ich habe den größten Teil des letzten Jahres damit verbracht, am Entwurf eines Buches zu arbeiten, das sich mit Monsieur Saunières Hauptinteressensgebiet befasst. Ich habe mir einiges davon versprochen, seine Meinung zu dem Thema zu hören.«
»Verstehe. Und um welches Thema handelt es sich?«
Langdon zögerte. Er wusste nicht recht, wie er sich verständlich machen sollte. »Mein Manuskript befasst sich im Wesentlichen mit der Verehrung der Urgöttin – den Vorstellungen von einer Heiligkeit des Weiblichen und der damit verbundenen künstlerischen Symbolik.«
Fache strich sich mit seiner Pranke über das pomadige Haar. »Und Saunière war Experte auf diesem Gebiet?«
»Der Experte schlechthin.«
»Verstehe. Es könnte also sein, dass Saunière von Ihrem Manuskript gewusst und das Treffen vorgeschlagen hat, um Ihnen bei Ihrem Buch zu helfen«, mutmaßte Fache.
Langdon schüttelte den Kopf. »Zurzeit weiß niemand etwas von meinem Manuskript. Es ist bislang nur ein Entwurf. Einzig mein Lektor hat es schon gesehen.«
Der Lift fuhr an. »Sie und Monsieur Saunière …«, sagte Fache nachdenklich, »Sie haben sich noch nie miteinander unterhalten? Nie Briefwechsel gehabt?«
Schon wieder so eine seltsame Frage. Langdon schüttelte den Kopf. »Nein, nie.«
Fache legte den Kopf schief. Er schien sich einen Knoten ins imaginäre Taschentuch zu machen und betrachtete kommentarlos die Edelstahltür.
Darin spiegelte sich der Krawattenclip des Polizisten – ein silbernes Kreuz mit einer Einlegearbeit aus dreizehn schwarzen Onyxsplittern. Langdon kannte das Symbol als crux gemmata, ein christliches Symbol für Jesus und die zwölf Apostel. Er war erstaunt. Eigentlich hatte er nicht damit gerechnet, dass ein französischer Captain seine religiöse Überzeugung so offen vor sich hertrug. Aber das war nun mal Frankreich. Das Christentum war hier keine Religion, sondern ein Muttermal.
Der Aufzug hielt. Langdon schaute auf und bemerkte, dass Faches Blick in der Reflektion der Tür auf ihm ruhte.
Er trat hinaus auf den Gang. Überrascht blieb er stehen.
Fache streifte ihn mit einem Blick. »Ich kann wohl davon ausgehen, Mr Langdon, dass Sie den Louvre noch nie nach Öffnungsschluss gesehen haben?«
Davon können Sie getrost ausgehen, dachte Langdon. In den üblicherweise perfekt ausgeleuchteten Galerien des Louvre war es überraschend schummrig. Ein gedämpfter roter Lichtschimmer schien sich von den Fußleisten aus nach oben und auf dem gekachelten Boden auszubreiten.
Eigentlich hättest du mit etwas Ähnlichem rechnen müssen, dachte Langdon beim Blick in den düsteren Korridor. In sämtlichen bedeutenden Bildergalerien hatte man inzwischen für die Nachtstunden eine rote Servicebeleuchtung installiert – an strategisch wichtigen Stellen tief angebrachte Lichtquellen, deren diffuses Licht dem Personal das in den Räumlichkeiten erforderliche Arbeitslicht lieferte, andererseits die Farben der Gemälde nicht ausbleichte.
»Hier entlang«, sagte Fache. Er wandte sich scharf nach rechts, um durch eine Reihe miteinander verbundener Galerien zu gehen. Langdon folgte ihm. Seine Augen gewöhnten sich nach und nach an das schummrige Licht.
Wie Fotos in einer gigantischen Entwicklerschale tauchten ringsum großformatige Ölporträts aus der Dunkelheit … Langdon wurde das Gefühl nicht los, von den Augen der Porträtierten beim Gang durch die Räume verfolgt zu werden.
Die hoch an den Wänden montierten, gut sichtbaren Überwachungskameras lieferten den Besuchern eine eindeutige Botschaft: Wir sehen dich! Wehe, du rührst etwas an!
»Sind einige der Kameras echt?«, erkundigte sich Langdon.
»Natürlich nicht«, sagte Fache.
Langdon war keineswegs überrascht. Bei seiner nach Hektar zu bemessenden Ausstellungsfläche hätte der Louvre allein zur Beobachtung der Bildschirme mehrere hundert Mann Überwachungspersonal einsetzen müssen. Die Sicherheitssysteme der meisten großen Museen beruhten mittlerweile auf dem Prinzip der containment security, dem Prinzip des Einsperrens der Täter. Man kann Diebe nicht aus dem Gebäude aussperren, aber man kann sie im Gebäude einsperren. Nach Öffnungsschluss wurde die Schließanlage aktiviert. Sobald ein Täter ein Ausstellungsobjekt von seinem angestammten Platz entfernte, schlossen sich sämtliche Zugänge zur betreffenden Galerie. Der Täter befand sich gewissermaßen schon hinter Gittern, bevor die Polizei anrückte.
Aus dem Marmorflur vor ihnen hallten ihnen Stimmen entgegen. Der Lärm schien aus einem geräumigen kurzen Flur zu kommen, der sich weiter vorn nach rechts öffnete. Helles Licht fiel in den Gang.
»Das Büro des Museumsdirektors«, erläuterte Fache.
Sie folgten dem Lichtschein. Langdon konnte durch den Flur in Saunières luxuriös ausgestattetes Büro schauen – kostbares Holz und alte Meister. Eine Handvoll Polizeibeamte wuselte telefonierend und Notizen machend umher. Einer saß an Saunières Schreibtisch und tippte etwas in ein Notebook. Das Büro des Museumsdirektors war für diese Nacht offensichtlich zum einstweiligen Hauptquartier des DCPJ umfunktioniert worden.
»Messieurs!«, rief Fache, und alles fuhr herum. »Ne nous derangez pas sous aucun prétexte. Entendu?«
Alles nickte.
Langdon hatte im Hotel oft genug das Schild mit dem NE PAS DERANGER außen an die Türklinke gehängt, um zu wissen, dass der Captain seine Zweisamkeit mit ihm unter keinen Umständen gestört wissen wollte.
Sie ließen die Beamtenschar hinter sich. Fache führte Langdon weiter den großen abgedunkelten Gang hinunter. Dreißig Meter vor ihnen öffnete sich der Zugang zur berühmtesten Abteilung des Louvre, der Grande Galerie, einer scheinbar endlos langen Flucht breiter Gänge, in denen die kostbarsten italienischen Meisterwerke untergebracht waren. Langdon hatte sich bereits ausgerechnet, dass dies der Ort sein musste, wo Saunières Leiche lag: Das Foto hatte den berühmten Parkettboden der Grande Galerie unverkennbar wiedergegeben.
Beim Näherkommen bemerkte Langdon, dass der Zugang durch ein gewaltiges Stahlgitter versperrt war. Er fühlte sich an die Falltüren erinnert, mit denen mittelalterliche Burgen sich vor streunendem Raubgesindel geschützt hatten.
»Containment security«, sagte Fache.
Am Gitter angekommen spähte Langdon durch die Stäbe in das schwach beleuchtete Innere der Grande Galerie.
»Nach Ihnen, Mr Langdon«, sagte Fache. Er deutete auf den Boden. Das Gitter war einen halben Meter weit angehoben. »Seien Sie bitte so nett, hier unten durchzukriechen.«
Langdon betrachtete den engen Durchschlupf zu seinen Füßen und dann das massive Stahlgitter darüber. Das kann doch nicht Faches Ernst sein! Die Barrikade wirkte wie eine Guillotine, die nur darauf wartete, jeden Eindringling zu zermalmen.
Fache sah auf die Uhr und sagte ein paar französische Worte. Dann ließ er sich auf alle viere nieder und quetschte seine massige Gestalt durch die Öffnung. Drüben angekommen erhob er sich und blickte Langdon durch die Gitterstäbe auffordernd an.
Seufzend ging Langdon in die Hocke. Er stützte die Hände flach auf das polierte Parkett, legte sich auf den Bauch und robbte vorwärts. Der Kragen seines Tweedjacketts verfing sich in einer Halteklaue des Gitters, und er stieß mit dem Hinterkopf gegen den Stahlrahmen.
Was für ein Spaß, dachte er säuerlich, doch schließlich war er durch und erhob sich. In ihm keimte der Verdacht auf, dass es eine sehr lange Nacht werden würde.
5. KAPITEL
Murray Hill Place, das neue Ordenshauptquartier und Konferenzzentrum von Opus Dei, liegt an der 243 Lexington Avenue in New York. Der Turm bietet gut zwölftausend Quadratmeter Nutzfläche. Er hat mehr als hundertzwanzig Zimmer, sechs Speisesäle, Bibliotheken, Aufenthaltsräume, Konferenzräume und Büros. Der sechzehnte Stock dient ausschließlich Wohnzwecken. Männer betreten das Gebäude durch den Haupteingang an der Lexington Avenue; der Eingang für Frauen befindet sich in einer Seitenstraße. Männer und Frauen sind im ganzen Gebäude voneinander getrennt.
In der Abgeschiedenheit seiner Penthousewohnung hatte Bischof Manuel Aringarosa die schwarze Soutane eines gewöhnlichen Priesters angelegt und eine kleine Reisetasche gepackt. Der vierzehnkarätige Bischofsring mit rosa Amethysten, den großen Brillanten und den fein geschmiedeten Symbolen Mitra und Krummstab fiel nur bei näherem Hinsehen auf.
Als Prälat der »Prälatur vom Heiligen Kreuz und Opus Dei«, wie die vollständige Bezeichnung lautet, hatte Bischof Aringarosa das vergangene Jahrzehnt seines Lebens damit verbracht, die Botschaft vom »Werk Gottes« zu verbreiten – die wörtliche Übersetzung des lateinischen Begriffs Opus Dei. Die im Jahre 1928 von dem spanischen Priester Josemaría Escrivá gegründete Kongregation setzte sich für die Rückkehr zu einem konservativen Katholizismus ein und verpflichtete ihre Mitglieder zu einem frommen und entsagungsvollen Leben im Dienste Gottes.
Escrivás Buch »Der Weg – 999 Meditationssätze zur Umsetzung von Gottes Willen in der eigenen Lebensführung« hatte sich explosionsartig auf der ganzen Welt verbreitet. Inzwischen war »Der Weg« in zweiundvierzig Sprachen übersetzt und mehr als vier Millionen Mal verkauft worden. Opus Dei war zu einer weltweit operierenden Größe geworden. Seine Ordenshäuser, Lehrinstitute und sogar Universitäten fanden sich in fast jeder größeren Metropole der Welt. Opus Dei war die am schnellsten wachsende und finanziell am besten abgesicherte katholische Organisation der Welt. Der Papst und seine Kardinäle im Vatikan hatten ihr ihren Segen gegeben. Reichtum und Einfluss der Organisation hatten aber auch Argwohn auf sich gezogen.
»Man hört oft den Vorwurf, Opus Dei sei eine Sekte, die Gehirnwäsche praktiziert«, war eine häufige Einlassung von Journalisten. »Ein anderer Vorwurf lautet, dass Opus Dei eine ultrakonservative katholische Geheimgesellschaft ist. Was sind Sie denn nun wirklich?«
»Keines von beiden«, pflegte Bischof Aringarosa geduldig zu antworten. »Wir sind eine Kongregation der katholischen Kirche – Katholiken, die es sich zur vornehmsten Aufgabe gemacht haben, in ihrem Alltag die katholische Lehre so streng wie möglich zu befolgen. Tausende unserer Mitglieder sind verheiratet, haben Familie und verrichten das Werk Gottes in ihren Gemeinden. Andere entschließen sich zu einem asketischen Leben in einem unserer Ordenshäuser. Das sind persönliche Entscheidungen unserer Mitglieder, wobei aber jedes Mitglied von Opus Dei dem Ziel verpflichtet ist, durch den Dienst am Werk Gottes zur Verbesserung unserer Welt beizutragen – zweifellos ein löbliches Unterfangen.«
Vernunftargumente wirkten selten. Die Medien brauchten Skandalgeschichten, und auch bei Opus Dei gab es – wie in allen großen Organisationen – hin und wieder ein paar schwarze Schafe, die ihre ganze Herde in Verruf brachten.
In den Medien sprach man inzwischen von Opus Dei als der »Mafia Gottes« und von einem »Christuskult«.
Die Angst vor dem Unbekannten, dachte Aringarosa.
Doch jüngst hatte Opus Dei sich plötzlich der Bedrohung durch eine Macht ausgesetzt gesehen, die viel stärker war als die Medien: Aringarosa befand sich unvermutet im Visier eines Gegners, vor dem es kein Verstecken gab. Vor fünf Monaten hatte jemand das Kaleidoskop der Macht geschüttelt. Aringarosa hatte sich von diesem Schlag noch immer nicht erholt.
Sie wissen nicht, auf was für einen Krieg sie sich eingelassen haben, flüsterte Aringarosa, der sich nun auf einem Linienflug nach Rom befand. Er blickte aus dem Fenster hinunter auf die Dunkelheit des Atlantiks. Einen kurzen Moment schlug die Perspektive seiner Augen um, und sein Blick blieb an der Spiegelung in der Fensterscheibe haften: ein unattraktives Gesicht, dunkel, länglich, mit einer unübersehbaren krummen Nase, die ein Spanier platt geschlagen hatte, als Aringarosa noch ein junger Missionar gewesen war. Die Verunstaltung kümmerte ihn nicht mehr. Aringarosa lebte für eine jenseitige Welt, nicht für das Diesseits.
Beim Überfliegen der portugiesischen Küste begann das stumm geschaltete Handy in der Tasche seiner Soutane plötzlich zu vibrieren. Aringarosa war sich bewusst, dass die Benutzung von Handys während des Fluges untersagt war; er wusste aber auch, dass es der von ihm so dringend erwartete Anruf sein musste. Nur ein einziger Mensch kannte seine Nummer – der Mann, der ihm den Apparat mit der Post zugeschickt hatte.
Aufgeregt nahm er das Gespräch an. »Ja?«, sagte er leise.
»Silas hat den Stein lokalisiert«, sagte der Anrufer. »Er befindet sich in Paris, in der Kirche Saint-Sulpice.«
Bischof Aringarosa lächelte. »Dann sind wir also nahe dran.«
»Wir können uns den Stein sofort holen. Aber dazu brauchen wir Ihre Beziehungen.«
»Aber natürlich! Was soll ich tun?«
Achthundert Kilometer entfernt stand der Albino mit Namen Silas über einer Schüssel mit Wasser und wusch sich den Rücken, ein weiteres persönliches Ritual.
Entsündige mich mit Ysop, dann werde ich rein, betete er die Psalmen. Wasche mich, dann werde ich weißer als Schnee.
In den vergangenen zehn Jahren war er den Weg gegangen, hatte seinen Sünden abgeschworen, sein Leben in den Griff bekommen, die Gewalttätigkeit seiner Vergangenheit ausgelöscht.
Die Botschaft Jesu ist die Botschaft des Friedens … der Gewaltlosigkeit … der Liebe, hatte man Silas von der ersten Stunde an eingehämmert, und er hatte die Botschaft verinnerlicht. Und diese Botschaft drohten die Feinde Christi jetzt zu zerstören. Wer die Botschaft Gottes mit Gewalt bedroht, dem wird Gewalt entgegenschlagen. Entschlossen und unausweichlich.
Und heute Abend war an Silas der Aufruf zur Schlacht ergangen.
6. KAPITEL
Robert Langdon stand auf der anderen Seite des Sperrgitters im Eingang der Grande Galerie. Die Wände, die zu beiden Seiten neun Meter in die Höhe stiegen, verloren sich oben im Dunkeln.
Das Streulicht der Servicebeleuchtung warf einen unnatürlichen Rotschimmer auf eine atemberaubende Sammlung von Stillleben und religiösen Szenen Da Vincis und anderer großer Meister.
Langdons Blick folgte den diagonal verlegten Dielen des Parkettbodens, der für viele die eigentliche Attraktion des Flügels darstellte, und blieb an einem mit Absperrband markierten Gegenstand haften, der weiter links nur ein paar Meter entfernt auf dem Boden lag. Er fuhr zu Fache herum.
»Liegt da etwa … ein Caravaggio?«, stieß er hervor.
Fache nickte, ohne hingesehen zu haben.
Nach Langdons Schätzung bewegte sich der Wert des Gemäldes, das dort wie ein achtlos weggeworfenes Plakat auf dem Parkett lag, irgendwo oberhalb von zwei Millionen Dollar. »Du lieber Himmel! Warum liegt das hier einfach so?«
Fache blickte Langdon düster an. »Mr Langdon, wir befinden uns hier am Tatort eines Verbrechens. Wir haben alles so belassen, wie wir es vorgefunden haben. Das Gemälde wurde von Saunière von der Wand gerissen. Auf diese Weise hat er das Alarmsystem ausgelöst. Wir glauben, Saunière wurde in seinem Büro angegriffen. Er ist in die Grande Galerie geflüchtet und hat beim Herunterreißen des Gemäldes den Alarm ausgelöst. Das Gitter im Zugang ist sofort heruntergefallen und hat den einzigen Weg versperrt, auf dem man in diese Galerie hinein- oder wieder hinausgelangen kann.«
Langdon war verwirrt. »Dann ist es Saunière also gelungen, seinen Mörder in der Grande Galerie einzuschließen?«
Fache schüttelte den Kopf. »Das Sperrgitter hat den Direktor von seinem Angreifer getrennt. Der Mörder stand draußen im Gang und hat Saunière durch das Gitter erschossen. Saunière war allein, als er hier drinnen starb.«
Langdon spähte den gewaltigen Gang der Galerie hinunter. »Und wo ist die Leiche?«
Fache rückte die kreuzförmige Krawattennadel zurecht und schritt aus. »Die Grande Galerie ist sehr lang, wie Ihnen vermutlich bekannt sein dürfte.«
Wenn Langdon sich recht erinnerte, betrug die Länge um die vierhundertfünfzig Meter. Ähnlich gewaltig war die Breite. Zwei D-Züge hätten hier bequem nebeneinander Platz gehabt. Auf der Mittellinie der Galerie hatte man in unregelmäßigen Abständen große Statuen oder riesige Porzellanvasen aufgestellt, die als geschmackvolle Raumteiler dafür sorgten, dass der Besucherstrom sich ordentlich auf der einen Seite hin- und auf der anderen zurückbewegte.
Den Blick fest nach vorn gerichtet schritt Fache zielstrebig auf der rechten Seite den Gang hinunter. Langdon kam es beinahe pietätlos vor, an so vielen Meisterwerken vorbeizueilen, ohne auch nur einen flüchtigen Blick darauf zu werfen. Von der Leiche war immer noch nichts zu sehen. »Jacques Saunière ist noch so weit gekommen?«, wunderte sich Langdon.
»Monsieur Saunière hat einen Magendurchschuss erlitten. Sein Tod ist sehr langsam eingetreten, vielleicht in einer Zeitspanne von fünfzehn bis zwanzig Minuten. Er war offensichtlich sehr gut bei Kräften.«
Langdon hielt erstaunt inne. »Die Sicherheitsleute haben sich eine geschlagene Viertelstunde Zeit gelassen, bis sie hier waren?«
»Nein, keineswegs. Das Wachpersonal des Louvre hat unverzüglich auf den Alarm reagiert, den Zugang zur Grande Galerie aber versperrt vorgefunden. Die Leute konnten zwar hören, dass sich irgendwo weit hinten etwas bewegte, aber nicht erkennen, um wen oder was es sich handelte. Also haben sie uns routinemäßig informiert. Wir waren binnen fünfzehn Minuten vor Ort und haben das Sperrgitter so weit angehoben, dass man darunter durchkriechen konnte. Wir haben über ein Dutzend bewaffnete Beamte hineingeschickt, um den Eindringling in der Galerie zu stellen.«
»Und?«
»Sie haben niemanden gefunden.« Fache zeigte ein Stück weit voraus. »Abgesehen von ihm.«
Langdons Blick folgte Faches ausgestrecktem Finger. Dreißig Meter weiter im schummrigen Leuchten warf ein einzelner, auf einen Ständer montierter Scheinwerfer eine Insel aus weißem Licht auf den Boden. In der Mitte des Lichtkreises lag der Leichnam des Museumsdirektors wie ein Insekt unter einem Mikroskop.
Langdon lief es eiskalt den Rücken hinunter, als er sich der Leiche näherte. Vor seinen Augen tat sich das merkwürdigste Bild auf, das er je gesehen hatte.
Jacques Saunières nackter Leichnam lag in exakt der gleichen Haltung auf dem Parkett, die schon auf dem Foto zu erkennen gewesen war.
Der Körper des Museumsdirektors war sorgfältig nach der Längsachse der breiten Galerie ausgerichtet. Er lag auf dem Rücken, Arme und Beine weit von sich gestreckt. Seine Kleidung befand sich neben ihm, ordentlich zusammengelegt.
Unmittelbar unterhalb von Saunières Brustbein markierte eine blutverschmierte Stelle das Loch, wo die Kugel eingedrungen war. Die Wunde hatte erstaunlich wenig geblutet und war mit einem kleinen Pfropf von schwarz gewordenem Blut gefüllt.
Auch Saunières linker Zeigefinger war blutverschmiert. Er hatte den Finger augenscheinlich in die Wunde getaucht und den blutigen Finger dann als Pinsel und seinen nackten Bauch als Leinwand benutzt. So hatte er sich ein Symbol auf den nackten Leib gemalt, fünf gerade Linien, die zusammen einen fünfzackigen Stern ergaben.
Das Pentagramm.
Langdon überkam ein abgrundtiefes Unbehagen.
Er hat sich das selbst angetan.
»Nun, Mr Langdon?«, fragte Fache und musterte ihn mit seinen dunklen Augen.
»Das ist ein Pentagramm«, meinte Langdon. In der Weitläufigkeit des Raums schien seine Stimme einen hohlen Klang anzunehmen. »Es ist eines der ältesten Symbole, die wir kennen, und wurde schon viertausend Jahre vor Christi verwendet.«
»Und was bedeutet es?«
Bei dieser Frage pflegte Langdon stets zu zögern. Erklären zu wollen, was ein Symbol »bedeutet« war so ähnlich, als wolle man jemandem vermitteln, welche Empfindungen ein Musikstück auslöst.
»Symbole haben je nach dem Umfeld eine andere Bedeutung«, sagte er. »Das Pentagramm ist in erster Linie ein heidnisches religiöses Symbol.«
»Teufelsanbetung«, sagte Fache und nickte.
»Keineswegs«, berichtigte Langdon und bedauerte sofort, sich nicht klarer ausgedrückt zu haben. »Das Pentagramm ist ein vorchristliches Symbol aus der Welt der Naturgottheiten. Unsere Vorväter verstanden die Welt als aus zwei Hälften zusammengesetzt, dem Männlichen und dem Weiblichen. Ihre Götter und Göttinnen waren bestrebt, das Gleichgewicht aufrechtzuerhalten, Yin und Yang, wie man es in Asien nennt. Wenn das Männliche und Weibliche ausgewogen waren, befand die Welt sich in Harmonie und Ausgewogenheit. Gerieten sie aus dem Lot, brach das Chaos aus. Dieses Pentagramm repräsentiert die weibliche Hälfte der Schöpfung. Religionswissenschaftler sprechen vom ›göttlich Weiblichen‹ oder der ›Urgöttin‹. Wenn jemand sich damit auskannte, dann Saunière.«
»Saunière hat sich das Symbol für das göttlich Weibliche auf den Bauch gemalt?«
Langdon musste zugeben, dass dies alles äußerst seltsam war. »Bei sehr eng gefasster Interpretation ist das Pentagramm das Symbol der Venus, der Göttin der weiblichen körperlichen Liebe und Schönheit.«
Fache betrachtete stirnrunzelnd den nackten Mann.
»Die frühen Religionen gründeten sich auf die Verehrung der göttlichen Ordnung in der Natur. Die Göttin Venus und der Planet waren ein und dasselbe, welchen Namen man der Venus auch gab.«
Fache schaute drein, als wäre ihm ein Zusammenhang mit Teufelsanbetung lieber gewesen.
»Mr Langdon«, meldete er sich zu Wort, »das Pentagramm muss aber irgendeinen Bezug zum Teufel haben. In amerikanischen Horrorfilmen, zum Beispiel, wird ausgiebig Gebrauch davon gemacht. Gewiss nicht ohne Grund?«
Langdon runzelte die Stirn. Vielen Dank, Hollywood. Der fünfzackige Stern war inzwischen in der Tat zum unverzichtbaren Klischee sämtlicher Zelluloidmachwerke über satanische Serienmörder avanciert. Ihm lief jedes Mal die Galle über, wenn er das Symbol unter Verfälschung seines wahren Ursprungs in diesem Kontext auftauchen sah.
»Ich kann Ihnen versichern«, sagte er, »dass trotz aller Bemühungen der Filmindustrie die Interpretation des Pentagramms als dämonisches Zeichen historisch unzutreffend ist. Der ursprüngliche Bezug zum Weiblichen ist im Lauf der Jahrtausende verfälscht worden, auch durch Blutvergießen.«
»Ich fürchte, ich kann Ihnen nicht ganz folgen«, entgegnete Fache.
Langdon war nicht sicher, wie er sich ausdrücken sollte, und streifte Faches Kruzifix mit einem vielsagenden Blick. »Ich spreche von der Kirche, Monsieur Fache. Die römisch-katholische Kirche hat es in ihrer Anfangszeit geschafft, dem Pentagramm eine andere Bedeutung zu verleihen. Im Zuge der Bemühungen, die heidnischen Religionen auszurotten und die Massen zum Christentum zu bekehren, hat die Kirche in einer Verleumdungskampagne den Symbolgehalt der heidnischen Gottheiten ins Negative gewendet …«
»Fahren Sie fort.«
»In Zeiten des Umbruchs ist das nicht ungewöhnlich. Mächte, die sich neu konstituieren, pflegen vorhandene Symbole zu übernehmen und unschädlich zu machen, indem sie ihnen die ursprüngliche Bedeutung rauben und allmählich herabwürdigen. Die heidnischen Symbole haben den Kampf mit den christlichen Symbolen verloren. Der Dreizack des Neptun pervertierte zur Mistgabel des Teufels, der spitze Hut der weisen Frauen wurde zum Hexenhut gemacht und der fünfzackige Venusstern zum Pentagramm des Teufels.«
»Interessant«, sagte Fache und deutete mit dem Kopf auf den nackten Leichnam, der mit ausgestreckten Gliedmaßen am Boden lag. »Und was fällt Ihnen zu dieser Körperhaltung ein?«
Langdon zuckte die Schultern. »Sie unterstreicht nur den Bezug zum Pentagramm und der Göttlichkeit des Weiblichen.«
Faches Miene verdüsterte sich. »Wie darf ich das bitte verstehen?«
»Replikation. Die Wiederholung eines Symbols ist die einfachste Methode, seine Bedeutung zu verstärken. Jacques Saunière hat einen fünfzackigen Stern aus sich gemacht.« Zwei Pentagramme sind besser als eins.
Faches Blicke zeichneten die fünf Sternspitzen von Saunières Beinen, Armen und Kopf nach. Wieder strich er sich über das ölige Haar. »Und die Nacktheit?«, sagte er dann mit einer ungnädigen Betonung auf dem letzten Wort. Der Anblick eines gealterten männlichen Körpers schien ihm gegen den Strich zu gehen. »Warum hat er sich nackt ausgezogen?«
Verdammt gute Frage, dachte Langdon. Sie hatte ihm zu schaffen gemacht, seit er das Foto gesehen hatte.
»Die Frage, warum Saunière sich dieses Symbol aufgemalt und weshalb er diese Haltung eingenommen hat, kann ich Ihnen nicht beantworten, Monsieur Fache, aber eines ist sicher: Für einen Mann wie Jacques Saunière war das Pentagramm das Zeichen der weiblichen Gottheit.«
»In Ordnung. Und die Benutzung von Blut als Tinte?«
»Ganz einfach: Offenbar hatte Saunière nichts anderes zum Schreiben.«
»Ich bin eher der Meinung«, sagte Fache nach einem Augenblick des Schweigens, »dass er Blut benutzt hat, damit die Polizei zu bestimmten forensischen Methoden greift. Sehen Sie sich seine linke Hand an.«
Langdon ging um die Leiche herum und kauerte sich nieder. Zu seiner Überraschung bemerkte er, dass der Tote einen großen Filzschreiber umklammert hielt.
»Als wir Saunière auffanden, hatte er den Schreiber in der Hand«, sagte Fache. Er trat an einen seitwärts aufgestellten Klapptisch mit allerlei Gerätschaften, Kabeln und elektronischen Apparaten heran. »Wie ich Ihnen schon sagte, haben wir alles so gelassen, wie es war.« Er kramte auf dem Tisch herum. »Kennen Sie diese Filzschreiber?«
STYLO DE LUMIÈRE NOIRE.
Überrascht blickte Langdon auf.
Diese Schwarzlicht-Schreiber waren ursprünglich zur Verwendung in Museen, durch Restauratoren und Ermittlungsbehörden entwickelt worden, um Gegenstände mit unsichtbaren Markierungen zu versehen. Sie waren mit einer wetterfesten fluoreszierenden Flüssigkeit auf Alkoholbasis gefüllt, die erst unter ultraviolettem Licht sichtbar wurde. Heutzutage benutzten die Restauratoren der Museen diese Schreiber bei ihren Rundgängen, um auf dem Rahmen restaurierungsbedürftiger Gemälde eine entsprechende Markierung anzubringen.
Während Langdon sich erhob, ging Fache zum Scheinwerfer und schaltete ihn aus. Die Galerie versank in plötzlicher Dunkelheit.
Dann näherte sich Fache, in ein sattes Violett getaucht und mit einer Art Taschenlampe in der Hand.
»Wie Sie vielleicht wissen«, meinte er, wobei seine Augen violett fluoreszierten, »benutzt die Polizei auch UV-Licht, um einen Tatort auf Blutspuren und andere forensische Hinweise zu untersuchen. Sie können sich gewiss unsere Überraschung vorstellen, als wir …« Unvermittelt richtete er die Lampe auf den Toten.
Langdon sprang vor Schreck einen Schritt zurück. In violett fluoreszierender Leuchtschrift erglühten die letzten Worte des Museumsdirektors neben seiner Leiche. Je länger Langdon auf den geisterhaft schimmernden Text starrte, umso mehr schien sich der Nebel zu verdichten, der schon den ganzen Abend um ihn wogte.
Erneut las er die Botschaft. »Was hat das zu bedeuten?«, fragte er dann und blickte Fache an.
Dessen Augen leuchteten lila. »Genau das, Monsieur, ist die Frage, auf die wir von Ihnen gern eine Antwort hätten.«
7. KAPITEL
In der Kirche Saint-Sulpice gab es im Obergeschoss neben der Orgelempore eine spartanisch eingerichtete Zweizimmerklause mit Steinfußboden. Die bescheidene Unterkunft war seit mehr als zehn Jahren das Heim von Schwester Sandrine Bieil, die sechzigjährige Nonne hatte es sich hier recht gemütlich gemacht.
Sie war für alle nichtreligiösen Aspekte des Kirchenbetriebs verantwortlich, etwa die Hausverwaltung, die Einstellung von Hilfs- und Reinigungskräften und Fremdenführern, das Verschließen des Gebäudes am Abend, die Bestellung von Messwein und Oblaten für die heilige Kommunion und vieles andere mehr.
Das Schrillen des Telefons ließ sie in ihrem kleinen Bett hochfahren. Schlaftrunken griff sie nach dem Hörer.
»Soeur Sandrine, Église Saint-Sulpice.«
»Hallo, Schwester«, sagte der französische Anrufer.
Schwester Sandrine setzte sich auf. Wie viel Uhr ist es eigentlich? Sie erkannte die Stimme ihres Vorgesetzten. In fünfzehn Jahren war es noch nie vorgekommen, dass er sie aus dem Schlaf geklingelt hatte. Der Abbé war ein frommer, tief religiöser Mann, der sich nach der Abendmesse stets sofort nach Hause und unverzüglich zu Bett begab.
»Es tut mir leid, Schwester, wenn ich Sie aus dem Schlaf gerissen habe«, sagte der Abbé, dessen Stimme ebenfalls ziemlich schlaftrunken klang. »Ich muss Sie um einen Gefallen bitten. Ich habe soeben von einem einflussreichen amerikanischen Bischof einen Anruf erhalten. Sie kennen ihn vielleicht. Es handelt sich um Bischof Manuel Aringarosa.«
»Der Prälat des Opus Dei?« Natürlich kenne ich ihn. Wer in der katholischen Kirche kennt ihn nicht?
Opus Dei hatte sie immer schon argwöhnisch gemacht. Der Orden beharrte auf einem Frauenbild, das man bestenfalls mittelalterlich nennen konnte. Schwester Sandrine hatte mit ungläubigem Erstaunen gehört, dass die Numerarierinnen angehalten waren, ohne jedes Entgelt die Wohnräume der männlichen Numerarier zu putzen, während diese die Messe besuchten. Frauen mussten auf dem nackten Dielenboden schlafen, während den Männern wenigstens Strohmatten zugestanden wurden – alles als zusätzliche Bußübung für die von Eva über die Menschheit gebrachte Erbsünde. Sie wusste auch, dass der Aufstieg des Opus Dei eigentümlicherweise im gleichen Jahr erfolgte, in dem die wohlhabende Organisation angeblich fast eine Milliarde Dollar auf das Vatikanische Institut für Religiöse Werke – besser unter dem Namen Vatikanbank bekannt – transferiert und damit in letzter Sekunde einen blamablen Bankrott des Instituts abgewendet hatte.
»Bischof Aringarosa hat mich telefonisch um einen Gefallen gebeten«, erklärte der Abbé. Seine Stimme klang nervös. »Einer seiner Numerarier ist heute Abend in Paris … und er hat immer schon davon geträumt, Saint-Sulpice zu sehen, aber sein Flugzeug geht morgen schon in aller Herrgottsfrühe.«
»Aber die Kirche ist doch am Tag viel interessanter.«