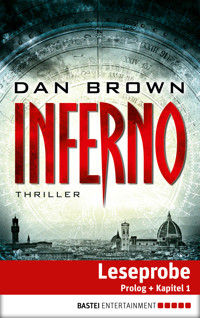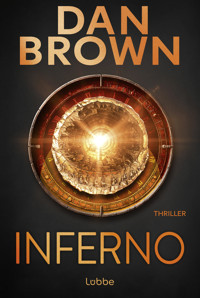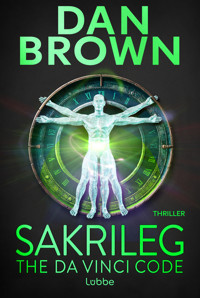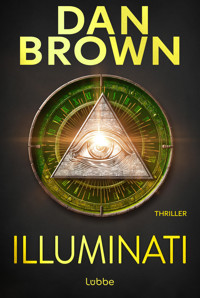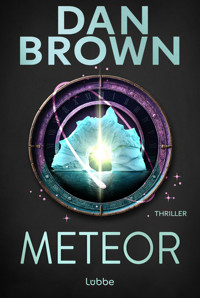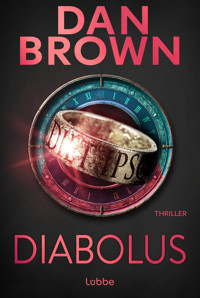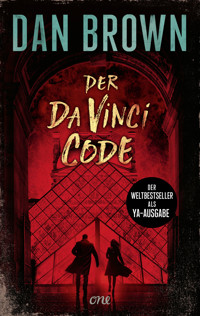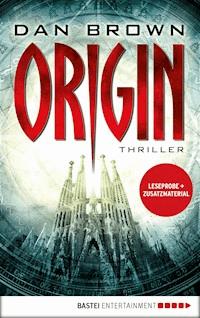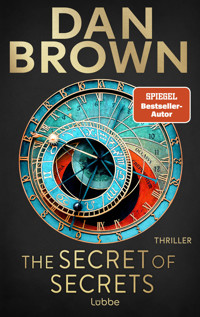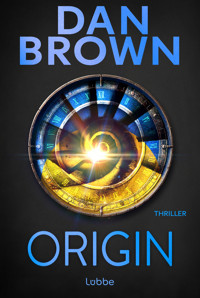
11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Robert Langdon
- Sprache: Deutsch
ILLUMINATI, SAKRILEG, DAS VERLORENE SYMBOL und INFERNO - vier Welterfolge, die mit ORIGIN ihre spektakuläre Fortsetzung finden.
Die Wege zur Erlösung sind zahlreich.
Verzeihen ist nicht der einzige.
Als der Milliardär und Zukunftsforscher Edmond Kirsch drei der bedeutendsten Religionsvertreter der Welt um ein Treffen bittet, sind die Kirchenmänner zunächst skeptisch. Was will ihnen der bekennende Atheist mitteilen? Was verbirgt sich hinter seiner "bahnbrechenden Entdeckung", das Relevanz für Millionen Gläubige auf diesem Planeten haben könnte? Nachdem die Geistlichen Kirschs Präsentation gesehen haben, verwandelt sich ihre Skepsis in blankes Entsetzen.
Die Furcht vor Kirschs Entdeckung ist begründet. Und sie ruft Gegner auf den Plan, denen jedes Mittel recht ist, ihre Bekanntmachung zu verhindern. Doch es gibt jemanden, der unter Einsatz des eigenen Lebens bereit ist, das Geheimnis zu lüften und der Welt die Augen zu öffnen: Robert Langdon, Symbolforscher aus Harvard, Lehrer Edmond Kirschs und stets im Zentrum der größten Verschwörungen.
Jetzt das eBook herunterladen und in wenigen Sekunden loslesen!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 770
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Inhalt
WIDMUNG
MOTTO
FAKTEN
PROLOG
1. KAPITEL
2. KAPITEL
3. KAPITEL
4. KAPITEL
5. KAPITEL
6. KAPITEL
7. KAPITEL
8. KAPITEL
9. KAPITEL
10. KAPITEL
11. KAPITEL
12. KAPITEL
13. KAPITEL
14. KAPITEL
15. KAPITEL
16. KAPITEL
17. KAPITEL
18. KAPITEL
19. KAPITEL
20. KAPITEL
21. KAPITEL
22. KAPITEL
23. KAPITEL
24. KAPITEL
25. KAPITEL
26. KAPITEL
27. KAPITEL
28. KAPITEL
29. KAPITEL
30. KAPITEL
31. KAPITEL
32. KAPITEL
33. KAPITEL
34. KAPITEL
35. KAPITEL
36. KAPITEL
37. KAPITEL
38. KAPITEL
39. KAPITEL
40. KAPITEL
41. KAPITEL
42. KAPITEL
43. KAPITEL
44. KAPITEL
45. KAPITEL
46. KAPITEL
47. KAPITEL
48. KAPITEL
49. KAPITEL
50. KAPITEL
51. KAPITEL
52. KAPITEL
53. KAPITEL
54. KAPITEL
55. KAPITEL
56. KAPITEL
57. KAPITEL
58. KAPITEL
59. KAPITEL
60. KAPITEL
61. KAPITEL
62. KAPITEL
63. KAPITEL
64. KAPITEL
65. KAPITEL
66. KAPITEL
67. KAPITEL
68. KAPITEL
69. KAPITEL
70. KAPITEL
71. KAPITEL
72. KAPITEL
73. KAPITEL
74. KAPITEL
75. KAPITEL
76. KAPITEL
77. KAPITEL
78. KAPITEL
79. KAPITEL
80. KAPITEL
81. KAPITEL
82. KAPITEL
83. KAPITEL
84. KAPITEL
85. KAPITEL
86. KAPITEL
87. KAPITEL
88. KAPITEL
89. KAPITEL
90. KAPITEL
91. KAPITEL
92. KAPITEL
93. KAPITEL
94. KAPITEL
95. KAPITEL
96. KAPITEL
97. KAPITEL
98. KAPITEL
99. KAPITEL
100. KAPITEL
101. KAPITEL
102. KAPITEL
103. KAPITEL
104. KAPITEL
105. KAPITEL
EPILOG
DANKSAGUNG
Hat es dir gefallen?
Über dieses Buch
Der fünfte Robert-Langdon-Thriller: das neue Buch des Autors der internationalen Bestseller ILLUMINATI, SAKRILEG – THE DA VINCI CODE, DAS VERLORENE SYMBOL, INFERNO.
Auch in seinem jüngsten Werk wird Dan Brown gemäß seinem Erfolgsrezept geheime Codes, Wissenschaft, Religion, Geschichte, Kunst und Architektur miteinander verknüpfen. In ORIGIN wird der Symbolforscher Robert Langdon – in bisher drei Hollywood-Blockbustern von Tom Hanks verkörpert – mit den beiden ewigen und entscheidenden Fragen der Menschheit konfrontiert und mit einer bahnbrechenden Entdeckung, die diese Fragen beantworten könnte.
Über Dan Brown
Dan Brown ist der Autor von acht Nummer-1-Bestsellern, darunter Sakrileg (The Da Vinci Code), das zu einem der meistverkauften Bücher aller Zeiten geworden ist. Seine Thriller um Robert Langdon – darunter Illuminati (Angels & Demons), Das verlorene Symbol (The Lost Symbol), Inferno und Origin – fesseln Leserinnen und Leser weltweit und regen seit ihrem Erscheinen zu intellektuellen Debatten und Spekulationen an. Browns Romane erscheinen in 56 Sprachen und haben eine weltweite Gesamtauflage von über 250 Millionen Exemplaren.
Besuchen Sie den Autor auf:
danbrown.com
X: @AuthorDanBrown
Facebook: @DanBrown
Instagram: @authordanbrown
DAN BROWN
ORIGIN
THRILLER
Aus dem amerikanischen Englischvon Axel Merz
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Dieser Titel ist auch als Hörbuch erschienen
Titel der amerikanischen Originalausgabe: »Origin«
Für die Originalausgabe:Copyright © 2017 by Dan Brown
All rights reserved. Published in the United States by Doubleday, a division of Penguin Random House LLC, New York, and in Canada by Random House of Canada, a division of Penguin Random House Canada Limited, Toronto.
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2017/2025 by Bastei Lübbe AG, Schanzenstraße 6 – 20, 51063 Köln, Deutschland
Vervielfältigungen dieses Werkes für das Text- und Data-Mining bleiben vorbehalten.
Die Verwendung des Werkes oder Teilen davon zum Training künstlicher Intelligenz-Technologien oder -Systeme ist untersagt.
Textredaktion: Wolfgang Neuhaus, Oberhausen
Covergestaltung: Guter Punkt, München
Covermotiv: © lukbar / iStock / Getty Images Plus; © Shutterstock AI Generator; © Ig0rZh / iStock / Getty Images Plus; © Désirée Russeau/ iStock / Getty Images Plus; © Patchakorn Phom-in/ iStock /Getty Images Plus
eBook-Erstellung: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-7325-4221-5
luebbe.de
lesejury.de
Im Gedenken an meine Mutter
Wir müssen bereit sein, uns von dem Leben zu lösen,das wir geplant haben, um das Leben führen zu können,das uns erwartet.
JOSEPH CAMPBELL
FAKTEN
Sämtliche Werke der Kunst und der Architektur, alle Orte, Straßen und Bauwerke, jede wissenschaftliche Disziplin in diesem Roman und jede religiöse Organisation, die in Origin eine Rolle spielt, gibt es tatsächlich.
PROLOG
Während die historische Zahnradbahn sich mühsam ihren Weg den schwindelerregend steilen Hang hinaufkrallte, blickte Edmond Kirsch auf die gezackten Bergspitzen hoch über ihm. In der Ferne, hineingebaut in die Flanke einer senkrecht aufragenden Klippe, schien das weitläufige Klostergebäude über dem Abgrund zu schweben, als hätte es sich auf magische Weise von der Felswand gelöst.
Dieser zeitlose Zufluchtsort hatte die glühende Sonne Kataloniens, den rauen Wind in den Bergen und andere Unbilden des Wetters und der Geschichte nun schon seit mehr als vierhundert Jahren überdauert, ohne je von seiner ursprünglichen Bestimmung abzukommen, seine Bewohner vor der modernen Welt abzuschotten.
Und ausgerechnet sie sind die Ersten, die nun die Wahrheit erfahren, dachte Kirsch. Was für eine Ironie.
Er fragte sich, wie sie reagieren würden. Schließlich waren die gefährlichsten Männer auf Erden immer und zu allen Zeiten Männer des Glaubens gewesen – insbesondere, wenn ihre Götter bedroht wurden.
Nicht mehr lange, und ich stoße einen flammenden Speer in ein Hornissennest.
Als die Zahnradbahn ihren höchsten Punkt erreichte, erblickte Kirsch eine einsame Gestalt, die auf dem Bahnsteig auf ihn wartete. Der erschreckend hagere Mann trug ein weißes Rochett zur violetten Soutane eines Bischofs, dazu ein Scheitelkäppchen. Kirsch kannte die knochigen Gesichtszüge seines Gastgebers von zahlreichen Fotos und verspürte einen unerwarteten Adrenalinstoß.
Valdespino nimmt mich persönlich in Empfang.
Bischof Antonio Valdespino war in Spanien eine Berühmtheit. Der getreue Freund und Ratgeber des Königshauses galt als einer der prominentesten und einflussreichsten Fürsprecher konservativer katholischer Werte und einer fortschrittsfeindlichen politischen Grundhaltung.
»Edmond Kirsch, nehme ich an«, sagte der Bischof, als Kirsch aus dem Waggon stieg.
»Schuldig im Sinne der Anklage.« Kirsch lächelte und schüttelte Valdespinos knochige Hand. »Ich danke Ihnen, dass Sie dieses Treffen arrangiert haben, Exzellenz.«
»Und ich freue mich, dass Sie darum gebeten haben.« Die Stimme des Bischofs war kräftiger, als Kirsch erwartet hätte, klar und volltönend wie der Klang einer Glocke. »Es kommt nicht oft vor, dass wir von Männern der Wissenschaft konsultiert werden. Erst recht nicht von jemandem, der so bekannt ist wie Sie. Hier entlang bitte.«
Valdespino führte Kirsch über den Bahnsteig, während der kalte Wind aus den Bergen an seiner Soutane zerrte. »Ich muss gestehen«, fuhr er fort, »Sie sehen anders aus, als ich mir vorgestellt hätte. Ich hatte einen Wissenschaftler erwartet, aber Sie sind ausgesprochen …« Er beäugte den maßgeschneiderten Kiton-Anzug seines Besuchers und die exquisiten Straußenlederschuhe von Barker, und ein Hauch von Missbilligung erschien auf seinem hageren Gesicht. »Das nennt man wohl hip, nicht wahr?«
Kirsch lächelte höflich. Der Begriff »hip«, Herr Bischof, ist seit Jahrzehnten aus der Mode.
»Obwohl ich mir die Liste Ihrer Errungenschaften angeschaut habe«, fuhr Valdespino fort, »weiß ich immer noch nicht, was genau Sie eigentlich tun.«
»Ich bin Fachmann für Spieltheorie und computerbasierte Modellrechnungen.«
»Sie programmieren diese Computerspiele für Kinder?«
Kirsch wusste, dass der Bischof Unwissenheit vortäuschte, um rückständig zu erscheinen. In Wirklichkeit war Valdespino ein beängstigend gut informierter Kenner neuester technologischer Entwicklungen und warnte häufig vor deren Gefahren. »Nein, Exzellenz. Vereinfacht ausgedrückt, ist die Spieltheorie ein Gebiet der Mathematik, bei dem bestimmte Muster untersucht werden, um Vorhersagen für die Zukunft treffen zu können.«
»Ach ja, ich erinnere mich. Sie haben vor ein paar Jahren die Finanzkrise der Europäischen Union vorhergesagt, nicht wahr? Als niemand auf Sie hören wollte, haben Sie ein Computerprogramm geschrieben, das die EU von den Toten hat auferstehen lassen. Wie war noch gleich Ihr berühmter Ausspruch? ›Mit meinen dreiunddreißig Jahren bin ich genauso alt wie Jesus bei seiner Wiederauferstehung.‹«
Kirsch wand sich. »Ein ziemlich verunglückter Vergleich. Aber ich war jung, Exzellenz.«
»Und Sie brauchten das Geld.« Der Bischof lachte. »Wie alt sind Sie heute? Vierzig?«
»So gerade eben.«
Valdespino schmunzelte, während der steife Wind seine Robe blähte. »Würde es nach dem Willen des Herrn gehen, würden die Sanftmütigen die Erde besitzen. Stattdessen haben die Jungen sie sich genommen – die technisch Versierten, genauer gesagt, die auf Bildschirme starren, statt in ihre eigene Seele zu schauen. Ich muss gestehen, ich hätte nie geglaubt, dass ich einmal Veranlassung haben würde, den Mann zu treffen, der die Speerspitze dieser Entwicklung verkörpert. Man nennt Sie einen Propheten, stellen Sie sich vor.«
»Im aktuellen Fall war ich kein sehr guter, wie mir scheint«, erwiderte Kirsch. »Als ich um ein privates Treffen mit Ihnen und Ihren Kollegen gebeten habe, hatte ich mir eine höchstens zwanzigprozentige Chance ausgerechnet, dass Sie einverstanden sind.«
»Nun, Sie hatten Glück. Und wie ich meinen Kollegen immer wieder sage: Der Fromme kann auch dann profitieren, wenn er Ungläubigen zuhört. Indem wir der Stimme des Teufels lauschen, lernen wir die Stimme Gottes umso mehr zu schätzen.« Der alte Mann lächelte. »Keine Sorge, das war nur ein Scherz. Verzeihen Sie mir meinen vorsintflutlichen Sinn für Humor. Hin und wieder verliere ich den Blick für das rechte Maß.« Er deutete nach vorn. »Die anderen erwarten uns. Hier entlang bitte.«
Kirsch betrachtete das Gebäude, auf das sie zuhielten – eine gewaltige Zitadelle aus grauem Stein unmittelbar am Rand einer steilen Klippe, die Hunderte von Metern senkrecht abfiel, wo die Felswand im üppigen grünen Teppich eines bewaldeten Höhenzuges verschwand.
Schaudernd riss Kirsch den Blick vom gähnenden Abgrund los und konzentrierte sich auf das bevorstehende Treffen, während er dem Bischof über den unebenen Pfad am Klippenrand folgte.
Kirsch hatte eine Audienz bei drei prominenten Religionsführern erbeten, die einer soeben zu Ende gegangenen Konferenz im Kloster beigewohnt hatten.
Das Parlament der Weltreligionen.
Seit 1893 hatten sich Hunderte spirituelle Führer aus fast dreißig Religionsgemeinschaften regelmäßig alle paar Jahre an verschiedenen Orten eingefunden, um eine Woche in interreligiösem Dialog zu verbringen. Zu den Teilnehmern gehörten einflussreiche christliche Geistliche, jüdische Rabbis, islamische Mullahs, hinduistische Pujaris, buddhistische Bhikkhus, Jainas, Sikhs und andere religiöse Führer aus aller Welt.
Das selbsternannte Ziel dieses Parlaments bestand darin, »die Harmonie zwischen den Weltreligionen zu kultivieren, Brücken zwischen den unterschiedlichen Glaubensgrundsätzen zu bauen und die Gemeinsamkeiten aller Religionen zu preisen«.
Ein nobles Unterfangen, dachte Kirsch, auch wenn er selbst die Sinnlosigkeit dahinter sah – eine bedeutungslose Suche nach zufälligen Zusammenhängen und Übereinstimmungen in einer unübersehbaren Fülle historischer Aufzeichnungen, Prosatexten, Fabeln und Mythen.
Als Valdespino ihn immer höher den Pfad hinaufführte, kam Kirsch ein zynischer, beinahe lästerlicher Gedanke: Moses war auf einen Berg gestiegen, um das Wort Gottes zu empfangen. Ich steige auf einen Berg, um das genaue Gegenteil zu tun.
Kirschs Motivation, auf diesen Berg zu steigen, entsprang seinem Wunsch, einer ethischen Verpflichtung nachzukommen; zugleich aber war er sich darüber im Klaren, dass sein Besuch von einer kräftigen Dosis Selbstsucht befeuert wurde: Er war begierig auf die Genugtuung, diesen selbstgefälligen Klerikern gegenüberzusitzen und ihnen ihren unmittelbar bevorstehenden Niedergang vorherzusagen.
Ihr hattet lange genug Gelegenheit, uns vorzugeben, was wir unter der Wahrheit verstehen sollen.
»Ich habe mir Ihren Lebenslauf angeschaut«, sagte der Bischof unvermittelt und blickte Kirsch über die Schulter hinweg an. »Sie haben in Harvard studiert, nicht wahr?«
»Ja. Bis zum Diplom.«
»Verstehe. Kürzlich habe ich gelesen, dass zum ersten Mal in der Geschichte Harvards mehr Atheisten und Agnostiker ein Studium aufgenommen haben als die Anhänger sämtlicher Religionen zusammen. Das ist eine sehr vielsagende Statistik, Mr. Kirsch, finden Sie nicht auch?«
Was soll ich dir darauf antworten?, ging es Kirsch durch den Kopf. Unsere Studenten werden immer klüger.
Der Wind frischte weiter auf, als sie das uralte steinerne Gemäuer auf dem höchsten Punkt des Berges erreichten. Im Halbdunkel des Eingangsbereichs war die Luft süß und schwer vom Duft nach Weihrauch. Die beiden Männer schritten durch ein dunkles Labyrinth aus Gängen. Kirsch blinzelte; es dauerte einige Zeit, bis seine Augen sich den veränderten Lichtverhältnissen angepasst hatten, während er seinem Gastgeber folgte. Schließlich erreichten sie eine außergewöhnlich kleine Holztür. Der Bischof klopfte an, öffnete die Tür und duckte sich durch den Eingang, während er Kirsch mit einer Handbewegung bedeutete, ihm zu folgen.
Unsicher trat Kirsch über die Schwelle.
Er fand sich in einem rechteckigen Saal wieder, an dessen hohen Wänden sich Bücherregale reihten, die vollgestellt waren mit antiken ledergebundenen Folianten. In regelmäßigen Abständen ragten weitere, versetzt stehende Regale wie Rippen aus den Wänden. Dazwischen standen gusseiserne Heizkörper, deren Knacken und Zischen den Saal auf unheimliche Weise lebendig erscheinen ließ. Kirsch hob den Blick zur Galerie, die von einer kunstvollen, verzierten Balustrade gesäumt wurde, die um den gesamten ersten Stock herum verlief. Voll ehrfürchtigem Staunen machte Kirsch sich bewusst, wo er sich befand.
Die legendäre Bibliothek von Montserrat. Nicht zu fassen, dass man mir Zutritt gewährt hat.
In diesem altehrwürdigen Saal wurden Gerüchten zufolge außerordentlich seltene Texte aufbewahrt, zugänglich nur den Mönchen, die ihr Leben Gott geweiht hatten und zurückgezogen hier auf diesem Berg lebten.
»Sie hatten um Diskretion gebeten«, sagte Bischof Valdespino. »Nun, dies hier ist unser abgeschiedenster Raum. Nur wenige Laien haben ihn je betreten.«
»Ein überaus großzügiges Privileg. Ich danke Ihnen.«
Kirsch folgte Valdespino zu einem großen Holztisch, an dem zwei alte Männer saßen, die offenbar auf den Bischof und seinen Besucher gewartet hatten. Der Mann zur Linken, ein Greis mit verfilztem weißen Bart und müden Augen, wirkte erschöpft. Er trug einen zerknitterten schwarzen Anzug, ein weißes Hemd und einen Fedora.
»Das ist Rabbi Yehuda Köves«, stellte der Bischof ihn vor. »Ein bekannter jüdischer Philosoph, der Standardwerke über die kabbalistische Kosmologie verfasst hat.«
Kirsch streckte den Arm über den Tisch hinweg aus und schüttelte dem Rabbi höflich die Hand. »Es ist mir ein Vergnügen, Sie kennenzulernen«, sagte er. »Ich habe einige Ihrer Bücher über die Kabbala gelesen. Ich kann nicht behaupten, sie in vollem Umfang verstanden zu haben, aber ich habe sie trotzdem gelesen.«
Köves nickte liebenswürdig und tupfte sich die wässrigen Augen mit einem Taschentuch ab.
»Und hier haben wir den hoch angesehenen Al-‘Allāma Syed al-Fadl.« Bischof Valdespino deutete auf den zweiten Mann.
Der Angesprochene, in einen unscheinbaren weißen Thawb gekleidet, erhob sich und lächelte freundlich. Er war klein und massig, und sein gutmütiges Gesicht wollte so gar nicht zu seinen dunklen, durchdringenden Augen passen.
»Ich habe Ihre Vorhersagen über die Zukunft der Menschheit gelesen, Mr. Kirsch«, sagte er. »Ich kann nicht behaupten, dass ich mit Ihren Schlussfolgerungen in vollem Umfang einverstanden bin, aber ich habe sie trotzdem gelesen.«
Kirsch lächelte liebenswürdig und schüttelte die dargebotene Hand.
»Wie Sie wissen«, wandte der Bischof sich an seine beiden Kollegen, »ist Mr. Kirsch ein renommierter Computerwissenschaftler, Erfinder und Experte auf dem Gebiet der Spieltheorie. Für viele ist er eine Art Hohepriester der modernen Technologie. In Anbetracht dieses Hintergrundes hat mich seine Bitte, uns drei zu treffen, doch sehr verwundert, muss ich gestehen. Deshalb möchte ich es Mr. Kirsch überlassen, uns den Grund für sein Kommen darzulegen. Bitte, Mr. Kirsch.«
Valdespino nahm zwischen seinen beiden Kollegen Platz, faltete die Hände auf dem Tisch und blickte Kirsch erwartungsvoll an. Die drei Männer hatten sich ihm zugewandt wie ein Richterkollegium; in dem klösterlichen Ambiente hätte man den Eindruck gewinnen können, Kirsch stünde vor einem Inquisitionstribunal. Der Bischof, wurde ihm bewusst, hatte ihm nicht einmal eine Sitzgelegenheit angeboten.
Doch Kirsch war eher belustigt als eingeschüchtert, als er die drei greisen Männer musterte, die vor ihm saßen. Das also ist die Heilige Dreifaltigkeit,ging es ihm durch den Kopf. Die Drei Weisen.
Er ließ sich Zeit, um ihnen zu demonstrieren, dass sie keine Macht über ihn besaßen. Gemächlich trat er ans Fenster und schaute hinaus auf das atemberaubende Panorama. In der Ebene tief unter ihm leuchtete das Ackerland in satten Braun- und Ockertönen, durchzogen von schwarzen Schatten; dahinter erhoben sich, glühend im Licht der Nachmittagssonne, die Höhenzüge der Serra de Collserola. Viele Kilometer weiter, draußen über dem Mittelmeer, ballten sich bedrohliche dunkle Unwetterwolken.
Wie passend, dachte Kirsch, als er an die Turbulenzen dachte, die er bald verursachen würde – zuerst in diesem Raum, dann auf der ganzen Welt.
»Meine Herren«, begann er schließlich und drehte sich zu den drei Männern um. »Ich nehme an, Bischof Valdespino hat Sie bereits über meine Bitte um Diskretion informiert. Ehe wir fortfahren, möchte ich eines klarstellen: Was ich Ihnen nun mitteilen werde, muss absolut vertraulich behandelt werden. Deshalb möchte ich Sie bitten, mir den Eid zu leisten, dass Sie schweigen werden. Sind Sie dazu bereit?«
Die drei Geistlichen nickten in stillschweigendem Einverständnis. Doch die Geste war bedeutungslos, das wusste Kirsch. Sie werden alles vertuschen. Sie dürfen nicht zulassen, dass die Welt es erfährt.
»Ich bin zu Ihnen gekommen«, fuhr er fort, »weil ich eine wissenschaftliche Entdeckung gemacht habe, die Sie zutiefst erstaunen wird. Es ist ein Thema, mit dem ich mich seit vielen Jahren beschäftigt habe in der Hoffnung, Antworten auf zwei grundlegende Fragen der menschlichen Existenz zu finden. Dieses Ziel habe ich erreicht. Nun komme ich zu Ihnen, weil das, was ich herausgefunden habe, die Gläubigen weltweit auf elementare Weise betrifft. Es wird eine Umwälzung herbeiführen, die dramatisch sein wird, vielleicht sogar zerstörerisch. Derzeit bin ich der Einzige, der über die Information verfügt, die ich Ihnen gleich enthüllen werde.«
Kirsch griff in sein Jackett und zog ein überdimensionales Smartphone – ein Phablet – hervor, dessen Hülle ein Mosaik in leuchtend bunten Farben war. Er hatte dieses Gerät selbst entworfen und nach seinen Spezifikationen anfertigen lassen, damit es seine individuellen Bedürfnisse erfüllen konnte. Nun stellte er das Phablet wie einen kleinen Fernseher vor den drei Männern auf. In wenigen Augenblicken würde er sich über dieses Gerät in einen ultrasicheren Server einloggen, sein Passwort aus siebenundvierzig Buchstaben eingeben und seine Livestream-Darbietung starten.
»Was Sie gleich sehen werden«, fuhr er fort, »ist ein Teil einer Präsentation, die ich in ungefähr einem Monat mit der ganzen Welt zu teilen hoffe. Zuvor aber wollte ich mich mit einigen der einflussreichsten religiösen Denkern der Welt austauschen, um Einblick darin zu erhalten, wie meine Entdeckung von jenen aufgenommen wird, die am meisten davon betroffen sein werden – Leuten wie Ihnen.«
Der Bischof stieß einen tiefen Seufzer aus, der eher gelangweilt als besorgt klang. »Eine faszinierende Einführung, Mr. Kirsch. Sie reden, als würde es die Fundamente sämtlicher Religionen der Welt erschüttern, was Sie uns in Kürze anvertrauen werden.«
Die Fundamente erschüttern? Kirsch ließ den Blick über das historische Repositorium altehrwürdiger Texte schweifen. Es wird sie nicht erschüttern, es wird sie zerschmettern.
Wieder schaute Kirsch auf die drei Männer vor ihm. Sie konnten nicht wissen, dass er in drei Tagen mit seiner Präsentation an die Öffentlichkeit gehen würde – im Rahmen eines spektakulären, minutiös choreographierten Events, in dessen Verlauf die Menschheit erkennen würde, dass die Lehren sämtlicher Religionen auf Erden tatsächlich eine Gemeinsamkeit hatten.
Sie alle lagen völlig falsch.
1. KAPITEL
Professor Robert Langdon schaute hinauf zu dem zwölf Meter großen Welpen, der mitten auf der Plaza saß und dessen Fell ein lebender bunter Teppich aus Gras und duftenden Blumen war.
Ich versuche ja, dich zu mögen. Ehrlich, ich versuche es.
Langdon betrachtete den Hund noch eine Zeit lang, ehe er seinen Weg fortsetzte, der ihn zuerst über einen hohen stählernen Laufsteg mit Gitterrostboden führte; dann ging es eine terrassenartig angelegte Treppe hinunter, deren Stufen in unregelmäßigen Abständen aufeinander folgten und offenbar dazu gedacht waren, eintreffende Besucher beim Gehen aus dem Rhythmus zu bringen.
Na, das Ziel habt ihr erreicht, dachte Langdon, nachdem er das zweite Mal über eine der Stufen gestolpert war.
Am Fuß der Treppe blieb er unwillkürlich stehen und starrte hinauf zu einer einschüchternden Kreatur.
Also, der Welpe eben war netter.
Vor ihm erhob sich eine gigantische Schwarze Witwe. Lange dünne Spinnenbeine aus rostfreiem Stahl trugen einen kleinen dicken Leib, der sich in etwa neun Metern Höhe befand. Am Bauch der Spinne hing ein Eiersack aus Maschendraht, gefüllt mit Kugeln aus Marmor.
»Sie heißt Maman«, sagte eine Stimme.
Langdon senkte den Blick und sah einen schlanken Mann unter der Spinne stehen. Er trug einen skurrilen Salvador-Dali-Schnurrbart und war in einen schwarzsamtenen Sherwani gekleidet.
»Mein Name ist Fernando«, fuhr der Mann fort. »Willkommen in unserem Museum.« Er überflog einen Stoß Namensschilder, die vor ihm auf dem Tisch lagen. »Dürfte ich erfahren, wie Sie heißen?«
»Ja, natürlich. Robert Langdon.«
Sofort riss der Mann den Blick von den Namensschildchen los und schaute Langdon an. »Oh, verzeihen Sie! Ich habe Sie nicht erkannt, Sir.«
Ich erkenne mich ja selbst kaum, dachte Langdon, der in seinem klassisch geschnittenen Frack mit weißer Weste und weißer Fliege ziemlich steif und verloren dastand. Ich sehe aus wie ein Sänger der Comedian Harmonists. Der Frack war fast dreißig Jahre alt und stammte noch aus der Zeit, als Langdon Mitglied des Ivy Clubs in Princeton gewesen war. In seiner Eile beim Packen hatte er sich die falsche Kleiderhülle geschnappt und seinen Smoking zu Hause im Schrank hängen lassen, doch dank seines rigorosen täglichen Schwimmtrainings saß der Frack noch ziemlich gut.
»Dresscode Black and White«, sagte Langdon. »So stand es auf der Einladung. Ich nehme an, mein Outfit ist angemessen.«
»Absolut, Sir. Sie sehen blendend aus.« Der Mann mit dem Dali-Schnurrbart kam um den Tisch herum und befestigte geschickt ein Namensschild am Revers von Langdons Frack. »Es ist mir eine Ehre, Sie kennenzulernen, Sir. Sie haben unser Museum bestimmt schon mal besucht, nicht wahr?«
Langdon starrte zwischen den Spinnenbeinen hindurch auf das schimmernde, spektakuläre Bauwerk dahinter. »Offen gesagt nein, wie ich zu meiner Schande gestehen muss. Ich war noch nie hier.«
»Nein!« Der Mann griff sich an die Stirn, als würde er jeden Moment in Ohnmacht fallen. »Sind Sie kein Freund moderner Kunst?«
Langdon hatte die Herausforderungen der modernen Kunst stets genossen – vor allem, wenn es um die Frage ging, weshalb manche Arbeiten als Meisterwerke bezeichnet wurden, beispielsweise die Drip Paintings von Jackson Pollock, die Campbell’s-Suppendosen von Andy Warhol oder die schlichten farbigen Rechtecke von Mark Rothko. Langdon gestand diesen Werken ihren kunstgeschichtlichen Rang durchaus zu, fühlte sich aber wohler, wenn er über den religiösen Symbolgehalt der Gemälde von Hieronymus Bosch oder die Pinselführung von Francisco de Goya referieren konnte.
»Ich bin Anhänger eines eher klassischen Kunstbegriffs«, entgegnete Langdon. »Ich kann mehr mit Leonardo da Vinci anfangen als mit Willem de Kooning.«
»Tatsächlich? Wo Leonardo und de Kooning sich doch so ähnlich sind?«
Langdon lächelte geduldig. »Wenn das stimmt, muss ich wohl noch einiges über de Kooning lernen.«
»Dann sind Sie hier an der richtigen Adresse.« Der Mann hob den Arm und zeigte auf das in der Ferne schimmernde Bauwerk. »In diesem Museum befindet sich eine der weltweit großartigsten Sammlungen moderner Kunst. Ich hoffe, Sie haben Ihre Freude daran.«
»Das hoffe ich auch«, sagte Langdon. »Ich wüsste nur gern, warum ich eigentlich hier bin.«
»Da geht es Ihnen wie allen anderen.« Der Mann lachte und schüttelte den Kopf. »Ihr Gastgeber gab sich sehr geheimnisvoll, was Sinn und Zweck des heutigen Events angeht. Nicht einmal das Museumspersonal weiß, was passieren wird. Nun ja, dieses Geheimnis ist der halbe Spaß an der Sache, zumal die Gerüchte überhandgenommen haben. Es sind bereits mehrere hundert Gäste eingetroffen, darunter zahlreiche Berühmtheiten, und niemand hat auch nur eine Ahnung, was heute Abend auf der Agenda steht!«
Jetzt war es an Langdon, zu lächeln. Es brauchte schon sehr viel Selbstbewusstsein, um Last-Minute-Einladungen zu verschicken, die im Grunde nichts weiter besagten als: Komm am Samstagabend. Es lohnt sich. Glaub mir. Erst recht, wenn man damit Hunderte von VIPs dazu bringen will, alles stehen und liegen zu lassen und nach Nordspanien zu fliegen, um dem Event beizuwohnen.
Langdon setzte seinen Weg unter der Spinne hindurch fort, ehe er den Blick hob und auf ein großes rotes Banner schaute, das sich im Wind blähte.
EIN ABEND MIT EDMOND KIRSCH
Edmond hat es nie an Selbstvertrauen gemangelt, dachte Langdon belustigt.
Vor mehr als zwanzig Jahren war Eddie Kirsch einer der ersten Studenten Langdons an der Harvard University gewesen – ein Computergeek mit einer Frisur wie ein Wischmopp, der von seiner Begeisterung für Codes und Zeichensysteme in Langdons Anfängerseminar gelockt worden war: Chiffren, Codes und die Sprache der Symbole. Der überragende Intellekt des jungen Mannes hatte Langdon damals sehr beeindruckt, und wenngleich Kirsch später die staubige Welt der Semiotik verlassen hatte und den strahlenden Verlockungen der Computerwissenschaften erlegen war, hatten er und Langdon eine enge Schüler-Lehrer-Bindung entwickelt, die dafür sorgte, dass beide Männer seit Kirschs Examen vor zwei Jahrzehnten in Verbindung geblieben waren.
Der Student hat seinen Lehrer längst überflügelt, dachte Langdon. Um Lichtjahre.
Mittlerweile war Edmond Kirsch weltbekannt – ein milliardenschwerer Unternehmer, Computerwissenschaftler, Erfinder, Querdenker und Futurologe. Der inzwischen Vierzigjährige hatte eine erstaunliche Anzahl modernster Technologien entwickelt, die zu atemberaubenden Fortschritten auf so unterschiedlichen Gebieten wie der Robotik, der Hirnforschung, der künstlichen Intelligenz und der Nanotechnologie geführt hatten. Seine präzisen Vorhersagen über zukünftige wissenschaftliche Durchbrüche hatten eine beinahe mystische Aura um seine Person entstehen lassen.
Langdon vermutete, dass Edmonds beinahe gespenstische Fähigkeit, richtige Prognosen zu treffen, auf sein enzyklopädisches Wissen zurückzuführen war. Solange Langdon sich erinnern konnte, war Edmond Kirsch ein unersättlicher Bücherwurm gewesen, der alles verschlungen hatte, was er in die Finger bekam. Seine Leidenschaft für Bücher und seine Fähigkeit, deren Inhalt in kürzester Zeit in sich aufzunehmen, übertraf alles, was Langdon in dieser Hinsicht je erlebt hatte.
In den vergangenen Jahren hatte Kirsch vor allem in Spanien gelebt und dies mit seiner anhaltenden Liebe zum Alte-Welt-Charme dieses Landes, seiner avantgardistischen Architektur, den exzentrischen Bars und dem perfekten Wetter begründet.
Einmal im Jahr, wenn Kirsch nach Cambridge kam, um am MIT Media Lab zu referieren, traf er sich mit Langdon zum Essen an einem der trendigen Bostoner Hotspots, die Langdon mit schöner Regelmäßigkeit gänzlich unbekannt waren. Bei ihren Gesprächen ging es nie um Technologie: Kirsch wollte mit seinem alten Lehrer immer nur über Kunst reden.
»Du bist meine Verbindung zur Kultur, Robert«, scherzte er häufig. »Mein privater Bachelor[1] of Arts.«
Dieser Seitenhieb auf Langdons Familienstand war von besonderer Ironie, kam er doch von einem eingefleischten Junggesellen-Kollegen, der Monogamie als »Affront gegen die Evolution« betrachtete und im Lauf der Jahre mit einer Vielzahl wechselnder Supermodels an seiner Seite abgelichtet worden war.
In Anbetracht der Reputation Kirschs als Innovator der Computerwissenschaften hätte man auf den Gedanken kommen können, man bekäme es mit einem zugeknöpften Techno-Nerd zu tun; stattdessen hatte er sich zu einer modernen Pop-Ikone stilisiert, die sich in Promi-Kreisen bewegte, nach der neuesten Mode kleidete, obskure Undergroundmusik hörte und eine umfangreiche Sammlung unbezahlbarer impressionistischer und moderner Kunst ihr Eigen nannte. Es kam häufig vor, dass Kirsch seinen einstigen Lehrer per E-Mail kontaktierte, um dessen Rat bezüglich neuer Objekte einzuholen, die er für seine Sammlung in Betracht gezogen hatte.
Und dann tut er jedes Mal das genaue Gegenteil von dem, was ich ihm rate, sinnierte Langdon.
Vor einem Jahr hatte Kirsch ihn überrascht, als er ausnahmsweise nicht über Kunst, sondern über Gott hatte reden wollen. Ein eigenartiges Thema für einen selbsternannten Atheisten. Bei einem Teller Crudo im Tiger Mama, einem Bostoner Szene-Restaurant, hatte Kirsch Langdons Hirn nach den zentralen Aussagen der großen Weltreligionen durchforstet, insbesondere den jeweiligen Schöpfungsgeschichten.
Langdon hatte ihm einen kurzen, aber fundierten Überblick über die Glaubensrichtungen geliefert, angefangen bei der Genesis, die für Juden, Christen und Muslime gleichermaßen Gültigkeit besaß, bis hin zur hinduistischen Geschichte Brahmas, der Geschichte des babylonischen Hauptgottes Marduk und anderen.
»Ich bin neugierig«, hatte Langdon gestanden, als sie das Restaurant verlassen hatten. »Warum interessiert sich ein Futurologe wie du mit einem Mal so brennend für die Vergangenheit? Hat unser berühmter Atheist endlich zu Gott gefunden?«
Edmond lachte herzhaft. »Wunschdenken! Ich versuche nur, meine Konkurrenz abzuschätzen, Robert.«
Langdon lächelte. Typisch. »Wissenschaft und Religion sind keine Konkurrenten, sondern zwei verschiedene Sprachen, die versuchen, ein und dieselbe Geschichte zu erzählen. In unserer Welt ist Platz genug für beide.«
Nach dieser Begegnung hatten sie fast ein Jahr lang keinen Kontakt mehr gehabt. Dann aber, wie aus heiterem Himmel, war vor drei Tagen ein FedEx-Umschlag eingetrudelt mit einem Flugticket, einer Hotelreservierung und einer handschriftlichen Notiz von Edmond, in der er Langdon drängte, am Event dieses Abends teilzunehmen. Robert, es würde mir unendlich viel bedeuten, wenn gerade du kommen würdest. Deine Einsichten während unseres letzten Treffens haben mir geholfen, diesen Abend überhaupt erst zu ermöglichen.
Langdon hatte es glatt die Sprache verschlagen. Nichts an ihrer Unterhaltung war auch nur im Entferntesten von Bedeutung gewesen für ein Event, das von einem Zukunftsforscher veranstaltet wurde.
Der FedEx-Umschlag enthielt außerdem ein Schwarzweißfoto, das zwei Personen zeigte, die sich von Angesicht zu Angesicht gegenüberstanden. Kirsch hatte dazu ein kurzes Gedicht verfasst:
Robert,
Wenn wir uns sehen
Von Angesicht zu Angesicht
Füll ich den leeren Raum mit Licht
– Edmond
Langdon musste lächeln, als er das Foto sah – eine geschickte Anspielung auf eine Episode, in die er ein paar Jahre zuvor verwickelt gewesen war. Die Silhouette eines Abendmahlskelchs oder eines Gralsbechers füllte den leeren Raum zwischen zwei Gesichtern.
Jetzt stand Langdon vor dem Museum und brannte darauf, zu erfahren, was sein einstiger Student enthüllen würde. Eine leichte Brise zerrte an seinen Frackschößen, als er den betonierten Weg am Ufer des gewundenen Flüsschens Nervión entlangging, einst die Lebensader einer blühenden Industriestadt. Die Luft roch leicht nach Kupfer.
Und dann, als Langdon eine lang gezogene Biegung hinter sich gebracht hatte, erhob es sich in seiner ganzen grotesken Fremdartigkeit vor ihm: das Guggenheim-Museum in Bilbao, Spanien.
Es war unmöglich, das gesamte Bauwerk auf einmal in sich aufzunehmen. Deshalb schweifte Langdons Blick mehrmals über die gesamte Breite des bizarren, lang gestreckten Museumsbaus hinweg.
Dieses Bauwerk verstößt gegen sämtliche Regeln,ging es Langdon durch den Kopf. Nein, viel mehr noch. Es missachtet sie vollkommen. Ein Ort, wie geschaffen für Edmond.
Das schimmernde Museumsgebäude mutete wie der Entwurf eines fremdartigen Geistes an, wie ein Fiebertraum, eine Halluzination, eine Collage aus gekrümmten und verdrehten Metallelementen, die aussahen, als wären sie auf willkürliche Weise gegeneinandergelehnt. Die Außenhülle des chaotisch anmutenden Gebildes war mit mehr als dreißigtausend Titanblechen verkleidet, die wie Fischschuppen glänzten und dem Bauwerk eine organische und zugleich extraterrestrische Aura verliehen, als wäre ein futuristischer Leviathan aus dem Wasser gekrochen, um sich am Flussufer zu sonnen.
Als das Bauwerk im Jahr 1997 enthüllt worden war, hatte der New Yorker den Architekten Frank Gehry für seinen Entwurf gefeiert und diesen als »fantastisches Traumschiff aus wogenden Formen in einem Mantel aus Titan« bezeichnet. Andere Kritiker waren in dieses Lob eingefallen und hatten in höchsten Tönen geschwärmt: »Das großartigste Bauwerk unserer Zeit!« »Berauschende Brillanz!« »Eine ganz und gar erstaunliche architektonische Leistung!«
Seit der Eröffnung des Museums waren Dutzende weiterer Gebäude im Stil des »Dekonstruktivismus« errichtet worden – die Disney Concert Hall in Los Angeles, BMW Welt in München, selbst die neue Bibliothek in Harvard, Langdons Alma Mater. Jedem dieser Bauwerke lagen ein unkonventionelles Design und eine wagemutige Konstruktion zugrunde, und doch bezweifelte Langdon, dass irgendeines davon mit dem Guggenheim-Museum in Bilbao wetteifern konnte, wenn es um den Schock des ersten Eindrucks ging.
Die titanverkleidete Fassade des Museums schien mit jedem Schritt, den Langdon näher kam, ihre Gestalt zu verändern und bot aus jeder Perspektive einen neuen, unbekannten Charakter. Langdon stockte der Atem, als die dramatischste Veränderung eintrat: Mit einem Mal schien die kolossale Struktur auf dem Wasser zu schweben, auf einer unendlich anmutenden Infinity-Lagune, deren Wogen träge gegen die Außenwände schwappten.
Langdon blieb einen Moment stehen, um das Bild zu bestaunen, ehe er den Weg über die minimalistische Brücke einschlug, von der die glasartige Wasserfläche der Lagune überspannt wurde. Er war erst auf halbem Weg, als ihn ein lautes Zischen, das direkt unter ihm ertönte, erschreckt innehalten ließ. Im gleichen Augenblick quoll eine wirbelnde Nebelwolke zu beiden Seiten unter der Brücke hervor. Ein dichter Schleier erhob sich ringsum, breitete sich über die Lagune aus, wogte auf das Museum zu und hüllte dessen gesamte Basis ein.
Die Nebelskulptur, dachte Langdon.
Er hatte von dieser Arbeit der japanischen Künstlerin Fujiko Nakaya gelesen. Die »Skulptur« war insofern revolutionär, als sie aus sichtbar gemachter Luft bestand – eine Wand aus Nebel, die materialisierte und sich mit der Zeit wieder auflöste. Aufgrund der Luftbewegungen und wechselnden atmosphärischen Bedingungen veränderte sich ihr Aussehen von Tag zu Tag.
Das Zischen unter der Brücke verstummte, und Langdon verfolgte, wie sich die Wand aus Nebel lautlos über die Lagune senkte, dann weiterkroch und sich wand, als hätte sie ein eigenes Bewusstsein. Der Effekt war ätherisch und desorientierend. Das Museumsgebäude schien gewichtslos auf dem Wasser zu schweben, getragen von einer Wolke – ein Geisterschiff, verloren auf einem unendlichen Meer.
Langdon wollte schon weitergehen, als die stille Oberfläche des Wassers durch eine Aufeinanderfolge kleiner Eruptionen in heftige Bewegung geriet. Unvermittelt schossen Flammensäulen himmelwärts, begleitet von einem dumpfen Grollen wie von Raketenantrieben, und fraßen sich durch den Nebel, um funkelnde Lichtblitze auf die silbrigen Titankacheln des Museums zu schleudern.
Klassische Museumsbauten wie der Louvre in Paris oder der Prado waren eher nach Langdons architektonischem Geschmack, doch während er den Kampf zwischen Nebel und Feuer über der Lagune beobachtete, wollte ihm kein Veranstaltungsort einfallen, der besser als dieses ultramoderne Bauwerk für das bevorstehende Ereignis geeignet gewesen wäre – ein Event, inszeniert von einem Mann, der die Kunst und die Wissenschaft liebte und der einen so klaren Blick auf die Zukunft besaß wie kein Zweiter.
Langdon durchschritt die Nebelwand und hielt zielstrebig auf den Eingang zu, ein bedrohlich wirkendes schwarzes Loch in der panzergleichen Außenhaut der reptilienartigen Struktur. Als er sich der Schwelle näherte, hatte er das beunruhigende Gefühl, in das Maul eines Drachen zu steigen.
2. KAPITEL
Almirante Luis Ávila saß auf einem Barhocker in einer fast leeren Kneipe in einer unbekannten Stadt. Er war erschöpft von seiner Reise, war er doch gerade erst in dieser Stadt gelandet, nachdem seine Mission ihn im Verlauf von zwölf Stunden über viele tausend Kilometer geführt hatte.
Ávila nahm einen Schluck von seinem zweiten Tonic Water und blickte auf das farbenfrohe Sammelsurium von Flaschen an der Wand hinter dem Tresen.
In einer Wüste kann jeder nüchtern bleiben, sinnierte er, aber nur der Standhafte kann in einer Oase sitzen, ohne die Lippen zu öffnen.
Ávila hatte die Lippen seit fast einem Jahr nicht mehr für den Teufel Alkohol geöffnet. Als er nun in den Spiegel hinter dem Tresen schaute, erlaubte er sich einen seltenen Augenblick der Zufriedenheit bei dem Anblick, der sich ihm bot.
Luis Ávila war einer jener beneidenswerten Südeuropäer, die mit zunehmendem Alter kaum an Attraktivität verloren, im Gegenteil. Mit den Jahren hatten sich seine einst harten schwarzen Stoppeln in einen distinguiert aussehenden graumelierten Bart verwandelt, und seine straffe, tief gebräunte Haut war von Wind und Wetter gegerbt und verlieh ihm die Aura eines Mannes, der den größten Teil seines Lebens auf dem Meer verbringt.
Trotz seiner dreiundsechzig Jahre war er schlank und durchtrainiert; seine beeindruckende Physis wurde durch seine strahlend weiße, maßgeschneiderte Kleidung noch unterstrichen – die Ausgehuniform eines Almirante der spanischen Marine: zweireihiges Sakko mit breiten schwarzen Schulterklappen und einer imposanten Sammlung von Orden und Dienstabzeichen auf dem Brustteil, dazu ein Hemd mit Stehkragen und eine mit Seide gefasste Hose.
Die spanische Armada mag nicht mehr die mächtigste Flotte der Welt sein, aber wir wissen immer noch, wie man einen Offizier kleidet.
Der Admiral hatte diese Uniform seit Jahren nicht mehr getragen, doch heute war eine besondere Nacht. Als er durch die Straßen dieser unbekannten Stadt geschlendert war, hatte er die begehrlichen Blicke der Frauen genauso sehr genossen wie die Reaktion der Männer, die einen weiten Bogen um ihn machten.
Wer nach einem Kodex lebt, wird von allen respektiert.
»¿Otra tónica?«, fragte die hübsche Frau hinter dem Tresen. Sie war Mitte zwanzig, mit üppiger Figur und attraktivem Lächeln.
Ávila schüttelte den Kopf. »No, gracias.«
Er spürte die bewundernden Blicke der jungen Frau auf sich ruhen. Es fühlte sich gut an, wieder wahrgenommen zu werden.
Ich bin zurück aus dem Abgrund.
Das schreckliche Unglück, das Ávilas Leben vor fünf Jahren beinahe zerstört hätte, würde für immer in den dunklen Winkeln seines Verstandes lauern – ein einziger verheerender Augenblick, als der Boden sich unter seinen Füßen aufgetan und ihn in einem Stück verschlungen hatte.
Die Kathedrale von Sevilla.
Am Ostermorgen.
Das klare Licht der andalusischen Sonne fiel durch die Glasfenster und warf Bahnen und Pfützen aus glühenden Farben in das steinerne Innere des Gotteshauses, das erfüllt war von rauschenden Orgelklängen, während Tausende von Gläubigen das Wunder der Wiederauferstehung feierten.
Ávila kniete auf der Kommunionbank, durchströmt von einem Gefühl tiefer Dankbarkeit. Nach einem Leben des Dienstes auf See war er mit dem größten Geschenk gesegnet worden, das Gott zu geben hatte – einer Familie. Mit glücklichem Lächeln drehte er sich um und schaute über die Schulter auf Maria, seine junge Frau, die noch immer an ihrem Platz saß, hochschwanger und zu ungelenk, als dass sie den Weg zur Kommunionbank hätte zurücklegen können. Sie bemerkte den Blick ihres Mannes und lächelte ihn liebevoll an. Neben Maria saß Pepe, ihr gemeinsamer Sohn, und winkte seinem Vater mit der überschwänglichen Begeisterung eines Dreijährigen. Ávila zwinkerte dem Jungen zu.
Danke, Herr, dachte er, als er sich wieder zur Brüstung umdrehte, um die Hostie zu empfangen.
Den Bruchteil einer Sekunde später wetterte ein ohrenbetäubendes Krachen durch die Kathedrale.
Mit einem Lichtblitz stand Ávilas Welt in Flammen.
Die Druckwelle der Explosion schleuderte ihn mit verheerender Wucht gegen die Balustrade, wo ein glühend heißer Sturm aus Trümmern und menschlichen Körperteilen über ihn hinwegfegte.
Als Ávila das Bewusstsein wiedererlangte, bekam er im dichten Rauch kaum noch Luft. Für einen schrecklichen Augenblick wusste er nicht, wo er sich befand und was sich zugetragen hatte.
Dann hörte er über das Klingeln in seinen Ohren hinweg die gequälten Schreie. Er kämpfte sich hoch, sah sich um und erkannte voller Entsetzen, wo er war. Bitte, Herr, mach, dass es nur ein Alptraum ist. Er stolperte durch die raucherfüllte Kathedrale nach hinten, stieg über stöhnende, verstümmelte Opfer hinweg, erfüllt von schrecklichen Vorahnungen, und taumelte zu der Stelle, an der sein Sohn und seine Frau noch Augenblicke zuvor lächelnd gesessen hatten.
Da war nichts mehr.
Keine Kirchenbänke.
Keine Menschenseele.
Nur blutige Trümmer auf dem geschwärzten Steinboden.
Die Eingangstür der Bar klingelte und riss Ávila aus seinen schmerzlichen Erinnerungen. Er packte das Glas, nahm hastig einen Schluck von seiner tónica und kämpfte sich aus der Düsternis ans Licht.
Die Tür der Bar schwang auf.
Ávila drehte sich um. Zwei Männer kamen hereingetorkelt. Hooligans. Sie trugen grüne fútbol-Trikots, die sich über ihren Bäuchen spannten, und grölten ein irisches Kampflied. Offenbar hatte die irische Gastmannschaft das nachmittägliche Länderspiel für sich entschieden.
Das ist mein Zeichen. Ávila erhob sich. Ich muss gehen. Er bat um die Rechnung, aber das Barmädchen zwinkerte ihm zu und winkte ab. Ávila dankte ihr und wandte sich zur Tür.
»Da will ich doch verdammt sein!«, rief einer der Neuankömmlinge und starrte auf Ávilas prächtige Uniform. »Der spanische König!«
Die beiden Männer krümmten sich vor Lachen und wankten ihm entgegen.
Ávila versuchte, ihnen auszuweichen, um zur Tür zu gelangen, doch der größere der beiden packte ihn grob am Arm, zerrte ihn mit sich zum Tresen und stieß ihn auf einen Barhocker. »Immer langsam, Hoheit!«, grölte er. »Wir sind den ganzen weiten Weg nach Spanien gekommen. Jetzt wollen wir ein Bier mit dem König trinken!«
Ávila musterte die schmuddelige Hand auf seinem frisch gebügelten Ärmel. »Lassen Sie mich los«, sagte er leise. »Ich muss gehen.«
»Nichts da. Du bleibst auf ein Bier bei uns.« Der Mann packte noch fester zu, während sein Kumpan mit einem verdreckten Finger auf die Orden an Ávilas Brust tippte. »Du bist wohl ein Held, was?« Er zupfte an dem Orden, den Ávila am meisten schätzte. »Ein Streitkolben! Bist du der Ritter von der traurigen Gestalt, oder was?« Er wieherte vor Belustigung.
Toleranz, rief Ávila sich ins Bewusstsein. Er war zahlreichen Menschen wie diesen begegnet – schlichte, bedauernswerte Seelen, die sich nie für etwas eingesetzt, nie etwas bewirkt hatten und die in dumpfer Einfalt jene Freiheiten missbrauchten, die andere ihnen mutig erkämpft hatten.
»Nein. Der Streitkolben ist das Symbol der Unidad de Operaciones Especiales der spanischen Marine«, erwiderte Ávila sanft.
»Eine Spezialeinheit? Wow.« Der Hooligan ahmte ein ehrfurchtsvolles Schaudern nach. »Mann, das ist echt beeindruckend. Und was ist das da für ein Ding?« Er deutete auf Ávilas rechte Hand.
Ávila blickte hinunter auf seine Handfläche, auf die schwarze Tätowierung, die ein Emblem zeigte, das auf das vierzehnte Jahrhundert zurückging.
Dieses Symbol dient zu meinem Schutz, dachte er, als er die Tätowierung betrachtete. Auch wenn ich es nicht brauche – nicht heute.
»Na, egal«, sagte der Hooligan, ließ Ávilas Arm los und richtete seine Aufmerksamkeit auf das Mädchen hinter dem Tresen. »Na,Süße?« Er grinste. »Bist du Spanierin?«
»Ja, bin ich«, antwortete sie.
»Hundert Prozent? Du hast nichts Irisches in dir?«
»Nein.«
»Dann wird’s Zeit, dass mal ein Schuss davon in dich reinkommt.« Der Hooligan zeigte auf seinen Hosenschlitz, stieß ein schrilles Lachen aus und hämmerte die Faust auf den Tresen.
»Lassen Sie die Frau in Ruhe«, sagte Ávila.
Der Mann fuhr zu ihm herum, funkelte ihn an.
Der zweite Hooligan stieß Ávila die Faust gegen die Brust. »Hey, Meister. Willst du uns sagen, was wir zu tun haben?«
Ávila holte tief Luft. Er fühlte sich erschöpft nach der langen Reise des Tages. Müde deutete er auf den Tresen. »Bitte setzen Sie sich doch, Gentlemen. Ich lade Sie zu einem Bier ein.«
Schön, dass er geblieben ist, ging es dem Barmädchen durch den Kopf. Sie konnte gut auf sich selbst aufpassen, doch als sie nun beobachtete, wie ruhig und gelassen der Offizier mit den beiden Schlägern umging, erschien ihr dieser gut aussehende Mann noch attraktiver als zuvor. Vielleicht bleibt er ja, bis ich schließe.
Der Offizier hatte zwei Bier und ein weiteres Tonic für sich selbst bestellt, nachdem er wieder auf dem Hocker am Tresen Platz genommen hatte. Die beiden Hooligans saßen rechts und links von ihm.
»Tonic?«, spottete der eine. »Ich dachte, wir trinken zusammen.«
Der Offizier lächelte das Barmädchen müde an und leerte sein Glas.
»Ich fürchte, ich muss jetzt gehen«, sagte er. »Ich habe einen Termin. Genießen Sie Ihr Bier.«
Als Ávila sich erheben wollte, legten beide Männer wie auf ein Kommando ihre rauen Hände auf seine Schultern und drückten ihn zurück auf den Hocker. In den Augen des Offiziers loderte ein Funke heißen Zorns auf, verschwand aber sogleich wieder.
»Ich glaub nicht, Alter, dass du uns mit deiner Freundin allein lassen möchtest.« Der Hooligan beäugte das Barmädchen und machte eine obszöne Geste mit der Zunge.
Ávila blieb ein paar Sekunden regungslos sitzen, dann griff er in seine Jacke.
Beide Kerle packten ihn. »Hey! Was hast du vor?«
Langsam zog der Offizier ein Mobiltelefon aus der Jackentasche und sagte etwas auf Spanisch. Als die Schläger ihn verständnislos beäugten, wechselte er ins Englische. »Entschuldigung, ich muss kurz meine Frau anrufen und ihr Bescheid sagen, dass ich später komme. Sieht so aus, als würde ich noch ein Weilchen bleiben.«
»Endlich redest du vernünftig, amigo«, sagte der größere der beiden Schläger, leerte sein Glas und stellte es krachend auf dem Tresen ab. »Noch eins!«
Während das Barmädchen die Gläser der Hooligans nachfüllte, beobachtete sie im Spiegel, wie der Offizier auf dem Display seines Smartphones tippte und es sich dann ans Ohr hielt. Der Anruf wurde entgegengenommen, und er sprach in schnellem Spanisch in den Hörer.
»Le llamo desde el Bar Molly Malone«, las er den Namen der Bar vom Bierdeckel vor sich ab, dann die Adresse: »Calle Particular de Estraunza, ocho.«
Er lauschte einen Moment. »Necesitamos ayuda inmediatamente«, sagte er dann. »Hay dos hombres heridos.«
¿Dos hombres heridos? Der Herzschlag des Barmädchens beschleunigte sich. Zwei verletzte Männer?
Bevor sie die Bedeutung dieser Worte verarbeiten konnte, geschah es. Ein verschwommener weißer Schemen, und der rechte Ellbogen des Offiziers zuckte nach oben und landete krachend auf der Nase des größeren der beiden Hooligans. Es gab ein widerwärtig knirschendes Geräusch. Blut spritzte über das Gesicht des Mannes, und er kippte nach hinten. Bevor der zweite Schläger reagieren konnte, fuhr der Offizier zu ihm herum und drosch ihm den linken Ellbogen mit Wucht gegen den Kehlkopf. Der Mann flog hintenüber vom Hocker.
Das Mädchen starrte schockiert auf die beiden Hooligans, die zappelnd am Boden lagen. Der eine schrie sich die Seele aus dem Leib, der andere hielt seine Kehle umklammert und rang mit einem pfeifenden Geräusch nach Atem.
Der Offizier erhob sich gemächlich. Mit beinahe unheimlicher Ruhe zog er seine Geldbörse aus der Tasche und legte einen Hunderteuroschein auf den Tresen.
»Entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten«, sagte er auf Spanisch zu dem Mädchen. »Die Polizei wird gleich hier sein und Ihnen helfen.« Damit wandte er sich um und ging.
Draußen auf der Straße atmete Ávila tief durch und genoss die kühle Abendluft, ehe er durch die Via Alamede de Mazarredo in Richtung des Flusses eilte. Als er das Heulen von Polizeisirenen hörte, das sich rasch näherte, huschte er in die Schatten. Er konnte sich an diesem Abend keine weiteren Verzögerungen und Komplikationen leisten. Die Aufgabe, die auf ihn wartete, war viel zu schwer.
Der Regent hat die Mission klar umrissen.
Ávila nahm die Befehle des Regenten stets aufmerksam, aber gelassen hin. Keine Diskussionen, kein Verhandeln. Nur gehorchen. Nach vielen Jahren in einem Beruf, in dem er selbst die Befehle erteilt hatte, war es eine Erleichterung für Ávila, das Ruder aus der Hand geben zu können und andere das Schiff steuern zu lassen.
In diesem Krieg bin ich nur Fußsoldat.
Vor ein paar Tagen hatte der Regent ihm ein Geheimnis anvertraut, das so verstörend war, so beängstigend, dass Ávila sich der Sache mit Leib und Seele verschrieben hatte. Die Brutalität seiner Mission vom vergangenen Abend verfolgte ihn noch immer, aber er wusste, dass man ihm vergeben würde, was er getan hatte.
Die Gerechtigkeit kann vielerlei Gestalt annehmen.
Es wird noch mehr Tote geben, bevor diese Nacht um ist.
Als Ávila auf einen leeren Platz am Flussufer gelangte, hob er den Blick und schaute auf das ungeheure Bauwerk, das sich vor ihm erhob, eine wogende Masse aus perversen Formen, gehüllt in glänzende Fliesen aus Metall – als hätte jemand Tausende von Jahren architektonischer Entwicklung aufgegeben, um sich für Chaos und Hässlichkeit zu entscheiden.
Es gibt Leute, die nennen dieses Ding ein Museum. Ich nenne es eine Monstrosität.
Ávila atmete tief durch und sammelte sich. Dann überquerte er die Plaza vor dem Guggenheim-Museum in Bilbao und folgte dem gewundenen Weg zwischen einer Reihe bizarrer Skulpturen hindurch. Als er sich dem Museumsgebäude näherte, sah er Dutzende von Gästen in eleganter Abendgarderobe, die zum Eingang strebten.
Die Heerscharen der Gottlosen versammeln sich.
Aber der heutige Abend wird anders verlaufen, als sie sich träumen lassen.
Ávila rückte seine Admiralsmütze zurecht, strich seine Uniformjacke glatt und wappnete sich innerlich auf die vor ihm liegende Aufgabe. Sie war Teil einer weit größeren Mission – eines Kreuzzugs für die Gerechtigkeit.
Als Ávila den weitläufigen Hof überquerte, hinter dem sich der Eingang der architektonischen Abscheulichkeit befand, tastete er behutsam nach dem Rosenkranz in seiner Tasche.
3. KAPITEL
Das Atrium des Guggenheim sah wie eine futuristische Kathedrale aus.
Nachdem Langdon eingetreten war, schweifte sein Blick in die Höhe, wanderte an zwei kolossalen weißen Säulen hinauf zu einem riesigen Vorhang aus Glas, der in sechzig Metern Höhe unter einer Gewölbedecke endete, angestrahlt von reinweißem Licht aus Halogenscheinwerfern. Hoch in der Luft befand sich ein Netzwerk aus kreuz und quer verlaufenden Stegen und Balkonen, das zu schweben schien und gesprenkelt war von festlich gekleideten Besuchern, die dort oben über die Galerien strömten oder vor den hohen Fenstern standen und die Lagune draußen vor dem Gebäude bewunderten. Ein Glasaufzug schwebte lautlos an einer Wand herab und kehrte zur Erde zurück, um weitere Gäste aufzunehmen.
Das Guggenheim war anders als alles, was Langdon je an Museen besucht hatte. Selbst die Akustik klang fremdartig. Statt der ehrfurchtsvollen musealen Stille, erschaffen durch schalldämpfende Oberflächen, war dieser Ort lebendig, erfüllt vom Klang raunender Stimmen, die von Stein und Glas widerhallten. Lediglich der sterile Geschmack auf der Zunge war Langdon vertraut: Museumsluft war überall gleich, akribisch gefiltert, von allen Oxidantien und Staubpartikeln befreit und mit ionisiertem Wasser auf exakt fünfundvierzig Prozent Luftfeuchte gebracht.
Langdon bewegte sich zwischen mehreren überraschend dichten Kordons aus Sicherheitsposten hindurch – hier gab es weit mehr als nur eine Handvoll bewaffneter Wachleute – und fand sich schließlich vor einem weiteren Empfangsschalter wieder. Eine junge Frau verteilte Kopfhörer.
»¿Audioguía?«, fragte sie.
Langdon lächelte. »Nein danke.«
Doch als er sich dem Tisch näherte, hielt die Frau ihn auf und sprach ihn in perfektem Englisch an: »Tut mir leid, Sir, aber Mr. Kirsch, unser Gastgeber am heutigen Abend, hat darum gebeten, dass jeder einen Kopfhörer trägt. Es ist Bestandteil dieses Events.«
»Wenn das so ist …«
Langdon wollte nach einem der Kopfhörer greifen, doch sie winkte ab, überprüfte sein Namensschild anhand einer langen Gästeliste und reichte ihm schließlich ein Headset, das mit der gleichen Nummer versehen war wie sein Name auf der Liste. »Die Führungen sind für jeden Besucher individuell zusammengestellt«, erklärte sie.
Tatsächlich? Langdon blickte sich um. Es sind Hunderte von Gästen!
Langdon drehte den Kopfhörer in den Händen und betrachtete ein wenig ratlos das schlanke Gestell aus Metall mit den winzigen Plättchen an den Enden. Offenbar hatte die Frau seinen Blick richtig interpretiert, denn sie kam um den Tisch herum, um ihm zu helfen.
»Das ist eine ziemlich neue Technologie«, sagte sie und half Langdon beim Aufsetzen des Headsets. »Die Transducer-Plättchen werden nicht auf das Ohr aufgesetzt, sondern unmittelbar davor.« Sie legte das Metallgestell hinter Langdons Kopf und platzierte die Transducer so, dass sie federleicht auf dem Bereich zwischen Kieferknochen und Schläfe aufsaßen.
»Aber wie …«
»Knochenübertragung, Sir. Die Transducer übermitteln den Schall auf die Kieferknochen und somit ohne Umweg auf die Hörschnecke des Innenohrs. Ich habe es selbst ausprobiert. Es ist wirklich erstaunlich – als spräche eine Stimme mitten im Kopf. Außerdem bleiben Ihre Ohren frei, und Sie können an Unterhaltungen teilnehmen, wann und wo es Ihnen gefällt.«
»Sehr einfallsreich.«
»Mr. Kirsch hat die Technologie vor mehr als einem Jahrzehnt erfunden. Heute ist sie in zahlreichen Geräten der verschiedensten Hersteller zu finden.«
Ich hoffe, Ludwig van Beethoven bekommt seine Prozente, dachte Langdon.
Tatsächlich hatte kein Geringerer als der große Komponist sich die Tatsache zunutze gemacht, dass Schall durch menschliche Knochen geleitet wurde. Nachdem er taub geworden war, gewöhnte Beethoven sich an, das eine Ende eines dünnen Holzstabs an sein Klavier zu drücken, während er sich das andere Ende zwischen die Zähne klemmte. Auf diese Weise gelangten die akustischen Schwingungen über den Holzstab und die Zähne an den Kieferknochen und weiter an das Innenohr, sodass Beethoven zumindest ahnungsweise »hören« konnte, was er komponierte.
»Wir hoffen, Sie genießen Ihre Tour«, sagte die Frau. »Sie haben ungefähr eine Stunde Zeit, das Museum zu erkunden, bevor Mr. Kirschs Präsentation beginnt. Ihr Audioguide wird Sie informieren, wann es Zeit ist, sich nach oben ins Auditorium zu begeben.«
»Danke. Muss ich auf irgendetwas drücken oder so?«
»Nein, das Gerät aktiviert sich von allein. Ihre geführte Tour beginnt, sobald Sie sich in Bewegung setzen.«
»Ja, natürlich«, sagte Langdon, lächelte die Frau an und machte sich dann auf den Weg, schlenderte durch das Atrium auf eine Gruppe anderer Gäste zu, die vor den Aufzügen warteten und allesamt die gleichen Kopfhörer trugen wie er selbst.
Er hatte erst die Hälfte des Weges zurückgelegt, als tief im Innern seines Kopfes eine Männerstimme erklang. »Guten Abend und willkommen im Guggenheim-Museum in Bilbao.«
Obwohl Langdon wusste, dass die Stimme aus dem Kopfhörer gekommen war, hielt er verdutzt inne und drehte sich um. Die Wirkung war verblüffend – genau, wie die junge Frau es beschrieben hatte: Als spräche eine Stimme mitten im Kopf.
»Ein herzliches Willkommen, Professor Langdon«, fuhr die Stimme freundlich und mit schwungvollem britischen Akzent fort. »Mein Name ist Winston. Ich habe die Ehre, Sie am heutigen Abend durch das Museum zu führen.«
Wen haben die hier als Sprecher unter Vertrag? Hugh Grant?
»Tun Sie sich keinen Zwang an. Streifen Sie nach Lust und Laune durch das Guggenheim, und sehen Sie sich an, was immer Sie interessiert«, fuhr die beschwingte Stimme fort. »Ich werde mich nach Kräften bemühen, Ihnen zu erklären, was Sie sich gerade anschauen.«
Anscheinend war jeder Kopfhörer – zusätzlich zu einem individuellen Erzähler, personalisierten Aufzeichnungen und Knochenleittechnologie – obendrein mit einem GPS-Sender ausgestattet, sodass das Gerät exakt bestimmen konnte, wo der Besucher stand und welcher Kommentar zu welchem Kunstwerk aktiviert werden musste.
»Mir ist bewusst, Sir, dass Sie als Kunstprofessor einer unserer fachlich versiertesten Gäste sind«, fuhr die Stimme fort. »Vielleicht benötigen Sie meine Hilfe deshalb nur in geringem Maße oder gar nicht. Schlimmer noch – es wäre möglich, dass Sie völlig anderer Meinung sind als ich, was die Analyse bestimmter Museumsobjekte betrifft.« Langdon stutzte: Die Stimme kicherte verlegen!
Du meine Güte,ging es ihm durch den Kopf. Wer hat bloß dieses Skript geschrieben? Der fröhliche Tonfall und der personalisierte Dienst waren zugegebenermaßen ein charmanter Einfall, aber Langdon konnte sich nicht annähernd vorstellen, wie viel Mühe es gekostet haben mochte, Hunderte von Kopfhörern auf diese Weise individuell vorzubereiten.
Zum Glück verstummte die Stimme in diesem Moment. Anscheinend hatte sie ihren programmierten Willkommensgruß abgespult.
Langdons Blick schweifte durch das Atrium und richtete sich auf ein weiteres riesiges Banner, das über der Menge hing:
EDMOND KIRSCHHEUTE ABEND BEGINNT DIE ZUKUNFT
Was um alles in der Welt wird er wohl ankündigen?
Langdon wandte den Blick zu den Aufzügen, wo eine Gruppe plaudernder Gäste stand, einschließlich zweier berühmter Gründer globaler Internetkonzerne, eines prominenten indischen Schauspielers und mehrerer anderer gut gekleideter VIPs, von denen Langdon überzeugt war, sie kennen zu müssen, ohne dass er wusste, wen er vor sich hatte. Er war auch nicht willens – und noch weniger darauf vorbereitet –, Smalltalk über Sinn und Unsinn sozialer Netzwerke oder den künstlerischen Wert von Bollywood-Filmen zu führen, also bewegte er sich in eine andere Richtung, hin zu einem riesenhaften Werk moderner Kunst an der gegenüberliegenden Wand der Halle.
Die Installation war in eine dunkle Grotte eingebettet und bestand aus neun schmalen Fließbändern, die aus Schlitzen im Boden kamen und steil in die Höhe führten, bis sie in der Decke verschwanden. Die Bänder erinnerten an motorisierte Gehwege, nur dass sie vertikal statt horizontal verliefen. Jedes Band transportierte eine illuminierte Botschaft, die nach oben scrollte:
Ich bete laut … ich rieche dich auf meiner Haut … ich sage deinen Namen.
Als Langdon näher trat, erkannte er, dass die Bänder sich in Wirklichkeit gar nicht bewegten. Die Illusion wurde durch eine »Haut« aus winzigen LEDs auf den verschiedenen Bändern erschaffen, die in rascher Folge aufblinkten und auf diese Weise Worte formten, die sich aus dem Fußboden materialisierten und hinauf zur Decke schossen, wo sie verschwanden.
Ich weine bitterlich … überall Blut … niemand hat mir etwas gesagt.
Langdon bewegte sich um die vertikalen Bänder herum und nahm das gesamte Objekt in sich auf.
»Ein reizvolles Kunstwerk, nicht wahr?«, sagte der Audioguide, plötzlich wieder aktiv. »Es trägt den Titel Installation für Bilbao und wurde von der Konzeptkünstlerin Jenny Holzer geschaffen. Es besteht aus neun LED-Bändern, jeweils zwölf Meter hoch. Jedes dieser Bänder transportiert Zitate auf Baskisch, Spanisch und Englisch, die sich allesamt auf die Schrecken beziehen, die Aids heraufbeschworen hat, und den Schmerz, den die Hinterbliebenen der Aids-Opfer erlitten haben.«
Langdon musste einräumen, dass die Wirkung hypnotisch war und auf eigenartige Weise sein Inneres berührte.
»Vielleicht haben Sie früher schon Arbeiten von Jenny Holzer gesehen?«
Langdon blickte wie gebannt auf den nach oben scrollenden Text.
Ich vergrabe meinen Kopf … ich begrabe deinen Kopf … ich begrabe dich.
»Mr. Langdon?« Die Stimme im Innern seines Schädels wurde drängend. »Können Sie mich hören? Funktioniert Ihr Headset?«
Langdon schreckte aus seinen Gedanken. »Entschuldigung … was? Hallo?«
»Ja, hallo«, entgegnete die Stimme. »Ich glaube, wir haben uns bereits begrüßt. Ich wollte mich nur vergewissern, ob Sie mich hören.«
»Ich … es tut mir leid«, stammelte Langdon, drehte sich um und ließ den Blick durch das Atrium schweifen. »Ich dachte, du wärst eine Aufzeichnung. Mir war nicht bewusst, dass ich es mit einer lebenden Person zu tun habe.«
Er stellte sich eine lange Reihe von Kabinen vor, bemannt mit einer Armee von Kuratoren, bewaffnet mit Kopfhörern und Museumskatalogen.
»Nicht weiter schlimm, Sir. Ich bin heute Abend Ihr persönlicher Guide. Ihr Headset ist mit einem Mikrofon ausgestattet. Dieses Programm ist als interaktive Erfahrung ausgelegt. Sie können einen Dialog über Kunst mit mir führen.«
Erst jetzt sah Langdon, dass auch andere Gäste mit sich selbst zu reden schienen. Sogar diejenigen, die als Paare oder in der Gruppe gekommen waren, hatten sich mehrere Schritte voneinander entfernt und wechselten verwirrte Blicke, während sie mit ihren persönlichen Dozenten private Konversationen führten.
»Hat heute Abend jeder Gast seinen eigenen Museumsführer?«, fragte Langdon.
»So ist es, Sir. Heute Abend wird jeder der dreihundertachtzehn Gäste individuell betreut.«
»Also … das ist wirklich unglaublich!«
»Wie Sie wissen, Sir, ist Edmond Kirsch ein glühender Verehrer von Kunst und Technologie. Er hat dieses System eigens für Museen entwickelt, in der Hoffnung, Gruppenführungen zu ersetzen, von denen er persönlich rein gar nichts hält. Auf die von ihm erdachte Weise kann jeder Besucher seine ganz persönliche Führung genießen, das Tempo selbst bestimmen, mit dem er sich durch die Ausstellungsräume bewegt, und Fragen stellen, die er in einer Gruppe aus Verlegenheit oder aus welchen Gründen auch immer möglicherweise nicht stellen würde. Die Erfahrung eines Museumsbesuchs ist auf diese Weise viel intensiver und intimer.«
»Ich möchte ja nicht altmodisch erscheinen, aber weshalb wird nicht jeder Besucher von einer Person aus Fleisch und Blut herumgeführt?«
»Logistik«, erklang es aus dem Headset. »Private Guides bei einem Museumsevent würden die Zahl der im Museum anwesenden Personen verdoppeln und somit die Zahl möglicher Besucher zu jedem gegebenen Zeitpunkt halbieren. Und das babylonische Sprach- und Stimmengewirr, das entstehen würde, wenn alle Dozenten gleichzeitig ihre Vorträge hielten, wäre in höchstem Maße ablenkend. Hinter dem System von Mr. Kirsch steht der Gedanke, das Zwiegespräch mit dem Dozenten zu einer reinen und unverfälschten Erfahrung zu machen. Den zwischenmenschlichen Dialog zu fördern ist eines der großen Ziele aller Kunst, wie Mr. Kirsch zu sagen pflegt.«
»Das ist es ja gerade«, entgegnete Langdon. »Dieser zwischenmenschliche Dialog ist der Grund, weshalb viele Leute ein Museum zusammen mit einem Ehepartner, mit Freundin oder Freund besuchen. Diese Headsets könnte man ohne Weiteres als antisozial betrachten, findest du nicht?«
»Keineswegs«, erwiderte die Stimme in Langdons Kopf. »Wenn Sie mit einer Begleitung kommen, besteht die Möglichkeit, zwei Headsets dem gleichen Dozenten zuzuweisen und eine Gruppendiskussion zu genießen. Die Software ist sehr weit entwickelt.«
»Du scheinst auf alles eine Antwort zu haben.«
»Das ist mein Job, Professor.« Die Stimme lachte verlegen und wechselte das Thema. »Wenn Sie nun das Atrium durchqueren, Sir, und zu den Fenstern gehen, können Sie dort das größte Gemälde des Museums genießen.«
Als Langdon sich auf den Weg machte, kam er an einem attraktiven Paar vorbei, beide Mitte dreißig, beide mit weißen Baseballmützen im Partnerlook. Auf der Vorderseite der Mützen prangte statt eines Firmenlogos ein unerwartetes Emblem:
Es war ein Symbol, das Langdon sehr gut kannte, doch auf einer Mütze hatte er es noch nie gesehen. In den vergangenen Jahren war der durchstilisierte Buchstabe A zum weithin bekannten Zeichen für eine der am schnellsten wachsenden Bevölkerungsgruppen des Planeten geworden, der Atheisten, die sich mit jedem Tag lauter gegen die Gefahren des religiösen Glaubens wandten – oder das, was sie dafür hielten.
Und jetzt haben sie ihre eigenen Baseballmützen? Wow!
Während Langdons Blick über die versammelten technikaffinen Genies glitt, rief er sich ins Gedächtnis, dass viele dieser jungen analytischen Geister mit hoher Wahrscheinlichkeit antireligiös eingestellt waren, genau wie Edmond. Das Publikum an diesem Abend war nicht gerade die Stammhörerschaft eines Professors für religiöse Symbologie.
4. KAPITEL
ConspiracyNet.com
Update: Um die »Top 10 Media News des Tages« auf ConspiracyNet aufzurufen, bitte hierklicken.
Außerdem erreicht uns soeben folgende brandaktuelle Information:
EDMOND KIRSCH PLANT ÜBERRASCHENDE BEKANNTMACHUNG
Zahlreiche Größen aus der Technik-Branche haben sich heute Abend in Bilbao, Spanien, eingefunden, um im Guggenheim-Museum an einer VIP-Veranstaltung des Futurologen Edmond Kirsch teilzunehmen. Die Sicherheitsvorkehrungen sind enorm. Nicht einmal den Gästen wurde verraten, was sie erwartet. Wie ConspiracyNet jedoch aus Insiderkreisen erfahren hat, wird Edmond Kirsch in Kürze eine Rede halten und seine Gäste mit einer bedeutenden wissenschaftlichen Entdeckung überraschen. ConspiracyNet bleibt an der Story dran. Weitere Informationen folgen, sobald sie uns vorliegen.