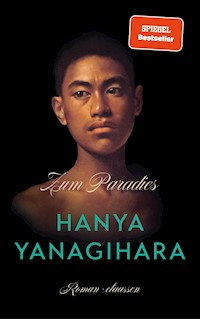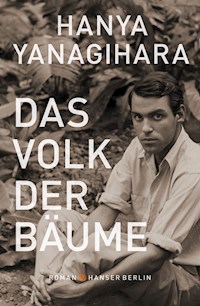
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der junge Arzt Norton Perina kehrt mit einer unfassbaren Entdeckung von der Insel Ivu’ivu zurück: Hat er wirklich ein Mittel gegen die Sterblichkeit gefunden? Eine uralte Schildkrötenart soll die Formel des ewigen Lebens bergen. So kometenhaft er damit zur Spitze der Wissenschaft aufsteigt, so rasant vollzieht sich die Kolonisierung und Zerstörung der Insel. Mit gnadenloser Verführungskraft zieht Hanya Yanagihara uns hinein in den Forscherrausch im Urwald und lässt uns auch dann nicht entkommen, als Perina dort eine weitere Entdeckung macht: seine fatale Liebe zu Kindern. Wie betrachten wir eine Lebensleistung, wenn sich das Genie als Monster entpuppt? Ein brillant geschriebener, gefährlicher Dschungel von einem Roman.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 736
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Der junge Arzt Norton Perina kehrt mit einer unfassbaren Entdeckung von der Insel Ivu’ivu zurück: Hat er wirklich ein Mittel gegen die Sterblichkeit gefunden? Eine uralte Schildkrötenart soll das Geheimnis des ewigen Lebens in sich tragen.
So kometenhaft Perina damit zur Spitze der Wissenschaft aufsteigt, so rasant vollzieht sich die Kolonisierung und Zerstörung der Insel. Mit gnadenloser Verführungskraft zieht Hanya Yanagihara uns hinein in den Forscherrausch im Urwald und lässt uns auch dann nicht entkommen, als Perina dort eine weitere Entdeckung macht: seine fatale Liebe zu Kindern. Wie betrachten wir eine Lebensleistung, wenn sich das Genie als Monster entpuppt? Das ist die Frage in diesem brillant geschriebenen, gefährlichen Dschungel von einem Roman.
Hanya Yanagihara
Das Volk der Bäume
Roman
Aus dem Englischen von Stephan Kleiner
Hanser Berlin
PROSPERO:
Ein geborner Teufel ist’s,
An dem Erziehung nichts verbessern kann,
Und alle Müh’, die ich mir menschlich gab,
Verloren ist, ganz und durchaus verloren.
So wie sein Körper garst’ger wird durch’s Alter,
Verhärtet auch sein Geist sich mit den Jahren,
Ich will sie alle plagen, bis sie brüllen.
William Shakespeare, Der Sturm,
Vierter Aufzug, Erste Szene
INHALT
Vorwort vonDr. Ronald Kubodera
Die Erinnerungen des A. Norton Perina
Herausgegeben von Ronald Kubodera, M.D.
Teil I
Der Bach
Teil II
Mäuse
Teil III
Die Träumer
Teil IV
Die neunte Hütte
Teil V
Das erste Kind
Teil VI
Victor
Teil VII
Danach
Epilog von Dr. Ronald Kubodera
Nachtrag
Anhang
Für meinen Vater
»Vom Vater … die Lust zu fabulieren«
19. März 1995
Namhafter Wissenschaftler mit Vorwürfen sexuellen Missbrauchs konfrontiert
ASSOCIATED PRESS
Bethesda, Md. – Dr. Abraham Norton Perina, der namhafte Immunologe und emeritierte Leiter des Center for Immunology and Virology an den National Institutes of Health in Bethesda, wurde gestern unter dem Verdacht auf sexuellen Missbrauch festgenommen.
Dr. Perina, 71, werden Vergewaltigung in drei Fällen, Unzucht mit Minderjährigen in drei Fällen, sexuelle Nötigung in zwei Fällen und Kindeswohlgefährdung in zwei Fällen vorgeworfen. Die Vorwürfe erhob ein Adoptivsohn Dr. Perinas.
»Diese Vorwürfe sind haltlos«, ließ Dr. Perinas Anwalt Douglas Hindley am gestrigen Tag verlauten. »Dr. Perina ist ein bedeutendes und hochangesehenes Mitglied der wissenschaftlichen Gemeinde und erpicht darauf, diese Angelegenheit schnellstmöglich aufzuklären, um seine Arbeit wiederaufnehmen und zu seiner Familie zurückkehren zu können.«
Für die Erstbeschreibung des den Alterungsprozess verlangsamenden Selene-Syndroms wurde Dr. Perina 1974 mit dem Nobelpreis für Medizin ausgezeichnet. Die Krankheit, die den Körper des Opfers in einem vergleichsweise jugendlichen Stadium erhält, während der geistige Verfall zugleich verstärkt fortschreitet, wurde bei dem Volksstamm der Opa’ivu’eke entdeckt, die auf Ivu’ivu, einer der drei Inseln des mikronesischen Staates U’ivu, leben. Ausgelöst wurde sie durch den Verzehr einer seltenen Schildkrötenart, nach welcher Dr. Perina den Stamm benannte und deren Fleisch, wie sich zeigte, die Telomerase stimuliert, das natürliche Enzym, welches Telomere verlängert und dadurch die mögliche Anzahl der Teilungen jeder einzelnen Zelle erhöht. Wie festgestellt wurde, können vom – nach der unsterblichen und ewig jugendlichen Mondgöttin der griechischen Mythologie benannten – Selene-Syndrom Befallene über Jahrhunderte hinweg mit der Krankheit leben. Perina, der erstmals 1950 als junger Arzt mit dem bekannten Anthropologen Paul Tallent nach U’ivu reiste, führte auf den Inseln jahrelange Feldforschungen durch. Dort adoptierte er auch seine 43 Kinder, viele von ihnen Waisen oder Söhne und Töchter verarmter Opa’ivu’eke-Stammesangehöriger. Einige der Kinder befinden sich derzeit noch in Perinas Obhut.
»Norton ist ein vorbildlicher Vater und ein genialer Kopf«, sagte Dr. Ronald Kubodera, langjähriger Mitarbeiter in Perinas Labor und einer der engsten Freunde des Wissenschaftlers. »Ich bin fest davon überzeugt, dass diese lächerlichen Vorwürfe fallengelassen werden.«
*
3. Dezember 1997
Freiheitsstrafe für bedeutenden Wissenschaftler, Nobelpreisträger
REUTERS
Bethesda, Md. –Dr. Abraham Norton Perina wurde heute zu einer zweijährigen Freiheitsstrafe in der Frederick Correctional Facility verurteilt.
Dr. Perina erhielt 1974 den Nobelpreis für Medizin; er hatte nachgewiesen, dass der Verzehr einer inzwischen ausgestorbenen Schildkrötenart aus dem mikronesischen Staat U’ivu das Enzym Telomerase stimuliert, wodurch die mögliche Anzahl der Teilungen jeder einzelnen Zelle steigt. Untersuchungen ergaben eine Übertragbarkeit der als Selene-Syndrom bekannten Krankheit zwischen einer Vielzahl von Säugetieren einschließlich des Menschen.
Perina gehörte zu den wenigen Vertretern der westlichen Welt, die unbegrenzten Zugang zu diesen entlegenen und abgeschotteten Inseln erhielten, und im Jahr 1968 adoptierte er das erste von insgesamt 43 dort geborenen Kindern, die allesamt in seinem Haus in Bethesda aufwuchsen. Vor zwei Jahren war Perina der Vergewaltigung und Gefährdung des Kindeswohls bezichtigt worden; Ankläger ist eines seiner Adoptivkinder.
»Das ist eine echte Tragödie«, sagt Dr. Louis Altschur, Leiter der National Institutes of Health, an denen Dr. Perina viele Jahre als Wissenschaftler tätig war. »Norton ist ein ausgesprochen kluger Kopf, ein begnadeter Forscher, und ich hoffe inständig, dass er alle notwendige Hilfe bekommt, auch von ärztlicher Seite.«
Weder Perina noch sein Anwalt standen für Stellungsnahmen zur Verfügung.
VORWORT
Ich bin Ronald Kubodera – aber nur in wissenschaftlichen Publikationen. Für alle anderen bin ich Ron. Ja, ich bin der Dr. Ronald Kubodera, von dem Sie sicherlich in den Zeitschriften und Zeitungen gelesen haben. Nein, nicht all die Geschichten sind wahr – das sind sie ja in den seltensten Fällen.
Aber in meinem Fall sind es die wichtigsten schon, und ich bin stolz darauf. So bin ich beispielsweise stolz, überhaupt eine Beziehung zu Norton zu haben (und bis vor anderthalb Jahren hätte ich das nicht einmal eigens betonen müssen), den ich kenne, seit ich 1970 in seinem Labor an den National Institutes of Health in Bethesda, Maryland, zu arbeiten begann. Den Nobelpreis hatte Norton damals noch nicht erhalten, doch mit seiner Arbeit hatte er bereits das Medizinwesen revolutioniert und den wissenschaftlichen Blick auf die Fachgebiete Virologie und Immunologie, aber auch, das muss hinzugefügt werden, auf die medizinische Anthropologie für immer verändert. Stolz bin ich auch darauf, dass aus unserer anfänglichen Arbeitsbeziehung eine ebenso intensive freundschaftliche Beziehung erwuchs; tatsächlich ist meine Verbindung zu Norton die bedeutsamste in meinem Leben. Vor allem aber bin ich stolz darauf, dass ich nach den Ereignissen der vergangenen zwei Jahre noch immer sein Freund bin und er noch der meine ist.
Natürlich habe ich nicht die Möglichkeit, so häufig mit Norton zu sprechen, wie ich – und das gilt sicherlich auch für ihn – es gern täte. Es ist ein sonderbares, einsames Gefühl, ihn nicht in meiner Nähe zu haben. Tatsächlich möchte ich behaupten, dass wir bis zu meinem Umzug vor sechzehn Monaten1 – einen Monat nach Nortons Verurteilung – während unserer normalen täglichen Abläufe nie mehr als zwei Tage voneinander getrennt waren. Vielleicht sogar weniger. (Besondere Umstände wie die gelegentlichen Urlaube mit meiner damaligen Frau oder Reisen zu Begräbnissen, Hochzeiten usw. natürlich ausgenommen. Doch selbst während dieser Anlässe versuchte ich, täglich mit ihm zu kommunizieren, entweder telefonisch oder per Fax.) Worauf ich hinauswill: Die gemeinsamen Gespräche mit Norton, die Zusammenarbeit mit Norton, das Zusammensein mit Norton waren schlicht Teil meines täglichen Lebens, so wie manche Leute täglich fernsehen oder täglich die Zeitung lesen – eines dieser leicht zu vergessenden, aber darum längst nicht unbedeutenden Rituale, welche uns die Gewissheit geben, dass das Leben plangemäß fortschreitet. Wird ein solcher Rhythmus allerdings unterbrochen, ist man nicht nur verunsichert, man ist ankerlos. So habe ich mich während der letzten etwa anderthalb Jahre gefühlt. Ich wache morgens auf und gehe meinem Tagwerk nach wie immer, aber abends schiebe ich das Zubettgehen hinaus, streife durch die Wohnung, starre in die Nacht hinaus und frage mich, was ich vergessen habe. Ich hake die Dutzenden kleinen Aufgaben ab, die ich an einem normalen Tag gedankenlos verrichte – Briefe geöffnet und beantwortet? Abgabetermine eingehalten? Türen abgeschlossen? –, bis ich schließlich widerstrebend ins Bett steige. Erst an der Schwelle zum Schlaf wird mir wieder bewusst, dass mein Leben seine ganze Form geändert hat, und dann durchlebe ich einen kurzen Augenblick der Melancholie. Man sollte meinen, inzwischen hätte ich gelernt, mich mit Nortons – und damit auch meinen eigenen – veränderten Lebensumständen abzufinden, doch etwas in mir wehrt sich dagegen; schließlich war er drei Jahrzehnte lang Teil meines Tagesablaufs.
Aber wenn mein Leben schon einsam ist, dann ist Nortons noch weit einsamer. Stelle ich ihn mir an diesem Ort vor, bin ich einfach nur wütend: Norton ist kein junger Mann mehr und auch nicht ganz gesund, und ihn einzusperren ist in meinen Augen weder eine geeignete noch eine angemessene Strafe.
Mir ist bewusst, dass ich mit dieser Ansicht in der Minderheit bin. Ich weiß nicht, wie oft ich versucht habe, Norton – seine Menschlichkeit, seine Intelligenz, seine Außergewöhnlichkeit – Freunden, Kollegen und Reportern (sowie Richtern, Geschworenen und Anwälten) begreiflich zu machen. Tatsächlich wurde ich in den vergangenen sechzehn Monaten oft mit der Heimtücke Nortons früherer Freunde konfrontiert, damit, wie rasch sie einen Mann vergessen und aufgegeben haben, den sie angeblich liebten und respektierten. Einige dieser Freunde – Menschen, mit denen Norton seit Jahrzehnten bekannt gewesen ist und zusammengearbeitet hat – verschwanden von der Bildfläche, sobald die Vorwürfe aufkamen. Aber noch schlimmer sind diejenigen, die ihn nach dem Schuldspruch verlassen haben. Das hat mir ins Bewusstsein gerufen, wie treulos und heuchlerisch die meisten Menschen sind.
Doch ich schweife ab. Eine der größten Herausforderungen seiner Gefangenschaft bestand für Norton darin, die große Monotonie zu bekämpfen, die seine Lebensumstände zwangsläufig bestimmt. Ich war zugegebenermaßen etwas überrascht, als er sich nach nicht einmal einem Monat über die lähmende Langeweile zu beschweren begann. Es war stets einer der sehnlichsten Träume von Norton – und, wie ich glaube, von vielen brillanten und überanstrengten Männern – gewesen, einmal einen Monat oder ein Jahr ohne jegliche Verpflichtungen an einem warmen Ort verbringen zu können. Keine Reden zu halten, keine Artikel zu redigieren oder zu schreiben, keine Studenten anzuweisen, keine Kinder zu umsorgen, keine Forschungen zu betreiben; nur eine leere Ebene aus freier Zeit, die er füllen könnte, womit er wollte. Norton hatte immer von der Zeit als einem Meer gesprochen, einer spiegelgleichen, endlos weiten Leere, und tatsächlich wurde dieser Traum – »Meerzeit« nannte er es – zu einer Art Witz, einem Kürzel für Dinge, mit denen er sich eines Tages zu beschäftigen hoffte, für die er aber im Augenblick keine Zeit fand. Und so leistete er Schwüre: In der Meerzeit würde er Tropengräser züchten. In der Meerzeit würde er seine Memoiren schreiben. Niemand, am allerwenigsten Norton selbst, glaubte daran, dass er jemals wirklich Meerzeit haben würde, aber jetzt hat er sie natürlich, nur ohne den warmen Ort und die angenehme, träge Erstarrung, die man mit mühsam verdientem Nichtstun verbindet. Doch unglücklicherweise hat es nun den Anschein, als wäre Norton einfach nicht für den Müßiggang geschaffen; tatsächlich ist es ein quälender Zustand für ihn (wobei ich natürlich einräumen muss, dass das zum großen Teil den unglücklichen Umständen geschuldet sein könnte, unter denen ihm dieser Müßiggang gewährt wurde). Kürzlich schrieb er mir in einem Brief:
Es gibt hier wenig zu tun und von einem gewissen Punkt an noch weniger zu denken. Ich hätte nie geglaubt, dass ich mich je in einem solchen Zustand befinden könnte, so erschöpft, dass ich mich fühle wie nach einem Aderlass, bei dem ich kein Blut, sondern meine Gedanken verloren habe. Langeweile – ich dachte eigentlich immer, ich wüsste eine Zeit permanenter Leere zu schätzen und mit Leichtigkeit auszufüllen. Aber ich musste feststellen, dass es uns nicht gegeben ist, Zeit in solch dicken, leeren Brocken zu füllen: Wir sprechen davon, die Zeit zu verwalten, aber eigentlich ist es andersherum – unser Leben ist so sehr mit Geschäftigkeit angefüllt, weil wir nur diese dünnen Zeitspalten wirklich bewältigen können.2
Das scheint mir eine weise Erkenntnis zu sein.
Doch der offensichtlichen Härte von Nortons derzeitigen Umständen ungeachtet, besitzen manche die Unverfrorenheit zu sagen, er solle dankbar für das sein, was sie als Milde seiner gegenwärtigen Situation betrachten; ein Kommentar, der mir nicht nur stumpfsinnig, sondern auch grausam erscheint. Einer von ihnen ist ein gewisser Herbert West (den Namen habe ich widerwillig geändert), der Anfang der 1980er-Jahre ebenfalls für Norton tätig war und ihn später auf dem Weg zu einer Londoner Konferenz in Bethesda besuchte. Das war vor der Gerichtsverhandlung, aber nach der Anklageerhebung, als Norton quasi unter Hausarrest stand und der Obhut für seine sämtlichen Kinder enthoben war. West, den ich immer für erträglicher als Nortons vorherige wissenschaftliche Mitarbeiter gehalten hatte, blieb etwa eine Stunde bei Norton und fragte mich dann, ob ich mit ihm essen gehen wolle. Ich hatte eigentlich keine große Lust (und fand es schrecklich unhöflich von ihm, mich im Beisein von Norton einzuladen, der das Haus schließlich nicht verlassen durfte), aber Norton sagte, ich solle ruhig gehen, er wolle ohnehin noch ungestört an etwas arbeiten.
Ich musste also mit West zu Abend essen, und auch wenn es mir schwerfiel, nicht an Norton zu denken, der allein zu Hause saß, entspann sich ein überraschend angenehmes Gespräch über Wests Arbeit und einen Vortrag, den er auf der Konferenz halten wollte, über einen Artikel, den Norton und ich vor seiner Verhaftung im New England Journal of Medicine veröffentlicht hatten, und über einige gemeinsame Bekannte, bis West, gerade als das Dessert serviert wurde, sagte: »Norton ist ganz schön alt geworden.«
Ich sagte: »Er ist in einer fürchterlichen Lage.«
»Ja, fürchterlich«, murmelte West.
»Es ist ausgesprochen ungerecht«, sagte ich.
West sagte nichts.
»Ausgesprochen ungerecht«, wiederholte ich, um ihm eine weitere Gelegenheit zu geben.
West seufzte und tupfte sich die Mundwinkel mit der Serviette ab, eine nicht nur gekünstelte und effeminierte, sondern auch auf ostentative, unausstehliche Weise anglophile Geste. (West hatte – vor Jahrzehnten und nur zwei Jahre lang – als Marshall-Stipendiat in Oxford studiert und besaß ein herausragendes Talent dafür, bei jedem gesellschaftlichen oder geschäftlichen Anlass darauf aufmerksam zu machen.) Er aß eine Blaubeerpastete, die seine Zähne mit Flecken vom dunklen Violett eines Blutergusses überzog.
»Ron«, setzte er an.
»Ja?«, sagte ich.
»Glaubst du, er hat es getan?«, fragte West.
Auf diese Frage war ich inzwischen vorbereitet. »Glaubst du das denn?«
West schaute mich lächelnd an, dann blickte er an die Decke, bevor er mich wieder ansah. »Ja«, sagte er.
Ich sagte nichts.
»Du glaubst es nicht«, sagte West mit leichter Verwunderung.
Auch darauf hatte ich eine Antwort parat. »Es kommt nicht darauf an, ob er es getan hat oder nicht«, sagte ich. »Norton ist ein Genie, und das ist alles, was in meinen Augen zählt und meiner Ansicht nach für die Geschichte zählen sollte.«
Wir schwiegen.
Schließlich sagte West verlegen: »Ich sollte bald aufbrechen. Ich habe noch einiges zu lesen, bevor ich morgen fliege.«
»Verstehe«, sagte ich. Und wir aßen schweigend unser Dessert.
Wir waren mit meinem Wagen zum Restaurant gefahren, und nachdem wir das Essen bezahlt hatten (West wollte die Rechnung übernehmen, aber ich setzte mich durch), brachte ich ihn zu seinem Hotel. Während der Fahrt unternahm er noch einige Gesprächsanläufe, die mich nur zorniger machten.
Nachdem wir auf dem Hotelparkplatz minutenlang schweigend dagesessen hatten, West erwartungsvoll, ich wütend, streckte er schließlich die Hand aus, und ich schüttelte sie.
»Na dann«, sagte West.
»Danke für den Besuch«, sagte ich knapp. »Ich weiß, dass Norton sich darüber gefreut hat.«
»Na dann«, wiederholte West. Ich wusste nicht, ob er meinen Sarkasmus zur Kenntnis genommen hatte oder nicht; ich glaubte es eher nicht. »Ich werde an ihn denken.«
Erneutes Schweigen.
»Wenn er schuldig gesprochen wird –«
»Das wird er nicht«, erklärte ich.
»Aber wenn doch«, fuhr West fort, »kommt er dann ins Gefängnis?«
»Ich kann es mir nicht vorstellen«, antwortete ich.
»Na ja, wenn doch«, beharrte West, und mir fiel wieder ein, wie abstoßend ambitioniert, wie gierig West als wissenschaftlicher Mitarbeiter gewesen war und wie sehr er darauf hingefiebert hatte, Nortons Labor zu verlassen und sein eigenes zu betreiben, »dann wird er zumindest jede Menge Meerzeit haben, was, Ron?« Ich war über diese Frivolität so entsetzt, dass ich nichts erwidern konnte. Während ich noch mit offenem Mund dasaß, lächelte mich West an, verabschiedete sich nochmals und stieg aus. Ich blickte ihm nach, als er die Flügeltüren des Hotels öffnete und die hell erleuchtete Eingangshalle betrat, und dann ließ ich den Motor wieder an, um zu Nortons Haus zurückzufahren, wo ich die meisten Nächte verbrachte. In den folgenden Monaten begann und endete der Gerichtsprozess, und dann begann und endete die Urteilsverkündung, aber West besuchte Norton selbstredend nie wieder.
*
Doch wie ich bereits sagte: Nein, die Menschen haben kein Verständnis für Nortons gegenwärtige Situation. Tatsächlich haben sie ihn verurteilt und verstoßen, bevor er offiziell verurteilt und verstoßen wurde, auf legale Weise, von einer angeblich ebenbürtigen Jury – wie musste es sich für einen Mann von Nortons Intellekt anfühlen, zwölf Dilettanten (wenn ich mich recht entsinne, arbeitete einer der Geschworenen in einem Mauthäuschen, ein anderer in einem Hundesalon) über seinen Charakter entscheiden und sein Schicksal bestimmen zu lassen, deren Entscheidung im Grunde jede seiner bisherigen Errungenschaften schmälerte, wenn nicht gar vollkommen bedeutungslos machte? Ist es, so betrachtet, ein Wunder, dass Norton sich niedergeschlagen, gelangweilt und geistig unangeregt fühlt?
Ich möchte auch gern einige Worte zu der Berichterstattung über Nortons Verhandlung sagen, denn es wäre wohl töricht, ihre Stoßrichtung und ihre Breite zu ignorieren. Zunächst einmal fand ich es in Anbetracht der Verbrechen, deren Norton bezichtigt wurde, nicht im Mindesten überraschend, dass die Medien Seiten über Seiten an Geschichten verschwendeten, in denen das wenige, was die Öffentlichkeit über Norton weiß, aufs Ausführlichste und mit einer schockierenden Geringschätzung der Wahrheit ausgeschmückt wird. (Zugegebenermaßen wurde in diesen Geschichten, wenn auch recht widerwillig, auf einige seiner beträchtlichen Errungenschaften eingegangen, aber nur um seine angebliche Verderbtheit noch schärfer zu konturieren.)
Ich erinnere mich, dass Norton in den Tagen, als ich damals mit ihm zusammen in seinem Haus auf seine Verhandlung wartete (draußen verbrachten einige Fernsehreporter ihre Tage damit, sich vor Nortons Garten auf dem Gehweg zu versammeln, wo sie an der sirrenden, vor Insekten strotzenden Sommerluft aßen und plauderten wie bei einem Picknick), nur in einer einzigen der zahlreichen (und natürlich vergeblichen) Interviewanfragen, die wir erhielten – leider kam diese eine ausgerechnet vom Playboy –, dazu aufgefordert wurde, selbst eine Verteidigung zu formulieren, statt dass man irgendeinen geifernden jungen Schreiberling darauf ansetzte, sein Leben und seine angeblichen Vergehen für die Leserschaft aufzubereiten. (Ich hatte das ursprünglich, ungeachtet des Mediums, für ein gutes Angebot gehalten, aber Norton fürchtete, was immer er schreibe, könnte manipuliert und als Geständnis gegen ihn verwendet werden. Natürlich hatte er recht, und damit war die Sache erledigt.) Aber ich wusste auch, dass ihn die Einsicht, nicht einmal mehr für sich selbst sprechen und sich verteidigen zu können, wütend und traurig machte.
Ironischerweise hatte Norton kurz vor seiner Verhaftung tatsächlich den Plan gefasst, seine Memoiren zu schreiben. Zu dieser Zeit – 1995 – befand er sich bereits im Vorruhestand und musste sich nicht mehr mit den verschiedenen administrativen Pflichten und Scherereien des Labors herumschlagen. Das soll nicht heißen, dass er nicht nach wie vor der lebendigste und unabkömmlichste Geist dort war – nur dass er sich inzwischen erlaubte, seine Zeit anders einzuteilen.
Aber Norton sollte nicht die Gelegenheit bekommen, sein bemerkenswertes Leben aufzuzeichnen, zumindest nicht unter den Bedingungen, die er, wie ich weiß, bevorzugt hätte. Doch wie ich immer gesagt habe, verfügt er über einen Verstand, der in der Lage ist, jedes Hindernis zu überwinden. Und so fragte ich ihn im April, zwei Monate nach Antritt seiner Haftstrafe, in meinem täglichen Brief an ihn, ob er nicht in Erwägung ziehen wolle, trotzdem seine Memoiren zu schreiben. Nicht nur würden sie, so schrieb ich, sowohl die Welt der Literatur als auch die der Wissenschaft wirklich bereichern, sondern ihm auch endlich eine Gelegenheit bieten, allen Interessierten zu beweisen, dass er nicht war, wozu ihn die Welt unbedingt hatte machen wollen. Ich erklärte, es wäre mir eine Ehre, seine Niederschrift für ihn abzutippen und, wenn er mich ließe, behutsam zu redigieren wie zuvor schon verschiedene wissenschaftliche Aufsätze, die er bei Fachzeitschriften zur Publikation eingereicht hatte. Für mich, schrieb ich, wäre es ein faszinierendes Projekt, und ihm könnte es zur Zerstreuung dienen.
Eine Woche später schickte mir Norton eine kurze Mitteilung:
Auch wenn ich nicht behaupten kann, die vielleicht letzten Jahre meines Lebens damit verbringen zu wollen, die Leute davon zu überzeugen, dass ich an den Verbrechen, die ich ihrem Willen nach begangen haben soll, unschuldig bin, habe ich beschlossen, mit der Erzählung der, wie Du schreibst, »Geschichte meines Lebens« zu beginnen. Ich habe … [großes] Vertrauen [in Dich].3
Einen Monat später hatte ich das erste Kapitel.
*
Ich sollte wohl einige Dinge vorausschicken, bevor ich den Leser einlade, Nortons außergewöhnliches Leben kennenzulernen. Schließlich ist es eine Geschichte, in deren Herz die Krankheit wohnt.
Natürlich wird Norton das alles besser erklären als ich, doch ich möchte dem Leser einige Informationen über den Mann, um den es hier geht, an die Hand geben. Er hat mir gegenüber einmal bemerkt, sein Leben habe erst wirklich begonnen, als er das Land verließ, um nach U’ivu zu gehen, wo er Entdeckungen machen sollte, die die moderne Medizin transformierten und in der Auszeichnung mit dem Nobelpreis mündeten.1950, im Alter von fünfundzwanzig Jahren, reiste er zum ersten Mal in den damals noch unbekannten mikronesischen Staat – eine Reise, die sein Leben für immer verändern und das Medizinwesen revolutionieren sollte. In U’ivu lebte er bei einem später als das Volk der Opa’ivu’eke bezeichneten isolierten Stamm auf Ivu’ivu, dem damals (zumindest unter den U’ivuanern) als die »verbotene Insel« bekannten und größten zu der geringen Landmasse gehörenden Eiland. Dort entdeckte er eine Krankheit – eine nie zuvor beschriebene, unerforschte Krankheit –, an der die eingeborene Bevölkerung litt. Die U’ivuaner waren – und sind es zu einem gewissen Grad noch immer – für ihre geringe Lebenserwartung bekannt. Doch während seines Aufenthalts auf Ivu’ivu begegnete Norton einer Gruppe von Inselbewohnern, deren Alter die normale Lebensspanne weit überstieg: um zwanzig, fünfzig oder sogar hundert Jahre. Zwei weitere Dinge machten seine Entdeckung noch bemerkenswerter: Erstens alterten die Betroffenen zwar nicht körperlich, fielen aber geistigem Niedergang anheim; und zweitens handelte es sich nicht um ein angeborenes, sondern um ein erworbenes Leiden. Nie ist der Mensch dem ewigen Leben näher gekommen als durch Nortons Entdeckung. Und doch hat sich nie eine so wundervolle Verheißung derart rasch in Luft aufgelöst: ein Geheimnis aufgedeckt, ein Geheimnis verloren, alles innerhalb eines einzigen Jahrzehnts.
*
Doch Nortons Arbeit mit den Opa’ivu’eke spiegelte richtungsweisende Veränderungen in Feldern jenseits der Medizin wider: Die nahezu zwei Jahrzehnte seines Zusammenlebens mit dem Stamm begründeten einen neuen Bereich der modernen medizinischen Anthropologie, und seine in dieser Zeit entstandenen Schriften sind heute fester Bestandteil der Lehrpläne vieler Hochschulen.
Doch U’ivu4 war auch der Ort, an dem seine Schwierigkeiten begannen. Zu den vielen Dingen, die Nortons Reisen durch U’ivu prägten, gehörte auch die Erfahrung, die seine anhaltende Liebe zu Kindern begründen sollte. Für jene Leser, die Ivu’ivu nicht kennen: Es ist eine bedrohliche Landschaft, zu gleichen Teilen schön und einschüchternd. Alles ist dort größer, reiner und beeindruckender, als man es sich vorstellen kann, und in jeder Himmelsrichtung bieten sich dem Blick atemberaubende Aussichten, eine spektakulärer als die andere: zur einen Seite eine endlose Wasserfläche, so still und so farbintensiv, dass man nicht lange darauf schauen kann; zur anderen lange, tiefe Gebirgsfältelungen, deren Gipfel in schäumendem Nebel verschwinden. Von seiner ersten Reise nach Ivu’ivu an engagierte Norton U’ivuaner, von denen er sich zu Schauplätzen und Objekten führen ließ, wie er sie noch nie gesehen hatte. Jahrzehnte später nahm er – auf ihren inständigen Wunsch hin – ihre Kinder und Enkelkinder mit nach Maryland, wo er sie wie seine eigenen aufzog und ihnen eine Erziehung ermöglichte, die ihnen auf U’ivu nie zuteilgeworden wäre. Er nahm auch viele Waisenkinder mit nach Hause, darunter Kleinkinder, die unter himmelschreienden Bedingungen ohne Aussicht auf irgendeine Besserung ihrer Umstände lebten.
Ehe er sichs versah, hatte er eine mehr als vierzig Köpfe zählende Kinderschar um sich versammelt. Viele dieser in drei insgesamt beinahe drei Jahrzehnte umspannenden Wellen adoptierten Kinder kehrten nach Mikronesien zurück, wo sie heute Ärzte, Anwälte, Professoren, Häuptlinge, Lehrer und Diplomaten sind. Andere haben sich dafür entschieden, in den USA zu bleiben, wo sie arbeiten oder studieren. Und wieder andere sind, wie ich leider berichten muss, Armut, Drogen und Kriminalität anheimgefallen. (Wer dreiundvierzig Kinder hat, kann nicht erwarten, dass alle von ihnen erfolgreich sind.) Aber sie gehören jetzt natürlich nicht mehr zu Norton. Und Norton soll nach ihrem Willen auch nicht mehr zu ihnen gehören: Wie sie sich während seiner jüngsten Notlage förmlich in Massen von ihm abgewandt haben, war nicht weniger als schockierend. Schließlich ging es hier um einen Mann, von dem sie Obdach, Sprache und Bildung erhalten haben – all die Mittel, die sie benötigten, um ihn eines Tages zu hintergehen, was sie schließlich auch getan haben. Nortons Kinder haben die Botschaft des Westens, die Botschaft Amerikas nur allzu tief verinnerlicht; irgendwo haben sie mitbekommen, dass der Vorwurf der Perversion stets wohlfeil ist, ein Vorwurf, dem nicht einmal ein Nobelpreisträger, ein hochangesehener Wissenschaftler, standhalten kann. Es ist ausgesprochen schade; ich hatte einige von ihnen in mein Herz geschlossen.
*
Zweitens sollte ich wohl erklären, dass es sich hierbei meinem offensichtlichen Interesse an diesem Bericht zum Trotz nicht um meine Geschichte handelt. Zum einen bin ich ein schweigsamer Mann. Zum anderen habe ich auch gar kein Interesse daran, meine Geschichte zu erzählen – schließlich gibt es heutzutage ohnehin zu viele Geschichten.
Dennoch möchte ich einige Worte zur Zusammenstellung und Redaktion dieser Seiten sagen. Tatsächlich waren meine herausgeberischen Aufgaben sehr überschaubar. Ich sollte auch erwähnen, dass die einzelnen Abschnitte (deren Titel von mir stammen) eigentlich jeweils eigenständige Teile sind, die ich während Nortons Gefangenschaft von ihm erhielt. Jedem Teil war ein Brief vorangestellt, aber weil diese Briefe vorrangig persönlicher Natur sind, fand ich es unangemessen, sie hier beizufügen. Da dieser Text aus ursprünglich einzelnen Teilen besteht, wird der Leser bemerken, dass er mitunter etwas Spontanes, Beiläufiges an sich hat und beim Leser eine gewisse Vertrautheit mit Leben und Werk seines Verfassers voraussetzt. Da ich derjenige bin, der Norton am besten kennt (und da das Buch letztlich für mich geschrieben wurde, auf meinen Wunsch hin), fühlte ich mich angehalten, Fußnoten einzufügen, wo ich solche zusätzlichen Informationen für ein besseres Verständnis von Nortons Text hilfreich fand. (Gelegentlich sollen meine Anmerkungen auch der Ergänzung von Nortons Aufzeichnungen dienen. Darüber hinaus habe ich – behutsam – Kürzungen an Passagen vorgenommen, welche die Erzählung meinem Empfinden nach nicht bereicherten oder in anderer Hinsicht ohne besondere Relevanz waren; Streichungen dieser Art werden dem Gesamtporträt, das Norton hier von sich selbst gezeichnet hat, nicht abträglich sein.)
Und schließlich halte ich es nur für angebracht, auf eine Frage einzugehen, die Norton im Begleitbrief zu seinem ersten Textteil aufgebracht hat: die Frage danach, was ich mir von diesem Projekt erhoffe. Die Antwort ist nicht kompliziert: Ich möchte nicht weniger als Nortons Ruf wiederherstellen, ich möchte die Welt daran erinnern, dass die Zeit vor den letzten beiden Jahren unvorstellbar viel wichtiger ist als das, was im Laufe einiger kurzer Monate geschehen oder auch nicht geschehen sein mag. Vielleicht ist das naiv von mir. Aber ich muss es versuchen: Weniger als das für einen Mann zu tun, welcher der Welt der Wissenschaft und der Medizin so viel gegeben hat, wäre, in einem Wort, unverzeihlich.
Ronald Kubodera
Palo Alto, Kalifornien
Die Erinnerungen des A. Norton Perina
HERAUSGEGEBEN VON RONALD KUBODERA, M.D.
TEIL I
DER BACH
I.
Ich wurde 1924 in der Nähe von Lindon, Indiana, geboren, einem jener unscheinbaren kleinen Landstädtchen, die sich zwanzig Jahre vor meiner Geburt still, aber beharrlich im Mittleren Westen auszubreiten begonnen hatten. Ich will damit sagen, dass meiner Erinnerung nach das einzig Außergewöhnliche an diesem Ort das Fehlen jeglicher besonderer Merkmale war. Es gab dort Silos, rote Scheunen (die meisten Einwohner waren Farmer), Gemischtwarenläden, Kirchen, Pfarrer, Ärzte, Lehrer, Männer und Frauen und Kinder: ein Entwurf für eine amerikanische Gesellschaft, aber einer ohne Schnörkel, ohne schmückende Elemente, ohne Beiwerk. Es gab ein paar Säufer und einen stadtbekannten Irren, es gab Hunde und Katzen und einen Jahrmarkt im Verbund mit Locust, einem angegliederten Ort einige Kilometer westlich, den es heute nicht mehr gibt. Die Einwohner – wir waren achtzehnhundert – wurden geboren, gingen zur Schule, erledigten ihre täglichen Pflichten, wurden Farmer, heirateten Leute aus Lindon und gründeten eigene Familien. Begegnete man jemandem auf der Straße, nickte man ihm zu oder zog als Mann die Hutkrempe leicht nach unten. Die Jahreszeiten wechselten, Tabak und Mais wuchsen und wurden geerntet. Das war Lindon.
In unserer Familie waren wir zu viert: mein Vater, meine Mutter, Owen und ich.5 Wir lebten auf einem vierzig Hektar großen Grundstück in einem absackenden Haus, dessen einziges hervorstechendes Merkmal eine gewaltige, einstmals prachtvolle Treppe war, die Generationen von Termiten schon vor Langem in ein filigranes, baufälliges Ding verwandelt hatten.
Etwa anderthalb Kilometer hinter dem Haus schlängelte sich ein Bach dahin, zu klein, zu gemächlich und zu unbeständig, um einen richtigen Namen zu verdienen. Im März und April, nach der Schneeschmelze, wuchs er immer über sich hinaus, schwoll durch hektoliterweise Schmelzwasser und Frühlingsregen zu einem veritablen, reißenden Fluss an. Während dieser Monate veränderte sich das gesamte Wesen des Baches. Er wurde gnadenlos und zielgerichtet, riss Sanguinaria mit ihren winzigen sternförmigen Blüten und Feldthymian an der Wurzel aus und jagte sie stromabwärts, wo sie im Dickicht eines vor langer Zeit von Unbekannten errichteten Damms zurückblieben. Die Bitterfische, die den Bach das ganze Jahr über bevölkerten, kämpften gegen die Strömung an und ertranken. Für die Dauer dieser einen Jahreszeit hatte der Bach eine Stimme: das aufgebrachte Tosen des rauschenden Wassers, der Macht. Und dieser schmale, sonst so stille und eigenschaftslose Zufluss verwandelte sich während dieser Monate zu etwas Furchteinflößendem und Unberechenbarem, und wir wurden ermahnt, uns von ihm fernzuhalten.
Aber in der Hitze der Sommermonate dörrte der Bach – der nicht auf unserem Grundstück, sondern auf dem der Muellers etwa acht Kilometer östlich von uns entsprang – wieder zu einem zahmen Rinnsal aus, das furchtsam an unserer Farm vorbeischlich. Wolken von Mücken und Libellen erfüllten die Luft darüber mit ihrem Summen, und Blutegel saugten sich an seinem weichen, sandigen Bett entlang. Wir gingen immer zum Angeln und zum Schwimmen dorthin, und anschließend stiegen wir den Hügel zu unserem Haus hinauf und kratzten an den Mückenquaddeln auf unseren Armen und Beinen, bis sie mit einer Kruste aus alter Haut und frischem Blut bedeckt waren.
Mein Vater ließ sich nie unten am Bach blicken, aber meine Mutter saß gern im Gras und sah zu, wie das Wasser über ihre Knöchel leckte. Als wir noch klein waren, riefen wir immer zu ihr hinüber – Mama, guck mal! –, und sie hob verträumt den Kopf und winkte, wobei sie ebenso gut uns hätte zuwinken können wie beispielsweise einer jungen Eiche in der Nähe. (Unsere Mutter hatte gute Augen, aber sie verhielt sich oft wie eine Blinde; sie ging wie eine Schlafwandlerin durch die Welt.) Als Owen und ich vielleicht sieben oder acht Jahre alt waren (in jedem Fall zu jung, um sie mit desillusioniertem Blick zu betrachten), wurde sie erst zum Gegenstand unseres Mitleids und dann zum Quell unseres Amüsements. Wir winkten ihr zu, wenn sie, die Arme unter den Knien verschränkt, am Ufer saß, und sobald sie zurückwinkte (mit dem ganzen Arm statt einer Hand, wie ein Büschel Seegras, das sich unter Wasser neigt), wandten wir uns ab, sprachen laut miteinander, gaben vor, sie nicht zu sehen. Wenn sie uns später beim Abendessen fragte, was wir am Bach getrieben hätten, taten wir überrascht, verdutzt. Am Bach? Dort seien wir gar nicht gewesen! Wir hätten den ganzen Tag lang auf dem Feld gespielt.
»Aber ich habe euch doch gesehen«, sagte sie dann.
Nein, sagten wir einmütig und schüttelten die Köpfe. Das müssten zwei andere Jungen gewesen sein. Jungen, die genau wie wir aussähen.
»Aber –«, setzte sie an, und die Verwirrung verzerrte kurz ihr Gesicht, bevor es sich wieder glättete. »So muss es wohl gewesen sein«, sagte sie dann zweifelnd und blickte auf ihren Teller hinab.
Zu diesem Abtausch kam es mehrmals im Monat. Für uns war es ein Spiel, aber ein beunruhigendes. Spielte unsere Mutter mit? Doch die Miene, die über ihr Gesicht huschte – und in der echte Besorgnis lag, die Angst davor, wie es damals hieß, nicht ganz richtig zu sein, ihren Augen oder ihrem Gedächtnis nicht vollständig vertrauen oder glauben zu können –, wirkte zu echt, zu spontan. Wir entschieden uns zu glauben, dass sie uns etwas vorspielte, denn die Alternative, dass sie verrückt oder, schlimmer noch, ernsthaft schwachsinnig war, war zu beängstigend, um sie wirklich in Betracht zu ziehen. Später auf unserem Zimmer ahmten Owen und ich sie lachend nach (»Aber … aber … aber … das wart doch ihr!«), doch wenn wir hinterher stumm in unseren Betten lagen und über unser Spiel nachdachten, wühlte es uns auf. Wir waren noch jung, aber wir wussten beide (aus Büchern, von unseren Spielkameraden), was die Aufgaben einer Mutter waren – zu strafen, zu lehren, zu unterweisen, bei Bedarf zu züchtigen –, und wir wussten auch, dass unsere Mutter diesen Aufgaben nicht gewachsen war. Was, fragten wir uns, würde mit einer solchen Mutter aus uns werden? Warum war sie so unfähig? Wir gingen mit ihr um, wie die meisten Jungen mit Kleintieren umgingen: freundlich, wenn wir glücklich und milde gestimmt waren, und grausam, wenn wir es nicht waren. Wir berauschten uns daran, dass wir über die Macht verfügten, ihre Schultern zu entspannen und sie ihren Mund zu einem unsicheren Lächeln verziehen zu lassen, sie aber auch dazu bringen konnten, den Kopf zu senken und mit der Handfläche schnell über ihr Bein zu reiben, was sie immer tat, wenn sie aufgeregt, unglücklich oder verwirrt war. Unsere Bedenken sprachen wir nie laut aus; in unseren wenigen Diskussionen über sie klangen Spott und Abscheu mit. Die Sorge ließ uns näher zusammenrücken, machte uns nur noch dreister und gemeiner. Gewiss, so dachten wir, könnten wir sie an einen Punkt bringen, an dem die wahre Erwachsene, die sie so gut versteckt hatte, zum Vorschein käme. Wie die meisten Kinder glaubten wir, alle Erwachsenen trügen von Natur aus etwas Einschüchterndes, eine gewisse Autorität in sich.
Über ihre fehlende Substanz hinaus konnte man meine Mutter in weiteren entscheidenden Punkten als Niete betrachten. Sie war eine schludrige Köchin (ihr gedämpfter Brokkoli war gummiartig, doch beim Kauen knackten die in den Röschen verborgenen Kadaver winziger Käfer, in ihrem Brathähnchen schmatzte das Blut) und kümmerte sich nur gelegentlich um den Haushalt – unser Vater hatte ihr einen Staubsauger geschenkt, der unbeachtet im Garderobenschrank stand, bis Owen und ich ihn eines Tages auseinandernahmen und ausschlachteten. Sie schien auch keinerlei Interessen zu haben. Nie sahen wir sie lesen, schreiben, malen oder Gartenarbeit verrichten – allesamt Beschäftigungen, von denen wir (schon damals) wussten, dass sie interessant und bereichernd waren. An Sommernachmittagen trafen wir sie manchmal im Wohnzimmer an, wo sie mit auf mädchenhafte Weise untergeschlagenen Beinen und einem einfältigen Lächeln auf dem Gesicht dasaß und gebannt, aber mit leerem Blick auf eine Staubflockenformation starrte, die von einem Streifen Sonnenlicht sichtbar gemacht wurde.
Einmal sah ich sie beten. Ich betrat eines Nachmittags nach der Schule das Wohnzimmer, und da kniete sie auf dem Boden, die Handflächen aneinandergepresst, den Kopf erhoben. Ihre Lippen bewegten sich, aber ich verstand nicht, was sie sagte. Sie gab ein lächerliches Bild ab, wie eine Schauspielerin, die vor leerem Haus spielt, und ich schämte mich für sie. »Was machst du denn da?«, fragte ich, und sie schlug überrascht die Augen auf. »Nichts«, sagte sie erschrocken. Aber ich wusste, was sie tat, und ich wusste auch, dass sie log.
Was kann ich sonst noch sagen? Ich kann sagen, dass sie dumpf, verhuscht, wahrscheinlich sogar dumm war. Aber ich muss auch dazusagen, dass sie mir immer ein Rätsel geblieben ist, und das ist nur wenigen Menschen gelungen. Und ich erinnere mich auch an andere Dinge: Sie war groß und anmutig, und obgleich ich mich nicht mehr an die Einzelheiten ihres Gesichts erinnere, weiß ich, dass sie von einer gewissen Schönheit war. Eine alte, unscharfe Sepiafotografie in Owens Büro bestätigt das. Wahrscheinlich galt sie damals nicht als so schön, wie sie es heute täte, denn ihr Gesicht war ihrer Zeit voraus – lang, weiß, erstaunt: ein Gesicht, das Intelligenz, Geheimnis, Tiefe verhieß. Heute würde man sie »faszinierend« nennen. Aber mein Vater muss sie sehr schön gefunden haben, denn mir fällt kein anderer Grund ein, warum er sie geheiratet haben sollte. Wenn mein Vater überhaupt mit Frauen sprach, bevorzugte er gebildete Frauen, aber er fand sie in keiner Weise sexuell anziehend. Das lag vermutlich daran, dass ihn intelligente Frauen an seine Schwester Sybil erinnerten, die in Rochester als Ärztin arbeitete und für die er große Bewunderung empfand. Also blieb ihm die Schönheit. Ich war enttäuscht, als ich als Heranwachsender erkannte, dass mein Vater meine Mutter allein wegen ihrer Schönheit geheiratet hatte, aber das war, bevor ich herausfand, dass Eltern uns in mannigfaltiger Weise enttäuschen und man am besten gar keine Erwartungen an sie stellt, denen sie mit großer Wahrscheinlichkeit ohnehin nicht gerecht werden.
Vor allem aber war sie unergründlich. Ich weiß nicht einmal, woher genau sie stammte (irgendwo aus Nebraska, glaube ich), aber ich weiß, dass sie aus einer mittellosen Familie kam und mein Vater sie durch seine vergleichsweise vermögenden Verhältnisse und seine Anspruchslosigkeit gerettet hatte. Merkwürdigerweise aber machte sie ihrer Armut zum Trotz keinen abgearbeiteten oder verbrauchten Eindruck; sie wirkte weder erschöpft, noch hatte sie etwas Hartes an sich. Sie erweckte vielmehr den Eindruck einer jener verwöhnten Frauen, die vom Haus ihres Vaters aufs Mädchenpensionat und von dort aus in die Arme ihres Ehemanns schweben. (Der Schimmer, der sie auf Owens Foto zu umgeben scheint, ihr früher, stiller Tod, ihre schläfrigen, langsamen Bewegungen lassen sie in meiner Erinnerung zu einem wohlbehüteten, verhätschelten, ätherischen Wesen werden, obwohl ich es besser weiß.) Soweit ich weiß, verfügte sie über keinerlei Bildung (wenn sie meinem Vater unsere Zeugnisse vorlas, stolperte sie über Wörter: »Ex-, ex-em-pl«, buchstabierte sie, bis Owen oder ich das Wort – exemplarisch – selbstgefällig, ungeduldig und schamerfüllt herausschrien), und bei ihrem Tod war sie noch sehr jung.
Aber sie war in jeder Hinsicht jung. In meiner Erinnerung ist sie auf hartnäckige Weise kindlich, nicht nur was ihr Benehmen anging, sondern auch in ihrer äußeren Erscheinung. Ihr Haar zum Beispiel: Sie trug es zu jedem Anlass offen, ließ es sich in einer losen, gewundenen Spirale an ihrem Rücken hinunterkräuseln. Schon als Kind ärgerte mich diese Frisur; für mich war sie ein weiterer Beleg für eine auf rücksichtslose und unangemessene Weise aufrechterhaltene Mädchenhaftigkeit – das lange Haar, das entrückte, gedankenlose Lächeln, die Art und Weise, wie ihre Augen davonwanderten, sobald man sie ansprach: sämtlich wenig bewundernswerte Eigenschaften einer Frau mit ihren vermeintlichen Verantwortlichkeiten.
Während ich diese wenigen Details aus dem Leben meiner Mutter aufliste, bereitet es mir Unbehagen, wie wenig ich weiß und wie wenig neugierig ich in Bezug auf sie stets geblieben bin. Vermutlich will jedes Kind seine elterliche Abstammung verstehen, doch meine Mutter erschien mir als Person nie interessant genug, um über sie nachzudenken. (Oder war es doch eher umgekehrt?) Aber ich habe auch nie an eine Romantisierung der Vergangenheit geglaubt – was hätte ich schon davon? Owen dagegen entwickelte später ein weit größeres Interesse an unserer Mutter und versuchte als Student sogar eine Zeit lang, ihre Familie ausfindig zu machen und eine informelle Biografie über sie zu verfassen. Doch Monate nach dem Beginn des Projekts gab er es auf und fühlte sich sofort angegriffen, wenn man ihn darauf ansprach, weshalb ich nur annehmen kann, dass er unsere Verwandten mütterlicherseits ohne größere Schwierigkeiten ausfindig machte, feststellte, dass sie noch immer Bauerntölpel waren, und das Vorhaben angeekelt abbrach (seinerzeit war er noch elitär genug, um genau das zu tun).6 Sie hat ihn immer auf eine Weise beschäftigt, die ich nie verstehen konnte. Aber Owen ist eben Dichter, und ich glaube, es war ihm wichtig, diese Details zur späteren Verwendung vorliegen zu haben, wie unbedeutend oder in letzter Konsequenz enttäuschend sie auch gewesen sein mochten.
*
Wie dem auch sei. Jedenfalls war es im Juli 1933. Ich scheue mich zu sagen: »Es war ein Tag wie jeder andere«, denn das klingt so melodramatisch und schicksalhaft und zudem ganz und gar unglaubwürdig. Aber es stimmt auch. Also: Es war ein Tag wie jeder andere. Mein Vater war mit seinem Freund, dem Kleinbauern Lester Drew, unterwegs, um zu tun, was zwei Kleinbauern eben so taten. Owen und ich füllten am Bach einen Eimer mit Blutegeln, die wir in einer Pastete verbacken und Ida, der Teilzeitköchin, unterjubeln wollten, einer mürrischen Frau, die uns beiden verhasst war. Meine Mutter ließ die Füße ins Wasser hängen.
Noch Wochen danach wurde von Owen und mir verlangt, uns zurückzuerinnern – war sie uns an jenem Nachmittag irgendwie verändert erschienen? Hatte sie apathisch gewirkt, kränklich oder besonders müde? Hatte sie uns gegenüber erwähnt, dass sie sich benommen oder schwach fühlte? Doch die Antwort war stets Nein. Und wenn ich nur wenig über das Tun oder die Stimmung meiner Mutter an jenem Tag berichten kann, dann vermutlich ebendeswegen, weil sie so sehr dem entsprachen, was wir als ihr normales Verhalten zu akzeptieren gelernt hatten. So frustrierend das Zusammenleben mit meiner Mutter auch war, so konnten wir ihr doch nie Unbeständigkeit vorwerfen. Selbst der letzte Tag ihres Lebens folgte dem gleichen undurchschaubaren Ablauf, der nur für sie allein zu entschlüsseln war.
Am Morgen darauf schliefen Owen und ich lange, wie wir es im Sommer meist taten. Als ich aufwachte – Owen lag noch schlafend im Nachbarbett –, war es draußen schon heiß. Von uns wurde wenig erwartet. Im Gegensatz zu anderen Kindern mussten wir keinerlei Haushaltspflichten übernehmen; wir konnten die Tage ausfüllen, wie wir wollten. Wir verbrachten die Sommermonate mit entsprechend sinnlosen Tätigkeiten – wir quälten unten am Bach die Ochsenfrösche, klauten Aprikosen von Lester Drews Bäumen, schlichen einer Murmeltierfamilie durch das hohe, kratzige Gras hinterher. Morgens standen wir auf, wann wir wollten, aßen, was uns in der Küche hinterlassen wurde, und zogen los, um unsere Tagespläne umzusetzen. Manchmal war mein Vater mit Lester Drew da und rollte eine Zigarette zwischen den Fingern, und zwischen den beiden stand ein Teller mit roten, in Spalten geschnittenen Pfirsichen, die übelerregend glänzten wie rohes Fleisch. Sie knurrten uns etwas zu, und wir knurrten zurück und setzten uns an den Tisch und schwiegen.
Sie waren auch dort, als ich an diesem Morgen in die Küche kam, aber da waren noch zwei andere Leute: John Naples, der Arzt, und Reverend Cunningham, der Pfarrer der Stadt. Sie redeten leise miteinander. Als ich eintrat, verstummte das Gespräch. Mein Vater war ein ungerührter Mann, stoisch und unempfänglich für jede Art von Gefühlsduselei. (Er hatte ein großes, vierschrötiges Gesicht, und seine Augenfarbe war das trübe Olivgrün von Kapern.) Wenn er irgendeine Gefühlsregung zeigte, waren wir daher stets alarmiert oder zumindest neugierig. Tatsächlich erinnere ich mich an seinen Blick an jenem Morgen – eine Mischung aus Überraschung, Betroffenheit und Fassungslosigkeit – besser als an sein eigentliches Gesicht.
»Deine Mutter ist tot«, sagte mein Vater. Er klang ruhig und ernst, und er sprach in seiner normalen Tonlage, die seine Miene Lügen strafte – tatsächlich fand ich seine Stimme beruhigend.
»Also wirklich, Joseph«, sagte Reverend Cunningham.
»Es ist am besten, wenn er es so hört. Geradeheraus«, sagte mein Vater. Beim Überbringen der Nachricht hatte er mir direkt ins Gesicht gesehen. Nun wandte er den Blick ab und richtete ihn auf irgendetwas über Reverend Cunninghams Kopf. »Ich nehme an, Sie werden sich um den Leichnam kümmern, Reverend. Tun Sie, was auch immer … sie wollte.« Dann klatschte er in einer präzisen, abschließenden Geste einmal in die Hände und ging zur Hintertür in den Garten hinaus. Nachdem er mir einen langen schmerzlichen Blick zugeworfen hatte, trottete Lester ihm hinterher und ließ mich mit einem seufzenden Reverend Cunningham und einem finster dreinblickenden John Naples zurück.
»Du!«, sagt Naples zu mir. »Hast du nicht noch einen Bruder?«
Er wusste, dass ich einen hatte. Im vergangenen Sommer hatten Owen und ich ein ganzes Knäuel grüner Grasnattern gefangen und sie, einen sich schlängelnden Strang nach dem anderen, in den Briefschlitz von Naples’ Klinik gesteckt. Es war nur ein Kinderstreich gewesen, aber er war in Wut geraten und hatte es uns nie verziehen. Er war ein bitterer, zorniger Mann, zerfressen von seiner Enttäuschung über die Welt, einer jener Männer, die auf der Straße absichtlich mit den Füßen Staub aufwirbelten, wenn Kinder vorbeikamen, weil er wusste, dass sie sich kaum zur Wehr setzen konnten. »Willst du nicht wissen, wie deine Mutter gestorben ist?«, fragte er mich.
»Naples!«, sagte Reverend Cunningham.
Naples ignorierte Father Cunningham. »Diese Mücken, die euren Bach bevölkern«, fuhr er fort. »Meiner medizinischen Ansicht nach übertragen sie einen Erregerstamm der Chinagrippe. Mücken übertragen Krankheiten, und deine Mutter ist in eine von Bakterien wimmelnde Kloake marschiert und hat ihr Ableben so selbst herbeigeführt.« Er lehnte sich zufrieden im Stuhl zurück und paffte seine Pfeife. »Und wenn dein Bruder und du euch nicht von diesem Bach fernhaltet, werdet ihr auf dieselbe Weise sterben.«
Reverend Cunningham wirkte entsetzt. »Also wirklich, Naples«, sagte er und ging, nachdem er sich mit dieser einen Rüge verausgabt hatte, ebenfalls durch die Hintertür hinaus. Ich war nicht überrascht und hatte nicht mehr von ihm erwartet – nicht bloß weil er ein Pfarrer war, sondern weil er einen so schwächlichen Eindruck machte. Er hatte eines jener Gesichter, die sich eher durch Fehlendes als durch Vorhandenes einprägen: Seine Wangen waren so ausgemergelt und eingefallen, als hätte jemand hineingegriffen, das Fleisch mit zwei raschen Bewegungen herausgelöst und ihn so weiterziehen lassen.
Naples zuckte mit den Schultern. Im Gegensatz zu den anderen schien er nicht die Absicht zu haben, das Haus zu verlassen. Owen und ich hatten festgestellt, dass die Erwachsenen oft schockiert waren, wenn wir mit ihnen sprachen, als wären sie etwas begriffsstutzig, ja intellektuell unterlegen – ein Ärgernis, mit dem wir uns arrangiert hatten –, und uns dann mit Informationen versorgten und in einem Ton mit uns redeten, den sie sonst nie bei Kindern anschlugen. Auf Naples hatte diese Technik jedoch nicht den gleichen Effekt; seine Arroganz verlieh ihm eine Art Unerschütterlichkeit, die sich als sehr ungünstig erwies.
»Was zur Hölle ist die Chinagrippe?«, begann ich.
Naples paffte. »Das würdest du nicht verstehen«, sagte er unwirsch.
»Ich glaube, das haben Sie sich ausgedacht.«
»Und ich glaube, du bist ein unverschämter Rotzlöffel. Und dein Bruder genauso.«
»Sie haben es sich wirklich ausgedacht, oder?«
»Pass auf, was du sagst, Junge.«
»Aber was ist es denn dann?«
So ging das einige Male hin und her – ich fragte, Naples drohte –, bis er schließlich seufzend nachgab. »Es ist eine Krankheit, die durch Mücken verbreitet wird. Deine Mutter wurde gestochen, erkrankte und starb.« Das schien mir eine logische Erklärung zu sein, und ich verstummte. Eine Minute lang saßen wir schweigend da und dachten wohl jeder für sich über ihr irgendwie enttäuschendes Dahinscheiden nach. Doch dann wurde Naples bewusst, wie ich ihn zur Beantwortung meiner Frage gedrängt hatte, und er wurde wieder er selbst. »Ich bin überrascht, dass sich deine Mutter nicht umgebracht hat«, sagte er. »Ich hätte es weiß Gott getan, wenn du mein Sohn wärst.« Seine Augen glänzten triumphal und erwartungsvoll.
Es kümmerte mich nicht, was er gesagt hatte, aber er schien mein Schweigen als Zeichen der Betroffenheit zu werten; zufrieden klopfte er die Asche aus seiner Pfeife auf den Tisch, wo sie einen sauberen Ameisenhügel bildete, und verließ das Haus durch die Vordertür, die er hinter sich zuschlug. Ich hörte ihn pfeifen, als er den Weg entlangging, bis der Klang allmählich verhallte und schließlich nur das Summen eines sommerlichen Insektenschwarms zurückblieb. Es war das erste Mal, dass jemand mit mir wie mit einem Erwachsenen gesprochen hatte.
*
Aber es war auch John Naples, dieser eingebildete, fünftklassige Kleinstadtarzt, der mein Interesse für Krankheiten weckte. Er tat es unabsichtlich – ich glaube nicht, dass er mit mir so offen über den Tod meiner Mutter redete, weil er mich wie einen Erwachsenen ansprechen wollte; tatsächlich war er ein engherziger, grausamer Mann, und ich bin mir sicher, dass er nichts weiter beabsichtigte, als mich vor den Kopf zu stoßen und zum Weinen zu bringen –, aber mit seiner brutalen und fehlerhaften Erklärung ermöglichte er mir einen ersten Einblick in die Welt der Krankheiten und ihre anspruchsvollen, hochkomplexen Rätsel.
Schon in diesem Alter interessierte sich Owen für Wörter: Er las Lexika und alle möglichen anderen Bücher und liebte jede Art von Wortspiel – Anagramme, Kalauer, Palindrome. Er konnte den ganzen Tag lang Reime aneinanderreihen, die er irgendwo entdeckt oder erdacht hatte. Und obgleich ich ebenfalls Freude am Lesen hatte, liebte ich den Sprachsport nie so sehr wie Owen. Das lag daran, dass die Sprache in meinen Augen über keine eigene Intelligenz verfügte – Menschen hatten sie erschaffen, und Menschen hatten sie mit Bedeutung gefüllt, und daher war ein gut geschriebener Text für mich oft nicht mehr als ein ausgeklügelter chinesischer Geheimniskasten. Autoren werden für ihre Gewandtheit im Umgang mit etwas Menschengemachtem gerühmt, etwas, das nach Gutdünken verändert oder manipuliert werden kann; doch was soll brillant daran sein, ein von Menschenhand geschaffenes Gebäude zu erweitern? Aber vielleicht ergibt das auch keinen Sinn. Ich will es anders sagen: Der Sprache wohnt kein Geheimnis inne.
Die Wissenschaft hingegen, insbesondere die Wissenschaft der Krankheiten, bestand durch und durch aus köstlichem Geheimnis, war voller Einschlüsse aus dunklem, öligem Mysterium. Sprache war anfällig für Missverständnisse und Fehldeutungen, ihre Regeln konnten nach Lust und Laune oktroyiert oder ignoriert werden. Sie war disziplinlos. Zuweilen erschien sie mir wie eine Art Spiel, das der Mensch zu seiner Zerstreuung ersonnen hatte, so wie Owen es tat. Eine Krankheit aber, ein Virus, ein sich schlängelnder Bakterienstrang, existierte unabhängig vom Menschen, und es oblag uns, seine Geheimnisse zu ergründen.
John Naples betrachtete Krankheiten natürlich nicht auf diese Weise (es ist ein deutliches Anzeichen für einen schwachen Verstand, wenn der Arzt darauf beharrt, seine Bemühungen müssten sich auf den Patienten und nicht auf die Krankheit richten), aber ich muss ihm zubilligen, dass er als abschreckendes Beispiel in mein Leben trat, als Prototyp jener Leute, mit denen ich mich heute auseinandersetzen müsste, hätte ich mich nicht für die medizinische Forschung entschieden. Schon damals wusste ich, dass ich mich mit unvollständigen Erklärungen nicht zufriedengeben würde. Dafür war ich schlicht zu ungeduldig.
*
Glücklicherweise sollte Naples nicht das letzte Wort behalten. Mein Vater mag ein bequemer Mensch gewesen sein, aber er war kein Narr, und in dieser Angelegenheit erwies er sich als überraschend kompetent. Später am Nachmittag, nach einem Telefonat mit seiner Schwester in Rochester (er hatte nicht daran gedacht, Owen zu informieren, was ich selbst übernehmen musste, als dieser schließlich murrend und sich die Augen reibend in die Küche getappt kam), rief er einen ehemaligen Kommilitonen von Sybil in Indianapolis an, der seinerseits einen Freund in Crawfordsville anrief, einem achtzig Kilometer östlich gelegenen Ort. Dieser Arzt – ein gewisser Dr. Burns – ließ meine Mutter zur Autopsie in seine Klinik bringen.
In der darauffolgenden Woche schickte er uns seinen Bericht, dem zufolge meine Mutter nicht an der Chinagrippe (»Mir persönlich ist diese Krankheit nicht bekannt, wobei ich einräumen muss, dass ich als Pathologe vielleicht weniger gut mit örtlich auftretenden Krankheiten vertraut bin als mein geschätzter Kollege Dr. John M. Naples«, wie Burns es in seinem Brief diplomatisch formulierte), sondern an einer Arterienerweiterung gestorben war. Einer Arterienerweiterung! Nachdem Sybil mir erklärt hatte, was das war, stellte ich es mir oft vor; beinahe konnte ich die leise Explosion des geplatzten Gefäßes hören, die Windung des durchnässten, schlaffen Gewebes sehen, das schwarze Blut, das ihr Hirn im glänzenden, klebrigen Rot von Granatäpfeln färbte. (Als ich später, im Teenageralter, einen sonderbaren Anflug von Schuldgefühlen durchlebte, dachte ich: So jung! So ungerecht! Und noch später, als ich erwachsen und alt genug war, um ernsthaft über mein eigenes Ableben und meine bevorzugten Todesumstände nachzudenken: So dramatisch! Ich stellte mir Sternschnuppen vor, Feuerwerk, prächtige Lichttropfen, die wie tausend funkelnde Juwelen vom Himmel fielen, jede Scherbe für sich nicht größer als ein Keimling, und beinahe neidete ich meiner Mutter diese letzte großartige Erfahrung.)
»Sie hat nicht gelitten«, schrieb mir Sybil. »Sie hatte einen guten Tod. Sie hat Glück gehabt.«
Einen guten Tod. Ich dachte viel über diese Formulierung nach, bis ich selbst Arzt wurde und erkannte, was Sybil gemeint hatte. Doch als Kind erschienen mir ihre Worte so rätselhaft wie das Konzept des Todes an sich. Ein guter Tod. Meine Mutter war jemand, dem ein guter Tod zuteilgeworden war. Sie, die Träumerin, der Geist, hatte das größte Geschenk erhalten, das die Natur zu geben hat. In jener Nacht war sie so still unter ihre Decke gekrochen, wie sie die Füße in den blassen, murmelnden Strom tauchte, und hatte die Augen geschlossen, ohne ihren nächsten Aufenthaltsort zu kennen oder zu fürchten.
Noch Jahre danach hatte ich Träume, in denen meine Mutter mir in den seltsamsten Gestalten erschien, ihre Züge als groteske, hintergründig wirkende Applikation auf den verschiedenen Kreaturen: Sie begegnete mir in einem glitschigen weißen Fisch am Ende meines Hakens, mit dem klaffenden, gramvollen Maul und den dunklen Augen hinter schweren Lidern; in der Ulme am Saum unseres Grundstücks, die struppigen Büschel mattgoldener Blätter durch verfilzte Strähnen ihres schwarzen Haars ersetzt; in dem lahmen grauen, auf dem Grundstück der Muellers lebenden Hund, der sein Maul, ihren Mund, schmachtend öffnete und schloss, ohne einen Laut von sich zu geben. Als ich älter wurde, begriff ich, dass das Sterben für meine Mutter einfach gewesen war; um den Tod zu fürchten, muss man zuerst etwas haben, das einen ans Leben bindet. Aber sie hatte so etwas nicht gehabt. Es war, als hätte sie sich auf ihren Tod vorbereitet, seit ich sie kannte. An einem Tag war sie am Leben; am Tag darauf nicht mehr.
Und wie Sybil sagte, hatte sie Glück gehabt. Denn was können wir anderes vom Tod erwarten – als Güte?
*
Dann waren da nur noch Owen und ich und unser Vater. Ich habe kurz über meinen Vater gesprochen, und während es nicht ganz zutreffend wäre zu sagen, dass wir ihn gernhatten, war er doch in jedem Fall leichter zu ertragen als unsere Mutter, obwohl sie sich beide auf die gleiche ärgerliche Weise weigerten, in der Welt der praktischen Dinge Wurzeln zu schlagen. Hatte meine Mutter im Tod ihr Quäntchen Glück gefunden, so betrachtete mein Vater das Glück schon seit Langem als etwas, worauf er ein natürliches Anrecht hatte.
Mein Vater war in einer nahe gelegenen Stadt namens Peet zur Welt gekommen und aufgewachsen, einem Ort, von dem kaum jemand gehört haben wird. Heute ist Peet mehr oder weniger verlassen, einer jener Orte, die von Jahr zu Jahr trauriger und karger werden, während die Kinder aufwachsen und fortgehen, um niemals zurückzukehren. Als mein Vater jung war, war Peet jedoch eine nicht ganz unbedeutende Stadt. Sie verfügte über einen eigenen Bahnhof, der wiederum ein kleines, aber gesundes lokales Gewerbe hervorgebracht hatte. Es gab beispielsweise ein Hotel, ein Varieté und eine von zweistöckigen, in den Farben von Meer und Fels gestrichenen Holzgebäuden mit Ladenlokalen gesäumte Hauptstraße. Wer in westlicher Richtung nach Kalifornien reiste, machte in Peet halt, um sich in dem Kolonialwarenladen am Bahnhof ein Sandwich mit Eiersalat und eine Sellerielimo zu kaufen, bevor er seine Reise fortsetzte. Die Stadt florierte durch diese zeitlich begrenzten Beziehungen, die auf ihre Art rein und unverfälscht waren: Geld gegen Ware, eine freundliche Verabschiedung, die Gewissheit, dass man einander niemals wiedersehen würde. Denn sind die meisten Beziehungen im Leben schließlich nicht genau das, wenn auch über Jahre und Generationen hinweg ausgedehnt, bis sie schlaff und wabbelig werden?
Der Kolonialwarenladen gehörte den Eltern meines Vaters, deren Eltern wiederum aus Ungarn immigriert waren. Im Gegensatz zu ihrem Sohn waren sie fleißige Arbeiter, die genügsam lebten und vernünftig mit ihrem Geld umgingen.1911, im vierten Studienjahr meines Vaters, verstarben sie beide an der Grippe. Mein Vater und seine Schwester erbten das elterliche Geschäft, das Haus, dreißig Hektar Farmland, das sie in einer Stadt namens Lindon erworben hatten, sowie ihre gesamten Ersparnisse. Wie nach dem Tod meiner Mutter erwies sich mein Vater bereits damals als ein fähiger und tüchtiger Verwalter. Er verkaufte das Geschäft und das Haus in Peet, zahlte die Abgaben, organisierte die Beerdigung und eröffnete für seine Schwester ein Sparkonto. Sybil, die gerade die Highschool abschloss, verwendete einen Teil ihres Geldes für das Wellesley College. Mein Vater, der bequemer war, brachte sein Semester an der Purdue University zu Ende, machte seinen Abschluss und zog nach Lindon, wo er ein Haus kaufte und das Grundstück jedes Jahr um ein paar Hektar Land erweiterte. Während Sybil ihr Medizinstudium an der Northwestern University aufnahm, pflanzte mein Vater Sojabohnen, Schnittbohnen und gelbe Bohnen an. Er zog seine Söhne auf. Schließlich begann er als Fahrdienstleiter für die örtliche Eisenbahngesellschaft zu arbeiten. Er hatte alles erreicht, was er in seinem Leben erreichen würde.
Mein Vater war für mich so frustrierend, wie meine Mutter ungreifbar gewesen war. Soweit ich erkennen konnte, interessierte er sich ausschließlich dafür, einen Zustand vollständiger, absoluter Trägheit zu erreichen. Es ist kaum zu beschreiben, wie wütend mich das machte. Zum einen lebten wir in einem Land, in dem sich der Wert eines Menschen nach seinem Arbeitseifer bemaß. Nicht dass Owen oder ich besonders viel darauf gegeben hätten, was in den Augen der Einwohner bewundernswert war; es war nur so, dass wir ähnlich empfanden – dass das Verhalten meines Vaters auf eine Weise beschämend, ja vielleicht sogar unanständig war. Schließlich befanden wir uns mitten in der Wirtschaftskrise. Wir hörten Geschichten über Kinder, die von ihren Eltern ausgesetzt wurden, sahen Bilder von abgeschlagenen, erschöpften Männern, die für einen Teller Suppe, eine Beschäftigung, ein Darlehen anstanden. Und doch kam mein ehrgeizloser, behäbiger, auf spektakuläre Weise antriebsloser Vater irgendwie unversehrt aus der Sache heraus. Ich erinnere mich an viele Abende, an denen ich am Küchentisch saß, kribbelnd vor ungeduldigem Verlangen nach einem Vater, der schrie, mit mir schimpfte, mich schlug, damit ich mich mehr anstrengte, härter arbeitete, der Pläne für mich hatte, die meine eigenen überstiegen. Stattdessen saß mein Vater bloß da, summte verträumt den jüngsten Gassenhauer vor sich hin und rollte seine Zigaretten. In seinem struppigen Schnurrbart hing Mais, ein Überbleibsel einer hastig zubereiteten Mahlzeit, und als ich ihn darauf aufmerksam machte, schob er träge die Zunge heraus und fuhr sich damit in einer eleganten schlängelnden Bewegung um den Mund, ohne sein Summen zu unterbrechen. Diese achtlose, unbekümmerte Geste ärgerte mich maßlos. Heute muss ich über meine selbstgerechte Missbilligung ein wenig lachen: Natürlich profitierte ich außerordentlich vom unverdienten Glück meines Vaters, doch damals kam es mir vor, als würde er Owen und mir einen Bärendienst erweisen. Wer in diesem Haus aufwuchs, musste glauben, dass das Geld mit einem beruhigenden Prasseln vom Himmel fiel und dass nichts, nicht einmal die Aussicht auf ein großes Vermögen, irgendwelcher Mühen wert war. Tatsächlich häufte mein Vater sein Vermögen nicht aus kapitalistischem Eifer an – nein, wenn das Geld kam, dann kam es, und traf er hin und wieder eine falsche Geschäftsentscheidung, schien ihn das auch nicht weiter zu stören.
Die ganze Situation ärgerte mich, denn verwöhnte Kinder sehnen sich nach nichts so sehr wie nach Armutsromantik. Oft erträumte ich mir hart arbeitende Migranten, deren einzige Hoffnung ich war, als Eltern. Rührselige Kindergeschichten wie Die silbernen Schlittschuhe bewegten mich sehr, und ich machte meine Familienmitglieder zu Figuren in einer ähnlichen Erzählung. Mein Vater war dann das ungeschlachte, hilflose, sabbernde Schlaganfallopfer und Owen mein verkrüppelter, schwachsinniger Bruder. Ich war der heldenhafte Wegbereiter, so skrupellos wie listenreich. Bildung war die alleinige Hoffnung meiner Familie. Mein akademischer Erfolg war eine Notwendigkeit; ich würde Arzt werden und uns alle aus der Verzweiflung und dem Schmutz in solide, helle, geräumige Häuser führen. In meiner Fantasie heilten meine nach jahrelanger amerikanischer Ausbildung magisch gewordenen Hände meinen armen Vater, der sich über meinen Protest hinwegsetzte und augenblicklich zu arbeiten begann. Meine starke, zielstrebige Mutter würde zum ersten Mal seit Jahren wieder lächeln, schöner als je zuvor, und sobald das Geld für eine ordentliche Schule aufgebracht war, würde mein Bruder sprechen lernen und sich wie ein Athlet bewegen. Wie sehnte ich mich nach einem solchen Ansporn! Doch wie die Dinge lagen, musste ich nicht die Bürde der Armut überwinden, sondern die eines auf zufriedene und entschiedene Weise bequemen Vaters und einer behüteten Kindheit – einer Kindheit, die ich vielleicht hätte genießen können, wäre ich nicht so fest entschlossen gewesen, sie abzulehnen.
Allerdings hatte ich ja noch Sybil. Wie erwähnt, brachte mein Vater Sybil außerordentlichen Respekt entgegen, ja es ist wohl nicht übertrieben zu sagen, dass er Ehrfurcht vor ihr hatte. Bestimmt war sie ihm ein ebensolches Rätsel wie er mir: Wie konnte jemand, der so arbeitsam, so intelligent, so aktiv war, aus derselben Familie stammen wie er?