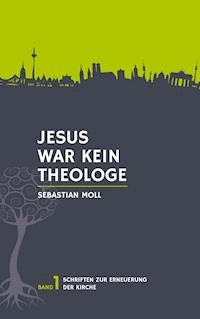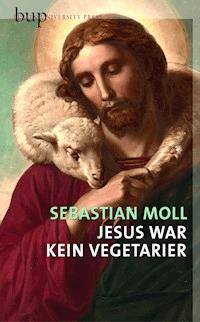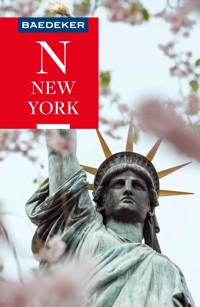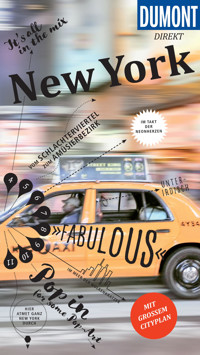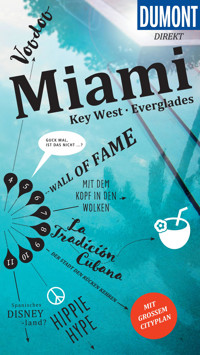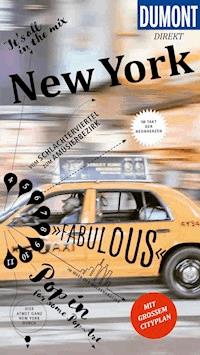19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Insel Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als Sebastian Molls Vater in den 60er Jahren ein Zuhause für seine Familie baute, verband er damit eine Hoffnung: die Vergangenheit vergessen. Denn als Angehöriger der Flakhelfer-Generation hatte er Nazi-Indoktrinierung, Kriegstrauma sowie die seelische Verstümmelung durch den faschistischen Männlichkeits-Kult erlitten. Mit dem Bau eines Vorort Reihenhauses im Süden Frankfurts vollzog er diesen Neuanfang architektonisch, zudem prägte er als Städteplaner einer Frankfurter Wohnungsbaugesellschaft den Neuaufbau seiner Heimat und trieb so eine Architektur der Verdrängung voran, die bis heute die deutschen Städte prägt. Doch sowohl im Privaten als auch im Leben der Stadt meldete sich das Verdrängte zurück.
Das Würfelhaus ist eine architektonische Freilegung der deutschen Nachkriegszeit. Kundig und einfühlsam erzählt Sebastian Moll anhand seiner Familiengeschichte den schwierigen und schmerzlichen Versuch seiner Generation und mit ihr der deutschen Gegenwart, das Erbe des Nationalsozialismus abzutragen.
»Sebastian Moll gelingt es eindringlich, eine familiäre Black Box zu füllen und dabei berührend, zutiefst persönlich und zugleich klar analytisch der Frage nach Männlichkeitsbildern gestern und heute nachzugehen. Ein spannend geschriebenes Stück Erinnerungskultur, wie wir es nötiger denn je brauchen.« Shelly Kupferberg
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 269
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Cover
Titel
Sebastian Moll
Das Würfelhaus
Mein Vater und die Architektur der Verdrängung
Insel Verlag
Impressum
Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.
Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.
Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.
eBook Insel Verlag Berlin 2024
Der vorliegende Text folgt der Erstausgabe, 2024.
© Insel Verlag Anton Kippenberg GmbH & Co. KG, Berlin, 2024
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlaggestaltung: Anzinger und Rasp, München
eISBN 978-3-458-78135-6
www.insel-verlag.de
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
Informationen zum Buch
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
1 Das Zimmer
2 Klaus
3 Erika
4 Frankfurt im NS
5 Heinz
6 Bombenkind
7 Ruinenlust
8 Heinz und Erika
9 Das neue Neue Frankfurt
10 Die Wiederkehr des Unterdrückten
11 Nowhere Man
12 Abgründe
13 Frankfurt als Nicht-Ort
Danksagung
Ausgewählte Literatur
Informationen zum Buch
1
Das Zimmer
Der Frühling des Jahres 2009 war ungewöhnlich schön, so jedenfalls will es die Erinnerung. Die Tage waren mild, die Luft klar, und über der Reihenhaus-Siedlung im Süden von Frankfurt lag der schwere Duft von Forsythien und Hyazinthen.
Das Labyrinth schmaler Gehwege zwischen den sorgsam gepflegten Gärten der Siedlung war satt überwuchert, und wenn ich in diesem Frühling mit den Stimmen spielender Kinder im Ohr hier entlanglief, überkam mich ein wohliges Gefühl der Geborgenheit.
An diesen Tagen erschien die Siedlung als all das, als was ihre Planer sich zu Beginn der 1960er Jahre gewünscht hatten: ein grünes Familienidyll mit der rechten Mischung aus Privatsphäre und nachbarschaftlicher Begegnung. Die grünen Parzellen, je individuell angelegt, verhinderten mitnichten, wie es die Kritiker seinerzeit befürchtet hatten, den nachbarschaftlichen Kontakt. Das Gespräch über den Zaun war Alltag, und Kinder spielten gemeinsam in den Gärten und Sandkästen.
Es stiegen Bilder in mir auf von verträumten Sommertagen, in denen wir uns auf dem Heimweg von der Schule in der Zeit und in dem Wegegewirr verloren, bis unsere Eltern Suchtrupps bilden mussten. Oder von durchlesenen Tagen unter dem Schatten des großen Ahorns hinter unserem Haus. Oder von langen Streifzügen durch die Wälder rund um die Siedlung, bei denen wir uns vorstellten, wir seien Trapper in den Weiten der Appalachen am Ende des 18.Jahrhunderts.
Es war sicher kein Zufall, dass mein Gedächtnis gerade jetzt die Siedlung in ein Idyll verwandelte, jene Siedlung, zu der ich fünfundzwanzig Jahre lang mit aller Kraft versucht hatte eine größtmögliche Distanz aufzubauen. Es war eine Flucht, die mich über Frankfurt am Main nach New York, dann über München und erneut nach New York geführt hatte. Ich wollte weg – weg aus dem Kleinbürgermief der westdeutschen Vorstadt, weg von der vermeintlich wohlgeordneten Existenz zwischen den gleichförmigen Reihenhäusern und vor allem weg von dem, was diese scheinbare Aufgeräumtheit dann schließlich doch nur dürftig zu übertünchen vermochte.
Doch jetzt, da die Auflösung des Hagebuttenwegs Nummer 41 anstand, wurde mein Blick frei für das, was meine Eltern sich erhofft und erträumt hatten, als sie im Jahr 1963 die Grundmauern eines der streng kubischen, zickzackförmig angeordneten Einfamilienhäuser in den sandigen Boden des hessischen Waldes gesetzt hatten.
Um 1960 herum, als die Gemeinde Langen die Gartenstadt Oberlinden in Rekordzeit aus dem Boden stampfte, waren meine Eltern ein Vorzeigepaar des deutschen Wirtschaftswunders. Mein Vater, 1927 als Sohn eines niederbayerischen Holzhändlers geboren, war nach seinem Wirtschaftsstudium in Frankfurt am Main jung in die Führungsetage der Nassauischen Heimstätte, eine der größten Frankfurter Wohnungsbaugesellschaften, aufgestiegen. Meine Mutter, Jahrgang 1930, Tochter eines Frankfurter Justizangestellten, war Redakteurin bei einem Wiesbadener Fachverlag.
Die Familiengründung des jungen Paares hatte sich ein wenig länger hinausgezögert. Der Wohnraum im zerstörten Nachkriegsfrankfurt, das zugleich als wirtschaftliches Zentrum der jungen Bundesrepublik einen enormen Zuzug zu verkraften hatte, war knapp. Meine Eltern konnten froh sein, nach der Heirat 1955 im Frankfurter Ostend eine kleine Zweizimmerwohnung beziehen zu können.
Außerdem wollte das junge Paar, dessen Jugend der Krieg und das Nazi-Regime aufgefressen hatten, leben. Es wurden Nächte in Jimmy’s Bar an der Messe durchgetanzt. Man ging ins Kino, um begierig französische und amerikanische Filme anzuschauen. Und man fuhr, wie so viele Deutsche in den 1950er Jahren, mit dem neuen Käfer in den Urlaub nach Italien.
Natürlich hätten meine Eltern als Doppelverdiener auch in die ausgesuchteren Vororte im Taunus ziehen können, wenn es allein um das Häuschen im Grünen gegangen wäre. Doch mein Vater wollte keine Villa, er wählte ganz bewusst ein normiertes Reihenhaus in einer jener Siedlungen, die ab Beginn der 1950er Jahre in immer weiteren Kreisen die Frankfurter Innenstadt umringten und in das Umland wucherten.
Die Bewerbung bei einer Frankfurter Wohnungsbaugenossenschaft war für den jungen Diplom-Kaufmann Heinz Moll keine rein pragmatische Entscheidung gewesen. Er hätte auch, in Frankfurt naheliegend, in das Finanzgeschäft einsteigen können, doch er wollte am Wiederaufbau der Stadt teilhaben. Er wollte die Zukunft mitgestalten.
Dabei war er, als nach 45 überzeugter Sozialdemokrat, von jenem »realistischen städtebaulichen Idealismus« getragen, den der Leiter des Stadtplanungsamtes Herbert Boehm im Jahr 1953 für Frankfurt beanspruchte. Boehm, 1949 in sein Amt eingesetzt, war nach dem Krieg aus Polen nach Frankfurt zurückgekehrt, wo er bereits Ende der 1920er Jahre als Dienststellenleiter unter dem berühmten Stadtbaurat Ernst May einen Generalbebauungsplan für die Stadt mitverantwortet hatte.
Er war die Blaupause für das »Neue Frankfurt«, dieser Generalbebauungsplan, jene Utopie der durch und durch modernen Stadt, deren Verwirklichung zuerst die Weltwirtschaftskrise und dann die Nazis verhinderten. Immerhin hatte May, der nie nach Frankfurt zurückkehrte, bis dahin deutliche Spuren in der Stadt hinterlassen.
Sie sind heute Pilgerstätten für Architektur-Connaisseurs, die original May-Siedlungen rund um Frankfurt, an der Nidda entlang in Praunheim, Westhausen, in der Römerstadt und am Riederwald. Die den vorfabrizierten, gänzlich rationalen Häusern zugehörige Frankfurter Küche von Margarethe Schütte-Lihotzky ist ein Prunkstück der Designsammlung des Museum of Modern Art in New York. Für May-Häuser, die einst dem Kleinbürgertum erschwingliche Lebensqualität bringen sollten, werden von Gutverdienenden, nicht zuletzt um Kennerschaft und Geschmack zu demonstrieren, Rekordpreise bezahlt.
Gemäß der Charta von Athen, dem Abschlussdokument der Congrès Internationaux d’Architecture Moderne, das May im Jahr 1933 mitverfasst hatte, sollte die neue Stadt die chaotische, mittelalterliche europäische Stadt entzerren und entrümpeln. Der Stadtkern, aus dem, wie in Frankfurt, das Bürgertum schon im 19.Jahrhundert geflohen war und der zunehmend verelendete, sollte in ein rein kommerzielles Verwaltungszentrum umgewandelt werden. Für die Arbeiter- und die Mittelschicht sollten rund um den Kern herum bezahlbare Quartiere mit hohem Lebensstandard entstehen. Licht, Luft und Grün waren die Gestaltungsprinzipien der Anlagen, Fertigbauweise und moderne Praktikabilität in den Häusern. »Hier sollen unsere Kinder zu gesunden und lebensfrohen Staatsbürgern heranwachsen«, hatte Ernst May gesagt.
Natürlich war der Rückgriff auf die Ideale des Neuen Frankfurt nach dem Krieg ideologisch nicht unproblematisch. Frankfurt machte, wie vielleicht keine andere deutsche Stadt, ernst mit der »Stunde Null«. Man tat so, als könne man einfach am Jahr 1933, dem Jahr der Athener Charta, wieder anknüpfen und so tun, als sei dazwischen nichts gewesen. Das neue Neue Frankfurt sollte eine durch und durch geschichts- und erinnerungslose Bauwelt darstellen.
Alexander Mitscherlich, der damals an der philosophischen Fakultät in Frankfurt lehrte und im Selbstversuch in einem Sozialbauturm in Frankfurt-Sossenheim wohnte, beschäftigte sich schon 1965, zwei Jahre vor dem gemeinsam mit seiner Frau Margarete verfassten Traktat über die Unfähigkeit der Deutschen zu trauern, mit dieser Frankfurter Anstrengung, die jüngere Geschichte auszuradieren. In seinem Pamphlet Die Unwirtlichkeit unserer Städte spricht er von Stadtlandschaften, die mit aller Macht die quälenden Traumata und Schuldgefühle, die der Zusammenbruch des Dritten Reichs ausgelöst hatte, zu vermeiden suchen.
»Eine Gesellschaft, die ihre ›Wiedergutmachung‹ – was gleich mit seelischer Genesung ist – dadurch betreibt, dass sie so tut, als hätte es keine Katastrophe gegeben«, heißt es da, »erwacht in ihren Gliedern sicher unterschiedlich schnell aus ihren Wunschträumen und Verleugnungen, aber sie erwacht. Dabei wird sich herausstellen, dass der Wiederaufbau, den wir erlebt und zugelassen haben, noch eine peinliche Nachphase der kollektiven Psychose des Nationalsozialismus ist, die zur Zerstörung unserer edelsten Stadtsubstanz geführt hat.«
Das Verdrängte hatte sich freilich bereits zwei Jahre vor der Veröffentlichung des Buches, im Jahr 1963, in Frankfurt sein Recht gesucht. Der Auschwitz-Prozess im Bürgerhaus an der Frankenallee zwang die Wirtschaftswunder-Gesellschaft dazu, sich mit ihrer Vergangenheit auseinanderzusetzen, die sie so angestrengt zu ignorieren versucht hatte. Auf wirklich ernsthaften Widerstand stieß das städtebauliche Verdrängungsprojekt allerdings erst, als im Jahr 1987 am Börneplatz – der erst neun Jahre zuvor wieder den Namen des jüdischen Publizisten und 48er-Revolutionärs zurückerhalten hatte – beim Bau eines städtischen Verwaltungsgebäudes die Grundmauern des jüdischen Ghettos ausgegraben wurden. Nur nach schweren Protesten zeigte sich die Stadt dazu bereit, diese letzten Überreste jüdischen Lebens in der Innenstadt von Frankfurt nicht einfach wegzubetonieren.
Als die Kämpfe um den Börneplatz abgeklungen waren, gestand im Jahr 1992 der einstige Planungsdezernent der Stadt, Hans Kampffmeyer, ein: »Wer sich nach Krieg, Drittem Reich, Unterdrückung und Holocaust darauf einließ, die neue Freiheit als neue Herausforderung und Chance für sich, für seine Stadt, für eine demokratische Gesellschaft zu sehen und zu nutzen, nahm sie als schwere, allerdings vielfach faszinierende Aufgabe auf sich […] Haben wir für die Stadtentwicklung Verantwortlichen […] ahnungslos und unsensibel Straßenzüge geplant und Bauvorhaben unternommen? Ich fürchte, das Studium der Magistrats-Akten wird genau das ergeben. Wir sahen die Stadt Frankfurt vor 1933, insbesondere ihre große ›Weimarer Zeit‹: Ludwig Landmann, Ernst May, Mannheim, Horkheimer, Adorno. An sie knüpften wir an.«
Die Langener Siedlung meiner Eltern hatte freilich nur wenig an Geschichte, die man hätte ausradieren können. Sie wurde in ein gerodetes Waldstück gebaut, das die Stadt Langen der Nachbargemeinde Egelsbach abgekauft hatte.
Historisch war hier lediglich das angrenzende Schloss Wolfsgarten, ein barockes Jagdschloss der Landgrafen zu Hessen. Es lag versteckt im Wald, auf der anderen Seite jener Ringstraße um die Siedlung, die wir als Kinder eigentlich nie überqueren sollten, weshalb wir es natürlich umso lieber taten. Dort umschlichen wir oft die hohe, dichte Hecke und versuchten Blicke auf den prächtigen Garten und das dreihundert Jahre alte geheimnisvolle Herrenhaus zu erhaschen.
Das Schloss war ein beliebtes Thema der Klatschspalten, als wir hier aufwuchsen, weil der englische Prinz Philip häufig zu Besuch kam. Er hatte gute Erinnerungen an das Waldschloss. Schon als kleiner Junge durfte Philip die Sommer hier mit seiner Mutter, der gebürtigen Darmstädterin Alice von Battenberg, verbringen.
In späteren Jahren fanden die Besuche jedoch zunehmend inkognito statt. Das Bild des jungen Prinzen bei der Beerdigung seiner Schwester und seines Schwagers nach einem Flugzeugabsturz im Jahr 1937 hatte in London für Ungemach gesorgt. Die Trauergemeinde war durchsetzt von SA- und SS-Uniformen. Spätestens nach 1939 wurde es für Angehörige der britischen Monarchie deshalb heikel, den Kontakt zur deutschen Verwandtschaft allzu offen zu pflegen. Doch gerade darum war es für uns immer ein Spiel, zu spekulieren, ob und wann vielleicht eine abgedunkelte Limousine mit dem Prinzen die Egelsbacher Landstraße heruntergefahren kommen würde.
Wenn ich aus meiner Wahlheimat New York kam und im Taxi vom Flughafen nach Langen saß, musste ich manchmal an den Prinzen denken. Meine Besuche in der Siedlung, glaubte ich, waren denen von Philip gar nicht so unähnlich. Aus der großen weiten Welt kommend, ein wenig verhohlen und mit Scham besetzt, auf der Suche nach einem vermeintlichen Kindheitsidyll, nach einem Ruhepol, nach einem Ort der Überschaubarkeit und Sorglosigkeit.
Von dem Jagdschloss abgesehen, war die Siedlung jedoch betont ahistorisch. Die organisch geschwungenen, den Adern eines Blattes nachempfundenen Straßen hatten Namen wie Hagebuttenweg, Farnweg und Anemonenweg. Nur die Berliner Allee, am Eingang mit einem steinernen Bären markiert, sollte vage daran erinnern, dass Deutschland noch immer ein geteiltes Land war.
Ansonsten erinnerte an den Krieg und die Welt außerhalb der Gartenstadt nur noch die Sudetensiedlung, die an das Ernst May zitierende Ensemble von Reihenhäusern angrenzte und deren Straßen Namen wie Schweriner Straße und Dresdner Straße trugen. In dreistöckigen Mehrfamilienhäusern mit großen Gärten kamen hier heimatvertriebene Bauern unter, die, ihren Lebensgewohnheiten entsprechend, kleinteilige Landwirtschaft betreiben durften. Aus meiner Kindheit erinnere ich mich noch an die Gemüsegärten mit Hühnern und Kaninchenställen. Im Jahr 2009 waren sie akkurat gemähten Rasenflächen mit Campingsitzgruppen und Grillgelegenheiten gewichen.
Unser Haus spiegelte die Geschichtslosigkeit der Siedlung perfekt wider. Bereits die geometrische Würfelform signalisierte strenge Rationalität, die auch das bleiche Hellrosa der Fassade nur bedingt zu brechen vermochte. Der Grundriss des Erdgeschosses war seinerseits enorm praktisch. Durch den Vorgarten in das Haus eintretend, erreichte man durch ein kleines Vestibül das geräumige Wohnzimmer, das beinahe das gesamte Parterre einnahm. Nach hinten öffnete es sich zum Garten, in der Mitte war es durch einen kleinen Wanddurchbruch unmittelbar mit der für die Zeit hochmodernen Küche verbunden.
Das Wohnzimmer selbst hatte mein Vater in eine Art Studio für modernes Design verwandelt. Ich sage mein Vater, weil ich mir sicher bin, dass er bei der Einrichtung das Sagen hatte. Das gesamte Haus war sein Projekt gewesen, in das meine Mutter nur zögerlich einwilligte. Sie verließ die Stadt, in der sie aufgewachsen war, nur ungern, jene Stadt, deren Zerstörung und Wiederaufbau sie aus allererster Hand erlebt hatte und mit der sie beinahe körperlich verbunden war. Frankfurt war ein Teil von ihr, und sie fühlte sich in der Vorstadt bis zu ihrem Tod 2009 wie amputiert.
Die Vision des neuen Neuen Wohnens, der mein Vater sich beruflich und privat verschrieben hatte, blieb ihr jedenfalls fremd. Einige der besten Stücke seiner Sammlung, wie ein Eames-Sessel etwa, mottete sie nach dem Tod meines Vaters ein. Der kalifornische Designer Charles Eames war ihr kein Begriff. Ebenso wenig dürfte ihr Dieter Rams etwas gesagt haben, dessen Regale die gesamte Längsseite des Wohnzimmers zierten. Für sie waren die in die Wand gehängten Module, die den Frankfurter Gestalter weltberühmt gemacht hatten, wohl einfach nur praktisch und stabil.
Diese Wand auszusortieren war für mich der einfachste Teil der Haushaltsauflösung in jenem Frühling. Es gab hier kaum etwas, das mich sonderlich aufgewühlt hätte. Die Literatur, die hier präsentiert wurde, war, wie die Möbel, eine Demonstration modernen Geschmacks. Neben amerikanischen Klassikern des 20.Jahrhunderts von Jack London und John Dos Passos bis hin zu Norman Mailer und Sinclair Lewis stand eine Standardauswahl deutscher Nachkriegsliteratur – Günter Grass, Walter Kempowski, Heinrich Böll.
Mit dem Plattenregal, in dessen Mitte eine Kompaktstereoanlage der Marke Wega aus den 1970er Jahren überlebt hatte, verhielt es sich ähnlich. Dort fand sich eine für einen deutschen Nachkriegshaushalt ansehnliche Sammlung an Jazzalben, von Glenn Millers Big Band Sound über Frank Sinatra und Mahalia Jackson bis hin zu Bop-Klassikern wie Dave Brubeck und Charlie Parker.
Auf etwas Tieferes im Gefühlsleben meines Vaters deutete lediglich die Ecke mit Shanties hin. Es war ein Überrest jener Seefahrerromantik, die er lebenslang mit sich trug und die nicht zuletzt sein Schicksal während des Dritten Reichs bestimmte. Wäre mein Vater zum Kriegsende älter als siebzehn gewesen, dann wäre er sicherlich als Offizier der Marine in die Kriegsgefangenschaft gegangen, vielleicht als Kommandant eines Zerstörers oder gar als einer jener verwegenen U-Boot-Fahrer, die er als Hitlerjunge romantisierte.
Die Bücher und Platten waren für mich leicht zu sortieren. Bände, die mir selbst etwas bedeuteten oder deren Lektüre mich als Jugendlicher mit meinem Vater verbanden, behielt ich. Eine Biografie von Dschingis Khan etwa, über dessen Verwegenheit als junger Krieger mein Vater und ich Männerbande knüpften. Oder eine als Abenteuerroman verpackte Erzählung über das Leben des nordamerikanischen Shawnee-Häuptlings Tecumseh, der, ganz ähnlich wie Dschingis Khan, die Stämme seines Volkes einte und sie in den Kampf gegen die amerikanischen Kolonialisten führte. Mit diesen Büchern träumte ich mich als Zehnjähriger in die Rolle des jungen Kriegerprinzen hinein, der sich anschickt, die Welt zu erobern.
Vom Rest konnte ich mich leicht trennen. Nichts dabei fühlte sich nach einem Verrat an dem Verstorbenen an. Die Rams-Regale behielt ich selbstverständlich. Sie zieren heute, gemeinsam mit dem Eames-Sessel, mein Wohnzimmer in New York.
Das einzige Stück des Wohnzimmers, das aus dem stilistischen Rahmen fiel, war der große Esstisch, der den vorderen Teil des Raumes einnahm. Die lange Holztafel, an der acht Personen Platz fanden, stammte mitsamt den Stühlen direkt aus der Werkstatt meines Großvaters, des niederbayrischen Sägewerkers, der gewiss nichts mit modernem Design am Hut hatte.
An diesem Tisch fand ein Großteil des Familienlebens statt, insbesondere an den Wochenenden. Auf dem hinteren Teil stapelten sich nicht selten meine Schulbücher, die zwischen den Mahlzeiten hervorgezogen wurden. Mein Vater saß dann am Kopf, ich direkt neben ihm, während er mich dabei beaufsichtigte, wie ich meine Aufgaben erledigte.
Oder besser gesagt, er erledigte sie häufig für mich. Wie einmal in der achten Klasse, als ich eine Hausarbeit über den Film zu Joachim Fests Hitler-Biografie zu schreiben hatte. Mein Vater schrieb sie mit einem Kugelschreiber auf einem Din-A4-Block vor, ich übertrug sie dann penibel mit einem Füllfederhalter der Marke Geha auf einzeilig liniertes Papier.
Aus der Hausarbeit wurde ein 130 Seiten starkes Konvolut, das bei der Haushaltsauflösung 2009 in einem Kellerregal wieder zum Vorschein kam. Es war durchsetzt mit fotokopierten und säuberlich ausgeschnittenen Fotos, einige davon aus Fests Buch, einige davon offensichtlich aus Nazi-Büchern, komplett mit Fraktur-Bildunterschriften wie dieser: »1929 – Ruhelos stürmt der Führer von Versammlung zu Versammlung. Sein Wort reißt Jagende vorwärts, macht Zweifelnde gläubig. In übermenschlicher Arbeit zwingt ein Wille das Schicksal. Deutschland steht auf.«
In der von meinem Vater vorgeschriebenen Einleitung war zu lesen: »Hitler hat für ein Jahrzehnt die Weltgeschichte bestimmt. Umso erstaunlicher erscheint die Tatsache, dass seit seinem Tod vor Fest niemand den Versuch unternommen hat, eine breite Öffentlichkeit über diesen Mann und sein Wirken zusammenhängend zu informieren, schon gar nicht die deutsche Öffentlichkeit. Diese deutsche Öffentlichkeit hatte ihn zum Teil selber erlebt und hatte ihn noch in Erinnerung, wie er ihnen damals erschienen war (Autobahn, Beseitigung der Arbeitslosigkeit, Ruhe und Ordnung – wenn nur das mit den Juden nicht passiert wäre). Alles, was ihnen an Film geboten wurde, musste lächerlich auf sie wirken und sie konnten sich seine Verbrechen und seinen Erfolg noch immer nicht erklären.«
Das waren natürlich nicht die Worte eines Dreizehnjährigen und auch meine Lehrer damals waren offenbar stutzig geworden. »Äußerst informativ und aufschlussreich«, steht mit rosarotem Edding auf die Rückseite geschrieben. »Kann ich die Arbeit noch ein paar Tage behalten?« Zweifellos wird es im Kollegium eine Diskussion gegeben haben, was mit diesem Werk anzustellen sei. Ich bekam schließlich eine Eins dafür, die mir jedoch ebenso wenig bedeutete wie der Aufsatz selbst. Beides hatte nur wenig mit mir zu tun.
Die 130 Seiten waren genau das, was die Einleitung versprach: Ein Erklärungsversuch für die gelungene Verführung Deutschlands durch die Augen von Fest. Natürlich sollte diese Aufarbeitungsarbeit nur sekundär bewirken, dass ich etwas über das Dritte Reich lerne. Ich war lediglich ein Vehikel für die Arbeit, die mein Vater an der eigenen Vergangenheit zu leisten versuchte.
Vielleicht war das Szenario aber sogar noch finsterer. Mein Niederschreiben, die beinahe monastische Praxis des Transkribierens seiner Gedanken dazu, warum er sich als Junge hatte verführen lassen, sollten diese Gedanken validieren. Ich war eine Verlängerung seiner selbst und gleichzeitig eine Instanz, die er in sich selbst nicht finden konnte. Es war nicht das einzige und nicht das letzte Mal, dass die Grenzen zwischen meinem Vater und mir verwischten.
Später, als ich in der gymnasialen Oberstufe angekommen war und meine Wochenenden zunehmend von Schwimmwettbewerben beansprucht waren, wurden diese Sitzungen immer seltener. Ich hatte in den Schwimmbädern Hessens und später der ganzen Bundesrepublik eine Welt gefunden, die mir gehörte und in der ich ich selbst sein konnte – unabhängig von der Gedanken- und Gefühlswelt des Vaters. Mein Vater verschwand hingegen ganz aus dem Wohnzimmer und verbrachte zunehmend Zeit in einem kleinen Kellerraum, den er als seinen Rückzugsort für sich in Anspruch genommen hatte.
Das Zimmer war das letzte, das ich in Angriff nahm, als ich das Würfelhaus von oben bis unten durchging, um zu entscheiden, was mit jedem einzelnen Ding zu geschehen hat. Es war der Endpunkt einer schier endlosen Trauerarbeit, bei der ich mich monatelang unter Schmerzen damit beschäftigte, welches Stück einer nun unwiderruflich verloren gehenden Welt ich mitnehmen möchte in meine Zukunft und was nun mit dem Reihenhaus endgültig aus meinem Leben verschwinden sollte.
Ich mochte dieses Zimmer noch nie, schon der leicht modrige Geruch, der dem Raum entstieg, verursachte mir Übelkeit. Es ist ein Reflex, der sich bei mir bis heute einstellt, wenn ich daran denke.
Das Zimmer bestand aus nicht viel mehr als aus zwei Regalen, einem Sessel und einem Sofa, doch die Literatur in diesen Regalen war eine andere als jene in der Etage darüber. Da stand zum einen das, was wir in der alten Bundesrepublik als Aufarbeitungsliteratur kennengelernt haben. Das ging von Eugen Kogon über die Mitscherlichs und Hannah Arendt bis hin zu den Memoiren des Auschwitz-Kommandanten Hess.
Komplementär dazu gab es jedoch auch eine ganze Wand voller Weltkriegs-Bildbände. Es waren dieselben Bände, aus denen die Illustrationen zu meiner Hitler-Hausarbeit stammten, Fotobücher mit Kodachrome-Farbbildern des Krieges in Russland, in Frankreich und in Ägypten, Verklärungen der Schlachten von Flandern über Nordafrika bis nach Russland und Dokumente des Grauens zugleich.
Zwischen diesen Werken fand ich im Jahr 2009 auch mehrere Jahrgänge der Illustrierten Das Dritte Reich – Zeitgeschichte in Wort und Bild, einer in den 60er und 70er Jahren überaus erfolgreichen Zeitschrift. Herausgeber war John Jahr, Mitbegründer des Gruner + Jahr Verlages und NSDAP-Mitglied seit 1933. Unter dem Deckmantel der historischen Aufklärung wurden hier die Heldentaten der deutschen Wehrmacht gefeiert, der Leser wurde in eine Zeit zurückversetzt, in der er ohne die Bürde der Schuld und der Scham an den Endsieg und die Größe und Herrlichkeit der deutschen Wehrmacht glauben konnte. Die Titelseiten hatten Schlagzeilen wie »Über den Don«, illustriert vom Foto eines entschlossen vorstürmenden deutschen Landsers. Ein anderes Cover trug den Titel »Der Angriff – Sieg im Westen«, ein weiteres zeigte Herman Göring, die Bildunterschrift lautete »Wer Jude ist, bestimme ich«. In derselben Ausgabe fand sich ein Text mit der Überschrift: »Nürnberger Gesetze – Blut und Ehre.« Auf der Rückseite wurde ein komplettes LP-Set mit den Reden des Führers angeboten.
Als Punkt hinter der III im Schriftzug »Das III. Reich« war in der Anzeige ein kleines Hakenkreuz versteckt, gerade klein genug, um keine Verfassungsschützer auf den Plan zu rufen. Sie liefen gut, diese Hefte damals, mein Vater war nicht der Einzige, der dann und wann in den Keller ging, um heimlich in die Zeit vor dem Zusammenbruch des Dritten Reiches zurückzureisen. Rund 450000 Exemplare wurden verkauft, auch wenn das Münchner Institut für Zeitgeschichte sich beschwerte, der Verlag ordne »zeitgeschichtliche Aufklärung seinem Geschäftsinteresse unter« und betreibe »verantwortungslose Verlagsspekulation.«
Ich erinnere mich daran, als Kind in solchen Heften geblättert zu haben, ohne den ideologischen Zusammenhang wirklich zu verstehen. Eingeprägt haben sich nicht zuletzt Fotos ausgebrannter Panzer mitsamt verkohlten Landser-Leichen, die mir das Grauen des Krieges vielleicht viel zu jung, viel zu tief in die Glieder fahren ließen. Wenn die Fest-Hausarbeit mich an der Anstrengung meines Vaters partizipieren ließ, seine Hitler-Faszination als Jungnazi zu begreifen, ließen mich diese Fotos an seinem Kriegstrauma teilhaben.
Ganz in der Ecke befand sich dann noch eine kleine Sammlung an Erotika. Die Memoiren von Josefine Mutzenbacher und Xaviera Hollander gab es da sowie einen Stapel von Sexheften, Produkte der vermeintlichen sexuellen Befreiung im Westdeutschland der 1970er Jahre, die allzu rasch in Voyeurismus und Pornographie gekippt war. Darunter hing, an einer gemaserten Holzwand, eine kleine Galerie mit gerahmten Portraits von Liebhaberinnen aus seiner Jugend. Odette aus dem Elsass, Friedl vom Bodensee, beides ausnehmend hübsche junge Frauen mit wallendem hellbraunem Haar und einem sinnlichen, dem Fotografen geltenden Lächeln.
Mein Vater zog sich in dieses Zimmer zurück, um den verschiedenen Anteilen seines konfusen und aufgewühlten Geistes- und Gefühlslebens Raum zu geben, die hier, im Gegensatz zum wohlkuratierten Regal des Obergeschosses, unzensiert sichtbar wurden. Auf eine beinahe unheimliche Art hatte mein Vater das Haus zur Stein gewordenen Manifestation seines Innenlebens gemacht. Oben lag der Raum für die bewussten, kontrollierten Anteile seiner Psyche und seines Intellekts. Unten der für die unterbewussten, ungezügelten, unsortierten. Dort fand sich zum einen die komplizierte und gepeinigte Kriegsfaszination des Luftwaffenhelfers und Marinekadetten, der als Sechzehnjähriger in den letzten Kriegsmonaten noch an der Ostsee gegen die Rote Armee kämpfen musste. Zum anderen war da der brave Sozialdemokrat, der sich nach dem Krieg dem mühsamen Unterfangen widmete, den Bruch in der Biographie nach 1945 zu bewältigen; der versuchte, durch eine manische Beschäftigung mit dem Dritten Reich irgendwie diese prägenden Jahre in sein Nachkriegs-Ich zu integrieren und mit seiner bundesrepublikanischen Realität zu versöhnen.
Und dann war da schließlich die provokative Zurschaustellung seiner sexuellen Fantasien und Sehnsüchte. Sie war schwer zu ertragen, diese Ecke, auch im Jahr 2009, schwerer noch als die Schmuddelhefte mit Nazipropaganda aus dem Hause Jahr. Mein Vater wollte uns, meiner Mutter und mir, offenbar diese Seite von sich zeigen, gerade weil er gewusst haben muss, dass wir das nicht sehen wollten. Das Regal war ein Akt des Exhibitionismus und des Sadismus zugleich und noch vierundzwanzig Jahre nach dem Tod meines Vaters, ließ es in mir überwältigende und verwirrende Gefühle aufsteigen.
2
Klaus
Sonntagnachmittag. Hochsommer. Es schüttet in der Reihenhaus-Siedlung im Süden von Frankfurt, ein satter Sommerregen, der in Sekunden die Haare schwer auf die Stirn klebt, wenn man vor die Tür tritt. Das Jahr – vielleicht 1973, dem, wie man sagt, besten Jahr aller Zeiten der deutschen Fußball-Nationalelf, mit dem Dream-Team Netzer, Müller, Beckenbauer. Und auch den Frankfurtern Grabowski und Hölzenbein.
Die Polster sind hastig von den Gartenmöbeln der Siedlung abgezogen und ins Trockene gerettet worden. Niemand ist draußen auf den Terrassen, auf denen sich sonst um diese Zeit die Kaffeekränzchen durch den Tag ziehen, während die Kinder auf sorgsam gepflegten Grünflächen unter Aufsicht herumtollen dürfen.
Nur mein Vater und ich sind da. Wir rennen nackt das kaum dreißig Meter lange Rasenhandtuch hinter dem Reihenhaus auf und ab, einem glitschig gewordenen Lederfußball hinterher. Rutschen über die Grasnarbe, lachen, jauchzen, berauscht von dem Gefühl, dass wir uns ein Vergnügen gönnen, das die braven Nachbarn, die sicherlich hinter Gardinen stehen und sich das Maul zerreißen, niemals erleben werden.
Solche kleinen Grenzüberschreitungen waren ganz nach dem Geschmack meines Vaters, Ausbrüche aus dem selbstgewählten Kleinbürgerleben der Reihenhaus-Siedlung. Eruptionen einer Lebendigkeit, die sich nicht von der strengen Geometrie der Wohnanlage einzwängen lässt.
Es waren solche Momente ungezähmter Körperlichkeit, in denen ich mich meinem Vater am nächsten fühlte. Wir waren Komplizen in der Grenzüberschreitung, verbunden durch eine geheime sinnliche Erlebniswelt, die andere nicht einmal erahnen konnten; die bravere Nachbarn in Aufruhr versetzte, weil sie ihnen das enge Korsett ihrer Rituale vor Augen führte. Und die deshalb umso mehr Lust bereitete.
Die Jahre meiner vorpubertären Jugend waren voll von solchen Erlebnissen. Momente der Vereinigung in roher Körperlichkeit. Groß und überwältigend mussten sie immer sein, voll Abenteuer und Freiheit für den Sohn, der sich dabei doch immer des starken Vaters sicher sein konnte.
Wenn ich etwa bei einer Wanderung jenseits der ausgezeichneten Pfade einen Baumstamm umklammerte und nicht mehr vor noch zurück konnte, weil der mit feuchtem Laub überzogene Waldboden zu rutschig und der Abhang zu steil war und der Vater mich einfach am Gürtel packte und den Berg hinauftrug.
Oder als ich noch gar nicht richtig schwimmen konnte und der Vater mich trotzdem in einem aufblasbaren, zum Floß umfunktionierten Kleinbecken in die Mitte eines Bergsees zog. Furchtlos sprang ich in den See und ließ mich vom Vater fangen und wieder auf das Floß setzen. Wieder und wieder und wieder.
Sie kehrten später nie zurück, diese Glücksmomente der Vater-Sohn-Verschmelzung. Mit der Pubertät erfüllte ich zunehmend meine Sehnsucht nach dem Ausloten körperlicher Grenzen im Sportverein, in der Kameradschaft Gleichaltriger. Und mein Vater fand ohne diese Erlebnisse wohl nur noch selten aus den Tiefen von Depression und Isolation heraus. Jedenfalls nicht im Kreis der Familie.
Ich fand nie mehr eine Verbindung zu meinem Vater, die letzten zwanzig Jahre seines Lebens waren geprägt von Sprachlosigkeit zwischen uns. Die Erinnerung an das Glück der jugendlichen Verschmelzung wurde verschüttet vom Schmerz eines gegenseitigen Ablösungsprozesses, der nie ein wirkliches Ende fand. So wurde es, solange er lebte, für mich ganz unvorstellbar, dass wir uns einmal so nahe gewesen waren.
Erst viel, viel später, in jenem Sommer, in dem ich das Würfelhaus auszumisten hatte, drang eine vage Erinnerung an jene Glücksgefühle erneut in mein Bewusstsein. Bilder des Vaters jener Tage kamen zurück, eines Mannes mit überbordender Kraft und Vitalität, aber gleichzeitig mit einer Fähigkeit zur Zärtlichkeit. Auslöser war ein kleines Fotoalbum aus mittlerweile brüchiger brauner Pappe, das mir beim Durchforsten des elterlichen Nachlasses in die Hände fiel.
Das querformatige Album enthielt Aufnahmen aus der Jugend meines Vaters, einer Zeit, von der ich aus Erzählungen nur eine bruchstückhafte Vorstellung hatte. So wusste ich, dass die Familie im Elsass gelebt hatte, nicht zuletzt, weil wir in meiner Kindheit einige Male dort Urlaub gemacht hatten, um die Stätten der Jugend meines Vaters aufzusuchen. Und ich wusste, dass es einen Jugendfreund namens Klaus gegeben hatte, der im Gefühlsleben meines Vaters eine bedeutende Rolle gespielt hatte. So bedeutend, dass Klaus mein Zweitname wurde. Ich wusste nur, dass er im Krieg gestorben war.
Dass ich nie eine größere Neugier entwickelt hatte, wer Klaus eigentlich war, hing sicherlich mit der Entfremdung zwischen meinem Vater und mir zusammen. Das Gefühlsleben meines Vaters war mir nicht nur egal, es war mehr als das. Es war bedrohlich und unheimlich, so sehr, dass ich es, so gut es ging, zu meiden suchte.
Nun sprang es mir jedoch aus jenem kleinen braunen Pappalbum unausweichlich entgegen. Auf einer Seite in der Mitte des Albums zog mich eine Aufnahme in ihren Bann.
Beschriftet war sie lediglich mit der Jahreszahl 1943, Details über den Ort und die abgebildeten Personen fehlten. Darauf zu sehen sind zwei junge Männer, beinahe Knaben noch, in HJ-Uniform. Der vordere, mein Vater, sitzt auf einer Parkbank, die Beine verschränkt und warm in die Linse des unbekannten Fotografen lachend.
Es war ein Lachen, das mir überaus vertraut vorkam. Da war mein Vater, so gelöst und froh, wie ich ihn nur von den Eskapaden in den Wäldern rund um unsere Wohnsiedlung kannte. Über eine Zeitspanne von sechsundsechzig Jahren hinweg lachte er mich da an, aus einer Ära, in der es mich noch nicht gegeben hatte, und doch war er mir so präsent wie in meinen Kindheitstagen.
Der Junge hinter ihm, dessen Uniform im Kontrast zu der braunen meines Vaters schwarz war, schaut hingegen ernst und verkniffen in die Kamera. Die Arme sind verschränkt, der Blick hat nichts von der Unbeschwertheit, die mein Vater auf dem Bild an den Tag legt. Es ist, als trage er die Schwere der Zeit auf den Schultern, als wisse er um die kurz bevorstehende Apokalypse und seinen eigenen, nahenden Tod und schaue alldem entschlossen und schicksalsergeben entgegen.
Das Bild warf Fragen auf, Fragen, die sich nicht wieder verdrängen ließen. Wie viel von dem Glück etwa, das mein Vater bei unseren Abenteuern empfand, stammte daher, dass sie ihn an jene Zeit erinnerten, an die Zeit, bevor das Dritte Reich in Flammen aufging und die großdeutsche Welt des ideologisch durchtrainierten Hitlerjungen des Jahrgangs 27 noch in Ordnung war? Welche Rolle spielte dabei Klaus, der etwas ältere Freund und Kamerad, der ihm so nahe war, dass er seinen Sohn nach ihm benannte? Und was hatte das alles mit mir zu tun? War ich in irgendeiner Form der Stellvertreter von Klaus? Sollte ich dieses Glück, wenn auch nur flüchtig, zurückbringen?
Mein Vater und Klaus müssen sich irgendwann in den Jahren 1940/1941 in der Hitlerjugend im Elsass kennengelernt haben. Die genauen Umstände, wie die Familie meines Vaters nach dem Einmarsch der Nazis im Juni 1940 ins Elsass gelangte, sind mir nicht überliefert. Anfragen bei elsässischen Archiven blieben unbeantwortet. Aber man kann es sich zusammenreimen.
Der Großvater Jakob Moll, Weltkriegsveteran aus Niederbayern und gelernter Holzkaufmann, hatte im Lauf der 20er und 30er Jahre mehrere Anstellungen als Betriebsleiter in Holz verarbeitenden Unternehmen im süddeutschen Raum inne, zuletzt im württembergischen Aulendorf. Mit der Annexion von Elsass-Lothringen, das, anders als der Rest von Frankreich, formal nicht bloß besetzt wurde, taten sich jedoch für Männer wie meinen Großvater Gelegenheiten auf.