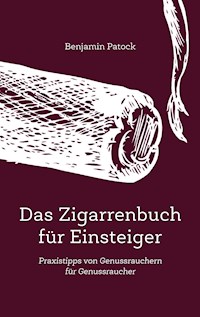
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Was vor mehr als zweitausend Jahren mit den Maya begann, erlebt heute mehr denn je eine Renaissance. Die Zigarre ist ein hochgefragtes und luxuriöses Genussmittel, das an Komplexität kaum zu überbieten ist: 292 Einzelschritte und jahrelange Arbeit stecken nicht selten in jedem einzelnen Produkt. Das Zigarrenbuch für Einsteiger bietet Ihnen Einblicke in die tägliche Praxis der Profis und beantwortet alle Fragen, die sich beim ersten Herantasten an die Materie stellen. Neben vielen praktischen Tipps zu Kauf, Lagerung und Genuss finden Sie hier nicht nur zahlreiche Informationen zu den verschiedenen Anbaugebieten, sondern auch einen Überblick über die wichtigsten Marken und Interviews mit bekannten Größen der Zigarrenbranche – José Orlando Padrón, Litto Gomez, Heinrich Villiger, Rocky Patel und Axel-Georg André. Lehnen Sie sich entspannt zurück, zünden Sie sich eine Zigarre an und genießen Sie.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 233
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
»Tabak ist die Pflanze, die Gedanken in Träume verwandelt.«
Victor Hugo
Inhalt
Vorwort
Einleitung
Die Geschichte der Zigarre
Kuba und der Tabak
Zigarrenboom in den USA
Zigarren in Deutschland
Anbaumethoden und Ernte
Aufbau der Zigarre
Das Rollen
Das Deckblatt
Deckblattarten
•
Von hell bis dunkel
•
Maduro, Maduro oder Maduro?
Zigarrentypen
Handgerollt oder maschinell?
•
Long- oder Shortfiller?
•
Formate
•
Von dünn bis dick
•
Rund oder eckig?
Vor dem Genuss der Zigarre
Tipps für den Kauf
Fachgeschäft oder Internet?
•
Vor dem Kauf
•
Mild oder kräftig?
•
Günstig oder teuer?
•
Vorsicht bei Selbstimporten und falschen Schnäppchen
•
Sonderfall kubanische Zigarren?
Aufbewahrung
Luftfeuchtigkeit
•
Hygrometer
•
Befeuchter
•
Temperatur
•
Schimmel oder Zigarrenblüte?
•
Mit oder ohne Zellophan?
•
Aromatisierte Zigarren
•
Humidor
•
Alternativen
Das Nachreifen /»Aging«
Accessoires
Zigarrenschneider
•
Feuer
•
Etuis
Anbaugebiete und Marken
Kuba
Bolivar
•
Cohiba
•
Cuaba
•
El Rey del Mundo
•
Fonseca
•
Guantanamera
•
H. Upmann
•
Hoyo de Monterrey
•
Juan Lopez
•
La Gloria Cubana
•
Montecristo
•
Partagás
•
Por Larrañaga
•
Punch
•
Ramón Allones
•
Rafael Gonzalez
•
Romeo y Julieta
•
Saint Luis Rey
•
Trinidad
•
Vegas Robaina
Interview mit Heinrich Villiger und Christoph A. Puszkar (5th Avenue)
Dominikanische Republik
Aging Room
•
Ambiente
•
Antonius
•
Arturo Fuente
•
Ashton
•
Avo
•
Bock y Ca
•
Balmoral Cigars
•
Blanco
•
Bossner
•
Bundle Selection
•
Casa de Garcia
•
Cuesta Rey
•
Dalay
•
Davidoff
•
Domenico
•
Dominican Estate
•
Don Diego
•
Don Sebastian
•
Dunhill Aged Cigars
•
El Credito
•
Flores y Rodriguez
•
Griffins
•
Gurkha
•
Hommage 1492
•
Inch by E. P. Carrillo
•
Imperiales
•
Juan Clemente
•
La Aurora
•
La Flor Dominicana
•
Laura Chavin
•
León Jimenes
•
Macanudo
•
Marca Fina Dominicana
•
Miguel Private Cigars
•
Mustique Red
•
Mustique Blue
•
Nat Sherman
•
Private Stock
•
Quisqueya
•
Santa Damiana
•
Vasco da Gama
•
Vega Fina
•
Villiger
•
Winston Churchill
•
Zino
Interview mit Litto Gomez (La Flor Dominicana)
Nicaragua
Alec Bradley (Nicaragua)
Brick House
•
Cain
•
CAO (Nicaragua)
•
Casa de Torres
•
Casa Magna
•
Castro Puros
•
Chinchalero
•
Cumpay
•
Don Pepin Garcia
•
Drew Estate
•
Dunhill Signed Range
•
Flor de las Antillas
•
Gilbert de Montsalvat
•
Jaime Garcia
•
Joya de Nicaragua
•
L‘Atelier
•
La Aroma del Caribe
•
La Ley
•
La Meridiana
•
La Reloba
•
My Father
•
Nicarao
•
Nub
•
Oliva
•
Padilla
•
Padrón
•
Paradiso
•
Perdomo
•
Plasencia
•
Rocky Patel (Nicaragua)
•
San Lotano
•
Surrogates
•
Tatuaje
•
Tres Reynas
•
Villiger (Nicaragua)
Interview mit José Orlando Padrón
Honduras
Alec Bradley
•
Camacho
•
CAO (Honduras)
•
Carlos Toraño
•
Flor de Copan
•
Flor de Selva
•
J. Fuego
•
La Libertad
•
Maria Mancini
•
Rocky Patel
•
Villa Zamorano
Interview mit Rocky Patel
Mexiko
Costa Rica
Panama
Italien
Brasilien
Spanien & Kanarische Inseln
Deutschland
Interview mit Axel-Georg André (Arnold André)
Rauchen – aber richtig!
Die richtige Gelegenheit
Der richtige Anschnitt
Das richtige Anzünden
Die richtige Umgebung
Das richtige Rauchen
Das richtige Schmecken
Die richtigen Getränke
Fazit
Tasting-Bögen
Über den Autor
»Die beste Zigarre der Welt ist die, die Ihnen schmeckt.«
Hendrik Kelner
Vorwort
Zigarrenbücher gibt es viele, ebenso wie unzählige Internetquellen von Experten und Liebhabern. Dennoch erhalten wir bei noblego.de täglich zahlreiche Anfragen, die wir gerne nach bestem Wissen beantworten. In der Regel geht es dabei nicht um die spezielle Sonderedition aus dem Jahr 1998, sondern vielmehr um klassisches Praxiswissen. Häufig werden wir dann nach Literatur gefragt, die eben dieses Basiswissen verständlich zusammenfasst. Doch gerade darauf hatten wir bis heute leider keine gute Antwort.
Noblego.de ist in der Zigarrenbranche noch ein Jüngling und zudem eher ein Exot. Wir produzieren keine Zigarren, sind keine Händler in der x-ten Generation, sondern lediglich Konsumenten, wie viele andere auch. Zu Beginn waren wir etwas unzufrieden mit den bestehenden Internet-Händlern, sodass wir uns entschieden, selbst Zigarren zu verkaufen.
Und genauso wie wir einen Online-Shop nach unseren eigenen Bedürfnissen geschaffen haben, schreiben wir nun das Buch, das wir uns zu lesen gewünscht hätten, als wir anfingen, uns näher mit der Materie zu beschäftigen. Ein Buch mit Geschichte, Hintergründen und sehr vielen praktischen Tipps, um sich langsam an das vielleicht schönste Genussmittel der Welt heranzutasten. Dieses Buch ist für unsere Kunden, die – wie wir alle einmal – noch am Anfang ihres Zigarrenlebens stehen.
Zigarren sind einzigartig – in ihrem Dasein als Handwerkskunst und als Kulturprodukt. Zigarrenraucher wissen dies zu schätzen. Sie sind selbstbewusst, tolerant und die ultimativen Genießer, wissen aber auch um die gesundheitlichen Risiken. Durch dieses Buch wollen wir unsere bisher gesammelten Erfahrungen als Genießer und Händler mit allen Interessierten teilen, ergänzt um Interviews mit den Fachleuten der Branche – aus Deutschland und der ganzen Welt.
Ihnen gilt der wahre Dank, denn niemand sonst beschäftigt sich so intensiv mit der Materie. Wir sind sehr stolz, dass sie sich die Zeit genommen haben, uns zu unterstützen. Ihre Arbeit ist – wie unser fortwährender Genuss – immer work in progress. Dass sie uns einen Einblick in diese Arbeit gewährten und ihr besonderes Wissen mit uns teilten, lässt sich gar nicht hoch genug würdigen: Heinrich Villiger, Axel-Georg André, José Orlando Padrón, Rocky Patel und Litto Gomez – vielen Dank für die wunderbaren Zigarren und eure Zeit für unser kleines Werk.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und freuen uns sehr über Feedback, Vorschläge und tolle Geschichten, die uns helfen, unsere Arbeit zukünftig weiter zu verbessern. Eine einfache E-Mail an [email protected] genügt. Oder vielleicht treffen wir uns einfach einmal auf eine Zigarre – persönlich oder virtuell auf www.facebook.com/zigarrenbuch.
Ihr Benjamin Patock& das Noblego -Team
»Zigarren sind so köstlich wie das Leben. Das Leben bewahrt man sich nicht auf. Man genießt es in vollen Zügen. «
Artur Rubinstein
Einleitung
Die Geschichte der Zigarre
Die Anfänge der Tabakkultur reichen bis zum Beginn unserer Zeitrechnung zurück: Bereits um das Jahr 0 wurde die Tabakpflanze kultiviert – vermutlich in klimatischen Gunsträumen Amerikas wie Mexiko und anderen südlich gelegenen Gebieten. Erste Abbildungen des Tabaks entstanden zwischen 300 und 900 n. Chr. durch die Maya, die wesentlich zur Verbreitung des Tabaks beitrugen. Hier soll auch das Wort »Zigarre« seinen Ursprung haben – die Maya bezeichneten das Rauchen als »si-kar«. Experten halten es jedoch ebenso für möglich, dass das spanische Wort »cigarra« (dt. Zikade) die Namensgebung aufgrund der langen, zylindrischen Form beeinflusste.
Christoph Kolumbus entdeckte im Jahre 1492 die Inseln der Karibik und damit Teile der »Neuen Welt«. Gleichzeitig liegen in diesem Ereignis auch die Ursprünge europäischer Kontakte mit der Zigarre. Tabakblätter sollen neben Früchten und Speeren zu den Begrüßungsgeschenken der Indianer gehört haben. So wurden die Entdecker schon bald auf die Gewohnheit der Ureinwohner aufmerksam, eine bestimmte Grassorte in Holzröhrchen zu rauchen. Auch Luis de Torres, einer der ersten Europäer auf Kuba, lernte den Genuss des Rauchens zu schätzen und führte den Tabak in seine Heimat Spanien ein. Seine Freude daran war jedoch nur von kurzer Dauer: Als er sich 1493 rauchend in der Madrider Öffentlichkeit zeigte, wurde er von der Inquisition der Hexerei bezichtigt und zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt.
Das Wort »Tabak« wurde erst 1507 durch Amerigo Vespucci geprägt, der auf seinen Reisen das Tabakkauen bei den Indianern beobachtete. Der Florentiner Seefahrer und Entdecker Giovanni da Verrazano sprach wenig später von den »fröhlichen Gedanken«, die der Genuss dieses Mittels, das er »petum« nannte, zur Folge hatte. Der Tabak erfreute sich zunehmender Beliebtheit und entwickelte sich schon bald zum gängigen Tauschmittel.
Nachdem die Tabakpflanze 1554 bereits in einigen belgischen Gärten angepflanzt worden war, widmete sich der Franziskaner-Mönch André Thevet erstmals deren Züchtung in Frankreich. Er war überzeugt von der bahnbrechenden Wirkung der Pflanze und beschrieb, dass sie Hunger und Durst schlagartig lindere, der rauschartige Zustand, den der Genuss hervorrufe, jedoch nicht zu unterschätzen sei. Er selbst sei bereits einem Ohnmachtsanfall erlegen, als er noch nicht an die Wirkung des Krautes gewohnt gewesen sei.
Die Anzahl der positiven Eigenschaften, die dem Tabak fortan zugeschrieben wurden, wuchs rasant, und schon in den 1560er-Jahren hatte er den Ruf eines Wundermittels erlangt. Zu dieser Entwicklung trug der Privatsekretär des spanischen Königs, Jean Nicot, wesentlich bei. Er erforschte insbesondere die medizinische Bedeutung des »petum« und sah in diesem ein unerlässliches Heilmittel gegen nahezu jedes körperliche Leiden – von Migräne über Schnittwunden bis hin zu asthmatischen Beschwerden. Der Tabakwirkstoff schien allem etwas entgegensetzen zu können. Nicot selbst wurde letztlich auch zum neuen Namensgeber des Krautes: Aus dem »petum« wurde das heute bekannte Nikotin.
Die Tabakmanie jener Zeit wurde jedoch bereits 1565 durch den Italiener Girolamo Benzoni gebremst, der heftige Bedenken bezüglich des neuen Modestoffes hegte. Seiner Meinung nach handle es sich dabei nicht nur um eine »stechende und stinkende« Substanz, sondern gar um ein Werk des Teufels, dessen berauschende Wirkung völlig lächerlich, wenn nicht sogar gefährlich sei. Allen Kritikern zum Trotz wurde der Tabak 1571 offiziell als Medikament eingeführt und verbreitete sich rasch über die Kontinente Europa und Asien.
Die Zigarre hingegen stieß lange Zeit – insbesondere in Deutschland – auf wenig Interesse. Zwar wurde sie angeboten, aber gekauft wurde sie nicht. Erst im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Zigarrenindustrie zu einem wesentlichen Zweig der europäischen Wirtschaft, wobei Holland, Deutschland, aber auch Frankreich die Spitzenreiter der Produktion waren. Um die steigende Nachfrage zu befriedigen, wurde der Tabak nun auch aus Sumatra und Brasilien importiert. So erreichte die Zigarrenproduktion im 20. Jahrhundert ihre Blütezeit.
Kuba und der Tabak
Kuba gehört zu den klangvollsten Namen in der Welt der Zigarren. Bereits im 17. Jahrhundert arbeiteten etwa drei Viertel der kubanischen Bevölkerung im landwirtschaftlichen Sektor – und ein Großteil davon auf den ältesten Tabakplantagen des Landes.
Während der spanischen Herrschaft, die das Land bis ins späte 18. Jahrhundert prägte, wurde der Anbau jedoch durch zahlreiche Gesetze eingeschränkt. So war es beispielsweise unter Todesstrafe verboten, kubanischen Tabak in andere Länder als Spanien zu exportieren. Gleichzeitig – etwa ab den 1620er-Jahren – wurden in Sevilla Fabriken zur Weiterverarbeitung des importierten Tabaks errichtet. Bis 1817 befand sich Kuba in der Rolle des Zulieferers, begann nun jedoch auch handgerollte Zigarren vor Ort herzustellen. Die Plantagen wurden bedeutend erweitert und ein enormes Wirtschaftswachstum war die Folge: 1827 wurden 500.000 Zigarren exportiert, 1836 waren es bereits unglaubliche fünf Millionen. Zusätzlich begünstigte die Entwicklung der Dampfmaschine den Handel, die eine viel schnellere Atlantiküberquerung ermöglichte und somit völlig neue Geschäftsbeziehungen sowie eine Expansion des gesamten Wirtschaftszweiges eröffnete.
Die heute noch wichtigen, international bekannten Zigarrenmarken Punch, Partagás und H. Upmann entstammen dieser Zeit. Die Entwicklung war so gewaltig, dass die »puro«, wie die kubanische Zigarre bis zu diesem Zeitpunkt genannt worden war, den Namen der Hauptstadt Havanna erhielt und zum Nationalsymbol Kubas erklärt wurde. Auch die »Zigarrenringe«, meist kunstvoll verzierte Papierbanderolen, entstammen dieser Zeit – Politiker, Künstler, Großindustrielle und andere berühmte Persönlichkeiten konnten sich darauf abbilden lassen. Ob die Banderolen das Vergilben der damals üblichen weißen Handschuhe verhindern oder das Produkt schlichtweg edler und hochwertiger erscheinen lassen sollten, ist heute unklar. Übrigens: Auch die Zigarrenkiste hat ihren Ursprung in den 40er-Jahren des 19. Jahrhunderts.
Der politische Alltag Kubas im 19. Jahrhundert wurde maßgeblich von politischen Spannungen bestimmt, die vor allem in Konflikten zwischen Plantagenbesitzern und Arbeitern bestanden. Die Betreiber großer Plantagen waren darauf bedacht, die Ansiedlung neuer Tabakbauern zu verhindern, sodass zahlreiche Arbeiter bevorzugt in den Süden Floridas emigrierten und damit die Entstehung von Zigarrenfabriken in den USA anregten.
In Kuba selbst löste sich die Problematik letztlich zugunsten der Tabakpflanzer. Der Wohlstand sollte sich nicht länger auf einige wenige Großunternehmer konzentrieren, sondern auch kleinere Betriebe sollten sich wirtschaftlich erfolgreich ansiedeln können. Zudem war die Qualität des Tabaks aus Kleinbetrieben oft besser, als die auf den Plantagen der Großgrundbesitzer – ein Nachteil der weniger sorgfältigen, stark profitorientierten Bewirtschaftung.
Der große Erfolg Kubas im Tabak- und Zigarrenexport sollte sich allerdings bald gegen das Land richten. Da die Havanna-Zigarren nach wie vor einen Qualitätsvorsprung hatten, bangten die europäischen Staaten sowie die USA um ihre eigene Tabakindustrie. Sie reagierten mit einer drastischen Erhöhung der Zölle auf Tabakwaren jeglicher Art. Die Insolvenz großer Manufakturen und die damit einhergehende Arbeitslosigkeit waren die Konsequenz, sodass Kuba in eine ernste Wirtschaftskrise geriet.
Eine Schlüsselrolle spielten die Tabakpflanzer Kubas auch im zehnjährigen Unabhängigkeitskrieg gegen Spanien zwischen 1868 und 1898. In der kubanischen Bevölkerung bildeten sich zwei Gruppen heraus: zum einen die Reformer, die eine friedliche, geordnete Vorgehensweise anstrebten; zum anderen die radikaleren Separatisten, welche die Unabhängigkeit im bewaffneten Kampf erreichen wollten. Gemeinsame Positionen waren die Forderungen nach Abschaffung der Sklaverei, freiem Handelsverkehr sowie Reformen im Boden- und Finanzrecht. Wirtschaftlich war das Land zu diesem Zeitpunkt stark geschwächt. Eine neue Steuer, mit der Spanien Kuba zu weiteren Abgaben zwang, wurde als zusätzliche Provokation gegenüber der Bevölkerung wahrgenommen.
Im Oktober 1868 setzte der Grundbesitzer Carlos Manuel de Céspedes – ebenfalls ein engagierter Verfechter der kubanischen Unabhängigkeit – ein eindeutiges Zeichen, indem er alle seine Sklaven befreite und zum bewaffneten Kampf aufrief. Damit markierte er den Beginn der Revolution. Bereits ein Jahr später wurde die Sklaverei abgeschafft, kurz darauf eine Verfassung verabschiedet und Céspedes wurde zum Präsidenten Kubas gewählt.
Spanien war nun zwar geschwächt, aber keinesfalls bereit, das Land kampflos aufzugeben. Der Krieg forderte in den folgenden Jahren zahlreiche Opfer und konnte erst 1878 mit einem Friedenspakt beendet werden. Obwohl die politische Ordnung somit vordergründig wiederhergestellt war, stellte sich auch in den folgenden Jahren kein freies Leben ein. Die Amerikaner investierten nun zunehmend in die Tabakindustrie des Landes und unterstützen dabei vor allem die großen Produzenten. Die USA hatten Spanien in der Rolle der wirtschaftlichen Vorherrschaft auf Kuba abgelöst.
Nachdem von 1879 bis 1880 ein »kleiner Krieg« für die Unabhängigkeit erfolglos blieb, entwickelte sich 1895 ein dritter Unabhängigkeitskrieg. Erneut kam es zu Verhandlungen, die in der Bildung einer Regierung mündeten. In dieser wurde die revolutionäre Unabhängigkeitsbewegung allerdings völlig außen vor gelassen, weshalb es kurze Zeit später zu einem Aufruhr in Havanna kam. Mit der Absicht, die eigenen Interessen im Land infolge des angekündigten Rückzugs der Spanier zu schützen, sandten die Amerikaner ein Kriegsschiff aus, das aus ungeklärten Gründen explodierte und damit den Anlass zu erneuten kriegerischen Auseinandersetzung lieferte. Seine Freiheit erlangte Kuba schließlich durch eine Verfassung, die im Zuge der gesetzgebenden Versammlung von 1901 verabschiedet wurde, die aber auch einen Passus enthielt, der den USA die Möglichkeit eines militärischen Eingreifens sicherte.
Nach dem Krieg begann die Qualität des Tabaks unter einer Saatmittelknappheit zu leiden. Teilweise mussten die Keimlinge sogar aus anderen südamerikanischen Staaten importiert werden, um die Produktion aufrechtzuerhalten. Dies führte allerdings zu einem regelrechten Durcheinander an Tabaksorten, dem letztlich mithilfe eines Importverbots für Saatmittel abgeholfen werden sollte.
Darüber hinaus hatte ein Generationswechsel innerhalb der traditionellen Produktionsstätten stattgefunden. Die »Zigarre als Liebhaberei« war allmählich in den Hintergrund gerückt und einem neuen profitorientierteren Denken gewichen. Nicht zuletzt der Einfluss des Ersten Weltkrieges führte zum Verschwinden zahlreicher großer Marken wie beispielsweise der Señora Cubana und La Imperiosa. Weitere Firmen waren wiederum von dem Großkonzern American Tobacco aufgekauft worden.
Zwar bewirkten die beiden Weltkriege auch einen wirtschaftlichen Aufschwung – kubanische Exportgüter (Zucker und Tabak) waren auf dem Weltmarkt gefragter denn je –, doch nach 1945 hatte Kuba vermehrt mit Problemen wie Korruption, finanziellen Krisen und der Mafia zu kämpfen. Nachdem sich der Konsum in den 1950er-Jahren erneut zugunsten Kubas eingependelt hatte, begann Ende des Jahrzehnts mit der Gründung der »Bewegung 26. Juni« unter Führung Fidel Castros schließlich die Kubanische Revolution. Die Aufständischen schlugen den herrschenden Diktator Fulgencio Batista in die Flucht.
Mit ihm wanderten auch einige bedeutende Zigarrenfabriken ab. Die gesamte verbliebene Zigarrenproduktion wurde der staatlichen Einheitsbehörde »Cubatabaco« untergeordnet, wodurch Banderolen, Etiketten, Schachteln und alles andere, was an die alten Marken hätte erinnern können, vom Markt verschwand. Die Zigarrenvielfalt des Landes schrumpfte von 960 auf lediglich vier Sorten.
Die Verstaatlichung der Plantagen führte zur Enteignung amerikanischen Besitzes auf Kuba. Als daraufhin der Export nahezu vollständig zusammenbrach, wurde der vom Staat übernommene Besitz einheimischer Tabakbauern an diese zurückgegeben, und auch die charakteristischen Markennamen und Bauchbinden wurden wieder eingeführt. Die Qualität der Produkte hatte dennoch unter der Abwanderung zahlreicher Fachkräfte gelitten. Die ausgesprochen gute und ergiebige Ernte von 1964 entspannte diese Situation wieder.
Fidel Castro selbst war zum bekennenden Zigarrenliebhaber geworden und durch einen Zufall der Geschichte maßgeblich an der Entstehung der Cohiba beteiligt. So wird erzählt, dass Castro von seinem Leibwächter eine sehr aromatische Zigarre bekam, die dessen Freund Eduardo Ribera zum Eigengebrauch hergestellt hatte. Castro war so begeistert von dieser Zigarre, dass er Ribera aufsuchte und sich seine Zigarren fortan von ihm produzieren ließ. Von da an sollte die Cohiba für zwei Jahrzehnte ausschließlich Diplomaten und Castros politischen Freunden vorbehalten sein und ist heute auf der ganzen Welt bekannt.
Nachdem Castro das Eigentum aller US-Unternehmen auf Kuba verstaatlicht hatte und sich wirtschaftlich an die damalige Sowjetunion anzunähern begann, verhängte die USA ein Wirtschaftsembargo über Kuba, das bis heute anhält. Aufgrund dessen verlagerten zahlreiche Tabakproduzenten ihren Sitz ins Ausland, insbesondere nach Honduras, Nicaragua, Costa Rica und die Dominikanische Republik. Da die Markennamen beibehalten wurden, existieren auch heute noch einige Premium-Zigarren in »doppelter Ausführung« – erst die Angabe von Herstellungs- und Blattherkunftsland bringt Klarheit; eine Ähnlichkeit in Geschmack, Aussehen oder Preis ist trotz gleichen Namens nicht zwangsläufig zu erwarten.
Zigarrenboom in den USA (1993–1997)
Einen bemerkenswerten Imagewechsel erlebte die Welt der Zigarre Ende des 20. Jahrhunderts. Als Auslöser wird auch die Gründung der Zigarrenzeitschrift Cigar Aficionado durch die Verleger eines bekannten Weinmagazins betrachtet, die den Tabakkonsum wieder zu einer angesagten Mode erhob. Vor dem Erscheinen des heute noch sehr einflussreichen Magazins war das Zigarrenrauchen noch nicht das große »Genussthema« und Statussymbol, das es heute ist. In kürzester Zeit stieg das Interesse an Zigarren enorm: Hollywoodstars, berühmte Sportler etc. zeigten sich auf den Titelseiten. Das Angebot und auch die Preise stiegen entsprechend stark. Auch der wirtschaftliche Aufschwung nach dem Ende des Kalten Krieges trug dazu bei, dass der Umsatz an Tabakprodukten in Europa und den USA in dieser Zeit von 120 auf 500 Millionen anstieg.
Der plötzliche Hype um die Zigarre hatte jedoch mancherorts auch einen Qualitätsverlust zur Folge. Die riesige Nachfrage verleitete die Hersteller zur Billigproduktion. Immer häufiger wurde minderwertiger Tabak untergemischt, um die bloße Menge des Angebots zu steigern. Erst als um 1998 der Boom abebbte, pendelte sich das Verhältnis zwischen Qualität und Quantität am weltweiten Markt wieder ein.
Berühmt ist Cigar Aficionado heute vor allem durch seine Punkteskala, anhand derer Zigarren von 0 bis 100 bewertet werden können. Ein naturgemäß sehr umstrittenes Feld, aber das Magazin hat sich damit als feste Größe etabliert und mit seinen Bewertungen sowie den Top25-Jahres-Ranglisten schon manchem kleinen Produzenten zu Weltruhm verholfen.
Liste der Cigars of the Year seit 2004:
2014 – Oliva Serie V Melanio Figurado (Nicaragua)
2013 – Montecristo No.2 (Kuba)
2012 – Flor de Las Antillas Toro (Nicaragua)
2011 – Alec Bradley Prensado Churchill (Honduras)
2010 – Cohiba Behike BHK 52 (Kuba)
2009 – Padrón Family Reserve No.45 Maduro (Nicaragua)
2008 – Casa Magna Colorado Robusto (Nicaragua)
2007 – Padrón Serie 1926 No. 9 (Nicaragua)
2006 – Bolivar Royal Corona (Kuba)
2005 – Fuente Fuente OpusX Double Corona (Dominikanische Republik)
2004 – Padrón Serie 1926 40th Anniversary (Nicaragua)
Zigarren in Deutschland
In Deutschland setzte sich die Zigarre erst im 19. Jahrhundert durch, dann jedoch schnell und effektiv. Die Produktion konzentrierte sich auf die Länder Baden und Preußen, wobei eine gewisse Parallele zur gegenwärtigen Produktion deutlich wird. Übrigens gehörten die Zigarrenarbeiter in Deutschland zu den ersten, die sich in Gewerkschaften versammelten – ihnen müssen wir heute für unsere vergleichsweise entspannten Arbeitszeiten dankbar sein. Im frühen 20. Jahrhundert erreichte die Zigarrenproduktion ihre Blüte und sank ab diesem Zeitpunkt langsam, aber stetig.
In der BRD existierten nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges kaum noch Fabriken oder Produktionsorte. Diese mussten erst wieder aufgebaut werden. In der DDR war die Zigarrenproduktion eine gute Möglichkeit, Devisen ins Land zu holen, sodass besonders im heutigen Thüringen einiges an mechanischer Zigarrenarbeit erreicht wurde. Die Wende 1989/90 traf viele Ostbetriebe jedoch hart – im schlimmsten Fall folgte die Insolvenz, im besten die Fusion mit einem Konkurrenten. Erst im Laufe der 1990er-Jahre stabilisierte sich die Lage. Vom folgenden »Zigarrenboom« profitierten aber besonders die importierenden Unternehmen, da die Wachstumsraten sich vorrangig auf kubanische und andere karibische Produkte bezogen.
Dennoch machen die Zahlen des Deutschen Zigarrenverbandes Mut: Zwar gehen diese insgesamt ein wenig zurück, trotzdem wurden im Jahr 2010 in Deutschland 680 Millionen Zigarren und Zigarillos produziert. Aufgrund der immer noch starken Mechanisierung der Produktion arbeiten mehr als 1.000 Menschen in der Branche – ein nicht zu unterschätzender Wirtschaftsfaktor, insbesondere für die strukturschwachen Regionen, in denen die »Zigarrenindustrie« ansässig ist.
»Menschen sind wie Zigarren: Beide werden am Anfang gewickelt, lassen sich später entflammen und enden als Asche.«
Mark Twain
Anbaumethoden und Ernte
Das Pflanzen und Ernten der Tabakblätter beschreibt einen langwierigen, zwischen 18 Monaten und 3 Jahren andauernden sowie 292 Einzelschritte umfassenden Prozess, der in sorgfältiger Handarbeit vollzogen wird.
Das Saatgut wird zunächst im September im Treibhaus gezogen, wo die jungen Pflanzen bis zu einem Alter von ungefähr 40 Tagen verbleiben. Wenn sie eine Größe von ca. 15 Zentimetern erreicht haben, werden sie auf die Felder verpflanzt. Dabei wird peinlich genau darauf geachtet, dass die Pflanzen in idealem Abstand voneinander und in richtiger Tiefe gesetzt werden. Auch die perfekte Bewässerung, Düngung und Unkrautbekämpfung spielen eine wichtige Rolle. Zudem muss stets darauf geachtet werden, die Tabakpflanzen vor Schimmel und Insektenbefall zu schützen, da Plagen dieser Art die Ernte eines ganzen Jahres unbrauchbar machen könnten. Bewässerungsgräben, durch die überschüssiges Regenwasser abfließen kann, entstehen, indem 18 bis 20 Tage nach der Aussaat ein kleiner Erdhaufen um jeden Setzling errichtet wird, wodurch zusätzlich das Wurzelwachstum gefördert wird. Auch die Maßnahme des sogenannten »Köpfens« dient einer Beschleunigung und Optimierung des Wachstumsvorgangs: Hierzu werden die sprießenden Blütenknospen von der Pflanze abgetrennt. Da sie für die spätere Funktion des Tabaks nicht von Bedeutung sind, sollen sie nicht überflüssigerweise von der Energie der Pflanze zehren. Auch unter Umständen entstehende Seitentriebe werden aus diesem Grunde entfernt.
Die Ernte erfolgt mehrphasig im Zeitraum von Januar bis März. Dabei wird zumeist jedes Blatt einzeln gepflückt und bereits vorsortiert. Hier wird ebenso zwischen den schwach aromatischen Unterblättern, den beinahe schon zu starken Oberblättern und den normalerweise geschmacklich idealen Blättern aus der Mitte der Pflanze sortiert. Die unterschiedliche Ausprägung der Würze, je nach Lage des Blattes, hängt mit der Intensität der Sonneneinstrahlung zusammen. Der »Schattentabak« entwickelt wesentlich größere, meist hellere Blätter und benötigt dementsprechend mehr Wasser. Üblicherweise beginnt man mit der Ernte der zwei bis drei bodennächsten Blätter (libre de pie bzw. volado) und fährt erst einige Tage später die zwei folgenden Blätter (uno y medio) ein. Sie haben einen ähnlich süßen Geschmack wie die vorhergegangenen, enthalten aber bereits deutlich mehr Nikotin. Das »helle Zentrum« (centro ligero bzw. seco) wird erst sechs bis zehn Tage danach gepflückt. Die Blätter sind meist recht kräftig und eignen sich sowohl als Umblatt als auch als Teil der Einlage.
Tabaksetzlinge in der Dominikanischen Republik
(® sooksun – fotolia.com)
Die wohl hochwertigsten Tabakblätter werden allerdings erst 68 bis 72 Tage nach der Aussaat geerntet. Sie haben eine eher dunkle Farbe und zeichnen sich durch ihr besonders vielfältiges, intensives, aber nicht zu kräftiges Aroma aus und tragen gleichermaßen zum Deckblatt wie zum Herzstück einer Zigarre bei. Die Ernte dieser Phase wird als das »dünne Zentrum« (centro fino bzw. viso) bezeichnet und liefert in der Regel zwei bis vier qualitativ besonders hochwertige Blätter. Etwas grober sind hingegen die darauffolgenden Ernten des »dicken Zentrums« (centro gordo bzw. ligero). Wie der Name bereits vermuten lässt, sind sie vergleichsweise dick und kräftig und beinhalten darüber hinaus viele Öle und Harze. Ihr Geschmack ist deshalb herber als der anderer Blätter. Die Blüte der Pflanze wird übrigens in der Regel nach 45 bis 50 Tagen »getoppt«, also abgeschnitten. So kann sich die Energie der Pflanze mehr in den Blättern konzentrieren, was bis zu zwei Prozent mehr Erntegewicht einbringen kann.
In den USA werden diese verschiedenen Stufen »Priming« (engl. Grundierungen) genannt. In der Regel gibt es je nach Tabakart zwischen fünf und acht Primings, von unten nach oben:
» Criollo-Priming (5): Volado, Seco, Viso, Ligero, Corona
» Corojo-Priming (8): Libra de Pie, Uno y Medio, Centro Ligero, CentroFino, Centro Gordo, Semi Corona, Corona
In Deutschland sind hingegen die Begriffe Grumpen, Sandblatt, Hauptgut und Obergut geläufig.
Das 1st und 2nd Priming, also die untersten Blätter der Pflanze (Volado oder Sandblatt), werden zuerst abgenommen, der Rest verbleibt an der Pflanze und reift weiter. Was die anschließende Reifezeit angeht, übertrifft die Krone (Corona), welche die oberen beiden Blätter der Tabakpflanze umfasst, alle anderen, ihr vorausgegangenen Teile. Aufgrund der hohen Sonneneinstrahlung entwickelt sie ein ausgesprochen starkes Aroma. Die Blätter bleiben jedoch relativ klein, sodass sie meist nicht als Deckblätter geeignet sind.
Tabakpflanze mit Primings
Direkt nach der Ernte wird der Tabak im sogenannten Trockenschuppen, paarweise entlang der Mittelrippe zusammengenäht, an Stielen aufgehängt und gut belüftet für 50 Tage gelagert. In den ersten vier bis fünf Tagen dieser Phase erfolgt die Farbänderung von grün zu braun. Sie ist auf die chemische Umwandelung von Chlorophyll in Carotin zurückzuführen. Mittlerweile existiert neben der traditionellen Trocknungsmethode im Schuppen die Heizkanaltrocknung. Sie ermöglicht es, den Vorgang besser zu regulieren, und verkürzt die benötigte Zeit etwa um die Hälfte.
Im Anschluss an die Phase der Trocknung findet eine erneute Auslese statt. Diesmal wird nach den geplanten Funktionen der Blätter in der späteren Zigarre sortiert. Die größten und wohlgeformtesten werden als ummantelnde Deckblätter vorgesehen, die restlichen noch einmal in die Umblätter, welche die sogenannte Lederhaut bilden, sowie die Einlageblätter, die zum Kern der Zigarre werden, unterteilt. Anschließend werden alle Tabakblätter befeuchtet, damit sie elastischer werden und den folgenden Formungsprozess unbeschadet überstehen, und in Palmblätter gewickelt nochmals zwischengelagert. Um ein gleichmäßiges Reifen zu gewährleisten, werden sie während des nun stattfindenden Gärungsprozesses (Fermentation) mehrfach gewendet.
Der nächste wesentliche Arbeitsschritt ist das sogenannte Entrippen. Hierbei wird das Blatt in zwei Hälften geteilt, um die mittig sitzende kräftige Hauptader zu entfernen.
Nach nochmaliger Fermentation, während der Zucker- und Stärkereste abgebaut werden sowie eine Vertiefung von Farbe und Aroma stattfindet, erfolgt die eigentliche Charakterisierung der Zigarrensorte. Indem mehrere sich in ihrer aromatischen Intensität und ihrem Nikotingehalt unterscheidende Tabaktypen in einem bestimmten Verhältnis gemischt werden, entsteht jene Würze, die eine Zigarrensorte einmalig machen sollte. Die Qualitätsauswahl erfolgt extrem genau. Nach erneuter Befeuchtung und Belüftung werden die Blätter gebündelt und in großen Körben zwischen einem Jahr und fünf Jahren ruhen gelassen. In diesem Zeitraum sollen sie weiter reifen und ihr Aroma in aller Fülle entfalten. Ausgenommen von dieser Maßnahme sind die Deckblätter. Da sie meist dem untersten Teil der Tabakpflanze entstammen, haben sie aufgrund der schattigen Lage ohnehin einen milden Geschmack.
Zum Ende der letzten Reifungsphase werden die entrippten Um- und Einlage-Blätter mithilfe zweier Holzbretter über einen Zeitraum von ca. 90 Tagen gepresst, anschließend ballenförmig gewickelt und bis zur Weiterverarbeitung an einem ruhigen Ort gelagert.
Zum Reifetest werden unfertige Tabakblätter gerollt und angeraucht
»Die Götter haben die Zigarre erfunden, um sich den Genuss des Tabakgeschmacks zu schenken.«
Maya-Sprichwort
Aufbau der Zigarre
Jede Zigarre setzt sich aus einem Deckblatt, dem Umblatt und der Einlage zusammen. Als Deckblatt (capa) wird ein großes, gleichmäßig geformtes Blatt gewählt, das den Geschmack der Zigarre nicht dominiert, ihn aber durchaus bereichern soll. Damit es nach dem Rollen befestigt ist, wird ein kappenähnlicher Verschluss auf den Zigarrenkopf gesetzt, der aus dem übrigen, abgeschnittenen Teil des Deckblattes besteht. Das Umblatt (capote)





























