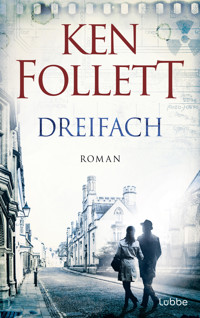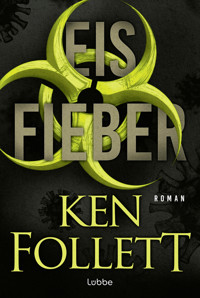9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein Mann erwacht in einem dunklen, kalten Raum. Er öffnet die Augen und stellt fest, dass er auf dem Fußboden einer öffentlichen Toilette liegt. Und dass er sich an nichts mehr erinnern kann.
Ohne einen Cent in der Tasche macht Luke, der Mann ohne Gedächtnis, sich daran herauszufinden, was mit ihm geschehen ist. Bald wächst in ihm der schreckliche Verdacht, dass der Verlust seiner Erinnerung nicht auf natürlichen Ursachen beruht.
Hat er etwas gewusst, das so brisant war, dass man ihm die Vergangenheit raubte, um ihn zum Schweigen zu bringen? Und warum ist man hinter ihm her?
Der Countdown läuft ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 550
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Inhalt
CoverÜber dieses BuchÜber den AutorTitelImpressum20 Jahre »Das zweite Gedächtnis«AnmerkungenErster Teil05.00 Uhr06.00 Uhr194106.30 Uhr07.00 Uhr07.30 Uhr08.00 Uhr194108.30 UhrZweiter Teil09.00 Uhr10.00 Uhr11.00 Uhr12.00 Uhr194113.00 Uhr13.30 Uhr14.00 Uhr14.30 Uhr15.00 Uhr15.30 Uhr15.45 UhrDritter Teil16.15 Uhr16.45 Uhr17.00 Uhr18.00 Uhr194318.30 Uhr19.30 Uhr20.00 Uhr20.30 Uhr21.30 Uhr22.30 Uhr23.00 Uhr24.00 UhrVierter Teil1.00 Uhr194502.30 Uhr03.00 Uhr04.30 Uhr06.30 Uhr195407.00 Uhr08.00 UhrFünfter Teil10.45 Uhr11.00 Uhr12.00 Uhr13.00 Uhr15.00 Uhr15.45 Uhr16.00 Uhr16.30 Uhr19.30 Uhr21.30 Uhr22.29 Uhr23.00 Uhr24.00 Uhr01.30 UhrSechster Teil08.30 Uhr16.00 Uhr20.30 Uhr21.30 Uhr22.48 UhrEpilog1969DanksagungÜber dieses Buch
Ein Mann erwacht in einem dunklen, kalten Raum. Er öffnet die Augen und stellt fest, dass er auf dem Fußboden einer öffentlichen Toilette liegt. Und dass er sich an nichts mehr erinnern kann. Ohne einen Cent in der Tasche macht Luke, der Mann ohne Gedächtnis, sich daran herauszufinden, was mit ihm geschehen ist. Bald wächst in ihm der schreckliche Verdacht, dass der Verlust seiner Erinnerung nicht auf natürlichen Ursachen beruht. Hat er etwas gewusst, das so brisant war, dass man ihm die Vergangenheit raubte, um ihn zum Schweigen zu bringen?
Über den Autor
Ken Follett, Autor von über zwanzig Bestsellern, wird oft als »geborener« Erzähler gefeiert. Betrachtet man jedoch seine Lebensgeschichte, so erscheint es zutreffender zu sagen, er wurde dazu »geformt«. Ken Follett wurde am 5. Juni 1949 im walisischen Cardiff als erstes von drei Kindern des Ehepaares Martin und Veenie Follett geboren. Nicht genug, dass Spielsachen im Großbritannien der Nachkriegsjahre echte Mangelware waren – die zutiefst religiösen Folletts erlaubten ihren Kindern zudem weder Fernsehen noch Kinobesuche und verboten ihnen sogar, Radio zu hören. Dem jungen Ken blieben zur Unterhaltung nur die unzähligen Geschichten, die ihm seine Mutter erzählte – und die Abenteuer, die er sich in seiner eigenen Vorstellungswelt schuf. Schon früh lernte er lesen; er war ganz versessen auf Bücher, und nirgendwo ging er so gern hin wie in die öffentliche Bibliothek. »Ich hatte kaum eigene Bücher und war immer dankbar für die öffentliche Bücherei. Ohne frei zugängliche Bücher wäre ich nie zum eifrigen Leser geworden, und wer kein Leser ist, wird auch kein Schriftsteller.« Als Ken Follett zehn Jahre alt war, zog die Familie nach London. Nach seinem Schulabschluss studierte er Philosophie am University College; dass der Sohn eines Steuerinspektors sich für dieses Fach entschied, mag auf den ersten Blick befremden, aber bedenkt man, dass Kens religiöse Erziehung viele Fragen aufgeworfen und offengelassen hatte, erscheint sie gar nicht mehr so untypisch. Ken Follett ist der Überzeu-gung, dass die Entscheidung für dieses Studienfach ihm die Weichen in seine Zukunft als Schriftsteller gestellt hat. »Zwischen der Philosophie und der Belletristik besteht ein Zusammenhang. In der Philosophie beschäftigt man sich mit Fragen wie zum Beispiel: ›Wir sitzen hier an einem Tisch, aber existiert der Tisch überhaupt?‹ Eine verrückte Frage, aber beim Studium der Philosophie muss man solche Dinge ernst nehmen und braucht eine unorthodoxe Vorstellungsgabe. Beim Schreiben von Romanen ist es genauso.« In einem Hörsaal danach zu fragen, was wirklich ist, war eine Sache – doch plötzlich sah sich Ken mit einer ganz anderen Wirklichkeit konfrontiert: Er wurde Ehemann und Vater. Er heiratete seine Freundin Mary am Ende seines ersten Semesters an der Universität. Im Juli 1968 kam ihr Sohn Emanuele zur Welt. »So etwas plant man nicht, wenn man erst achtzehn ist, aber als es geschah, war es ein unglaubliches Erlebnis.«
KEN FOLLETT
DASZWEITE GEDÄCHTNIS
ROMAN
Aus dem Englischen vonTill R. Lohmeyer und Christel Rost
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2000 by Ken Follett
Titel der englischen Originalausgabe: »Code to Zero«
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2001/2015/2025 by Bastei Lübbe AG, Schanzenstraße 6 – 20, 51063 Köln, Deutschland
Vervielfältigungen dieses Werkes für das Text- und Data-Mining bleiben vorbehalten.
Die Verwendung des Werkes oder von Teilen davon zum Training künstlicher Intelligenz-Technologien oder -Systeme ist untersagt.
Covergestaltung: Johannes Wiebel | punchdesign, München unter Verwendung von Motiven von © Good Studio – stock.adobe.com; peterschreiber.media – stock.adobe.com; paladin1212 – stock.adobe.com
eBook-Produktion: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-8387-0342-8
luebbe.de
lesejury.de
20 Jahre »Das zweite Gedächtnis«
Als ich Das zweite Gedächtnis verfasste, wusste ich nicht, dass Robert Ludlum zwanzig Jahre zuvor einen Roman über einen Mann geschrieben hatte, der sein Gedächtnis verliert. Ich hatte Die Bourne-Identität nicht gelesen (das ist noch immer so), und die Bourne-Filme gab es noch nicht. Ich schrieb in seliger Unkenntnis des Umstands, dass Matt Damon in einer höchst erfolgreichen Hollywood-Serie einmal diesen Jason Bourne spielen würde.
Über Menschen, die ihr Gedächtnis verlieren, wurden etliche großartige Geschichten geschrieben. Man hat damit einen wunderbar dramatischen Anfang: Wo bin ich? Was ist mit mir passiert? Wem gehört das Gesicht im Spiegel? Und dann schafft die allmähliche Entdeckung der eigenen Vergangenheit – Familie, Geliebte, Fähigkeiten, Erlebnisse – eine Erzählung, die den Leser bis zur letzten Seite fesselt.
Das früheste Beispiel, das mir einfällt, ist Die Rückkehr von Rebecca West, veröffentlicht 1918. Der Held kommt aus den Schützengräben des Ersten Weltkriegs nach Hause, nachdem er einen Granatschock erlitten hat. An die letzten fünfzehn Jahre seines Lebens erinnert er sich nicht. Seine Ehefrau ist für ihn eine vollkommen Fremde, aber er ist hoffnungslos in eine Frau verliebt, mit der ihn in seiner Jugend eine Romanze verband.
Meine Geschichte spielt zum größten Teil in den Fünfzigerjahren, in der Frühzeit der Erforschung des Weltalls. Während meiner Recherchen lernte ich mit großem Vergnügen Huntsville, Alabama, kennen, wohin Wernher von Braun und andere deutsche Raketenwissenschaftler nach dem Zweiten Weltkrieg verlegt wurden, um das Raumfahrtprogramm der USA in Gang zu bringen.
Die Geschichte umfasst auch Rückblicke in die Vierzigerjahre, und bei meinen Recherchen hat es mir die größte Freude bereitet, einige der lebhaften, intelligenten Frauen zu interviewen, die zu einer Zeit die Harvard University besuchten, als so etwas als höchst undamenhaft betrachtet wurde.
Ich habe die Filmrechte nie verkauft, aber das ist egal. Ich habe Das zweite Gedächtnis sehr gern geschrieben, und Millionen von Lesern hat es in vielen Sprachen gefallen. Wenn Sie das Buch 2000 verpasst haben sollten, ist jetzt Ihre Gelegenheit.
Ken Follett, 2020
Historische Anmerkung
Der Start des ersten amerikanischen Weltraumsatelliten, Explorer I, war ursprünglich für Mittwoch, den 29. Januar 1958, vorgesehen. Am späten Abend wurde er auf den nächsten Tag verschoben, angeblich wegen ungünstiger Witterungsbedingungen. Beobachter in Cape Canaveral begriffen das nicht, denn in Florida herrschte strahlender Sonnenschein. Die Armee dagegen verwies auf den Jetstream, eine starke Luftströmung in großen Höhen, der ungünstig gewesen sei.
Am nächsten Abend kam es erneut zu einer Verschiebung – aus den gleichen Gründen, wie es hieß.
Am Freitag, dem 31. Januar, wurde es ernst.
Seit ihren Anfängen im Jahr 1947 hat die Central Intelligence Agency Millionen von Dollar in ein Forschungsprogramm investiert, dessen Ziel es war, ganz normale Menschen, ob nun freiwillig oder unfreiwillig, mithilfe von Drogen und anderen esoterischen Methoden völlig unter ihre Kontrolle zu bekommen. Auf Befehl sollten sie handeln, sprechen, die wertvollsten Geheimnisse ausplaudern – und sogar vergessen.
John Marks, The Search for the ›Manchurian Candidate‹: The CIA and Mind Control, 1979.
Erster Teil
05.00 Uhr
Die Jupiter-C-Rakete steht auf der Abschussrampe im Komplex 26, Cape Canaveral. Aus Geheimhaltungsgründen ist sie mit riesigen Planen verhängt, die lediglich den unteren Teil der ersten Stufe freilassen. Es ist der gleiche wie bei den bekannten Redstone-Interkontinentalraketen, doch was sich sonst unter der Hülle verbirgt, ist ganz und gar einzigartig …
Als er aufwachte, fürchtete er sich.
Schlimmer noch: Er hatte eine Höllenangst. Sein Herz schlug ihm bis zum Hals, sein Atem ging stoßweise, sein Körper war gespannt wie eine Bogensehne. Es war wie nach einem Albtraum – nur dass das Aufwachen keine Erlösung mit sich brachte. Er hatte das Gefühl, dass etwas Furchtbares geschehen sein musste, wusste aber nicht, was es war.
Er öffnete die Augen. Das Licht aus einem anderen, dürftig beleuchteten Raum erhellte seine Umgebung schwach. Er nahm undeutliche Schemen wahr; sie wirkten vertraut, aber zugleich beunruhigend. Irgendwo in der Nähe lief Wasser in einen Behälter.
Er versuchte, sich zu beruhigen, schluckte, atmete regelmäßig, bemühte sich, klare Gedanken zu fassen. Er lag auf einem beinharten Untergrund. Er fror, und alles tat ihm weh. Er hatte eine Art Kater: Kopfschmerzen, Übelkeit, sein Mund war trocken.
Er setzte sich auf und schlotterte vor Angst. Es roch unangenehm nach feuchten Fliesen, die mit einem starken Desinfektionsmittel gereinigt worden waren. Er erkannte die Konturen einer Reihe von Waschbecken.
Er befand sich in einer öffentlichen Bedürfnisanstalt.
Ekel überkam ihn. Er hatte auf dem Fußboden in einer Männertoilette geschlafen! Was, zum Teufel, war mit ihm geschehen? Er konzentrierte sich. Er war vollständig bekleidet mit einer Art Mantel und schweren Stiefeln, hatte jedoch das Gefühl, dass es sich dabei nicht um seine eigenen Sachen handelte. Allmählich legte sich die Panik, doch an ihre Stelle trat eine tiefere Furcht – eine, die nicht so sehr auf Hysterie, sondern mehr auf Vernunft gründete. Was immer ihm zugestoßen sein mochte: Es war sehr schlimm.
Er brauchte Licht.
Er rappelte sich auf, stand, sah sich um, spähte in die Düsternis und fragte sich, wo der Ausgang sein mochte. Zum Schutz vor unsichtbaren Hindernissen streckte er die Arme aus, bis er an eine Wand stieß, von dort aus tastete er sich wie eine Krabbe im Seitwärtsgang weiter. Eine kalte, glasige Oberfläche deutete er als Spiegel. Dann waren da eine Handtuchrolle und ein Metallkasten, bei dem es sich wahrscheinlich um einen Automaten handelte. Schließlich fanden seine Fingerspitzen einen Schalter. Er knipste ihn an.
Helles Licht ergoss sich über weiß gekachelte Wände, einen Betonfußboden und mehrere Toilettenkammern, deren Türen offen standen. In einer Ecke lag etwas, das aussah wie ein Bündel alter Kleider. Er dachte angestrengt nach. Was war gestern Abend passiert? Er hatte keinerlei Erinnerung daran.
Die hysterische Furcht kehrte zurück, als ihm klar wurde, dass er sich an absolut gar nichts erinnern konnte.
Er biss die Zähne zusammen, um nicht laut herauszubrüllen. Gestern … vorgestern … nichts. Wie war sein Name? Er wusste es nicht.
Er ging auf eine Reihe Waschbecken zu, über der ein großer Spiegel angebracht war. Ein schmutziger, in Lumpen gehüllter Landstreicher mit stumpfem Haar, verdrecktem Gesicht, irrem Blick und hervortretenden Augen sah ihn an. Eine Sekunde lang starrte er die Gestalt an – dann überkam ihn eine furchtbare Erkenntnis. Erschrocken schrie er auf und fuhr zurück. Der Mann im Spiegel tat das Gleiche. Der Landstreicher war er selbst.
Jetzt hatte er der Panik nichts mehr entgegenzusetzen; sie überrollte ihn wie eine Woge. Er öffnete den Mund und rief mit vor Entsetzen zitternder Stimme: »Wer bin ich?«
Das Kleiderbündel bewegte sich, drehte sich um. Ein Gesicht erschien, eine Stimme brummte: »Du bist ein Penner, Luke, reg dich ab.«
Ich heiße Luke.
Es erschütterte ihn, wie ungeheuer dankbar er für diese Auskunft war. Ein Name bedeutete nicht viel, aber er war immerhin etwas, woran man sich festhalten konnte. Er starrte seinen Gefährten an. Der Mann trug einen zerrissenen Tweedmantel, der um die Taille von einem Stück Schnur zusammengehalten wurde. Ein verschlagener Blick lag auf dem verschmierten Gesicht. Der Mann rieb sich die Augen und stammelte: »Mir brummt der Schädel.«
»Wer bist du?«, fragte Luke.
»Ich bin Pete, du Schwachkopf, hast du keine Augen im Kopf?«
»Ich kann mich nicht …« Luke schluckte, um die Panik in den Griff zu bekommen. »Ich habe mein Gedächtnis verloren!«
»Das überrascht mich nicht! Du hast die Pulle gestern Abend ja fast allein geleert. Ein Wunder, dass von deinem Verstand überhaupt noch was übrig ist.« Pete leckte sich die Lippen. »Ich hab kaum einen Schluck von dem verdammten Bourbon abbekommen.«
Bourbon! Das kann einen Kater schon erklären, dachte Luke. »Warum sollte ich eine ganze Flasche Whiskey in mich hineinkippen?«, wollte er wissen.
Pete lachte spöttisch. »Das ist so ungefähr die dämlichste Frage, die ich je gehört habe. Um dir einen anzusaufen natürlich!«
Wieder dieser Horror. Ich bin ein besoffener Penner, der nachts in Männerklos unterkriecht, dachte Luke.
Er hatte einen Wahnsinnsdurst. Er beugte sich über ein Waschbecken, drehte das kalte Wasser an und trank direkt aus dem Hahn. Sofort ging es ihm besser. Er wischte sich den Mund ab und zwang sich erneut zu einem Blick in den Spiegel.
Das Gesicht wirkte jetzt ruhiger, der irre Blick war verflogen und einem eher bestürzten, verzweifelten Ausdruck gewichen. Das Spiegelbild zeigte einen dunkelhaarigen, blauäugigen Mann Ende dreißig ohne Bart, aber mit starkem Bartwuchs. Dunkle Stoppeln umschatteten sein Kinn.
Er wandte sich wieder an seinen Gefährten. »Luke wie? Wie heiße ich mit Nachnamen?«
»Luke … soundso. Woher soll ich das wissen, verdammt noch mal?«
»Wie komme ich hier her? Seit wann geht das schon so? Wie ist das passiert?«
Pete kam mühsam auf die Beine. »Ich brauch ’n Frühstück«, sagte er.
Luke spürte, dass er auch Hunger hatte. Ob ich Geld bei mir habe, fragte er sich und durchsuchte seine Taschen – den Regenmantel, das Jackett, die Hosen. Alles leer. Er hatte weder Geld noch eine Brieftasche, nicht einmal ein Taschentuch. Keine Wertgegenstände, keinerlei Hinweise. »Ich glaub, ich bin pleite«, sagte er.
»Was du nicht sagst«, erwiderte Pete sarkastisch. »Komm jetzt!« Er stolperte durch eine Tür.
Luke ging ihm nach.
Der nächste Schock folgte auf dem Fuße: Luke betrat einen riesigen, menschenleeren Tempel. Es herrschte eine unheimliche Stille. Auf dem Marmorfußboden standen Bankreihen aus Mahagoni, standen da wie in einer Kirche vor Beginn einer gespenstischen Versammlung. Auf Steinträgern über Säulenreihen erhoben sich surreale, behelmte Steinkrieger und wachten über die heilige Stätte. Hoch über ihren Häuptern wölbte sich eine reich mit vergoldeten Achtecken geschmückte Kuppel. Luke schoss der verrückte Gedanke durch den Kopf, er sei einem sinistren Kult zum Opfer gefallen und habe bei dessen Ritualen das Gedächtnis verloren.
Von ehrfürchtiger Scheu ergriffen fragte er: »Wo sind wir denn hier?«
»Union Station, Washington, D. C.«, antwortete Pete.
Der Groschen fiel, und Luke begriff endlich, was das alles bedeutete. Erleichtert sah er den Dreck an den Wänden, die platt getretenen Kaugummis auf dem Marmorboden, die Bonbonpapiere und Zigarettenschachteln in den Ecken, und kam sich furchtbar dumm vor. Er befand sich in einer pompösen Bahnhofshalle, und es war noch zu früh am Morgen, als dass sie schon voller Reisender gewesen wäre. Er hatte sich selbst Angst eingejagt wie ein Kind, das sich im dunklen Schlafzimmer vor eingebildeten Gespenstern fürchtet.
Pete hielt Kurs auf einen Triumphbogen mit der Aufschrift Exit, und Luke lief ihm hinterher.
Eine aggressive Stimme rief: »He! He, Sie da!«
»O je«, sagte Pete und beschleunigte seinen Schritt.
Ein untersetzter Mann in eng sitzender Eisenbahner-Uniform stürzte, sichtlich empört, auf die beiden zu. »Wo kommt ihr zwei Berber her?«
»Wir gehen ja schon, wir gehen ja schon«, winselte Pete.
Luke empfand es als Demütigung, sich von einem feisten Amtsträger aus dem Bahnhof jagen zu lassen.
Doch der Mann gab sich nicht damit zufrieden, sie einfach los zu werden. Er blieb ihnen dicht auf den Fersen und schimpfte: »Ihr habt hier wohl gepennt, was? Ihr wisst doch, dass das verboten ist!«
Es ärgerte Luke, wie ein Schuljunge zurechtgewiesen zu werden, obwohl er sich eingestand, dass er es vermutlich nicht anders verdiente – schließlich hatte er ja in der verdammten Toilette geschlafen. Er verkniff sich eine scharfe Entgegnung und ging schneller.
»Das ist keine Absteige hier«, fuhr der Mann fort. »Und jetzt verpisst euch, ihr Penner, ihr verfluchten!« Er rempelte Luke an der Schulter.
Luke drehte sich um und stellte sich dem Mann von der Bahn. »Fass mich nicht an!«, sagte er und war selbst überrascht von der ruhigen Drohung, die in seiner Stimme mitschwang. Der Eisenbahner blieb abrupt stehen. »Wir gehen ja schon. Sie können sich also jedes weitere Wort sparen, ist das klar?«
Der Mann trat einen Schritt zurück, er hatte offenbar Angst.
Pete packte Luke am Arm. »Komm, wir verschwinden.«
Luke schämte sich. Der Typ war ein dummer Wichtigtuer, er selbst und Pete hingegen Vagabunden. Jeder Bahnangestellte hatte das Recht, sie hinauszuwerfen – es gab also nicht die geringste Veranlassung zu Drohgebärden.
Sie traten durch das majestätische Portal ins Freie. Draußen war es noch dunkel. Auf dem kreisförmigen Bahnhofsvorplatz parkten ein paar Autos, doch die Straßen waren still. Die Luft war bitterkalt. Luke zog die Lumpen, die er trug, enger um seinen Körper. Es war ein frostiger Wintermorgen in Washington, Januar oder Februar vielleicht.
Welches Jahr haben wir, fragte er sich.
Pete wandte sich nach links; er wusste offenbar, wohin er wollte. Luke folgte ihm. »Wohin gehen wir?«, fragte er.
»Ich kenne da so eine Kirche in der H-Straße, da gibt’s ’n Frühstück umsonst – solange du dich nicht dagegen sträubst, ein frommes Lied zu singen. Oder zwei.«
»Meinetwegen ein ganzes Oratorium. Ich bin am Verhungern!«
Zielstrebig steuerte Pete im Zickzack durch das von heruntergekommenen Mietshäusern geprägte Viertel. Die Stadt war noch nicht erwacht. Die Häuser waren dunkel, die Läden vor den Geschäften, die Schnellrestaurants und Zeitungskioske noch geschlossen. Lukes Blick fiel auf ein mit billigen Vorhängen verhängtes Schlafzimmerfenster, und er stellte sich dahinter einen Mann im Tiefschlaf vor, in Decken gehüllt, neben sich, warm und kuschelig, die Ehefrau. Neid wallte in ihm auf. Anscheinend gehörte er, Luke, zu jener menschlichen Gemeinschaft, die sich im allerfrühesten Morgengrauen, wenn der Normalbürger noch friedlich im Bett liegt und schläft, auf die Straße hinauswagt: der Mann in Arbeitskluft unterwegs zu einem frühen Job; der junge Radfahrer, dick vermummt in Schal und Handschuhen; die einsame Frau, die im hell erleuchteten Innenraum eines Busses eine Zigarette raucht.
Wirre, beklemmende Fragen schwirrten ihm durch den Kopf. Wie lange bin ich schon Alkoholiker? Habe ich jemals versucht, trocken zu werden? Habe ich eine Familie, die mir gegebenenfalls helfen kann? Wo habe ich Pete kennen gelernt? Woher haben wir den Sprit bekommen, wo ihn getrunken?
Doch Pete war maulfaul, und Luke bezwang seine Ungeduld in der Hoffnung, dass sein Begleiter vielleicht etwas mitteilsamer wurde, wenn er erst einmal etwas im Magen hatte.
Sie kamen zu einer kleinen Kirche, die trotzig ihren Platz zwischen einem Kino und einem Tabakladen behauptete. Sie traten durch einen Nebeneingang ein und stiegen eine Treppe hinunter, die in den Keller führte. Luke fand sich in einem lang gestreckten Raum mit niedriger Decke wieder, bei dem es sich anscheinend um die Krypta handelte. Auf der einen Seite erkannte er ein Klavier und eine kleine Kanzel, an der anderen befand sich eine Küchenzeile. Dazwischen standen drei einfache, auf Schragen gestellte Tische mit Bänken. Drei andere Penner saßen bereits da – je einer an jedem Tisch – und starrten geduldig ins Nichts. In der Küchenecke stand eine rundliche Frau und rührte in einem großen Kochtopf. Der Mann neben ihr, ein Graubart mit Priesterkragen, sah von seinem Kaffeebecher auf und lächelte.
»Nur herein, meine Herren, nur herein mit Ihnen!«, sagte er fröhlich. »Kommen Sie ins Warme!« Luke beäugte ihn misstrauisch und fragte sich, ob hier alles mit rechten Dingen zuging.
Es war in der Tat warm – atemberaubend warm nach der kalten Winterluft draußen. Luke knöpfte seinen abgewetzten Trenchcoat auf, und Pete sagte: »Morgen, Pastor Lonegan.«
»Waren Sie schon einmal hier?«, fragte der Pastor. »Ich habe Ihren Namen vergessen.«
»Ich bin Pete – und der da ist Luke.«
»Petrus und Lukas, zwei Jünger des Herrn!« Die Jovialität wirkte echt. »Fürs Frühstück kommen Sie ein wenig zu früh, aber frischen Kaffee gibt es schon.«
Luke hätte gerne gewusst, wie es ein Mann, der in aller Herrgottsfrühe aufstehen musste, um einen Raum voll verblödeter Vagabunden mit Frühstück zu versorgen, schaffte, sich seinen Frohsinn zu bewahren.
Der Pastor goss Kaffee in zwei Steingutbecher. »Milch und Zucker?«
Luke wusste nicht, ob er Milch und Zucker im Kaffee mochte. »Ja, bitte«, sagte er aufs Geratewohl, bedankte sich, nahm den Becher und nippte am Kaffee. Er schmeckte ekelhaft sahnig und süß. Wahrscheinlich trinke ich ihn normalerweise schwarz, dachte Luke. Doch da das Gebräu auch das Hungergefühl besänftigte, trank er den Becher rasch aus.
»In ein paar Minuten werden wir ein kurzes Gebet sprechen«, sagte der Pastor, »und danach dürfte Mrs. Lonegans berühmter Haferbrei servierfertig sein.«
Luke kam zu dem Schluss, dass sein Verdacht ungerechtfertigt gewesen war: Bei Pastor Lonegan stimmten Schein und Wirklichkeit überein – er war ein fröhlicher Zeitgenosse, der gerne anderen Menschen half.
Luke und Pete setzten sich an den klobigen Brettertisch, und Luke musterte seinen Gefährten. Bisher waren ihm nur das dreckige Gesicht und die Lumpen aufgefallen, die er am Leibe trug. Jetzt bemerkte er, dass die typischen Merkmale des Langzeitsäufers fehlten: keine geplatzten Äderchen, keine trockenen Hautfetzen, die sich vom Gesicht abschälten, keine Schnitte oder blauen Flecken. Vielleicht ist Pete einfach noch zu jung, dachte Luke; er schätzte ihn auf etwa fünfundzwanzig. Pete hatte eine kleine Missbildung: Ein dunkelrotes Muttermal zwischen rechtem Ohr und Kiefer. Seine Zähne waren schief und verfärbt. Den dunklen Schnurrbart hat er sich wahrscheinlich stehen lassen, um von seinen schlechten Zähnen abzulenken – irgendwann in längst vergangenen Tagen, als ihm seine äußere Erscheinung noch nicht gleichgültig war. Luke spürte unterdrückte Wut in seinem Kumpel – einen Hass auf die Welt, vielleicht, weil sie ihn hässlich gemacht hatte, vielleicht aber auch aus einem ganz anderen Grund. Vielleicht hing Pete einer Verschwörungstheorie an und glaubte, irgendeine ihm verhasste Bevölkerungsgruppe richte das Land zugrunde – chinesische Einwanderer, arrivierte Schwarze oder ein undurchsichtiger Klub von zehn Superreichen, die insgeheim den Aktienmarkt beherrschten.
»Was glotzt du mich so an?«, fragte Pete.
Luke zuckte mit den Schultern, antwortete aber nicht. Auf dem Tisch lag eine Zeitung, daneben ein Bleistiftstummel; die Seite mit dem Kreuzworträtsel war aufgeschlagen. Lukes Blick fiel auf die leeren Kästchen; er nahm den Bleistift zur Hand und begann, die gesuchten Wörter einzutragen.
Immer mehr Berber schlurften herein. Mrs. Lonegan stellte einen Stapel Geschirr bereit: schwere Suppenschalen und Löffel. Luke hatte das Kreuzworträtsel fast gelöst, nur ein Wort fehlte noch, Kleiner Ort in Dänemark, mit sechs Buchstaben. Pastor Lonegan sah ihm über die Schulter, zog überrascht die Augenbrauen hoch und sagte leise zu seiner Frau: »Oh, welch ein edler Geist ist hier zerstört!«
Sofort war das fehlende Wort da – Hamlet. Luke trug es ein und dachte: Woher weiß ich das?
Er schlug die Zeitung auf und sah nach dem Datum auf der Titelseite. Es war Mittwoch, der 29. Januar 1958. Dann fesselte die Schlagzeile seinen Blick – US-Erdtrabant bleibt auf dem Boden –, und er las:
Cape Canaveral, Dienstag: Nach zahlreichen technischen Problemen hat die US-Marine einen zweiten Versuch, ihre Vanguard-Rakete in den Weltraum zu schicken, kurz vor dem geplanten Start abgebrochen.
Die Entscheidung fiel zwei Monate nach dem ersten Versuch, der mit einer demütigenden Katastrophe endete. Damals war die Rakete zwei Sekunden nach der Zündung explodiert.
Die amerikanischen Hoffnungen auf den Start eines Weltraumsatelliten, der dem sowjetischen Sputnik erfolgreich Paroli bieten kann, richten sich nun auf die konkurrierende Jupiter-Rakete der Armee.
Ein lauter Akkord auf dem Klavier ließ Luke aufblicken. Mrs. Lonegan spielte die einleitenden Töne eines bekannten Kirchenlieds, und gleich darauf begannen sie und ihr Mann What a Friend We Have in Jesus zu singen. Froh darüber, dass er sich an das Lied erinnern konnte, stimmte Luke ein.
Dieser Bourbon wirkt sich echt seltsam aus, dachte er. Ich kann ein Kreuzworträtsel lösen und ein Kirchenlied mitsingen, habe aber keine Ahnung, wie meine Mutter heißt. Trinke ich vielleicht schon seit Jahren, sodass mein Gehirn entsprechend ruiniert ist? Wie habe ich es nur so weit kommen lassen können?
Nach dem Choral las Pastor Lonegan einige Bibelverse und versicherte daraufhin allen Anwesenden, dass auch sie gerettet werden könnten. Das hat diese Bande hier auch dringend nötig, dachte Luke. Doch wie auch immer – selbst empfand er nicht das Bedürfnis, sein Vertrauen in Jesus zu setzen. Zunächst einmal wollte er herausfinden, wer er überhaupt war.
Der Pastor extemporierte einen Segen, alle sprachen ein Tischgebet, dann stellten sich die Männer an, und Mrs. Lonegan teilte Haferbrei mit Sirup aus. Luke schlang drei Schalen voll hinunter. Danach ging es ihm wesentlich besser, und der Kater verschwand rasch.
Luke war ungeduldig, er hatte noch so viele Fragen. Er wandte sich an den Pastor: »Sagen Sie, Sir, haben Sie mich hier schon einmal gesehen? Ich habe mein Gedächtnis verloren.«
Lonegan musterte ihn aufmerksam. »Ich glaube, nein«, sagte er. »Aber ich kann mich irren. Ich habe jede Woche mit Hunderten von Leuten zu tun, wissen Sie. Wie alt sind Sie?«
»Das weiß ich nicht«, sagte Luke und kam sich dabei sehr dumm vor.
»Ende dreißig, würde ich sagen. Lange sind Sie noch nicht auf der Straße, das sieht man einem nämlich an. Sie haben einen federnden Gang, Ihre Haut ist rein unter dem Dreck, und außerdem sind Sie geistig noch so fit, dass Sie ein Kreuzworträtsel lösen können. Hören Sie auf zu trinken, und Sie werden wieder ein ganz normales Leben führen können.«
Luke fragte sich, wie oft der Pastor diesen Rat schon erteilt haben mochte. »Ich werd ’s versuchen«, versprach er.
»Wenn Sie Hilfe brauchen, wenden Sie sich an uns.« Ein junger Mann, der offensichtlich geistig behindert war, tätschelte beharrlich Lonegans Arm. Der Pastor wandte sich ihm mit geduldigem Lächeln zu.
»Wie lange kennst du mich schon?«, fragte Luke Pete.
»Weiß nicht. Du hängst hier schon ’ne Zeit lang rum.«
»Wo haben wir die vorletzte Nacht verbracht?«
»Immer mit der Ruhe, ja! Früher oder später wird sich dein Gedächtnis schon wieder melden.«
»Ich muss aber wissen, wo ich herkomme.«
Pete wirkte unschlüssig. »Was wir jetzt brauchen, ist ein Bier«, sagte er endlich. »Dann können wir wieder klar denken.« Er wandte sich zum Gehen.
Luke hielt ihn am Arm fest. »Ich will kein Bier«, sagte er entschieden. Pete will offenbar nicht, dass ich mich mit meiner Vergangenheit beschäftige, dachte er. Vielleicht hat er Angst, einen Kumpel zu verlieren. Aber da kann ich ihm auch nicht helfen – ich habe Wichtigeres zu tun als Pete Gesellschaft zu leisten. »Ehrlich gesagt, ich wär jetzt gerne ein Weilchen allein.«
»Für wen hältst du dich eigentlich? Für Greta Garbo?«
»Ich meine das ernst.«
»Du brauchst mich aber! Allein schaffst du ’s nicht. Mensch, du weißt ja nicht mal, wie alt du bist.«
In Petes Blick lag eine gewisse Verzweiflung, doch Luke ließ sich davon nicht beirren. »Du machst dir Sorgen um mich, das ist nett von dir. Aber ich will herausfinden, wer ich bin, und dabei bist du mir keine Hilfe.«
Pete zögerte einen Augenblick, dann zuckte er mit den Schultern. »Na schön, das ist dein gutes Recht.« Er wandte sich wieder dem Ausgang zu. »Alsdann, bis irgendwann mal.«
»Bis irgendwann mal, ja.«
Pete ging. Luke schüttelte Pastor Lonegan die Hand. »Vielen Dank für alles«, sagte er.
»Ich hoffe, Sie finden, was Sie suchen«, antwortete der Pastor.
Luke stieg die Treppe hinauf und trat auf die Straße. Einen Straßenzug weiter stand Pete und sprach mit einem Mann in einem grünen Regenmantel und einer dazu passenden Mütze. Wahrscheinlich bettelt er ihn an, damit er sich sein Bier kaufen kann, dachte Luke, schlug die entgegengesetzte Richtung ein und bog bei nächster Gelegenheit um die Ecke.
Es war noch immer dunkel. Luke bekam kalte Füße und spürte plötzlich, dass er zwar Stiefel trug, aber keine Socken. Während er weiterhastete, begann es leicht zu schneien. Nach ein paar Minuten verlangsamte er seine Schritte wieder. Es gab keinen Grund zur Eile; es war vollkommen egal, ob er schnell ging oder langsam. Er blieb stehen und suchte Schutz in einem Hauseingang.
Er hatte keine Ahnung, wohin er sich wenden sollte.
06.00 Uhr
Die Rakete ist auf drei Seiten von einem gerüstartigen Wartungsturm umgeben, der sie in stählerner Umarmung hält. Der Turm – eine umgebaute Ölbohrplattform – ist auf zwei Radpaare montiert, die auf breitspurigen Schienen laufen. Vor dem Start wird die Konstruktion, die höher ist als ein mehrstöckiges Haus, um knapp einhundert Meter zurückgerollt.
Elspeth wachte auf voller Sorge um Luke.
Eine Weile blieb sie noch im Bett liegen. Das Herz war ihr schwer, so sehr bangte sie um den Mann, den sie liebte. Schließlich knipste sie die Nachttischlampe an und setzte sich auf.
Ihr Motelzimmer war mit Weltraumdekor ausgestattet. Die Stehlampe hatte die Form einer Rakete, und die Bilder an den Wänden zeigten Planeten, Halbmonde und Umlaufbahnen in einem aberwitzig unrealistischen Nachthimmel. Das Starlite gehörte zu einer dicht gedrängten Gruppe neuer Motels, die im Dünengelände um Cocoa Beach, Florida, zwölf Kilometer südlich von Cape Canaveral, wie Pilze aus dem Boden geschossen waren, um die wachsende Zahl von Gästen aufzunehmen. Der Innenarchitekt hatte offenbar das Thema »Weltraum« für genau das Richtige gehalten, doch Elspeth kam sich vor, als hätte man sie im Zimmer eines Zehnjährigen einquartiert.
Sie griff nach dem Telefon, das auf dem Nachttisch stand, und wählte die Nummer von Anthony Carrolls Büro in Washington, D.C. Der Ruf ging ab, aber am anderen Ende meldete sich niemand.
Sie probierte es mit der Privatnummer, doch das Ergebnis war das gleiche. War etwas schief gegangen?
Ihr wurde übel vor Angst. Anthony ist gerade auf dem Weg ins Büro, redete sie sich ein. Ich probiere es in einer halben Stunde noch einmal. Länger als dreißig Minuten ist er bestimmt nicht unterwegs.
Unter der Dusche musste sie daran denken, wie sie Luke und Anthony kennen gelernt hatte. Die beiden studierten vor dem Krieg in Harvard und sie in Radcliffe. Die Jungs gehörten beide dem Harvard Glee Club an, dem Universitätschor. Luke hatte einen hübschen Bariton, Anthony einen prächtigen Tenor. Sie selbst war damals Dirigentin der Radcliffe Choral Society und hatte ein gemeinsames Konzert mit dem Glee Club organisiert.
Luke und Anthony waren die besten Freunde und doch ein ungleiches Paar. Beide waren sie große, sportliche Typen, doch damit endete auch schon die Ähnlichkeit. Bei den Radcliffe-Mädchen hießen sie »der Schöne und das Biest«. Der Schöne war der stets elegant gekleidete Luke mit seinem welligen schwarzen Haar. Anthony mit seiner großen Nase und dem langen Kinn sah nicht gut aus, und man hatte bei ihm immer den Eindruck, er trage einen Anzug, der ihm nicht gehörte. Seine Energie und Begeisterungsfähigkeit machten ihn dennoch anziehend für die Studentinnen.
Elspeth hielt sich nicht lange unter der Dusche auf. Im Morgenrock setzte sie sich an den Schminktisch und trug ihr Make-up auf. Ihre Armbanduhr hatte sie zuvor neben den Eyeliner gelegt, um ja nicht zu verpassen, wann die halbe Stunde vorüber war.
Auch damals, als sie zum ersten Mal mit Luke sprach, hatte sie im Morgenrock am Schminktisch gesessen. Bei einer so genannten Schlüpferjagd. Eine Gruppe von Harvard-Boys, einige davon angetrunken, war spätabends durch ein Fenster im Erdgeschoss in das Studentinnenheim eingedrungen. Heute, fast zwanzig Jahre später, kam es Elspeth schier unglaublich vor, dass sie und die anderen Mädchen damals nichts Schlimmeres befürchtet hatten, als dass man ihnen womöglich die Unterwäsche klauen könne. War die Welt damals noch so unschuldig gewesen?
Luke war rein zufällig bei ihr im Zimmer gelandet. Er studierte Mathematik wie sie. Zwar trug er eine Maske, doch Elspeth erkannte ihn an seinen Kleidern, dem hellgrauen Jackett aus irischem Tweedstoff mit einem rot gepunkteten Baumwolltaschentuch in der Brusttasche. Unter vier Augen mit ihr wirkte Luke auf einmal sehr gehemmt, als ginge ihm just in diesem Augenblick auf, dass er einen großen Blödsinn begangen hatte. Elspeth hatte gelächelt, auf ihren Kleiderschrank gedeutet und gesagt: »Oberstes Fach.« Worauf Luke zu ihrem Bedauern – denn sie waren recht teuer gewesen – zwei hübsche weiße Schlüpfer mit Spitzenbesatz an sich nahm. Doch schon am nächsten Tag bat er sie um ein Rendezvous.
Elspeth konzentrierte sich auf ihr Make-up. Da sie schlecht geschlafen hatte, war es diesmal schwieriger als sonst. Grundierung glättete ihre Wangen, und lachsrosa Lippenstift hellte ihre Mundpartie auf. Sie konnte ein abgeschlossenes Mathematikstudium von der renommierten Universität Radcliffe vorweisen, doch am Arbeitsplatz erwartete man von ihr immer noch, dass sie wie ein Mannequin aussah.
Sie bürstete sich das Haar. Es war rotbraun und modisch geschnitten: kinnlang und am Hinterkopf nach innen gewellt. Dann zog sie sich rasch an: ein Kleid mit einem ärmellosen Oberteil aus braun-grün gestreifter Baumwolle und mit einem breiten, dunkelbraunen Kunstledergürtel.
Seit ihrem ersten Versuch, Anthony telefonisch zu erreichen, waren neunundzwanzig Minuten vergangen.
Die letzte Warteminute vertrieb sie sich mit Gedankenspielen um die Zahl 29.
Es war eine Primzahl – also eine Zahl, die lediglich durch den Faktor 1 geteilt werden konnte. Abgesehen davon war die 29 ziemlich uninteressant. Das einzig Ungewöhnliche war, dass 29 plus 2x2 für jeden x-Wert bis 28 ebenfalls eine Primzahl war. Sie zählte die Reihe in Gedanken auf: 29, 31, 37, 47, 61, 79, 101, 127 …
Dann griff sie zum Telefon und wählte noch einmal Anthonys Büronummer.
Niemand hob ab.
1941
Elspeth Twomey verliebte sich in Luke, als er sie zum ersten Mal küsste.
Die meisten Harvard-Studenten hatten vom Küssen keine Ahnung. Entweder verletzten sie einem die Lippen mit ihrem brutalen Ungestüm, oder aber sie rissen den Mund so weit auf, dass man sich wie eine Zahnärztin vorkam. Luke küsste sie fünf Minuten vor Mitternacht im Schatten des Studentinnenheims von Radcliffe ebenso leidenschaftlich wie zärtlich. Seine Lippen waren ständig in Bewegung, nicht nur auf ihrem Mund, sondern auch auf ihren Wangen, ihren Augenlidern und an ihrem Hals. Seine Zungenspitze schob sich sanft zwischen ihre Lippen und bat höflich um Einlass, den Elspeth ihr nicht einmal andeutungsweise verwehrte. Als sie danach in ihrem Zimmer saß, flüsterte sie ihrem Spiegelbild zu: »Ich glaube, ich liebe ihn.«
Ein halbes Jahr war seither vergangen, und das Gefühl war immer stärker geworden. Mittlerweile sahen sie sich beinahe täglich. Für beide war es das Jahr vor den letzten Examina. Entweder trafen sie sich zum Mittagessen, oder sie lernten ein paar Stunden zusammen. Die Wochenenden verbrachten sie fast immer gemeinsam.
Dass sich eine Radcliffe-Studentin im letzten Studienjahr mit einem Harvard-Studenten oder einem jungen Professor verlobte, war nicht ungewöhnlich. Im Sommer wurde dann geheiratet und eine lange Hochzeitsreise angetreten. Danach bezog man eine gemeinsame Wohnung, fing an zu arbeiten – und ungefähr ein Jahr später kam das erste Kind zur Welt.
Luke aber hatte nie vom Heiraten gesprochen.
Jetzt sah sie ihn vor sich und beobachtete ihn: Er saß in einer Nische in Flanagan’s Bar und führte ein Streitgespräch mit Bern Rothsten, einem langen postgraduierten Studenten mit buschigem schwarzem Schnurrbart und kampferprobtem Blick. Luke fielen die dunklen Haare immer wieder ins Gesicht und über die Augen, worauf er sie mit der linken Hand wieder zurückstrich – eine vertraute Geste. Wenn er älter ist und in Amt und Würden, dachte Elspeth, wird er sich Pomade ins Haar schmieren, damit es an Ort und Stelle bleibt, aber so verführerisch wie jetzt sieht er dann bestimmt nicht mehr aus …
Bern war, wie viele Studenten und Professoren in Harvard, Kommunist. »Dein Vater ist Bankier«, sagte er voller Verachtung zu Luke. »Und du wirst auch einer. Ganz klar, dass du den Kapitalismus großartig findest.«
Elspeth sah, wie sich Lukes Hals rötete. Sein Vater war vor kurzem im Time Magazine als einer von zehn Männern porträtiert worden, die seit der Weltwirtschaftskrise Millionäre geworden waren. Elspeth ging jedoch davon aus, dass Luke nicht etwa rot wurde, weil er sich seiner reichen Herkunft schämte, sondern weil er seine Familie liebte und die indirekte Kritik an seinem Vater missbilligte. Sie schlug sich auf seine Seite und erwiderte empört: »Wir beurteilen einen Menschen nicht nach seinen Eltern, Bern!«
»Wie dem auch sei«, sagte Luke, »Bankier ist ein anständiger Beruf. Bankiers helfen anderen Leuten bei Unternehmensgründungen und sorgen für neue Arbeitsplätze.«
»Wie man 1929 ja gesehen hat.«
»Sie machen Fehler, ja. Manchmal helfen sie den Falschen. Auch Soldaten machen Fehler – sie schießen manchmal die falschen Leute tot. Trotzdem behaupte ich nicht, dass du ein Mörder bist.«
Nun war es an Bern, beleidigt zu sein. Er hatte im Spanischen Bürgerkrieg gekämpft – er war drei oder vier Jahre älter als seine Kommilitonen –, und Elspeth gewann den Eindruck, dass ihn die Erinnerung an einen tragischen Irrtum plagte.
»Außerdem habe ich nicht die geringste Absicht, Bankier zu werden«, fügte Luke hinzu.
Berns Freundin Peg, ein Mädchen ohne jeden Schick, beugte sich neugierig vor. Wie Bern stand sie fest zu ihren Überzeugungen, verfügte jedoch nicht über dessen sarkastisches Mundwerk. »Was denn dann?«
»Wissenschaftler.«
»Was für einer?«
Luke deutete mit dem Finger himmelwärts. »Ich will wissen, was außerhalb unseres Planeten vorgeht.«
Bern lachte verächtlich. »Weltraumraketen! Hirngespinste eines Schuljungen!«
Wieder warf sich Elspeth für Luke in die Bresche. »Komm, hör auf, Bern, du hast doch keine Ahnung, wovon du redest.« Bern studierte französische Literatur.
Luke indessen schienen die Sticheleien nichts auszumachen – vielleicht war er schon daran gewöhnt, dass man über seine Träume lachte. »Ich bin sicher, dass die Raketen kommen werden«, sagte er. »Und noch was, das du dir hinter die Ohren schreiben kannst: Ich bin fest davon überzeugt, dass noch zu unserern Lebzeiten Wissenschaft und Forschung mehr fürs einfache Volk tun werden als der Kommunismus.«
Elspeth zuckte zusammen. Sie liebte Luke, hielt seine politische Einstellung aber für naiv. »So simpel ist das nicht«, sagte sie. »Die Früchte von Wissenschaft und Forschung bleiben einer privilegierten Elite vorbehalten.«
»Das stimmt einfach nicht«, erwiderte Luke. »Dampfschiffe machen nicht nur Transatlantikpassagieren das Leben leichter, sondern auch den Seeleuten.«
»Hast du jemals den Maschinenraum eines Ozeandampfers von innen gesehen?«, fragte Bern.
»Ja, hab ich. Und keiner ist da unten an Skorbut gestorben.«
Der Schatten einer hoch gewachsenen Gestalt fiel über ihren Tisch. »Sind die Herrschaften denn schon alt genug, um in der Öffentlichkeit Alkohol trinken zu dürfen?« Es war Anthony Carroll. Er trug einen Anzug aus blauem Serge, der aussah, als hätte er darin geschlafen.
Anthony war nicht allein, und die auffallende Erscheinung neben ihm verblüffte Elspeth dermaßen, dass ihr ein unfreiwilliger Überraschungslaut entfuhr: Die junge Frau war klein und ihre zierliche Figur modisch mit einer roten Jacke und einem weiten schwarzen Rock bekleidet. Unter ihrer roten Schirmkappe quoll dicht gelocktes schwarzes Haar hervor.
»Ich möchte euch Billie Josephson vorstellen«, sagte Anthony.
»Bist du Jüdin?«, wollte Bern Rothsten wissen.
»Ja.« Die unverblümte Direktheit der Frage hatte sie erschreckt.
»Gut, dann kannst du Anthony zwar heiraten, aber kein Mitglied in seinem Country-Club werden.«
Anthony protestierte. »Ich bin doch gar kein Mitglied in einem Country-Club!«
»Wart ’s nur ab!«, sagte Bern.
Luke stand auf, um Billie die Hand zu geben. Dabei stieß er mit der Hüfte an den Tisch und warf ein Glas um, eine Unbeholfenheit, die gar nicht zu ihm passte. Elspeth erkannte mit einem Anflug von Ärger, dass er sich unmittelbar von Miss Josephson angezogen fühlte. »Ich bin überrascht«, sagte er und schenkte ihr sein charmantestes Lächeln. »Als Anthony sagte, seine Begleiterin heute Abend heiße Billie, habe ich mir eine Person von eins achtzig mit der Figur eines Ringers vorgestellt.«
Billie lachte fröhlich und rutschte auf den Sitz neben Luke. »Mein richtiger Name ist Bilhah und stammt aus der Bibel. Bilhah war die Magd Jakobs und die Mutter von Dan. Aber ich bin in Dallas aufgewachsen, und dort hat man mich Billie-Jo genannt.«
Anthony setzte sich neben Elspeth und sagte leise: »Ist sie nicht hübsch?«
Direkt hübsch ist sie eigentlich nicht, dachte Elspeth bei sich. Billie hatte ein schmales Gesicht mit einer scharf geschnittenen Nase, großen, dunkelbraunen Augen und durchdringendem Blick. Das Faszinierende an ihr war die Gesamterscheinung – das Lippenrot, die schief aufgesetzte Kappe, der texanische Akzent, vor allem aber ihre Lebhaftigkeit. Im Augenblick war sie dabei, Luke eine Anekdote über die Texaner zu erzählen; dabei lächelte sie, runzelte die Stirn, brachte pantomimenhaft eine ganze Palette von Gefühlen zum Ausdruck. »Sie ist süß«, sagte Elspeth zu Anthony. »Ich frage mich, warum sie mir bisher nie aufgefallen ist.«
»Sie arbeitet die ganze Zeit und geht nur selten auf Partys.«
»Und wie hast du sie dann kennen gelernt?«
»Ich hab sie im Fogg Museum entdeckt. Sie trug einen grünen Mantel mit Messingknöpfen und auf dem Kopf ein Barett. Sie kam mir vor wie ein Spielzeugsoldat, frisch aus der Packung.«
Ein Spielzeug ist sie bestimmt nicht, dachte Elspeth. Dazu ist sie viel zu gefährlich. Billie lachte über eine Bemerkung Lukes und gab ihm in gespielter Entrüstung einen Klaps auf den Arm – eine Geste nicht ohne Koketterie, wie Elspeth fand. Nervös unterbrach sie die beiden und sagte zu Billie: »Hast du vor, heute Abend die Sperrstunde zu brechen?«
Die Radcliffe-Studentinnen hatten um zehn Uhr abends auf ihren Zimmern zu sein. Es gab Ausnahmegenehmigungen, doch musste man sich in diesen Fällen in ein Buch eintragen und angeben, wohin man gehen und wann man zurückkommen wollte. Die pünktliche Rückkehr wurde kontrolliert. Natürlich inspirierte das komplizierte Regelwerk die jungen Frauen, clever wie sie waren, zu einer Reihe raffinierter Täuschungsmanöver.
»Ich verbringe die Nacht offiziell bei einer Tante, die auf Besuch ist und sich im Ritz eine Suite genommen hat«, sagte Billie. »Was hast du dir ausgedacht?«
»Kein Märchen – ich verlasse mich auf ein Fenster im Erdgeschoss, das die Nacht über offen bleibt.«
Billie senkte die Stimme. »In Wirklichkeit übernachte ich bei Freunden von Anthony in Fenway.«
Anthony wirkte verlegen. »Bekannte meiner Mutter mit einer Riesenwohnung«, sagte er zu Elspeth. »Schau mich nicht so altmodisch an, diese Leute sind furchtbar solide und konventionell.«
»Na, hoffentlich«, gab Elspeth spröde zurück und registrierte mit Zufriedenheit, dass Billie rot wurde. An Luke gewandt, sagte sie: »Wann fängt denn der Film an, Liebling?«
Luke warf einen Blick auf seine Armbanduhr. »Ja, wir müssen gehen«, sagte er.
Er hatte sich übers Wochenende einen Wagen geliehen, einen zweisitzigen Ford-A-Roadster, der schon zehn Jahre auf dem Buckel hatte und neben den stromlinienförmigen Fahrzeugen der frühen vierziger Jahre wie eine rollende Hutschachtel wirkte.
Luke hatte das alte Vehikel gut im Griff; das Chauffieren machte ihm sichtlich Spaß. Sie fuhren nach Boston. Elspeth fragte sich unterwegs, ob sie sich Billie gegenüber nicht zu gehässig verhalten hatte. Ein bisschen vielleicht, dachte sie, aber deswegen würde sie bestimmt keine Träne vergießen.
Im Loew’s State Theatre sahen sie sich Suspicion an, den jüngsten Film von Alfred Hitchcock. In der Dunkelheit legte Luke seinen Arm um Elspeth, und sie lehnte den Kopf an seine Schulter. Sie fand es schade, dass sie sich ausgerechnet einen Film über eine Ehekatastrophe ausgesucht hatten.
Gegen Mitternacht fuhren sie nach Cambridge zurück und parkten gegenüber dem Charles River am Memorial Drive, unweit des Bootshauses. Der Wagen hatte keine Heizung. Elspeth klappte den Pelzkragen ihres Mantels hoch und kuschelte sich an Luke, um die Wärme seines Körpers zu spüren.
Sie unterhielten sich über den Film. Elspeth war überzeugt, dass sich ein unterdrücktes und in einem erzkonservativen Elternhaus aufgewachsenes Mädchen – im Film dargestellt von Joan Fontaine – im realen Leben nie zu einem solchen Tunichtgut hingezogen fühlen konnte, wie Cary Grant ihn verkörperte.
Luke widersprach ihr. »Aber das ist es doch gerade, was ihn so anziehend für sie gemacht hat – er war gefährlich!«
»Sind gefährliche Menschen attraktiv?«
»Ja, absolut!«
Elspeth wandte sich ab und betrachtete das Spiegelbild des Mondes auf der unruhigen Wasserfläche. Billie Josephson ist gefährlich, dachte sie.
Luke spürte ihre Missstimmung und wechselte das Thema. »Professor Davies hat heute Nachmittag zu mir gesagt, dass ich mein Master’s Degree hier in Harvard machen kann, wenn ich will.«
»Und wie kommt er darauf?«
»Ich hatte erwähnt, dass ich mir Hoffnungen mache, mein Studium an der Columbia-Universität fortzusetzen. ›Wozu denn?‹, fragte er. ›Bleiben Sie doch hier!‹ Ich erklärte ihm, dass meine Familie in New York lebt, da sagte er: ›Familie! O je!‹ So was Ähnliches jedenfalls. Es klang, als wäre ich als Mathematiker nicht ernst zu nehmen, wenn ich ab und zu meine kleine Schwester sehen möchte.«
Luke war das älteste von vier Kindern. Seine Mutter war Französin; sein Vater hatte sie gegen Ende des Ersten Weltkriegs in Paris kennen gelernt.
Elspeth wusste, dass Luke seine beiden halbwüchsigen Brüder sehr gern hatte und in seine elfjährige Schwester geradezu vernarrt war. »Professor Davies ist Junggeselle«, sagte sie. »Er lebt nur für seine Arbeit.«
»Was hast du eigentlich vor?«, fragte Luke. »Willst du auch den Magister machen?«
Elspeths Herz stockte. »Soll ich?« Wollte er sie bitten, mit ihm zusammen nach New York zu gehen?
»Du bist besser in Mathe als die meisten Männer hier in Harvard.«
»Ich wollte eigentlich immer einen Job im Außenministerium.«
»Das hieße also Washington als Wohnort.«
Elspeth war sich sicher, dass Luke dieses Gespräch nicht geplant hatte. Er dachte bloß laut nach. Typisch Mann – von einer Minute zur anderen kam er ohne Bedenken auf Dinge zu sprechen, die für ihr beider Leben entscheidend sein konnten. Immerhin schien ihn die Aussicht, sie könnten in verschiedene Städte ziehen, zu bestürzen. Dabei liegt die Lösung des Problems doch auf der Hand, dachte Elspeth glücklich, für ihn genauso wie für mich.
»Warst du jemals verliebt?«, sagte er plötzlich, bemerkte seine Taktlosigkeit aber sofort und fügte hinzu: »Ich weiß, das ist eine sehr persönliche Frage, die ich eigentlich nicht stellen sollte.«
»Schon in Ordnung«, sagte sie. Wenn Luke mit ihr über die Liebe sprechen wollte, war es immer in Ordnung. »Um ehrlich zu sein, ja. Ich war mal verliebt.« Sie sah sein Gesicht im Mondschein und registrierte nicht ohne Genugtuung einen Anflug von Empörung in seiner Miene. »Als ich siebzehn war, gab es in Chicago einen Metallarbeiterstreik. Ich war damals politisch sehr engagiert und stellte mich als freiwillige Helferin zur Verfügung. Ich durfte Botengänge machen und Kaffee kochen. Der junge Gewerkschaftsfunktionär, dem ich zugeteilt war, hieß Jack Largo, und ich hab mich in ihn verliebt.«
»Und er sich in dich?«
»Meine Güte, nein! Er war fünfundzwanzig und hielt mich für ein Kind. Er war freundlich zu mir, charmant sogar, aber das war er allen gegenüber.« Elspeth zögerte. »Einmal hat er mich allerdings geküsst.« Sie war sich nicht sicher, ob sie Luke das erzählen sollte, wollte sich aber von der Last befreien. »Wir waren allein in einem Hinterzimmer und packten Flugblätter ein. Ich sagte irgendetwas, das ihn zum Lachen brachte – ich weiß gar nicht mehr, was. ›Du bist ein Schatz, Ellie‹, sagte er – er gehörte zu den Leuten, die alle Vornamen abkürzen, dich hätte er sicher Lou genannt. Ja, und dann hat er mich geküsst, direkt auf den Mund. Ich wäre vor Glück fast gestorben. Aber dann packte er weiter Flugblätter ein, als wäre nichts geschehen.«
»Er hat sich bestimmt nicht getraut. Wahrscheinlich war er doch in dich verknallt.«
»Kann sein.«
»Hast du noch Kontakt zu ihm?«
Elspeth schüttelte den Kopf. »Er ist tot.«
»Was? In dem Alter?«
»Man hat ihn umgebracht.« Sie schluckte die plötzlich aufsteigenden Tränen hinunter. Das Letzte, was sie wollte, war, dass Luke den Eindruck gewann, sie wäre noch in den toten Jack verliebt. »Zwei Polizisten, die sich außerdienstlich von den Stahlbossen anheuern ließen, drängten ihn in eine enge Gasse und schlugen ihn mit Eisenstangen tot.«
»Herr im Himmel!« Luke starrte sie an.
»Jeder vor Ort wusste, wer es gewesen war, aber festgenommen wurde niemand.«
Luke ergriff ihre Hand. »Von solchen Sachen habe ich bisher nur in der Zeitung gelesen – es kam mir immer irgendwie irreal vor.«
»So sieht die Realität aber aus. Die Walzen im Stahlwerk müssen sich drehen. Wer quer schießt, wird zum Schweigen gebracht.«
»So wie du das sagst, klingt es, als wäre die Industrie um keinen Deut besser als ein Gangstersyndikat.«
»Ich seh da auch keinen großen Unterschied. Aber ich mische mich nicht mehr ein. Das hat mir damals gereicht.« Luke hatte von Liebe gesprochen – und ihr war doch wahrhaftig nichts Gescheiteres eingefallen, als eine politische Diskussion daraus werden zu lassen. Sie versuchte, zum eigentlichen Thema zurückzukehren. »Und du?«, fragte sie. »Warst du schon mal verliebt?«
»Ich weiß es nicht genau«, sagte er zögernd. »Ich glaube, ich weiß gar nicht, was Liebe ist.« So eine Antwort war typisch für einen jungen Mann. Dann küsste er sie, und Elspeths Ärger über sich selbst legte sich.
Sie streichelte ihn beim Küssen gern mit den Fingerspitzen, ließ sie über seine Ohren gleiten, folgte der Linie seiner Wangenknochen, strich ihm über Haar und Nacken. Manchmal hielt er einen Augenblick inne und studierte mit der Andeutung eines Lächelns ihr Gesicht, was Elspeth an ein Ophelia-Zitat aus Hamlet erinnerte: ›… betrachtet’ er so prüfend mein Gesicht, als wollt’ er ’s zeichnen.‹ Dann küsste er sie wieder. Dass er sie so gern hatte, war ein wunderbares Gefühl.
Nach einer Weile zog er sich zurück und seufzte schwer. »Ich frag mich, warum Ehepaare sich jemals langweilen. Die brauchen doch nie aufzuhören.«
Das Thema Ehe gefiel ihr. »Ich glaube, die Kinder hindern sie daran«, sagte sie und lachte.
»Möchtest du Kinder haben – irgendwann?«
Sie spürte, wie sich ihr Atem beschleunigte. Was fragte er da? »Selbstverständlich will ich Kinder.«
»Ich möchte vier.«
So viele wie seine Eltern. »Mädchen oder Jungs?«
»Sowohl als auch.«
Sie schwiegen. Elspeth hatte Angst, etwas Falsches zu sagen. Die Stille zog sich in die Länge. Dann endlich drehte Luke sich zu ihr um und fragte sie mit ernster Miene: »Was hältst du davon? Möchtest du vier Kinder haben?«
Auf dieses Stichwort hatte Elspeth nur gewartet. Sie lächelte glücklich. »Ja, unbedingt«, sagte sie. »Wenn sie von dir sind.«
Er küsste sie wieder.
Bald wurde es ihnen zu kalt, sodass sie sich widerstrebend zur Rückkehr entschlossen.
Der Weg nach Radcliffe führte über den Harvard Square. In der Dunkelheit stand eine Gestalt am Straßenrand und winkte ihnen zu. Luke traute seinen Augen nicht. »Ist das nicht Anthony?«, fragte er.
Er war es, Elspeth erkannte ihn. Neben ihm stand Billie.
Luke hielt an, und Anthony kam ans Seitenfenster. »Ein Glück, dass ich dich erwischt habe«, sagte er. »Du musst mir einen Gefallen tun.«
Schlotternd in der kalten Nachtluft stand Billie hinter Anthony und war offenbar sehr aufgebracht.
»Was treibt ihr eigentlich hier draußen?«, wollte Elspeth von Anthony wissen.
»Es ist alles schief gelaufen. Meine Freunde in Fenway sind übers Wochenende verreist – sie haben anscheinend das Datum verwechselt. Billie weiß nicht, wo sie pennen soll.«
Billie hatte sich unter Angabe falscher Tatsachen aus dem Studentinnenheim entfernt. Kehrte sie jetzt zurück, flog der Schwindel unweigerlich auf.
»Ich habe sie mit ins Haus genommen« – damit meinte er Cambridge House, wo er und Luke wohnten. Die Unterkünfte der Harvard-Studenten wurden »Häuser« genannt. »Ich dachte, sie könnte vielleicht in unserem Zimmer schlafen. Luke und ich hätten in der Bibliothek übernachten können.«
»Du spinnst wohl«, sagte Elspeth.
»Hat ’s alles schon gegeben«, warf Luke ein. »Wieso hat das nicht geklappt?«
»Man hat uns gesehen.«
»O nein!«, rief Elspeth. Keine Frau durfte sich in einem Männerzimmer erwischen lassen, schon gar nicht nachts. Das galt als gravierender Verstoß gegen die Hausordnung. Beide, Mann und Frau, konnten deswegen von der Universität verwiesen werden.
»Wer hat euch denn gesehen?«, fragte Luke.
»Geoff Pidgeon und eine ganze Horde anderer.«
»Geoff ist okay, aber wer waren die anderen?«
»Kann ich nicht genau sagen. Es war fast dunkel, und sie waren alle betrunken. Morgen Früh rede ich mit ihnen.«
Luke nickte. »Und was wollt ihr jetzt machen?«
»Billie hat einen Cousin in Newport, Rhode Island«, sagte Anthony. »Könntet ihr sie hinfahren?«
»Was?«, rief Elspeth. »Das sind doch achtzig Kilometer!«
»Dann dauert es halt ein Stündchen oder zwei«, sagte Anthony abschätzig. »Was meinst du, Luke?«
»Selbstverständlich«, sagte Luke.
Elspeth hatte gewusst, dass er Ja sagen würde. Für Luke war es Ehrensache, einem Freund aus der Patsche zu helfen, auch wenn es unbequem war. Trotzdem machte sie das wütend.
»Danke dir«, sagte Anthony erleichtert.
»Kein Problem«, sagte Luke, »oder doch: Ein Problem haben wir. Der Wagen ist ein Zweisitzer.«
Elspeth öffnete die Tür und stieg aus. »Bitte sehr«, sagte sie missmutig und schämte sich im selben Atemzug ihrer schlechten Laune. Es war doch nur recht und billig, dass Luke einem Freund half, der in Schwierigkeiten steckte. Dennoch war ihr der Gedanke verhasst, dass er zwei Stunden mit der kessen Billie Josephson in dem kleinen Wagen verbringen würde.
Luke spürte ihren Unmut und sagte: »Komm, Elspeth, steig wieder ein. Ich fahr dich zuerst nach Hause.«
Sie versuchte sich mit Großmut aus der Affäre zu ziehen. »Nicht nötig! Anthony kann mich bis zum Heim begleiten. Außerdem sieht Billie aus, als würde sie gleich erfrieren.«
»Na gut, wenn du meinst«, sagte Luke.
Schon bereute Elspeth, dass sie so schnell zugestimmt hatte.
Billie drückte ihr einen Kuss auf die Wange. »Ich weiß gar nicht, wie ich euch danken soll«, sagte sie. Dann stieg sie ins Auto, ohne Anthony gute Nacht zu sagen.
Luke winkte zum Abschied und fuhr los.
Anthony und Elspeth blieben noch stehen, bis der Wagen in der Dunkelheit verschwand.
»Verdammt«, sagte Elspeth.
06.30 Uhr
Auf die Flanke der weißen Rakete ist mit riesengroßen schwarzen Buchstaben die Bezeichnung »UE« eingestanzt. Es handelt sich um einen einfachen Code:
HUNTSVILEX1234567890UE ist demnach die Rakete Nr. 29. Der Code soll verhindern, dass Rückschlüsse auf die Gesamtzahl der produzierten Raketen gezogen werden können.
Unmerklich kroch das Tageslicht in die kalte Stadt. Männer und Frauen verließen ihre Häuser, kniffen die Augen zusammen und schürzten die Lippen gegen den beißenden Wind, eilten durch die grauen Straßen und strebten den warmen, hell erleuchteten Büros, den Läden, Hotels oder Restaurants zu, in denen sie arbeiteten.
Luke hatte kein Ziel. Eine Straße ist wie die andere, wenn keine einem etwas sagt. Kann ja sein, dachte er, ich gehe um die Ecke und weiß auf einmal, wo ich mich befinde. Vielleicht ist es die Straße, in der ich aufgewachsen bin. Oder ich stehe plötzlich vor einem Gebäude, in dem ich mal gearbeitet habe.
Doch jede Straßenecke entpuppte sich als Enttäuschung.
Mit der Zeit wurde es heller, und er konzentrierte sich auf die Menschen, die ihm entgegen kamen. Einer von ihnen konnte sein Vater sein, eine Frau seine Schwester, ein Jugendlicher vielleicht sogar sein Sohn. Er hoffte, irgendjemand möge ihn erkennen, stehen bleiben, ihn umarmen und sagen: »He, Luke, was ist denn mit dir passiert? Komm mit nach Hause, lass dir helfen!« Ebenso gut war es natürlich auch möglich, dass ein Verwandter vorbeikam, ihn erkannte und ihm dennoch die kalte Schulter zeigte. Vielleicht habe ich meine Familie ja in irgendeiner Weise vor den Kopf gestoßen, dachte er, oder sie lebt ganz woanders.
Nein, das brachte alles nichts. Kein Passant fiel ihm mit einem Freudenschrei um den Hals, und auch, dass er urplötzlich die Straße erkannte, in der er gelebt hatte, war nichts als ein frommer Wunsch. Ziellos herumzustreunen und auf einen glücklichen Zufall zu warten, das war keine Strategie. Er brauchte einen Plan. Es musste doch die eine oder andere Möglichkeit geben, seine verlorene Identität wiederzufinden.
Vielleicht liegt eine Vermisstenmeldung über mich vor? Sicher gab es irgendwo eine entsprechende Liste mit Personenbeschreibungen. Wer führte solche Listen? Bestimmt die Polizei.
Er glaubte sich zu erinnern, dass er vor wenigen Minuten erst an einer Polizeiwache vorübergekommen war, und machte auf dem Absatz kehrt. Dabei stieß er unversehens mit einem jungen Mann in einem olivfarbenen Regenmantel und einer dazu passenden Mütze zusammen, von dem er das Gefühl hatte, ihn schon einmal gesehen zu haben. Ihre Blicke trafen sich, und Luke hoffte schon, endlich erkannt worden zu sein, doch da wandte der Mann peinlich berührt den Blick ab und entfernte sich.
Luke schluckte die Enttäuschung hinunter und bemühte sich, den Weg zu finden, den er gekommen war. Das war gar nicht so leicht, denn er war immer wieder mehr oder weniger willkürlich abgebogen und hatte Straßen überquert, wie es ihm gerade eingefallen war. Trotzdem: Früher oder später musste er auf eine Polizeiwache stoßen.
Unterwegs versuchte er, auf eigene Faust Informationen über sich herauszubekommen. Ein großer Mann mit einem grauen Homburg auf dem Kopf zündete sich eine Zigarette an und nahm einen tiefen, befriedigenden Zug. Luke empfand bei diesem Anblick keinerlei Lust auf Tabak. Also bin ich wahrscheinlich Nichtraucher, dachte er. Er sah sich die Autos näher an und stellte fest, dass die rassigen, tief liegenden Modelle, die ihm gut gefielen, neu waren. Er stellte fest, dass er schnelle Wagen mochte und war überzeugt davon, dass er Auto fahren konnte. Außerdem kannte er die meisten Marken- und Modellnamen. Diese Art von Informationen war ihm ebenso erhalten geblieben wie seine englische Muttersprache.
Als er in einem Schaufenster sein Spiegelbild musterte, sah er einen Penner unbestimmbaren Alters. Bei den Passanten fiel es ihm dagegen leicht zu sagen, ob sie in den Zwanzigern oder Dreißigern, in den Vierzigern oder älter waren. Auch fand er heraus, dass er automatisch jeden der Vorübergehenden taxierte: Der ist älter, der ist jünger als ich. Als er darüber nachdachte, ging ihm auf, dass er die Menschen zwischen zwanzig und dreißig generell für jünger hielt und die Vierziger für älter. Also gehörte er selbst irgendwo dazwischen.
Diese ersten kleinen Siege im Kampf gegen die Amnesie erfüllten ihn mit einem ungeheuren Triumphgefühl.
Inzwischen jedoch hatte er sich vollkommen verlaufen. Er befand sich, wie er mit Widerwillen feststellte, in einer heruntergekommenen Straße mit vielen Billigläden: Kleiderläden mit Schaufenstern voller Sonderangebote, Second-Hand-Möbelgeschäfte, Pfandleiher und Lebensmittelhändler, die Essenmarken akzeptierten. Unvermittelt blieb er stehen und sah sich um. Keine zehn Meter hinter ihm stand der Mann im grünen Gabardine-Regenmantel und stierte in ein Schaufenster, hinter dem ein Fernsehgerät lief.
Luke runzelte die Stirn und dachte: Beschattet der mich?
Ein Beschatter war stets allein, trug nur selten eine Aktentasche oder eine Einkaufstüte und erweckte unvermeidlich den Eindruck, als schlendere er ziellos herum, anstatt einem bestimmten Zweck nachzugehen. Der Mann mit der olivgrünen Mütze erfüllte all diese Voraussetzungen.
Aber die Sache ließ sich ja leicht überprüfen.
An der nächsten Kreuzung überquerte Luke die Straße und ging auf der anderen Seite zurück. Am Ende des nächsten Häuserblocks trat er an den Bordstein und sah sich nach beiden Seiten um. Der olivgrüne Regenmantel war zehn Meter hinter ihm. Wieder überquerte Luke die Straße. Um keinen Verdacht zu erregen, besah er sich aufmerksam alle Eingänge, an denen er vorbeikam, als suche er nach einer bestimmten Hausnummer.
Der Regenmantel blieb ihm auf den Fersen.
Luke konnte sich keinen Reim darauf machen, doch in seinem Innern keimte Hoffnung auf. Ein Mann, der ihn verfolgte, musste etwas über ihn wissen – vielleicht kannte er sogar seine Identität.
Um die letzten Zweifel zu beseitigen, musste Luke ein Fahrzeug benutzen und seinen Schatten dazu zwingen, das Gleiche zu tun.
Obwohl er ziemlich aufgeregt war, flüsterte ihm ein distanzierter Beobachter im Hinterkopf zu: »Woher weißt du eigentlich so genau, wie man herausfindet, dass man verfolgt wird?« Der Trick mit dem Fahrzeug war ihm spontan eingefallen, einfach so. Bin ich etwa vor meiner Pennerkarriere Geheimdienstler oder so etwas gewesen, fragte er sich.
Doch darüber konnte er sich später noch Gedanken machen. Was er jetzt vorrangig brauchte, war ein Busfahrschein. In den Lumpen, die er am Leibe trug, steckte nicht ein Cent, doch das war kein Problem. Bargeld gab es überall: in Taschen, in Läden, in Taxis und in Häusern.
Plötzlich sah er seine Umgebung mit anderen Augen: Da waren Zeitungskioske, die man ausrauben, Handtaschen, die man stibitzen und Hosentaschen, in die man greifen konnte. Sein Blick fiel in ein Café, wo ein Mann hinter dem Tresen stand und eine Kellnerin servierte. Ob nun dort oder woanders, es war ihm egal. Er trat ein.
Seine Augen überflogen die Tische. War nicht irgendwo das Wechselgeld liegen geblieben, als Trinkgeld gedacht? Nein, so leicht war es nicht. Er ging zum Tresen. Im Radio liefen die Nachrichten: »Nach Aussagen von Raketen-Experten hat Amerika noch eine letzte Chance, den Vorsprung der Russen im Wettlauf um die Beherrschung des Weltraums aufzuholen.« Der Mann hinterm Tresen brühte gerade einen Espresso auf; aus der spiegelblanken Maschine quoll Wasserdampf. Der köstliche Duft dehnte Lukes Nasenlöcher.
Was würde ein Penner sagen? »Ham Se nich’ ’n alten Berliner für mich?«, fragte Luke.
»Verschwinde!«, gab der Mann grob zurück. »Und lass dich nie mehr hier blicken!«
Luke überlegte, ob er über den Tresen springen und sich über die Registrierkasse hermachen sollte, doch das wäre zu viel Aufwand für einen Busfahrschein.
Dann sah er, was er brauchte. Neben der Kasse und problemlos erreichbar stand eine Büchse mit einem Schlitz auf dem Deckel. Auf dem Etikett war ein Kind abgebildet, und die Bildunterschrift lautete: »Denkt an die Blinden!« Luke stellte sich so, dass sein Körper die Büchse vor den Blicken der Kellnerin und der Gäste abschirmte. Jetzt brauchte er bloß noch den Mann am Tresen abzulenken.