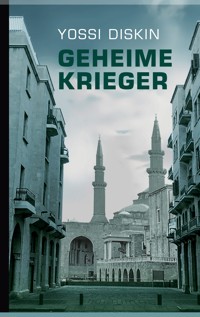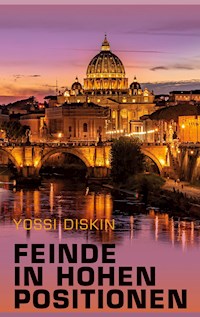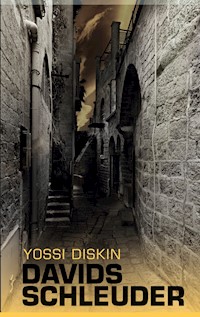
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Avi Halon, ehemaliger Führungsoffizier des israelischen Auslandsgeheimdienstes und berüchtigt für seine unkonventionelle Kreativität, wird mit einer Mission beauftragt, die der Generaldirektor keinem aktiven Agenten zutraut. Er schickt Halon nach Deutschland, um einen vernichtenden Schlag gegen drei libanesische Clans zu führen, die maßgeblich in den illegalen Drogenhandel der Terrororganisation Hisbollah verstrickt sind. Halon führt den Auftrag erfolgreich aus, aber gerade als er nach Tel Aviv zurückfliegen will, wird er mit einer neuen Aufgabe betraut, die noch mehr Kreativität, Intelligenz und Erfahrung erfordert: Sabrina Wallis, die attraktive Kämpferin für mehr soziale Gerechtigkeit, hat die Aufmerksamkeit des Mossad erregt. Julian Tagman, ein junger Düsseldorfer Schriftsteller, den Halon gerade erst auf einer privaten Chanukka-Feier kennengelernt hat, scheint der ideale Kandidat für eine Annäherung an die Zielperson zu sein. Während Halon den Schriftsteller auf seine erste Begegnung mit Sabrina Wallis vorbereitet, stellt der Mossad verstärkt subversive und kriminelle Aktivitäten der iranischen Revolutionsgarde in Deutschland fest. Israelische und jüdische Einrichtungen werden verstärkt ausgespäht, vermutlich für Anschläge an einem Tag X. Offensichtlich existiert eine operative Struktur, von der der Mossad bis jetzt nichts weiß und deren Wurzeln möglicherweise im iranischen Geheimdienst zu suchen sind. Für Halon beginnt eine gefahrvolle Spurensuche, die ihn auf die Fährte eines Phantoms bringt: Idris Abu Salim, ein arabischer Top-Terrorist, an dessen Existenz selbst im israelischen Geheimdienst kaum jemand glaubt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 393
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Dezember
Januar
Februar
März
April
Mai
Dezember
Straßburg – »Te decet hymnus, Deus, in Sion, et tibi redetur votum in Jerusalem.«
Gäbe es einen Nobelpreis für die schönste Stimme, so müsste ihn diese Sopranistin erhalten, schoss es Sabrina Wallis durch den Kopf. Die schöne mandeläugige Europaabgeordnete saß im hinteren linken Seitenschiff des Straßburger Münsters und hatte einen beseelten Ausdruck im Gesicht. Die mächtige Kathedrale erbebte unter den Klängen von Mozarts Requiem. In diesem bedeutendsten Werk des Salzburger Komponisten erschien der Tod als der beste Freund des Menschen. Nichts Erschreckendes, nichts Beängstigendes, sondern etwas Beruhigendes und Tröstendes, sogar etwas Glückseligkeit durchzog diesen Hymnus über das Ende des Menschen.
Sabrina Wallis entstammte einem atheistischen Elternhaus. Sie war überzeugte Marxistin. Die Tatsache, dass sie nicht an einen Schöpfergott glaubte, bedeutete nicht, dass sie nicht tiefster Empfindungen fähig gewesen wäre. Sie wusste nichts über die katholische Liturgie, aber eine noch nicht ganz verschüttete Ebene in ihr fühlte, dass dieses Requiem die Tür zu einer anderen Welt aufschloss – einer Welt, die für sie vollkommen irrational war und vor der sie sich immer verbarrikadiert hatte.
Ihre Welt war die diesseitige Welt. Eine Welt, die sie immer mehr verstehen wollte. Eine Welt, die ihre ganze Intelligenz forderte. Das Ende dieser Welt war in greifbare Nähe gerückt. Der Untergang einer weiteren US-amerikanischen Investmentbank lag gerade mal drei Monate zurück. Der hinterlassene Schuldenberg belief sich auf 200 Milliarden US-Dollar.
Sabrina verdrängte diesen Gedanken umgehend, obwohl sie sich als wirtschaftspolitische Expertin ihrer Partei geradezu zwanghaft mit diesem Thema auseinandersetzen musste. Aber nicht jetzt! Jetzt wollte sie sich ganz auf diese überirdisch schöne Musik einlassen.
»Exaudi orationem meam …« Sabrina Wallis blinzelte, weil sich gegen ihren Willen Tränen in ihren Augen gebildet hatten. »Ad te omnis caro veniet …« Sie schloss die Augen und senkte den Kopf. »Requiem aeternam dona eis Domine …«
Und dann begann sie hemmungslos zu schluchzen.
Während die schöne Kathedrale in jenseitiger Musik schwamm, schwammen Sabrinas schöne Augen in Wasser.
***
Düsseldorf – Julian Tagman lag mit geschlossenen Augen auf dem Sofa in seinem Wohnzimmer. Die Arme hatte er hinter dem Kopf verschränkt. Er befand sich in einer Art Halbschlaf. Als er die Augen wieder öffnete, sah er im Licht der Straßenlaternen Bruchstücke eines bewölkten Himmels zwischen den Zweigen.
In Düsseldorf lag Schnee – ein ganz seltenes Ereignis in der Rheinmetropole.
Julian ließ die letzten Stunden noch einmal an sich vorüberziehen. Heute Nachmittag hatte er seine erste öffentliche Lesung gehalten. In der Mayerschen Buchhandlung. Direkt an der Kö. Eine gute Bekannte hatte ihm diesen Termin verschafft, denn als nahezu unbekannter Schriftsteller hatte man nicht die geringste Chance, eine Lesung in einer der renommiertesten Buchhandlungen Düsseldorfs abzuhalten. Die Rheinische Post hatte diesen Termin vier Tage vorher angekündigt.
Er war unglaublich aufgeregt gewesen. Aber immerhin hatte er fünfundzwanzig Bücher verkauft und signiert. Ein kleiner Sensationserfolg.
Er hatte auch eine neue Bekanntschaft gemacht. Eine bildhübsche schwarzhaarige Literaturwissenschaftlerin, Daria Cohn, hatte sein Buch bereits vor Wochen gelesen und sich sehr für den Autor interessiert. Die beiden hatten ein paar Sätze gewechselt, schnell Sympathie füreinander empfunden und dann zusammen einen Prosecco getrunken. Eine halbe Stunde später hatte sie ihm ihre Nummer gegeben.
Obwohl ihm die Lokalpresse durchaus etwas Anerkennung zuteilwerden ließ, hatte Julian noch keinen echten Bucherfolg vorzuweisen. Wie alle Autoren träumte er vom ganz großen Durchbruch. Der würde auch irgendwann kommen. Dessen war er sich sicher.
Julian war vor zwei Monaten zweiunddreißig geworden. Obwohl er noch sehr jugendlich wirkte und sich auch so fühlte, fand er trotz seines mit Prädikat absolvierten betriebswirtschaftlichen Studiums keine Festanstellung. Seit zwei Jahren lebte er in einer kleinen Dreizimmerwohnung in Düsseldorf-Oberkassel und hielt sich nur mit wagemutiger Börsenzockerei über Wasser. Das Startkapital verdankte er dem frühen Tod seiner Eltern, die ihm ein kleines Vermögen hinterlassen hatten.
Daria ist echt hübsch, keine Frage. Aber sie ist erst dreiundzwanzig. Ausgeschlossen, dass ich mit ihr etwas anfange.
***
Straßburg – Das Requiem war mit einem wahrhaft göttlichen Lux aeterna ausgeklungen. Gewaltiger Applaus brandete auf. Der Chor verbeugte sich, der Dirigent senkte seinen Kopf, und Sabrina Wallis verbarg ihre Hände in den Manteltaschen. Als sich immer mehr Menschen erhoben, um ihre Ovationen stehend darzubringen, blieb Sabrina sitzen. Sie zog ihr Mobiltelefon, das auf Vibrationsalarm gestellt war, aus der Manteltasche und blickte auf das Display. Zwei Nachrichten. Eine von ihrer Mutter, die andere vom Parteivorsitzenden. Sie las sie regungslos. Dann ließ sie ihr Mobiltelefon zurück in die Manteltasche gleiten und erhob sich ebenfalls, um Beifall zu klatschen.
Draußen schneite es heftig. Sabrina überlegte, ob sie ein Taxi rufen sollten. Sie entschied sich für einen Spaziergang, da es nicht weit bis zu ihrem Appartement war. Die Sopranstimme hallte noch immer in ihrem Kopf.
Sie kam an einem kleinen Haus mit einem wunderbar verschneiten Vorgarten vorbei. Entgegen ihrer Gewohnheit blieb sie stehen, um diese Schönheit tief in sich aufzunehmen. Ein kleiner Steinbuddha steckte bis zum Hals im Schnee. Auf seinem Kopf hatte sich ein Schneehäubchen gebildet. Obwohl es viel zu dunkel war, um Details zu erkennen, wurde Sabrina von seinem Anblick berührt. Sie hatte das Gefühl, dass der Buddha sie ansah.
Zehn Minuten später zog sie ihre Schneestiefel aus, klopfte sie kurz ab und schloss dann die Tür zu ihrem Appartement auf. Ihr Tag war noch lange nicht zu Ende. Sie schob eine Pizza in die Mikrowelle und hockte sich dann über ihre Dissertation, die einfach nicht fertig werden wollte.
***
Düsseldorf – Julian Tagman saß gerade über seinen letzten Kontoauszügen, die gar nicht so rosig aussahen, wie er das gern gehabt hätte, als sich sein Mobiltelefon meldete. Eine Kurzmitteilung von Daria Cohn: Ich würde unser Gespräch gern fortsetzen. Hast du Lust? LG, Daria.
Er musste grinsen. Klar. Aber nur, wenn du mir etwas von dem Apfelkuchen deiner Mutter mitbringst.
Gegen Mitternacht ging er zu Bett.
Kurz nach halb eins weckte ihn sein Mobiltelefon: Du bist wirklich ein sehr interessanter Mann. Ich weiß nicht, was es ist, aber irgendetwas zieht mich zu dir hin.
***
Tel Aviv – Avi Halon, ein Haudegen mit stahlgrauem Stoppelhaarschnitt, betrat sein kleines beheiztes Büro im Hadar-Dafna-Gebäude, dem Hauptquartier des israelischen Auslandsgeheimdienstes Mossad an der Glilot-Auto bahnkreuzung. Als ehemaliger katsa (Führungsoffizier) hatte er selbstverständlich keinen Anspruch auf ein eigenes Büro, aber der Generaldirektor hatte bei ihm eine Ausnahme gemacht.
Halon zog seine Lederjacke aus, in der ein verräucherter Geruch nach Winter hing. Er warf die Jacke über den nächstbesten Stuhl und krempelte die Ärmel seines Hemdes bis zu den Ellbogen auf. Zwei muskulöse, stark behaarte Unterarme wurden sichtbar. Dann setze er sich an seinen Schreibtisch, fuhr den Rechner hoch und durchforstete die aktuellen Meldungen: Iran, Libanon, Syrien … Deutschland.
Deutschland. Das Land, dessen Sprache er perfekt beherrschte.
Deutschland. Das Land, in dem seine Mutter, eine Überlebende der Schoah, geboren und verfolgt worden war. Eine Mutter, die ihn von Kindesbeinen an gelehrt hatte, die deutsche Sprache zu lieben und sie perfekt zu beherrschen.
Ein Mann in den Mittdreißigern und kahlrasiertem Schädel erschien in der halb offen stehenden Tür und räusperte sich. Yossi Gewirzman, katsa in der Pariser Residentur, hielt in beiden Händen einen Pott mit dampfendem Kaffee.
Halon blickte nicht einmal auf.
Offiziell war der Kontakt oder die Verbindung von Ehemaligen mit Aktiven verboten, aber bei Halon machte man eine Ausnahme. Er hatte die Linie zwischen Legende und Mythos längst überschritten. Er war ein Denkmal. Der Mossad war nach wie vor die erste Familie des Staates, und solange die Arbeit, die Halon selbst als Ehemaliger leistete, hervorragend war und den Segen des Generaldirektors hatte, war alles bestens.
Gewirzman betrachtete zwei Sekunden lang das verlebte Gesicht des ehemaligen katsas. Die zehn Zentimeter lange Narbe, die von Halons rechtem Wangenknochen bis zu seinem Kinn verlief, war das Andenken an ein Himmelfahrtskommando im Libanon vor zwanzig Jahren. Mit seinem stahlgrauen Stoppelhaarschnitt und seinen kalten blaugrauen Augen sah er kein Jahr jünger aus als er war.
»Danke für den Kaffee«, sagte Halon.
Gewirzman stellte den Kaffee auf dem Schreibtisch ab. »Wäre ich in der Lage, Mitgefühl zu empfinden, würde mich dein Aussehen geradezu irritieren«, sagte er. »Identitätskrise?«
»Wahrscheinlich«, sagte Halon und lachte rau. In Wirklichkeit war ihm gar nicht zum Lachen zumute. Gewirzman war zwanzig Jahre jünger als er und befand sich auf dem Höhepunkt seiner Karriere.
»Wie alt bist du eigentlich?«, fragte der jüngere katsa.
»Pass bloß auf, dass ich dir keine reinhaue«, erwiderte Halon. »Im Juli werde ich vierundfünfzig.«
»Ja und? Du heißt eben nicht Ehud Barak. Nicht jeder katsa befehligt mit dreißig eine Operation Caesarea, wird anschließend Generalstabschef, Minister und schließlich Ministerpräsident. Auch wenn du nicht mehr im aktiven Dienst bist, ist deine Erfahrung hier sehr gefragt. Warum bist du eigentlich nicht wie alle anderen Ehemaligen in die freie Wirtschaft oder zumindest zu Black Cube gegangen?«
Black Cube war ein privater Informationsdienst ehemaliger Mitarbeiter israelischer Geheimdienstbehörden wie Aman, Mossad und Shabak sowie Rechts- und Finanzexperten.
Halon überhörte die Frage.
Sie wussten beide, dass die Blütezeit eines katsas zwischen fünfundzwanzig und vierzig lag. Allerhöchstens fünfundvierzig. Halon war die extreme Ausnahme. Er hatte noch im Alter von achtundvierzig Jahren einen Einsatz im Iran befehligt, bevor er aus dem aktiven Dienst ausgeschieden war.
»Findest du deine Arbeit nicht hinreichend gewürdigt?«, fragte Gewirzman.
»Doch.«
»Und warum machst du dann so ein beschissenes Gesicht?«
»Weil dies ein Scheißjahr für mich war, Yossi.« Halon sah zum ersten Mal von seinem Rechner auf. »Ich habe noch nie in meinem Leben so viel Geld an der Börse verloren wie in diesem Jahr.«
»Das ist allerdings ein großes Kunststück, denn die letzten zwölf Monate liefen an der Börse geradezu fantastisch.«
Avi Halon war wie fast alle Mitarbeiter des Mossad rechtskonservativer Gesinnung. Demzufolge hatte er auch noch nie etwas anderes gewählt als das rechte Wahlbündnis Likud. Und dem Likud konnte man nicht gerade nachsagen, dass er sozialistisches Gedankengut pflegte. Aber die ungezügelte und extrem verantwortungslose Zockerei auf den internationalen Geldbühnen hätte in den vergangenen Wochen fast zum Zusammenbruch einiger Volkswirtschaften geführt. Zum ersten Mal in seinem Leben empfand er gegenüber dem kapitalistischen System so etwas wie Feindschaft.
»Außerdem wird mich meine Scheidung ein Vermögen kosten«, fügte er hinzu.
»Darüber mach dir mal keine Sorgen. Deine Scheidung bezahlt das Büro aus seiner schwarzen Kasse«, sagte Gewirzman.
»Wie kommst du darauf?«
»Ben-Zvi liebt dich wie seinen eigenen Sohn, und der memuneh hört auf ihn.«
»Wenn du meinst.«
»Du bist wahrscheinlich der erste katsa in der langjährigen Geschichte des Büros, der es nicht zum Millionär gebracht hat.«
»Weil ich mir noch einen Funken Ehrgefühl bewahrt habe, du Arschloch.«
»Ich weiß. Und gerade das schätzt der Boss so an dir. Du hast fast alle Operationen mit Brillanz ausgeführt, sonst hätten sie dir hier kein eigenes Büro eingerichtet.«
»Ich versteh mich halt nicht so gut auf das Erpressen ehrbarer Bürger.«
Gewirzman überhörte diese Anspielung. »Seit wann bist du eigentlich dabei?«, fragte er.
»Meine Ausbildung begann vor ziemlich genau dreißig Jahren.«
»Kaum zu glauben. Und unter wie vielen Generaldirektoren hast du gedient?«
Halon nahm einen Schluck aus seinem Pott. Der heiße Kaffee tat ihm gut. »Unter sechs: Nahum Admoni, Shabtai Shavit, Danny Yatom, Efraim Halevy, Meir Dagan und Tamir Pardo. Als Dagan ging, wollte ich auch gehen, bin dann aber doch noch zwei weitere Jahre geblieben. Kurz darauf fragte mich der memuneh, ob er mir hier ein Büro einrichten dürfte.«
Memuneh war der interne Titel des Mossad-General direktors. Aktuell hatte dieses Amt der siebenundfünfzigjährige Ron Dahan inne.
Yossi Gewirzman zog lakonisch die Schultern hoch. Dann reichte er dem Älteren einen Stapel zusammengehefteter Blätter, die er unter dem Arm geklemmt hatte. »Sag mir, was du davon hältst.«
Halon überflog die Seiten. »Was ist damit?«
»Der Entwurf eines Memos an den memuneh.«
»Das seh ich. Seit wann schreiben wir Memos direkt an den memuneh und nicht an den Chef der Operationsabteilung? Was soll ich damit?«
»Ben-Zvi ist zweiundsiebzig. Vielleicht hält der memuneh gerade Ausschau nach einem geeigneten Nachfolger. Tu mir bitte einen Gefallen und sag mir, was du davon hältst!«
Halon sah ihn jetzt mit demselben Blick an, mit dem er neulich die Jerusalemer Studentin taxiert hatte, die Gewirzman gelegentlich vögelte. Gewirzman hatte sie ihm vorgestellt. Obwohl er verheiratet war, sah er keinen Grund, seine Affäre mit Michal Galil – so hieß das Mädchen – vor Halon geheim zu halten. Innerhalb des Mossad wusste ohnehin jeder, was der andere tat.
»Wenn du mich so kritisch beäugst, siehst du aus wie Zohar Argov, dieser beschissene Schmalzsänger«, nörgelte Gewirzman.
»In meinem Stammbaum gibt‹s keine beschissenen mizrahim, merk dir das!«, konterte der ehemalige katsa mit einem Anflug von beleidigt sein. »Aber vielleicht ist diese Ähnlichkeit darin begründet, dass wir beide an einem 16. Juli geboren wurden.«
»Es beeindruckt mich immer wieder aufs Neue, wie du dir jedes Geburtsdatum merken kannst. Wie viele Geburtstage hast du eigentlich im Kopf?«
»Tausende.«
»Feierst du deinen hebräischen oder deinen weltlichen Geburtstag?«
»Den weltlichen.«
»Der memuneh feiert immer seinen hebräischen.«
»Der stammt ja auch aus einer Rabbinerfamilie. Jetzt komm endlich zum Punkt. Erzähl mir, worum es in deinem Memo geht.«
Gewirzman nahm einen Schluck aus seinem Kaffeepott. Dann wandte er sich von Halons Schreibtisch ab, ging zum Fenster und sah auf das morgendliche Tel Aviv hinunter. »Es geht um den internationalen Drogenhandel der Hisbollah. Ich weiß sehr genau, wie sie in Frankreich arbeiten, aber Deutschland ist eins ihrer wichtigsten Zentren. Deshalb brauche ich dich«, sagte er schließlich.
Zehn Minuten später war Avi Halon über die Grundzüge einer Operation informiert, die Gewirzman dem Generaldirektor im Laufe des Tages vorschlagen würde.
***
Straßburg – Für Sabrina Wallis war es wieder mal eine der üblichen Pflichtveranstaltungen. Sie musste Präsenz zeigen, war aber mit ihren Gedanken ganz woanders. Sie betrat den Plenarsaal in einem eleganten schwarzen Hosenanzug, und ihr schwarzes Haar war wie immer hochgesteckt. Ihre aparte Erscheinung lenkte wie so oft die Blicke sämtlicher männlichen Parlamentarier auf sich. Das wusste sie natürlich, aber es interessierte sie nicht wirklich, denn rund neunzig Prozent ihrer Gedanken kreisten ausschließlich um ihre Karriere. Aktuell spielte sie mit dem Gedanken, bei nächster Gelegenheit wieder für den Stellvertretenden Parteivorsitz zu kandidieren. Ihr letzter Versuch im Mai dieses Jahres war durch die Intervention zweier mächtiger Herren gescheitert. Aber sie wusste, dass ihre Zeit kommen würde.
Während gerade der Wirtschaftsexperte der Grünen im EU-Parlament ans Rednerpult trat, nahm Sabrina auf ihrem angestammten Sitz im hinteren Teil des Plenarsaales Platz. Vor ihr lagen ein Notizblock, ein Kugelschreiber und ihr auf lautlos gestelltes Mobiltelefon. Während sie noch das Für und Wider einer Kandidatur abwog, ergriff sie den Kugelschreiber und begann zu kritzeln … Nein, sie kritzelte nicht, sie zeichnete. Sie zeichnete eine wunderschöne Winterlandschaft mit einem Buddha. Das ausgeprägte Talent zum Zeichnen war nur eine der vielen Eigenschaften, die sie von ihrer Mutter geerbt hatte.
***
Tel Aviv – Ron Dahan, der Generaldirektor des Mossad, saß in einem blütenweißen Hemd und wie immer ohne Krawatte hinter seinem beeindruckenden Schreibtisch, einer endlos weiten Rauchglasfläche, die, abgesehen von einem Computer und zwei Telefonen, leer war. Er trug eine Brille mit Spezialgläsern, die keinerlei Licht reflektierten, damit niemand sehen konnte, was er gerade las. Er betrachtete den Mann, der soeben sein Büro betrat, mit dem desillusionierten Blick eines Menschen, der schon viele unschöne Dinge gesehen hatte. An der Wand über seinem Schreibtisch hing das Wappen des Mossad, eine von zwei Olivenzweigen umrahmte Menora. An der Wand rechts neben der Tür hing ein Foto des Ministerpräsidenten.
»Shalom, Avi«, begrüßte er den Besucher.
»Shalom.«
»Setzen Sie sich bitte.«
Halon nahm vor dem Schreibtisch des Generaldirektors Platz.
»Danke, dass Sie sich bereiterklärt haben, den Job zu übernehmen. Andernfalls hätte ich Dani damit betrauen müssen, und das hätte ich nur sehr ungern getan. Ich wollte Sie, weil Sie über mehr Einfallsreichtum verfügen als Dani.«
Dani Gerstein war der katsa in ihrer Berliner Residentur.
»Ich bin, ehrlich gesagt, stolz, dass ich diese Operation leiten darf.« In Wirklichkeit kannte Halon natürlich den wahren Grund, weshalb die Wahl auf ihn gefallen war. Falls etwas schiefgehen würde, hatte der Mossad nichts damit zu tun, schließlich war er ein Ehemaliger.
»Freuen Sie sich nicht zu früh.«
»David Ben-Gurion sagte mal: Das Schwierigste wird sofort erledigt, das Unmögliche dauert etwas länger. Ich wurde nie in einen Feldeinsatz geschickt, wenn ein Erfolg wahrscheinlich war. Ich kam immer dann zum Einsatz, wenn die Erfolgsaussichten gleich Null waren.«
Der Generaldirektor, der zuvor als Nationaler Sicherheitsberater des Premierministers gedient hatte und diesen höchsten Posten, den der Mossad zu vergeben hatte, erst seit zwei Jahren innehatte, nickte ausdruckslos. »Sie mussten immer die Letzte Ölung geben, kurz bevor der Patient starb.«
»Wie viele Männer stehen mir zur Verfügung?«
»Vier.«
»Alles kidonim?«
»Ja. Alles Männer aus der komemiute.«
Die komemiute war eine topgeheime Organisation innerhalb des Mossad. Ihr operativer Arm – der kidon – war für Exekutionen und Entführungen verantwortlich.
»Wie viel Zeit steht mir zur Verfügung?«
»Ich wünsche, dass wir den Fall spätestens Mitte Januar zu den Akten legen können.«
Halon nickte.
»Haben Sie Yossis Memo gelesen?«, fragte der memuneh.
»Ja.« Halon unterließ es zu erwähnen, dass er selbst dem Memo seinen Feinschliff verpasst hatte.
»Dann wissen Sie, um wie viele Zielpersonen es sich handelt.«
»Ja, dreiundsiebzig. Eine Operation in diesem Ausmaß haben wir noch nie ausgeführt.«
»Ich weiß, aber der Drogenhandel der Hisbollah hat ein Ausmaß angenommen, dem wir kaum noch gewachsen sind. Ich möchte dieser Brut einen Schlag verpassen, der in die Geschichte eingeht. Keiner darf überleben.« Der Generaldirektor fixierte ihn mit seinem Raubtierblick. »Die Hisbollah verfügt in Deutschland über ein ausgefeiltes Warnsystem. Wenn man eine Ratte liquidiert, werden die übrigen Ratten sofort unsichtbar. Man muss sie deshalb alle gleichzeitig ausschalten.«
»Ich lasse mir etwas einfallen.«
Als Halon das Büro des Mossad-Chefs verließ, war er mit seinen Gedanken bereits bei der bevorstehenden Operation. Ihm war klar, dass diese Operation, so schwierig ihre Ausführung auch werden würde, nur eine winzige Facette in einem viel größeren Kanon von hochkomplexen Operationen war, die sich alle nur um Israels Todfeind Nr. 1, den Iran, drehten.
Er ging zurück in sein Büro, setzte sich an den Schreibtisch und schloss die Augen. Spontanes Handeln war selten effektiv. Bevor er sich mit den kidonim – alles hochprofessionelle und passionierte Killer zwischen zwanzig und dreiundzwanzig – treffen würde, musste er selbst erst mal eine Vorstellung davon haben, wie er die neue Aufgabe angehen sollte.
Es ging um die Liquidierung von dreiundsiebzig libanesischen Drogenhändlern in Deutschland. Wenn alles glattging, würde dies einen erheblichen Medienrummel verursachen, aber es durfte nicht der leiseste Verdacht auf den Mossad fallen.
Die schiitische Hisbollah finanzierte ihren Terror gegen Israel und jüdische Einrichtungen nicht nur durch beträchtliche Finanzspritzen des iranischen Mullahregimes, sondern hauptsächlich durch weltweite Drogen- und Waffengeschäfte.
Insbesondere der Iran und seine Verbündeten – Hisbollah und Hamas – nutzten zur Finanzierung ihrer Terroraktivitäten internationale Netzwerke, um verschiedene Institute und Organisationen wie Banken, Wohltätigkeitsfirmen und Hilfsorganisationen für ihre Zwecke zu missbrauchen. Um terroristische Geldnetzwerke aufzuspüren, hatte der ehemalige Generaldirektor Meir Dagan Scheinfirmen gegründet, um besonders Hisbollah- und Hamasfunktionäre zu täuschen, die dort Gelder aus dem Drogenhandel anlegten – bis das Geld plötzlich verschwand. Beim Gaza-Krieg 2014 war diese Strategie besonders erfolgreich. Der Mossad deckte illegale Barzahlungen an die Hamas auf, und das israelische Militär zerstörte daraufhin die Übergabe mit einer gezielten Aktion. Ohne das Geld konnte die Terrororganisation den Kampf nicht aufrechterhalten und bat 48 Stunden später um einen Waffenstillstand.
In Deutschland war die Hisbollah sehr stark.
Die amerikanischen Drogenermittler der Drug Enforcement Administration (DEA), die das weltweite Drogengeschäft der Hisbollah frühzeitig hätten ausheben können, scheiterten, weil sie bereits ab dem Jahre 2008 von der Obama-Regierung regelmäßig ausgebremst wurden. Obwohl die DEA-Agenten schon 2011 Nachweise über die Geldwäsche in Höhe von fünfhundert Millionen US-Dollar gesammelt hatten und darüber hinaus über Beweise gegen die wichtigsten Hintermänner verfügten, wurden sie von der Obama-Regierung gestoppt, angeblich um ein besseres Verhältnis zum Terrorregime von Teheran und zu vermeintlich »moderaten Elementen« der Hisbollah aufzubauen. Als weiterer Grund wurde ab 2015 angegeben, man wolle das Atom-Abkommen mit dem Iran »nicht gefährden«.
Ab dieser Zeit und unter dem Schutz der israelfeindlichen Obama-Regierung entwickelte sich die Hisbollah von einer paramilitärischen Organisation mit regionaler Bedeutung zu einem weltweit operierenden kriminellen Konzern, der Milliarden mit den gefährlichsten Geschäften der Welt umsetzte, darunter Programme zur Herstellung chemischer und nuklearer Waffen.
Der Mossad behielt diese Entwicklung die ganze Zeit über sorgfältig im Auge. Er wusste, dass die libanesische Drogenmafia in Deutschland sehr stark vertreten war und ihre Leute bei der Polizei, der Bundeswehr und sogar in einigen Landeskriminalämtern eingeschleust hatte.
Die Informationen, die die deutschen Dienste lieferten, waren nicht immer zuverlässig. Das war aber nicht weiter schlimm, weil der Mossad längst deren Codes geknackt hatte. Überhaupt waren die Deutschen bei Fällen dieser Art nicht immer kooperativ. Ihr Hauptproblem war, dass sie eine starke Neigung hatten, Terroristen vor ein irdisches Gericht zu zerren, wo sie bereits nach kurzer Zeit wieder auf freien Fuß kamen, anstatt sie gleich dorthin zu befördern, wo sie hingehörten – ins Jenseits.
Die Zeit, als ihn der Fanatismus und Israelhass der Hisbollah noch wütend machte, war für Avi Halon längst Vergangenheit. Gefahr erkennen, Krallen ausfahren, Ziel liquidieren – das war das Motto, nach dem man mit Terroristen, die die Sicherheit jüdischer und israelischer Bürger gefährdeten, zu verfahren hatte und dem hier praktisch jeder nachging.
Die letzten heftigen Auseinandersetzungen mit seiner Frau Sara kehrten plötzlich in seinen Kopf zurück. Er wollte sie verdrängen, aber es gelang ihm nicht. Um sich von ihnen zu befreien, brauchte er eine Operation, die ihn stark forderte. Der bevorstehende Einsatz in Deutschland kam ihm deshalb gerade recht.
***
Düsseldorf – »Wo gehst du hin?«, fragte ihre Mutter.
Frau Cohn betrachtete argwöhnisch ihre Tochter, die sich vor dem großen Spiegel im Foyer noch einmal die Lippen nachzog.
»Ich treffe mich mit dem Schriftsteller.«
»Mit welchem Schriftsteller?«
»Julian Tagman. Ich hab dir doch von ihm erzählt, aber du hörst ja nie zu.«
»Aber der ist doch ein Goi!«
»Ja, er ist ein Goi. Aber ein höchst interessanter.«
»Und wie alt ist er, wenn ich fragen darf?«
»Du darfst aber nicht fragen.«
»Ist es ein etwas reiferer Herr?« Sie schüttelte ungläubig den Kopf. »Warum triffst du dich nicht mit den jungen Männern aus unserer Gemeinde?«
»Ach, Muttchen.« Daria steckte ihren Lippenstift zusammen und ließ ihn in ihre Handtasche gleiten. »In zwei Wochen ist Chanukka, da werde ich diese langweiligen Heiratskandidaten, an denen dir so viel liegt, alle auf einmal sehen. Aber bis dahin möchte ich mich noch ein wenig mit einem Mann amüsieren, der mich auch intellektuell fordert.«
»Du hast den gleichen Dickkopf wie dein Vater.«
Daria lachte. Dann nahm sie ihre Mutter in den Arm und drückte sie. »Ciao.«
»Wann kommst du zurück?«
»Nicht allzu spät. Wir gehen nur was essen.«
»Wo denn?«
»Wir gehen in Die Kurve – koscher essen.«
»Gut. Dann wünsche ich euch viel Spaß«, rief ihr Frau Cohn, mehr besorgt als erleichtert, hinterher.
Daria steuerte das Parkhaus an, das der Goebenstraße am nächsten lag. Als sie den freien Parkplatz sah, bog sie schnell ein. Glück gehabt! Denn es war nicht einfach, in der Vorweihnachtszeit einen Parkplatz in Düsseldorf zu ergattern.
Sie stieg aus und hörte eine Stimme hinter sich.
»Daria?«
Sie fuhr herum.
Es war Julian.
»Hey! Das nenn ich mal präzises Timing!«, rief sie und strahlte.
»Ja, in der Tat.«
Sie waren praktisch gleichzeitig ins Parkhaus gefahren.
Daria erschien ihm diesmal noch anziehender als am Sonntag. Mit ihrem glatten schwarzen Haar und den schwarzen Augen, ihrem schwarzen Mantel und der schwarzen Tasche wirkte sie wie jemand, der sich bewusst älter und reifer machen wollte.
Sie zog ihren rechten Handschuh aus und gab ihm die Hand.
Zum ersten Mal fiel ihm die schöne Wölbung ihrer Wangenknochen auf.
Sie setzten sich in Bewegung. Schöne Augen, schöne Beine.
In dem Restaurant Die Kurve wurden sie an einen reservierten Tisch geführt. Julian nahm ihr den Mantel ab und ging damit zur Garderobe. Dann hängte er seinen Mantel neben den ihren.
»Und? Schon das nächste Buch in Planung?«, fragte sie, als er ihr gegenüber Platz nahm.
»In Planung habe ich noch nichts. Aber ich habe gerade meinen zweiten Politthriller beendet, für den ich jetzt erst mal einen Literaturagenten begeistern muss. Das wird vermutlich nicht so einfach.«
»Ja, ich weiß. Ohne einen renommierten Agenten sind die Chancen zur Publikation bei einem renommierten Verlag gleich Null.« Sie lächelte. »Du machst das schon.«
Die Bedienung trat an ihren Tisch und reichte ihnen die Speisekarte.
»Ich brauch jetzt erst mal was zum Aufwärmen«, sagte Daria und schlug die Karte auf.
»Dann sollten wir mit einer heißen Suppe beginnen.«
»Einverstanden. Und dazu grünen Tee?«
»Sehr gern.«
Eine Stunde später waren sie sich deutlich näher gekommen. Zum Hauptgericht hatten sie einen leichten Weißwein vom Golan getrunken. Daria hatte einen Schwips. Sie lächelte ihn oft an. Es war ein warmes, hübsches Lächeln, und er sah, dass ihre Augen gar nicht schwarz waren, sondern dunkelbraun. Sie wusste inzwischen auch, dass er eine besondere Sympathie für Israel hegte. Geahnt hatte sie es bereits aufgrund des Buches, das er veröffentlicht hatte, aber im Laufe des Abends bekam sie darüber Gewissheit.
»Kennst du Chanukka?«, fragte sie.
»Natürlich. Das jüdische Lichterfest.«
»Hast du es schon mal gefeiert?«
»Nein.«
»Möchtest du?«
»Klar, sehr gern.«
»Ich lad dich ein!«
»Wow!«
Draußen wehte ein eisiger Wind. Daria vergrub ihre Hände in den Manteltaschen und zog fröstelnd die Schultern hoch. Im Parkhaus sah sie ihn dann mit einem Blick an, der eindeutig auf eine Fortsetzung dieses schönen Abends hoffen ließ. Dann küsste sie ihn zum Abschied flüchtig auf den Mund.
***
Nördlich von Tel Aviv – Der nüchtern eingerichtete Besprechungsraum befand sich im Erdgeschoss eines zweigeschossigen weißen Backsteingebäudes auf einem kleinen Hügel nördlich von Tel Aviv. Offiziell war es die Sommerresidenz des Premierministers, in Wirklichkeit handelte es sich um das Ausbildungszentrum des israelischen Auslandsgeheimdienstes. Insider nannten dieses Gebäude einfach Ha-Midrasha – die Akademie. Gemäß seinem Motto Mit den Mitteln der Täuschung sollst du Krieg führen weihte der Mossad hier sowohl die jungen Kadetten als auch die erfahrenen Agenten in die Geheimnisse der subtilen Kriegsführung ein.
Avi Halon war gerade dabei, den vier kidonim die Grundzüge der Operation vorzustellen.
»Ihr wisst, dass man diesen Hunden nicht trauen kann. Niemals!« Er hatte sich in Rage geredet.
Während die vier kidonim andächtig den Worten ihres hoch dekorierten Führungsoffiziers lauschten, tobte sich Halon regelrecht aus.
»Schlimmer noch als diese Hunde sind die liberalen Scheißer in unserem eigenen Land. Die wollen immer nur verhandeln. Wann werden diese Wichser endlich begreifen, dass man mit diesen Hunden nicht verhandelt!«
David Talbergs Augen blitzten zustimmend auf. Der zweiundzwanzigjährige Scharfschütze fand, dass der Chef genau den richtigen Ton getroffen hatte.
»Wir werden ihnen eine Lektion erteilen, die sie niemals vergessen werden«, fuhr Halon fort. »Wir werden ihre Nester komplett ausheben, damit es ihre Auftraggeber in Beirut ein für alle Mal begreifen. Die werden uns nicht weiter auf der Nase herumtanzen.«
David Talberg hob seine rechte Hand.
»Ja?«
»Normalerweise werden Operationen dieser Art wochenlang in unserem Ausbildungslager in der Negev eingeübt. Straßen und Wohnungen werden so realistisch wie möglich nachgebaut. Warum nicht bei dieser?«
»Weil uns die Zeit fehlt. Weil die Regierung bis Mitte Januar ein Ergebnis sehen will.«
David nickte – aber keineswegs aus Zustimmung. Bei dieser Operation würde alles anders sein. Das wusste er. Und davor hatte er auch etwas Angst. »Wann geht‹s los?«, fragte er.
»Ich fliege in der nächsten Woche nach Deutschland, um vor Ort weitere Informationen einzuholen. Sobald ich mir sicher bin, dass mein Plan funktioniert, kommt ihr nach und wir legen die Details der Operation fest. Treffpunkt ist unser sicheres Haus in Düsseldorf … Dieser Einsatz wird all das von euch verlangen, was ihr eintrainiert habt – Geschwindigkeit, Reaktionsvermögen, Mut und gegenseitige Deckung.«
Die kidonim nickten zustimmend.
***
Düsseldorf – Die drei Tage, in denen sie ihn nicht gesehen hatte, waren Daria wie eine Ewigkeit vorgekommen. Unter dem Vorwand, bei einer Tasse Kaffee über neue Strömungen in der deutschen Literatur zu diskutieren, wobei sie natürlich beide wussten, dass dies nur ein Vorwand war, klingelte sie kurz nach halb vier an seiner Haustür.
Als er ihr öffnete, wurde er von ihrer Schönheit geradezu überwältigt. Er hatte den Eindruck, dass sie von Mal zu Mal schöner wurde.
Während er ihr den Mantel abnahm, um ihn über einen Bügel in der Garderobe zu hängen, fragte sie: »Kann ich meine Stiefel ausziehen?«
Bevor er etwas erwidern konnte, öffnete sie den Reißverschluss ihrer Stiefel und streifte sie ab.
Sie trug eine eng sitzende schwarze Hose und eine tief ausgeschnittene pinkfarbene Bluse, die ihre kugelrunden Brüste perfekt zur Geltung brachte. Ein verschwenderisch teurer Duft umwehte sie.
»Komm rein«, sagte er. »Zur Begrüßung gibt‹s ein Glas Champagner, okay?«
»Okay.« Sie strahlte ihn an.
Er führte sie ins Wohnzimmer. Im Hintergrund lief Lounge Musik.
Neugierig und mit schnellen Blicken alles taxierend, sah sie sich um.
Julian entschwand in die Küche, um eisgekühlten Champagner und zwei Gläser zu holen.
»Ah, mein Lieblingschampagner«, sagte sie, als er ihr die Flasche Veuve Cliquot zeigte.
»Ist auch mein Lieblingschampagner.«
»Hübsch hast du‹s hier«, sagte sie, während er die Gläser füllte. »Wo schreibst du? Ich möchte wissen, wo du deine Bücher schreibst.«
»Mein Arbeitszimmer ist nebenan.«
»Komm, zeig‹s mir. Du weißt, wir Frauen sind unglaublich neugierig.«
Julian nahm die gefüllten Gläser und ging voran. Daria lief ihm auf Strümpfen hinterher.
Sein Arbeitszimmer war aufgeräumt. Während ihr Blick langsam an den prallgefüllten Bücherregalen, die vom Boden bis zur Decke reichten, entlang schweifte, stellte er die Gläser auf dem Schreibtisch ab und setzte sich auf die Schreibtischkante, um ihr dabei zuzusehen.
Dann drehte sie sich plötzlich zu ihm um. Ihre Augen waren verschleiert wie die einer Katze, die während des Schlafs sanft die Augen öffnet. Sie kam auf ihn zu und blieb direkt vor ihm stehen. Er blieb auf der Schreibtischkante sitzen, berührte sie mit der Hand kurz unterm Kinn und zog sie dann sanft zu sich herunter. Sie schloss die Augen, und er küsste sie. Ihre Lippen waren unglaublich weich.
Sie knöpfte langsam sein Hemd auf. Als sie beim untersten Knopf angelangt war, zog sie sein Hemd aus der Hose und liebkoste seine Brust mit den Händen, indem sie sanft darüber fuhr.
Dann lächelte sie ihn an – so zärtlich, dass er eine Gänsehaut bekam. Wortlos ergriff er die beiden Gläser und reichte ihr eins.
Sie stießen an und tranken ein paar Schlucke. Niemand sprach ein Wort.
Als Daria ihr Glas abstellte, stellte er sein Glas ebenfalls ab. Dann öffnete er die Knöpfe ihrer Bluse und zog sie schließlich ganz aus. Sie griff mit beiden Händen hinter sich und öffnete den Verschluss ihres BHs, so dass er ihr nur noch die Träger abstreifen musste. Ihre Brüste waren zwei perfekt geformte Kugeln mit kleinen dunkelbraunen Brustwarzen, die ganz hart geworden waren.
Sie streichelten und küssten sich noch eine Weile, dann konnten sie sich beide nicht länger zurückhalten. Sie glitten hinunter auf das flauschige Fell und liebten sich.
Daria blieb bis Mitternacht bei ihm, sehr zur Sorge ihrer Mutter. Und am nächsten Morgen erhielt Julian bereits um halb acht eine Kurzmitteilung von ihr: Können wir uns jetzt bitte noch mal sehen? Ich sehne mich so sehr nach deinen zärtlichen Händen auf meiner Haut.
***
Berlin – Ein Angehöriger der Israelischen Botschaft hatte Halon gegen elf Uhr vom Flughafen Berlin-Tegel abgeholt. Bevor der Fahrer in die Auguste-Viktoria-Straße im Stadtteil Grunewald einbog, sah Halon bereits aus großer Entfernung die beiden mit lebhaftem Grün patinierten Kupferdächer, die vor dem knallblauen Berliner Winterhimmel regelrecht aufleuchteten. Rechts befand sich die für Empfänge und als Residenz umgebaute Villa, links davon der Botschaftsneubau. Das israelische Außenministerium hatte mit dem Botschaftsgebäude seinerzeit die Komplexität und Symbolik, die eine Repräsentanz des jüdischen Staates im geeinigten Berlin bedeutet, zum Ausdruck bringen wollen. Und die israelische Architektin Orit Willenberg-Giladi hatte die Vorstellungen des Auftraggebers geradezu perfekt umgesetzt.
Sie fuhren gerade an der Front des neuen Kanzleigebäudes vorbei, das durch sechs steinerne Pylone gebildet wurde – jeder Pylon stand für jeweils eine Million jüdischer Opfer des NS-Regimes –, als das Mobiltelefon des Fahrers klingelte: »Wo bleibt ihr denn?«, fragte ein Stimme auf Hebräisch.
»Zwei Minuten noch«, lautete die knappe Antwort des Fahrers. Kurz darauf passierte der Wagen die scharfen Kontrollen und fuhr hinunter in die Tiefgarage. Von dort waren es nur wenige Meter bis zu der unterirdischen Berliner Residentur des Mossad.
Dani Gerstein, ein Hüne von Mann mit scharfen Gesichtszügen, rötlichem Haar und breiten Schultern, war der in Deutschland residierende katsa. Er bekleidete den Rang eines Obersten und war dreiunddreißig Jahre alt.
»Shalom, Avi«, begrüßte er seinen Kollegen.
»Shalom, Dani.«
»Ziemlich heikle Operation, wie?«, scherzte er.
»Ja, aber nicht unmöglich.«
Sie kamen an einem Raum vorbei, dessen Tür offen stand. Halon erkannte vier junge Techniker. Er nickte ihnen kurz zu. Dann betraten sie einen kleinen Besprechungsraum mit einem runden Tisch, auf dem eine Kanne mit frischem Kaffee stand.
»Wie lange wirst du bleiben?«, fragte Gerstein, nachdem er ihnen zwei Tassen Kaffee eingeschenkt hatte.
»Hängt davon ab, wie gut ihr gearbeitet habt. Der memuneh will den Fall spätestens Mitte Januar zu den Akten legen.«
»Ja, habe ich schon gehört«, sagte Gerstein. »Weil ihm der Ministerpräsident im Nacken sitzt. Wir werden auch alles tun, um seine Wiederwahl im nächsten Jahr zu sichern. Du weißt, was passiert, wenn die linken Scheißer an die Macht kommen. Als erstes gehen sie uns an den Kragen.
»Bis dahin ist noch reichlich Zeit.«
»Ja, aber wir planen weit vor. Du weißt vermutlich, dass diese kleine Scheißnummer mit der Hisbollah nur der Auftakt für etwas viel Größeres ist.«
»Kann ich mir denken.«
»Nachdem wir mit Obama nichts als Ärger hatten, haben wir jetzt einen wahren Freund Israels im Weißen Haus sitzen. Und das nutzen wir natürlich aus. Und wir passen sehr gut auf ihn auf, damit ihm nichts zustößt.« Gerstein grinste breit.
Halon musste ebenfalls grinsen, als er aus Gersteins Mund das Wort »Freund« vernahm. Das erste, was ein angehender Führungsoffizier während seiner Ausbildung lernte, war der Satz: »Wenn du mit deinem Freund zusammensitzt, sitzt er nicht mit seinem Freund zusammen. Alles ist Feind, nichts ist Freund. Merkt euch das ein für alle Mal.«
***
Düsseldorf – Erev Chanukka – der Vorabend des jüdischen Lichterfestes.
Julian wusste inzwischen, wo seine kleine Freundin wohnte.
Die Villa der Cohns gefiel ihm – zumindest von außen, denn noch hatte er keinen Fuß hineingesetzt. Der Vorgarten war groß und glitzerte im winterlichen Zauber. Darias Eltern verfügten zweifellos über einen erlesenen Geschmack. Heute würde er sie kennenlernen.
Er stand vor dem großen gusseisernen Portal und klingelte. Augenblicke später öffnete sich in der Ferne die Haustür. Dann ein kurzes Surren. Das gusseiserne Portal sprang auf. Daria stand in der Haustür und rief ihm zu: »Komm bitte rein, es ist kalt!«
Julian trat durch das Tor, das sich sofort hinter ihm schloss. Dann ging er über den gepflasterten Weg zu ihr.
»Hi«, sagte sie zur Begrüßung. Sie fiel ihm um den Hals. »Meine Eltern sind schon vorgefahren. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit.« Sie fasste ihn an der Hand und zog ihn in den nächstgelegenen Salon.
Dann streifte sie ihre Kleidung ab.
»Was wird das denn?«, fragte er.
»Ich hab gerade Lust. Fick mich bitte. Es ist nicht schlimm, wenn wir etwas später kommen.«
Julian musste grinsen. Er zog sich ebenfalls aus und bekam sofort eine Erektion.
»Nimm bitte keinerlei Rücksichten auf mich. Fick mich einfach nur hart durch, dann komme ich am schnellsten«, sagte sie.
Daria kam rasend schnell, und für Julian war es der schnellste Quickie seines Lebens.
Sie gingen gemeinsam ins Bad, machten sich frisch und saßen kurz darauf in seinem Wagen.
»Bist du jetzt schockiert?«, fragte sie.
»Nein.«
»Ich brauchte es einfach«, sagte sie und zündete sich eine Zigarette an.
»Ist schon okay.«
»Was bist du eigentlich für ein Sternzeichen?«
»Waage. Und du?«
»Zwillinge. Waage und Zwillinge passen hervorragend zusammen.«
Julian lachte.
***
Eintrittskarten gab es natürlich schon seit Wochen nicht mehr. Die Jüdische Gemeinde in Düsseldorf zählte rund siebentausendfünfhundert Mitglieder. Davon hatten rund tausendfünfhundert Personen Interesse an der Teilnahme bekundet. Da es aber nur zweihundertfünfzig Karten gab, musste man entweder ganz fix sein oder die Karten einem anderen abkaufen. Natürlich zu einem gepfefferten Aufpreis. Nichtsdestotrotz war es Darias Vater gelungen, für den Begleiter seiner Tochter eine Karte zu ergattern.
Sie gaben ihre Mäntel an der Garderobe ab und präsentierten dem Türsteher ihre Eintrittskarten.
Der Gemeindesaal war riesig, aber nicht so repräsentativ, wie Julian es dem feierlichen Anlass gemäß erwartet hatte. Die runden Tische waren mit blütenweißen Tischdecken überzogen und groß genug, um acht Personen bequem Platz zu bieten.
»Komm, wir suchen meine Eltern«, sagte Daria.
Sie hatte ihre Mutter schnell gefunden. Sie stand mit drei weiteren Frauen in der Mitte des Saales und erging sich mit ihnen in Smalltalk. Frau Cohn war eine füllige jüdische Mama von vielleicht fünfzig Jahren mit drallen Oberschenkeln und riesigen Brüsten. Ihre Haare waren blondiert, und ihr rosiges Gesicht strahlte echte Lebensfreude aus.
Als Julian ihr vorgestellt wurde, musterte sie ihn kritisch, aber ihr Gesicht hellte sich schnell auf, denn er war ihr auf Anhieb sympathisch.
»Wo ist Papa?«, frage Daria.
Frau Cohn sah sich um. »Er sitzt da drüben. Ich weiß aber nicht, ob du ihn jetzt stören kannst.«
»Keine Sorge, das kann ich … Komm!«, sagte sie zu Julian.
Efraim Cohn saß mit einem weiteren Mann zusammen. Sie hatten die Köpfe zusammengesteckt, als gelte es etwas auszuhecken. Efraim Cohn hatte diesen Mann zuletzt vor zehn Jahren gesehen. Er kannte ihn nur als einen gewissen Dr. Yoram Katz, Professor für Zeitgeschichte an der Universität von Tel Aviv, aber er konnte sich denken, dass das nicht der wahre Name dieses Mannes war. Yoram Katz war eine Autorität, dessen Identität man einfach nicht hinterfragte.
Efraim Cohn war seit vielen Jahren ein sayan, ein unbezahlter freiwilliger jüdischer Helfer des israelischen Auslandsgeheimdienstes. Sayanim gab es in fast jedem Land der Erde. Sie unterstützten Mossad-Agenten heimlich mit Geld und Unterkünften, wenn diese gerade einen Einsatz in ihrem Land hatten und der heimlichen Hilfe bedurften. Das Wort »Mossad« hatte Herr Cohn noch nie in den Mund genommen. Wenn überhaupt, dann benutzte er nur das Wort misrad, »Büro«.
Zehn Jahre war es jetzt her, dass sich die beiden Männer zum letzten Mal gesehen hatten. Katz hatte damals eine schwierige Operation in Deutschland geleitet. Es war gleichzeitig seine letzte Operation in Deutschland gewesen. Efraim Cohn wunderte sich, dass sich Yoram Katz nach so langer Zeit wieder bei ihm gemeldet hatte.
»Ah, da ist ja meine Tochter!«, rief er plötzlich aus, als Daria in Begleitung eines gut aussehenden Mannes auf ihn zukam.
Cohn und Katz erhoben sich aus ihren Sesseln, und man machte sich miteinander bekannt.
»Geht doch schon mal zu unserem Tisch, wir haben die Nummer Vier«, sagte Cohn schließlich. »Professor Katz und ich haben noch etwas zu besprechen. Wir sitzen ja ohnehin gleich alle zusammen.«
Der Mann, mit dem der sehr distinguiert wirkende Vater von Daria zusammensaß, hatte Julian auf Anhieb Respekt eingeflößt. Er hatte eine sehr militärische Ausstrahlung, vielleicht war er Professor an einer Militärakademie. Die große Narbe in seinem Gesicht sprang ihm sofort ins Auge. Wie war noch mal sein Name? Ach ja, Katz. Katz‹ Deutsch war fehlerfrei, aber er hatte eine raue Stimme und einen starken ausländischen Akzent. »Kennst du den Mann?«, fragte er Daria.
»Nie gesehen«, bekannte diese wahrheitsgemäß und wunderte sich etwas, weshalb sich Julian überhaupt für diesen Mann interessierte. Dann stellte sie ihm zwei ihrer Freundinnen vor. Rachel und Liliana.
Gegen siebzehn Uhr, etwa zwanzig Minuten nach shkiat hachama, also kurz nach Sonnenuntergang, wurde es feierlich. Denn jetzt begann nach dem jüdischen Kalender offiziell der 25. Kislev – jener Tag, an dem sich das Tempelwunder ereignet hatte, das die Juden seit mehr als zweitausend Jahren jeweils acht Tage lang im Gedenken an das heilige Öl, das acht Tage lang im Tempel gebrannt hatte, feierten.
Die Gemeindemitglieder hatten inzwischen an den Tischen Platz genommen und blickten bewegt auf den Rabbiner, der sich soeben der chanukkia, dem neunarmigen Leuchter, genähert hatte. Der Rabbiner entzündete zunächst den shamash – das war die etwas erhöht stehende Kerze in der Mitte. Dann nahm er den shamash aus der Halterung, sprach feierlich die drei brachoth, also die drei Segenssprüche, die dem Anzünden der ersten Kerze vorangehen mussten, und entzündete das erste Licht.
Applaus brandete auf.
Der Rabbiner hielt eine kurze Ansprache, in der er betonte, dass Chanukka die Gedenkfeier für heroische Taten war, die in der Weltgeschichte kaum ihresgleichen fanden. »Eine kleine Schar, von nationaler Begeisterung durchglüht, wirft einen zehn- und zwanzigfach überlegenen Feind nieder, befreit das Land von der Fremdherrschaft, welche alles jüdische Volkstum und alle jüdische Gotteserkenntnis zu vergewaltigen und auszurotten trachtete. Vom Judentum wird gesagt: ›Ich habe Dich gemacht zur Völkerverbindung, zum Lichte der Nationen.‹ Wie viel hat unser Volk nicht zur Verbrüderung und Erleuchtung der Nationen beigetragen und wie hat man es ihm gelohnt! Ein jüdischer Dichter vergleicht unser Volk mit dem shamash, jenem kleinen Licht, mit welchem all die übrigen Chanukka-Lichter angezündet werden. Alle haben von ihm ihr Licht empfangen und trotzdem nennt man dieses Licht verächtlich den Knecht und weist ihm seinen Platz in irgendeinem Winkel zu, nicht in der Reihe der übrigen Lichter …«
Bevor die Speisen serviert wurden, nahm Herr Cohn einen der auf dem Tisch liegenden Dreidel in die Hand und fragte Julian, ob er wisse, was das sei.
»Papa!«, wurde er von seiner Tochter sofort ermahnt. »Julian weiß mehr über die jüdischen Bräuche als die meisten Juden!«
Herr Cohn hob ungläubig die Augenbrauen.
Julian lächelte. »Die griechischen Syrer, die damaligen Besatzer, hatten das Lehren und Lernen der Torah zu einem Verbrechen erklärt, das mit der Todesstrafe oder mit Gefängnis zu bestrafen war. Aber die jüdischen Kinder trotzten diesem Verbot und lernten insgeheim weiter. Sobald syrische Patrouillen auftauchten, taten sie so, als spielten sie ganz unschuldig Dreidel. Jeder der vier Seiten eines Dreidels zeigt einen anderen hebräischen Buchstaben: Nun, Gimmel, He und Shin. Sie stehen für den Satz ›Nes gadol haja sham‹, das heißt: ›Ein großes Wunder ist dort geschehen‹. Diese Beschriftung des Dreidels findet allerdings nur in der Diaspora Verwendung. In Israel zieren den Dreidel die Buchstaben Nun, Gimmel, He und Pe, das heißt: ›Nes gadol haja po‹, also ›Ein großes Wunder ist hier geschehen‹.«
Herr Cohn spitzte die Lippen.
»Sprechen Sie Iwrit?«
»Nur ein wenig. Für eine Verständigung mit Israelis reicht es leider nicht.«
»Aber Israel kennen Sie.«
»Ich denke schon. Sofern es meine Finanzen erlauben, bin ich dort, wo mein Herz schlägt. Ich war schon mit sechzehn das erste Mal in Israel, und in den letzten fünf Jahren bin ich bestimmt zwei Mal pro Jahr in Israel gewesen. Die ganze Atmosphäre, die dieses wunderschöne Land versprüht, war ideal für mein Buch.«
»Ja-ja-ja-ja«, meldete sich Frau Cohn zu Wort, »Sie schreiben Bücher. Daria erzählte davon. Schreiben Sie direkt über Israel?«
»Jein … Ich schreibe Politthriller. Natürlich geht es da auch um den Nahen Osten. Leider habe ich erst ein Buch veröffentlicht.«
»Was nicht ist, kann noch werden«, sagte Herr Cohn.
»Ich gebe dir sein Buch zu lesen, Papa«, meinte Daria. »Es ist wirklich großartig.«
»Gern.«
»Und sein zweites Buch ist bereits fertig. Julian sucht nur noch einen Verlag.«
Die Kellner trugen die Speisen auf.
Avi Halon, den die hier Anwesenden nur unter dem Namen Professor Dr. Yoram Katz kannten, hatte die ganze Zeit über aufmerksam zugehört. Er hatte den Eindruck, an diesem Abend sehr viel zu lernen. Als sich die Runde zu später Stunde auflöste, behielt er folgendes im Gedächtnis: Julian Tagman war bei all seiner Bescheidenheit ein profunder Israelkenner und ohne jeden Zweifel ein Freund des jüdischen Volkes. Aber vor allem war er ein Experte in der anschaulichen Darstellung von wirtschaftlichen Zusammenhängen.
»Haben Sie eine Visitenkarte für mich?«, fragte er. »Ich würde Sie gern mal nach Israel einladen. Und vor allem brauche ich von Ihnen ein paar gute Aktientipps.«
Julian öffnete seine Brieftasche und reichte ihm seine Karte. Im Gegenzug erhielt er die Karte von Dr. Yoram Katz, Professor für Zeitgeschichte an der Universität von Tel Aviv.
Am nächsten Tag googelte Julian den Namen von Professor Katz. Die Website der Universität von Tel Aviv war in englischer und hebräischer Sprache verfasst. Professor Katz war demnach eine Koryphäe. Aktuell hatte er sein Sabbatical, eine kleine Auszeit.
***
Berlin-Karlshorst – Das Europäische Parlament in Straßburg hatte längst die Weihnachtsferien eingeläutet. Die meisten EU-Abgeordneten entspannten sich bereits im Kreise ihrer Familie oder waren vor einer Woche in wärmere Gefilde geflüchtet.
Für Sabrina Wallis gab es keine Ferien. Ihre Dissertation absorbierte jede freie Minute. So auch heute.
Vor einem Monat war ein neues Buch von ihr erschienen.
Eine brillante ökonomische Analyse über die Ursachen der Finanzkrise und deren wahre Zusammenhänge. Das Buch war brandaktuell, und Sabrina hatte es meisterhaft verstanden, auch die kompliziertesten Sachverhalte anschaulich darzustellen. Wie durch höhere Fügung bewirkt, war es genau zum richtigen Zeitpunkt erschienen.
Die Weltfinanzkrise, von der die Fachleute überzeugt waren, sie würde noch Jahre andauern, hatte offiziell am 15. September 2008 mit dem Zusammenbruch der US-amerikanischen Investmentbank Lehmann Brothers begonnen. Danach kamen viele Jahre einer trügerischen Erholung, während derer sich die Masse in Sicherheit wog. Aber in Fachkreisen überwog längst die Überzeugung, dass der finale Finanzcrash umso schlimmer werden würde, je länger er auf sich warten ließe. Aber der Crash war weder 2016 noch 2017 gekommen. Vielleicht käme er in diesem Jahr, vielleicht aber auch erst in fünf Jahren. Aber wie dem auch war – es war Sabrina Wallis, die in ihrem Buch auch vernünftige Perspektiven aufzeigte.
Um halb sieben klingelte ihr Wecker. Sie war sofort hellwach, sie hatte ohnehin einen leichten Schlaf. Auf dem Weg ins Bad kam sie an ihrem Notebook vorbei, das sie entgegen ihren sonstigen Gepflogenheiten die ganze Nacht über angelassen hatte. Hastig überflog sie die Absender der neu eingegangenen Mails – fast alles Mails von Parteigenossen. Sie würde sie später lesen.
Sie machte Licht im Bad und betrachtete sich kritisch im Spiegel. Sie fand, dass sie in letzter Zeit ein leicht verhärmtes Gesicht bekommen hatte. Es war einfach das Übermaß an Arbeit, das niemand lange durchhalten konnte. An diesem Morgen war es wohl besser, wenn sie niemand zu Gesicht bekam. Einerseits schmeichelten ihr die Medienphrasen von ihrer Schönheit, andererseits waren genau sie der Grund, weshalb sie sich ausgesprochen konservativ kleidete. Denn nichts war der Karriere so abträglich wie der Neid der Genossen.
Morgen war Heiligabend. Wie in all den Jahren zuvor, würde sie auch in diesem Jahr ihre Mutter besuchen. Ihr fiel ein, dass sie noch kein Weihnachtsgeschenk hatte.
Unter der Dusche dachte sie daran, dass Weihnachten ein Fest war, das sie immer gern gefeiert hatte. Sie war zwar nicht religiös geprägt, aber Weihnachten und Ostern waren für sie Feiertage, die immer eine wichtige Rolle gespielt hatten. Es waren Familienfeiern. Man traf sich und saß in fröhlicher Runde zusammen. Weihnachten war ein Fest, auf das man sich – vor allem, als sie noch ein Kind gewesen war – immer freute. Nicht nur der Geschenke wegen, sondern weil es Tradition war und damit zur Kultur gehörte.