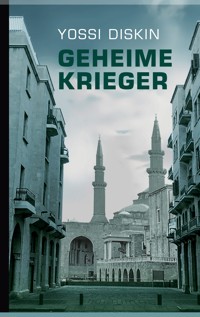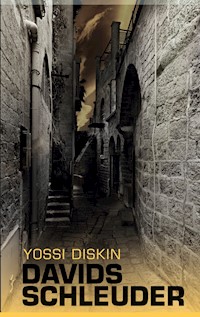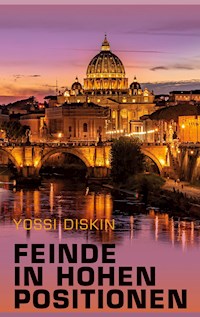
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Anlässlich eines interreligiösen Treffens zwischen einem Rabbiner und einem katholischen Erzbischof auf der Insel Malta findet ein heimtückischer Bombenanschlag auf das Institut für interreligiösen Dialog statt. Der Erzbischof und sein Sekretär werden dabei getötet, der Rabbiner kommt mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus und ringt mit dem Tod. Eine Gruppierung, die noch nie zuvor in Erscheinung getreten ist, übernimmt die Verantwortung für das Attentat. Da das Institut für interreligiösen Dialog vom Mossad als sicheres Haus genutzt wurde und stark gesichert war, rätselt man in Tel Aviv, wie der Sprengsatz in das Gebäude gelangen konnte. Avi Halon, Führungsoffizier des Mossad, wird in die maltesische Hauptstadt geschickt, um verdeckte Nachforschungen anzustellen. Für Halon beginnt eine gefahrvolle Spurensuche, die ihn über homosexuelle Priester, eine katholische Geheimgesellschaft und einen maltesischen Auftragskiller schließlich zum "Schwarzen Monarchen" führt. Je tiefer er in den Fall eindringt, desto unglaublichere Ausmaße nimmt das Komplott an ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 360
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Juli 2019
August 2019
Nachwort
Juli 2019
Valletta, Malta – Montag, 15. Juli. Wer in Valletta, der Hauptstadt der Mittelmeerinsel Malta, die legendäre Merchant Street hinabschlendert, läuft schnell an der engen und unscheinbaren Magdalene Lane vorbei. Diese Gasse ist in keiner Straßenkarte verzeichnet, was beabsichtigt ist, und auf Google Maps wurde sie schon vor Jahren unkenntlich gemacht. An der Eingangstür des Gebäudes Nummer 17 verkündet ein kleines Messingschild, dass hier das Institut für interreligiösen Dialog untergebracht ist. Wer das Institut besuchen möchte, muss vorher einen Termin vereinbaren und benötigt zumindest ein Empfehlungsschreiben. Eingelassen wird nur, wer zuvor die von einer obskuren Firma aus Tel Aviv installierte hochempfindliche Sicherheitsschleuse passiert hat. Aktenkoffer und Handtaschen werden von zwei jungen Herren mit pedantischer Effizienz durchsucht. Der eine heißt Gadi, der andere Shaul.
Sobald der Besucher die Sicherheitsschleuse erfolgreich passiert hat, wird er in einen geräumigen, hell erleuchteten und angenehm kühlen Raum geführt, in dem sich zwischen wandhohen Bücherregalen, ein großer Schreibtisch, zwei exklusive braune Ledercouchen und ein schwerer runder Tisch mit einer weinroten Samtdecke befinden. Im hinteren Teil des Raumes führt ein Korridor zu den Toiletten und zu dem Raum, in dem Gadi und Shaul arbeiten.
Der Mann, der hier arbeitet, heißt Dr. Yonah Melman und ist offiziell Rabbiner. Er trägt einen gestutzten weißen Bart, ist unscheinbar gekleidet und die meiste Zeit in Zigarettenqualm gehüllt. Manche vermuten, er habe Eheprobleme, andere glauben, er sei leicht verrückt. Die Wahrheit ist: Kaum jemand weiß, wer er wirklich ist.
Sobald ein ranghoher Würdenträger einer anderen Religionsgemeinschaft zu Gast ist, bietet er ihm eine der bequemen Couchen und einen Kaffee an. Außer Hörweite streiten Gadi und Shaul dann darum, wer ihn servieren muss. Gadi ist ein reformierter Jude aus New York, intellektueller als Shaul und deshalb etwas geduldiger. Shaul ist ein Orthodoxer aus Jerusalem und betrachtet es als unter seiner Würde, Nichtjuden Kaffee zu servieren. Seine Gedanken kreisen mehr um die richtige Erfüllung der Mitzvot zum Laubhüttenfest, das erst in drei Monaten stattfinden wird. Er ist der festen Überzeugung, dass die Juden seit Generationen einem Fehler aufsitzen und das Gebot des Feststraußes mit den vier Arten von Zweigen für das Laubhüttenfest nicht richtig erfüllen, denn die aravot, von denen die Torah spreche, seien nicht Zweige des niedrigen Bachweidenstrauches, sondern die des Eukalyptusbaumes. »Bei der arava, der Bachweide, ist der Stil rot und das Blatt länglich mit glattem Rand, bei der zafzafa ist der Stil weiß und das Blatt rund mit sichelartigem Rand.« Gadi verdreht bei solchen Spitzfindigkeiten regelmäßig die Augen, hört aber immer geduldig zu.
Es gibt aber ein Thema, das Shaul in richtige Erregung versetzt. Das ist die Unwissenheit der israelischen Jugend über die wahre Berufung eines Juden. Die israelische Jugend glaube nämlich, die Kernaufgabe eines Juden sei es, den Gedanken des Liberalismus in der Welt zu verbreiten. Dies sei eine riesengroße Täuschung und ausschließlich auf das schlechte säkulare Bildungssystem zurückzuführen. In Wirklichkeit bestehe die Hauptaufgabe eines Juden darin, die zehn Gebote zu verkünden, die HaShem dem Moshe überreicht hat.
Rabbi Melman hält sich bei seinen Besprechungen mit Würdenträgern anderer Religionen an kein festes Schema. Er hat auch nichts dagegen, Fragen über sich selbst zu beantworten, und falls der Besucher nicht locker lässt, erklärt er ihm auch, wieso er sich so vehement für den interreligiösen Dialog engagiert. Seine Bereitschaft, über seine Vergangenheit zu sprechen, hat allerdings ihre Grenzen. So erzählt er dem Besucher nicht, dass er ab den Siebzigerjahren, kurz nach dem Yom-Kippur-Krieg, bis in die Neunzigerjahre für den berüchtigten israelischen Geheimdienst gearbeitet hat. Oder dass er regelmäßig nach Israel fliegt und eine streng bewachte geheime Einrichtung nördlich von Tel Aviv aufsucht, um einige seiner Tricks an die nächste Generation weiterzugeben. Einer seiner besten Freunde, Aryeh Ben-Zvi, ebenfalls wie Melman dreiundsiebzig Jahre alt und aktuell der Chef der Operationsabteilung, pflegt zu sagen, Yonah Melman könne verschwinden, während er einem die Hand schüttelt.
Im Umgang mit Gästen ist Melman still, genau wie er bei den Männern, die er für Ben-Zvi und dessen Vorgängern aufzuspüren hatte, still vorgegangen war. Er spricht mehrere Sprachen und hört seinem Gast in derjenigen Sprache zu, die dieser bevorzugt.
***
An diesem heißen Julivormittag saß Melman wie jeden Tag bereits seit drei Stunden über einen riesigen Stapel Akten gebeugt. Er klappte die Mappe zu, sah auf die Uhr auf seinem Computerbildschirm und ging dann über den Korridor zu dem kleinen Raum, in dem die jungen Männer arbeiteten. »Es ist bereits zehn nach zehn. Für wann hatte sich der Erzbischof angekündigt?«
»Für zehn Uhr«, erwiderte Gadi. »Vielleicht steckt er im Stau.«
Im selben Moment tauchte auf einem der sechs Überwachungsmonitore das Bild eines schwarzen Fiats auf. Kurz darauf entstiegen ihm ein großgewachsener, schlanker Mann mit rosiger Gesichtsfarbe und ein etwas kleinerer Mann mit einer Aktentasche unterm Arm. Ersterer war der katholische Würdenträger, dessen Besuch Melman erwartete, der andere war sein Sekretär. Beide im Priesterhabit.
Der Fahrer des Fiats wartete, bis die Geistlichen geklingelt hatten und ihnen geöffnet worden war. Dann brauste er davon.
Erzbischof Karl Maria Wegener und sein Sekretär passierten, wie jeder andere Besucher auch, die Sicherheitsschleuse und ließen sich dann akribisch von Gadi und Shaul abtasten. Die Aktentasche, die der Sekretär nur widerwillig aus der Hand gab, wurde sorgfältig durchsucht und zusätzlich geröntgt, bevor er sie zurückerhielt. Dann wurden die Herren in einen angenehm kühlen Raum geführt, wo Rabbi Melman sie herzlich willkommen hieß.
Rabbi Melman hatte dem Dossier, das er noch rechtzeitig aus Tel Aviv erhalten hatte, bereits entnommen, dass Erzbischof Wegener kein Hebräisch und nur ein rudimentäres Englisch sprach. Deshalb bot er ihm umgehend an, die Konversation auf Deutsch zu führen, ein Angebot, dass der katholische Würdenträger erleichtert annahm.
Nachdem man sich gegenseitig vorgestellt und auf den Ledercouchen Platz genommen hatte, sagte der Erzbischof: »Ich darf Ihnen zunächst die Segensgrüße und guten Wünsche des Heiligen Vaters überbringen. Der Heilige Vater ist, wie er mir persönlich versicherte, sehr mit unserer Arbeit zufrieden. Die Gläubigen haben verstanden, dass die Religionsverschiedenheit keine Rechtfertigung für Gleichgültigkeit oder Feindschaft ist. Im Gegenteil, vom Glauben her können wir zu ›Handwerkern‹ des Friedens werden und bleiben nicht länger träge Zuschauer des Übels von Krieg und Hass. Die Religionen dienen dem Frieden und der Geschwisterlichkeit.«
Während Melman dem aufgeblasenen Wortschwall gerade zustimmen wollte, klingelte es ein zweites Mal. Sein Blick wanderte schnell zu dem Überwachungsmonitor hoch, der über dem Kopf des Erzbischofs hing. Befriedigt nahm er zur Kenntnis, dass es ein brauner UPS-Wagen war. Dieser brachte das dringend erwartete Paket aus Tel Aviv.
Gadi und Shaul eilten zur ersten gepanzerten Tür, tippten auf einem Tastenfeld neben dem Ausgang den Berechtigungscode ein, zogen die innere Tür auf und betraten dann die Sicherheitsschleuse. Dort mussten sie einige Sekunden warten, ehe sie die zweite, ebenfalls gepanzerte Tür öffnen konnten, um den Empfang des Paketes abzuzeichnen. Gemäß den strengen Vorschriften des Büros kontrollierten sie die Echtheit des Absenders und röntgten das Paket anschließend. Nachdem sie keinerlei Sicherheitsbedenken hatten, trugen sie das Paket in den großen Raum und legten es geräuschlos auf Melmans Schreibtisch ab.
Bei dem heutigen Gespräch zwischen Erzbischof Wegener und Rabbi Melman ging es im Wesentlichen um die Vorbereitung des interreligiösen Treffens in Rom im Oktober 2020.
»Wie Sie wissen, sind es bis dahin noch fünfzehn Monate«, begann der Erzbischof, »aber angesichts der Komplexität der Thematik …«
Rabbi Melman ließen diese Fragen rund um den interreligiösen Dialog vollkommen kalt, aber weil er ein exzellenter Schauspieler war, spielte er das Spiel gekonnt mit. Das Büro interessierte sich weniger für den interreligiösen Dialog als für die geheime Politik, die sich dahinter verbarg. Ganz besonders aber interessierte es sich für den Erzbischof. Denn Erzbischof Karl Maria Wegener war jemand, der sich beim klar erkennbaren Linkskurs des aktuellen Pontifikats zu Recht große Chancen auf die Kardinalswürde ausrechnete.
»Haben die Herren vielleicht Lust auf ein Eis?«, fragte Melman unvermittelt.
Der Erzbischof hob verwundert eine Augenbraue. Angesichts der Bedeutung der zu besprechenden Themen empfand er diese weltliche Frage geradezu als Plattheit und Respektlosigkeit.
»Haben Sie denn Eis hier?«
»Nein, aber wir haben schräg gegenüber ein hervorragendes italienisches Eiscafé, vielleicht das Beste von ganz Valletta.«
»Nun gut.« Ein mildes Lächeln huschte über das Gesicht seiner Exzellenz. »Dann hätte ich gern eine Kugel Schokoladeneis.«
Der Sekretär hob zaghaft einen Finger. »Ich hätte gern das Gleiche.«
»Eine gute Entscheidung«, befand Melman. »Einen Moment bitte, ich schicke einen von den Jungs.«
Mit diesen Worten erhob sich der Rabbiner und ging zum anderen Ende des Raumes, wo ein schmaler Korridor zu dem relativ kleinen Arbeitszimmer führte, in dem Gadi und Shaul ihrer Arbeit für das Büro nachgingen. Als Melman die Tür öffnete, fiel sein Blick sofort auf den großen Plasmabildschirm. Er kannte das Gesicht des Mannes auf dem Bildschirm nur zu gut. Seine Jungs befanden sich gerade in einer Arbeitssitzung mit dem für Südeuropa zuständigen katsa. Da konnte er unmöglich stören.
Wortlos schloss er die Tür.
»Ich gehe selbst«, sagte er, als er zum Erzbischof und dessen Sekretär zurückgekehrt war. »Entschuldigen Sie mich bitte.«
Die Räume des Instituts für interreligiösen Dialog zu verlassen, war fast so schwierig wie sie zu betreten. Auf dem Tastenfeld neben dem Ausgang tippte Melman eine Zahlenkombination ein. Sowie der Summer ertönte, zog er die innere Tür auf und trat in die Sicherheitskammer. Die äußere Tür ließ sich erst öffnen, wenn die innere Tür zehn Sekunden lang geschlossen gewesen war.
Melman drückte das Gesicht an die Panzerglasscheibe und spähte hinaus.
Am Ende der Gasse stand ein untersetzter, muskulöser und tätowierter Mann in schwarzem T-Shirt und schwarzer ausgeblichener Jeans. Bis auf einen kurzgeschnittenen schwarzen Haarkranz war er kahl. Der Mittdreißiger trug eine Schildpattbrille mit runden Gläsern.
Yonah Melman konnte nicht auf den Straßen Vallettas unterwegs sein, ohne automatisch zu kontrollieren, ob er beschattet wurde, und sich alle Gesichter zu merken, die zu häufig in zu vielen unvereinbaren Situationen auftauchten. Selbst aus der Ferne wusste er, dass er die Gestalt auf der anderen Straßenseite in den letzten Tagen mehrmals gesehen hatte.
Er durchsuchte sein Gedächtnis, wie ein Bibliothekar einen Karteikasten durchblätterte. Und er wurde dreimal fündig.
Melman drehte sich um und drückte die Taste der Sprechanlage. Kommt schon, Jungs. Er drückte erneut, dann blickte er über die Schulter. Die tätowierte Gestalt war verschwunden.
Aus dem Lautsprecher drang die Stimme von Gadi. »Was ist passiert?«
Melman drückte die Sprechtaste noch einmal. »Kommt sofort raus! Sagt das auch den beiden Geistlichen! Sofort!«
Sekunden später erschienen Gadi, Shaul und die beiden Geistlichen in seinem Blickfeld. Sie waren aber noch durch die Wand aus Panzerglas von ihm getrennt. Gelassen gab Gadi den Sicherheitscode ein. Die anderen drei standen wortlos hinter ihm.
Später konnte sich Melman nicht daran erinnern, die Detonation gehört zu haben. Gadi, Shaul und die beiden Geistlichen wurden von einem Feuerball eingehüllt, dann von der Druckwelle mitgerissen. Die Eingangstür wurde nach draußen geblasen, Melman wie ein Spielzeug hochgehoben und durch die Luft gewirbelt. An den Aufprall konnte er sich nicht erinnern. Er wusste nur, dass er in einem Hagelsturm aus zersplittertem Glas auf dem Rücken lag. Dann wurde ihm schwarz vor Augen.
***
New York City – Dienstag, 16. Juli. Es ist kurz nach Mitternacht. Der Mann auf dem Rücksitz des gelben Taxis hat ein Gesicht, das man nicht so schnell vergisst. Die zehn Zentimeter lange Narbe, die von seinem rechten Wangenknochen bis zu seinem Kinn verläuft, ist das Andenken an ein Himmelfahrtskommando im Libanon vor zwanzig Jahren. Mit seinem stahlgrauen Stoppelhaarschnitt und seinen kalten blaugrauen Augen sieht er kein Jahr jünger aus als er ist. Daran ändert auch der maßgeschneiderte dunkelblaue Anzug nichts, den er bei Giorgenti hat anfertigen lassen und der ihm noch rechtzeitig für das Abendessen mit seiner Tochter ins Hotel gebracht worden war. Sein Name ist Avi Halon. Er ist Führungsoffizier des israelischen Auslandsgeheimdienstes. Er hat sich ein paar Tage frei genommen, um mit seiner zweiundzwanzigjährigen Tochter Ronit seinen 55. Geburtstag in den USA zu feiern.
Während ihn das Taxi jetzt zum Ritz-Carlton zurückbringt, kreisen seine Gedanken um seine Tochter und um die Gespräche, die er an diesem Abend mit ihr geführt hat.
Sie hatten in einem der besten New Yorker Restaurants gespeist und sich anschließend an der Bar noch einen hinter die Binde gekippt. Sie hatten sich die ganze Zeit über sehr gut und tiefgründig unterhalten. Halon hatte befriedigt zur Kenntnis genommen, dass seine Tochter ihm im Hinblick auf die ganzen Vorbehalte, die er schon frühzeitig gegenüber einem Studium in den USA geäußert hatte, in allen Punkt Recht gegeben hatte. »Du hast wie immer Recht gehabt«, hatte sie gesagt. »Mit dieser Studentengeneration haben die USA keine Zukunft. Als ich mich in Yale einschrieb, hatte ich keine Ahnung, wie schlimm es werden würde. Die Professoren und die Studenten sind dermaßen links, dass ich mir ernsthaft überlege, alles hinzuschmeißen.« »Und dann?«, hatte er sie gefragt. »Ich möchte zurück zum Militär und eine soldatische Laufbahn einschlagen.« »Als was?« »Als Mitarbeiterin des Nachrichtendienstes der Armee. Vielleicht in einer geheimen militärischen Aufklärungseinheit.« Halon hatte daraufhin nur genickt. Da Israelis immer sagen, was sie wirklich denken, braucht man keine Mutmaßungen anzustellen. Ronit würde also in die Heimat zurückkehren. Je früher dies geschah, desto besser war es für sie. Denn er wusste genau, was die USA erwartete. Früher oder später.
Ronit, eine Schönheit mit langem, braunem, welligem Haar und warmen braunen Augen, studierte Political Science an der Yale Universität in New Haven, Connecticut. Sie hatte bereits während ihres einundzwanzigmonatigen Militärdienstes bei den Bodentruppen den Wunsch geäußert, Politische Wissenschaften in den USA zu studieren, aber ihr Vater war strikt dagegen gewesen. Er hatte ihr auch den Grund genannt: »Ronit, hör mir gut zu! Es gibt zwei große jüdische Gemeinden in der Welt: die amerikanische und die israelische. Die Mentalitätsunterschiede zwischen diesen beiden Gruppen könnten nicht größer sein. Die amerikanischen Juden sind überwiegend linksliberal, sie wählen die korrupten Demokraten, lesen linke Zeitungen wie die New York Times und die Washington Post und sind in der Mehrzahl israelkritisch eingestellt. Mich regt dieser latente Antizionismus der amerikanischen Juden schon seit Jahren auf, und ich möchte nicht, dass du irgendwann mal von diesen Ideen infiziert wirst. Du bist eine waschechte tzabar, und ich will, dass das so bleibt.«
Halon war von Anfang an gegen Ronits Studium in den USA gewesen, denn fast alle amerikanischen Universitäten waren extrem linksindoktriniert. Dennoch hatte er ihrem Herzenswunsch schließlich nachgegeben. Wie die meisten israelischen Eltern hatten er und Sara – die Frau, von der er inzwischen geschieden war – sich schwer getan, ihrer einzigen Tochter Grenzen zu setzen. Sie hatten sie bereits als Kind zu möglichst viel Selbstständigkeit und Eigeninitiative ermutigt, nicht zuletzt um sie auf den Militärdienst und das Erwachsenenleben vorzubereiten.
Ronit war jetzt eine von 630.000 Reservisten, über die die israelischen Streitkräfte aktuell verfügten. Dass sie ihre Semesterferien in Israel bei einer vierwöchigen Reserveübung verbringen musste, war für sie normal. »Jeder Bürger Israels ist ein Soldat auf elfmonatigem Urlaub pro Jahr«, pflegte der einstige Generalstabschef Yigal Yadin immer zu sagen, und Ronit konnte ihm diesbezüglich nur beipflichten. Wenn es einen Punkt gab, in dem sich die meisten Israelis einig waren, dann war es die Überzeugung, dass die Streitkräfte unverzichtbar waren. »Wir können es uns nicht leisten, auch nur einen Krieg zu verlieren, sonst hätten wir kein Land mehr. Israelin zu sein, bedeutet für mich, das Land zu verteidigen«, versuchte sie die blanken Tatsachen ihren unverständigen amerikanischen Kommilitonen zu erklären.
Mit der Gründung ihres Staates, aber auch schon vorher, lebten die Israelis immer in einem Zustand des Krieges oder eines drohenden Krieges. Auf den Unabhängigkeitskrieg von 1947 bis 1949 folgten der Suez-Feldzug von 1956, der Sechstagekrieg von 1967, der Abnutzungskrieg von 1968 bis 1970, der Yom-Kippur-Krieg von 1973, der erste Libanon-Krieg von 1982 bis 2000 und der zweite Libanon-Krieg von 2006. Darauf folgten drei militärische Operationen gegen die Hamas und andere palästinensische Terrorgruppen im Gazastreifen: »Gegossenes Blei« 2008/2009, »Wolken säu le« im November 2012 und »Protective Edge« im Sommer 2014.
Ronit wusste natürlich, was ihr Vater beruflich machte, wenngleich zu Hause nie ein Wort darüber verloren wurde. Ronit konnte schweigen wie ein Grab. Selbst ihrer besten Freundin gegenüber. Diese erfuhr nur, dass ihr Vater einen Bürojob im Verteidigungsministerium hatte. Manchmal war er tagelang verschwunden. Und wenn er wieder nach Hause kam, konnte sie den Tod in seinen Augen sehen.
»Sehen wir uns morgen noch mal?«, hatte sie ihn beim Verlassen des Luxusrestaurants gefragt. »Das geht leider nicht. Aber wir sehen uns in sechs Wochen in der Heimat.« »Okay. Ich freu mich drauf.« Dann war sie ihm um den Hals gefallen, hatte ihm einen flüchtigen Kuss auf den Mund gegeben und sich noch mal für die Einladung bedankt. Halon hatte sie daraufhin ein weiteres Mal in den Arm genommen und diesmal sehr fest gehalten. »Danke, dass du meinen Geburtstag mit mir gefeiert hast.« »Es war mir eine Ehre«, hatte sie erwidert und dabei feuchte Augen bekommen. Dann hatte sie ein Taxi herbeigerufen, das sie zurück nach New Haven in ihre Studentenwohnung bringen sollte. Halon hatte dem abfahrenden Taxi noch einen Augenblick hinterhergesehen, bevor er sich selbst ein Taxi nahm.
***
Um an der Rezeption der großen Hotels der Welt nicht unnötig Zeit zu verlieren, besitzt jeder Führungsoffizier des Mossad eine Zugangskarte zu einer Suite, die ausschließlich für ihn reserviert ist.
Das gilt selbstverständlich auch für das New Yorker Ritz-Carlton. Suite 1101 weist jedoch eine Besonderheit auf. Sie wird vom Mossad als sicheres Haus genutzt, ist abhörsicher und mit zahllosen technischen Raffinessen ausgestattet. Der normale Zimmerservice des Hotels hat keinen Zugang zu dieser Suite, deshalb ranken sich diverse Mythen um sie.
Kaum hatte Halon das prächtige Foyer des Hotels betreten, kam ihm ein sayan entgegen.
Sayanim heißen die unbezahlten freiwilligen jüdische Helfer des israelischen Auslandsgeheimdienstes.
»Der Alte will Sie sprechen. Er erwartet Sie oben«, sagte der junge Mann mit leiser Stimme.
»Er ist hier?«
»Ja.«
Halon wusste, dass er den Drink, den er sich noch an der Bar genehmigen wollte, vergessen konnte. Er ging zu den Aufzügen, drückte einen Knopf und wartete, bis sich eine Tür öffnete.
Das Licht in seiner Suite war stark gedimmt. Es roch nach türkischen Zigaretten. Ein sicheres Zeichen dafür, dass der Alte in der Nähe war. Im Ritz-Carlton galt ein allgemeines Rauchverbot, aber da praktisch alle Führungsoffiziere rauchten, war die Mossad-Suite davon ausgenommen. Ein alter Mann mit schneeweißem Haar und gedrungenem Körperbau stand am Fenster und blickte auf den Central Park hinaus. Halon trat an seine Seite. Er wusste, dass Aryeh Ben-Zvi – so hieß der Chef der Operationsabteilung – gekommen war, um ihm vom Tod zu erzählen. Der Tod hatte sie vor dreißig Jahren zusammengeführt, und der Tod blieb das einzige stabile Element ihres Bundes.
Ben-Zvi verzichtete auf die Begrüßung, gratulierte ihm auch nicht zum Geburtstag. Stattdessen berichtete er Halon ruhig, was er über die Ereignisse in Valletta wusste. Gestern war in den Räumen des Instituts für interreligiösen Dialog ein Sprengsatz detoniert. Rabbi Yonah Melman, der Leiter des Instituts, lag in tiefem Koma im Saint Thomas Hospital auf der Intensivstation. Seine Überlebenschance wurde als gering eingeschätzt. Seine beiden Assistenten waren bei dem Anschlag ums Leben gekommen, ebenso Erzbischof Karl Maria Wegener und dessen Sekretär, die gerade zu Besuch gewesen waren. Ein Aktionsbündnis gegen Religion und Aberglaube, eine Gruppierung, die noch nie zuvor in Erscheinung getreten war, hatte im Rahmen eines Bekennerschreibens die Verantwortung für das Attentat übernommen.
»Kein Hinweis auf Israel oder Juden im Allgemeinen?«, fragte Halon.
»Nein.«
»Dann steht nicht zweifelsfrei fest, dass wir das Ziel waren.«
»Für diese Schlussfolgerung wurde der Anschlag zu professionell durchgeführt. Melmans Büro war eine Festung. Verrate mir mal, wie eine völlig unbekannte Gruppierung einen Sprengsatz in ein stark gesichertes Gebäude bekommt.«
»Feindlicher Geheimdienst?«
Ben-Zvi schwieg. Er wandte sich vom Fenster ab und drehte am Dimmer. Die Lichter im Wohnzimmer flammten auf. Der Chef der Operationsabteilung ging ein paar Schritte, dann ließ er seinen wuchtigen Körper auf die Couch fallen. Er griff nach der silbernen Kaffeekanne, die auf dem niedrigen Marmortischchen stand, und schenkte zwei Tassen Kaffee ein.
»Kaffee um ein Uhr morgens?«, fragte Halon, der noch immer am Fenster stand.
»Die Nacht wird lang. Setz dich.«
Halon zog sein Jackett aus. Nachdem er Zigaretten und Feuerzeug herausgenommen hatte, legte er es sorgfältig über die Stuhllehne. Dann löste er die Krawatte, streifte sie über den Kopf und legte sie über sein Jackett.
Er setzte sich in den Ledersessel neben seinem Chef.
Ben-Zvi zündete sich eine weitere seiner übelriechenden türkischen Zigaretten an. »Ich habe mich freiwillig erboten, nach Valletta zu fahren, aber davon wollte Ron nichts hören. Er glaubt, dass die Polizei mitteilsamer ist, wenn wir durch eine weniger polarisierende Gestalt vertreten werden.«
»Und da dachtest du an mich. Obwohl wir Leute in Valletta haben.«
»Mir ist wohler, wenn jemand, dem ich vertraue, die Dinge im Auge behält.«
»Was ist mit unserem katsa für Südeuropa?«
»Zev ist zurzeit stark mit Rom beschäftigt. Aber wenn du mit deinen Ermittlungen nicht weiterkommst, kannst du ihn als Ratgeber zu Rate ziehen.« Ben-Zvi nahm einen Schluck aus seiner Tasse. »Nein, Avi, für Valletta bist du der richtige Mann.«
»Wissen wir schon etwas über den verwendeten Sprengstoff?« Halon zündete sich nun ebenfalls eine Zigarette an.
»Ich habe sofort ein Team von Bombenspezialisten nach Valletta geschickt, um in den Trümmern nach Hinweisen auf Zusammensetzung und Herkunft der Sprengladung zu fahnden. Ich erwarte ihren Bericht stündlich.« Der Alte beugte sich vor und sah seinen Führungsoffizier eindringlich an. »Ich will ehrlich zu dir sein, Avi. Du tust es nicht fürs Büro, sondern für mich. Yonah ist mein Freund. Er liegt in Valletta im Krankenhaus und ringt mit dem Tod. Und ich wüsste gern, wer ihn dorthin gebracht hat.«
»Erzähl mir von Yonah.«
Der Blick des Alten veränderte sich, als würde das Grauen des Krieges noch einmal an seinem inneren Auge vorbeiziehen. »Yonah ist genauso alt wie ich«, begann er. »Dreiundsiebzig. Wir haben zusammen im Sechstagekrieg und im Yom-Kippur-Krieg gekämpft. Ich sehe Yonah noch vor mir, als wir am Mittwoch, dem 7. Juni 1967, Ostjerusalem befreiten und vor unserem größten Heiligtum, dem kotel, standen. Unsere Empfindungen in diesem Moment waren unbeschreiblich. Wir nahmen unsere Helme ab und fingen an zu tanzen. Wir sangen gemeinsam Yerushalayim shel zahav, und Yonah weinte wie ein kleines Kind. Ich glaube, dies war auch der Moment, in dem er beschloss, Rabbiner zu werden. Nach dem Sechstagekrieg war das ganze Land in Euphorie. Das Lebensgefühl von damals war einfach unbeschreiblich. Alle blickten positiv in die Zukunft. Innerhalb von nur sechs Tagen hatten wir nicht nur Ägypten, Syrien und Jordanien niedergerungen, sondern auch die Kontrolle über den Gazastreifen, den Sinai, die Hälfte des Golan, Samaria, Judäa und Ostjerusalem erlangt. Für Yonah und mich begann die schönste Zeit unseres Lebens. Ich begann mein Ingenieurstudium, aber Yonah, der über viele Talente verfügte, wollte unbedingt Rabbiner werden und begann sein Theologiestudium. Trotz unterschiedlicher beruflicher Ambitionen verloren wir uns in den folgenden sechs Jahren aber nie aus den Augen. Wir hatten einfach die gleiche Wellenlänge, wie man so schön sagt. Außerdem liefen wir uns bei den jährlichen Reserveübungen ohnehin immer über den Weg. Kurz nach dem Sechstagekrieg lernten wir unsere späteren Ehefrauen kennen, und im Frühjahr 1973 – Yonah und ich waren gerade siebenundzwanzig geworden – heirateten wir.«
»Ihr wart beide siebenundzwanzig, hattet aber bis zu diesem Zeitpunkt noch keinen Kontakt zum Büro.«
»Nein, das war erst nach dem Yom-Kippur-Krieg. Aber lass mich der Reihe nach erzählen. Dieser Krieg vom Oktober 1973 änderte alles. Absolut alles. Er wurde nicht nur für Yonah und mich zum Trauma, sondern für unser ganzes Land. Keiner von uns hatte damals geglaubt, dass es die Ägypter wagen würden, uns nach ihrem Debakel von 1967 anzugreifen. Und doch taten sie es. Der Stolz der Araber und ihr Nationalismus verlangten es so. Sadat sagte damals, dass er keinen Millimeter ägyptischen Bodens freiwillig hergeben würde. Yonah und ich lagen damals direkt an der Bar-Lev-Linie am Ostufer des Suezkanals in einem der fünfunddreißig Bunker. Am 27. September 1973 bezogen wir unsere Stellung. Kurze Zeit später sahen wir, wie die Ägypter Lkw, Kanonen und Raketenwerfer in Stellung brachten. Wir informierten das Hauptquartier, aber dort hieß es: Macht euch nicht in die Hosen, Jungs. Sie verspotteten uns. Für unsere Führung war der Aufmarsch der Ägypter nichts weiter als das übliche Herbstmanöver, das sie jedes Jahr aufführten. Und so wie unsere Führung dachte, dachte der Rest unseres Landes. Hinter der Bar-Lev-Linie fühlten sich alle absolut sicher. Der Sechstagekrieg hatte unser Denken vollkommen verändert. Unser Bewusstsein als Nation war davon zutiefst beeindruckt worden. Nach diesem Erfolg gingen unsere Politiker und unsere Nachrichtendienste davon aus, dass die Araber nicht fähig wären, unseren Streitkräften zu widerstehen. Wir alle fühlten uns sicher, und wir sagten uns, mit dieser Armee kann uns nichts passieren.«
»Und das böse Erwachen kam dann am 6. Oktober.«
»Richtig. Die Jahre der Euphorie waren mit einem Schlag zu Ende. Um Punkt 14 Uhr gab Sadat seiner Luftwaffe den Befehl zum Angriff. Yonah und ich saßen im selben Bunker. Aufgeregt hörten wir den Funkverkehr zwischen den einzelnen Bunkern ab. Deshalb wussten wir genau, was gerade passierte.«
»Soweit ich mich erinnere, wurden damals sämtliche Bunker überrannt.«
»Nicht alle. Yonah und ich hatten extremes Glück. Nur unser Bunker, ganz im Norden, in der Nähe von Port Said, hielt über die ganze Dauer des Krieges stand, während alle anderen überrannt wurden.«
»Aber dann kam doch ziemlich schnelle die Wende zu unseren Gunsten.«
»Nun ja. Es waren eigentlichen im Wesentlichen zwei Gründe, die uns die Wende brachten. Nachdem Golda Meir von Moshe Dayan, unserem damaligen Verteidigungsminister, informiert worden war, dass wir gegenüber Syrien und Ägypten eine militärische Niederlage erleiden würden, reagierte sie innerhalb weniger Minuten. Das habe ich allerdings erst Jahre später erfahren. Golda ließ sofort dreizehn Atombomben mit der Sprengkraft von je zwanzig Kilotonnen TNT für unsere Jericho-Raketen gefechtsbereit machen. Als die Amerikaner am Morgen des 9. Oktober davon erfuhren, drehten sie geradezu durch. Nixon wollte unseren Atomschlag gegen Kairo und Damaskus unter allen Umständen vermeiden und ordnete sofort massive Unterstützung mit militärischem Material für uns an. Der zweite Grund war, dass Sadat eine Panzeroffensive auf dem Sinai befahl. Absolut offenes Gelände und absolut freies Schussfeld für unsere Luftwaffe. Am Morgen des 14. Oktober gab Sadat seinen Befehl, am Mittag desselben Tages hatte unsere Luftwaffe 250 ägyptische Panzer vernichtet. Von dieser Stunde an waren die Ägypter in der Defensive, und General Bar-Lev konnte seine Offensive am nächsten Tag starten. Alle unsere Hoffnungen ruhten dabei auf Arik Sharon und seinen Divisionen. Drei Tage lang wurde gekämpft. Mann gegen Mann. Panzer gegen Panzer. Dann hatte sich der Krieg festgefahren. Wir lagen vor Suez fest, und am 22. Oktober erwirkte die UNO einen Waffenstillstand.«
»Was habt ihr damals empfunden, als euch klar wurde, dass im Grunde keine Seite gesiegt hatte?«
»Wir hatten eine Scheißwut auf den Mossad, da es ja seine Aufgabe gewesen war, unsere Führung rechtzeitig vor dem drohenden Angriff zu warnen. Wir dachten, der Mossad war dermaßen beschäftigt mit der Eliminierung der Terroristen des Schwarzen September und der Jagd auf Ali Hassan Salameh, dass er die Kriegsvorbereitungen der Ägypter und Syrer einfach übersah. Erst Jahre später erfuhren wir, dass der Mossad in Wirklichkeit mehrfach vor einem Präventivschlag der Ägypter gewarnt hatte, aber er hatte mit seinen Warnungen unter den israelischen Geheimdiensten alleine dagestanden. Jedenfalls trieb der Glaube, dass der Mossad nicht so gut war, wie wir bis dahin angenommen hatten, Yonah und mich zu der Erkenntnis, dass sich dies schleunigst ändern müsste. Wir hatten glasklar erkannt, dass wir immer auf uns allein gestellt sein würden, dass wir überall auf der Welt Feinde hatten und dass unsere Lebensaufgabe darin bestand, unser Volk zu beschützen. Wir mussten unser Volk schützen, sowohl vor den Narren im eigenen Land als auch vor den dämonischen Kräften, die uns umgaben. Also fassten wir den Entschluss, uns beim Mossad zu bewerben. Und tatsächlich luden sie uns zu einem Vorstellungsgespräch ein. Drei Jahre später war ich katsa und wurde sofort dem Hauptquartier zugeteilt. Bei Yonah lief es nicht ganz so gut. Er fiel durch einige Prüfungen. Er verfügte zwar über die notwendige Intelligenz, er war auch damals schon ein Intellektueller, aber die Ausbilder warfen ihm mangelnden Mut und mangelnde Durchsetzungskraft vor. Nach langem Hin und Her beschlossen sie dennoch, ihn zu behalten. Vor allem wegen seiner Verschwiegenheit, seiner Mehrsprachigkeit, seiner ausgeprägten Intuition und seiner exzellenten Beobachtungsgabe. Außerdem verfügt Yonah über eine Gabe, die ich bis jetzt noch bei keinem anderen Agenten angetroffen habe. Er kann sich auf der Stelle unsichtbar machen.«
Halon lachte. »Ja, daran erinnere ich mich noch sehr gut. Während meiner Ausbildung hatte ich zwei Unterrichtsstunden bei ihm. Ich habe damals viel bei ihm gelernt.« Der katsa machte eine Pause, um sich eine weitere Zigarette anzuzünden. »1973 war ich neun Jahre alt. Damals verstand ich nicht, was vor sich ging, aber ich spürte sehr genau die Angst meiner Eltern.«
»Heutzutage kann sich von unseren jungen Leuten niemand vorstellen, was wir damals empfanden. Die jungen Leute haben ein ganz anderes Lebensgefühl. Ich bin noch mit patriotischen Liedern aufgewachsen, die jungen Leute mit Rap. Sie wissen nichts über die Geschichte. Weder über die jüngere, noch über die alte. Sie fühlen sich sicher, weil sie wissen, dass das Büro nicht nur die Sicherheit Israels verteidigt, sondern auch große Initiativen auf dem diplomatischen Parkett ergreift. Aber auf meine Generation trifft das nicht zu. Wir haben zu viel erlebt. Als ich jung war, war unser Land isoliert, klaustrophobisch, von Feinden eingekreist und von der Welt abgekoppelt. Vielen von uns sitzt immer noch die Angst im Nacken.«
Es entstand eine kleine Gesprächspause, während derer Halon den Alten aufmerksam beobachtete. »Wenn ich nach Valletta reise, brauche ich eine Identität.«
Ben-Zvi zuckte nur mit den Schultern, als wolle er sagen: Na, wenn das alles ist, mein Junge. Er klappte seinen Aktenkoffer auf und übergab Halon einen großen braunen Umschlag.
Halon kippte den Inhalt auf den Couchtisch: Flugtickets, eine aufklappbare Geldbörse und ein abgenutzter israelischer Pass. Als er den Pass aufschlug, starrte ihn sein eigenes Gesicht an. Sein neuer Name war Rafael Goldberg. Dann klappte er die Geldbörse auf. In einem Fach unter den Kreditkarten und dem Führerschein steckten mehrere Business Cards: Dr. Rafael Goldberg – Oberrabbinat, Abteilung für DNATests, 80 Yirmiyahu Street, Jerusalem.
»Was hast du dir dabei gedacht?«, fragte er.
»Nun, als Rabbiner gehst du ja wohl nicht durch. Als wissenschaftlicher Mitarbeiter für halachische Fragen aber schon.«
»Weiß der memuneh davon?«
»Noch nicht, aber ich werde es ihm mitteilen, sobald du sicher in Valletta angekommen bist.«
Halon öffnete den Umschlag mit den Flugtickets und dem Reiseplan.
»Ich glaube nicht, dass es eine gute Idee wäre, von hier aus direkt nach Valletta zu fliegen«, sagte Ben-Zvi. »Ich begleite dich morgen nach Tel Aviv zurück. Dort übernachtest du in deiner Wohnung, beschäftigst dich noch mal mit den wichtigsten Fragen der Halacha und nimmst am nächsten Tag die Nachmittagsmaschine nach Valletta.«
»Okay, war’s das?«
»Nein, hier habe ich noch eine Liste mit den Namen und Kontaktdaten unserer sayanim in Valletta.«
Sayanim gab es in fast jedem Land der Erde. Sie unterstützten Mossad-Agenten heimlich mit Geld und Unterkünften, wenn diese gerade einen Einsatz in ihrem Land hatten und der heimlichen Hilfe bedurften.
»Sobald mir die Ergebnisse unserer Bombenspezialisten vorliegen, erfährst du es als Erster. Es gibt aber noch etwas, was du wissen musst. Jeffrey Epstein wurde vor einer Woche festgenommen. Ich weiß nicht, wie lange du für deine Nachforschungen in Valletta brauchen wirst. Aber du sollst schon mal wissen, dass du dich auch um diesen Fall kümmern wirst, falls er akut werden sollte.«
»Wie meinst du das?«
»Wir werden es erst mal mit einer hohen Kaution versuchen, aber falls der Richter die Kaution ablehnt und Epstein wider Erwarten dauerhaft einbuchtet, musst du ihn lebend aus dem Knast holen und nach Israel bringen.«
»Das dürfte schwierig werden.«
Ben-Zvi lachte rau. »Das ist nicht nur schwierig, das ist unmöglich! Deshalb bist du der richtige Mann dafür. Tief in deinem Innern weißt du auch, dass du das kannst. Nur du bist in der Lage, anders zu denken und mehr zu tun, als das, was sich andere zutrauen.«
»Ich wusste gar nicht, dass Epstein für uns arbeitet.«
»Tut er auch nicht. Zumindest nicht unmittelbar. Epstein arbeitet für diverse Finanzoligarchen, die die kompromittierenden Videos ausschließlich für die Erpressung diverser Politiker benutzen. Aber Ghislaine Maxwell, seine engste Freundin, arbeitet natürlich für uns. Ghislaine hat Epstein kurz nach dem Tod ihres Vaters Robert Maxwell im November 1991 kennengelernt. Als das Imperium ihres Vaters zusammenbrach, war sie raus aus der sogenannten feinen Gesellschaft. Aber Epstein nahm sie bei sich auf und ermöglichte ihr den Wiedereinstieg in die Gesellschaft. Sie zeigte sich erkenntlich und ging ihm deshalb bei seinen schmutzigen Geschäften immer gewissenhaft zur Hand. Und natürlich hat sie auch dafür gesorgt, dass für uns was abfiel.«
»Das weiß ich.« Halon nahm einen tiefen Zug von seiner Zigarette. »Was war eigentlich der wahre Grund, weshalb uns ihr Vater damals in die Quere kam? Ich weiß nur, dass er extrem viel für uns getan hat.«
»Das stimmt. Robert Maxwell hat Außerordentliches für Israel geleistet.« Bin-Zvi seufzte. »Aber sein Versuch, Shamir zu erpressen, ist ihm nicht gut bekommen.«
»Aber anfangs waren Shamir und Maxwell doch ziemlich gute Freunde.«
»Natürlich. Sehr gute Freunde sogar. Die beiden kannten sich seit Jahrzehnten. Shamir hat den jungen Maxwell sogar in den Irgun eingeführt. Das war noch vor unserer Staatsgründung. Das hätte Shamir niemals gemacht, wenn zwischen ihnen nicht eine ganz tiefe Freundschaft bestanden hätte. Wie du weißt, arbeitete Shamir zwischen 1955 und 1965 für uns und lernte sein Handwerk von der Pieke auf. Später ging er dann in die Politik und wurde schließlich 1983 zum ersten Mal Premierminister.«
»Shamir hat ihn soviel ich weiß auch hochgebracht.«
»Das stimmt.«
»Hat Maxwell uns wenigstens mit exzellenten Informationen versorgt?«
»Das weniger, aber er verfügte über exzellente Kontakte. Wir haben ihn mit Informationen versorgt, und er hat jedes Mal unsere finanziellen Löcher gestopft, wenn wir gerade teure Operationen laufen hatten, die nicht auf legitime Weise finanziert werden konnten. Das war zum Beispiel nach der amerikanischen Invasion in Panama der Fall, als unsere Einnahmen aus dem Drogenhandel für einige Zeit nicht mehr flossen. Maxwell hat dann jedes Mal tief in die Kasse seiner Unternehmen gegriffen. Irgendwann 1990, 1991 kamen wir mit der Rückzahlung seines Geldes in Verzug, und das brachte letztlich sein ganzes Finanzimperium in eine starke Schieflage. Er rief Shamir an und drohte damit, die von ihm mitarrangierte Zusammenkunft zwischen der Mossad-Liaison und dem früheren KGB-Chef Krjutschkow publik zu machen. Wir hatten damals nämlich auf Maxwells Jacht über unsere Unterstützung zum Sturz Gorbatschows diskutiert. Shamir war sich natürlich völlig im Klaren darüber, was passieren würde, wenn herauskäme, dass sich der Mossad an dem Putschversuch zur Beendigung des Demokratisierungsprozesses in der Sowjetunion beteiligt hatte. Maxwell benutzte diese Tatsache als Drohung gegen Shamir, um eine sofortige Hilfsaktion für sein schwankendes Imperium zu erzwingen. Und Shamir tat erwartungsgemäß genau das, was jeder andere Premier in dieser Situation ebenfalls getan hätte. Er rief Zvika an und verlangte, sich Maxwells zu entledigen. Es vergingen ein paar Tage, aber irgendwann haben sie ihn dann auf hoher See erwischt und auf den Grund des Atlantiks versenkt.«
»Wie war er als Agent?«
»Er war ein perfekter Agent. Zwar nicht so bedeutend wie Ashraf Marwan, unser Mann in unmittelbarer Nähe von Anwar as-Sadat, aber perfekt. Er hatte seine Finger praktisch überall drin. Er war für uns von großem Wert. Dass die Sache so unglücklich für ihn ausging, war im Grunde unsere Schuld. Wir hätten nicht zulassen dürfen, dass sein Imperium in eine dermaßen krasse Schieflage kam.«
Halon zündete sich eine weitere Zigarette an. »Ich bin jetzt übrigens hellwach. Was hältst du von einem Whiskey?«
»Gute Idee.«
Halon stand auf, ging zur Bar und kam kurz darauf mit einem Single Malt und zwei Gläsern zurück. Er setzte sich, öffnete die Flasche und schenkte zwei Gläser ein.
»Bevor ich es vergesse«, begann Bin-Zvi. »Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag.«
»Danke.« Halon erhob sein Glas. »L’chaim!«
»L’chaim! Wie war das Abendessen mit deiner Tochter?«
Halon genoss den milden Tropfen einen Moment auf der Zunge. »Es war angenehm und erkenntnisreich.«
»Inwiefern?«
»Ich glaube, dass Ronits Zeit an der Universität zu Ende geht. Sie fühlt sich da einfach nicht wohl. Außerdem wird sie wegen ihrer konservativen und patriotischen Einstellung ständig gemobbt.«
»Das überrascht mich überhaupt nicht. Hast du sie vor Studienbeginn nicht ausreichend aufgeklärt?«
»Selbstverständlich habe ich ihr gesagt, dass an den amerikanischen Universitäten überwiegend Kommunisten und Antizionisten unterrichten. Aber Ronit gehört leider zu den Menschen, die ihre Erfahrung selber machen müssen. Unter Clinton war es schon schlimm. Aber unter Obama wurde es noch schlimmer.«
»Hör mir bloß auf mit Obama. Weißt du eigentlich, mit wem er an seinem ersten Tag im Oval Office sein erstes Auslandsgespräch geführt hat?«
»Nein.«
»Mit Mahmoud Abbas! Und weißt du, welchem TVSender er sein erstes Interview gab? Einem arabischen Sender! Und wer hat Obama gewählt? Mehr als siebzig Prozent der amerikanischen Juden! Die liberalen, progressiven und globalistisch eingestellten amerikanischen Juden. Mit anderen Worten: die linken Traumtänzer, Weltverbesserer und Antizionisten!«
»Tja, leider.« Halon nahm einen tiefen Zug von seiner Zigarette.
»Die amerikanischen Juden wollen die Welt besser machen, ignorieren aber vollständig die Realitäten im Nahen und Mittleren Osten.«
»Dann wäre es doch die Aufgabe unseres Ministerpräsidenten, dafür zu sorgen, dass der Graben zwischen uns und den amerikanischen Juden nicht noch tiefer wird.«
»Du sagst es. Aber er will das nicht. Selbstverständlich weiß er, dass sich die Beziehungen zwischen uns und den progressiven jüdischen Bewegungen in den USA in den letzten Jahren immer weiter verschlechtert haben. Er hat diese Situation sogar bewusst begünstigt. Er weiß, dass die progressiven amerikanischen Juden, die mit überwältigender Mehrheit die Demokraten wählen, sein Bündnis mit Trump nicht gutheißen, und er weiß, dass sie gegen seine Politik in Israel sind.« Ben-Zvi seufzte. »Hoffentlich fliegt uns die Sache nicht irgendwann um die Ohren.«
»Trump wird nicht ewig Präsident bleiben. Bibi auch nicht ewig Ministerpräsident. Wir müssen also sicherstellen, dass wir später nicht den Preis für Bibis Kurzsichtigkeit zahlen.«
»Trump ist doch auch nur eine Marionette. Du musst dir immer vor Augen halten, dass die globalen Finanzoligarchen China zum neuen Steuerungszentrum der Welt machen wollen. Ihr Hauptziel besteht nach wie vor in der Aufspaltung der USA in ein linkes und in ein patriotisches Lager. Aber wenn sie beides auf die Spitze getrieben haben, wird es zum Bürgerkrieg kommen. Und ein Bürgerkrieg, das kannst du dir denken, wird schließlich zu einer Aufspaltung des amerikanischen Staatenbundes führen. Am Ende dieses Prozesses wird die nationale amerikanische Elite völlig zerstört sein. Die USA werden verarmen und ihre Rolle als wichtigstes Steuerungszentrum der Welt an China abtreten, und dann wird auch der Zerfall und die Verarmung Europas nicht mehr zu stoppen sein.«
Halon schwieg. Er hatte ähnliche Gedanken. Die Aufspaltung der USA in ein linkes und in ein patriotisches Lager war bereits in den Neunzigerjahren eine deutlich sichtbare Realität. Beginnend mit Clinton über Bush bis zu Obama wurde die Aufspaltung von Jahr zu Jahr schlimmer. Alle diese Präsidenten hatten die Spaltung als das eigentliche Problem der USA erkannt und jeweils unterschiedliche Wege gesucht, das Land zu einen, aber die Kräfte, die das Land in Wirklichkeit steuerten, wollten und forcierten diese Aufspaltung.
Ben-Zvi kippte den Rest seines Whiskeys in einem Zug herunter, und während er sich sofort ein weiteres Glas einschenkte, fragte er: »Hat sich Ronit schon zu ihren Zukunftsplänen geäußert?«
»Sie will zurück zum Militär.«
»Hm. Sie ist mutig und hochintelligent. Hast du schon mal daran gedacht, sie für uns arbeiten zu lassen? Sechsundvierzig Prozent unserer Agenten sind bereits weiblich.«
»Ich werde darüber nachdenken.« Halon nahm ebenfalls einen großen Schluck aus seinem Glas. »Sind es wirklich schon sechsundvierzig Prozent?«
»Ja. Liest du nicht die Berichte der Personalabteilung? Ron verfolgt eine völlig andere Personalstrategie als die memunehs vor ihm. Sein Ansatz ist sehr viel breiter. Deshalb ist er auch so erfolgreich. Er hat nicht nur die fähigsten Frauen geholt, sondern auch viele intelligente haredim. Niemand mag die haredim, aber Ron hat sie trotzdem geholt. Er meinte, unter ihnen seien auch viele mit einem offenen Geist.« Ben-Zvi lachte rau. »Wir müssen unsere Fähigkeiten zur Informationsbeschaffung ständig erweitern, hat er mir gesagt. Er ist der Auffassung, dass es Wissensbereiche gibt, um die wir uns in der Vergangenheit zu wenig oder gar nicht gekümmert haben. Vielleicht hat es damit zu tun, dass er aus einer Rabbinerfamilie stammt. Jedenfalls will er künftig auch die Kabbalisten aus Tzfat zu Rate ziehen.«
»Ist nicht wahr!«
»Und ob das wahr ist! Er sagte mir: Die Kabbala ist die tiefste verfügbare Beschreibung der gesamten Realität. Mit unserer Wissenschaft erfahren wir nur einen winzigen Teil dieser Realität. Nach seiner Ansicht gibt es keinen Widerspruch zwischen Torah und Wissenschaft. Torah und Wissenschaft sind uns von Gott gegeben worden, sagte er. Da kann es keinen Widerspruch geben. Wenn es den Anschein hat, dass es einen Widerspruch gibt, dann liegen wir entweder falsch oder unser Wissen ist unvollständig. Er will sogar unsere klassischen Lügendetektoren abschaffen.«
»Warum?«
»Er plant, die Lügendetektoren durch sogenannte Neuroquanten-Adepten zu ersetzen. Das sind hochsensitive Menschen, die hundertmal zuverlässiger arbeiten als jeder Lügendetektor.« Ben-Zvi zündete sich eine weitere Zigarette an. Nach einer kurzen Überlegung sagte er: »Ich vertraue dir jetzt etwas an, was ich noch keinem anderen Kommandeur anvertraut habe. Vor rund drei Wochen hatte ich ein Gespräch mit ihm. Darin hat er mir etwas sehr Seltsames anvertraut: ›Aryeh‹, sagte er, ›es gibt einen Gott und es gibt einen göttlichen Plan. Dieser Plan entfaltet sich in der Geschichte, und er erstreckt sich über sechs Jahrtausende. Die Geschichte des jüdischen Volkes hat Wegmarken, wesentliche Ereignisse, die alle von Gott geplant wurden. Und diese Wegmarken finden sich inklusive ihren exakten Jahreszahlen alle in der Torah‹. Ich war natürlich ziemlich verblüfft, ihn so sprechen zu hören. Bisher hielt ich ihn für einen traditionellen Juden, der weder streng religiös noch völlig säkular war, aber in diesem Moment wusste ich wirklich nicht, was ich sagen sollte. Dann fuhr er fort: ›Alle wesentlichen Ereignisse in unserer Geschichte haben ihre Entsprechung in einem Vers in der Torah. Und die Torah nennt uns sogar das exakte Jahr‹! Und dann nannte er mir mehrere Beispiele. Er hat in seinem Computer die gesamte Torah abgespeichert und Vers für Vers durchnummeriert.«
»Unglaublich!«
»Ja. Und was dich betrifft: Ron hat große Pläne mit dir. Sobald du wieder im Büro bist, wird er dir zwei Vorschläge unterbreiten. Entweder du übernimmst meinen Job als Chef der Operationsabteilung, oder du findest dich in Berlin wieder und löst Dani Gerstein ab. Sei froh, dass Ron so große Stücke auf dich hält. Deine Karriere setzt sich fort, sei froh. Andere Kommandanten in deinem Alter haben nicht dieses Glück. Die leben zurückgezogen, sind über ganz Israel verstreut, beschäftigen sich überwiegend mit der Lektüre von historischen Büchern und versuchen sich mit dem Umstand zu arrangieren, dass sie zum alten Eisen gehören. Du hingegen hast die Chance, erneut zu zeigen, dass du ein methodisch und sorgfältig vorgehender Agent bist, einer, der in der Lage ist, zu liefern, was erwartet wird. Willst du wissen, welche Meinung Ron wirklich über dich hat? Er hat es mir gesagt: ›Avi ist derjenigen, der den Geist des Büros am stärksten verinnerlicht hat. Sein Handwerkszeug ist Täuschung und Desinformation, zusammen mit Subversion, Korruption, Erpressung und Attentaten. Er ist wie kein anderer darauf trainiert, zu lügen, Freundschaften zu gebrauchen und zu missbrauchen. Und was am Wichtigsten ist: Er ist so viel wert wie eine Division Soldaten‹.«
»Hast du ihm irgendetwas darauf erwidert?«
»Ja, ich habe ihm gesagt: ›Avi muss am Schauplatz des Geschehens sein und nicht hinter einem Schreibtisch in Tel Aviv oder bei endlosen Planungssitzungen verkümmern. Du kannst ihm die beiden Alternativen anbieten, aber ich sage dir jetzt schon, Avi wird sich für Berlin entscheiden‹.«
***
Valletta