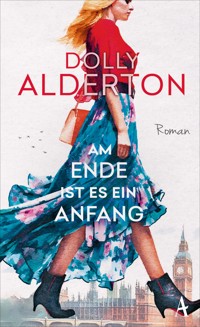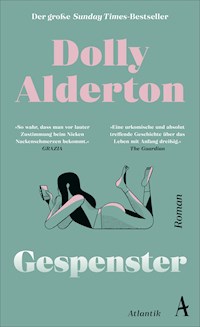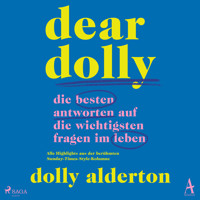
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Dolly Alderton auf der Höhe ihrer Weisheit, ihres Humors und ihrer Klugheit« Red Der neue Bestseller der Erfolgsautorin aus Großbritannien Dolly Alderton gibt in ihrer berühmten Kolumne Dear Dolly als sogenannte Agony Aunt – als Kummerkastentante – kluge, feinsinnige und warmherzige Ratschläge zu Problemen aus allen Bereichen des Lebens: Dating, Freundschaft, Beziehung, Familie, Sex, Trennung und Spiritualität. Sie hat für ihre Leser*innen ein offenes Ohr, behandelt die Fragen mit Wertschätzung, Einfühlungsvermögen und einer gesunden Portion Humor. Dolly findet für uns alle genau die richtigen Antworten auf die wichtigsten Fragen. Und das Schönste: Sie gibt uns das Gefühl, niemals allein zu sein.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Dolly Alderton
Dear Dolly. Die besten Antworten auf die wichtigsten Fragen im Leben
Alle Highlights aus der berühmten Sunday-Times-Style-Kolumne
Aus dem Englischen von Eva Bonné
Atlantik
Für India Masters, meine Kummerkastentante.
Einleitung
Als ich beschloss, die Probleme anderer Leute zu lösen, befand ich mich am Tiefpunkt meines Lebens. In meinem Kopf herrschte Chaos, mein Herz war gebrochen. Ich machte eines dieser Jahre durch, in denen jeder Monat einen neuen Kummer bringt – ich glaube, man nennt so etwas ein annus horribilis. Und wie durch einen bösen Schachzug des Schicksals fiel mein persönlich schlimmstes Jahr mit dem schlimmsten Jahr überhaupt zusammen – 2020. Das horribiliste aller annusse.
Damals bewarb ich mich bei meiner Redakteurin von der Sunday Times Style als Kummerkastentante. In meinen Zwanzigern hatte ich für das Magazin eine wöchentliche Dating-Kolumne geschrieben – ein Umstand, der manchmal mitten in der Nacht die Tore zu meinem Unbewussten aufstößt und mich in kaltem Schweiß gebadet aufwachen lässt. Trotzdem war es eine der größten beruflichen Chancen, die mir je eingeräumt wurden, und die Zeit zwischen sechsundzwanzig und achtundzwanzig ist wahrscheinlich das perfekte Alter, um sich zu Unterhaltungszwecken selbst bloßzustellen; eine Art exhibitionistischer Kipppunkt, wenn mangelnde Selbsterkenntnis für hauptfigurentaugliche Kapriolen sorgt, diese Selbsterkenntnis aber schon so weit ausgeprägt ist, dass man sich über sich selbst lustig machen kann. Später gab ich die Kolumne auf, schrieb ein Memoir über meine Zwanziger und zog dann, was die serielle Verwertung meines Privatlebens betraf, einen Schlussstrich. Ich hatte genug preisgegeben.
Was mich vorübergehend in ein journalistisches Niemandsland verfrachtete. Weil ich ein Memoir veröffentlicht hatte, erwarteten die Leute von mir, dass ich mich auch weiterhin in meinen Geschichten selbst thematisierte, sogar wenn ich persönlich rein gar nichts mit dem Thema zu tun hatte. Ich wurde als vermeintlich neutrale Beobachterin angeheuert, die über bestimmte Menschen, Orte und Dinge schreiben soll, doch anschließend bat man mich jedes Mal, wie mit einer Brechstange Lücken im Text zu schaffen und Bezüge auf mein Privatleben einzufügen. Hätte ich in jener Zeit beispielsweise Barack Obama interviewt, hätte es in den Anmerkungen meiner Redakteurin geheißen: »VIELLEICHTKÖNNTESTDUHIERBESCHREIBEN, INWIEFERNEUREGESCHICHTENSICHGLEICHEN?? GIBTESINDEINERDATING-VERGANGENHEITPARALLELENZUSEINERAMTSZEIT? ERINNERTERDICHANIRGENDEINENDEINEREXFREUNDE?«
Wofür ich natürlich Verständnis hatte. Schließlich war ich diejenige gewesen, die darauf bestanden hatte, die ganze Welt an ihrem Leben teilhaben zu lassen; anfangs hatte niemand mich darum gebeten. Zwar hatte ich versucht, eine Kolumne in der ersten Person zu schreiben, die ohne aktuelle, intime Einzelheiten aus meinem Privatleben auskam. Aber was eine persönliche Kolumne interessant macht, ist nun einmal die Offenlegung der eigenen Schwächen, Fehler und Katastrophen, was das Ganze, um es vorsichtig auszudrücken, zu einer Herausforderung machte. Zudem war ich keine Meinungskolumnistin. Ich habe eine zu dünne Haut, zu wechselhafte Ansichten und erbärmlich wenig Mut. Da mir also weder mein Privatleben noch eine öffentliche Meinung als Material zur Verfügung standen, blieb wenig übrig, worüber ich hätte schreiben können, abgesehen von Jubeltexten über Dinge, die ich mochte, und handzahme, durch verlegene Haftungsausschlüsse abgemilderte Fast-Tiraden über Dinge, die ich nicht mochte. Eine Freundin nennt diese weichgespülten, wenig erinnerungswürdigen Kolumnen Ich-habe-die-Batterien-in-meiner-Fernbedienung-gewechselt-Journalismus. Ich wollte keinesfalls, dass so mein Vermächtnis aussieht.
Aber eine Kummerkastentante wollte ich immer schon sein. Wenn ich als Jugendliche ein Teenie-Magazin in die die Hände bekam, blätterte ich sofort zu den Problemseiten weiter. Meine Eltern sprachen durchaus über Sex, wahrscheinlich offener als die meisten Boomer (die letzten Opfer der viktorianischen Erziehung), doch nie gingen sie ins Detail. Stattdessen redeten sie über das Risiko ungewollter Schwangerschaften, dieses »kribbelnde« Gefühl und den Moment, wenn man merkt, dass man »einen anderen Menschen sehr gern hat«. Mir reichte das nicht. Ich brauchte mehr, und die Problemseiten waren meine Rettung. Mein lüsterner Blick jagte über die Seiten und blieb an den Schlüsselbegriffen hängen: »Jungfräulichkeit«, »Masturbation«, »Erguss«. Ich sammelte die Tipps, gab sie als eigene Weisheiten weiter und wurde zum Sex-Yoda des Pausenhofs. Mit meinen eigenen Erfahrungen übertrieb ich maßlos, damit ich nicht nur gleichaltrige, sondern auch ältere Mädchen beraten konnte.
Am meisten bereue ich wahrscheinlich, dass ich meine Kindheit und Jugend als demütigenden Zustand empfand. Wenn ich heute meine Teenie-Tagebücher lese, erkenne ich, wie oft ich beim Schreiben gelogen habe, bloß weil ich mich dafür schämte, so jung zu sein. Ich hatte noch nicht einmal jemanden geküsst, redete aber so blasiert über Sex, als wäre ich davon gelangweilt. Wie eine abgestumpfte Geschiedene notierte ich die Anzahl meiner täglich konsumierten Kalorien und Zigaretten. Ich verwünschte mein Leben und machte mir nicht bewusst, dass ich im Besitz einer Sache war, die wertvoller ist als Gold: Jugend. Doch meine ganze Kindheit lang wollte ich nichts damit zu tun haben. Möglicherweise ging meine Idee, mich als Kummerkastentante zu bewerben, auf diesen verzweifelten Wunsch zurück: Ich wollte kein trampeliger Teenie sein, der auf seinem Bett liegt und Ratschläge liest, sondern eine lebenskluge Frau, die anderen ebendiese Ratschläge erteilt.
Als ich dann erwachsen wurde, zog es mich zu einer ganz bestimmten Sorte von Mentorin hin. Ich wollte mir von Frauen in schwarzen Kaschmirpullovern erklären lassen, wie ich mein Leben zu leben hätte, vorzugsweise in drastischen Worten. Welche Rezepte ich nachkochen, welche Männer ich daten, welche Frisur ich ausprobieren sollte. Auch aus diesem Grund wurde Nora Ephron zu meiner Lieblingsschriftstellerin und meinem ewigen Lebensguru. Ihre journalistischen und persönlichen Essays sind auf geradezu militante Weise konkret (Gib nicht zu viel für eine Handtasche aus, niemals nur das Eiweiß essen, immer etwas mehr Butter in die Pfanne und mehr Badeöl in die Wanne geben als nötig.) Ich brauche keine fröhlichen Lifestyle-Influencerinnen mit weißen Zähnen und modellierten Gesichtern, die jedes Video mit »Hey, guys« beginnen und mir dann erklären, ich solle unbedingt diese Süßkartoffelbrownies probieren, »die es auch in der nicht-veganen Variante gibt, falls ihr das mögt«. So etwas brauche ich kein bisschen. Ich brauche eine gebieterische Dame, die mir sagt, ich solle mich mal zusammenreißen. Eine lustige, clevere, »mir doch scheißegal«-Frau mit einer Liste scheinbar willkürlicher Regeln, die mein Leben besser machen, effizienter, leichter und vor allem vergnüglicher. Sie soll mir sagen, dass ich, wenn ich diese Regeln nicht befolge, dumm bin. Von einem Mann würde ich mir so etwas niemals anhören, aber wenn eine weise ältere Frau mit Statement-Ohrringen mir erzählt, was sie vom Leben gelernt hat, hänge ich an ihren Lippen. Falls ich auf einer Hochzeitsfeier abtauche und weder am Käsebüfett noch an der Bar zu finden bin, sitze ich wahrscheinlich zu Füßen einer Großmutter oder Großtante und lasse mich von einer Wolke Shalimar und traurigen Liebesgeschichten berauschen.
Es gibt nur einen einzigen Mann, den ich jemals um Rat gefragt habe. In einer von vielen schlaflosen Nächten während meines annus horribilis schrieb ich eine Mail an Nick Cave. Er versendet einen Newsletter, The Red Hand Files, in dem er als mystischer und poetischer Kummerkastenonkel auf die Zuschriften seiner Fans reagiert. Während meiner Jahre als eifrige Leserin von Problemseiten hatte ich niemals einer fremden Person geschrieben und sie um Rat gebeten. Aber da saß ich nun in der Dunkelheit zwischen Mitternacht und Morgengrauen auf meinem Bett und bat Nick Cave um Hilfe. Ich werde nicht verraten, was ich ihn gefragt habe, weil es zu peinlich wäre, außerdem hat er nicht geantwortet. Aber das macht nichts. Meinen intimsten Schmerz einem semiprofessionellen Problemlöser zu offenbaren, hat mich etwas gelehrt: Andere um Hilfe zu bitten, ist der Beginn der Heilung. Es war, als hätte ich mich im Schutz der Dunkelheit zum Hafen geschlichen und eine Flaschenpost ins Wasser geworfen, und nun malte ich mir aus, wer sie finden würde. Indem ich meine Sorgen aufschrieb, schuf ich eine Möglichkeit, dass ein anderer Anteil daran nehmen und ganz ohne mich zu kennen das Richtige antworten könnte. Was ich fühlte, hatten schon viele andere vor mir gefühlt, und plötzlich war ich nicht mehr die einsamste und traurigste Frau auf der Welt.
Einige Jahre zuvor hatte ich eine andere Redakteurin um eine Ratgeberkolumne angefleht (um welche, werde ich nicht verraten, aber sie erschien in der Vogue) und war abgelehnt worden. Es war ganz fraglos besser so, denn inzwischen sehe ich ein, wie schwierig es für viele Leute ist, Rat von einer Mittdreißigerin anzunehmen, geschweige denn von einer Mittzwanzigerin. Doch im Alter von einunddreißig Jahren gelang es mir dann endlich, meine wundervolle Style-Redakteurin davon zu überzeugen, dass dieses Medium wie für mich gemacht war. Es war der Ort, an dem ich mich ganz offen an die Leserschaft wenden konnte, ohne notwendigerweise offen über mich zu sprechen. Wo ich meine Meinung über die Gefühle fremder Leute äußern durfte, nicht über den Zustand der Welt. In meinen ersten zehn Jahren als professionelle Texterin hatte ich vor allem von meinen persönlichen Fehlschlägen berichtet, in meinen Augen ein gutes Training für eine Kummerkastentante. Ich konnte und wollte nicht behaupten, allwissend zu sein oder eine Expertin oder auch nur ein Mensch, der immer die richtigen Entscheidungen trifft. Ich bot mich als eine Frau an, die Fehler gemacht hatte und dazulernen wollte. Die das Leben besser zu verstehen versuchte, genau wie die Personen, die mir schrieben.
Der erste Schwung aus Zuschriften erwies sich als untypisch komisch. Da war die Frau, die »fast sofort« nach dem ersten Lunch Sex mit ihrem Date-Partner hatte; der pensionierte Zahnarzt, dessen Kinder keine Lust mehr hatten, seine neueste »Eroberung« kennenzulernen; die Frau, die nach Paris umziehen wollte und fürchtete, sich vor den Einheimischen durch ihre »spektakulären« Alkoholabstürze zu blamieren; eine andere Frau, die fürchtete, sie könnte Hunde mehr lieben als Männer. Nun, da ich die Kolumne einige Jahre lang betreut habe, weiß ich, dass wöchentlich dieselben Probleme hereinschneien (Ich bin nicht verliebt; Meine Liebe wird nicht erwidert; Ich möchte eine Freundschaft beenden; Meine Mutter nervt). Wohl aus diesem Grund hat die bekannte Kolumnistin Claire Rayner alle Probleme und Antworten in Kategorien zusammengefasst (z.B.: Dieser Brief betrifft Problem Nr. 45, Antwort Nr. 78). Ich schreibe gern über diese Kummerkastendauerbrenner, denn ihre zuverlässige Wiederkehr und die Tatsache, dass wir in unserem einzigartigen Leid doch alle gleich sind, hat etwas Tröstliches. Oft sind es gerade diese Kolumnen, die am häufigsten geteilt und kommentiert werden. Doch man kann solche Anfragen nicht wieder und wieder beantworten, ohne sich irgendwann zu wiederholen, und dann erscheint ein ursprünglich ernst gemeinter Rat nur noch banal.
Am meisten sehne ich mich nach ungewöhnlichen Problemen und merkwürdigen Details, die tief ins moralische Labyrinth führen und die Menschen zwingen, sich eine kluge Strategie zu überlegen. Eine meiner Lieblingsfragen stammt von einer Frau, die sich in den Sohn des langjährigen Partners ihrer Mutter verliebt hatte (sozusagen ihren Stiefbruder). Nach dem besten Sex ihres Lebens fragte sie sich, ob das, was sie da taten, richtig, falsch oder vielleicht sogar illegal war (war es nicht, wie mir einer der Sunday-Times-Ressortleiter versicherte). Von so einem Problem hatte ich noch nie gehört, und nun musste ich mir Gedanken zu meiner Haltung machen. Während jener Woche holte ich die Meinung von allen greifbaren Kolleginnen und Freunden ein und lotete alle möglichen Antworten aus. Nichts finde ich aufregender, als so eine Frage in meiner Mailbox zu finden. Wobei in meinem Hinterkopf natürlich immer die vermeintlich wahre Geschichte von der Kolumnistin einer überregionalen Zeitung herumspukt, die mit großem Ernst eine Reihe von detailreichen und ungewöhnlichen Zuschriften beantwortete, nur um später zu erfahren, dass es sich um Fakes handelte, die auf berühmten Filmplots basierten, ganz nach dem Motto: »Ich führe ein Antiquariat in Notting Hill und habe mich in eine Kundin verliebt. Das Problem ist, dass sie in einer völlig anderen Branche arbeitet und in Amerika lebt. Soll ich mein Glück trotzdem versuchen?« Wann immer mir eine Anfrage ein bisschen zu grotesk vorkommt, gleiche ich sie mit IMDb ab, um nicht einem zugegeben sehr cleveren Scherz zum Opfer zu fallen.
Viele der Zuschriften, die ich in meinem ersten Jahr als Kummerkastentante erhielt, hatten mit Corona zu tun. Ich wollte nicht immer wieder die Pandemie als Erklärung für ein Elend anführen, weil mir das zu naheliegend erschienen wäre und auch ein bisschen faul. Trotzdem fand ich es wichtig, ihre durchschlagende und unberechenbare Wirkung auf alle Bereiche des Lebens zu berücksichtigen, vor allem, da niemand Erfahrung damit hatte. Ich bekam viele Zuschriften von Leuten, die sich aufgrund abweichender politischer Ansichten mit ihren Verwandten zerstritten hatten, ein Punkt, um den man bei Diskussionen über Corona oft nicht herumkam. Gequälte Seelen beschrieben ihre Einsamkeit, ihre Trauer darüber, das Leben zu verpassen, ihre Angst, als junger Mensch oder Single zu kurz zu kommen. Eine weitere Sorte Zuschriften stammte von langjährig Verheirateten, die sich plötzlich an ihre erste Liebe erinnerten. Ich fand das ebenso unvermeidlich wie verständlich, war ich doch während der Lockdowns selbst zu einer Archivarin meiner Beziehungen geworden. Als körperliche Begegnungen nicht mehr möglich waren, fand ich Trost im Virtuellen. Ich las alte WhatsApp-Chats mit Freundinnen, die bis ins Jahr 2017 zurückreichten, scrollte bis zu meinem ersten iPhone-Foto aus dem Jahr 2010 zurück und blätterte in meiner Geschichte wie in einem Hochglanzmagazin beim Friseur. Ich googelte meine Exfreunde in Kombination mit »LinkedIn« oder »JustGiving«, um herauszufinden, ob ich wieder mit dem Menschen in Kontakt kommen könnte, der sie einmal waren, ganz ohne sie direkt zu kontaktieren.
Ich versuche, nicht Corona die Schuld an allem zu geben, und außerdem versuche ich, nicht zu streng über das Internet zu urteilen. Über das »böse Internet« möchte ich wirklich nichts mehr lesen oder hören. Wir alle wissen, wie vergiftet Teile davon sind. Wir alle wissen, dass bestimmte Menschen keinen gesunden Umgang damit pflegen. Das Internet ist wie Alkohol, Autofahren oder Sex. Wir sollten uns über die Risiken informieren und uns entsprechend verhalten, und ich kann mir gut vorstellen, dass der Zugriff darauf eines Tages überwacht und begrenzt wird. Aber an dem Punkt sind wir noch nicht, und bis es so weit ist, finde ich es wenig hilfreich, jeden zweiten Satz mit »Im Zeitalter von Social Media …« zu beginnen. Alle Probleme auf die Existenz einer digitalen Welt zu schieben, wäre zu bequem. Ich glaube nicht, dass das Internet unsere Ängste erfunden hat. Ich glaube, das Internet bietet uns einfach nur einen Raum, wo wir sie vorzeigen können. Wenn ich in der Vergangenheit die Nachteile des Internets beklagt habe, habe ich übersehen, wie sehr es unser Leben bereichert. Ich persönlich kenne viele sehr glückliche Paare, die sich über eine Dating-App oder Social Media kennengelernt haben. Und während mein Freundeskreis und ich älter werden und immer weniger Zeit füreinander finden, muss ich zugeben, dass ich mich manchen geliebten Menschen weniger nah fühlen würde, gäbe es keine WhatsApp-Gruppen, keine Stories auf Instagram, keine geteilten Alben mit Fotos von den Enkeln und keine öffentlichen Kalender, mittels derer wir ermitteln, wie und wann zur Hölle wir uns endlich treffen können.
Inzwischen finde ich die Frage viel interessanter, ob manche Internetprobleme nur ein Symptom sind, hinter dem sich unsere eigentlichen Fragen verbergen, und meine Hoffnung ist es, anderen bei dieser Diagnose zu helfen. Eine wiederkehrende Sorge im Dear Dolly-Postfach ist die, etwas zu verpassen. Häufig kontaktieren mich Mittzwanzigerinnen, die gerade nach London gezogen sind und befürchten, sie könnten zu wenig Spaß haben, oder Singles, die sich fragen, ob sie zu wenig daten. Oft höre ich von Frauen, die in einer Beziehung sind und schreckliche Angst davor haben, dass ihr Leben vielleicht nicht erfüllt ist und sie sich mit ihrer Entscheidung für einen Partner alle anderen, möglicherweise besseren Optionen verbaut haben. Ich soll ihnen sagen, ob die Stabilität, die sie in der festen Bindung gefunden haben, ein Zeichen für eine gute Beziehung ist oder in Wahrheit ein Hinweis auf Stagnation und mangelnde Abwechslung. Viele Leute sind der Meinung, unsere kollektive Bindungsphobie habe sich durch Social Media, die Tyrannei des ständigen Vergleichens und unser gesteigertes Bewusstsein für mögliche Alternativen noch verschlimmert. Doch spannender finde ich die Erklärung, dass es einfach schwieriger ist, sich ewig zu binden, wenn man so viel länger lebt; mit anderen Worten, dass es sich hier nicht um ein digitales Problem handelt, sondern um ein existenzielles. Unsere Lebenserwartung nähert sich langsam der Neunzig an, was bedeutet, dass wir im mittleren Alter einen Menschen kennenlernen und immer noch fünfundvierzig Jahre mit ihm verbringen können. Natürlich ist die Vorstellung einer lebenslangen Bindung für uns beängstigender als für unsere Großeltern, besonders da Frauen erst seit kurzem die gleichen sexuellen Freiheiten und beruflichen Möglichkeiten zugestanden werden wie Männern. Der Widerspruch zwischen dem Wunsch nach einer gesicherten häuslichen Existenz und einem Leben in nomadischer Freiheit entspringt einem menschlichen Instinkt, der in der männlichen Literatur mit ihren zerrissenen männlichen Protagonisten endlos seziert wurde. Nun finden wir Frauen uns plötzlich im gleichen Dilemma wieder, und ich werde niemals aufhören, es zu erkunden.
Denn wenn ich Zuschriften lese und beantworte, geht es mir immer ums Erkunden. Nur selten habe ich eine simple Lösung parat. Als ich Graham Norton in seiner Zeit als Kummerkastenonkel interviewte, erzählte er mir, er habe es immer als seine Aufgabe betrachtet, die Sichtweise des Menschen einzunehmen, dessen Verhalten gerade kritisiert wird. Wenn eine Person Rat sucht und Probleme mit der Freundin, dem Partner, der Familie oder dem Chef schildert, wäre es ein Leichtes, Mitgefühl zu zeigen und ihr zu sagen, sie habe recht. Die Sache von allen Seiten zu betrachten, ist viel schwieriger. Und dort, glaube ich, beginnt die wahre Arbeit der Kummerkastentante – sie muss sich in das Umfeld der Ratsuchenden einfühlen und allen Beteiligten dieselbe Empathie entgegenbringen. Ich gebe mir Mühe, in meinen Antworten genau das zu tun. Selbst wenn ich das Verhalten eines Menschen klar missbillige, sollte ich versuchen zu begreifen, welche Motivation vielleicht dahintersteht.
In einigen wenigen Fällen fiel es mir schwer, den Hilfesuchenden eine neue Perspektive aufzuzeigen, nämlich immer dann, wenn sie anscheinend in einer schädlichen oder potenziell gefährlichen Beziehung, Freundschaft oder Familiendynamik festhingen. Die körperliche Unversehrtheit hat immer Vorrang vor dem absoluten Durchblick. Einmal schrieb mir eine Leserin eine zweite Nachricht, in der sie mir mitteilte, sie habe sich, nachdem sie in der Zeitschrift meine Antwort auf ihre Frage gelesen habe, von ihrem Freund getrennt. Was mich daran erinnerte, wie ernst Zuschriften dieser Art zu nehmen sind. Ich habe sie nur selten beantwortet, weil ich mir darüber im Klaren bin, dass es dafür mehr Ausbildung braucht als nur ein bisschen »Schule des Lebens«.
Das Einzige, worauf ich unweigerlich scharf reagiere, ist Puritanismus in allen Ausprägungen. Ich hasse Puritanismus, und dieser Tage gibt es viel zu viel davon. Unsere Phobie vor Exzessen aller Art und unser Zurückhaltungsfetisch gefallen mir gar nicht. Ich werde nicht zulassen, dass sich jemand für sein Essen, Trinken oder seine Promiskuität selbst verurteilt, vor allem dann nicht, wenn das Urteil ganz eindeutig von anderen übernommen wurde. Ich kann es generell nicht leiden, wenn Leute sich über den Lebensstil oder die Gepflogenheiten anderer beschweren. Außerdem bin ich ziemlich intolerant, was die zwanghafte Anbetung von beruflichem Erfolg angeht. Zugegebenermaßen bin ich selbst von meiner Arbeit ziemlich besessen, aber je älter ich werde, desto deutlicher erkenne ich, dass Karriere zu machen für viele Menschen nicht das Richtige ist. Niemand sollte dafür verurteilt werden, dass er seine Beziehung und sein privates Glück wichtiger findet als seine Arbeit. Ich mag es auch nicht, wenn Leute sich beschweren, ihre Partner oder Freunde seien weniger ehrgeizig als sie selbst. Ganz generell möchte ich Menschen davon abbringen, gewissen Umständen, die in meinen Augen keine Leistungen sind, einen moralischen Wert beizumessen (beispielsweise dünn, reich, Jungfrau oder nüchtern zu sein).
Ein Teil meiner Leserschaft verurteilt mich für meine Weigerung, in meiner Kolumne zu moralisieren. Die Sunday-Times-Stammklientel versammelt sich jede Woche im Kommentarbereich und teilt das Übliche aus: ihr Urteil. Wer hat recht, wer hat unrecht, wer eine Abreibung verdient? Sie erwartet einen eindeutigen Urteilsspruch, und wenn ich keinen liefere, debattieren sie in der Kommentarspalte weiter. Besonders faszinierend finde ich, wie heftig vor allem die Reaktionen auf das Thema Untreue ausfallen. Bei fast allen Kolumnen zum Fremdgehen explodiert die Zahl der Shares und Kommentare. Zu betrügen oder betrogen zu werden ist eine traurige, aber weitverbreitete Erfahrung – höchstwahrscheinlich finden wir alle uns irgendwann im Leben an einem Punkt wieder, an dem wir aktiv oder passiv davon betroffen sind. Und doch gibt es in den Augen meiner Leserschaft nichts, was dringender skandalisiert werden sollte als dieses Phänomen. Statt der organisierten Religion mit ihren gesellschaftlichen Sanktionsmaßnahmen bleiben uns anscheinend nur noch die medialen Kommentarbereiche.
Seit langem werde ich von einem Leser verfolgt, dessen Namen ich an dieser Stelle nicht nennen werde, denn das wäre wohl genau das, was er sich wünscht. Jeden Sonntag meldet er sich zu Wort, manchmal eine Minute nach Mitternacht, wenn die Online-Ausgabe gerade abrufbar ist, und droht damit, sein Sunday-Times-Abo zu kündigen. Sein Problem mit mir reicht in die Zeit vor meiner Kummerkastenkolumne zurück, was bedeutet, dass die Drohung seit über fünf Jahren im Raum steht. Er findet mich, und das ist sein Hauptproblem, unendlich langweilig. Ich langweile ihn über alle Maßen. Hin und wieder verfasst er eine eigene Antwort an die Person, die mich um Rat gefragt hat. Inzwischen ist mir klar geworden, dass er den Kommentarbereich als seine eigene Minikolumne begreift. Ich kann ihn gut verstehen, wahrscheinlich ginge es mir an seiner Stelle genauso. Wenn ich lese, wie andere ihm zur Qualität seiner Beiträge gratulieren, fühle ich stellvertretend für ihn einen seltsamen Stolz, gerade so, als hätten wir gemeinsam einen Sieg errungen.
Abgesehen von der einen oder anderen lautstarken Kritik habe ich immer gern für die Sunday Times geschrieben. Als Feministin mit einer liberalen politischen Einstellung empfand ich die Aufgabe stets als ein riesiges Privileg. Ich habe einen direkten Draht zur englischen Mittelschicht, und wenn ich mich hinsetze und meine Kolumne schreibe, empfinde ich jede Woche dieselbe Freude. Ich schmuggele Botschaften auf die hinteren Seiten der Style-Beilage, die dann wiederum in die Haushalte von Hampshire geschmuggelt wird. Richterinnen, Gesetzgeber und Tories lesen meine Worte bei Toast und Marmelade. Linksliberale Menschen meines Alters brauche ich wohl kaum davon zu überzeugen, dass Frauen sich nicht für unverbindlichen Sex schämen müssen oder dass man einen Expartner, der plötzlich trans ist, nicht verleugnen soll. Wenn ich auswähle, welche Zuschriften ich beantworte, bin ich mir immer der Tatsache bewusst, dass sich hier eine Gelegenheit bietet, Themen dort zu normalisieren, wo ihnen vielleicht immer noch ein Stigma anhaftet. Und zu normalisieren ist wirksamer als zu dozieren, vor allem da ich selbst noch viel zu lernen habe. Ich möchte die Leute keinesfalls belehren, sondern mich als Kummerkastentante (und Mensch) in Empathie üben, und ich hoffe, dass meine Leserschaft mich auf diesem Weg begleitet.
Die meisten Nachrichten bekomme ich von heterosexuellen Frauen, die sich wegen eines Mannes an mich wenden. Ich sehne mich nach diverseren Fragestellungen von einem diverseren Publikum, aber ich kann nur die Zuschriften beantworten, die mich erreichen (einige Pessimisten behaupten, die Mails würden von der Redaktion selbst verfasst, was nicht stimmt; in dem Fall wären sie garantiert viel abwechslungsreicher). Gelegentlich schreiben mir auch Männer, und ich staune jedes Mal darüber, wie anders ihre Probleme gelagert sind. Die Briefe meiner Leserinnen folgen mehr oder weniger demselben Muster: »Dies ist mein Problem; aus diesem Grund vermute ich, dass es meine Schuld ist; ich weiß, dass ich vermutlich kein echtes Problem habe, weshalb ich mich für meine Anfrage schäme; danke für deine Zeit; nun, da ich alles aufgeschrieben habe, geht es mir schon viel besser. Bin ich ein schlechter Mensch?« Wogegen männliche Ratsuchende weniger Schwierigkeiten damit haben, die Verantwortung auf das Objekt ihrer Beschwerde zu schieben. Außerdem sind sie überzeugt, dass ihr Problem ein echtes Problem und daher diskussionswürdig ist.
Angesichts all dessen fällt es mir manchmal schwer, nicht schwermütig zu werden. Wenn ich die Zuschriften einer beliebigen Woche nebeneinanderlegen würde, ergäben sie eine Geschichte der weiblichen Verunsicherung; des Gefühls, nicht gut genug und von der Wiege bis zur Bahre keine richtige Frau zu sein. Jedes einzelne Jahrzehnt eines Frauenlebens ist von einem neuen Selbstzweifel geprägt. Angefangen beim Teenager, der sich für sein Aussehen hasst, geht es in den frühen Zwanzigern mit der Frage weiter, warum man noch Jungfrau ist, gefolgt von der Sorge (und den entsprechenden Selbstvorwürfen), mit Mitte oder Ende zwanzig immer noch keine feste Beziehung zu haben. Dann kommen die Dreißiger – und ich ertrinke förmlich in panischen Zuschriften von Frauen, die fürchten, womöglich nie Kinder zu bekommen. Wenn sie dann doch Kinder bekommen haben, schreiben sie mir, was für schreckliche Mütter oder Freundinnen sie sind, weil sie es nicht schaffen, ihr Sozialleben mit ihrem Familienalltag zu vereinbaren. Wenn ihre Kinder älter werden, fürchten sie, schlechte Partnerinnen oder Ehefrauen zu sein. Und dann sind da noch die verzweifelten Mails von Frauen jenseits der sechzig, die von der Erektionsschwäche ihres Mannes berichten und wissen wollen, ob es jetzt ihre Aufgabe sei, im Schlafzimmer für neuen Schwung zu sorgen.
Wenn ich den Frauen antworte, versuche ich zunächst, ihnen die Scham zu nehmen. Ich glaube, es ist immer hilfreich zu wissen, dass andere Frauen das Gleiche erleiden. In der Folge brauchen sie sich nicht mehr schlecht zu fühlen, sondern können sich der Problemlösung widmen. Die Kummerkastenphrase »Das ist total normal und sehr gesund« finde ich inzwischen absolut berechtigt. Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal eine Frau sein würde, die »Das ist total normal und sehr gesund« sagt, aber hier bin ich nun, die Matrone, die Klartext redet: »Mädels, es gibt nichts, was ich nicht schon gesehen hätte.«
Wenn es passend ist – also meistens –, gehe ich auf die Frage ein, was ein konkretes Problem mit gesellschaftlich verankertem Sexismus zu tun hat. Wenn Frauen sich für ihr Sexleben oder ihre sexuelle Vergangenheit schämen oder sich hasserfüllt über ihren Körper äußern, möchte ich das in einen größeren gesellschaftlichen Kontext setzen und ihnen verdeutlichen, woher ihre Selbstzweifel kommen. Ganz besonders wichtig ist mir das, wenn ich die typischste aller Anfragen erhalte: Eine Frau fürchtet, niemals Mutter zu werden. Ich fühle mich dem Thema persönlich verbunden, weil meine Jahre des Kolumnenschreibens zufällig in jene Lebensphase fallen, in der man sich der Fruchtbarkeitspanikmache unmöglich entziehen kann. Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um den Frauen jenen Trost zu bieten, den ich selbst immer suche, und sie darauf hinweisen, dass viele vermeintliche »Fakten« zum Thema Fruchtbarkeit auf überholten und unseriösen Studien basieren; dass es mehr als einen Weg gibt, eine Familie zu gründen; und vor allem, dass man nie wissen kann, wie schnell sich die eigenen Lebensumstände ändern.
Diese Art von Zuschriften – Mails von Frauen, die fürchten, keine richtigen Frauen zu sein – sind für mich am einfachsten zu beantworten. Meine Ratschläge sind ein Versuch, eigene Wunden ebenso zu heilen wie die meiner Leserinnen. Während der Zusammenstellung dieses Bandes habe ich jede einzelne meiner veröffentlichten Antworten noch einmal gelesen und begriffen, dass ich, obwohl ich als Autorin kein offenes Buch mehr bin, in meiner Kolumne meine kompliziertesten Gefühle und meine kostbarsten Erfahrungen untergebracht habe. Vielleicht war es kein Zufall, dass ich ausgerechnet an jenem Punkt, als ich scheinbar nichts mehr im Griff hatte, auf die Idee kam, Fremde in allen Lebenslagen zu beraten. In den meisten Fällen hätte meine Antwort genauso gut mit »Liebe Dolly« beginnen können. Ich schätze mich glücklich, dass ich in meinem Job die Zeit und den Raum bekommen habe, mein Leben auf diese Weise zu verarbeiten.
Dating
1. Dating
2. Freundschaft
3. Beziehungen
4. Familie
5. Sex
6. Trennungen
7. Körper & Seele
Immer wieder bekomme ich einen Korb von Männern, die sich ein paar Monate später auf eine kleinere Frau einlassen. Inzwischen glaube ich, dass vor allem meine Körpergröße (eins achtzig) die Männer abschreckt. In der Vergangenheit habe ich oft gehört, ich sei zu groß, um sexy rüberzukommen, was ich inzwischen so weit verinnerlicht habe, dass ich mich auf Dates nur noch unwohl fühle, vor allem, wenn ich den Mann online kennengelernt habe. Hilfe!
Einer der seltsamsten Widersprüche im Leben großer Frauen ist, dass sie einerseits aufgrund ihrer Größe viele Unannehmlichkeiten in Kauf nehmen müssen, andererseits regelmäßig gesagt bekommen, andere Frauen seien neidisch auf ihre Statur. »Du hast Glück«, erklären die zierlichen Elfen dieser Welt. Perfekt proportionierte, durchschnittlich große, niedliche junge Frauen mit Disneyprinzessinnengesicht, die noch nie im Übergrößeladen einkaufen mussten und nicht wissen, wie sehr der Zwickel einer zu kleinen Strumpfhose kneift, wollen dir ernsthaft erzählen, sie gäben alles dafür, so groß zu sein wie du.
In der Vergangenheit haben mich die Mythen, die große Frauen umranken, fast in den Wahnsinn getrieben. Warum kann ich groß zu sein nicht genießen, wenn mich angeblich alle darum beneiden? Wenn groß zu sein so erstrebenswert ist, warum schäme ich mich dann ständig dafür? Warum fühle ich mich wie ein uneleganter, wenig femininer, unsicherer Trampel? Warum heißt es, Männer würden große Frauen lieben, wenn mich doch die meisten, die kleiner sind als ich, nicht daten wollen?
Natürlich gab es auch für mich Momente der Genugtuung – Abende mit Freundinnen, an denen ich hohe Absätze trug und sie die unermüdlichen Kommentare von Fremden endlich einmal mitbekamen, oder das gelegentliche »Lol, sorry, zu groß« auf den Dating-Apps. Nie werde ich die Folge von First Dates