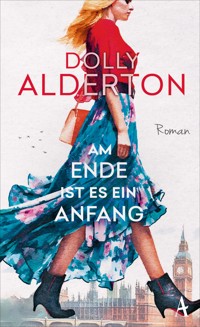Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
*** Der große Sunday Times-Bestseller *** "Dolly Alderton ist die Königin moderner Romantik." VOGUE "Ich liebe Gespenster . Dolly kann einfach über alles schreiben – was niemanden verwundert!" Candice Carty-Williams "Ich liebe es und musste laut lachen: wahnsinnig gut geschrieben, randvoll mit Ideen und so spannend, dass man es nicht aus der Hand legen kann." Philippa Perry "Ich liebe dieses Buch. Es ist weise, wahrhaftig, punktgenau beobachtet und urkomisch. Dolly Aldertons Talent ist phänomenal." Elizabeth Day "Ich schwärme unendlich für Dolly!" Laura Karasek "Es gibt keine Schriftstellerin auf der ganzen Welt, die mit Dolly Alderton vergleichbar wäre – und bald werden es alle, aber auch wirklich alle wissen." Lisa Taddeo "Dolly Alderton hat ein unglaubliches Talent, Menschen zu erreichen und zu berühren." Marian Keyes Die erfolgreiche Food-Autorin Nina George Dean trägt ihren zweiten Vornamen, weil ein Hit von Wham! an ihrem Geburtstag vor zweiunddreißig Jahren auf Platz eins der Charts stand. Das beeindruckt Max, den sie von einer Dating-App kennt und der auf rasante Weise ihr Herz erobert. Doch genauso schnell, wie er Nina an der Nachtbushaltestelle das ewige Glück versprochen hat, verschwindet er plötzlich wieder aus ihrem Leben – ohne eine Spur zu hinterlassen. Gleichzeitig plant Ninas Exfreund seine Hochzeit, und ihre beste Freundin erwartet ihr zweites Baby. Und dann erkrankt ihr geliebter Vater an Demenz. Als Nina alles zu entgleiten droht, wünscht sie sich nur noch sehnlichst in ihre Jugendtage zurück – bis sie erkennt, dass das Leben immer in dem Moment zwischen Vergangenheit und Zukunft spielt. Der große Roman über Beziehungen in all ihren Formen – hinreißend, lustig und tief berührend erzählt.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Dolly Alderton
Gespenster
Roman
Aus dem Englischen von Eva Bonné
Atlantik
Für Mum und Dad, weil ihr nie verschwunden seid
Prolog
An meinem zweiunddreißigsten Geburtstagsmorgen am 3. August 2018 putzte ich mir die Zähne und wusch mir das Gesicht, während »The Edge of Heaven« aus den Boxen im Wohnzimmer dröhnte. Ich würde den Tag allein verbringen und tun und essen, worauf ich Lust hatte. Zum Frühstück gab es ein pochiertes Ei auf Toast. Im Alter von zweiunddreißig Jahren kann ich selbstbewusst verkünden, dass ich drei Sachen perfekt beherrsche: zu jedem Termin und jeder Verabredung pünktlich und mit einem Puffer von fünf Minuten zu erscheinen; in Gesellschaft mein Gegenüber mit Fragen zu füttern, damit die Person das Reden übernimmt (Bist du eher introvertiert oder extrovertiert? Lässt du dich von deinem Kopf oder eher vom Herzen leiten? Hast du schon mal was in Brand gesteckt?); und das perfekte Ei zu pochieren.
Ich griff zum Handy. Meine Eltern hatten mir ein lachendes Selfie geschickt und wünschten mir alles Gute zum Geburtstag. Meine beste Freundin Katherine hatte ihre kleine Tochter Olive gefilmt, wie sie »Happy Birthday, Tante Niino« sang (sie konnte meinen Namen immer noch nicht richtig aussprechen, obwohl ich es oft mit ihr geübt hatte). Von meiner Freundin Meera bekam ich das GIF einer langhaarigen, sehr teuer aussehenden Katze mit Martini in der Pfote. Die Nachricht darunter lautete: »KANN DEINE PARTY HEUTE ABEND GAR NICHT ERWARTEN, GEBURTSTAGSKIND!!!!!«, was bedeutete, dass sie auf jeden Fall vor elf im Bett liegen würde. So läuft das immer, wenn junge Mütter sich zu sehr auf einen freien Abend freuen – sie verausgaben sich durch hohe Erwartungen, ziehen mit einem zum Scheitern verurteilten Amüsierwillen los, bekommen Lampenfieber und gehen am Ende nach zwei Bier heim.
Ich lief nach Hampstead Heath, um ein bisschen im Ladies’ Pond zu schwimmen. Nach der dritten Runde setzte ein unaufdringlich leichter Sommerregen ein. Ich liebe es, bei Regen zu schwimmen, und ich wäre noch viel länger im Wasser geblieben, hätte die matronenhafte Bademeisterin mich nicht aufgefordert, den Teich »aus Sicherheitsgründen« und zum »Schutz meiner Gesundheit« zu verlassen. Ich sagte ihr, ich hätte Geburtstag, als könnte mir die Information eine inoffizielle Bonusrunde verschaffen. Aber sie wies mich darauf hin, dass ich im Wasser vom Blitz erschlagen und »wie eine Scheibe Speck« gebraten würde, und sie habe keine Lust, hinterher die Sauerei wegzumachen, »ob Sie heute Geburtstag haben oder nicht«.
Nachmittags war ich wieder zu Hause in meiner neuen – und ersten eigenen – Wohnung, einem kleinen Zweizimmerapartment im ersten Stock einer viktorianischen Villa in Archway. Die Maklerin hatte die Immobilie generös als »gemütlich, individualistisch und renovierungsbedürftig« beschrieben. Der Teppich hatte die Farbe von Instantkaffeekörnchen und fühlte sich auch genau so an, im apricot gekachelten Bad gab es ein stillgelegtes Bidet, und in der Kiefernholzküche waren zwei Schranktüren kaputt. Ich war überzeugt, dass ich für die Modernisierung bis an mein Lebensende würde arbeiten müssen, aber wenn ich morgens die Augen aufschlug und die verkrusteten Putzwirbel unter der Decke sah, war ich jedes Mal überglücklich. Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal eine Immobilie in London besitzen würde, und dass der Wunschtraum sich erfüllt hatte, machte sie zur schönsten Wohnung aller Zeiten.
Ich hatte zwei Nachbarn. Über mir wohnte eine ältere Witwe namens Alma, deren Treppenhausgeplauder über erfolgreiche Tomatenzucht auf dem Fensterbrett ebenso reizend war wie ihre großzügigen Spenden von selbstgemachten Kibbeh. Im Erdgeschoss lebte ein Mann, dem ich noch nie begegnet war, obwohl ich nun seit Monaten hier wohnte und mehr als einmal versucht hatte, mich vorzustellen. Ich ging runter und klopfte an, aber nichts passierte. Alma sagte, auch sie habe noch nie mit ihm gesprochen, allerdings habe sie sich einmal mit seiner Mitbewohnerin über die Stromzähler im Haus unterhalten. Ich hörte ihn immer nur – er kam abends um sechs von der Arbeit und war mehr oder weniger leise, bis er dann gegen Mitternacht etwas kochte und dabei fernsah.
Für die Anzahlung hatte ich mein Erspartes zusammengekratzt, außerdem bekam ich Tantiemen für mein erstes Kochbuch Taste und hatte für das zweite, The Tiny Kitchen, einen Vorschuss erhalten. Taste war eine Sammlung von Rezepten, zu denen mich die Essensgewohnheiten meiner Familie, meine Freundschaften, meine einzige Langzeitbeziehung, meine Reisen und meine Lieblingsköche inspiriert hatten. Zwischen den Rezepten erzählte ich abschnittweise meine Lebensgeschichte. Die Grundaussage war, dass ich mich über meine kulinarischen Vorlieben selbst kennengelernt hatte. Erst auf diesem Umweg hatte ich erfahren, was ich im Leben wollte und brauchte. In Taste schilderte ich, wie ich mein Hobby – private Koch-Events an Abenden und Wochenenden – und meinen Job als Englischlehrerin unter einen Hut gebracht und dann eines Tages genug gespart hatte, um mich als Food-Journalistin selbstständig zu machen. Es ging darin auch um die Beziehung mit Joe, meinem ersten und einzigen Freund, und um unsere einvernehmliche Trennung. Er hatte nichts dagegen gehabt, dass ich über ihn schreibe. Das Buch wurde ein Überraschungserfolg und handelte mir eine eigene Kolumne in einer Zeitungsbeilage ein, dazu noch ein paar Werbedeals mit Lebensmittelherstellern (schlecht fürs Seelenheil, aber sehr gut für mein Bankkonto) und einen zweiten Buchvertrag.
The Tiny Kitchen war gerade fertig geworden. Das Buch handelte von der Zeit, als ich nach der Trennung von Joe in ein Einzimmerapartment ohne Vorratskammer gezogen war, und davon, wie es sich dort gekocht hatte. Der Herd war so klein wie ein Spielzeug gewesen und hatte nur eine einzige Kochplatte gehabt. In Gedanken war ich schon bei meinem dritten Buch, für das ich noch einen Titel suchte. Es würde vom Kochen und Essen nach Jahreszeiten handeln und befand sich noch in der Entwicklungsphase. Meine jahrelange Erfahrung als Autorin hatte mich gelehrt, dass ein Text dann am besten war, wenn er noch nicht mehr war als eine Idee und deshalb perfekt.
Ich ließ mir eine Wanne ein und schmiss eine alte, heißgeliebte iTunes-Playlist an, die ich in meinen Zwanzigern oft gehört hatte. Ursprünglich hatte sie »Auf in den Kampf« geheißen, aber vor ein paar Jahren hatte ich sie in »Gute alte Zeit« umbenannt, um meine Entwicklung weg von körperlicher Enthemmung hin zum achtsamen und wohlüberlegten Vergnügen zu dokumentieren. Ich hatte sie in meinem ersten Jahr an der Uni zusammengestellt und regelmäßig gehört, wenn ich mich abends fertig machte. Die Lieder begleiteten eins nach dem anderen mein Ritual der Verweiblichung, wie ich es seit fünfzehn Jahren befolgte: Haare waschen und kopfüber trocken föhnen, um einen Volumenzugewinn von mindestens zehn Prozent zu erzielen; Oberlippe enthaaren; zwei Schichten Mascara auftragen; einen zweiten Drink zu sich nehmen; zwei Spritzer Parfum in die Luft geben und durch die Wolke schreiten. Wenn das vorletzte Stück lief (»Nuthin’ but a ›G‹ Thang«), stand das Taxi schon vor der Tür, während ich mir über der Küchenspüle die Waden mit einer Einwegklinge zerschnitt, weil ich vergessen hatte, sie unter der Dusche zu rasieren.
Inzwischen waren meine Haare wieder naturbraun und schulterlang. Vor einiger Zeit hatte ich mir einen Pony schneiden lassen, um die ersten Fältchen an meiner Stirn zu verdecken. Sie waren hauchzart wie bei zerknitterten Taschentüchern, aber in meinen Augen sichtbar genug, um versteckt zu werden. Mit dem Make-up musste ich mich glücklicherweise nicht lange aufhalten; im Grunde hatte es nie zu meinem Gesicht gepasst. Ich war glücklich darüber, schließlich kostete mich das Föhnen und Rasieren schon genug Zeit und verursachte mir darüber hinaus Schuldgefühle, weil ich es irgendwie unemanzipiert fand, genau wie mein totales Desinteresse an Handwerksarbeiten und Sport. Wenn ich mich besonders verzweifelt fühlte, rechnete ich mir manchmal aus, wie viele Minuten meiner verbleibenden Lebenszeit ich, sollte ich fünfundachtzig werden, damit verbringen würde, die Härchen von meiner Oberlippe zu zupfen, und anschließend stellte ich mir vor, wie viele Fremdsprachen ich in derselben Zeit hätte lernen können.
Zu meiner Geburtstagsparty trug ich ein hochgeschlossenes schwarzes Kleid mit tiefem Rückenausschnitt. Ich verzichtete auf den BH, allein um damit anzugeben, dass ich keinen brauchte, was aber nur ein schwacher Trost dafür war, so kleine Brüste zu haben. Inzwischen machte mir das allerdings nichts mehr aus, meinem Körper gegenüber war ich mehr oder weniger gleichgültig geworden. Ich benötigte eine ärgerliche Kleidergröße L bei einer Größe von einem Meter dreiundsechzig. Ich war froh, dass dicke Hintern wieder in Mode waren, und hatte nicht ohne Stolz ermittelt, dass sie auf den gängigen Pornoseiten mindestens zwei eigene Unterkategorien besetzt hielten.
In diesem Jahr hatte ich gewisse Leute absichtlich nicht eingeladen, vor allem meinen Exfreund Joe nicht. Ich hätte mir gewünscht, dass er dabei wäre, aber in dem Fall hätte ich auch seine Freundin Lucy einladen müssen. Lucy war harmlos, sah man von der Tatsache ab, dass sie eine Handtasche in der Form eines Stiletto besaß. Aber sie litt unter dem dauerhaften Eindruck, zwischen uns müsste etwas geklärt werden. Wenn sie ihre drei Gläser Spezialrosé intus hatte (»Ist der auch blush?«, fragte sie den genervten Barmann und war damit an diesem Abend die hundertvierunddreißigste Frau mit derselben Frage), war es Zeit für eine Aussprache. Sie wollte wissen, ob ich ein Problem mit ihr hätte oder ob unser Verhältnis angespannt sei. Sie erzählte mir, wie wichtig ich für Joe sei und wie viel ich ihm bedeutete. Sie umarmte mich immer wieder und betonte mehrmals, sie hoffe doch sehr, wir könnten Freundinnen sein. Sie war seit über einem Jahr mit Joe zusammen, und ich hatte sie schon mindestens fünfmal gesehen, dennoch schien sie es für nötig zu halten, mich bei Gruppentreffen in eine stille Ecke zu ziehen und Dinge zu klären. Ich hatte mich oft gefragt, warum sie das tat, und ich war zu dem nachsichtigen Schluss gekommen, dass sie wahrscheinlich zu viele geskriptete Reality-Shows gesehen hatte. In ihren Augen war eine Party erst dann eine Party, wenn sich zwei Frauen in Schößchenkleidern gegenüberstanden, einander die Hände reichten und Sätze sagten wie: »Seit du mit Ryan geschlafen hast, kann ich nicht mehr mit dir befreundet sein, aber ich werde dich immer lieben wie eine Schwester.«
Ich hatte ungefähr zwanzig Gäste in den Pub eingeladen, hauptsächlich Freunde von der Uni oder noch aus Schulzeiten. Ein paar ehemalige Kollegen waren auch dabei, und Leute, mit denen ich gerade beruflich zu tun hatte. Außerdem noch einige Menschen, die ich genau zwei Mal im Jahr sah, auf ihrer Geburtstagsparty und auf meiner, und mit denen es eine unausgesprochene Vereinbarung auf Gegenseitigkeit gab: Wir wollten die Freundschaft nicht ganz aufgeben, hatten aber absolut keine Lust, über die zwei jährlichen Treffen hinaus Zeit zu investieren. Das Arrangement fand ich ebenso traurig wie tröstlich.
Der Form halber waren Lebenspartner und Ehegatten mit eingeladen, die meisten davon bemühte, aber wenig charismatische Männer. Die Hoffnung auf interessante Gespräche mit ihnen hatte ich längst aufgegeben. Ich wusste, sie würden in einer Ecke sitzen, Bier trinken und jedes Mal »Herzlichen Glückwunsch!« rufen, wenn sie mir auf dem Weg zum Klo begegneten, und irgendwann würden sie müde und weinerlich werden und ihre Freundin oder Frau zum Gehen überreden. Ich war fasziniert von den Männern, die meine Freundinnen sich ausgesucht hatten, vor allem von der Art und Weise, wie sie untereinander kommunizierten. Als ich noch mit Joe zusammen war und wir uns in der Gruppe trafen, taten sich die Freundinnen und Frauen in kriegerischer Euphorie zusammen. Wir erzählten, hörten zu und lernten einander kennen, und jedes Mal wenn wir uns bei den Verabredungen unserer Männer begegneten, kamen wir uns ein bisschen näher. Im Laufe der Jahre habe ich beobachtet, dass die zu einer Party mitgeschleppten Männer sich genau gegenteilig verhalten. Ich habe immer wieder erlebt, dass die meisten Männer ein Gespräch nur dann für gut halten, wenn sie mit Fakten oder einem Spezialwissen glänzen können, das den anderen fehlt, oder wenn sie interessante Anekdoten erzählen oder jemandem Tipps und gute Ratschläge zu einem anstehenden Vorhaben geben können. Ganz generell würde ich behaupten, dass sie in einer Unterhaltung ihre Duftmarken setzen wollen, wie ein Hund gegen einen Baum pinkelt. Wenn sie an einem Abend mehr Neues erfahren als verbreitet haben, geht es ihnen schlecht, gerade so, als wäre die Party ein Fehlschlag oder sie selbst wären nicht in Form gewesen.
Am liebsten sind ihnen Momente banaler Übereinstimmung. Ich habe das bei ausnahmslos jeder Geburtstagsfeier meiner Freundinnen beobachtet. Die Männer suchen nach ähnlichen Gedanken und Erfahrungen, um sich einem Mit-Mann verbunden zu fühlen, ganz ohne ihn mühsam kennenlernen oder verstehen zu müssen. Oh, mein Bruder hat auch in Leeds studiert. Wo hast du gewohnt? MEINST DU DAS ERNST, o Gott, okay, also du kennst doch die Silverdale Road beim Studentenwohnheim? Also, links davon. Da war das. Die Freundin von einem meiner Kommilitonen hatte da eine Wohnung. Die Welt ist ja so klein! Warst du schon mal in dem Pub an der Ecke? Im King’s Arms? Nein? Oh, du solltest mal hingehen, der ist echt super, ein toller Pub.
Ich konnte mich nur für einen einzigen der mitgebrachten Partner begeistern, Gethin, der seit Jahren mit meinem Studienfreund Dan zusammen war. Die beiden standen mir sehr nah, mit ihnen hatte ich die wildesten Partys und die phantastischsten Urlaube erlebt, auch wenn sie mich in der letzten Zeit ehrlich gesagt enttäuschten. Ich hatte immer geglaubt, auf Dan und Gethin sei in Sachen Traditionsbruch Verlass, aber langsam erschien mir ihr Lebenswandel beispiellos bieder. Sie hatten ihre Beziehung »geschlossen«, was ich ernüchternd fand. Ihre sexuellen Eskapaden hatten den Stoff für urkomische Anekdoten geliefert, außerdem waren sie das einzige mir bekannte Beispiel für eine geglückte offene Beziehung. Doch irgendwann hatten sie einen unglaublich komplizierten Konsumplan entwickelt, der vorsah, dass sie nur an jedem zweiten Wochenende Alkohol trinken durften und unter der Woche gar keinen. Sie gingen immer seltener aus, weil sie ständig auf diese oder jene Anschaffung sparten. Vor Kurzem hatten sie den Adoptionsprozess begonnen und eine Dreizimmerwohnung in Bromley gekauft.
Dan und Gethin kamen, tranken jeweils zwei Gläser Limonade, erzählten von dem Albtraum, den sie gerade durchmachten – der Baum eines Nachbarn wucherte bis auf ihr Grundstück –, und verabschiedeten sich vor acht, um »gen Bromley« aufzubrechen. Aus ihrem Mund klang es wie eine Reise nach Mordor.
Die Gäste hatten äußerst passende Geschenke mitgebracht, was mir bewies, dass sich meine Persönlichkeit auf eine gelungene und unmissverständliche Weise in meinem Lebenswandel und meinen geschmacklichen Vorlieben spiegelte. Ich bekam eine frühe Ausgabe der Whitsun Weddings von Philip Larkin, eine scharfe Spezialsauce, die ich sehr mag und die es nur in Amerika gibt, und einen Chinesischen Geldbaum, der sich als Einzugsgeschenk ebenso eignete wie als Glücksbringer für mein neues Buch. Das einzige unpassende Geschenk stammte von meiner ehemaligen Schulleiterin, die eingerahmte Illustration einer Hausfrau aus den 1950er Jahren beim Geschirrspülen. Die Bildunterschrift lautete: Wenn Gott gewollt hätte, dass ich den Abwasch mache, hätte er Diamanten in der Spüle versteckt! Nicht zum ersten Mal hatte ich ein Geschenk dieser Art bekommen; ich schob es auf mein verlängertes Singledasein plus meine Vorliebe für Wodka-Martinis. Anscheinend glaubten die Leute, ich hätte Verwendung für kitschige, spöttische Vintage-Slogans über Frauen, die trinken oder verzweifelt oder kinderlos oder süchtig nach Schokolade oder Shopping sind. Ich bedankte mich.
Eddie und Meera boten mir Kokain an, denn sie waren fest entschlossen, aus ihrem »ersten kinderfreien Abend seit achtzehn Monaten« das meiste herauszuholen. Meera hatte Schwangerschaft und Entbindung hinter sich gebracht und gerade mit dem Stillen aufgehört, was bedeutete, dass sie sich bis oben mit Alkohol abfüllen konnte, ohne das Baby zu gefährden. Beide hatten ein gieriges Flackern in den Augen, wie ich es auch schon bei anderen jungen Eltern am ersten kinderfreien Abend gesehen hatte. Das Kokain lehnte ich höflich ab. Ich hatte nichts dagegen, dass sie auf meiner Party koksten, aber mir war bewusst, wie lang und breit Meera sich über die Elternzeit auslassen würde, sobald sie high war. Ihre Lieblingsphrase war »die starren patriarchalischen Strukturen der Elternschaft«. Eddie trat unruhig von einem Bein aufs andere, weil er sich nicht entspannen konnte, und beide fingen immer wieder von Glastonbury an, als hätten sie das Festival persönlich erfunden.
Meine einzige Singlefreundin Lola nahm mich beiseite und erklärte nervös, sie fühle sich von den anwesenden Paaren verurteilt und ignoriert. Sie trug roten Lippenstift und eine merkwürdige Hochsteckfrisur. Die eine Hälfte der gewellten Strähnen war aufgedreht, die andere hing offen herunter, fast wie bei einer Richterperücke. So sah sie nur aus, wenn sie sehr verkatert war und etwas gutzumachen hatte. Sie räumte ein, ihre Nacht sei ziemlich heftig gewesen; ein Date, das um sieben in einem Pub am Kanal begonnen hatte und dann ins Restaurant und anschließend in eine Bar und dann in eine zweite Bar verlagert wurde, hatte gegen drei bei ihr zu Hause geendet. Ganz offensichtlich hatte sie nicht geschlafen. Lola war Eventmanagerin, wobei ich sie zu der Zeit eher als freiberufliche Daterin bezeichnet hätte. Sie war seit zehn Jahren Single und verzweifelt auf Beziehungssuche. An der Uni waren wir beste Freundinnen gewesen, und niemand in unserem großen Bekanntenkreis konnte verstehen, warum sie mit den Männern nie über eine Handvoll Treffen hinauskam. Sie war charmant, lustig und schön. Sie hatte sich bei der Verteilung der guten Gene rücksichtslos vorgedrängelt und nicht nur riesige Brüste geschenkt bekommen, sondern riesige Brüste, die keinen BH brauchten. Sie erzählte mir, sie könne sich wegen des Dates am Vorabend »die Haare raufen«. Ich scherzte, dass ihre Frisur in dem Fall doch recht gut zu ihrem Gefühlszustand passte, woraufhin sie ankündigte, mit der U-Bahn nach Hause zu fahren. Ich sagte, dass Eddies kleiner Bruder jeden Moment kommen würde: sechsundzwanzig, Single und angehender Tiermediziner. Lola sagte, vielleicht bleibe sie noch auf einen letzten Prosecco.
Meine älteste Freundin Katherine, die ich seit meinem ersten Tag in der weiterführenden Schule kenne, wollte wissen, was ich mir vom neuen Lebensjahr erwarte. Ich sagte, ich sei bereit, jemanden kennenzulernen, worauf sie mit ungezügelter Freude reagierte. Vermutlich glaubte sie, meine Entscheidung, mir endlich einen Freund zu suchen, käme der lange vorenthaltenen Billigung ihrer Heirat und Familiengründung gleich. Mir war aufgefallen, dass viele Menschen Anfang dreißig dazu neigen: Sie fassen jede Entscheidung, die man für sich persönlich trifft, als Kritik an ihren Lebensumständen auf. Wenn man Labour wählt und sie die Liberal Democrats, glauben sie, man tue das nur, um sie und ihre politische Haltung vorzuführen. Wenn sie in einen Vorort ziehen und man selbst lieber in der Stadt wohnen bleibt, nehmen sie an, man wolle ihnen beweisen, wie viel glamouröser man ist. Katherine hatte mit Mitte zwanzig ihren Mann Mark kennengelernt und war zur Monogamie übergelaufen, und seither wollte sie, dass alle anderen sich anschlossen und es ihr gleichtaten.
Seit meiner Trennung von Joe vor zwei Jahren war ich inaktiver Single – einer, der nicht auf Verabredungen geht. (Wir waren sieben Jahre lang ein Paar gewesen und hatten vier davon zusammengewohnt, sodass unser Leben und unsere Freundeskreise mehr oder weniger deckungsgleich gewesen waren. Irgendwann hatte er angefangen, Sachen zu sagen wie »Hallöchen« statt Hallo oder »Gesichtsbuch« statt Facebook.) Nach der Trennung versuchte ich, den vielen Sex nachzuholen, den ich zwischen zwanzig und dreißig nicht gehabt hatte, und ließ es ein halbes Jahr lang richtig krachen. In meinem Fall hieß das, dass ich mit drei verschiedenen Männern schlief und jeden einzelnen zu meinem nächsten festen Freund machen wollte. Nachdem ich mir eine Selbstdiagnose als liebessüchtig gestellt hatte, beschloss ich, vor meinem dreißigsten Geburtstag auf kein Date mehr zu gehen und herauszufinden, was es heißt, Single zu sein. So kam es, dass ich zum ersten Mal überhaupt allein wohnte und reiste und nebenbei den Übergang von der Lehrerin und Hobbyköchin zur Autorin schaffte. Mühsam trainierte ich mir alle Gewohnheiten ab, die sich während einer knappen Dekade der gemütlichen, behaglichen Zweierbeziehung eingeschlichen hatten.
Um elf rief der Barmann die letzte Runde aus. Katherine hatte sich schon vorher verabschiedet, weil sie wieder schwanger war. Sie hatte nichts davon gesagt, aber ich konnte es daran sehen, wie sie sich über die Pickles hermachte. Sie klaute den anderen die Gurkenscheiben aus den Burgern und bestellte zuletzt eine ganze Portion Cornichons. Während der Schwangerschaft mit Olive war sie nach stark gewürzten Speisen verrückt gewesen. Ich hatte sie gefragt, ob ihr Appetit auf Umami etwas mit der Namensgebung des Babys zu tun habe, was sie aber gar nicht lustig fand. In den letzten Jahren habe ich gelernt, was Schwangere und frischgebackene Mütter nicht hören wollen, und dazu zählen alle Fragen und Kommentare zum voraussichtlichen Namen des Babys. Eine Freundin redet gar nicht mehr mit mir, seit ich ihr – in bester Absicht! – erklärte, dass Beaux ein französischer Plural ist und sie ihren Sohn deswegen lieber Beau taufen sollte. Ich erfuhr erst danach, dass der Name schon eingetragen war. Eine andere nahm mir übel, dass ich gefragt hatte, ob der Name ihrer Tochter Camelia auf die Pflanze oder die Damenbinde zurückgehe. Am wenigsten konnten sie es leiden, wenn sie einem den Babynamen »im Vertrauen« enthüllten und man ihn später aus Versehen ausplauderte und die Schwangere über Umwege davon erfuhr.
Der schlimmste Patzer (und in derselben Liga wie jemanden nach seinem Alter fragen, in der Öffentlichkeit rülpsen oder das Messer ablecken) ist, wenn man eine offensichtlich schwangere Frau fragt, ob sie schwanger sei. Und wenn sie ihre Schwangerschaft dann endlich öffentlich macht, darf man auf keinen Fall sagen, man habe es längst gewusst. Das hassen sie. Sie brauchen die Theatralik der großen Offenbarung. Ich kann das verstehen, ehrlich, wahrscheinlich würde ich es nicht anders handhaben. Wenn man neun Monate lang keine Cocktails anrühren darf, muss man eben sehen, wo der Nervenkitzel herkommt. Deswegen nickte ich nur verständnisvoll und sagte nichts, als Katherine sich früh und mit der Ausrede verabschiedete, sie müsse am nächsten Morgen »das Auto in die Werkstatt bringen«.
Gegen zehn kamen erste Überlegungen auf, in einen rund um die Uhr geöffneten Klub in King’s Cross umzuziehen, am lautesten durch den angehenden Tierarzt. Lola redete schon auf ihn ein und zwirbelte sich dabei die Haarsträhnen auf, aber als es dann Viertel nach elf war, machten alle einen Rückzieher. Eddie und Meera mussten den Babysitter ablösen. Ich gruselte mich an ihrer Stelle vor der unruhigen bis schlaflosen Nacht, die vor ihnen lag. Lola und der Tierarzt sagten, sie wollten in eine »Weinbar« umziehen, mit anderen Worten an einen schummrigen Ort, wo sie weitertrinken und Unsinn reden würden, bis einer den ersten Schritt machte und sie sich an einen Barhocker gelehnt aneinander reiben konnten. Ich hatte nichts dagegen, denn ich war reif fürs Bett. Ich umarmte die letzten Gäste zum Abschied und versicherte ihnen, wie sehr ich sie liebte (ich war nicht mehr ganz nüchtern).
Zu Hause hörte ich mir die erste Hälfte meines aktuellen Lieblingspodcasts an, ein beschwingter Streifzug durch die Geschichte der Serienmörderin. Dabei schminkte ich mich ab, putzte mir die Zähne und benutzte sogar Zahnseide. Ich stellte meine neue alte Ausgabe der Whitsun Weddings ins Regal und den Chinesischen Geldbaum auf den Kaminsims und war ungewohnt und restlos zufrieden. An diesem Augustabend, während der ersten Stunden des zweiten Tages meines dreiunddreißigsten Lebensjahrs, fühlte es sich an, als wären alle willkürlichen Komponenten meiner Existenz vor langer Zeit entworfen worden, um sich just in diesem Moment zusammenzufügen.
Ich legte mich ins Bett und lud mir zum ersten Mal überhaupt eine Dating-App runter. Lola, eine Veteranin des Online-Dating, hatte mir Linx empfohlen (das Logo zeigte den Umriss einer schleichenden Wildkatze), weil es die höchste Erfolgsrate für Langzeitbeziehungen hatte und sich dort angeblich die meisten brauchbaren Kandidaten herumtrieben.
Ich füllte die »Ich über mich«-Seite aus. Nina Dean, 32, Food-Journalistin. Wohnt in: Archway, London. Sucht nach: der Liebe und dem perfekten Rosinenbrötchen. Ich lud ein paar Fotos hoch, und dann schlief ich ein.
Noch unspektakulärer hätte ich meinen zweiunddreißigsten Geburtstag nicht feiern können. Es war die perfekte Art, das seltsamste Jahr meines Lebens einzuläuten.
Erster Teil
»Unsere Vorstellungskraft ist verantwortlich für die Liebe, nicht unser Gegenüber.«
Frei nach Marcel Proust
1
Meine Eltern hatten aus rein pragmatischen Gründen entschieden, in einem nördlichen Vorort von London zu wohnen. Wenn ich sie fragte, was sie bewogen hatte, East London zu verlassen, als ich gerade einmal zehn Jahre alt war, verwiesen ihre Antworten immer nur auf das Praktische: Es war dort ein bisschen sicherer, die Häuser ein bisschen größer, es war immer noch nah genug an der Stadt, es gab eine gute Verkehrsanbindung und gute Schulen. Über ihr Leben in Pinner sprachen sie wie jemand, der einen frühen Flug gebucht hat und deswegen ein Hotel in Flughafennähe braucht. Es war bequem, anonym und unkompliziert und erfüllte keinen Zweck, außer seinen Zweck zu erfüllen. Nichts am Wohnort meiner Eltern verschaffte ihnen zusätzliche Freuden oder Genüsse, weder die Landschaft noch die Geschichte des Ortes, auch nicht die Architektur, die Parks, die Gemeinde oder die Kultur. Sie lebten in einem Vorort, weil man dort alles fußläufig erreichen konnte. Sie hatten ihr Zuhause – und damit ihr Leben – um die Bequemlichkeit herumgebaut.
Als wir noch zusammen waren, hat Joe seine Herkunft aus dem Norden Englands oft gegen mich verwendet. Er hielt sich für den authentischeren Menschen, für bodenständiger und deswegen im Recht. Es gab nur wenig an ihm, was ich noch unangenehmer fand als seine Art und Weise, die eigene Integrität an Yorkshire auszulagern und die harte Arbeit an der eigenen Person auf romantische Klischees von Bergleuten und Moorlandschaften abzuwälzen. Zu Beginn unserer Beziehung gab er mir das Gefühl, wir wären in unterschiedlichen Galaxien aufgewachsen, denn seine Mum war eine Friseurin aus Sheffield und meine eine Schulsekretärin aus Harrow. Aber als er mir zum ersten Mal sein Elternhaus zeigte, einen bescheidenen Dreizimmerbungalow in einem Vorort von Sheffield, begriff ich, wie sehr ich getäuscht worden war. Wenn ich nicht gewusst hätte, dass wir in Yorkshire waren, hätte ich geschworen, irgendwo in jenem Niemandsland zwischen London und Hertfordshire zu sein, wo ich aufgewachsen war. Kieselputz und Bleiglasfenster, wohin man auch sah. Joes alte Straße mit dem Wendekreis sah aus wie meine damals, ebenso die Häuser, und im Kühlschrank seiner Eltern lagerten die gleichen Joghurts mit Fruchtecke und das gleiche Aufbackbrot mit Knoblauchbutter. Er hatte ein ähnliches Fahrrad besessen wie ich und war an den Wochenenden durch Straßen mit den gleichen Hausfassaden und den gleichen roten Schindeldächern gefahren. Auch er war an seinem Geburtstag zu Pizza Express eingeladen worden. Aber nun war er aufgeflogen. »Komm mir nie wieder damit, wir kämen aus vollkommen unterschiedlichen Welten«, sagte ich auf der Rückfahrt im Zug zu ihm. »Tu nie wieder so, als wärst du der Typ aus dem Jarvis-Cocker-Song, der in eine Frau mit langem Mantel verliebt ist. Du gehörst so wenig in dieses Lied wie ich in eins von Chas & Dave. Wir sind praktisch im selben Vorort aufgewachsen.«
In den letzten Jahren habe ich mich oft nach der vertrauten Vergangenheit gesehnt. Nach der Einkaufsstraße mit den ungewöhnlich vielen Zahnarztpraxen, Friseurläden und Wettbüros, wo es weit und breit kein cooles Café gab. Der lange Fußweg vom Bahnhof nach Hause. Die Frauen mit den immergleichen Bobs, die Männer mit der Halbglatze, die Teenies im Hoodie. Das völlige Fehlen von Individualität, die friedliche Kapitulation vor dem Alltag. Aus einem jungen Erwachsenen wird dort im Handumdrehen ein normaler Erwachsener. Meine täglichen Entscheidungen – welche Partei ich wählte oder welchen Internetprovider – bestätigten mir, wer ich jetzt war, aber wenn ich für einen Nachmittag in die Kulissen meiner Jugend zurückkehrte, war es wie eine kleine Zeitreise. Sobald ich in Pinner war, fühlte ich mich wieder wie siebzehn, und sei es nur für einen Tag. Dann konnte ich so tun, als wäre meine Welt klein, meine Entscheidungen ohne Folgen und die Möglichkeiten, die vor mir lagen, einfach grenzenlos.
Meine Mum öffnete mir die Tür, wie sie jedem die Tür öffnete – auf eine Weise, die deutlich machte, wie vielbeschäftigt sie war. Sie schenkte mir ein schiefes, zerknirschtes Lächeln und klemmte sich dabei den Telefonhörer zwischen Ohr und Schulter. »Sorry«, flüsterte sie und rollte die Augen. Sie trug eine merkwürdige schwarze Hose – zu weich, um eine echte Hose zu sein, zu locker für Leggings und zu eng für einen Pyjama – und dazu ein graumeliertes T-Shirt und ihr persönliches Mindestmaß an Schmuck: dickes Goldarmband, schmale goldene Armreifen, Perlenohrstecker, eine goldene Panzerkette und den goldenen Ehering. Wahrscheinlich kam sie gerade von irgendeiner sportlichen Betätigung, oder sie war auf dem Weg dorthin. Seit ihrem fünfzigsten Geburtstag war meine Mutter verrückt nach Sport, hatte aber, soweit ich das sehen konnte, noch kein halbes Kilo abgenommen. Die postmenopausale Erschlaffung umgab ihren Körper wie eine zusätzliche Schicht, sie hatte ein kleines Doppelkinn, eine fleischige Taille und überschüssige Haut, die seitlich aus dem BH herausquoll und sich deutlich unter dem T-Shirt-Stoff abzeichnete. Außerdem war sie umwerfend. Umwerfend auf eine kuhäugige Art. Meine Mutter sah nicht gerade spektakulär aus, aber die meisten Menschen fanden sie auf eine natürliche und heimelige Weise anziehend; in der Hinsicht war sie wie ein Lagerfeuer, ein Strauß rosa Rosen oder ein Cockerspanielwelpe. Ihr espressobraunes dickes, zu einem Bob geschnittenes Haar schimmerte trotz der grauen Strähnen golden im Licht der IKEA-Flurlampe. Vom guten Aussehen meiner Mutter hatte ich so gut wie nichts geerbt.
»Ja, ja«, sagte sie in den Hörer und bedeutete mir hereinzukommen. »Super, ja, dann sehen wir uns nächste Woche zum Kaffee. Schick mir einfach die Uhrzeit, und ich bringe die Tarot-Anleitung mit, von der ich dir erzählt habe. Nein, gar nicht, du kannst sie behalten, ich kann sie jederzeit bei QVC nachbestellen. Okay. Okay. Bis dann, mach’s gut!« Sie beendete das Gespräch und umarmte mich. Dann schob sie mich von sich und musterte meinen Pony. »Das ist neu«, sagte sie wie beim Kreuzworträtsel, drei Buchstaben senkrecht.
»Ja«, sagte ich, stellte meine Handtasche ab und zog mir die Schuhe aus (alle mussten an der Tür die Schuhe ausziehen, hier wurde noch strenger kontrolliert als in der Blauen Moschee). »Hab ich mir vor meiner Party schneiden lassen. Ich dachte, damit könnte ich die zweiunddreißigjährigen Fältchen an meiner zweiunddreißigjährigen Stirn kaschieren.«
»Sei nicht albern«, sagte sie und schnippte vorsichtig gegen meine Haare. »Dafür braucht man keinen Mopp im Gesicht, sondern nur ein gutes Make-up.«
Ich lächelte, weder gekränkt noch belustigt. Ich hatte mich inzwischen daran gewöhnt, dass sie meine wenig weibliche Art enttäuschend fand. Wahrscheinlich hätte sie sich eine Tochter gewünscht, mit der man Urlaubskleidung shoppen und sich über den besten Primer austauschen konnte. Als ich ein Teenager war und Katherine regelmäßig zu Besuch kam, nötigte meine Mutter ihr ausrangierte Handtaschen und Modeschmuck auf. Die beiden wühlten im Schrank meiner Eltern wie zwei Mädchen im Kaufhaus. Als meine Mutter Lola zum ersten Mal sah, war sie auf der Stelle verliebt, bloß weil sie beide auf denselben exklusiven Highlighter schworen.
»Wo ist Dad?«, fragte ich.
»Liest.«
Ich schaute durch die Doppeltür ins Wohnzimmer, wo mein Vater in seinem flaschengrünen Lehnsessel saß. Ich sah ihn im Profil, er hatte die Beine auf einen Hocker gelegt und neben sich einen großen Teebecher. Sein kantiges Kinn und die große Nase – er hatte mir beides vermacht – schienen sich einen Wettstreit zu liefern, wer zuerst über die Ziellinie kam.
Meine Mum und meinen Dad trennten siebzehn Jahre. Sie hatten sich kennengelernt, als mein Vater stellvertretender Direktor an einer staatlichen Schule in der Londoner Innenstadt war und sie von ihrer Zeitarbeitsagentur als Schulsekretärin eingesetzt wurde. Sie war vierundzwanzig und er einundvierzig. Der Altersunterschied wurde nur noch von der Unterschiedlichkeit ihres Charakters übertroffen. Mein Vater war feinfühlig, sanft, neugierig, introvertiert und intellektuell. Es gab im Grunde nichts, was ihn nicht interessierte. Meine Mutter war pragmatisch, zupackend, organisiert, direkt und bestimmend. Es gab im Grunde nichts, in das sie sich nicht einmischte.
Ich ließ mir einen Moment Zeit, ihn durch die Glastür zu beobachten. Von hier wirkte er wie der Vater, den ich kannte, er las den Observer und wartete nur darauf, mir alles über Müllverbrennung in China, zehn interessante Fakten über Wallis Simpson oder eine vom Aussterben bedrohte Falkenart zu erzählen. Mein Vater, der mich auf den ersten Blick erkannte; nicht nur mein Gesicht, sondern mich als ganzen Menschen. Der sich im Bruchteil einer Sekunde an meinen imaginären Sandkastenfreund erinnern konnte, an das Thema meiner Dissertation, an meine Lieblingsfigur in meinem Lieblingsroman und an die Namen aller Straßen, in denen ich je gewohnt hatte. Wenn ich jetzt in sein Gesicht blickte, sah ich immer noch meinen Vater, aber etwas in seinen Augen beunruhigte mich. Manchmal war es, als läge sein gesamtes Wissen in Scherben, und nun musste er versuchen, es zu einer sinnvollen Collage zusammenzufügen.
Vor zwei Jahren hatte er einen Schlaganfall. Wir hatten schon wenige Monate später gemerkt, dass er nicht mehr der Alte war. Mein Vater mit dem messerscharfen Verstand wirkte irgendwie verlangsamt. Er fing an, die Namen von Freunden und Verwandten zu vergessen, und die selbstbewusste Lässigkeit, mit der er sonst Entscheidungen traf, schwand dahin. Bei Ausflügen entwischte er uns regelmäßig und verirrte sich. Oft vergaß er, wo er wohnte. Anfangs schoben Mum und ich es auf das Alter, wir sträubten uns gegen die Möglichkeit, es könnte etwas Ernsteres dahinterstecken. Dann eines Tages rief ein Fremder an und sagte meiner Mum, mein Vater fahre seit zwanzig Minuten im selben Kreisverkehr. Irgendwie schafften sie es, ihn abzudrängen und zum Anhalten zu bewegen. Er hatte vergessen, wo er abbiegen musste. Wir begleiteten ihn zum Hausarzt, der ihn untersuchte, seine kognitiven Fähigkeiten testete und ein MRT machen ließ. Er bestätigte unsere schlimmste Befürchtung.
»Hey, Dad«, sagte ich und ging auf ihn zu. Er blickte von der Zeitung auf.
»Hey, du!«
»Bleib sitzen.« Ich beugte mich hinunter und umarmte ihn. »Was gibt’s Neues?«
»Eine Neuverfilmung von Überredung«, sagte er und hielt die Rezension hoch.
»Oho«, sagte ich, »Jane Austen für denkende Menschen.«
»Genau.«
»Ich helfe Mum beim Kochen.«
»Mach das, Liebes«, sagte er, und dann schlug er die Zeitung wieder auf und lehnte sich in die gewohnte Ruheposition zurück.
Meine Mutter stand in der Küche und hackte Brokkoliröschen klein, neben dem Brett stapelten sich Kiwischeiben. Aus einer Box tönte eine Frauenstimme, die sehr laut und sehr deutlich über die weibliche Anpassung an das männliche Verlangen sprach.
»Was ist das?«, fragte ich.
»Das ist Geschlechtsverkehr von Andrea Dworkin. Das Hörbuch.«
»Was?« Ich drehte den Ton ein bisschen leiser.
»Andrea Dworkin, eine berühmte Feministin. Du kennst sie bestimmt, ziemlich dick, aber sie hat keinen Humor. Sie ist irre schlau …«
»Ich weiß, wer Andrea Dworkin ist, ich wollte nur wissen, warum du das hörst.«
»Das ist für die Weinlese.«
»Der Buchklub, von dem du erzählt hast?«
Sie seufzte dramatisch und holte eine Gurke aus dem Kühlschrank. »Das ist kein Buchklub, Nina, sondern ein literarischer Salon.«
»Wo ist der Unterschied?«
»Nun ja«, sagte sie, und ihre zuckende Oberlippe verriet, wie glücklich sie war, wieder einmal den Unterschied zwischen einem Buchklub und einem literarischen Salon erklären zu dürfen. »Ich und ein paar Freundinnen haben beschlossen, uns alle zwei Monate zu treffen und nicht bloß über bestimmte Bücher zu reden, sondern über unsere Gedanken dazu. Das Ganze ist also weniger eng gefasst. Jeder Salon ist einem Motto gewidmet, es gibt eine Diskussion, eine Lesung und persönliche Berichte, die mit dem Thema zu tun haben.«
»Worum geht es beim nächsten Abend?«
»›Ist jeder heterosexuelle Verkehr automatisch eine Vergewaltigung?‹«
»Okay. Und wer ist eingeladen?«
»Annie, Cathy, Sarah aus meiner Laufgruppe, Gloria, Glorias schwuler Cousin Martin, Margaret von meinem Ehrenamt im Sozialkaufhaus. Jeder muss was zu essen mitbringen. Ich mache Halloumispieße«, sagte sie, trug das Brett zum Mixer und kippte Obst und Gemüse hinein.
»Woher dieses plötzliche Interesse am Feminismus?«
Sie schaltete den Mixer ein, der die Stückchen unter schrillem Brummen und Raspeln zu blassgrünem Schleim verrührte.
»So plötzlich ist das nicht«, rief sie über das elektrische Tosen hinweg. Sie stellte den Mixer aus und goss die zähe Flüssigkeit in ein hohes Glas.
»Klingt super, Mum«, lenkte ich ein. »Ist doch toll, wenn man so engagiert und offen für Neues ist.«
»Ja«, sagte sie. »Und weil ich als Einzige Platz habe, werden wir unsere Weinlese-Treffen hier abhalten.«
»Du hast keinen Platz.«
»Das Arbeitszimmer deines Vaters!«
»Das braucht er noch.«
»Er kriegt es doch zurück. Wozu ein Zimmer haben, das kaum genutzt wird? Wir sind hier nicht im Blenheim Palace.«
»Was ist mit seinen Büchern?«
»Die kann ich hier unten in die Regale einsortieren.«
»Und seine Unterlagen?«
»Alles Wichtige ist abgeheftet, der ganze Rest kann weg.«
»Bitte lass mich vorher einen Blick drauf werfen«, sagte ich in einem leicht pampigen Kindertonfall. »Vielleicht ist ihm irgendwas davon wichtig. Vielleicht können wir es noch mal verwenden, wenn wir Material brauchen, um seine Erinnerung anzuregen und ihn …«
»Ja, ja, natürlich«, sagte sie mit bebenden Nasenflügeln und trank einen Schluck von ihrem Smoothie. »Es sind nur ein paar Kartons. Sie stehen oben auf der Treppe.«
»Okay, danke«, sagte ich, schenkte ihr ein stilles Lächeln als Friedensangebot und atmete wie beim Yoga tief und lautlos ein. »Was gibt’s sonst noch Neues?«
»Nicht viel. Ach ja, ich habe beschlossen, meinen Namen zu ändern.«
»Was? Warum?«
»Nancy hat mir nie gefallen. Viel zu altmodisch.«
»Findest du das nicht ein bisschen seltsam? Alle kennen dich als Nancy, es ist viel zu spät, niemand wird sich einen neuen Namen merken können.«
»Willst du damit sagen, ich sei zu alt?«
»Nein, ich finde nur, der geeignete Zeitpunkt für einen Namenswechsel wäre der erste Tag an der neuen Schule gewesen, nicht jetzt, wo du über fünfzig bist.«
»Tja, ich habe es aber nun mal entschieden, und ich habe auch schon recherchiert, wie es geht. So was ist überhaupt kein Problem. Es ist beschlossene Sache.«
»Und wie willst du heißen?«
»Mandy.«
»Mandy?«
»Mandy.«
»Aber.« Ich holte noch einmal tief Luft wie beim Yoga. »Mandy ist ein bisschen wie Nancy, findest du nicht? Also, vom Klang her.«
»Nein, finde ich nicht.«
»Doch, so was nennt man Assonanz.«
»Ich wusste, wie du reagieren würdest. Ich wusste, du würdest mich belehren, so wie immer. Ich verstehe überhaupt nicht, wieso das für dich ein Problem darstellt. Ich möchte einfach nur einen Namen tragen, der mir gefällt.«
»Mum«, sagte ich flehentlich. »Ich will dich nicht belehren. Aber du musst verstehen, dass das ziemlich seltsam klingt und völlig aus dem Nichts kommt.«
»Es kommt nicht aus dem Nichts! Ich habe dir immer gesagt, wie schön ich den Namen Mandy finde! Ich habe immer wieder gesagt, dass das ein sehr stilvoller und positiver Name ist!«
»Okay, er ist stilvoll und positiv, du hast recht, aber denk mal nach.« Ich dämpfte meine Stimme. »Es ist gerade vielleicht nicht die beste Zeit, Dad damit zu konfrontieren, dass die Frau, mit der er seit fünfunddreißig Jahren verheiratet ist, plötzlich einen anderen Vornamen hat.«
»Sei nicht albern. Es ist einfach nur eine kleine Namensänderung, da muss man kein großes Ding draus machen.«
»Es wird ihn verwirren.«
»Ich habe keine Zeit, das noch weiter zu diskutieren. Ich bin mit Gloria zum Vinyasa Flow verabredet.«
»Essen wir nicht zusammen? Ich bin extra fürs Mittagessen gekommen.«
»Der Kühlschrank ist voll. Du bist doch hier die Köchin. Ich bin in ein paar Stunden zurück«, sagte sie und griff nach den Schlüsseln.
Ich ging zurück ins Wohnzimmer. Dad las immer noch seine Zeitung.
»Dad?«
»Ja, Bohne?«, sagte er und hob den Kopf. Eine warme Welle der Erleichterung durchströmte mich – er hatte sich an meinen alten Kosenamen erinnert. Wie alle guten Kinderspitznamen hatte auch meiner viele unsinnige und komplizierte Abwandlungen durchlaufen – aus Nina-Bina wurde Mister Beanie, Bambini, Beanibohne und zuletzt nur Bohne.
»Mum ist ausgegangen, und ich wollte uns was kochen. Wie wäre es mit einer Frittata?«
»Frittata«, wiederholte er. »Wie heißt das in meiner Muttersprache?«
»Es ist so eine Art Omelett. Stell dir ein aufgebrezeltes Omelett vor.«
Er lachte. »Sehr schön.«
»Ich muss nur kurz nach oben und ein paar Unterlagen sortieren, und dann geht es los. Soll ich dir vorher noch einen Toast machen? Oder irgendwas anderes?« Ich sah ihm ins Gesicht und bereute sofort, mich nicht deutlicher ausgedrückt zu haben. Meistens war er immer noch in der Lage, sich schnell zu entscheiden, aber manchmal verstrickte er sich in den Antwortmöglichkeiten. Ich wünschte, ich hätte ihn vor die Wahl gestellt: »Toast, ja oder nein?«
»Vielleicht«, sagte er und runzelte ganz leicht die Stirn. »Ich weiß nicht. Später.«
»Okay. Sag einfach Bescheid.«
Ich schleppte die drei Kartons in mein altes Kinderzimmer, das sich seit meinem Auszug vor über zehn Jahren kaum verändert hatte und aussah wie eine Museumsinstallation, die den Besuchern vor Augen führte, wie man als Teenager zu Beginn der Nullerjahre so gewohnt hatte. Die Wände waren lila, an der Schranktür hing eine Fotocollage der Schulfreundinnen und an der Ecke des Spiegels eine Sammlung zerfranster, vergilbter Festivalbändchen, die Katherine und ich gesammelt hatten. Ich breitete die Akten auf dem Boden aus. Die meisten dokumentierten das Verstreichen der Zeit, aber keine Gefühle oder Beziehungen. Ich fand ganze Keile aus Neunziger-Jahre-Filofaxseiten voller Zahnarzttermine und Ferienzeiten, dazu alte Zeitungen mit Artikeln, die er aus irgendeinem Grund aufbewahrt hatte. Ich fischte ein paar Briefe und Postkarten aus dem Papiermüll: eine geschwätzige Nachricht von seinem verstorbenen Bruder, meinem Onkel Nick, der sich über das fettige Essen auf Paxos beschwerte; eine Karte von einem ehemaligen Schüler, der sich für die Unterstützung bei der Oxford-Bewerbung bedankte und ein Foto mitgeschickt hatte, das ihn strahlend am Tag seiner Abschlussfeier am Magdalen College zeigte. Meine Mutter hatte recht, mein Vater brauchte diese banalen Relikte des Alltags nicht, aber ich konnte trotzdem verstehen, warum er daran festgehalten hatte. Ich besaß bis heute einen Schuhkarton mit den Kinokarten meiner ersten Verabredung mit Joe und mit Nebenkostenabrechnungen von Wohnungen, aus denen ich längst ausgezogen war. Ich hatte mir nie erklären können, warum sie mir so viel bedeuteten, aber so war es. Sie waren ein Beweis des Lebens, das ich geführt hatte, und vielleicht würde ich sie irgendwann vorlegen müssen wie einen Führerschein oder einen Reisepass. Vielleicht hatte mein Vater geahnt, dass er die Zeit in Filofaxseiten, Briefen und Ansichtskarten festhalten musste für den Fall, dass sein Gehirnspeicher sich eines Tages wie von selbst löschte.
Plötzlich hörte ich das durchringende Gellen eines Rauchmelders. Ich lief nach unten und folgte dem Brandgeruch. Mein Vater stand hustend vor dem Toaster in der Küche und zupfte die angekokelten Reste des Observer aus dem Schlitz.
»Dad!«, rief ich über das Piepen hinweg und wedelte mit den Händen, um den Rauch zu verteilen. »Was tust du da?« Er fuhr zusammen und sah mich an, als wäre er aus einem Traum erwacht. Von der gefalteten, angesengten Zeitung in seiner Hand stieg eine dünne Rauchsäule auf. Er sah den Toaster an und dann mich.
»Ich weiß nicht«, sagte er.
2
Er hatte den Pub ausgesucht, was eine riesige Erleichterung war. Nach meinem Geburtstag hatte Lola mir via E-Mail und bei ein paar Drinks einen Crashkurs in Sachen »zeitgemäßes Dating« gegeben und mich vor den vielen Enttäuschungen gewarnt, die zweifellos auf mich zukommen würden. Eine davon war angeblich, dass die meisten Männer absolut unfähig waren, einen Ort für ein Treffen festzulegen oder auch nur vorzuschlagen. Für mich war diese apathische, unreife, gleichgültige Haltung ein echter Abturner; sie erinnerte mich an den faulen Praktikanten, der immer noch behauptet, er könne den Kopierer nicht bedienen. Lola sagte, ich müsse mich trotzdem überwinden. Andernfalls würde ich mich nie auf ein Date einlassen, den Rest meines Lebens in einem sexlosen Halbkoma auf dem Sofa verbringen und den Männern, die ich nie, niemals treffen würde, auf Linx die immer selben Nachrichten schicken: »Hey, hast du morgen Zeit? Wann? Wo würdest du gern hingehen?«
Max schlug mir noch während des ersten Chats einen Treffpunkt vor.
»Wäre eine Absturzkneipe für alte Männer okay?«, schrieb er.
»Nichts mag ich lieber!«, war meine Antwort. »Ich finde nur niemanden, der mit mir hingehen will.«
»Ich auch nicht!«
»Früher im Studium fanden alle solche Pubs gut, aber heute nicht mehr, weil es nicht mehr ironisch ist.«
»Du hast recht«, schrieb er. »Vielleicht sind wir den alten Männern zu ähnlich, um Alte-Männer-Pubs noch lustig finden zu können.«
»Vielleicht markieren die Alte-Männer-Pubs einfach nur den Beginn und das Ende unsere Trinkerkarriere. Erst ironisch als Teenager und dann als Rentner im Ernst«, schrieb ich.
»Und dazwischen sitzen wir im Fegefeuer der angesagten Bars und zahlen neun Pfund für ein Würstchen in Blätterteig.«
»Genau!«
»Wir treffen uns im Institution in Archway, Donnerstag sieben Uhr«, schrieb er. »Da gibt es Darts und einen alten irischen Wirt. Keine Negronis und keinen industrial chic weit und breit.«
»Perfekt«, schrieb ich.
»Und eine Tanzfläche, auf der ich dich, falls alles gut läuft, herumwirbeln kann.«
Ich war seit drei Wochen auf Linx, aber Max war mein erstes Date. Nicht dass ich mich nicht bemüht hätte. Insgesamt hatte ich mit siebenundzwanzig Männern gechattet. Das klingt nach viel, aber angesichts der Tatsache, dass ich anfangs vier Stunden meiner täglichen Wachzeit auf Linx verbracht und Hunderten oder Tausenden Männern Interesse signalisiert hatte, erschien mir ein Rücklauf von siebenundzwanzig eher dürftig. Ich fragte Lola, ob das normal sei. Ja, sagte sie, und dann erzählte sie mir noch, dass sich die Matches seit ihrem dreißigsten Geburtstag halbiert hatten, weil viele Männer dreißig als die obere Altersgrenze angaben. Seit sie das wisse, komme sie mit den wenigen Matches prima zurecht. Eine Zeitlang habe sie Reddit nach ihrem Namen durchsucht, weil sie überzeugt gewesen sei, da kursierten »Gerüchte« über sie, die sich im Internet verselbstständigt hatten und die Männer abschreckten. Ich hielt Lolas »Gerüchte im Internet«-Theorie für narzisstischen Größenwahn, aber dann erinnerte ich mich daran, dass sie früher überzeugt gewesen war, sie würde bei einem »Mordkomplott« sterben. Ich hatte es damals schon nicht über mich gebracht, ihr zu sagen, dass nur berühmte Menschen einem Komplott zum Opfer fallen. Normale Menschen werden einfach so erschossen.
In den ersten Tagen war ich hingerissen von Linx. Ich geriet vollkommen in den Bann der App. Ich hatte das romantische System überlistet – so viele attraktive, interessante junge Männer, und alle warteten nur auf mich. Jahrelang hatte man uns eingeredet, die Suche nach der großen Liebe sei ein unmögliches Unterfangen, das gutes Timing und jede Menge Glück voraussetzte. Ich hatte immer geglaubt, ich müsste zu blöden Pop-up-Events und in besondere Buchläden gehen, in der U-Bahn und bei Hochzeitsfeiern die Augen offen halten, im Ausland andere reisende Singles in ein Gespräch verwickeln und mindestens vier Abende pro Woche ausgehen, um meine Chancen zu erhöhen. Aber nun waren all diese strategischen Arbeitsstunden überflüssig – anders als früher brauchte ich kaum noch Zeit zu investieren. Ich saß in der Bahn, im Bus oder auf dem Klo, sichtete potenzielle Partner und wunderte mich darüber, wie effizient und zeitsparend die Methode war. Die Suche nach der großen Liebe nahm anders als befürchtet kaum Platz in meiner Terminplanung ein; ich konnte sie nebenbei erledigen, sogar beim Fernsehen, wenn ich wollte.
Lola erklärte mir, diese Reaktion sei vollkommen normal für jemanden, der sich zum ersten Mal bei einer Dating-App registriert habe. Das Hochgefühl würde in wenigen Wochen nachlassen und einer bedrückten Übersättigung weichen, bevor ich die App in ungefähr drei Wochen löschen würde. Das Ganze spiele sich, sagte sie, unweigerlich in dieser Reihenfolge ab, bis man dann endlich jemanden traf. Lola lud und löschte die Dating-Apps seit sieben Jahren.
Sie hatte mich auch gewarnt, dass die Apps neue User an sich binden, indem sie ihnen ihre besten Stücke anbieten. Offenbar steckte ein Algorithmus dahinter. Wer am meisten angeklickt wird, muss als Köder für die Neuzugänge herhalten, aber nach dem ersten Monat findet man sich dann auf der Resterampe wieder. Sie sagte auch, dass es funktioniere, weil man unbeirrt durch den Bodensatz wate in der Hoffnung, doch noch auf den verborgenen Schatz zu stoßen.
Die häufigste Art der Konversation auf Linx waren gestelzte Plaudereien, so lau und schwach wie ein Sommerwind. Alle begannen mit derselben Schlaftablette: »Hey, wie geht’s?«, oder dem Emoji einer winkenden Hand. Antworten bekam ich mit mindestens drei Stunden, häufiger drei Tagen Verzögerung. Doch das lange Warten wurde nie mit Qualitätsinhalt belohnt. »Sorry, hatte viel zu tun, Food-Journalistin, wie cool. Ich mache was mit Immobilien« – mehr kam meistens nicht dabei rum. Viele Chats drehten sich um Tage: Wie war dein Tag? Wie sieht es mit Dienstag aus? Wie war dein Donnerstag? Was machst du am Wochenende?, was inhaltlich ganz und gar bedeutungslos wurde, weil der Tag, auf den der Mann sich bezog oder nach dem ich gefragt hatte, erst eine Woche später wieder zur Sprache kam.
Und dann gab es noch eine andere Sorte von Ärgernis. Ich erkannte es schnell, es blieb dennoch ein Ärgernis: die Sorte Mann, die ich »engagierter Blender« nenne. Der Blender nutzt sein Profil, um seine traumhafte und unerschütterliche Verlässlichkeit zu demonstrieren. In seiner Galerie ist mindestens ein Foto, das ihn mit dem Baby eines Freundes zeigt oder, noch schlimmer, wie er mit nacktem Oberkörper Tapete von der Wand kratzt oder einen Holzboden abschleift. Im Profil standen hohle Phrasen wie »Auf der Suche nach der Richtigen« oder »Mein Traumabend? Bei einem Film von Sofia Coppola auf dem Sofa kuscheln«. Ich fand das ziemlich durchschaubar und biss nicht an.
Ebenso erfolglos, aber immerhin respektabel waren die Männer, die unverfroren zu verstehen gaben, dass sie an Sex und nichts anderem interessiert waren. Ich hatte frühzeitig eine virtuelle Begegnung mit so einem Exemplar, einem Brille tragenden Grundschullehrer namens Andrew. Wir chatteten freundlich eine halbe Stunde lang, bevor er mich fragte, ob ich heute Abend »auf ein Date gehen« wolle. Es war schon nach elf. Ich fragte zurück, ob er ein echtes Date meine oder ob ich einfach zu ihm in seine Wohnung kommen solle. »Ach, gegen ein schnelles Bier hätte ich nichts einzuwenden«, antwortete er angesäuert. Damit endete der Dialog.
Manche Männer, die mich kontaktierten, bedienten sich eines kraftlosen, ausgelaugten Jargons: »Guten Abend, Mylady – ob es mir vergönnt ist, Euch an diesem sonnigen Sonntag in den Pub zu begleiten?«, schrieb einer. »Wenn Musik die Nahrung der Liebe ist, spiel weiter, aber wenn eine Food-Autorin die Liebe so liebt wie die Musik – wollen wir nächste Woche tanzen gehen?«, fragte ein anderer. Ein wirres Rätsel, das mich an die Textaufgaben in Matheklausuren erinnerte (Shivani hat zehn Orangen. Wie viele bleiben ihr, wenn sie die Quadratwurzel davon weggibt?). Ein wohl einzigartiger Balzstil, der mir nie zuvor untergekommen war, nostalgisch und verträumt, verschroben und sinnfrei. Humorlos, undurchdringlich.
Andere hingegen verließen sich auf inhaltliche Schlichtheit. »ENGLÄNDERIN??«, fragte ein rothaariger Kfz-Mechaniker gleich zu Beginn. Einige Nachrichten glichen einem unzensierten, langweiligen, ganztägigen Gedankenstrom; ich erhielt Schwafeleien wie »Hey, wie geht’s, ich musste eben kalt duschen, weil der Durchlauferhitzer kaputt ist, ärgerlich!! Tja, was soll’s, jetzt erst mal raus auf einen Kaffee und vielleicht dazu ein Schinkensandwich, man lebt ja nur einmal. Später gehe ich schwimmen, wollte meinen Kumpel Charlie auf einen Drink treffen, aber er findet keinen Hundesitter, in dem Pub, wo wir uns treffen wollen, sind Hunde verboten. Wie läuft es so bei dir? xx.« »Sehr gelungenes Profil, Nina«, schrieb ein Mann, als wäre er ein Klassenlehrer, der die Halbjahreszeugnisse austeilt.
Und je mehr Männer ich kennenlernte, desto vielfältigere Kategorien von Menschen entdeckte ich. Ich hatte ja keine Ahnung gehabt. Es gab Männer, die unglaublich stolz darauf waren, einmal in Las Vegas gewesen zu sein. Andere waren von der Tatsache sehr eingenommen, in London zu leben, was mich befürchten ließ, dass sie einen Drink im Pub ausschlagen würden und stattdessen lieber auf den Millennium Dome klettern oder sich von der Fassade des Naturkundemuseums abseilen wollten. Immer wieder begegneten mir Festivalmänner – Typen, die tagsüber in der IT-Branche arbeiteten und nachts Glitzer im Gesicht trugen oder die ihr Urlaubsgeld sparten, um sich fünf Festivalbesuche im Jahr leisten zu können. Es gab Männer, die auf Hausbooten lebten, mit brennenden Fackeln jonglierten, Haremshosen trugen und ganz generell wirkten, als wollten sie mehr. Ich sah Hunderte von Männern, die so taten, als machte ihnen der Umstand, auf Linx zu sein, nichts aus. Einige erzählten, ihre Freunde hätten sie dazu gezwungen und sie wüssten nicht, was sie dort sollen, gerade so, als könnte man sich ganz aus Versehen die App runterladen, das Profil mit den vielen persönlichen Fragen ausfüllen und Fotos hochladen, so schnell und unüberlegt, wie man auf der Autobahn die falsche Ausfahrt nimmt.
Da waren die Männer, die unbedingt beweisen wollten, wie viele Bücher sie gelesen hatten und dass sie überhaupt lasen, und zwar nicht Dan Brown, sondern echte Literatur von Hemingway, Bukowski und Alastair Campbell. Da waren Graphikdesigner. Himmel, so viele Graphikdesigner! Wie kam es, dass ich im echten Leben nur eine Handvoll Graphikdesigner kannte und mir auf der Dating-App mindestens dreihundertfünfzig begegneten?
Die traurigste Kategorie war die der Abgehängten. Manche merkten vielleicht nicht einmal, dass sie einer ganz speziellen und sehr traurigen Spezies angehörten, aber so war es nun mal. Meistens waren sie Ende dreißig, Anfang vierzig, und ihr halbtoter Blick strafte ihr breites Grinsen Lügen. Auf den Fotos hielten sie gerade eine Rede als Trauzeuge, oder sie verfolgten mit ehrfürchtiger Miene die Taufe eines Babys aus dem Freundeskreis. Ihre Erschöpfung und ihre Sehnsucht waren greifbar. Etwa jedes zehnte Profil gehörte einem von ihnen, und wann immer ich darauf stieß, brach es mir erneut das Herz.
Meine gleichzeitig beruhigendste und verstörendste Entdeckung während jener intensiven Wochen des zwanghaften Wischens nach rechts und links war die Einfallslosigkeit der Menschen. Keiner von uns würde jemals in der Lage sein, das wahre Ausmaß seiner Unoriginalität zu begreifen. Die Erkenntnis wäre zu schmerzhaft. Ich mag Outdoor-Aktivitäten, bin aber auch gern drinnen. Ich liebe Pizza. Ich bin auf der Suche nach jemandem, der mich zum Lachen bringt. Ich brauche einfach jemanden, der da ist, wenn ich am Ende des Tages nach Hause komme, der sich nachts im Bett neben mir bewegt. Diese Art von Unoriginalität. All diese Profile bewiesen, wie groß der Spannungsabfall zwischen der Person, die wir sind, und der, für die wir gehalten werden wollen, wirklich war. Auf einmal wurde mir klar, dass wir alle die gleiche Zusammensetzung von Organen, Gewebe und Flüssigkeiten sind, abgepackt zu einer bestimmten Version eines millionenfach produzierten Klischees, und jede einzelne davon hat ihre eigenen Wünsche und Zweifel und vor allem das Bedürfnis, sich auf die eine oder andere Weise unterstützt, wichtig, verstanden und gebraucht zu fühlen. Keiner von uns ist etwas Besonderes. Ich weiß nicht, warum wir uns so gegen diese Tatsache sträuben.
Folgendes wusste ich über Max, bevor ich ihn zum ersten Mal traf: Sein Haar hatte eine Farbe irgendwo zwischen rot- und karamellblond und war kurz, aber noch lang genug, um sich leicht zu locken. Er war eins dreiundneunzig groß, einen ganzen Kopf größer als ich. Für jemanden mit so hellen Haaren war seine Haut erstaunlich dunkel; wahrscheinlich sonnengebräunt, denn wie aus den Fotos hervorging, hielt er sich ziemlich oft im Freien auf. Seine Augen waren moosgrün und standen leicht schräg, was nahelegte, dass er ein gutes Herz hatte und vielleicht einen älteren, gehbehinderten Nachbarn, für den er manchmal einkaufen ging. Max war siebenunddreißig Jahre alt und wohnte in Clapton. Aufgewachsen war er in Somerset. Er ging gern surfen. Dicke Rollkragenpullover standen ihm gut. Er züchtete Gemüse in einem Schrebergarten in der Nähe seiner Wohnung. Wir hatten die folgenden gemeinsamen Interessen, Erfahrungen und Werte ermittelt: Pet Sounds von den Beach Boys war der Soundtrack unserer Kindheit; wir liebten Kirchen und hassten Religion; wir gingen beide regelmäßig draußen schwimmen; wir waren uns einig, dass Erdbeer die beste und am meisten unterschätzte, weil naheliegende Eissorte war; Mexiko, Island und Nepal standen ganz oben auf unserer jeweiligen Reiseliste.
Ich zeigte Lola sein Profil, und sie nickte eifrig und sagte, ja, den habe sie »da draußen« schon mal gesehen, was mir gar nicht passte. Ich hatte die Männer als ein Angebot von Mütterchen Schicksal verstanden – handverlesene potenzielle Partner allein für mich (»Ist ja nicht so, als gäbe es da nur Premiumschwänze«, sagte Lola). Während ich mir die Fotos meiner potenziellen Seelenverwandten angesehen hatte, war mir total entfallen, dass Hunderte und Tausende Frauen gerade auf dem Sofa oder in der Bahn saßen und dasselbe zu sehen bekamen. Lola erklärte mir, diese Reaktion sei für eine liebessüchtige Monogamistin ohne richtige Dating-Erfahrung völlig normal; wenn ich in Sachen Dating-Apps erfolgreich sein wollte, würde ich mir ein dickeres Fell zulegen müssen. »Das ist ein Haifischbecken«, sagte sie. »Und der Vorgang lässt sich nicht persönlicher gestalten. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Du musst immer kampfbereit und konzentriert bleiben. Deswegen sind da so viele junge Männer.« Sie sagte, möglicherweise sei Max einer dieser Linx-Prominenten, wie sie sie ein paarmal getroffen hatte, niederträchtige Feiglinge, die dank ihres guten Aussehens und ihres abgedroschenen Charmes auf den Apps sehr erfolgreich waren (einmal hatten sie und ihre Kollegin festgestellt, dass sie denselben Mann dateten; manche seiner Nachrichten kopierte er und verschickte sie doppelt). Diese Männer, erklärte sie, hatten gar nicht vor, sich auf etwas Ernsthafteres einzulassen; sie würden das Singledasein erst aufgeben, wenn sich keine Alternativen mehr boten und die Frauen aufhörten, ihr Profil anzuklicken.