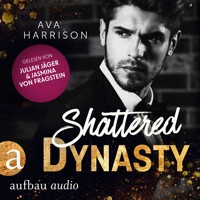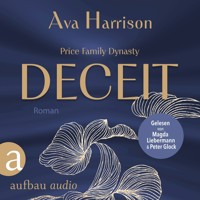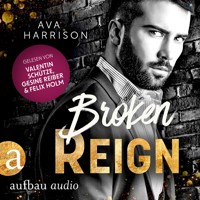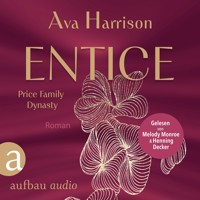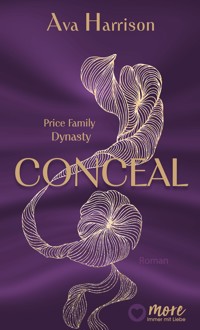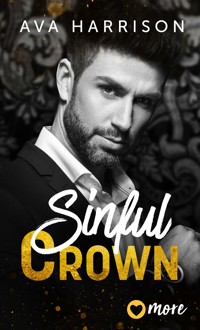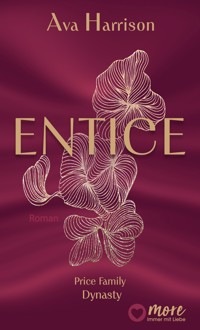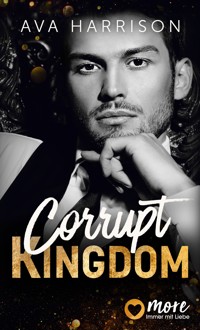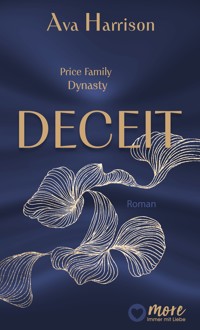
12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Price Family
- Sprache: Deutsch
Addison Price muss einfach weg – von ihrem Job, ihren Brüdern und der bevorstehenden Hochzeit ihres Ex. Die Reise nach England scheint die perfekte Lösung. Dort trifft sie auf den charmanten Oliver Black und erlebt eine leidenschaftliche Romanze, die sie alles vergessen lässt. Doch ihr Glück währt nur kurz, denn Oliver verbirgt ein großes Geheimnis: Er ist Oliver Blackthorn, 16. Earl of Lockhart und hat ganz eigene Pläne.
Als die Wahrheit ans Licht kommt, ist Addison am Boden zerstört und verbannt Oliver aus ihrem Leben. In der Überzeugung, dass Stabilität wichtiger ist als Leidenschaft, beginnt sie, sich mit einem anderen Mann abzufinden. Doch Oliver erkennt, dass er Addison nicht aufgeben kann. Entschlossen, sie vor einer großen Fehlentscheidung zu bewahren, kämpft er um ihre Liebe.
Kann Oliver Addison überzeugen, dass seine Gefühle echt sind? Und wird Addison erkennen, dass wahre Liebe manchmal nur einen zweiten Blick erfordert?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 483
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Liebe Leserin, lieber Leser,
Danke, dass Sie sich für einen Titel von »more – Immer mit Liebe« entschieden haben.
Unsere Bücher suchen wir mit sehr viel Liebe, Leidenschaft und Begeisterung aus und hoffen, dass sie Ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubern und Freude im Herzen bringen.
Wir wünschen viel Vergnügen.
Ihr »more – Immer mit Liebe« –Team
Über das Buch
Addison Price muss einfach weg – von ihrem Job, ihren Brüdern und der bevorstehenden Hochzeit ihres Ex. Die Reise nach England scheint die perfekte Lösung. Dort trifft sie auf den charmanten Oliver Black und erlebt eine leidenschaftliche Romanze, die sie alles vergessen lässt. Doch ihr Glück währt nur kurz, denn Oliver verbirgt ein großes Geheimnis: Er ist Oliver Blackthorn, 16. Earl of Lockhart und hat ganz eigene Pläne.
Als die Wahrheit ans Licht kommt, ist Addison am Boden zerstört und verbannt Oliver aus ihrem Leben. In der Überzeugung, dass Stabilität wichtiger ist als Leidenschaft, beginnt sie, sich mit einem anderen Mann abzufinden. Doch Oliver erkennt, dass er Addison nicht aufgeben kann. Entschlossen, sie vor einer großen Fehlentscheidung zu bewahren, kämpft er um ihre Liebe.
Kann Oliver Addison überzeugen, dass seine Gefühle echt sind? Und wird Addison erkennen, dass wahre Liebe manchmal nur einen zweiten Blick erfordert?
Über Ava Harrison
USA-Today-Bestsellerautorin Ava Harrison liebt das Schreiben. Wenn sie sich nicht gerade neue Romances ausdenkt, kann man sie bei einem ausgiebigen Schaufensterbummel, beim Kochen für ihre Familie oder mit einem Buch auf der Couch antreffen.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Ava Harrison
Deceit
Aus dem Amerikanischen von Ute Brookes
Übersicht
Cover
Titel
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Grußwort
Informationen zum Buch
Newsletter
Widmung
Zitat
1. Kapitel: Oliver
2. Kapitel: Addison — Einen Tag zuvor …
3. Kapitel: Oliver
4. Kapitel: Addison
5. Kapitel: Oliver
6. Kapitel: Addison
7. Kapitel: Oliver
8. Kapitel: Addison
9. Kapitel: Oliver
10. Kapitel: Addison
11. Kapitel: Oliver
12. Kapitel: Addison
13. Kapitel: Oliver
14. Kapitel: Addison
15. Kapitel: Oliver
16. Kapitel: Addison
17. Kapitel: Oliver
18. Kapitel: Addison
19. Kapitel: Oliver
20. Kapitel: Addison
21. Kapitel: Oliver
22. Kapitel: Addison
23. Kapitel: Oliver
24. Kapitel: Addison
25. Kapitel: Addison — Drei Monate später …
26. Kapitel: Oliver
27. Kapitel: Addison
28. Kapitel: Oliver
29. Kapitel: Addison
30. Kapitel: Oliver
31. Kapitel: Addison
32. Kapitel: Oliver — Vier Monate später
33. Kapitel: Addison
34. Kapitel: Addison
35. Kapitel: Oliver
36. Kapitel: Addison
37. Kapitel: Oliver
38. Kapitel: Addison
39. Kapitel: Oliver
40. Kapitel: Addison
41. Kapitel: Oliver
42. Kapitel: Addison
43. Kapitel: Addison
44. Kapitel: Oliver
45. Kapitel: Addison
46. Kapitel: Oliver
47. Kapitel: Addison
48. Kapitel: Oliver
49. Kapitel: Oliver
Epilog — Addison
Danksagung
Impressum
Lust auf more?
Dieses Buch ist allen Frauen gewidmet, die sich immer wieder in die falschen Männer verliebt haben – ehe sie endlich ihren Märchenprinzen fanden!
»Leben – es gibt nichts Selteneres in der Welt. Die meisten Menschen existieren, weiter nichts.«
Oscar Wilde
1. Kapitel
Oliver
»Wo bist du?« Die schrille Stimme meiner Mutter hallt durchs Telefon. So geht das jeden Tag, und manchmal frage ich mich, warum ich überhaupt drangehe.
Weil sie deine Mum ist und dich großgezogen hat. Weil ich weiß, dass sie mich, obwohl sie mich in den Wahnsinn treibt, tief in ihrem Innern, unter der eisigen Fassade und den ständigen Belehrungen, tatsächlich liebt.
»Du weißt ganz genau, wo ich bin, Mum.« Seufzend schließe ich das Fenster auf meinem Rechner. Ich wende mich von meinem Schreibtisch ab und drehe mich zum Fenster.
»Wieder einmal in London.« Sie hält kurz inne. »Soso.« Ihre Stimme ist leise, und angesichts ihres Tonfalls verspannt sich mein Nacken.
»Du weißt doch, dass ich von hier aus meine Geschäfte tätige.«
»Findest du nicht, es wäre höchste Zeit, dass du nach Hause kommst und dich hier um das Geschäftliche kümmerst?«
Nicht schon wieder die Leier. Bei jedem Gespräch mit meiner Mutter betont sie, wie wichtig es wäre, dass ich zurück auf mein Anwesen Pembroke Manor übersiedele. »Du führst das Anwesen doch ganz wunderbar. Und das seit Jahren.«
»Da hast du recht. Ich habe es übernommen, weil ich wusste, dass du jung warst und andere dringende Angelegenheiten zu erledigen hattest.«
Sie will damit sagen, ich hätte mir die Hörner abgestoßen, ist sich jedoch zu fein, es laut auszusprechen. Dabei hat sie völlig recht. Ich kann ohne Frage auf eine beträchtliche Zahl an Eroberungen zurückblicken.
»Aber jetzt ist die Zeit reif, dass du nach Hause kommst und deine Pflicht erfüllst. Das hier ist dein Anwesen. Dein Titel. Dein Erbe.«
Während sie von Titeln und familiären Verpflichtungen spricht, macht sich in mir das Gefühl breit, als würde sich eine Schlinge um meinen Hals legen. Ich zupfe am Kragen meines Armani-Hemds, damit mehr Sauerstoff in meine Lungen strömen kann.
Zum Teufel mit dem Titel, der Verantwortung und den Verpflichtungen.
Ich habe nicht darum gebeten, bin nicht bereit dafür und habe auch nicht das Gefühl, dass ich es je sein werde.
Für die meisten Menschen ist ihr Zuhause der Ort, an den sie zurückkehren, um Energie zu tanken. Ich hingegen empfinde es als einen Hort schlechter, kummervoller Erinnerungen. Mein Vater mag zwar vor Jahren gestorben sein, aber ich besuche das Anwesen noch immer nicht gern, selbst wenn es jetzt mir gehört.
Erst viele Jahre nach seinem Tod konnte ich Anspruch auf mein Erbe und den Titel erheben, doch in meiner Jugend drückte ich mich sowieso gern vor jeglicher Verantwortung. Zum Glück kümmert Mum sich um die Verwaltung von Pembroke Manor.
Mit dem Titel selbst wollte ich nie etwas am Hut haben. Er war besudelt von meinem Vater – von dem Mann, der er gewesen war.
Er starb, als ich noch klein war, aber das Gebrüll und die Trinkerei sind mir noch in lebhafter Erinnerung. Er war nur selten da, aber wenn doch, schickte meine Mutter mich immer auf mein Zimmer. Ich hörte nicht auf sie, sondern schlich oft auf Zehenspitzen die Treppe hinunter …
Und dann hörte ich ihn schreien und sie jammern.
Eines Tages wurde ich auf ein Internat geschickt und kam nur noch gelegentlich zu Besuch nach Hause.
Dementsprechend war es immer eine zweischneidige Angelegenheit für mich, der Earl of Lockhart zu sein.
»Ich bin mir meiner Verantwortung durchaus bewusst, Mum.« Ich schließe meine Augen, und Bilder blitzen auf, die ich selbst jetzt nicht sehen möchte. Mit einem Kopfschütteln wehre ich Dad ab, der vor meinem geistigen Auge auftaucht.
»Dann fang endlich an, dich dementsprechend zu verhalten«, stößt sie hervor.
Ihre Worte reichen aus, um mich aus meiner Benommenheit zu lösen und die Melancholie durch Zorn zu ersetzen. Ja, ich liebe meine Mum, aber sie schafft es jedes Mal wieder, mich auf die Palme zu bringen. »Ich bin immer vorsichtig und gehe den Paparazzi geflissentlich aus dem Weg«, erwidere ich scharf. Wenn man mir eines nicht vorwerfen kann, dann einen Mangel an Diskretion. Deswegen bin ich stinksauer, dass meine Mutter ausgerechnet auf diesem Punkt herumreitet.
»Zum Leben eines Earls gehört mehr, als nur zu vermeiden, dass man sich in kompromittierenden Situationen ablichten lässt«, entgegnet Mum. »Ich brauche dich hier, damit du mir bei den geschäftlichen Angelegenheiten der Familie unter die Arme greifen kannst.«
»Ich kümmere mich sehr wohl ums Geschäft … und zwar hier. Seit ich das Familienunternehmen in London übernommen habe, habe ich unsere Vermögen verdoppelt.«
»Es geht nicht immer nur ums Geld. Du musst dich hier um etwas anderes kümmern.« Als ich hörbar die Luft ausstoße, fährt sie fort: »Die Prices führen etwas im Schilde.«
»Mach dich nicht lächerlich, Mum. Das Land ist schon seit … nun, seit einer Ewigkeit nicht mehr angerührt worden.«
Sie lacht spöttisch auf, als spräche sie mit einem naseweisen Kind. »Aus sicherer Quelle weiß ich, dass es einen Besichtigungstermin gibt, und dass James Price in die Stadt kommen wird, Oliver. Was sagst du dazu?«
Die Genugtuung einer Antwort gebe ich ihr nicht.
»Hör auf, dich wie dein Vater aufzuführen. Dein Vagabundenleben und das Trinken sind schon genug Grund zur Sorge, aber die Frauengeschichten …«
Ihre Worte treffen mich mitten ins Mark, denn mein Vater war schon immer mein wunder Punkt. Er war ein Säufer, und was er uns beide durchmachen ließ, würde ich am liebsten für immer und ewig vergessen. Falls meine Mutter beabsichtigt hatte, dass ich mich wie ein Riesenarschloch fühle, ist es ihr jedenfalls gelungen.
»Ich brauche dich hier, Oliver«, sagt sie noch einmal, jetzt mit brüchiger Stimme. »Ich kann Price auf keinen Fall treffen. Dieser Mann hat mein Leben zerstört.«
»Wovon redest du da?«
Mum scheint außer sich. Es hört sich tatsächlich so an, als würde sie weinen, doch das kann nicht sein. Ich habe sie noch nie weinend erlebt. Meine Mutter stellt ihre Gefühle niemals auf diese Weise zur Schau.
»Weinst du etwa?«, frage ich ungläubig.
»Alles ist wegen ihm passiert«, murmelt sie ein Stück weit vom Telefon entfernt, und ich bin mir nicht sicher, dass sie mit mir redet. Ich weiß, dass sie die Prices verabscheut, und ich weiß auch, dass es das einzige Grundstück des ursprünglichen Fideikommisses ist, das sie nie zurückkaufen konnte, aber warum sollte dieser Umstand ihr Leben zerstört haben? Dann wurde früher der Familienbesitz eben über die Generationen hinweg als unteilbares Erbe an einen männlichen Sprössling weitergegeben – na und?
Heutzutage ist das eine lächerliche Vorstellung.
»Mum, was ist geschehen? Und wegen wem?«
»Komm einfach nach Hause, okay?«
Ihre klägliche Stimme erschüttert mich, und ich stoße ein Seufzen aus, denn obwohl ich London auf keinen Fall verlassen möchte, bleibt mir nichts anderes übrig. Aus Gewohnheit ziehe ich meine Glücksmünze hervor. Ich habe sie in meinem ersten Jahr im Internat vom Direktor bekommen, zu einer Zeit, als mein Leben mies war, ich meinen Dad hasste und an nichts glaubte. »Nicht alles muss dem Zufall überlassen werden. Wir können unseres Glückes Schmied sein«, hat er gesagt und mir dann die Münze mit einem Zwinkern in die Hand gelegt.
Ich werfe sie in die Luft.
Kopf.
Ab nach Hause.
Schließlich ruft die Pflicht. Sosehr ich mich dagegen auflehne, weiß ich doch, dass ich das Richtige tun muss.
Für meine Familie.
Für meinen Titel.
»Ich bin unterwegs.«
2. Kapitel
Addison
Einen Tag zuvor …
Rhythmisch hacken meine Finger auf die Tastatur ein. Frühmorgendliche Korrespondenz ist ein notwendiges Übel, das erledigt werden muss.
Nachdem ich die letzte E-Mail des Morgens beantwortet habe, strecke ich die Arme zur Zimmerdecke, balle die Hände zu Fäusten, öffne sie wieder und wackele mit den gefühllosen Fingern. Eigentlich bräuchte ich dringend eine Kaffeepause.
Ich schließe das Fenster auf meinem Computerbildschirm und rufe stattdessen eine Nachrichtenseite auf. Jasmine wird erst in einer halben Stunde hier sein. Jax und Grayson sind ebenfalls nicht da, ich kann also genauso gut nachsehen, was auf der Welt vor sich geht.
Sobald sich die Website aufgebaut hat, merke ich, dass ich einen Fehler begangen habe.
Ein Bild nach dem anderen.
Da ist sie. Die eine Sache, die ich unbedingt vergessen wollte, springt mir förmlich ins Gesicht. Dabei wollte ich doch nicht mehr daran denken.
Ich habe mir eingeredet, ich wäre stark genug, um die Hochzeit meines Ex-Freundes zu besuchen. Wie bin ich nur auf diesen abstrusen Gedanken gekommen? Dieses Wochenende lässt mich keinen Moment los, selbst wenn ich es nicht wahrhaben will.
Mir war klar, dass der Tag naht, doch dank meiner vielen Geschäftsreisen hatte ich so viel um die Ohren, dass es mir tatsächlich gelungen ist, kurzzeitig nicht daran zu denken. Da ich nun wieder in New York bin, wird mir mein Fehler schlagartig bewusst, und ich ahne, dass ich nicht hier sein, sondern mich weit weg in einem fernen Versteck verkriechen sollte. Ich habe geglaubt, ich würde schon damit klarkommen, wenn es erst einmal so weit wäre. Beim Anblick der Schlagzeilen und Fotos weiß ich: Das Gegenteil ist der Fall.
Hotelier Spencer Lancaster heiratet am Wochenende Olivia Miller, ehemaliges Supermodel und mittlerweile erfolgreicher Modelscout.
Rasch schließe ich die Seite wieder, doch es ist zu spät. Leider haben sich die Bilder des glücklichen Paares in meine Netzhaut eingebrannt. Spencers schönes Gesicht, das seine Verlobte liebevoll anhimmelt.
Dieses Bild werde ich nun bis in alle Ewigkeit vor Augen haben.
In meinem Innern brodeln Emotionen, tief unterdrückte Gefühle steigen an die Oberfläche. Unwillkürlich rufe ich die Website noch einmal auf, sodass das Foto abermals erscheint. Warum tue ich das?
Alles vor mir verschwimmt. Meine Lunge brennt, und ein ersticktes Schluchzen entfährt meiner Kehle. Ich hebe die Hand und fahre mit den Fingerspitzen über meine Haut, wo sie feucht ist von den Tränen, die ich vergossen haben muss.
Mit einem tiefen Atemzug stehe ich auf, gehe ins Bad und starre mein Spiegelbild an. Oberflächlich betrachtet mag bei mir alles in Ordnung sein. Meine braune Lockenmähne ist perfekt geföhnt, und ich bin makellos geschminkt. Aber jemand, der mich kennt – der mich wirklich kennt –, würde sofort Bescheid wissen.
Spencer würde es wissen.
Meine Augen sind ausdruckslos.
Es darf mich niemand sehen. Ich habe mir solche Mühe gegeben, um von allen ernst genommen zu werden. In dieser reinen Männerwelt, in der ich nun schon mein ganzes Leben verbracht habe, musste ich mich vielleicht nicht erst laut schreiend die Karriereleiter hochkämpfen, aber dennoch beweisen, dass ich das gleiche Führungsgeschick wie mein Vater besitze und mir nicht von Gefühlen dazwischenfunken lasse. Letzten Endes haben harte Arbeit und Beharrlichkeit dazu geführt, dass ich zusammen mit Grayson den Laden übernommen habe. Ich bin CEO und Grayson ist CFO von Price Enterprise. Jaxson, unser jüngster Bruder, ist COO.
Die Wahrheit lautet, dass ich nach ein paar Fehlern in jungen Jahren einfach kein Mädchen sein wollte, das sich von irgendeinem Mann reinreden lässt – lieber war ich allein und ganz auf mich gestellt. Allerdings habe ich mich da wohl auch wieder mal selbst belogen, denn es braucht nur eine einzige Schlagzeile im Internet, einen verfluchten Artikel, und schon stürzt alles, was ich mir aufgebaut habe, um mich herum zusammen. Und die Mauer um mein Herz zerbröckelt gleich mit.
Nein. Ich darf nicht zusammenbrechen. Nicht hier, nicht jetzt. Sie dürfen mich nicht so sehen – meine Brüder nicht und meine Angestellten auch nicht.
Ich drehe das Wasser auf, nehme mir ein Handtuch und tupfe mein Gesicht ab, wobei ich sorgfältig das verschmierte Make-up entferne. Dann straffe ich die Schultern.
Die coole und gelassene Addison Price.
Nur einen Moment später stehe ich wieder an meinem Schreibtisch und schaue auf die Uhr. Jasmine sollte mittlerweile hier sein, für Jax und Gray ist es allerdings ein wenig zu früh. Vielleicht schaffe ich es gerade noch unbemerkt hinaus.
Ich muss irgendwohin.
Raus aus dieser gottverdammten Stadt.
Wenn ich vor Ort bin, werden meine Brüder mit meinem Erscheinen bei der Hochzeit rechnen. Sie werden erwarten, dass ich mit einem strahlenden Lächeln applaudiere.
Da ich das nicht kann, bleibt mir keine andere Wahl als zu verschwinden.
Aber wohin?
Ich setze mich wieder an den Computer, öffne meine Dateien und gehe die Immobilien in unserem Portfolio durch. Wohin kann ich fahren? Ich muss unter dem Vorwand weg, dass es sich um Arbeit handelt, denn die Wahrheit darf niemand wissen. Schließlich bin ich eine starke Frau und werde keinem Mann erlauben, dass er mich derart in die Knie zwingt. Jedenfalls nicht in aller Öffentlichkeit.
Nein. Wenn ich von hier verschwinde und ins Ausland reise, um zu »arbeiten«, muss ich nicht den prüfenden Blicken der Menschen standhalten, die mich am besten kennen, und habe Zeit, meine Gefühle wieder in den Griff zu bekommen. Es ist ein guter Plan, aber jetzt muss ich mir noch einfallen lassen, wohin die Reise gehen soll.
Ich greife nach dem Telefon und drücke die Taste für die Gegensprechanlage. »Jasmine, kannst du bitte mal eben in mein Büro kommen?«
»Selbstverständlich«, ertönt es aus der Leitung.
Wenige Sekunden später tritt Jasmine ein. Auf halbem Weg in mein Büro bleibt sie stehen, und ihr Lächeln verblasst. Stattdessen mustert sie mich mit gerunzelter Stirn.
Jasmine ist seit ein paar Jahren meine Assistentin, und davor war sie Praktikantin. Wir haben uns bei einem Vortrag kennengelernt, den ich vor Studentinnen im Abschlussjahrgang der New York University gehalten habe. Bei einem Lunch sprach ich davon, Frauen in der Geschäftswelt zu stärken, und Jasmines zahlreiche pointierten und scharfsinnigen Fragen beeindruckten mich auf der Stelle. Schon beim Nachtisch habe ich ihr also eine Stelle angeboten.
Wir verstanden uns auf Anhieb, und nach kurzer Zeit beförderte ich sie zu meiner Assistentin. Doch sie ist so viel mehr, und wie sie mich im Moment ansieht, ihre schokoladenbraunen Augen zu Schlitzen verengt und den Kopf schief gelegt, weiß ich, dass sie mich durchschaut.
Sie sieht meinen Schmerz.
»Alles in Ordnung?«, erkundigt sie sich.
»Aber ja«, lüge ich. »Ich wollte dir nur sagen, dass ich geschäftlich wegmuss.«
Sie tritt weiter ins Zimmer, näher an meinen imposanten Schreibtisch heran. Noch einen Zentimeter mehr, und sie weiß mit Sicherheit Bescheid.
»Wann?« Während sie auf meine Antwort wartet, zuckt ein Muskel in ihrer Kieferpartie.
»Heute. Bald.«
Zwischen ihren Brauen bildet sich eine schmale Falte, während sie mich weiter anstarrt.
»Um was für ein Geschäft handelt es sich denn?«
Da ich noch völlig planlos bin, sacke ich in mich zusammen.
»Was ist los?«, will sie wissen.
»Mach die Tür zu«, sage ich und verberge das Gesicht in den Händen.
Ich kneife die Augen zusammen und befehle meinem Herzen, nicht mehr so schnell zu schlagen. Eigentlich will ich im Büro einen kühlen Kopf bewahren, aber ich muss unbedingt mit jemandem reden, und Jasmine hat sich schon des Öfteren als äußerst loyal erwiesen. Es wird mir helfen, wenn sie Bescheid weiß und meine Beweggründe versteht.
»Spencer wird am Wochenende heiraten«, sage ich mit geschlossenen Augen. Während ich es ausspreche, frage ich mich erneut, wie ich so dumm sein konnte. Ganz offensichtlich hatte ich die Hochzeit verdrängt und geglaubt, es würde vielleicht etwas dazwischenkommen, oder sie würde stattfinden, ohne dass es mir etwas ausmacht …
In beiden Fällen lag ich komplett falsch.
Ich schlage die Augen auf. Jasmine sitzt nun in dem Stuhl vor mir und beobachtet mich.
»Ich weiß.«
Jeder weiß es.
»Ich verlasse die Stadt«, wiederhole ich.
»Das verstehe ich. Wohin wirst du fahren?« Sie stützt die Hände auf der Oberfläche des Schreibtisches ab.
»Das weiß ich noch nicht genau. Ich weiß nur, dass Grayson und Jax nicht wissen dürfen, warum ich wegfahre.«
»Hältst du deine Brüder tatsächlich für so blöd?«
»Nun, natürlich nicht, aber wenn ich ihnen einen triftigen Grund liefern kann …«
»Und was wäre ein triftiger Grund?« Sie legt den Kopf schief, und ich stoße ein Seufzen aus.
Ich habe keine Ahnung.
So viel zum Thema gut durchdachter Plan.
»Ein Grundstück begutachten?«, lautet Jasmines Vorschlag, ehe mir etwas einfallen könnte.
»Okay. Das könnte funktionieren. Mhm. Wonach suchen unsere Kunden denn gerade?«
Jasmine steht auf, und ich sehe zu, wie sie aus dem Büro marschiert. Eine Minute später lässt sie sich wieder auf demselben Stuhl nieder, diesmal mit einem iPad auf dem Schoß. Sie wischt mit der Hand darüber. »Blue Coast Industries suchen nach einem Gewerbegebiet, um ihre neue Firmenzentrale zu bauen.«
Ich schüttele den Kopf. »Das ist immer noch in Amerika. Nicht weit genug weg.« In den Vereinigten Staaten kann ich ungehindert Nachrichten schauen. Na ja … In Wahrheit erlaubt das Internet mir, die US-News überall auf der Welt zu sehen.
Bei dem Gedanken durchläuft mich ein Schauder.
Ich werde einfach nicht online gehen.
Jasmine quittiert meine Antwort mit einem Nicken. »Okay, also nicht in den Staaten. Sonst noch irgendwelche Bedingungen?«
»Vielleicht ein bisschen abseits ausgetretener Touristenpfade. Ich brauche Ruhe, aber ich muss auch arbeiten können.«
»Alles klar.«
Ich bemerke, wie sich ihre Augen weiten.
»Was?«
»Nichts«, erwidert sie hastig.
»Rück raus damit, Jasmine.« Unter dem Schreibtisch ringe ich die Hände und warte ab.
»Die Lancasters möchten eine neue Hotelkette bauen …«
Ich stoße ein lang gezogenes und völlig melodramatisches Ächzen aus. Die Lancasters. Werde ich ihn jemals los sein?
»Nein!«
»Hör mir einfach zu.« Sie hebt beschwichtigend die Hand, und ich nicke ihr aufmunternd zu, damit sie fortfährt. »Du willst deine Brüder glauben machen, dass es dir nicht an die Nieren geht? Sie sollen denken, dass du dich nicht verkriechst? Dann ist das der ideale Deckmantel. Wenn es dir etwas ausmachen würde, würdest du dann für ihn arbeiten?«
Ich lasse mir ihren Vorschlag durch den Kopf gehen, und obwohl ich es nur ungern zugebe, hat sie völlig recht. »Okay«, murmele ich widerwillig. »Wonach suchen sie?«
»Es soll sich um ausgesprochen exklusive Luxusanwesen handeln. Städte kommen nicht infrage.«
»Wir benötigen also ein großes Grundstück am Strand oder auf dem Land. Was steht denn im Angebot? Aber nicht in Amerika«, sage ich.
»Es gibt ein paar in Spanien und Frankreich.«
»Was sonst noch?« Ich schüttele den Kopf, denn mit beiden Ländern verbinde ich zu viele Erinnerungen an Spencer. Er besitzt dort Hotels auf meinen Grundstücken.
Jasmine tippt und wischt weiter. »Mhm. Das hier könnte tatsächlich perfekt sein.«
»Wo ist es?« Ich beuge mich ein Stück über meinen Schreibtisch.
»Wiltshire«, erwidert sie und dreht ihr iPad zu mir. Auf dem Tablet ist kein Bild zu sehen – bloß Wörter, die ich von meinem Schreibtischstuhl aus nicht entziffern kann.
»Wo?«
»In Wiltshire. England. Kühe. Grüne Hügel. Heiße Briten. Du weißt schon.«
»Echt?« Ich hatte keine Ahnung, dass wir überhaupt Immobilien in Wiltshire besitzen. Herrgott, ich weiß noch nicht einmal, wo Wiltshire liegt!
»Anscheinend war es eines der ersten Grundstücke, die dein Vater erworben hat, aber er hat nie darauf gebaut. Es war noch nicht einmal in unserem Portfolio.«
»Ich frage mich, warum«, sage ich laut, aber dann trifft mich die Erkenntnis. Wenn es tatsächlich Dads erster Erwerb war, hat er deshalb das Grundstück nicht angetastet, denn er war ein echter Nostalgiker.
Ich bin da pragmatischer.
»Das steht hier nicht. Aber für das Grundstück ist kein Kaufpreis eingetragen, also hat er es vielleicht geerbt.«
Ich zucke mit den Schultern. Eines Tages werde ich Mom danach fragen müssen. »Erzähl mir von dem Grundstück.«
Die nächsten vierzig Minuten lausche ich Jasmines Vortrag über die Gegend, und als sie zum Ende kommt, steht mein Entschluss fest, dass ich unbedingt dorthin muss. Das Grundstück befindet sich gute zwei Stunden von London entfernt, sodass mir auf keinen Fall Zeitungsartikel zu der Hochzeit unterkommen werden, und da ich mir selbst verboten habe, ihn zu googeln, sollte es auch ansonsten keine Probleme geben.
»Es ist einfach ideal. Falls Gray nachfragt, ergibt es Sinn …«, sage ich mehr zu mir selbst als zu Jasmine.
»Was kann ich für dich tun?«
»Such mir eine Bleibe.«
»Verstanden.« Sie tippt abermals, wahrscheinlich eine Notiz für sich selbst auf ihrer To-do-Liste. Sie hat ein Faible für Listen. »Wann reisen wir ab?«
Auf ihre Bemerkung hin lege ich den Kopf schräg und sehe sie eindringlich an. »Ich fahre allein.«
Sie verdreht die Augen.
»Was denn?« Ich zucke mit den Schultern.
»Du reist sonst nie ohne mich zu Besichtigungen. Glaubst du nicht, dass das Aufmerksamkeit erregen wird?«
Sie hat schon wieder recht, und das gefällt mir gar nicht. Bei jeder anderen Gelegenheit würde ich einfach sagen, dass ich eine Auszeit brauche. Aber da ich mir sonst nie einfach so freinehme und diese Reise genau auf das Wochenende der Hochzeit fällt – eine Hochzeit, die meine Brüder besuchen werden –, muss ich die Sache glaubhaft machen. Geschäftsreisen unternehme ich immer zusammen mit meinem kleinen Team, also werde ich sie wohl oder übel mitnehmen müssen.
»Na schön, organisiere uns eine Unterkunft. Marcus soll uns begleiten«, sage ich. Marcus, mein Chauffeur, ist auch für die Security zuständig, wenn wir uns in unsicheren Gebieten aufhalten. Wobei von dieser Reise keine Gefahr ausgeht und ich die beiden dann halt eben zur Tarnung mitnehme. In meiner jetzigen Stimmung werde ich mir das Grundstück wahrscheinlich einmal kurz ansehen und mich das restliche Wochenende mit einer Riesenpackung Eis in meinem Hotelzimmer einsperren. Und sobald die Luft rein ist, Spencer seine Hochzeitsreise angetreten hat und neuer Klatsch die Seiten von Exposé füllt, werde ich nach Hause fliegen und so tun, als wäre nicht das Geringste geschehen.
Es ist ein guter Plan.
Was kann schon groß schiefgehen?
Es kann so einiges schiefgehen.
Sehr viel sogar.
Im Grunde eigentlich alles.
Ich dachte, New York zu verlassen, würde die Stimmen in meinem Kopf zum Schweigen bringen, aber das war nicht der Fall. Mir ist in lebhafter Erinnerung, wie ich ihn verletzt habe. Ich denke mit einem schlechten Gewissen daran, wie ich ihn behandelt habe, und ich erinnere mich immer noch an den Schmerz, als ich ihn zum ersten Mal mit ihr sah.
Jahre später weiß ich, dass ich nie die Richtige für Spencer war. Ich weiß, dass es sein Schicksal ist, mit Olivia zusammen zu sein. Aber während sich ein Teil von mir für ihn freut, ist ein anderer Teil von mir, den ich lieber verdränge, neidisch auf sein Glück. Ich beneide ihn darum, dass er mich hinter sich lassen konnte, während mir das mit ihm nicht gelungen ist. Stattdessen quäle ich mich mit endlosen Was-wäre-wenn-Fragen herum, und mein Gehirn schreit mich ständig an, ich solle im Internet nach ihm surfen, dabei weiß ich, dass das total dumm wäre.
Ich gehe ins Erdgeschoss und erblicke Marcus und Jasmine in der Küche.
»Ich gehe aus«, sage ich, ehe ich es mir anders überlegen kann.
Jasmine zieht eine Augenbraue in die Höhe. »Ähm, okay.«
»Ich werde mal sehen, ob man hier irgendwo etwas trinken kann.«
»Ich kann in die Stadt fahren und dir etwas …«
Ich hebe abwehrend die Hand. »Ich brauche einen Tapetenwechsel. Ich wollte in das Dorf, an dem wir vorbeigekommen sind, und schauen, ob man dort irgendwo einen Drink bekommt.«
»Ich fahre dich.« Marcus macht Anstalten aufzustehen, aber ich schüttele den Kopf.
»Sei nicht albern. Ich kann selbst fahren.«
»Und etwas trinken?« Er klingt wie ein besorgter Dad.
»Ich bin ein großes Mädchen, und was ist schon ein Drink?«
Glücklich sieht er nicht gerade aus, aber ich will die beiden nicht um mich haben – oder sonst jemanden, der mich kennt. Ich schnappe mir die Schlüssel und gehe auf die Tür zu.
»Vergiss nicht, dass man hier auf der anderen Straßenseite fährt«, sagt Jasmine.
Ich drehe mich um und werfe ihr einen bösen Blick zu. Sie verkneift sich ein Lachen, als ich das Cottage verlasse.
3. Kapitel
Oliver
Genau das habe ich gebraucht.
Der Scotch wandert meine Kehle hinunter und hilft dabei, alles in meinem Inneren zu lösen.
Heute bin ich auf meinem Anwesen eingetroffen. Sobald ich es betreten habe, hat sich Mum auf mich gestürzt und eine Liste der Dinge heruntergebetet, die ich für meinen Aufenthalt unbedingt wissen sollte. Dann hat sie in einem fort von dem Land geschwafelt – dem verfluchten Grundstück, das sie nie hat zurückkaufen können.
Da anscheinend jemand von den Prices in die Stadt kommen soll, möchte sie, dass ich herausfinde, was er im Schilde führt und was für Pläne der Immobilienmogul mit dem Land hat. Allerdings wird er wohl erst in ein paar Tagen eintreffen, mir bleibt also noch ein wenig Zeit vor meinem Auftritt in dieser katastrophalen Schmierenkomödie, und ich habe entschieden, mir ein paar Drinks im Pub zu genehmigen.
Was kann eine kleine Auszeit schon schaden? Außerdem muss ich offensichtlich meinen guten Ruf als betrunkener Frauenheld aufrechterhalten. Bei der Erinnerung an die Vorwürfe meiner Mutter entschlüpft mir unwillkürlich ein Ächzen.
Und nun sitze ich in The Carpenter’s Arms und trinke einen Schluck von meinem Drink. Zu meiner Überraschung ist es schön, das hektische Treiben in London hinter mir zu lassen. Es fühlt sich tatsächlich gut an, zu Hause zu sein. Ich bin viel zu lange nicht hier gewesen.
Oft fand ich es einfacher, Mum die Verwaltung von Pembroke Manor zu überlassen, und wenn ich einmal ehrlich bin, hatte ich viel zu lange nichts anderes im Kopf als das dringende Bedürfnis, auf Partys zu gehen, zu trinken und mich zu amüsieren.
Nachdem ich ein paar Minuten dagesessen und meinen Drink genossen habe, wandert mein Blick zu Robin, dem Barkeeper. Er sieht mit weit aufgerissenen Augen über meine Schulter hinweg. Selbst in dem muffigen Schankraum mit dem schummrigen Licht merkt man ihm die Überraschung an. Ich frage mich, worauf sein Blick gefallen ist.
Nach meinem nächsten Schluck siegt schließlich die Neugier, und ich drehe mich unwillkürlich um. Bei dem Anblick, der sich mir bietet, reiße auch ich die Augen auf.
Wer ist das?
Sie ist wunderschön. Wahrscheinlich handelt es sich um die atemberaubendste Frau, die ich jemals gesehen habe. Sie ist groß und schlank, mit langem braunem Haar, das über ihre Schultern bis unterhalb der vollen Brüste fällt. Das Bemerkenswerteste sind allerdings ihre wunderschönen Augen.
Ich bin mir sicher, dass ich sie noch nie zuvor gesehen habe. Ein solches Ausnahmewesen wäre mir zweifellos im Gedächtnis geblieben.
Ich lasse meinen Blick über ihren Körper gleiten. Es ist offensichtlich, dass sie nicht hierhergehört; allein schon ihre Kleidung verrät, dass sie völlig fehl am Platz ist. Sie trägt nicht die übliche locker-legere Pub-Kluft. Nein. Sie hat Stöckelschuhe an, mindestens zehn Zentimeter hoch, und einen Hosenanzug.
Sie lässt den Blick durch den Raum schweifen und rümpft dabei ein wenig die Nase.
Mit hochgezogenen Augenbrauen beobachte ich sie weiter.
Scheinbar zögerlich tritt sie auf die Bar zu. Auf halbem Weg bleibt sie stehen und scheint es sich dann mit einem Kopfschütteln anders zu überlegen, denn sie macht Anstalten umzudrehen.
»Schon wieder auf dem Sprung?«, frage ich mit rauer Stimme, während ich sie immer noch über die Schulter hinweg ansehe.
Sie hebt den Blick auf der Suche nach demjenigen, der sie so unverfroren angesprochen hat. Da ich der einzige Gast an der Bar bin, sollte es sie vor kein allzu großes Rätsel stellen. Nun, das stimmt nicht ganz. Harry ist auch hier. Aber er ist sturzbetrunken und liegt schlafend mit dem Kopf auf der Bar.
Schon nach wenigen Sekunden treffen sich unsere Blicke, und ihre Augen weiten sich. Sie sagt allerdings nichts, sondern starrt mich nur entgeistert an.
»Sie sind doch gerade erst gekommen«, fahre ich fort. Es kommt nicht oft vor, dass eine Frau wie sie in einen Pub wie diesen spaziert.
Das könnte interessant werden.
Zumindest eine gute Ablenkung.
»Und jetzt bin ich dabei zu gehen«, erwidert sie unwirsch und weicht einen Schritt zurück, als könnte sie sich irgendeine Krankheit holen, wenn sie noch eine Minute länger an diesem Ort bleibt.
»Ach, kommen Sie schon, bleiben Sie noch.« Mein Tonfall ist neckend, und ich drehe mich auf meinem Barhocker um, um sie besser sehen zu können.
Überrascht starrt sie mich an, da sie jedoch nicht weiter zurückweicht, hebe ich die Hand und klopfe auffordernd auf den Tresen. Ihr Blick folgt meiner Bewegung, und ihr schönes Gesicht verzieht sich, ihre vollen Lippen bilden einen Schmollmund.
Ich verkneife mir ein Lachen, denn ich weiß, warum sie eine Grimasse zieht. Der Tresen ist von getrockneten Spirituosen und verschüttetem Bier ganz klebrig unter meinen Fingerspitzen.
Abermals senkt sie den Blick, doch nun betrachtet sie den Boden, der ganz so aussieht, als sei er womöglich noch nie gekehrt worden. Von meinem Sitzplatz sehe ich verstreuten Abfall und sogar ein paar zerknüllte Servietten.
»Es ist ziemlich ekelhaft, aber meiner Meinung nach förderlich fürs Ambiente.« Ich zwinkere ihr zu. »Drink gefällig?« Ich deute auf die Flaschen an der Wand. »Sieht aus, als könnten Sie einen gebrauchen.«
»Und das wissen Sie, weil …?« Ihre Stimme ist voller Sarkasmus, und sie sieht mich herausfordernd an, die Augen zu Schlitzen verengt.
»Mit Stress kenne ich mich gut aus. Also kommen Sie schon, nehmen Sie Platz und lassen Sie sich von mir auf einen Drink einladen.«
»Lieber nicht … aber danke für das Angebot.« Sie will einen Schritt rückwärtsgehen, bleibt dann aber stehen. »Gibt es noch andere Restaurants …«
Da ich weiß, worauf sie hinauswill, schneide ich ihr mit einer Handbewegung das Wort ab. »Eigentlich nicht. Und warum sollten Sie überhaupt irgendwo anders hinwollen? The Carpenter’s Arms ist nicht nur der beste Pub in der ganzen Stadt, sondern tatsächlich der einzige in einem Umkreis von Gott weiß wie vielen Meilen.« Ich zucke mit den Schultern und blinzele, während ich versuche, die Entfernung zur nächsten Bar zu schätzen. »Dreißig Meilen? Höchstens vierzig.«
»Das soll wohl ein Scherz sein«, murmelt sie leise und pustet sich eine Haarsträhne aus dem Gesicht.
»Kein Scherz. Ich bin Brite, und über Pubs machen wir keine Witze.« Glucksend lache ich in mich hinein, woraufhin sich ihr Gesichtsausdruck verfinstert. Selbst mit verärgerter Miene ist sie ausgesprochen hübsch. Aus dieser Nähe gestatte ich mir, sie eingehend zu mustern.
Sie ist Amerikanerin. Das habe ich ihr gleich angehört, außerdem verraten sie die eng geschnittene Hose mit dem Blazer und die schicken High Heels. Groß und völlig reglos steht sie da, ihr sanft geschwungener Hals ist lang und einladend. Sie sieht aus, als käme sie direkt von einem Laufsteg.
Atemberaubend.
Doch das beantwortet immer noch nicht die Frage, die mir im Kopf herumspukt. Was macht sie hier? In meiner Stammkneipe? Kennt sie James Price?
»Kommen Sie, trinken Sie was.« Ich zucke mit den Schultern, nicht bloß, weil mir so allein langweilig ist, sondern vor allem, weil ich fasziniert bin.
Erstens will ich herausfinden, ob sie womöglich die Prices kennt, denn in dem Fall könnte sie sich als eine nützliche Informationsquelle erweisen.
Zweitens, besonders wichtig, würde ich dieser entwaffnenden Schönheit gern erlauben, mir die Abendstunden zu versüßen.
»Das geht nicht.« Wieder runzelt sie die Stirn.
»Ach, nun kommen Sie schon … lassen Sie sich das hier nicht entgehen«, scherze ich. Allerdings heitert es die Stimmung nicht auf, wenn überhaupt wird die Fremde nur noch angespannter. »Ich verspreche Ihnen«, ich senke die Stimme, »hier drinnen lauert keinerlei Gefahr.«
»Meine Sorge gilt nicht so sehr meiner Sicherheit als vielmehr meiner Gesundheit. Hier fange ich mir sicher eine Krankheit ein.« Zur Verdeutlichung zeigt sie auf den siffigen Tresen.
»Sie werden sich nichts einfangen.«
Sie tritt näher und berührt die Oberfläche. Und obwohl nichts zu hören ist, als sie den Finger wieder hebt, stelle ich mir vor, dass sie in Gedanken ein Geräusch hört – sonst würde sie nicht so angewidert das Gesicht verziehen. »Sie haben recht. Einfangen werde ich mir nichts, außer vielleicht den Tod.«
»Ich verspreche Ihnen auch, dass Sie nicht sterben werden. Und wenn Sie es dank irgendeines seltsamen Zufalls doch tun sollten, dann segnen Sie wenigstens in einem tollen Pub das Zeitliche. Hier wird jeder Sie behandeln, als gehörten Sie zur Familie. Wir würden Sie auf jeden Fall standesgemäß bestatten.«
»Das ist ja so beruhigend.« Mit einem Achselzucken zieht sie sich die Handtasche höher über die Schulter.
»Ganz wie Sie wollen. Aber es ist Ihr Verlust …« Ich verstumme allmählich und drehe mich dann wieder zum Barkeeper vor mir um. »Noch mal das Gleiche, Robin«, sage ich zu dem alten Mann auf der anderen Seite des Tresens.
Sein verwittertes Gesicht lässt keinerlei Regung erkennen, aber ich weiß, dass er am liebsten lachen würde. Er hat mir schon Scotch ausgeschenkt, als ich noch lange nicht alt genug war, um überhaupt hier zu sein. Dieser Mann hat mich zu meinen besten und zu meinen schlimmsten Zeiten gesehen.
»Ich nehme das Gleiche wie er«, sagt die temperamentvolle Amerikanerin neben mir und stößt ein Seufzen aus.
Als Robin geht, um uns den Scotch zu holen, wende ich mich nach links und sehe ihr in die Augen. Sie hat mich beobachtet, und der Röte nach zu schließen, die in ihre Wangen steigt, waren ihre Gedanken nicht ganz jugendfrei.
Die Farbe steht ihr.
In mir steigt die Vorstellung auf, die Nacht mit ihr zu verbringen. Das ist ein viel schönerer Gedanke als das, was mich auf meinem Anwesen erwartet.
Ich hebe erneut den Blick, und sie starrt mich immer noch an. Ihre großen Augen sind grün, und so einen intensiven Grünton habe ich noch nie gesehen. Er erinnert mich an den Ozean oder an die Augen einer Katze.
Abwägend taxiert sie mich. Am liebsten würde ich die Hände heben und »Ich komme in friedlicher Absicht« sagen, stattdessen entscheide ich mich für Nonchalance. In meinem dreißigjährigen Leben habe ich gelernt, dass Frauen sich oft gern so richtig reinhängen wollen. Ich wende mich also wieder dem Tresen zu.
Sobald die Drinks vor uns stehen, hebe ich das Glas an den Mund.
»Wollen wir denn nicht anstoßen?«, fragt sie und beugt sich zu mir, was mir ein Lächeln entlockt. Genau wie ich vermutet habe, zieht Gleichgültigkeit bei der Amerikanerin sofort.
Als würde man ein Lamm zur Schlachtbank führen.
Mit einer langsamen, präzisen Bewegung drehe ich mich wieder zu ihr, beuge mich vor und stoße mit ihr an. »Worauf trinken wir denn, Sweetie?«
»Sweetie?«, fragt sie. »Echt jetzt?«
»Sie sind ausgesprochen süß«, erwidere ich.
Sie beugt sich noch dichter zu mir und legt den Kopf schräg. »Hat der Spruch schon mal funktioniert?«
»Es geht mir nicht darum, dass er funktioniert. Ich sage nur die Wahrheit.« Mit einem Achselzucken trinke ich noch einen Schluck. Die Flüssigkeit rinnt meine Kehle hinab und versengt mich mit ihrer Wärme. »Außerdem bin ich Brite.«
»Und …?«
»Wir nennen jeden … Sweetie.«
»Nun, das ist wunderbar«, sagt sie mit ausdruckslosem Gesicht, ehe sie wieder zu ihrem Glas hinunterschaut – ihrem vollen Glas.
»Worauf sollen wir also anstoßen?«, frage ich. »Ruhige Pubs, in die sich alle möglichen Gestalten verirren?«
Das bringt sie zum Lachen, und ihre Schulterpartie entspannt sich. Sie betrachtet mich kopfschüttelnd.
»Kommt nicht infrage?«
»Nein. Etwas Besseres.« Da sie sich nun allmählich für mich erwärmt, wird sie sogar noch verlockender, wenn das überhaupt möglich ist.
»Auf das Ertränken unserer Probleme?«
Sie nickt eifrig. »Viel besser.« Dann lächelt sie mich an und führt das Glas an die Lippen. »Auf das Ertränken unserer Probleme.« Sie kippt den gesamten Inhalt, schluckt dann heftig und leckt sich über die Lippen.
Genial. Nur ganz wenige Frauen können Scotch so mühelos trinken.
»Noch einen?«, frage ich und folge dann ihrem Beispiel, indem ich das Glas in einem Zug leere.
»Ja.« Sie seufzt erleichtert auf. »Bitte noch einen.«
»Ist das Ihr Ernst?« Ich gebe mich bestürzt.
»Ja«, sagt sie gedehnt und sieht mich mit weit aufgerissenen Augen an. »Ich habe heute einen Scheißtag.«
»Das ist offensichtlich. Sind Sie sicher, dass es nicht gefährlich ist, wenn Sie so trinken? Ich meine, dieser Pub ist voller Gesindel.«
Ihre Augen wandern durch den Raum, und ihre wachsame Miene entlockt mir ein Grinsen.
»Ich scherze. Wie schon gesagt, lauert hier keinerlei Gefahr.«
»Etwas sagt mir, dass die einzige Gefahr für mich von Ihnen ausgeht.« Sie grinst.
»Darling, Sie wissen ja gar nicht, wie recht Sie haben.« Ich zwinkere ihr zu und gebe Robin dann ein Zeichen, uns nachzuschenken.
Nach dem dritten Drink ist sie weniger angespannt. Ihre Handtasche liegt auf dem Tresen, und ihr Körper ist nicht mehr so verkrampft wie beim Betreten des Pubs. Sie starrt zu den Spinnweben an der Decke hoch, und ich frage mich, was ihr durch den Kopf geht. Auf jeden Fall hoffe ich, sie denkt nicht darüber nach, dass sie zu viele Drinks intus hat und sich wahrscheinlich gleich quer über den Boden übergeben wird. Denn dann sollte sie zumindest die Toilette aufsuchen.
Als sie sich versteift, hebe ich die Hand und berühre sie am Rücken. »Alles in Ordnung?«, frage ich, jetzt besorgt, dass sie den Scotch tatsächlich nicht vertragen hat.
Ihr ist deutlich anzumerken, dass sie aus der Fassung ist. Was auch immer sie beschäftigt hat, als sie die Bar betrat, ist zurück, und es lässt mich nicht kalt. Ich möchte etwas an dem Blick in ihren Augen ändern, denn ich erkenne zu viele meiner eigenen Nöte darin.
»Und jetzt?«, will ich wissen.
Sie sieht mich an. »Was meinen Sie? Ich hatte ein paar Drinks, und jetzt fahre ich in mein Haus zurück.« Ihre Augen sind trübe, und ich weiß, dass sie beschwipst ist.
»Haus?« Interessant. Mit Sicherheit hätte es sich schnell herumgesprochen, wenn hier eine Amerikanerin leben würde. »Wohnen Sie in der Gegend?«
»Nein.« Sie schüttelt den Kopf.
»Was meinen Sie dann mit Haus?« Jetzt ist mein Interesse wirklich geweckt.
»Ich habe für eine Woche ein Haus angemietet. Sonderlich viele Hotels standen nicht zur Auswahl.«
»So ungefähr kein einziges.« Ich lache auf. »Abgesehen von dem Zimmer über dem Pub und dem Gasthof, aber dort sollten Sie besser nicht absteigen.«
»Ach, wirklich?«, fragt sie mit ausdrucksloser Miene.
»Der Gasthof ist ein bisschen zwielichtig. Genau wie das Zimmer oben.«
Sie wirft einen Blick auf den bierfleckigen Tresen. »Meinen Sie?« Wieder lacht sie und bei dem Geräusch ziehen sich unwillkürlich meine Mundwinkel nach oben. Sie ist noch umwerfender, wenn sie lächelt oder gar lacht.
»Was führt Sie also in unsere bescheidene Gegend? Amerikanischen Besuch haben wir nicht oft.«
»Das kann ich mir gar nicht erklären.« Sie verdreht die Augen und grinst. »Muss am mangelnden Unterhaltungsprogramm liegen«, stellt sie fest.
»Ohne Frage.« Ich neige den Kopf. »Die Wahrheit lautet, dass wir keine Lust auf die Londoner Hektik haben.« Zwar liebe ich die Stadt, aber das hier … es ist eine Zufluchtsstätte. »Je weniger Fremde, desto besser.« Mit Ausnahme dieses faszinierenden Exemplars gibt es hier so gut wie nie Besucher. Doch wenn ich sie mir so ansehe, bin ich nicht traurig darüber, sie hier zu haben. Sie könnte ein toller Zeitvertreib sein, während ich mich um die geschäftlichen Angelegenheiten kümmere. Wenn ich mal raus muss oder geschäftlich auf dem Familiensitz zu tun habe, gibt es nur selten vergnügliche Zerstreuungen. Meine Geschäftsreisen sind gewöhnlich schrecklich. Diese Frau hat das Potenzial, das zu ändern.
»Sie haben noch immer nicht gesagt, was Sie hierherführt«, hake ich nach.
»Ich mache Urlaub.« Da sie offenkundig nicht mehr von sich preisgeben will, tue ich, was jeder Kerl tun würde: Ich bohre weiter.
»Verraten Sie mir wenigstens Ihren Namen?«
Sie nagt an der Unterlippe, während Robin uns die vierte Runde einschenkt.
»Ach, kommen Sie schon, Sweetie, mir können Sie’s sagen.«
Sie stöhnt und verengt die Augen zu Schlitzen. »Es wird mir nichts anderes übrig bleiben.«
»Warum das?«
»Damit Sie aufhören, mich Sweetie zu nennen.« Sie nippt an ihrem Drink.
»Noch mal, ich bin Brite … das ist unsere Version von Darling.« Ich hebe mein eigenes Glas und halte es mir unter die Nase, um zu inhalieren. Die Aromen lassen mir das Wasser im Mund zusammenlaufen. Ich trinke einen Schluck.
»Aber ich bin nicht Ihr Darling.« Sie zieht eine Augenbraue in die Höhe. »Na schön.« Sie hält inne, und ihr Blick wandert zur Decke, als krame sie in ihrem Gedächtnis nach einem falschen Namen. »Addy. Ich heiße Addy.«
Ich muss lachen. »Sicher? Hundertprozentig sicher scheinen Sie sich da nicht zu sein.«
»Ich heiße Addy«, sagt sie mit Nachdruck.
»Nun, Addy«, ich lasse das Wort genüsslich auf meiner Zunge zergehen, »ich heiße Oliver. Oder Olly, wenn Sie möchten.«
»Oliver ist prima.« Ich starre sie eine Sekunde lang an, und sie öffnet den Mund. »Was?«
»Sie sehen nicht wie eine Addy aus.«
»Wie sehe ich denn aus?«
»Ich bin mit einer Addy zur Schule gegangen. Sie war ein schreckliches, gemeines Mädchen. Echt furchtbar. Als Spätentwickler war ich etliche Zentimeter kleiner als sie, was bedeutete, dass sie mich gemobbt hat. Sie kommen mir nicht wie eine Addy vor. Zu Ihnen passt viel besser … Sweetie.«
»Himmel, Sie sind unmöglich.« Ihre Worte bringen mich zum Lachen. »Nennen Sie mich Addison. Gefällt Ihnen das besser? Sehe ich wie eine Addison aus?«
»Ja. Viel besser. Wie wäre es mit noch einer Runde, Addison?«
»Ich weiß nicht …«
»Wenn Sie sich Sorgen wegen des Autofahrens machen, kann ich Sie zu Hause absetzen.«
»Erstens ist das überhaupt keine Hilfe, weil Sie dann angetrunken fahren würden. Und zweitens komme ich schon klar.« Diese Frau wird immer faszinierender, was gefährlich kompliziert werden könnte, nachdem ich sie ja nur in mein Bett bekommen will.
»Nun, dann gibt es doch kein Problem, oder? Bleiben Sie einfach und genehmigen Sie sich noch einen Drink. Gönnen Sie sich ein bisschen Spaß.«
Sie stößt einen weiteren Seufzer aus. »Okay.«
»Klasse.« Ich drehe mich wieder zum Tresen. »Noch eine Runde.«
Aus der einen Runde werden drei.
Und ich habe so viel Spaß wie seit einer Ewigkeit nicht mehr.
Addison spielt an der altmodischen und völlig deplatzierten Jukebox in der Ecke herum, während ich am Tresen sitze und auf sie warte. Die Jukebox ist schon immer hier gewesen. Angeblich hat der Betreiber des Pubs sie auf einer Amerikareise erworben, doch wenn man die grässliche Musikauswahl bedenkt, hätte sie lieber jenseits des großen Teichs bleiben sollen.
Ich beobachte, wie Addison ihre Wahl trifft. Sie ist anders als die meisten Frauen, die ich kenne. Sicher, beim Hereinkommen wirkte sie arrogant, aber ich spüre, dass sie tief in ihrem Innern ganz anders ist, gar nicht anmaßend. Im Grunde ist sie schlichtweg bezaubernd.
Als sie wieder Platz nimmt, hat sie ein verschlagenes Grinsen im Gesicht, das sie noch liebenswerter aussehen lässt.
»Was ist denn so lustig?«, frage ich. Und dann höre ich es. Den grottenschlechten Song, den sie ausgesucht hat. Der Sänger singt mit seinem Südstaatenakzent eine Schnulze über sein gebrochenes Herz, und ich muss ebenfalls lachen.
»Gute Wahl.«
»Finde ich auch.«
Auf einmal ist sie aufgestanden und tanzt neben dem Tresen. Außerdem singt sie und trifft dabei nicht einen Ton. Sie hört sich wie ein krächzender Vogel an. Ihr Körper wiegt sich im Takt der Musik, und schon bald hat sie sich mir genähert. Jetzt befindet sie sich direkt vor mir, auch wenn ich mir nicht sicher bin, ob ihr das bei ihren geschlossenen Augen bewusst ist.
Ihr Körper ist so nah, dass ich ihre Bewegungen bei jedem Beat der Musik spüren kann. Mein Verlangen, die Hand auszustrecken und sie zu berühren, verzehrt mich, und ich frage mich, ob sie die Berührung mögen würde. Da ich es unbedingt wissen muss, bewege ich mich ein Stück auf sie zu, und in dem Moment öffnet sie die Augen.
Das Grün ihrer Iris ist fast verschwunden, als sie mich anstarrt und warme Röte ihr Gesicht überzieht.
Sie würde es mögen.
Mit diesem Wissen gewappnet, erhebe ich mich und ziehe sie zu mir heran, bewege meinen Körper im Takt mit ihrem.
Als der Song zu Ende geht und die ersten Töne des nächsten erklingen, gestatte ich mir ein Lächeln. Zumindest ist dieses Lied gar nicht so schlecht.
»Na los … Ich weiß, dass Sie den Text kennen«, ruft sie mir über den bekannten Song hinweg zu.
»Ich habe keine Ahnung, wovon Sie sprechen.«
Das ist eine Lüge. Ich bin oft genug in die Staaten gereist, um die bekanntesten Hits zu kennen. Nachdem ich also noch einmal mein Glas gehoben und einen weiteren Shot intus habe, stimme ich mit ein.
Ich schmettere den Text, den ich vor niemandem sonst zu singen wagen würde. Aber in Gegenwart dieser Frau komme ich mir normal vor. Ich fühle mich frei. Mir steht der Sinn danach, zu singen und mich zum Deppen zu machen, und ich finde es einfach toll.
Während Addison mit einem Arm durch die Luft wedelt, singt sie in ein imaginäres Mikrofon in der anderen Hand. Ich trete dazu und greife mir mein eigenes »Mikro«, um mitzusingen.
»Don’t stop believin’!«
Mit jeder Zeile des Songs entspanne ich mich weiter und tauche in die Welt ein, die diese Frau um mich herum erschaffen hat.
Es gibt keine Arbeit.
Kein Familienunternehmen.
Es gibt keinen Titel und keine familiären Verpflichtungen.
Ich kann einfach nur ich sein. Wer auch immer das sein mag.
4. Kapitel
Addison
»Zeit, den Heimweg anzutreten.« Ich will schon nach der Rechnung fragen, da spüre ich Olivers Hand an meiner Schulter.
»Das geht auf mich.«
»Schon gut.« Er nickt dem Barkeeper zu. »Auf mich, Robin.«
Normalerweise würde ich jetzt lautstark Einspruch erheben, aber ich bin zu angetrunken, um die Energie aufzuwenden. Stattdessen nehme ich meine Handtasche und stehe auf, gerate jedoch sofort ins Taumeln und breche in lautes Gekicher aus. Ich hebe die Hand und versuche, das Lachen zu unterdrücken, aber auch das ist ein vergebliches Unterfangen.
»Du setzt dich auf keinen Fall hinters Steuer, Sweetie.« Er streckt die Hand aus, um mir Halt zu geben. Seine Finger umschließen mein Handgelenk, und die rauen Fingerspitzen jagen mir einen wohligen Schauder über den Rücken. Von der Hitze zwischen uns wird mir ganz schwindelig.
»Addison«, rufe ich ihm ins Gedächtnis. Nicht Sweetie. Ich bin niemandes Sweetie. »Und du fährst mich ganz bestimmt nicht.« Mit diesen Worten versuche ich, seine Hand von meinem Gelenk abzustreifen. Ich muss diese Berührung unbedingt unterbinden, denn bloß das Gefühl seiner Hand weckt heftige Emotionen in mir, und das will ich nicht. Jeglicher Schritt in diese Richtung wäre ein Fehler.
»Du bist besoffen.«
Herausfordernd ziehe ich eine Augenbraue in die Höhe, dann nicke ich. »Stimmt.«
Da dämmert es mir. Ich bin betrunken. Sehr betrunken. In einem fremden Land, ohne dass ich Auto fahren könnte … Mist. Ich stöhne leise auf und setze mich wieder.
»Was ist los?«
Ich antworte nicht gleich, nur mein Mund öffnet und schließt sich wie bei einem ertrinkenden Fisch. Ächzend lege ich den Kopf in die Handfläche, weil ich Jasmine nicht anrufen und mich von ihr abholen lassen will.
»Ich kann dich nach Hause bringen.«
»Aber sicher doch, Romeo.« Ich verdrehe die Augen.
»Nicht so …« Seine Stimme stockt mitten im Satz, und er klingt entsetzt.
Doch das habe ich nicht gemeint, also drücke ich mich klarer aus. »Ich steige in kein Auto. Du bist auch betrunken.«
»Nicht so betrunken.« Er zuckt mit den Schultern. »Aber ich habe eine Idee.«
»Oh, da bin ich aber gespannt!« Ich sitze reglos da und warte ab.
Er beugt sich näher zu mir, und sein sinnlicher Mund ist zu einem Lächeln verzogen. »Lass uns was essen«, sagt er, und meine verspannte Nackenmuskulatur löst sich ein wenig. Das war nicht, was ich erwartet habe, und er lacht in sich hinein, weil er das ganz genau weiß. »Das wird uns schön ausnüchtern.«
»Dieses Dorf ist winzig. Wo sollen wir denn was zu essen bekommen?«
»Im Gasthaus.«
Ich hebe die Hand an meine Stirn und schüttele vehement den Kopf. »Himmel, steht mir ›dumme Amerikanerin‹ quer über die Stirn geschrieben?« Ich spreche leise, aber die Schärfe in meinem Tonfall ist nicht zu überhören. »Ich gehe ganz bestimmt nicht mit dir in den Gasthof.«
Kapitulierend hebt er die Hand, hört aber nicht auf zu lächeln. Mich aufzuziehen bereitet ihm offenkundig großes Vergnügen. »Noch nicht einmal, wenn ich verspreche, mich tadellos zu benehmen?«
Aber ja, er amüsiert sich köstlich. Und dann macht er es sogar noch schlimmer, indem er lächelt. Verfluchtes Grübchen. Wenn er lächelt, kann ich keinen klaren Gedanken fassen. Es ist schon schlimm genug, dass ich betrunken bin, aber muss er auch noch so lächeln? Warum muss er so amüsant sein und mich alles andere vergessen lassen? Denn genau das tut er … Er lächelt, und ich vergesse.
Dieses Grübchen sollte mit einem Warnhinweis versehen sein.
»Meinst du?« Seine Stimme unterbricht meinen inneren Monolog.
Mist.
Mist.
Mist.
»Hab ich das eben etwa laut gesagt?«
»Ja.«
»Das auch?« Herrgott, dieser Mann bringt mich noch um den Verstand. Und der Scotch hat natürlich auch nicht geholfen. Ich bin es nicht gewohnt, derart viel zu trinken. Das ist der Grund für meine Verwirrtheit, nicht etwa sein Grübchen oder sein Grinsen. Und ganz bestimmt nicht seine blauen Augen, die über mich schweifen, als läge ich nackt vor ihm und er würde mich bei lebendigem Leib vernaschen.
»Komm schon, Addy, was hast du denn zu verlieren? Auf dieser Welt kannst du leben, oder du kannst existieren. Wie wäre es also damit, wenn wir ein kleines bisschen leben …?«
Er greift in seine Hosentasche und zieht eine Münze hervor – wohl einen Penny. Schließlich befinden wir uns in England. »Bei Kopf machst du mal was ganz Verrücktes und kommst mit mir ins Gasthaus.«
Ich reiße empört die Augen auf.
»Zum Essen«, stellt er klar. »Und zwar die beste Portion Fish and Chips im ganzen Dorf.«
»Wahrscheinlich ist es das einzige Restaurant im ganzen Dorf, wo dieses Gericht auf der Karte steht«, erwidere ich tonlos.
»Sei nicht so bissig.« Er setzt sein sündiges Grinsen auf und wirft die Münze in die Luft. Ich beobachte, wie sie sich dreht, und er fängt sie in der Handfläche auf und klatscht sie dann auf den Rücken der anderen Hand.
Als er mir die Münze zeigt, verspüre ich freudige Erregung in meiner Magengegend, dabei sollte meine Reaktion völlig anders ausfallen, denn schließlich habe ich verloren.
»Na schön, gehen wir … Romeo.«
»Wenn ich Romeo bin, macht dich das dann zur Julia?«
»Wohl kaum. Wir sind keine Feinde, und ich werde auch nie Gift für dich trinken.«
»Ähm, ich will ja nicht spoilern, aber …«
»Ja, ich kenne die Geschichte von Romeo und Julia. Himmel noch mal. Außerdem müsstest du dann meinen Balkon hochklettern und Sonette aufsagen.«
Bei meinen Worten leuchten seine Augen auf. »Zeig mir nur, wo ich hinmuss.«
»Hahaha«, mache ich, aber ehe ich noch was sagen kann, hat er meine Hand mit seiner umschlossen.
»Deine Kutsche wartet.«
»Ich dachte, wir gehen zu Fuß?« Ich lasse zu, dass er meine Hand hält, während wir auf die Tür zugehen.
»Das tun wir auch. Ich wollte nur was Geistreiches sagen.«
»Das ging dann ja wohl in die Hose.«
»Offensichtlich. Komm, gehen wir.« Er zieht mich durch die Tür nach draußen in die Sommerluft. Zum Glück hat es sich ein wenig abgekühlt. Tagsüber war die Hitze brütend, aber jetzt sind es vielleicht um die zwanzig Grad.
»Kannst du in denen laufen?«, fragt er mit Blick auf meine Schuhe.
»Natürlich kann ich das.« Doch als mein Absatz auf das Kopfsteinpflaster trifft, gerate ich in Schieflage und stolpere. Blitzartig schnellt seine Hand vor, und er hält mich am Arm fest. Als ich mich wieder aufgerichtet habe, rechne ich damit, dass er mich loslässt, doch er packt mich noch fester und legt den anderen Arm um meine Taille.
Es fühlt sich gut an.
»Bist du wieder nüchtern?«, fragt er und sieht zu, wie ich mir nicht allzu grazil ein weiteres Stück Kabeljau in den Mund schiebe.
»Fast«, erwidere ich kauend.
»Was hat dieser arme Fisch verbrochen, dass er so eine Tortur verdient hat?« Er unterdrückt ein Lachen, und mich packt das jähe Verlangen, mit etwas nach ihm zu werfen.
»Was denn?«
»Du bist ein echter Gierschlund«, neckt er mich.
»Gar nicht«, sage ich und werfe ihm eine Fritte an den Kopf.
Er duckt sich und entgeht meinem Angriff. »Vielleicht doch.« Er lacht.
Ich verenge die Augen zu Schlitzen und deute mit der Gabel in seine Richtung. »Du hast gesagt, es sei der beste Fisch in der ganzen Stadt, und da könntest du richtiggelegen haben.«
Er grinst, und wir sehen uns in die Augen.
In dem Moment kippt etwas. Selbstverständlich sieht er fantastisch aus, aber bis zu diesem Zeitpunkt hätte ich die Sache niemals über einen bedeutungslosen Flirt hinausgehen lassen. Aber wenn er mich noch ein einziges Mal so ansieht, könnte ich ins Wanken geraten. Ein Mann wie er könnte eine Frau dazu bekommen, sich zu verlieren – zumindest für eine Nacht.
»Lass uns einen Spaziergang machen, wenn du fertig bist.«
»Wohin?«, erkundige ich mich nervös.
Als spüre er mein Unbehagen, erwidert er: »Bloß ein Spaziergang, Addison. Ich werde nicht weiter gehen … es sei denn, du möchtest das.«
Ich glaube ihm.
»Hast du meine Schuhe gesehen?«
Er steht auf und nimmt mich an die Hand. »Die brauchst du nicht.«
»Und wie soll das funktionieren?«
»Vertrau mir.«
Und hier kommt das Verrückte: Ich vertraue ihm tatsächlich, obwohl ich es eigentlich nicht tun sollte, und lasse mich von meinem Stuhl ziehen. Er behält meine Hand in der seinen, hakt mich unter und führt uns aus dem Gasthof.
Sobald wir das Kopfsteinpflaster erreichen, verschwindet der Boden unter mir, denn ich werde in die Luft gehoben.
»Was tust du da?«, kreische ich.
»Ich beschütze dich, ganz der Gentleman.« Er trägt mich weiter. Die schwachen Lichter der Lampen an der Straße flackern, aber schon bald lassen wir sie hinter uns.
Wahrscheinlich sollte ich besorgt sein, aber das bin ich nicht. Zu meiner Überraschung fühle ich mich in seinen Armen völlig sicher. Statt mich zu fragen, wohin wir unterwegs sind, lege ich den Kopf in den Nacken und blicke in den Nachthimmel. Meist fehlt mir die Zeit, ihn bewusst wahrzunehmen.
»Einfach wunderschön«, flüstere ich.
»Ja«, raunt er.
Ich sehe nach unten und stelle fest, dass er gar nicht den Himmel, sondern mich betrachtet. Ich muss unwillkürlich lächeln. »Nicht ich, du Dummkopf.« Ich hebe die Hand. »Die Sterne.«
»Sie scheinen heute ziemlich hell.«
»So strahlend habe ich sie noch nie gesehen.«
»Wirklich? Gibt es da, wo du herkommst, keine Sterne?«, scherzt er. »Wo ist dieses seltsame Land, das du deine Heimat nennst?«
»Natürlich gibt es dort Sterne, aber in Manhattan sind sie nicht so deutlich zu sehen.«
Oliver bleibt abrupt stehen, und ich blicke zu ihm auf.
»Kommst du aus Manhattan?«, fragt er, als hätte ich eine kostbare Information über mich preisgegeben.
»Ja.«
»Und du machst hier Urlaub … aber da ist noch etwas anderes, oder?«
Der wahre Grund meines Aufenthalts lässt jeglichen Sauerstoff aus meiner Lunge entweichen, aber ich weiß nicht recht, was ich sagen soll oder auch nur, wie. Stattdessen streite ich lieber alles ab. Sicher ist sicher.
»Ich weiß nicht, was du meinst.« Meine Stimme klingt zittrig, und er muss mir gar nicht in die Augen sehen, um zu wissen, dass das nicht stimmt – er kann die Lüge hören.
Nach ein paar Schritten setzt er mich auf dem Boden ab. Mitten im Nirgendwo lege ich mich ins Gras. Es ist dunkel, zu dunkel, um etwas anderes als den Nachthimmel über uns zu sehen. Ein Teil von mir fragt sich, ob wir uns unbefugt auf Privatgelände befinden, aber einem anderen – viel größeren – Teil ist das völlig egal.