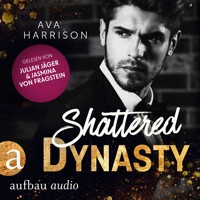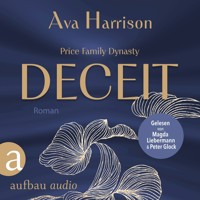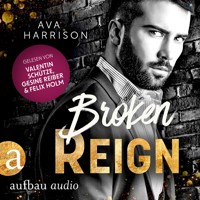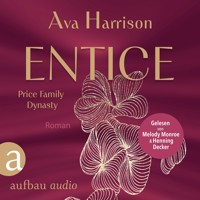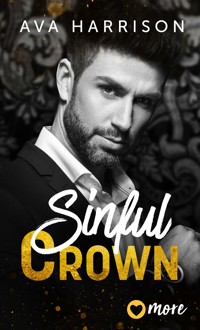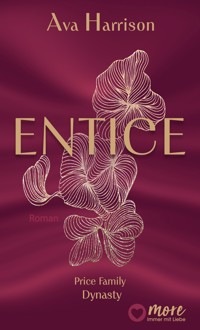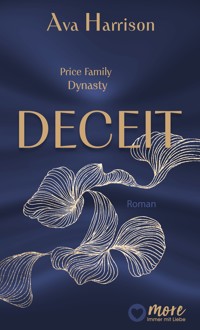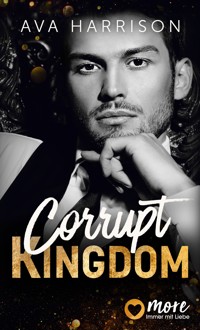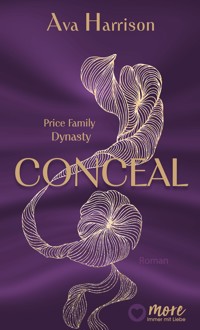
12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Price Family
- Sprache: Deutsch
Willow möchte ihre dunkle Vergangenheit endlich hinter sich lassen und flüchtet nach New York. Mit neuer Haarfarbe und Kontaktlinsen wagt sie den mutigen Schritt in ein unbekanntes Leben, während sie sich bei ihrer besten Freundin versteckt. Doch als sie kurzerhand für sie als Kellnerin einspringt, ahnt Willow nicht, dass ihr Schicksal bereits auf sie wartet. Inmitten des anonymen Treibens der Großstadt trifft sie Jaxson Price wieder - charismatisch, gutaussehend und mächtig. Und der Mann, dem Willow kurz zuvor 50 Dollar gestohlen hat.
Sie spürt sofort die magnetische Anziehung zwischen ihnen, doch gleichzeitig nagt die Angst an ihr. Jaxson ist kein gewöhnlicher Mann; er ist ein Meister des Spiels, jemand, der das Gesetz mit einem verführerischen Lächeln bricht und seine eigenen Regeln aufstellt.
Willow weiß instinktiv: Er könnte die Antwort auf all ihre Probleme sein – oder ihr größtes Risiko ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 459
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Liebe Leserin, lieber Leser,
Danke, dass Sie sich für einen Titel von »more – Immer mit Liebe« entschieden haben.
Unsere Bücher suchen wir mit sehr viel Liebe, Leidenschaft und Begeisterung aus und hoffen, dass sie Ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubern und Freude im Herzen bringen.
Wir wünschen viel Vergnügen.
Ihr »more – Immer mit Liebe« –Team
Über das Buch
Willow möchte ihre dunkle Vergangenheit endlich hinter sich lassen und flüchtet nach New York. Mit neuer Haarfarbe und Kontaktlinsen wagt sie den mutigen Schritt in ein unbekanntes Leben, während sie sich bei ihrer besten Freundin versteckt. Doch als sie kurzerhand für sie als Kellnerin einspringt, ahnt Willow nicht, dass ihr Schicksal bereits auf sie wartet. Inmitten des anonymen Treibens der Großstadt trifft sie Jaxson Price wieder - charismatisch, gutaussehend und mächtig. Und der Mann, dem Willow kurz zuvor 50 Dollar gestohlen hat.
Sie spürt sofort die magnetische Anziehung zwischen ihnen, doch gleichzeitig nagt die Angst an ihr. Jaxson ist kein gewöhnlicher Mann; er ist ein Meister des Spiels, jemand, der das Gesetz mit einem verführerischen Lächeln bricht und seine eigenen Regeln aufstellt.
Willow weiß instinktiv: Er könnte die Antwort auf all ihre Probleme sein – oder ihr größtes Risiko ...
Über Ava Harrison
USA Today Bestsellerautorin Ava Harrison liebt das Schreiben. Wenn sie sich nicht gerade neue Romances ausdenkt, kann man sie bei einem ausgiebigen Schaufensterbummel, beim Kochen für ihre Familie oder mit einem Buch auf der Couch antreffen.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Ava Harrison
Conceal
Aus dem Amerikanischen von Ute Brookes
Übersicht
Cover
Titel
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Grußwort
Informationen zum Buch
Newsletter
Widmung
Zitat
1. Kapitel — Jaxson
2. Kapitel — Willow
3. Kapitel — Jaxson
4. Kapitel — Willow
5. Kapitel — Jaxson
6. Kapitel — Willow
7. Kapitel — Jaxson
8. Kapitel — Willow
9. Kapitel — Jaxson
10. Kapitel — Willow
11. Kapitel — Jaxson
12. Kapitel — Willow
13. Kapitel — Willow
14. Kapitel — Willow
15. Kapitel — Willow
16. Kapitel — Jaxson
17. Kapitel — Jaxson
18. Kapitel — Willow
19. Kapitel — Jaxson
20. Kapitel — Jaxson
21. Kapitel — Willow
22. Kapitel — Jaxson
23. Kapitel — Willow
24. Kapitel — Jaxson
25. Kapitel — Willow
26. Kapitel — Jaxson
27. Kapitel — Willow
28. Kapitel — Jaxson
29. Kapitel — Willow
30. Kapitel — Jaxson
31. Kapitel — Willow
32. Kapitel — Jaxson
33. Kapitel — Willow
34. Kapitel — Jaxson
35. Kapitel — Willow
36. Kapitel — Jaxson
37. Kapitel — Willow
38. Kapitel — Jaxson
39. Kapitel — Willow
40. Kapitel — Jaxson
41. Kapitel — Willow
42. Kapitel — Jaxson
43. Kapitel — Willow
44. Kapitel — Jaxson
Epilog — Jaxson
Danksagung
Impressum
Lust auf more?
Allen Frauen gewidmet, die in dem Glauben aufgewachsen sind, sie müssten sich von einem Ritter retten lassen. In euren eigenen Händen sieht das Schwert viel besser aus.
»In unseren dunkelsten Momenten müssen wir uns konzentrieren, um das Licht zu sehen.«
– Aristoteles Onassis
1. Kapitel
Jaxson
Es geht doch nichts über ein Abendessen mit der Familie. Normalerweise sehen meine Pläne für Freitagabend definitiv anders aus, aber wenn Grayson anruft, lässt man alles stehen und liegen und fährt los. Denn was mein Bruder will, bekommt er. Und dazu gehört, neben vielen anderen Dingen, eben auch ein Familienessen.
Als Vorspeise bekommen wir mit Sicherheit eine Predigt darüber serviert, wie viel Grayson und Addison für Familie und Firma getan haben, und zum Hauptgang gibt es dann ein dreistündiges Referat zu dem Thema, was für ein Totalversager ich bin.
Das scheint mein unentrinnbares Schicksal zu sein.
Da ich keine Ermahnung von meinem Bruder brauche, mich blicken zu lassen, fahre ich frühzeitig durch die Stadt zu seinem und Rivers Apartment.
Der Verkehr ist mir heute wohlgesonnen und so bin ich im Nu im Aufzug auf dem Weg nach oben in sein Penthouse-Apartment, das die gesamte oberste Etage in dem Haus, das wir besitzen, einnimmt.
Wir.
Price Enterprise.
Addison, meine Schwester, hat ein ganz ähnliches Apartment. Ich nicht. Ich kann diese Gegend nicht ausstehen. Ich lebe in der Downtown in einem umgebauten Loft in Tribeca. Kein Vergleich zu der Aussicht auf den Central Park, die mein Bruder genießt, aber es ist viel mehr mein Ding. Dieses spießige Gebäude hier ist der reinste Albtraum für mich. Ich brauche Platz und vor allem Privatsphäre. Zu Grayson passt es jedoch gut. Mit den hohen Decken und der modernen Atmosphäre spiegelt das Apartment ganz wunderbar seine Persönlichkeit wider. Hier thront er in seiner Festung wie ein König über seinem Reich. Denn das ist Grayson Price … ein König, und ich bin bloß ein Hofnarr.
Das war nicht immer so. Klar, ein arroganter Arsch war Grayson schon immer, aber seit dem Tod meines Vaters ist es noch schlimmer geworden. Er hat das Bedürfnis, in Fußstapfen zu treten, die etliche Nummern zu groß für ihn sind.
Ihm ist nicht klar, dass er niemals wie Dad sein kann. Der Mann war eine Legende, nicht nur in der Vorstandsetage, sondern auch zu Hause. Er war immer da, ganz gleich, wie viele Stunden er arbeitete, und hat nie etwas verpasst. Dass ich das nicht zu schätzen wusste, bedauere ich mehr als alles andere im Leben. Als jüngstes Kind, fünf Jahre jünger als meine Schwester, hatte ich immer Komplexe, weil es keine Spielgefährten für mich gab. Ich dachte immer, mein Vater hätte zu viel mit meinen Geschwistern zu tun, um sich auch noch um mich zu scheren. Aber hinterher ist man immer klüger, und nun, wo er tot ist, begreife ich, dass ich mich geirrt habe und es nur kindliche Einbildung war. Leider kam diese Erkenntnis zu spät. Ich habe den Großteil meiner Jugend damit zugebracht, auf den Putz zu hauen, um Aufmerksamkeit zu bekommen, weshalb ich nun, Jahre später, immer noch beweisen will, dass ich mittlerweile erwachsen bin.
Genau wie jetzt, während ich mich abhetze, um rechtzeitig hier einzutreffen und ernst genommen zu werden.
Die Fahrstuhltür öffnet sich und ich befinde mich in dem modernen Apartment. Selbst für meine Verhältnisse ist es riesig, was viel heißt, denn ich bin auf einem Anwesen groß geworden. Raumhohe Fenster gehen auf den Park hinaus. Edelstahlgeräte, schwarze Schränke und dunkle Böden ergänzen den Look.
Fuck, ist das alles steril. Hier könnte man eine Operation durchführen und müsste vorher noch nicht einmal etwas desinfizieren.
Vielleicht eine OP, um ihm seine Arroganz zu entfernen.
Sein Apartment ist der Wahnsinn, bloß die Lage ist leider beschissen. Denn trotz der wunderschönen Aussicht muss man sich mit den Leuten in der Nachbarschaft auseinandersetzen.
Leute wie mein Bruder.
Leute, die mich von oben herab betrachten, weil ich mich in Jeans wohler fühle als im dreiteiligen Anzug.
»Jax, du bist da.«
Ich trete aus dem Fahrstuhl und spaziere in das Apartment. Mein Bruder steht mit verschränkten Armen da, den Kopf schräg, und betrachtet mich mit hochgezogener Augenbraue. Die Überraschung ist ihm ins Gesicht geschrieben. Ich habe ihn völlig verblüfft. Denn nicht nur bin ich zu diesem spontanen Dinner erschienen, ich bin auch richtig früh gekommen.
Gut. Ich bringe gern ein bisschen Leben in die Bude.
Sie sollen nie wissen, woran sie sind.
»Allerdings«, antworte ich selbstgefällig.
Da das nun geklärt ist, durchquere ich den Raum, nicke ihm zu und richte dann meine Aufmerksamkeit auf River, die auf dem Sofa sitzt. Die beiden sind ein süßes Paar. Während er hart ist, hat sie etwas Weiches. Zwei völlig gegensätzliche Eigenschaften, aber sie ergänzen sich vollkommen. Gegensätze ziehen sich an. River und Grayson als Paar haben zweifellos etwas ausgesprochen Paradoxes. Sie ist wie Sonnenschein, er wie Regen, aber letztlich kommt bei den beiden wohl ein Regenbogen heraus.
»Also«, setze ich an und schürze die Lippen, »wann heiratet ihr endlich?«
River ist mit Abstand meine Lieblingsverwandte, selbst wenn sie noch nicht offiziell meine Schwägerin ist. Je schneller wir das korrigieren, desto besser. Sie sorgt dafür, dass Grayson nicht völlig abhebt. Dank ihr ist er unbeschwerter, und es ist einfacher, mit ihm zurechtzukommen. Sicher, manchmal ist er trotzdem noch ein Mistkerl, aber mittlerweile ist er wenigstens die meiste Zeit über erträglich.
»Wir haben uns erst vor ein paar Monaten verlobt.« Lachend spielt sie mit dem blauen Diamanten an ihrem linken Ringfinger. Was genau dahintersteckt, weiß ich nicht, aber der Stein ist cool und einzigartig. Er ist anders, genau wie sie. Wie River.
»Mom kommt auch noch.«
Das führt bei mir zu einem Heben der Augenbraue, und ich wende mich meinem Bruder zu. »Heißt das, ihr seid dabei, die Hochzeit zu planen? Endlich«, füge ich hinzu.
»Ja, das heißt es.« Graysons Stimme klingt immer noch angespannt. Es ist, als sprächen wir über eine Vorstandssitzung und nicht über seine künftige Eheschließung.
Wie schwer ist es eigentlich für ihn zu lächeln? Ist er die ganze Zeit so verkrampft? Ich frage mich, ob er im Bett auch so ist … nein! Lassen wir das lieber.
»Wird auch langsam Zeit«, erwidere ich. Wie auf ein Stichwort öffnet sich abermals der Fahrstuhl. Diesmal betreten Addison, Oliver und meine Mom das Apartment.
Ich blicke ihnen entgegen. Addison sieht schön aus wie immer. Sie ist legerer gekleidet, als ich es von ihr gewohnt bin, und trägt schwarze Leggings, ein Strickkleid und Stiefel. Da sie kaum noch zur Arbeit kommt, sollte mich das nicht wundern. Wenn man nicht im Büro ist, braucht man keinen Hosenanzug.
Ihre Hand ruht auf ihrem leicht gewölbten Bauch.
Allmählich sieht man meiner großen Schwester an, dass sie schwanger ist. Ihr Gesicht strahlt vor Glück.
Grayson steht auf und geht mit einem breiten Lächeln auf sie zu. Mein Bruder scheint sich zu freuen. Unwillkürlich werde ich ein kleines bisschen eifersüchtig.
Meine Geschwister sehen so verdammt glücklich aus, und Oliver auch. Alle führen jetzt ein wahnsinnig gesetteltes Leben, nur ich habe bisher noch nichts vorzuweisen.
Stimmt nicht. Meine Binge-Liste auf Netflix ist einfach mega.
Mom und meine Schwester umarmen mich. Oliver begrüßt mich mit ausgestreckter Hand. Höflich wie ein echter englischer Gentleman – schließlich ist er ein Earl.
»Das Abendessen ist gleich fertig«, sagt Grayson und deutet in Richtung Esszimmer.
»Du hast gekocht?«, frage ich.
»Wohl kaum«, ächzt er, während wir zum Esstisch gehen.
»River?«
Er schüttelt den Kopf. »Catering.« Dann zuckt er die Schultern, als wäre allein schon die Frage lächerlich. Für die beiden mag das zutreffen, für mich hingegen nicht. Ich habe keine Dienstboten und auch keinen Koch. Ja, ich habe ein riesengroßes Loft und ein privates Büro, aber das ist nur wegen meines »Nebenberufs«. Diese Dinge benötige ich für die Arbeit und ich gewähre keiner Menschenseele dort Zutritt. Das kann ich nicht riskieren. Allem Anschein nach sieht die Regierung der Vereinigten Staaten Hacking nicht sonderlich gern.
Wir begeben uns alle zum Tisch. Es gibt doch tatsächlich Platzkarten, was bei einem Familienessen reichlich übertrieben wirkt, aber etwas sagt mir, dass dies Rivers erstes »Dinner« ist und sie unbedingt Eindruck machen will. Bei dem Gedanken muss ich lächeln. Als ich mich dem Tisch nähere, entdecke ich meinen Platz neben Olivers, während mein Bruder an der anderen Seite des Tisches sitzt. Ob das wohl Absicht war? Grayson hat zwar behauptet, er wolle sich mit mir mehr Mühe geben, aber da ich ihn trotzdem nie zu Gesicht bekomme und kaum mit ihm spreche, weiß ich, dass alles leeres Geschwätz ist. Und auch die Sitzordnung spricht Bände. Mein Bruder kann mich nicht ausstehen. Was für ein Arsch.
Bloß gut, dass es mir egal ist.
Jedenfalls rede ich mir das ein, während ich Platz nehme. Ich sitze gegenüber von dem Fenster mit atemberaubendem Blick auf den Central Park. Aufgrund der offenen Raumaufteilung des Apartments befindet sich der Essbereich in unmittelbarer Nähe zum Wohnzimmer, aber die Art, wie er dahinter versteckt ist, verleiht ihm dennoch etwas Intimes.
Sobald wir Platz genommen haben, erscheint das Personal, um das Essen zu servieren, und vor jeden von uns werden Teller gestellt.
Ich bin mir noch nicht einmal sicher, wo diese Leute auf einmal herkommen. Es ist, als wären sie plötzlich materialisiert, einfach so aus dem Nichts aufgetaucht, um sich um uns zu kümmern. Grayson und River wissen ganz genau, wie man eine gelungene Dinnerparty gibt, das muss ich ihnen lassen. Selbst wenn es unglaublich protzig ist.
Ich lehne mich auf dem Stuhl zurück und genieße das Schauspiel. Nachdem der Wein serviert worden ist, greife ich nach meinem Glas und trinke einen Schluck. Als ich gerade noch einmal nippen will, räuspert mein Bruder sich vernehmlich.
»Tja, ihr könnt euch ja bestimmt den Grund denken, weswegen wir hier sind. Da Addison schwanger ist, haben wir uns überlegt, mit der Hochzeit bis zum Frühjahr oder Sommer zu warten. Bis nach der Geburt des Babys.«
»Wie zuvorkommend.« Sie lacht.
»Wir haben auch sonst schon viel darüber nachgedacht, und wir würden gern in den Hamptons heiraten. Addy, wirst du es schaffen, mit einem Säugling zu reisen?« Jetzt hat er sich ihr zugewandt und sein Blick ist ganz sanft.
»Ja, klar. Je nachdem, wann genau ihr heiratet, wird das Baby älter als drei Monate sein, das passt schon. Wahrscheinlich leide ich dann an Schlafentzug und Erschöpfung, aber ich bin auf alle Fälle mit dabei.«
River lacht. »Okay, gut.«
Da hüstelt Grayson, und ich richte die Aufmerksamkeit wieder auf ihn.
»Wahrscheinlich werde ich viel von zu Hause aus arbeiten, um bei der Hochzeitsplanung mitzuhelfen.« Sein Blick ruht auf mir. Auf einmal scheint es sich in dem Raum aufzuheizen und die Wände rücken immer näher auf mich zu. Er wird gleich etwas sagen, und zwar etwas, das mich betrifft. Gleich wird er mir erzählen, dass es gar keinen Santa gibt, oder schlimmer noch, dass Mrs. Claus eine Massenmörderin ist. Jedenfalls freue ich mich nicht auf das, was er mir zu sagen hat.
Da wendet er sich wieder Addison zu, die nickt.
»Ich werde bald nach England zurückreisen«, erklärt meine Schwester. »Meine Ärztin möchte nicht, dass ich im letzten Schwangerschaftsdrittel noch fliege.«
Mist. Worauf läuft das alles hinaus?
»Das ist der andere Grund, warum ich dieses Treffen einberufen habe«, sagt nun Grayson. »Ich möchte darüber sprechen, dass wir jemanden einstellen, der einen Teil deiner Arbeit übernimmt, Addy. Ich werde nicht da sein …«
Bei seinen Worten krampft sich meine Lunge zusammen. Er vertraut mir nicht. Er möchte jemanden an Bord holen. Als Addy ihr Pensum reduziert hat, hinterfragte keiner Graysons Fähigkeit, beide Jobs zu übernehmen, aber da nun ich an der Reihe wäre, regen sich die Zweifel bei ihnen.
Sie glauben nicht, dass ich es schaffe.
Aber ich kann das.
»Ich übernehme«, werfe ich rasch ein. Es liegt nicht nur an meinem Stolz, der mir befiehlt, um meine Stellung zu kämpfen – ich will auch nicht, dass irgendein Fremder die Nase in meine Angelegenheiten steckt. Außerdem wäre es schön, endlich einmal ernst genommen zu werden.
»Jax …«
Die Art, wie er meinen Namen ausspricht, bringt mein Blut in Wallung. Ich hebe die Hand und unterbreche ihn mitten im Satz. »Nein. Komm mir nicht mit Jax. Warum einen anderen anheuern, wenn ich hier bin und es machen kann und will?« Ich bemühe mich, nicht die Stimme zu heben, aber ehrlich gesagt fällt es mir schwer, denn ich bin stinksauer. Jahrelanger versteckter Groll dringt an die Oberfläche und brodelt wie ein Vulkan kurz vor dem Ausbruch.
»Es ist eine große Verantwortung.« Er hört sich an wie Dad, der mich schimpfte, weil ich zu spät nach Hause kam. Aber er ist nicht mein Vater, und so stacheln mich seine Worte nur noch weiter an.
»Und ich kriege das nicht gebacken?«, gebe ich zurück, und jetzt ist der Zorn in meiner Stimme deutlich vernehmbar.
»Jax.« Ich höre meinen Namen von der anderen Tischseite und wende mich der sanften Stimme zu. »So meint Gray das nicht«, sagt Addison, aber es ist längst zu spät, um mich zu besänftigen. Ich springe auf und schiebe dabei den Stuhl zurück.
»Doch. Er glaubt nie, dass ich etwas hinbekomme. Aber an wen wendet ihr euch alle, wenn ihr unbedingt etwas braucht?« Ich starre erst Grayson zornig an und richte dann meine Aufmerksamkeit auf Addison. »An mich. Und keinen anderen.« Als Nächstes wandert mein Blick zu Oliver, dann zu River. Obwohl sie nichts gesagt haben, nehme ich sie doch in Sippenhaft, zumal ich ihnen auch schon geholfen habe. »Wie ist es nun also? Ihr behauptet immer, ihr würdet mich brauchen, aber jetzt … bin ich mal wieder nicht gut genug.« Kopfschüttelnd atme ich aus.
»Jax …« Grayson fährt sich mit den Fingern durchs Haar. »Natürlich weiß ich deine Hilfe und alles, was du für die Familie getan hast, zu schätzen, aber das hier ist etwas anderes.« Er versucht, mich mit einer Handbewegung zu beschwichtigen, aber über den Punkt bin ich längst hinaus.
»Inwiefern?«
»Sitzungen. Termine. Manchmal um spätestens sechs Uhr morgens im Büro sein. Die Nacht durcharbeiten.«
»Das habe ich alles schon in der Vergangenheit für dich gemacht.«
»Das mag sein, aber du tust es aus dem Homeoffice, Gott weiß, wo und wann. Wenn du im Büro mit anpackst, musst du auch im Büro sein. Wenn du auf Achse sein willst, hast du dich nicht mehr nach deiner Zeit zu richten, sondern nach der Arbeitszeit.«
»Damit komme ich klar.«
»Das denkst du vielleicht …«
»Ich habe gesagt, ich komme damit klar.«
»Grayson«, sagt Addison, und er dreht sich zu ihr. »Gib ihm die Chance. Ich bin einverstanden.«
»Schön«, antwortet Gray. »Aber …«
»Es reicht«, blaffe ich, weil ich es leid bin, der Pausenclown zu sein und von niemandem ernst genommen zu werden. Ganz egal, wie viel ich leiste, sie zweifeln trotzdem an mir, und ich habe es gründlich satt. »Ich mache es. Und damit basta.« Dann wende ich mich meiner Mutter zu, die während meines Wutausbruchs ganz blass geworden ist. Reue steigt in mir hoch, aber nachgeben werde ich trotzdem nicht. Ich schenke ihr ein mattes, verspanntes Lächeln. Sie hat meinen Groll nicht verdient. »Tschüss, Mom.«
Ich stürme zum Fahrstuhl und drücke auf den Knopf, ohne mich von sonst jemandem zu verabschieden. Keiner gibt einen Ton von sich, und als ich in den Aufzug steige, tue ich es mit geradem Rücken und hoch erhobenen Hauptes.
Ich habe meine Meinung gesagt, und jetzt werde ich tun, was ich tun muss. Denn ich will ihnen beweisen, dass sie sich täuschen.
2. Kapitel
Willow
Bumm.
Bumm.
Bumm.
Das Blut strömt pochend durch meine Adern, während die Worte, die ich nur Augenblicke zuvor gehört habe, noch einmal in meinen Ohren abspielen.
Wie ist das hier überhaupt möglich? Mit sechsundzwanzig Jahren sollte man heiraten und eine Familie gründen und nicht auf der Flucht sein.
Mit immer noch zitternden Händen lenke ich den Wagen aus der Auffahrt. Nicht zu schnell fahren, ermahne ich mich mit einem Blick auf den Tacho, aber ich muss hier weg. Trotzdem drücke ich nicht das Gaspedal durch, sosehr ich es auch möchte. Ich darf nicht das Risiko eingehen, in eine Polizeikontrolle zu kommen, oder mich von jemandem dabei erwischen lassen, wie ich mich aus dem Staub mache.
Wenn man mich erwischt, könnte alles Mögliche passieren.
Ich bin beinahe da. Fast habe ich es geschafft. Die Stadtgrenze rückt näher, aber mit jeder weiteren Meile zittere ich immer heftiger am ganzen Körper. Jetzt fehlt nur noch, dass ich das Bewusstsein verliere.
Mein Herz pocht so heftig, dass ich schon Angst habe, es könnte aus meinem Brustkorb hervorbrechen.
Ganz bestimmt schaffe ich es nicht. Ich werde hinter dem Steuer in Ohnmacht fallen, einen Unfall bauen und wahrscheinlich sterben. Bei meinem derzeitigen Glück wirkt der Tod allerdings wie ein verlockendes Schicksal.
Atmen.
Einatmen. Ausatmen.
In der Ferne sehe ich die Abzweigung. Mit angehaltenem Atem drehe ich am Lenkrad, biege rechts ab und fahre auf die Straße, die mich aus diesem Höllental bringen wird. Im Rückspiegel bemerke ich das Schild.
Die Stadt, die ich soeben hinter mir lasse.
Madison Bay, Michigan.
Ich bin fort und entferne mich immer weiter von den Dämonen, die dort leben. Doch diese Gedanken haben jetzt nichts in meinem Kopf zu suchen. Nein. Da ist kein Platz für Zweifel oder Angst. Ich muss die Sache durchziehen.
Ich fahre immer weiter, bis die Wörter in der Ferne nicht mehr zu entziffern sind. Bis ich auf eine andere Straße fahre. Und dann noch eine.
Bis die Vergangenheit hinter mir liegt, und ich mich auf meine Zukunft konzentrieren kann – jedenfalls die absehbare Zukunft.
Außer dem Licht meiner Scheinwerfer liegt die Straße vor mir dunkel da, was sich beinahe wie ein Omen anfühlt. Meine Zukunft ist so düster wie diese verlassene Straße.
Mit einem Kopfschütteln verbiete ich mir diese Gedanken. Dunkelheit hin oder her, ich bin jetzt in Sicherheit und frei.
Nach einer Stunde glaube ich, weit genug weg zu sein, um gefahrlos einen Zwischenstopp einzulegen. Ich fahre zu einer Tankstelle, benutze die Zapfsäule, die am weitesten von dem Laden entfernt ist, und gehe gar nicht erst hinein, um etwas zu kaufen. Es ist einfach zu riskant. Außerdem brauche ich nichts außer den Sachen in meiner Reisetasche. Ich zahle an der Zapfsäule, werfe mein Handy in einen Abfalleimer, und so schnell, wie ich hergekommen bin, bin ich auch schon wieder verschwunden.
Ich fahre noch eine halbe Stunde, biege immer wieder ab und entferne mich weiter, ehe ich mich entschließe, erneut zu halten. Einfach alles hinter mir zu lassen, fühlt sich total surreal an …
Es ist, als würde sich der Lügennebel, aus dem mein Leben bestand, mit jeder weiteren gefahrenen Meile auflösen. Auf einmal ist die Hölle, in der ich gelebt habe, kein verborgenes Geheimnis mehr.
Allerdings ist diese Hölle kein Ort; es ist ein Gefühl, das man in sich trägt, und ich befürchte, dass keine noch so große Entfernung es abmildern oder mir Sicherheit verschaffen wird.
Noch während ich den Gedanken niederkämpfe, suche ich mir eine Nische auf dem Parkplatz und schalte den Motor aus. Nachdem ich mir meine kleine Reisetasche geschnappt habe, öffne ich schwungvoll die Tür. Da ich weiß, dass man mein Auto mit der Zeit finden wird, stelle ich sicher, dass ich keine Spuren hinterlasse, die einen Verfolger zu meinem nächsten Ziel führen könnten. Zwar weiß ich noch gar nicht, wo ich landen werde, aber: je weiter weg, desto besser.
Mit der Tasche in der Hand gehe ich zu dem Schalter.
»Wohin?«, erkundigt sich die Frau hinter der Scheibe. Sie macht sich noch nicht einmal die Mühe, mich anzusehen, als wäre ich eine einzige große Unannehmlichkeit.
Wohin soll ich fahren?
Wie weit muss ich weg, um in Sicherheit zu sein?
Im Grunde ist das eine sinnlose Frage, denn er würde jegliche Entfernung zurücklegen, um mich zu finden. Aber je weiter ich mich von ihm entferne, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mir, ehe er mich findet, einen Plan zurechtlegen kann.
»Ohio«, lautet meine Antwort.
Mein Ziel ist das nicht. Nein, ganz und gar nicht. Aber je mehr Orte ich aufsuche, desto besser stehen meine Chancen.
Mit einem Nicken gibt sie alles ein, blickt beim Tippen aber immer noch nicht auf. Als sie mir den Preis sagt, hole ich das Bargeld aus der Tasche und bezahle.
Da das Geld nun vor ihr liegt, hebt sie endlich den Blick. Sie schaut durch mich hindurch, und ich bin dankbar dafür. Je weniger Menschen mir Beachtung schenken, desto besser. Sie reicht mir die Fahrkarte und ich mache mich auf den Weg zum Bus.
Mittlerweile ist es Nacht, und während der Wartezeit scheint der Mond auf mich herab. Es ist seltsam, dass sich innerhalb eines Tages mein ganzes Leben verändert hat, aber die Sterne am Abendhimmel immer noch dieselben sind. Alles ist anders und doch auch wieder nicht.
Es ist einfach unfassbar, dass dies tatsächlich geschieht. Ich laufe aus dem einzigen Zuhause weg, das ich je gekannt habe.
Dad.
Nein. Heftig schüttele ich den Kopf, denn ich darf nicht an ihn denken. Ich darf nicht darüber nachdenken, was wirklich geschehen ist.
Doch sosehr ich auch versuche, das neu gewonnene Wissen über meinen Vater aus meinem Kopf zu verbannen, will es mir einfach nicht gelingen. Wie konnte alles so aus dem Ruder laufen?
Bleiben kann ich nicht. Selbst wenn ich nicht genau weiß, was mit mir geschehen würde, ist das Risiko einfach zu groß. Die Flucht zu ergreifen, war keine leichte Entscheidung, aber letztlich blieb mir keine andere Wahl. Ich schnappte mir nur etwas Geld, ein paar Klamotten und ein gerahmtes Foto. Sonst nichts. Für mehr war keine Zeit.
Meine Brust senkt sich, als ich die Luft ausatme, die ich seit meiner Flucht angehalten habe.
Beinahe ist es so weit, beinahe bin ich in Sicherheit.
Ich wiederhole mein Mantra und atme langsam und tief, bis ich den Bus ankommen höre. Kreischend bleibt er stehen, und dann steige ich ein ins Ungewisse. Alles wird gut, rede ich mir ein, während ich mich nach hinten schleppe und nach einem Sitzplatz Ausschau halte. Ich hoffe, dass sich niemand neben mich setzt. Meine Nervosität ist auch so schon groß genug.
Zu meinem Glück ist der Bus zu dieser späten Stunde so gut wie leer, und keine Minute später fährt er auch schon ab.
Meine Muskulatur entkrampft sich ein wenig, als wir den Bahnhof immer weiter hinter uns lassen. Sobald er nicht mehr zu sehen ist, schließe ich endlich die Augen und zwinge mich dazu, mich ein wenig auszuruhen.
In Toledo, wo ich umsteigen muss, wache ich auf, und dann sitze ich wieder in einem Bus und reise immer weiter. Gleich nach meiner Ankunft in Columbus löse ich noch eine Fahrkarte. Diesmal setze ich einen Hut und eine Brille auf. Außerdem ist mein Haar jetzt dunkelbraun und nicht mehr rotblond wie sonst. Eine Perücke. Zusätzlich habe ich eine Flasche mit dunkelbrauner Haarfarbe gekauft, die ich anzuwenden gedenke, sobald ich mein endgültiges Ziel erreicht habe.
Nachdem ich aus dem Bus ausgestiegen war, war ich in einem kleinen Laden. Selbst wenn man mich bis nach Columbus verfolgt, wird man mich nicht finden können, denn mittlerweile bin ich nicht wiederzuerkennen.
In meiner Verkleidung nehme ich den nächsten Bus, und nach einer mehrstündigen Fahrt steige ich in einen neuen Bus um, um meinen endgültigen Bestimmungsort zu erreichen. Diese Stadt ist hoffentlich so riesig, dass ich dort in einem Meer von Menschen untertauchen und mir einen Plan für meine nächsten Schritte zurechtlegen kann.
Wir fahren durch die Nacht. Es ist über zwei Tage her, dass ich das letzte Mal in einem Bett geschlafen habe, über dreißig Stunden, seitdem mein Leben auf den Kopf gestellt und mir alles, was ich kannte und liebte, genommen wurde.
Ich gestatte mir zu schlafen, und als meine Augen das nächste Mal zuckend aufgehen, höre ich den Bus dröhnend zum Stehen kommen. Ich habe mein Ziel erreicht.
Benommen und desorientiert gehe ich auf den Ausgang zu und trete ins Freie. Ich befinde mich mitten in New York City und habe nicht die leiseste Ahnung, wohin ich soll. Ich habe kein Handy und kenne keine Menschenseele in dieser Stadt.
Gibt es hier überhaupt Telefonzellen? Wahrscheinlich nicht.
Ich gehe in den nächsten Drugstore und kaufe ein Prepaid-Handy. Aber wen kann ich schon anrufen? Wem kann ich vertrauen? Vielleicht sollte ich meine Kontakte auf dem Handy durchschauen.
Ach, Mist. Das alte Handy habe ich ja weggeworfen.
Ich zermartere mir das Gehirn nach sämtlichen Telefonnummern, die in meinem Handy gespeichert waren, aber das funktioniert sowieso nicht. Ich darf niemanden anrufen, der zu meinen Telefonkontakten gehörte. Sonst wird man mich auf jeden Fall finden. Außerdem muss ich jegliche Social Media und Websites vermeiden, die sich zu mir zurückverfolgen lassen.
Denk nach!
In Gedanken gehe ich all diejenigen durch, mit denen ich in regelmäßigem Kontakt bin, und anschließend die, mit denen ich es nicht bin. Ich rufe mir all meine Freunde und Freundinnen ins Gedächtnis, und dann kommt mir ein Name in den Sinn. Maggie.
Maggie. Meine beste Freundin aus der Grundschulzeit. Danach ist sie weggezogen. Es ist schon komisch, dass ich mir keine Telefonnummern merken kann, aber ihre weiß ich immer noch.
Damals hatte ich noch kein Handy. Als ihre Koffer gepackt waren, ließ sie mich auf ihrem Bett sitzend die Nummer immer wieder aufsagen.
Ich kann bloß hoffen, dass sie sich keine neue zugelegt hat. Wir haben seit Jahren keinen Kontakt mehr. Aber ich weiß, ganz egal, was los ist oder wie viel Zeit verstrichen ist, sie würde mich niemals abweisen.
Mit meiner Reisetasche und dem neuen Handy in der Hand gehe ich ein paar Straßen weiter und wähle dann aus dem Kopf ihre Nummer.
Es klingelt.
Fuck. Und wenn sie mittlerweile eine andere Nummer hat? Wenn sie nicht rangeht?
Meine Gedanken überschlagen sich, während ich sämtliche Möglichkeiten durchgehe. Und während das Telefon weiter läutet, schlägt mein Herz immer schneller.
Ich warte. Warte. Warte.
Als ich schon aufgeben und mir etwas anderes einfallen lassen will, höre ich es.
»Hallo.« Die Stimme klingt leise und zögerlich, aber ich erkenne sie sofort.
Meine Knie werden mit einem Mal ganz weich.
Mir war überhaupt nicht klar, wie dringend ich ihre Stimme hören musste. Aber hier ist sie nun, und während mir Tränen der Erleichterung in die Augen treten, weiß ich, dass ich sie brauche. Mit zugeschnürter Kehle versuche ich, die richtigen Worte zu finden.
»Maggie?«, frage ich mit vor Nervosität zitternder Stimme.
»Ja, am Apparat«, erwidert sie.
Mittlerweile kullern Tränen über meine Wangen. »Ich … ich bin’s …«
»Willow?«
Sie weiß es. Sie erinnert sich an mich. Sie ist es.
Mittlerweile sind meine Wangen tränenüberströmt. »Ja«, bringe ich krächzend hervor.
»Geht es dir gut?« Obwohl ich seit Jahren nicht mehr mit ihr gesprochen habe, höre ich Angst und Sorge in ihrer Stimme. Als wäre keine Zeit vergangen, als wären wir immer noch beste Freundinnen, und als würde sie immer noch alles für mich tun.
»Nein«, flüstere ich, denn selbst jetzt – nachdem ich meinen bösen Geistern entkommen und weit weg von all dem Schrecken bin – geht es mir nicht gut.
»Wo bist du?«
»In New York. Wohnst …« Ich hole tief Luft. »Wohnst du immer noch hier?« Ich lege den Kopf in den Nacken, und wenn am lichtverschmutzten Himmel von Manhattan eine Sternschnuppe zu sehen wäre, wüsste ich auf Anhieb, was ich mir jetzt wünschen würde.
»Ja.«
Ich muss unwillkürlich die Luft angehalten haben, denn jetzt entweicht sie in einem Schwall.
»Sag mir, wo du bist, dann hole ich dich ab.«
»Nein. Das brauchst du nicht. Alles gut. Kann ich zu dir kommen?«, frage ich.
»Natürlich.«
Sie nennt mir eine Adresse in der Wohnsiedlung Stuyvesant.
Da ich mir nicht sicher bin, wie weit es bis dort ist, entscheide ich mich für ein Taxi und ziehe für das Fahrgeld ein paar Dollar aus der Notfallreserve in der Reisetasche. Ich muss aufpassen, dass ich nicht so viel Geld ausgebe. In Zukunft kann ich mir vielleicht kein Taxi mehr leisten, aber nach dem Tag und der Nacht, die hinter mir liegen, lehne ich mich auf der schmutzigen Rückbank zurück und genieße die Fahrt.
Schon nach einer Viertelstunde hält das Taxi vor einem Hochhaus. Ich steige aus dem Wagen und gehe darauf zu. Meine Tasche ist zwar nicht sonderlich schwer, aber ich bin völlig erschöpft. Angesichts der Nervosität, die mich durchströmt, könnte ich schwören, dass ich gleich in Ohnmacht falle.
Doch das passiert nicht. Nein, ich halte durch. Im Aufzug und den gesamten Korridor entlang kämpfe ich mein Gefühlschaos nieder und setze eine stoische Miene auf.
Die Tränen kommen erst, als die Tür sich öffnet. Meine Freundin hat sich in all den Jahren kein bisschen verändert. Im nächsten Moment hält sie mich in den Armen, und ich weine hemmungslos, denn zum ersten Mal, seit mein Albtraum begann … bin ich in Sicherheit.
Hier wird mich keiner finden.
3. Kapitel
Jaxson
Drei Wochen später
Es ist Freitagnachmittag, und wieder einmal sind sowohl Addison als auch Grayson nicht in der Stadt. Eigentlich sollte ich mich mittlerweile daran gewöhnt haben, aber das habe ich nicht. Ich weiß, ich habe gesagt, es sei okay, und ich weiß auch, dass dies ein Test ist, um zu sehen, wie gut ich die Firma im Griff habe, aber ich vermisse die beiden. Laut sagen würde ich das natürlich niemals.
Es ist einfach zu still.
Sicher, bei Price Enterprise haben wir ein Riesengebäude voller Angestellter, aber auf meiner Etage, im obersten Stock, arbeitet kaum jemand.
Bevor ich die zusätzliche Verantwortung übernommen habe, bin ich nie ins Büro gekommen, deshalb ist es merkwürdig, jetzt ständig hier zu sein. Mit meinen »besonderen Fertigkeiten« kann ich von überall arbeiten und ziehe einen abgelegenen Standort vor, wo man mich nicht tracken kann.
Um mich zu beweisen und um ernst genommen zu werden, muss ich aber leider im Büro sein. Selbst wenn es nichts für mich zu tun gibt. Sei vorsichtig, was du dir wünschst … man denke nur an Midas. Als der sich wünschte, alles, was er berührte, in Gold zu verwandeln, dachte er ganz bestimmt nicht daran, was passieren würde, wenn er einmal pinkeln müsste.
Ich werfe einen Blick auf die winzige Uhr am rechten Rand meines Computers. Es ist sechzehn Uhr. Beinahe Feierabend.
Na endlich! Noch vor ein paar Monaten hätte ich mich längst vom Acker gemacht. Da wir die wöchentliche Vorstandssitzung abgeschafft haben, habe ich nichts mehr zu tun. Mit meiner Arbeit bin ich fertig, und mit Graysons und Addisons ebenfalls.
Ich sollte von hier verschwinden. Das einzige Problem besteht darin, dass ich Gefahr laufe, von meinem Bruder oder meiner Schwester angerufen zu werden, die dann wissen, dass ich zu früh nach Hause gegangen bin. Das mag auf den ersten Blick keine große Sache sein, aber im Moment habe ich wirklich keine Lust darauf, von ihnen angemeckert zu werden und Zweifel an meinen Führungsqualitäten zu schüren.
Am Ende stellen sie dann doch noch eine Vertretung ein.
Einen Spion. Eine Bürde.
Ich kann allen in dieser Etage vertrauen, was meinen geheimen Zeitvertreib betrifft, aber ich kann nicht riskieren, dass ein Außenstehender Wind davon bekommt. Das könnte zu Problemen führen. Wenn ich eines nicht will, dann dass das FBI bei mir vor der Tür steht. Je weniger Leute hier oben herumlaufen, desto besser. Deshalb ziehe ich gerade auch diese Show ab. Statt Feierabend zu machen, behalte ich die Uhr im Auge, spiele auf dem Handy …
Als mir das zu langweilig wird, hacke ich mich in Addisons Reisepläne, und sobald ich auf dem Laufenden bin, wann sie wieder in den Staaten sein wird, wird besser auch gleich noch Grays Terminplan gehackt. Wie es aussieht, wird keiner von beiden in den nächsten vierzehn Tagen zurück sein, und selbst dann werden sie kaum im Büro sein. Addison hat gute Gründe für ihre Abwesenheit, da sie schwanger ist. Aber Grayson …
Ich bin mir nicht sicher, was Grayson gerade treibt.
Irgendetwas sagt mir, dass es sich um einen Test handelt, und wenn ich Mist baue, springt er aus dem nächstbesten Schrank und erklärt mir, er hätte ja sowieso gewusst, dass ich es nicht hinbekäme. Überraschung!
Um Punkt siebzehn Uhr stehe ich auf, fahre den Computer herunter, schnappe mir mein Handy und verlasse das Büro.
Auf dem Weg zum Fahrstuhl winke ich Jasmine und Nicole zu. Jasmine war früher Addisons Assistentin, aber jetzt hangelt sie sich bei Price Enterprise auf der Karriereleiter nach oben. Nicole ist die Assistentin meines Bruders. Ich bin dankbar, die beiden hier zu haben, denn ich weiß, dass sie den Laden in meiner Abwesenheit schmeißen können.
Ich verlasse die Eingangshalle und trete hinaus in den Stadtverkehr. Da ich heute nicht mit dem Auto zur Arbeit gefahren bin, wird ein Taxi herhalten müssen. Während ich die rechte Hand hebe, zücke ich mit der linken mein Handy.
Nach Hause will ich nicht. Ich habe keine Lust darauf, allein zu sein, und würde viel lieber noch etwas trinken gehen. Wen kann ich anrufen? Wer würde mit mir ausgehen?
Ich scrolle durch meine Kontakte, und der erste Name, der mir als möglicher Kandidat für einen Cocktail ins Auge springt, ist Pierce Lancaster. Pierce und ich sind seit Jahren befreundet. Dass wir beide als jüngste Geschwister im Rahmen eines Familienerbes, dem man niemals gerecht werden kann, aufgewachsen sind, hat uns von Anfang an zusammengeschweißt. Ich habe seit Wochen nicht mehr mit ihm geredet, und so tippe ich auf seinen Namen und schicke ihm rasch eine Nachricht.
Ich: Wo bist du?
Pierce: Bei Lindsey.
Das war ja klar. Wo auch sonst? Wenn ich eine Frau wäre, würde ich jetzt die Augen verdrehen. Ich hatte ganz vergessen, was für eine Trantüte er geworden ist, seit er sich verliebt hat.
Immer noch mit erhobener Hand an der Straßenecke setze ich meine Suche nach einer anderen Möglichkeit fort.
An mir drängen unzählige Menschen vorbei, und alle scheinen sich auf den Beginn des Wochenendes zu freuen. Mit lächelnden Gesichtern telefonieren manche, während sie an mir vorbeigehen. Bestimmt schmieden sie Pläne. Das muss schön sein. Ich habe leider keinen Plan.
Normalerweise hätte ich ein heißes Date, aber in letzter Zeit hatte ich zu viel um die Ohren, um mich zu verabreden. Außerdem habe ich eigentlich keine Lust, mich mit einer der Frauen zu verabreden, die ich kenne.
Nein. Heute Abend muss ich mal einen anderen Gang einlegen. Ich brauche eine Abwechslung.
Verzweifelt zermartere ich mir das Hirn nach einem Ort, irgendeinem Laden. Aber da mir spontan nichts einfällt, wandert mein Blick wieder zu meinem Handy und ich scrolle weiter.
Bei T angelangt sehe ich eine Möglichkeit.
Trent.
Der gute alte Trent.
Trent und ich sind seit unserer gemeinsamen Schulzeit miteinander befreundet. Der Reichtum seiner Familie macht meiner Konkurrenz. Aber im Gegensatz zu mir arbeitet er nicht. Nun, das stimmt nicht: Er arbeitet durchaus, aber nur, wenn er will. Und wenn er nicht will, lässt er seinen Job als Hedgefondsmanager ruhen und lebt eine Zeit lang von seinem Treuhandvermögen.
Wie es ihm trotz seiner schlechten Arbeitsmoral gelingt, überhaupt Klienten zu haben, ist mir völlig schleierhaft. Aber er hat wohl nichts zu beweisen.
Im Gegensatz zu mir.
Das Gute an seinen sporadischen Arbeitszeiten ist, dass bei ihm immer etwas los ist. Zwar verbringen wir nicht mehr so viel Zeit miteinander, seitdem ich behauptet habe, mehr Verantwortung übernehmen zu wollen, aber das hier ist quasi ein Notfall. Mir ist langweilig.
Ich klicke auf Anrufen.
»Hey, Kumpel! Ich habe mich schon gefragt, wann du endlich mal wieder anrufst«, meldet er sich.
Es tut gut, seine Stimme zu hören. Es erinnert mich an bessere Zeiten, als ich herumgammeln und bis mittags ausschlafen konnte.
»So lange ist es doch noch gar nicht her.« Lüge. Es fühlt sich an, als wäre ich eine Ewigkeit nicht mehr um die Häuser gezogen. Mit der freien Hand fahre ich mir durchs Haar. Der bloße Gedanke, wie ich mir ein Bein ausgerissen habe, um mich zu beweisen – und was hat es mir gebracht?
Nichts.
Niemand respektiert mich.
»Es ist mindestens einen Monat her«, erwidert er trocken. »Hast du endlich diese verrückte Idee, unbedingt ernst genommen zu werden, an den Nagel gehängt?«
Er hat recht, es ist verrückt. Total durchgeknallt, wenn ich einmal ehrlich bin. Manchmal weiß ich noch nicht einmal so richtig, warum es mir überhaupt wichtig ist. Aber das ist es nun einmal. Aus der Nummer komme ich leider gerade nicht raus.
»Schön wär’s. Aber …« Meine Stimme verliert sich. »Ich finde, jeder braucht mal eine Pause.«
»Und deshalb rufst du mich an.« Er lacht, und während ich einstimme, drängen die Leute an mir vorbei, die über die Straße wollen. Ich stehe komplett im Weg.
Hier kann ich nicht stehen bleiben. Ich kann es auf den Tod nicht ausstehen, wenn jemand mitten auf dem Gehsteig telefoniert, und nun, da ich unbedingt eine Zerstreuung für den Abend finden will, benehme ich mich selbst wie die größte Nervensäge.
»Genau. Wenn jemand Pläne hat, die ich interessant finden könnte, dann du. Eh klar.« Da keine Taxis zu sehen sind, gehe ich auf die Subway zu. Wahrscheinlich sollte ich etwas ausmachen, ehe ich keinen Empfang mehr habe.
»Nun, zufälligerweise wüsste ich da tatsächlich etwas. Jedenfalls wenn du nichts dagegen hast, ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen.«
Bei diesen Worten bleibe ich doch wieder stehen und hebe abermals den Arm, um ein Taxi herbeizuwinken. »Jetzt bin ich ganz Ohr«, erwidere ich.
»Eine Pokerpartie.«
Mein Mund verzieht sich zu einem breiten Grinsen. Poker. Eine meiner liebsten Freizeitbeschäftigungen.
Das hört sich vielversprechend an.
»Okay«, antworte ich, denn da gibt es nicht viel zu überlegen.
»Es ist aber nicht das übliche Pokerspiel. Das hier ist ganz exklusiv, und es geht um hohe Einsätze.«
Jetzt hat er mein Interesse wirklich geweckt. Hohes Risiko ist genau mein Ding, aber wenn er exklusiv sagt, muss ich mehr in Erfahrung bringen.
»Einzelheiten«, fordere ich, denn so gern ich Poker spiele und so cool Trent auch ist, kann er doch manchmal ziemlich zwielichtig drauf sein. Solange es sich nicht um irgendein dubioses Hinterhofspiel handelt, bin ich mit von der Partie. Aber bei ihm weiß man nie.
»Kennst du Cyrus Reed?«
»Cyrus Reed«, wiederhole ich. »Der Name sagt mir etwas.« Ich versuche, mich zu erinnern, woher ich ihn kenne. Da fällt es mir schlagartig ein. Reed. Er ist mit River verwandt. Ein Cousin oder so etwas. »Ich bin ihm schon mal begegnet. Banker, stimmt’s?«
»Unter anderem.« Bei diesen Worten wird seine Stimme immer tiefer.
»Zum Beispiel?«
»Sein Portfolio umfasst etliche sehr unterschiedliche Unternehmungen.« Seine Antwort ist vage, was mir Warnung genug sein sollte, aber mir ist nun einmal langweilig.
»Und eine seiner vielen geschäftlichen Unternehmungen besteht darin, illegale Pokerpartien zu veranstalten?« Ich sage ja nicht, dass ich nicht mitmache, aber ich spiele eben gern mit offenen Karten.
»Exklusive Pokerpartien«, verbessert er mich.
»Worin besteht da der Unterschied?«
»Es verstößt nicht gegen das Gesetz.«
Zwar kann er mein Gesicht am Handy nicht sehen, aber wenn, wüsste er, dass ich ihm das nicht abkaufe. Die Sache ist nur, dass es mir egal ist. Es wäre schließlich nicht das erste Mal, dass ich bei etwas Illegalem die Finger im Spiel habe. Die US-Regierung würde es bestimmt gar nicht gern sehen, wenn sich jemand in ihre Regierungsakten hackt, und so einen Mist ziehe ich mindestens fünfmal die Woche ab. Was macht da schon eine Pokerrunde?
Immerhin hätte ich etwas zu tun.
Wie schon gesagt … Mir ist sterbenslangweilig.
»Ich bin dabei.« Endlich hält ein Taxi an der Straßenecke und ich reiße schwungvoll die Tür auf. Nachdem ich dem Fahrer die Adresse meines Lofts zugerufen habe, gilt meine Aufmerksamkeit wieder Trent. »Wo?«, erkundige ich mich.
»In Connecticut.«
»Echt jetzt? Das ist ärgerlich«, murmele ich. So viel zum Thema Alkohol. Ich werde mit dem Auto fahren müssen.
»Das sind dreißig Minuten aus der Stadt raus. Sei kein Waschlappen und hör mit dem Gejammer auf.«
Ich beende das Gespräch und stoße ein heiseres Lachen aus. Er redet echt nur Blödsinn. Auf keinen Fall wird es nur eine halbe Stunde dauern, ganz egal, wie schnell ich fahre.
Nur eine Sekunde später erreicht mich eine Nachricht.
Trent: 100.000 $ Buy-in.
Fuck.
4. Kapitel
Willow
Die drei Wochen seit meiner Ankunft in der Stadt sind nur schleppend vergangen. Ich bin in eine Sackgasse geraten, und es fühlt sich an, als würde ich hier tatenlos herumsitzen und Däumchen drehen. Mit jedem verstreichenden Tag warte ich darauf, dass meine Vergangenheit mich einholt.
Bisher habe ich allerdings Glück gehabt, und es ist nichts passiert. Es ist beinahe so, als würde ich mich gar nicht verstecken. Mein Leben ist ziemlich normal, wenn man die schlaflosen Nächte ignoriert, die Albträume, wenn ich doch einmal schlafe, und den Umstand, dass ich mir ständig über die Schulter schaue.
Ich wohne bei Maggie in ihrem Apartment. Ideal ist es nicht, aber es ist meine einzige Wahl, während ich mir einen Plan einfallen lasse, was ich mit den Informationen, auf die ich gestoßen bin, anstellen soll.
Insgeheim hege ich den Verdacht, dass ich der Situation nicht gewachsen bin.
Okay, es ist mehr als ein Verdacht: Ich bin hundertprozentig davon überzeugt.
Ich muss mich jemandem anvertrauen. Um unbeschadet aus der Sache herauszukommen, brauche ich Hilfe, aber im Moment vertraue ich niemandem. Noch nicht einmal Maggie. Ich weiß, dass sie mir niemals absichtlich schaden würde, aber sie könnte mein Leben trotzdem ungewollt in Gefahr bringen. Schlimmer noch, ihr könnte etwas passieren, und wenn so etwas eintreten sollte, könnte ich es mir niemals verzeihen. Die Schuldgefühle tief in meinem Herzen wegen Dingen, an denen ich nichts ändern kann, sind schlimm genug – aber wenigstens Maggie kann ich beschützen.
Jedes Mal, wenn sie mich also ansieht und in ihren Augen die flehende Bitte liegt, ich solle mit ihr reden, tue ich es nicht. Nein. Ich werde nicht das Risiko eingehen, sie zu einem Opfer in einem Krieg zu machen, in den ich sie niemals hätte hineinziehen dürfen.
Da ich ihr nicht die ganze Wahrheit darüber sagen kann, warum ich hier bin, schweige ich lieber. Es bringt mich schier um, aber es geht nicht anders.
Zum Glück hat sie vor ungefähr einer Woche aufgehört nachzufragen, und ihre flehentlichen Blicke sind auch verschwunden. Falls sie gern mehr erfahren würde, lässt sie es sich mittlerweile jedenfalls nicht mehr anmerken. Dafür bin ich dankbar. Sie behandelt mich, als wäre alles in bester Ordnung, als wäre ich bloß eine Freundin, die eine Pechsträhne hat und auf ihrer Couch schläft.
Sie weiß nicht, wie richtig sie damit liegt. Gelegentlich erwähnt sie Arbeit und erkundigt sich nach meinen Plänen, um Geld zu verdienen. Von dem Bargeld, das in ihrem Schrank versteckt liegt, ahnt sie nichts. Nein, das habe ich ihr auch vorenthalten, genau wie den emotionalen Ballast, den ich mit mir herumschleppe.
Heute sitze ich auf ihrer Couch. Es ist Freitagnachmittag. Eigentlich sollte ich mir eine Arbeit suchen, aber meine Optionen sind begrenzt.
Ohne Ausweis und Referenzen … Mist, aus Angst kann ich ja noch nicht einmal meinen Nachnamen verwenden – nein, ich bin völlig aufgeschmissen.
Und was für einen Job kann ich mir schon suchen, wenn ich gar nicht weiß, wie lange ich bleibe? Ich könnte monatelang hier sein oder vielleicht nur noch ein paar Tage. Es wäre nicht richtig, eine Arbeit anzufangen und mich dann plötzlich aus dem Staub zu machen. Ich brauche also einen Plan, ehe ich mir einen Job suche.
Da ich nicht wie der Rest der Welt ins Büro gehen kann, sehe ich fern. Ich weiß gar nicht, wo Maggie ist. Vermutlich auch arbeiten.
Als hätten meine Gedanken sie heraufbeschworen, geht die Apartmenttür auf, und Maggie kommt herein. Als sie näher kommt, fällt mir als Erstes auf, dass ihr Haar völlig zerzaust ist. Ihr braunes Haar ist zu einem unordentlichen Knoten zusammengebunden.
Mein Blick wandert von dem Vogelnest auf ihrem Kopf zu ihrem Gesicht. Sie sieht richtig mies aus. Ihre Haut ist fleckig, und ihre Nase hat einen Rotton, den man sonst nur an einem bestimmten Rentier zur Weihnachtszeit findet.
Mit glasigen Augen sieht sie mich an, und noch während sie mich anstarrt, niest sie. Nicht einmal.
Nicht zweimal.
Dreimal.
Du meine Güte! Wenn sie so weitermacht, brauche ich eine OP-Maske.
»Ich bin krank«, ächzt sie.
Ich ziehe eine Braue in die Höhe. »Echt jetzt? Ist mir überhaupt nicht aufgefallen«, erwidere ich, und sie schnieft erneut.
»Was soll ich nur tun?« Sie lässt sich neben mich auf die Couch plumpsen.
»Versuchen, mich nicht anzustecken.«
Als sie nicht lacht, bekomme ich ein schlechtes Gewissen. Offensichtlich geht es ihr gar nicht gut, denn normalerweise lacht sie über meine sarkastischen Witzeleien.
»Leg dich hin. Ich gehe nach unten zum Laden an der Ecke und besorge Suppe.« Ich stehe auf und streiche mein Hemd glatt.
»Du bist Weltklasse. Ich wollte auf dem Heimweg was besorgen, aber ich war so müde und musste mich unbedingt aufs Ohr hauen. Hoffentlich geht es mir heute Abend wieder besser«, sagt sie, während ich schon auf dem Weg bin, um meine Tasche zu holen.
Bei ihren Worten bleibe ich wie angewurzelt stehen und blicke kopfschüttelnd über die Schulter. »Was steht denn heute Abend auf dem Programm?«, frage ich, denn wenn es sich nicht um ein Dinner mit Gott handeln sollte, kann sie es hundertprozentig vergessen.
»Mein erster Soloauftritt.« Sie hustet, und ihr Gesicht läuft rot an, als hätte sie sich verschluckt und bekäme keine Luft mehr.
»Das ist nicht dein Ernst.«
»Todernst.«
»Da kannst du nicht hin, Mag. Du bist krank.«
Sie schüttelt den Kopf, aber die Bewegung und ihr Aufstöhnen lassen erkennen, dass sie sogar dafür zu schwach ist. »Ich muss aber. Mir bleibt keine andere Wahl. Ich kann die Sache auf gar keinen Fall vermasseln.«
Mir ist klar, wie wichtig es für sie ist, ihr Geschäft auf die Beine zu bringen. Maggie hat eine neue Firma zur Veranstaltung von Events gegründet, bei der man Bedienungen und Barpersonal für private Feiern mieten kann. Jahrelang hat Maggie in der City als Managerin einer luxuriösen Champagnerbar gearbeitet. Dann fing sie an, nebenbei Jobs als Bedienung anzunehmen, und so entstand das Ganze, nachdem sie immer wieder gebeten wurde, mehr Hilfskräfte zu organisieren.
Es hat Monate gedauert, bis nun der Startschuss für die Firma fallen kann, und ich weiß, wie wichtig ihr die Sache ist, aber es wäre der reinste berufliche Selbstmord, in ihrem jetzigen Zustand dort aufzukreuzen.
»Mach dir keinen Kopf. Wenn ich mit deiner Suppe zurückkomme, fällt uns schon etwas ein.«
Sie nickt, verzieht aber gleichzeitig das Gesicht. Wahrscheinlich glaubt sie mir nicht, aber arbeiten kann sie heute Abend auf gar keinen Fall gehen.
Ich winke ihr kurz zu und mache mich auf den Weg. Ehe ich das Apartment verlasse, schnappe ich mir meine Mütze und die Brille. Obwohl ich mir die Haare gleich bei meiner Ankunft in New York braun gefärbt habe, fühle ich mich ohne meinen Kram trotzdem nicht sicher auf den Straßen der Stadt. Falls es Maggie auffällt, dass ich mich verkleide, behält sie es für sich.
Mit gesenktem Kopf breche ich zu dem Laden auf. In dem Apartment mit Maggie mag ich mich sicher fühlen, aber wenn ich mich draußen bewege, werfe ich ständig Blicke über die Schulter. Aus Angst, jemand könnte mich erkennen.
Das Geschäft befindet sich nur ein paar Eingänge weiter, aber draußen ist es eiskalt. In dicke Mäntel eingehüllte Menschen gehen vorüber, wohingegen mein einziger Schutz vor der Kälte darin besteht, dass ich die Arme vor der Brust verschränkt um mich schlinge.
In meiner Eile, bei meinem Aufbruch meine Mütze anzuziehen, habe ich gar nicht daran gedacht, einen Mantel mitzunehmen. Ich weiß nicht genau, wann die Temperaturen so gesunken sind, aber, Herrgott noch mal, es ist wirklich bitterkalt.
In der Luft liegt der Geruch nach verbrennendem Laub.
Beim Betreten des Ladens schlägt mir jedoch das fettige Aroma sämtlicher zubereiteter Speisen entgegen – als wäre ich auf einem Gewürzmarkt und nicht in einem Lebensmittelgeschäft. Rasch greife ich nach einem Einwegbehälter und gieße Suppe hinein.
Nudelsuppe mit Hühnchen wird dir guttun.
Das sagte meine Mutter früher immer, als ich noch ein Kind war. Mein Gesicht verzieht sich zu einem Lächeln bei der Erinnerung, wie sie mir die Suppe löffelweise verabreicht und gesagt hat, sie sei besser als Penicillin.
Immer noch mit einem Grinsen und völlig gedankenversunken gehe ich mit der Suppe in der Hand an den Regalen vorbei. Da ich nun schon einmal hier bin, durchforste ich den ganzen Laden nach Dingen, die wir sonst noch brauchen könnten. Als ich an den Toilettenartikeln vorbeikomme, schnappe ich mir Taschentücher und Klopapier. Dann gehe ich zu der Ecke mit den Medikamenten.
Sobald ich alles habe, was ich brauche, gehe ich an die Kasse, bezahle und eile zurück.
Als ich wieder Maggies Apartment betrete, stelle ich fest, dass sie auf der Couch eingeschlafen ist.
»Mags.«
Ich bleibe neben ihr stehen, aber sie antwortet nur mit einem langgezogenen Gähnen, das in einem Wimmern endet. »Ich habe deine Suppe.«
Ich hole einen Löffel und stelle die Suppe vor sie auf den Couchtisch. »Mags.« Diesmal sage ich es lauter, und sie muss mich gehört haben, denn sie reckt die Arme, öffnet die Augen und schenkt mir ein mattes Lächeln.
»Danke«, flüstert sie, ehe sie sich aufsetzt und zu essen beginnt.
Ich setze mich und wende mich zu ihr. »Was steht heute Abend an? Kann eine deiner Mitarbeiterinnen für dich einspringen?«
Auf meine Frage hin lässt sie den Löffel sinken und runzelt die Stirn. »Nein.« Sie schüttelt den Kopf. »Wir sind so schon unterbesetzt.«
»Das verstehe ich nicht.«
»Eigentlich war ich nicht darauf vorbereitet, so früh einen Auftrag anzunehmen, aber mir hat sich eine fantastische Chance eröffnet und ich konnte einfach nicht Nein sagen.«
»Worum genau geht es?«
»Es ist ein Pokerabend mit hohen Einsätzen. Sehr exklusiv. Aber da der Auftrag so unerwartet hereingeschneit ist, hatte ich keine Zeit, genügend Personal anzuheuern, also sind da nur ich und noch eine Bedienung, um die Getränke zu servieren. Außerdem haben wir Josh an der Bar, aber das reicht nicht. Es handelt sich um High-End-Kundschaft, und die Zahl der Aufträge, die sich allein aus diesem Job ergeben dürfte, könnte mein Leben verändern. Ich kann das nicht absagen.« Ihr Tonfall lässt keinerlei Einwände zu. Sie umzustimmen, steht nicht zur Debatte, aber es muss eine Lösung geben.
»Ich sage ja nicht, dass du absagen sollst, aber es muss doch jemanden geben, der für dich einspringen kann«, sage ich.
»Es gibt niemanden. Alle, die ich gefragt habe, sind anderweitig beschäftigt. Ganz ehrlich, ich übertreibe nicht. Mir bleibt einfach keine andere Wahl. Entweder gehe ich krank dorthin oder ich muss absagen.«
Ehe ich es mir recht überlege, rutscht mir etwas heraus, das ich ganz bestimmt bereuen werde.
»Ich mache es.« Die Wörter entschlüpfen meinem Mund, ohne dass ich sie zurücknehmen könnte, dabei weiß ich noch im selben Moment, dass ich einen schrecklichen Fehler begangen habe. Das hier ist eine ganz miese Idee. Ich werde mein Gesicht nicht verbergen können. Und was soll ich überhaupt anziehen? Irgendetwas sagt mir, dass meine Mütze, Brille und die übergroße Schlabberhose, die meine Figur verhüllen soll, nicht infrage kommen.
Aber das ist egal.
Ich muss es tun.
Selbst wenn es bedeutet, dass ich auffliege.
Nein. Das passiert schon nicht. Sie hat gesagt, dass es sich um eine exklusive Pokerpartie handelt, was auch privat bedeutet …
Es wird schon gutgehen.
Auch Maggie scheint meinen Einfall für eine Schnapsidee zu halten, denn sie reißt die Augen auf. Sie starrt mich an, als wäre ich verrückt geworden oder spräche eine andere Sprache.
»Ich springe für dich ein.«
Sie legt den Kopf schräg. »Weißt du überhaupt, wie man serviert? Hast du so was schon mal gemacht?«
»Na ja, nein. Aber …«
Ihr Kopfschütteln lässt mich verstummen. »Es ist nicht so leicht, wie es aussieht.«
»Ich weiß, aber was für eine andere Möglichkeit bleibt dir?«
Ihre Stirn legt sich in Falten. »Keine.«
Ich bin spät dran.
Als ich Maggie endlich überredet hatte, blieb mir kaum genug Zeit, mich fertig zu machen.