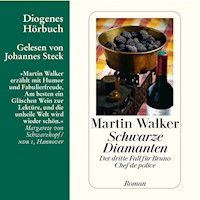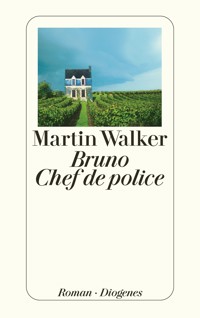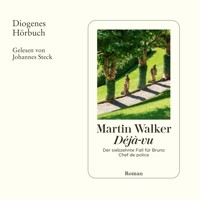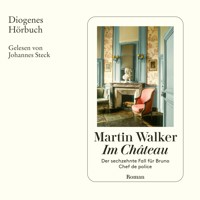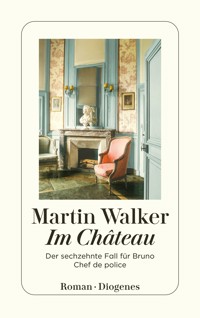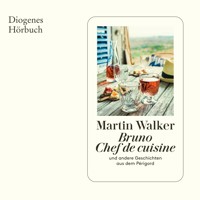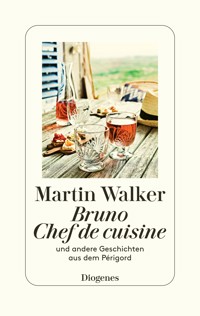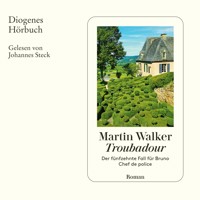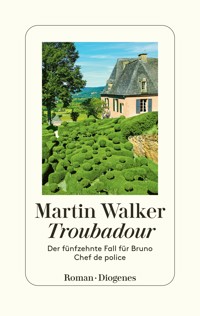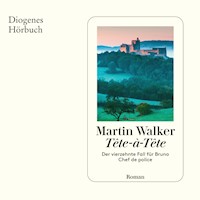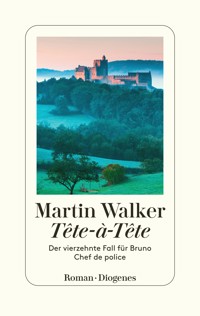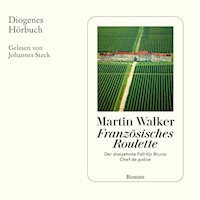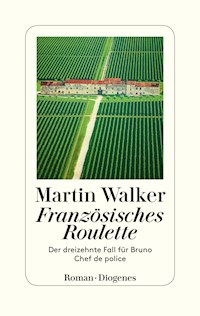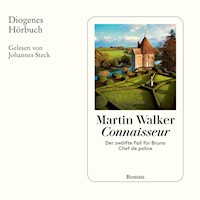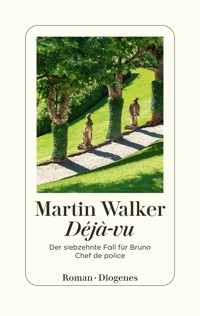
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Krimi
- Serie: Bruno, Chef de police
- Sprache: Deutsch
Bruno erholt sich noch von einer Schussverletzung, als ein geheimnisvoller Fund sein Interesse weckt: Bei einem verfallenen Schlösschen wird ein Grab mit drei Skeletten entdeckt, offenbar aus dem Zweiten Weltkrieg. Ist es im idyllischen Saint-Denis zu Kriegsverbrechen gekommen? Bruno begibt sich auf Spurensuche in dunkle Zeiten, doch auch in der Gegenwart wird er dringend gebraucht: Internationale Besucher müssen mit Köstlichkeiten aus dem Périgord bewirtet werden, und die malerische Vézère schwillt zu einem reißenden Strom an, der ganz Saint-Denis in Gefahr bringt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 431
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Martin Walker
Déjà-vu
Der siebzehnte Fall für Bruno, Chef de police
Roman
Aus dem Englischen von Michael Windgassen
Diogenes
In Erinnerung an meinen lieben Freund Pierre Simonet, der als Waisenkind aufwuchs, als junger Mann Militärdienst leistete und dann Dorfpolizist wurde; seine kluge und großzügige Art inspirierten mich zu den Bruno-Romanen. Wie mein fiktiver Bruno war Pierre ein guter Koch, er kannte jedermann, tanzte auf Hochzeiten und brachte den Kindern bei, Rugby und Tennis zu spielen. 2024 ist er nicht lange nach seiner Pensionierung nach kurzer Krankheit gestorben. Pierre war viele Jahre mit seiner (mittlerweile ebenfalls verstorbenen) Frau Francine verheiratet und hat mit ihr den gemeinsamen prächtigen Sohn Adrien erzogen.
Mit großem Respekt und Zuneigung ist dieses Buch allen drei Simonets gewidmet.
1
Bruno Courrèges, Polizeichef im Tal der Vézère in der französischen Region Périgord, stieg ein wenig steif aus seinem altehrwürdigen Land Rover und blickte liebevoll über die Brücke auf das Rathaus der kleinen Ortschaft von Saint-Denis. Hinter dem Balkon mit den Fahnen Frankreichs und Europas befand sich das Büro, das er seit über einer Dekade nutzte, aber schon seit gut zwei Monaten nicht mehr von innen gesehen hatte. Nach einer Schussverletzung an der Schulter hatte er mehrere Wochen im Krankenhaus verbracht, worauf ein Aufenthalt von weiteren sechs Wochen folgte in einer Reha-Klinik für französische Polizisten, die im Dienst verwundet worden waren. An dem weniger mondänen Abschnitt der Mittelmeerküste gelegen, bot die Einrichtung gutes Essen, sympathische Gesellschaft sowie großartige Pflege und Physiotherapie. Bruno fühlte sich gut erholt, wenn er auch noch nicht voll wiederhergestellt war.
Sein treuer Basset Balzac, der ihn am Vorabend bei seiner Rückkehr nach Saint-Denis überschwänglich begrüßt hatte, sprang nun aus dem Fahrzeug und folgte ihm auf dem Fuß. Bruno war noch immer gerührt von dem herzlichen Empfang, den ihm nicht nur Balzac und sein Pferd Hector bereitet hatten, sondern auch alle Freunde, die sich im Reiterhof zur Feier seiner Rückkehr an der langen Tafel versammelt hatten. Sie hatten ihn auch häufiger im Krankenhaus besucht, zuerst in Périgueux, dann in Bordeaux, wo ihm das zerschmetterte Schlüsselbein wieder aufgebaut worden war. Als sich nach dem Abendessen alle Freunde diskret zurückgezogen hatten, war er von Pamela nach oben in ihr Schlafzimmer geführt worden. War sie in der rechten Stimmung, forderte sie gern von ihrem einstigen Geliebten und jetzt sehr engen Freund seine amouröse Leidenschaft ein. Diesmal, sagte sie neckend, sei es, um sicherzustellen, dass alles noch gut funktioniere. Und es funktionierte prima.
Nach den schweren Regenfällen in der Nacht hingen die Fahnen tropfnass herab, und die Dachpfannen glänzten. Als Bruno die Brücke passiert hatte, war ihm der hohe Pegelstand der Vézère aufgefallen. Was ihn daran erinnerte, dass Ende Oktober die eher trockene Zeit vorbei war, gerade rechtzeitig, um aus seinen Winter-Hobbys, dem Rugbyspiel und der Jagd, eine schön schlammige Angelegenheit zu machen. Jedenfalls, so sagte er sich, tat der Regen seinem Rosenkohl und dem Brokkoli gut, die er im August gepflanzt hatte. Dicht gefolgt von Balzac überquerte er den Wochenmarkt. Es waren nur wenige Kunden zu sehen, manche mit Regenschirmen, andere mit Wollmützen auf dem Kopf, wie sie auch Bruno trug, um sich gegen den kalten Wind zu schützen. Vielleicht lag es daran, dass ihn, obwohl er von seinem stadtbekannten Hund begleitet wurde, niemand zu erkennen schien, als er auf die Mairie zusteuerte.
Er stieg über die steinernen Stufen des Bürgermeisteramtes, die nach Jahrhunderten leicht konkav abgelaufen waren, hinauf in die erste Etage, in der sich sein Büro befand. Die Buschtrommeln hatten seine Rückkehr offenbar angekündigt, denn im Flur war das ganze Personal versammelt, um ihn zu begrüßen: der Bürgermeister und sein Stellvertreter Xavier, Claire, die kokette Sekretärin, und Roberte vom Sozialamt; Michel von der Baubehörde, Marie vom Wohnungsamt und sogar Laurent, der Hausmeister, mit seiner Frau und Clémentine, die Reinigungskraft. Seine Kollegin Juliette, die Polizistin von Les Eyzies, und Yveline, die Kommandantin der örtlichen Gendarmerie, umarmten ihn als Erste. Alle anderen taten es ihnen gleich, bis auf Bürgermeister Mangin, der schon an dem Willkommensdiner am Vorabend teilgenommen und eine große Flasche von Brunos Lieblingswein, einem 2009er Grand Millésime vom Château de Tiregand, spendiert hatte.
Trotz aller Herzlichkeit, mit der Bruno in der Mairie empfangen wurde, spürte er doch eine gewisse Befangenheit unter den Kolleginnen und Kollegen, eine atmosphärische Störung, als wäre irgendetwas im Haus am Brodeln. Ohne genauer bestimmen zu können, was es war, schien der Ort verändert zu sein. Er war daran gewöhnt, gleichsam an Bord eines glücklichen Schiffes zu sein, auf dem jeder mit jedem gut und liebevoll zusammenarbeitete in der Überzeugung, gemeinsam einer wichtigen Aufgabe nachzugehen. Die Hälfte der Belegschaft warf immer wieder nervöse Blicke auf die geschlossene Tür zu Brunos Büro.
»Ich bin noch zwei Wochen krankgeschrieben, bevor mich der toubib wieder für einsatzbereit erklärt, also immer mit der Ruhe«, sagte er lächelnd. »Ich wollte nur kurz einen Blick in mein Büro werfen und nachsehen, ob alles noch an Ort und Stelle ist. Nicht dass ihr alle meine Kugelschreiber ausgeliehen oder den alten Drucker kaputt gemacht habt.«
Der eine oder die andere lachte gekünstelt, und dann teilte sich die Gruppe, um Bruno den Weg freizumachen. Erwartungsvolle Blicke folgten ihm. Hatte man zusammengelegt und ihm ein Geschenk gekauft oder den Raum mit Blumen dekoriert? Bruno hoffte, dass dem nicht so war. Die Gehälter in der Mairie waren notorisch knausrig, und die meisten Kollegen hatten Familien zu ernähren. Vor der Bürotür angelangt, winkte er ihnen zu und sagte: »Schön, wieder hier zu sein, wenn auch nur auf Stippvisite.« Er trat ein.
Einen Augenblick lang glaubte Bruno, durch die falsche Tür gegangen zu sein. Der Schreibtisch stand vor dem Fenster, und auch die anderen Möbel waren umgeräumt worden. Der alte Aktenschrank aus verbeultem Stahlblech war verschwunden, mit ihm auch der Drucker, den er darauf abgestellt hatte. Anstelle des Schranks stand ein Luftbefeuchter vor der Wand, und er konnte den Duft von Räucherwerk wahrnehmen, ein Vanillearoma. Ob auch sein ewig quietschender Drehsessel ausgetauscht worden war, ließ sich auf Anhieb nicht erkennen, weil hinter dem Schreibtisch eine Frauengestalt saß, die vor dem durch das Fenster hereinfallenden Licht nur als Silhouette wahrzunehmen war.
»Hat Ihnen noch niemand gesagt, dass man anklopft, bevor man ein Zimmer betritt?«, erkundigte sich eine barsche Stimme, deren Timbre darauf schließen ließ, dass dieser vermeintliche Fehltritt nur einer von vielen war, die es zu ertragen galt.
»Nicht wenn ich mein eigenes Büro betrete«, antwortete Bruno und versuchte, sich seine Verwunderung nicht anmerken zu lassen. »Wer sind Sie, und warum sitzen Sie auf meinem Sessel?«
»Ich bin Mademoiselle Cantagnac und neuerdings dem hiesigen Chef de police als Verwaltungsassistentin zugewiesen. Und wer sind Sie?«
»Ich bin der Chef de police. Was stimmt nicht mit dem Büro, das Ihnen, wie ich vermute, ursprünglich zugeteilt worden ist?«
»Es entspricht nicht den geltenden Standards, ist zu klein und zu dunkel. Die Arbeitsplatzspezifikationen für zivile Beamte, die für die Polizei arbeiten, sind klar und detailliert beschrieben. Mir wurde gesagt, dass Sie Ihren Dienst erst Ende der nächsten Woche wieder aufnehmen, und auch nur, wenn Ihr Arzt damit einverstanden ist. Und wenn das da Ihr Hund ist, Tiere haben am Arbeitsplatz nichts zu suchen.«
»Balzac ist sehr viel mehr als irgendein Tier«, entgegnete Bruno ruhig, obwohl ihm anders zumute war. »Er ist ein perfekt ausgebildeter Spürhund, hat zwei vermisste Kinder wiedergefunden und eine an Alzheimer erkrankte Mitbürgerin gerettet, die kurz davor war zu erfrieren. Außerdem hat er uns geholfen, eine Geisel zu befreien. Sein Vorgänger wurde erschossen, als er mich vor bewaffneten Terroristen zu schützen versucht hat. Ich kann nur hoffen, mademoiselle, dass Sie sich als ebenso hilfreich erweisen wie Balzac, der mir nach dem Tod meines ersten Hundes vom Innenminister höchstpersönlich übergeben worden ist. Und jetzt würde ich gern an meinem Schreibtisch Platz nehmen und für eine Weile ungestört sein, bitte.«
Er öffnete ihr die Tür, doch sie rührte sich nicht vom Fleck.
»Wenn das hier Ihr Büro war, sollten Sie sich schämen«, blaffte sie. »Akten in völligem Durcheinander, unvollständige Einsatzberichte, keine ordnungsgemäßen Protokolle, die alljährlich verlangten Gesundheits- und Fitnessnachweise unausgefüllt, ganz zu schweigen von den fälligen Gutachten über Ihre untergebenen Kollegen in Les Eyzies und Montignac.«
»Mademoiselle Cantagnac, ich muss jetzt zu einer Unterredung mit dem Bürgermeister; sie wird ungefähr eine Stunde dauern. Wenn ich zurückkomme, möchte ich Sie in diesem Büro nicht mehr antreffen. Und sorgen Sie bitte dafür, dass Schreibtisch und Sessel wieder an ihrem Platz sind. Außerdem wäre ich Ihnen dankbar für einen Rechenschaftsbericht über Ihre bislang geleistete Arbeit hier im Haus.«
Fast hätte er hinzugefügt, dass, wenn sie seinen Aufforderungen nicht nachkäme, ihr ein Verfahren drohe wegen Behinderung eines Vorgesetzten bei der Ausübung seiner Dienstpflichten, doch schwere Geschütze wollte er sich für spätere Gelegenheiten vorbehalten. Und die würde es aller Wahrscheinlichkeit nach geben.
»Sie sind noch krankgeschrieben«, erwiderte sie. »Solange Sie nicht offiziell wieder dienstfähig sind, haben Sie hier gar nichts zu sagen. Und wenn Sie es zum Äußersten treiben, seien Sie gewarnt: Ich habe einen schwarzen Gürtel im Büro-Judo und bin, nebenbei bemerkt, Delegierte unseres départements für die Fédération Interco, der Sie, wie ich inzwischen weiß, als Mitglied angehören. Au’voir, monsieur le chef de police.«
Bruno gab sich alle Mühe, einen möglichst würdevollen Abgang zu markieren, den er zudem, wie er sich einredete, nur fürs Erste zu vollziehen hatte, und trat in den Flur hinaus. Die Tür ließ er geöffnet für die Frau, die im Nationalrat von Interco saß, der Gewerkschaft des öffentlichen Dienstes, der die Mehrheit der französischen Beamtinnen und Beamten angehörte. Sie könnte, wenn sie zum Streik aufriefe, womöglich den ganzen Verwaltungsapparat des département lahmlegen und ihm dann wohl obendrein Sexismus vorwerfen. Bruno fragte sich, wie sie es angestellt hatte, nach Saint-Denis versetzt zu werden, während er im Krankenhaus lag und sich nicht wehren konnte. Nun, das würde er noch herauskriege.
Als er sich in Bewegung setzte, hörte Bruno vertraute, aber sehr ungewöhnliche Laute: die eines Hundes, der fast wie eine Katze schnurrte. Es war ein zufriedenes Kollern tief aus der Kehle seines Bassets, das Balzac nur von sich gab, wenn er glücklich und zufrieden war. Bruno drehte sich um und sah, wie sein treuer Hund mit der Feindin fraternisierte. Auf den Hinterläufen stehend, hatte Balzac seine Pfoten auf ihren Schoß gelegt, während sie ihm die Lieblingsstelle gleich hinter den Ohren kraulte.
Nun, dachte Bruno. Wenn Balzac sie mag, kann sie nicht ganz so übel sein. Den Instinkten seines Hundes vertraute er uneingeschränkt.
»Die erste Begegnung mit unserer neuen Streitaxt haben Sie überlebt, wie ich sehe«, kommentierte Bürgermeister Mangin, als Bruno auf dem Stuhl vor dessen riesigem Schreibtisch Platz nahm, von dem es hieß, dass er älter war als die ganze Mairie. »Nehmen Sie sich vor ihr in Acht, Bruno. Sie ist eine sehr beeindruckende Frau, voll und ganz dem öffentlichen Dienst verschrieben und beängstigend effizient. In ihrer Freizeit hat sie sogar ein Jurastudium absolviert.«
»Überlebt habe ich die Begegnung vielleicht nur, weil ich mich verletzungshalber zurückgezogen habe«, erwiderte Bruno. »Zuerst sagt sie, dass Hunde in Ämtern nichts zu suchen haben, und dann entlockt sie Balzac Wonnelaute. Sie scheint in meinem Büro das Kommando übernommen zu haben, hat die Möbel verrückt und mich wegen angeblich inadäquater Ablage gemaßregelt.«
»Wissen Sie schon, dass sie die Mutter Oberin von Interco ist?«, fragte Mangin und hob beide Hände, die Handflächen nach vorn, um Hilflosigkeit in dieser Sache zu signalisieren. Was ungewöhnlich war. Er war ein abgebrühter Politiker, hatte Jacques Chirac zugearbeitet, als dieser Bürgermeister von Paris war, auch später noch während dessen Amtszeit als Premierminister, und hatte daraufhin selbst im Senat gesessen. Danach hatte Mangin seine bürokratischen Fähigkeiten in Brüssel beweisen können. Als einer der drei oder vier erfahrensten und mächtigsten Funktionäre im département schwenkte er sehr selten die weiße Fahne.
»In welcher Stellung hat sie zuletzt gearbeitet?«, wollte Bruno wissen.
»Als Gleichstellungs- und Diversitätsbeauftragte von Nouvelle-Aquitaine, zuständig für die Bekämpfung von Sexismus, Rassismus und allen anderen Ismen«, antwortete der Bürgermeister. »Ihr letzter Bericht fand großen Beifall. Damit war ihr Job anscheinend erledigt; ihre Arbeitsgruppe wurde unter dankbarem Applaus aufgelöst und sie für andere Aufgaben freigestellt. Ihnen ist sie jetzt als verwaltungstechnische Assistentin zugeteilt, mit der Aufgabe sicherzustellen, dass das Experiment der Modernisierung munizipaler Polizeiarbeit ordentlich gemanagt und im Sinn der neuesten Grundsätze des öffentlichen Dienstes umgesetzt wird. Bedanken Sie sich bei Ihrer Freundin Amélie im Pariser Justizministerium; sie hat sich dieses Pilotprojekt ausgedacht und es in die Wege geleitet.«
»Es wundert mich, dass Mademoiselle Cantagnac mit all ihren Fähigkeiten nicht auch gleich Ihr Büro bekommen hat, sondern nur meins«, sagte Bruno.
»Ich habe vor, sie in die Gendarmerie zu versetzen, sobald das neue Gebäude am Bahnhof fertiggestellt ist. Es ist doppelt so groß wie das alte und bietet entsprechend viel Platz. Meine Begründung dafür wird sein, dass mit dieser Besetzung die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Polizeidiensten verbessert werden soll. Das wird wohl auch Kommandantin Yveline überzeugen. Wenn alles gut läuft, haben Sie Ihr Büro in einem halben Jahr wieder zurück.«
»Und in der Zwischenzeit?«
»Sie sind doch ohnehin nur selten im Büro«, sagte Mangin. »Sie gehen Streife auf dem Markt – oder sollte ich sagen, dass Sie mit Balzac Gassi gehen? –, bringen den Kindern Tennis und Rugby bei, lassen sich regelmäßig in den anderen Kommunen am Fluss blicken, feiern mit den Jägern diverser Vereine, knüpfen Beziehungen und bauen Vertrauen auf. Sie sagen schließlich selbst zu Recht, dass die Prävention von Kriminalität besser ist als deren Bekämpfung.«
»Ich bin also jetzt, was meine Arbeit betrifft, mehr oder weniger heimatlos. Wie wär’s, wenn ich mich hier bei Ihnen einniste?«, fragte Bruno. Er lehnte sich zurück und deutete mit einer Handbewegung in den großen Raum mit seiner hohen Decke, den Wänden voller Bücherregale und dem Ausblick über den Fluss. »Nicht dass uns Mademoiselle Cantagnac zuvorkommt und auf die Idee verfällt, Sie zu verdrängen und hier einzuziehen.«
»Netter Versuch, Bruno. Überlassen Sie die Sache mir. Ich werde mir was einfallen lassen und eine Lösung parat haben, wenn Sie Ihren Dienst wieder antreten, was, wie ich von unserer Streitaxt weiß, in knapp zwei Wochen der Fall sein wird. Zuerst müssen Sie wieder voll auf der Höhe sein. Und jetzt zu einem anderen Thema: Was wissen Sie über aufgelassene Gräber?«
»Nicht viel. Haben wir uns darum zu kümmern? Wenn ja, könnten Sie ja unserer Syndikusanwältin Mademoiselle Cantagnac was zu tun geben. Oder geht es um ein Problem der Kirche?«
»Das müssten wir erst einmal klären. Sie kennen doch das alte leerstehende Hotel, die Domaine de la Barde, an der Straße nach Périgueux gleich außerhalb der Stadt, oder? Ein hübsches Gebäude aus dem 18. Jahrhundert, im palladianischen Stil errichtet, aber inzwischen ziemlich heruntergekommen. Der Eigentümer war schon pleite, bevor Sie zu uns gekommen sind, vor ungefähr fünfzehn Jahren oder mehr. Es gab eine Menge Gläubiger, vor allem uns, die Stadt, wegen unbezahlter Grundsteuern. Ich habe damals mit dem Gedanken gespielt, das Anwesen zu kaufen und in ein Kulturforum umzuwidmen oder in ein neues Zentrum für Computerschulung. Seit Neuestem gibt es tatsächlich einen Kaufinteressenten, nur stellt sich jetzt das Problem mit dem aufgelassenen Grab. Fühlen Sie sich fit genug für einen Spaziergang? Es ist nicht weit.«
»Ein Spaziergang würde mir guttun, mir und Balzac. Wer ist der Interessent?«
»Ein Engländer namens Birch, Ende dreißig, verheiratet und mit einem Kind. Er hat eine ganz ansprechende Idee. Nach seinen Vorstellungen sollen die Außengebäude in gîtes verwandelt werden, das Château selbst zu einer Bed-and-Breakfast-Pension; außerdem will er darin eine Kochschule einrichten, die in der Nebensaison genutzt werden könnte. Allem Anschein nach war er selbst mal Küchenchef. Er hat zuvor in ein anderes altes Haus investiert, in der Nähe von Sarlat, hat es renoviert und mit beträchtlichem Gewinn weiterverkauft. Übrigens gibt es noch einen anderen interessanten Aspekt. Davon berichte ich Ihnen unterwegs.«
2
Sie machten sich auf den Weg, gingen um die Marktstände herum, die die Rue de Paris säumten, und folgten der schmaleren Rue Gambetta bis zum alten Exerzierplatz bei der Gendarmerie. Derweil erklärte der Bürgermeister, dass eine britische Fernsehgesellschaft in das Projekt involviert sei. Sie produzierte eine TV-Show mit dem Namen Do-it-Yourself-Château, die seit einiger Zeit im Nachmittagsprogramm ausgestrahlt wurde, sehr erfolgreich war und inzwischen an andere Sender auf der ganzen Welt verkauft werden konnte. Die Serie begleitete fünf oder sechs britische Familien, von denen jede auf eigene Faust ein Château in Frankreich restaurierte, unter zum Teil großen Schwierigkeiten, aber für gewöhnlich mit dem Happy End, eine alte Ruine in ein Hotel oder ein prächtiges Familienanwesen verwandelt zu haben. Solche Ruinen in Veranstaltungsorte für Hochzeiten umzubauen sei offenbar besonders beliebt, führte Mangin aus, denn dann endete eine Episode mit einem attraktiven Paar, das den Bund fürs Leben schließt.
»Trauungen machen sich im Fernsehen immer gut. Für gewöhnlich ist mindestens eine Krise im Spiel und jede Menge telegene Szenen«, sagte der Bürgermeister und versprach Bruno, ihm bei nächster Gelegenheit die Fernsehaufzeichnung der letzten Renovierungsarbeiten von Monsieur Birch zu zeigen.
Ein paar Hundert Meter hinter der alten Gendarmerie gelangten sie an einen Streifen aus wild wucherndem Gesträuch und vereinzelten Bäumen auf der linken Seite. Mangin blieb stehen.
»Schauen Sie, da vorn«, sagte er. »Sehen Sie das große Viereck dort? Das ist der alte Tennisplatz. Monsieur Birch hat ihn freigelegt, geprüft, ob er noch zu benutzen ist, und ihn mit geringem Aufwand wiederhergestellt.«
Nach weiteren fünfzig Metern erreichten sie ein zweiflügeliges, verrostetes Eisentor, an dem noch Reste einer verblichenen blauen Lackierung zu erkennen waren. Es kreischte in den Angeln, als sie es aufstießen, um einer schmalen Auffahrt zu folgen, die von Bäumen überschattet wurde. Zur Linken stand ein massives, aber baufälliges Gebäude, das vielleicht einmal als Stall gedient haben mochte. Darauf ließ das breite, auch von Kutschen passierbare Doppeltor und die Gaube darüber schließen, hinter der sich vermutlich ein Heuspeicher verbarg. Dort sollten vier abgeschlossene gîtes entstehen, erklärte der Bürgermeister. Halb rechts dahinter erhob sich das Château, ein ansehnliches Gebäude, obwohl die Fensterläden und etliche Dachpfannen fehlten und aus allen Ritzen Efeu wucherte. Es hatte einen imposanten Eingang in der Mitte der Längsseite, zwei Stockwerke mit jeweils sechs hohen Fenstern und weiteren kleineren Fenstern in der Dachschräge, über der sich hohe Schornsteine türmten.
»Da ist noch viel zu tun«, sagte Bruno, als Balzac den verwilderten Garten erkundete und sein Bein an einem Apfelbaum hob, der schon viele Jahre nicht mehr beschnitten worden war. »Wie viel Land gehört dazu?«
»Über vier Hektar. Das Grundstück reicht über den Tennisplatz hinaus und fast bis zum Denkmal der Résistance an der Straße nach Saint-Avit.« Bruno schaute sich um und richtete den Blick auf die Reste dessen, was einmal ein französischer Garten gewesen sein mochte, betrachtete die Baumreihen, die überwucherten Kiespfade und einen halb zerfallenen Springbrunnen.
»Dort drüben gab es früher ein Restaurant, und da hinten hinter dem flachen Gebäude ist der Swimmingpool. Auch der muss natürlich saniert werden«, fuhr Mangin fort. »Hinter den Bäumen dort befindet sich eine alte Schmiede, aus der Monsieur Birch eine weitere gîte machen will. Michel hat sich auf meine Bitte hin die ganze Anlage hier einmal gründlich angesehen und gesagt, dass die Substanz der meisten Gebäude einschließlich der Dachgebälke in Ordnung ist. Viel Arbeit muss vor allem in die Sanitär- und Elektroinstallation gesteckt werden. Und dann haben die Dachdecker noch einiges zu tun, schließlich sind auch Vorschriften der Wärmedämmung einzuhalten. Aber wie gesagt, die Substanz an sich ist in gutem Zustand. An dem anderen alten Château hat Monsieur Birch ja schon gute Arbeit geleistet, deshalb sollte er auch hier zurechtkommen. Unsere Stadt hätte ein Schmuckstück mehr.«
»Was ist mit dem Gebäude hinter dem Château?«, fragte Bruno.
»Es war eine Getreidemühle, angetrieben vom Wasser des Bachlaufs. Aber dann wurde sie umgebaut in ein Wohnhaus mit Atelier, das vor Kurzem von einem Künstlerpaar aus Limeuil gekauft worden ist. Sie kennen die beiden – Romain und Madeleine. Früher war die Mühle über einen großen Torbogen mit der Domaine verbunden, aber der ehemalige Eigentümer hat sie mit einem kleinen Stück Land verkauft, als ihm das Geld ausging.«
»Und was hat es nun mit dem Grab auf sich? Wo liegt es?«
»Ich weiß nur, dass in dem Grundbucheintrag davon die Rede ist, von einem kleinen, zwei mal drei Meter großen Flurstück, das sich zwar auf dem Gelände befindet, nicht aber zum Grundstück gehört. Es wäre mehr als schade, wenn an diesem Fleckchen das schöne Projekt scheitern würde.«
»Wenn es im Grundbuch aufgeführt wird, müsste es doch exakt zu lokalisieren sein. Was sagt der notaire dazu?«, fragte Bruno. »War es vielleicht unser Brosseil, der den Eintrag aufgesetzt hat?«
»Brosseils Großvater war dafür verantwortlich und hat das Grab vor ungefähr sechzig Jahren eingetragen. Michel hat die Stelle zu finden versucht, aber die ganze Umgebung ist von Bäumen zugewachsen. Man müsste großflächig roden, um festzustellen, wo genau das Grab ist und ob es überhaupt belegt ist, oder wie sagt man?«
»Das Sterberegister unseres Stadtarchivs müsste doch Aufschluss darüber geben. Ich schätze, Pater Sentout haben Sie schon auf die kirchlichen Aufzeichnungen angesprochen, nicht wahr? Wenn ich mich recht erinnere, konnten früher Familien verstorbene Angehörige auf eigenem Grund und Boden bestatten.«
»Theoretisch ist das immer noch möglich, aber unter so strengen Auflagen, insbesondere seitens der Wasserbehörde, dass es dazu kaum noch kommt. Aber wie schon gesagt, möchte ich Sie, Bruno, bitten, sich näher mit dieser Sache zu befassen. Von Pater Sentout habe ich immerhin schon erfahren, dass er keine Urkunde über ein solches Grab hat. Er sagt, dass ein Grab nach dreißig Jahren aufgelassen werden kann, wenn Angehörige kein Interesse mehr daran anmelden. Es wird dann ausgeräumt und das, was von dem Toten noch übrig ist, an anderer Stelle beigesetzt beziehungsweise eingeäschert, unter Wahrung geltender Vorschriften, versteht sich. Dazu erscheint eine förmliche Anzeige im Amtsblatt, damit Anwälte oder notaires die Möglichkeit haben, Kontakt zu Angehörigen aufzunehmen, falls von deren Seite Beschwerde eingelegt werden sollte.«
»Nun, ich könnte Brosseil aufsuchen und hören, was von ihm zu erfahren ist. Haben Sie eine Adresse, unter der ich diesen Monsieur Birch erreiche?«
»Ja, er hat ein Haus in Audrix gemietet, um seinen Jungen an der hiesigen Schule anmelden zu können. Er scheint ein anständiger Kerl zu sein und spricht ganz gut Französisch. Sagte mir, dass er es in den Alpen während der Skisaison gelernt hat. Dort war er Küchenchef in mehreren Luxushotels.«
»Daher auch die Idee mit der Kochschule«, sagte Bruno.
»Allerdings. Birch weiß schon, was er tut. Er meint, es hätte keinen Sinn, das Château ausschließlich als Hotel zu nutzen, das nur vier Monate im Jahr nachgefragt wird. Darum will er mit seiner Familie in einem der Flügel wohnen und die anderen fünf oder sechs Räume als Gästezimmer vermieten. Also braucht er auch nicht das ganze Jahr über Personal anzustellen. Dann wären da noch die vier gîtes, die Geld einbringen, und eine fünfte, wenn die alte Schmiede umgebaut ist. Ich glaube, er wird Ihnen gefallen, schon wegen seiner Kochkünste und weil er früher Rugby gespielt hat. Außerdem scheint er fest entschlossen, den Tennisplatz wieder in Ordnung zu bringen.«
»Was bedeutet das, die Pleite des Vorbesitzers, und gibt es noch Gläubiger mit Ansprüchen?«, wollte Bruno wissen.
»Ich habe mit dem Richter gesprochen. Unsere ausstehende Grundsteuer hat Vorrang vor allen anderen Ansprüchen, und wenn wir unsere Forderungen aussetzen, ist Birch bereit, die anderen Gläubiger mit einem Drittel ihrer Forderungen zu entschädigen. Die haben die nicht einziehbaren Außenstände schon vor über zehn Jahren abgeschrieben und werden sich über den unerwarteten Geldregen freuen. Der Richter hat sich damit schon einverstanden erklärt. Wir können uns auf Einnahmen von jährlich sechstausend Euro Grundsteuer freuen sowie auf zwei Vollzeitstellen und drei oder vier Teilzeitjobs pro Saison. Außerdem wird für unsere Handwerker etwa ein Jahr lang jede Menge zu tun sein. Für Saint-Denis ist Birch ein weiterer Aktivposten und keine Belastung.«
»Warum wollen Sie die Forderungen der Stadt, wie Sie sagten, bloß aussetzen, anstatt ganz darauf zu verzichten?«, fragte Bruno.
»Es könnte schließlich sein, dass Birch das Anwesen wieder verkauft, und dann wollen wir die unbezahlten Steuern haben. Birch rechnet mit guten Geschäften, und er geht davon aus, dass ohnehin ein Teil davon durch die Inflation geschluckt wird. Damit würde jede Seite gewinnen, Bruno. Vorausgesetzt, Sie können das Problem mit dem Grab lösen. Womöglich ist es ja ohnehin leer. Kommen Sie, ich setze Sie bei Ivan zum Mittagessen ab, wo Sie Freunde treffen werden.«
3
Die besagten Freunde – Horst und Clothilde – erwarteten ihn schon im Restaurant. Beide waren renommierte Archäologen und arbeiteten für das prähistorische Museum in Les Eyzies. Bei ihnen war eine fremde Frau, etwa Mitte dreißig. Sie trug Jeans, ein khakifarbenes Hemd im Militärlook und darüber eine Fleecejacke. Sie hatte die dunklen Haare zu einem festen Knoten am Hinterkopf zusammengefasst. Ihre Miene war ernst, fast feierlich, und ihr Gesicht ohne erkennbares Make-up. Die Augen leuchteten blau, und sie hatte ein nettes, etwas vorsichtiges Lächeln, das so wirkte, als wäre sie nervös oder vielleicht von Natur aus schüchtern.
Bevor sie miteinander bekannt gemacht werden konnten, eilte Clothilde, ein kleines, rothaariges Energiebündel, auf Bruno zu, umarmte ihn und gab ihm einen Kuss auf beide Wangen.
»Wir haben uns große Sorgen um dich gemacht«, sagte sie. »Aber der Bürgermeister konnte uns beruhigen und hat uns versichert, dass du dich wieder voll und ganz erholst. Die Geschichte von den kriminellen Russen, die bei der Straßensperre auf dich geschossen haben, glaubt niemand, vor allem, weil die halbe französische Armee blitzschnell zur Stelle war, um dich zu retten. Du kannst dir vorstellen, wie wild hier bei uns die Spekulationen ins Kraut geschossen sind.«
»Das tun sie doch immer«, erwiderte Bruno. »Und ja, ich bin wieder fast wie neu.« Er schüttelte Horst die Hand, einem freundlichen deutschen Professor mit weißem Bart. Nach einer langjährigen Romanze mit vielen Unterbrechungen hatten er und Clothilde in der Mairie von Saint-Denis endlich geheiratet. Sie waren einander lange Zeit hinterhergelaufen, von Felsmalereien in Australien bis zu Königsgräbern in Ägypten, von Funden prähistorischer Knochen in Südafrika bis zu Ausgrabungsstätten der Skythen in der Ukraine. Bruno war ihr Trauzeuge. Clothilde scherzte immer noch, dass sie Horst nur geheiratet habe, weil er in seinem Haus ein Badezimmer mit angeblich sagenhaften Brausen installiert habe, die von oben und allen Seiten heißes Wasser spritzten, dazu eine Sauna und einen Whirlpool. Bruno war schon mehrmals eingeladen worden, Gebrauch davon zu machen, hatte das Badezimmer aber noch nie mit eigenen Augen gesehen.
»Das ist Abigail Howard«, sagte Clothilde, »unter Freunden kurz Abby. Eine ehemalige Studentin von mir. Sie kommt aus den USA und wohnt bei uns. Weil sie länger bleiben will, ist sie zurzeit auf der Suche nach einer geeigneten Mietwohnung. Sie spielt mit dem Gedanken, spezielle Führungen für amerikanische Besucher anzubieten, und würde gern wissen, was du davon hältst.«
Als Bruno ihr die Hand gab, spürte er Schwielen, die ihn vermuten ließen, dass sie sehr aktiv Tennis spielte. Sie ging in die Hocke, um Balzac zu begrüßen, und erklärte leise in ausgezeichnetem Französisch, dass sie mit Basset-Hunden aufgewachsen war. Balzac war ihr auf Anhieb zugetan. Da kam Ivan aus der Küche, die Arme weit ausgebreitet, um Bruno an sich zu drücken, hielt sich aber dann zurück und fragte, ob die Schulter auch wirklich verheilt sei.
»So gut wie«, antwortete Bruno und umarmte mit seinem gesunden Arm den Koch, dem das Restaurant auch gehörte. »Und wer ist die neue Freundin in der Küche, von deren Kochkünsten alle Freunde schwärmen?«
»Marta aus Krakau«, antwortete Ivan. »Ihre Piroggen sind große Klasse, aber du musst erst mal ihre zurek probieren, ein weißer Borschtsch aus Sauerteig, Knollensellerie und hart gekochten Eiern. Außerdem macht sie den leckersten Apfel-Käsekuchen mit Rum, darauf stehe ich besonders. Kann ich euch wärmstens zum Nachtisch empfehlen.«
»Wo hast du sie kennengelernt?«, fragte Bruno und grinste. Wie er wusste, brachte Ivan fast regelmäßig aus seinen jährlichen Urlauben eine Frau aus dem Ausland mit nach Hause, die seine Küche mit Spezialitäten ihrer Heimat bereicherte, und das war bislang unter den Gästen sehr gut angekommen.
»Ich war dieses Jahr noch nicht im Urlaub und muss wohl auch nicht weg, jetzt, da sie hier ist«, entgegnete Ivan und warf einen liebevollen Blick in Richtung Küche. »Sie hat von jemandem in Bergerac gehört, dass bei mir vielleicht ein Job zu haben ist, und ist von sich aus gekommen. Sie war Kellnerin in einem Laden, dessen Besitzer sie immer wieder in die Speisekammer zu locken versucht hat, bis dessen Frau ihr riet, bei uns ihr Glück zu versuchen. Ich bin froh darüber, und das wirst du ebenfalls sein.«
Als sie am Tisch Platz nahmen, fragte Bruno Abby, ob sie Tennis spielte. Horst kam ihr mit der Antwort zuvor: »Sie wird dich vom Platz fegen, Bruno. Sie war Mitglied des Teams, das die US-College-Meisterschaften gewonnen hat.«
»Wirklich?« Bruno war beeindruckt. »Ich bin in unserem Klub hier an der Leitung einer Tennisschule für Kinder beteiligt. Vielleicht besuchen Sie uns demnächst einmal und unterstützen uns beim Training.«
Ihre Reaktion irritierte ihn. Mit offenem Mund und aufgerissenen Augen schaute Abby über seine Schulter hinweg. Er drehte sich um, um zu sehen, auf wen oder was sie ihren Blick gerichtet hatte, und sah sich einer Walküre gegenüber.
Bruno war kein Zwerg. In seinem Truppenausweis war seine Größe mit einem Meter fünfundachtzig angegeben. Die Frau aber, die in der Küchentür aufgetaucht war, schien mindestens fünfzehn Zentimeter größer zu sein und hatte entsprechend breite Schultern. Ein Wust von krausen blonden Haaren türmte sich über einem breiten weißen Stirnband. Sie grüßte alle und legte einen kräftigen Arm um Ivans Schulter, der ihr kaum bis zum Kinn reichte und schwärmerisch zu ihr emporschaute.
»Willkommen alle miteinander«, grüßte sie mit einem ungewöhnlichen Akzent, der gleichzeitig Kehl- und Fließlaute hervorzubringen schien. »Ich bin Marta und koche heute. Zuerst gibt’s eine zurek, dann haben Sie die Wahl zwischen einem Hähnchenschnitzel und einer frischen Forelle mit Kümmel, und zum Nachtisch folgt ein Stück von meinem Spezialkuchen. Wer von Ihnen ist der Polizist?«
»Ich, aber noch beurlaubt«, antwortete Bruno und reichte ihr die Hand zum Gruß. Sie schlug ein, riss ihn an sich und gab ihm einen Kuss auf beide Wangen. »Ich weiß von Ivan, dass Sie in der Küche für ihn eingesprungen sind, als er krank war, und Pater Sentout meint, Sie hätten eine gute Seele – für einen Heiden.«
»Und er ist ein echter Rugbyexperte – für einen Priester«, erwiderte Bruno. »Haben Sie jemals Rugby gespielt? Wir haben hier ein gutes Frauenteam.« Als Nummer acht würde Marta mit ihrem Gewicht und ihrer Kraft im Gedränge eine Mauer bilden, und ihre Größe wäre in einer Gasse eine gewaltige Bereicherung.
»Nein, aber ein bisschen Sport täte mir gut«, antwortete Marta. »Ich könnte ja mal vorbeischauen, den Frauen beim Training zusehen und selbst ein paar Runden laufen.«
»Morgen Nachmittag gegen fünf«, sagte Bruno. »Wenn Ivan auf Sie verzichten kann.«
»Abgemacht. Ich weiß, wo Ihr Klub trainiert, komme auf meiner Joggingrunde immer daran vorbei. Ich müsste aber um kurz nach sechs wieder hier sein und Ivan helfen. Jetzt muss ich zurück in die Küche.«
»Glaub mir, ihre Kochkünste passen zu ihrer Persönlichkeit. Wir können uns auf ein Festessen freuen«, versprach Clothilde, als sie wieder Platz nahmen. »Zurück zum Thema. Abby würde gern wissen, welche Regeln für Touristenführerinnen gelten und ob sie womöglich einen brevet braucht, da in Frankreich ja für alle möglichen Jobs formelle Qualifikationen verlangt werden. Sie möchte schon im Vorfeld eine spezielle Tour planen, die für amerikanische Touristen von besonderem Interesse sein könnte.«
Bruno erklärte, dass für eine Fremdenführerlizenz vom Tourismusverband, die zur Begleitung von Besucherinnen und Besuchern in Museen und zu besonderen Sehenswürdigkeiten berechtigte, spezielle Fähigkeiten und eine geeignete Ausbildung verlangt wurden. Der brevet werde nach einem zweijährigen Vorbereitungskurs mit abschließender Prüfung ausgestellt. Für private Führungen allerdings, insbesondere solche mit einem Spezialbereich wie den amerikanischen Verbindungen zum Périgord, seien die Voraussetzungen weniger streng. Die Empfehlung einer Person wie Clothilde, der Kuratorin eines Nationalmuseums, reiche wohl schon aus.
»Abby hat Archäologie studiert und an der Universität von Virginia promoviert«, sagte Clothilde. »Horst und ich schreiben gern eine Empfehlung an die Präfektur und den Tourismusverband und werden darin ihre außerordentlichen Qualifikationen als Führerin durch unsere regionalen archäologischen Fundstätten unterstreichen. Wenn es hilft, ernennen wir sie auch zur Gastkuratorin des Museums und vertrauen ihr einen Lehrauftrag für Vorlesungen an, die sie sowohl auf Englisch als auch auf Französisch halten könnte.«
Bruno ahnte, dass Clothilde nichts unversucht lassen würde, um Abby zu helfen. Es schien mehr dahinterzustecken als nur kollegiales Interesse. Horst und Clothilde waren alte Freunde, natürlich würde er sie darin unterstützen.
»Sie zur Gastkuratorin des Museums zu machen, ist wohl mehr als ausreichend«, meinte Bruno und wandte sich an Abby. »Wenn Sie mit den Einkünften als Fremdenführerin Ihren Lebensunterhalt bestreiten wollen, müssten Sie sich als Kleinunternehmerin eintragen lassen und der Sozialversicherung einen kleinen Beitrag überweisen. Außerdem brauchen Sie eine carte de séjour, eine Aufenthaltsgenehmigung.«
»Das wird kein Problem sein«, erwiderte sie geradeheraus. »Ich hatte eine irische Großmutter, kann also die irische Staatsbürgerschaft beantragen, die mich zur Europäerin macht, und als solche habe ich überall in Europa das Recht, zu wohnen und zu arbeiten.«
»Wollen Sie denn auf Dauer in Frankreich leben?«, fragte Bruno.
»Erst einmal nur während meines Sabbaticals, das mich von meinem Job als Lehrerin in den Staaten freistellt. Diese Zeit nehme ich mir, um zu sehen, ob es sich für mich lohnt hierzubleiben oder nicht. Momentan wohne ich noch bei Clothilde und Horst, würde aber gern möglichst bald in eine kleine Mietwohnung ziehen«, sagte sie. »Irgendwo in oder in der Nähe von Saint-Denis.«
»Wir könnten bei der Wohnungssuche helfen«, sagte Bruno. »Zwei meiner Freunde vermieten gîtes auf ihrem Grundstück, und wenn ich mich nicht irre, wird eine in den nächsten Tagen frei. Es ist ein kleines, komfortables Haus mit eigenem Garten und Zugang zum Swimmingpool und Tennisplatz. Fabiola – die Eigentümerin – will fünfhundert Euro im Monat dafür, Nebenkosten inbegriffen. Im Wohnzimmer befindet sich ein großer Kaminofen, mit dem Sie heizen können.«
»Klingt perfekt«, sagte Abby. »Ich wäre Ihnen sehr dankbar. Nebenbei bemerkt, mir scheint, Sie wollen mich als Tenniscoach verpflichten und Marta für das Rugby-Team gewinnen. Auf mich machen Sie weniger den Eindruck eines Polizisten als den des hiesigen Sportmanagers.«
»Das ist nur mein Hobby«, entgegnete Bruno und beeilte sich, das Thema zu wechseln. »Clothilde bürgt für Ihre Qualitäten als Archäologin, aber bislang hat noch niemand versucht, im Périgord spezielle Reiseziele für amerikanische Touristen ins Visier zu nehmen. Welche könnten das sein?«
»Wo soll ich anfangen? Vielleicht mit Thomas Jefferson und seiner Bewunderung für Erzbischof Fénelon. Ich würde meine Gäste also zum Château führen, in dem Fénelon zur Welt gekommen ist, und nach Rouffillac, wo er lebte. Dann wäre da das Château bei La Bachellerie bei Terrasson, dessen Pläne, wie vermutet wird, Jefferson für den Entwurf des Weißen Hauses in Washington kopiert hat. Und ich denke an T.S. Eliot, der mit seinem Dichterkollegen Ezra Pound durch das Périgord wanderte und in dieser Zeit Das wüste Land zu schreiben begonnen hat. Viele, ich eingeschlossen, halten dieses Gedicht für das größte des 20. Jahrhunderts«, sagte sie mit Pathos und schien sich warmzulaufen in ihrem Thema.
»Pound seinerseits«, fuhr sie fort, »hat die Troubadoure des Périgord gewissermaßen adoptiert, die Gesänge des Bertran de Born ins Englische übersetzt und sogar eigene Gedichte in der alten okzitanischen Sprache verfasst. Weil Eliot auch das Versdrama Mord im Dom geschrieben hat, würde ich meine Gäste zur Chapelle Saint-Martin bei Limeuil führen. Sie war eine der drei Kirchen, die Heinrich II. auf Befehl des Papstes zur Sühne für den Mord an Thomas Becket erbauen ließ, zwei in England, eine in Frankreich. Ich liebe die mittelalterlichen Fresken in dieser Kapelle, nicht nur die großen im Altarraum, sondern auch die kleinen. Ihre Farben verblassen, aber sie sind so wunderschön.«
Bruno lächelte und nickte bestätigend. »Sie können Ihren Gästen erzählen, dass sie laut Experten zwei alttestamentarische Propheten darstellen. Wir aber, die Hiesigen, glauben, dass das Fresko in der Seitenkapelle, das zwei Männer mit einer Flasche zeigt, Becket und König Heinrich in glücklicherer Zeit darstellt, als sie noch eng befreundet und Saufkumpane waren.«
»Darauf werde ich hinweisen«, sagte sie und lächelte ihn zum ersten Mal freundlich an. Bruno kam sich vor wie ein Schuljunge, der von seiner Lehrerin gelobt wurde.
»Ich würde auch gern von den amerikanischen Fallschirmspringern berichten, die im August 1944 in der Nähe von Cadouin abgesetzt worden sind, um die Résistance zu unterstützen. Die Deutschen hatten sich zu diesem Zeitpunkt größtenteils zurückgezogen, aber immerhin fanden die amerikanischen Soldaten Gelegenheit, sich der Befreiungsparade in Périgueux anzuschließen. Und dann soll auch von den Lindberghs die Rede sein, der Familie des ersten Piloten, der den Atlantik überflogen hat. Sein Sohn heiratete Monique Watteau, eine Schriftstellerin aus dem Périgord, die vorher die Geliebte des Schauspielers Yul Brynner gewesen war. Eine wichtige Station wäre natürlich auch das Château des Milandes von Josephine Baker. Sie war ein Superstar des Jazzzeitalters und wurde von Martin Luther Kings Witwe nach dessen Ermordung gebeten, als seine Vertreterin die Bürgerrechtsbewegung anzuführen.«
»Was sie abgelehnt hat«, unterbrach Bruno, »und zwar mit der Begründung, dass sie sich um ihre Regenbogenfamilie kümmern müsse, um ihre Adoptivkinder unterschiedlichster Herkunft.«
Jetzt meldete sich auch Horst zu Wort. »Wir sind mit Abby zu dem Weingut Château de Fayolle gefahren, das du uns empfohlen hast, Bruno, und das von einem Amerikaner betrieben wird. Der rote Sang du Sanglier, von dem du schwärmst, ist wirklich vorzüglich. Abby denkt seither auch über einen Tagesausflug über die hiesigen Weingüter nach.«
»Sang du sanglier. Wildschweinblut«, murmelte Bruno lächelnd. »Wenn Sie mit Gästen dort vorbeikommen, sollten Sie auch den Fluss überqueren und das Anbaugebiet von Montravel besichtigen, insbesondere auch Montaignes Turm, wo Sie ihnen aus dem Essay vorlesen können, in dem er seine Begegnung mit amerikanischen Ureinwohnern beschreibt.«
»Gute Idee! Ich habe mir schon Gedanken darüber gemacht, wie ich den großen Montaigne in mein Programm einbauen könnte«, sagte Abby und lächelte ihn wieder an. »Eine wunderbare Überleitung, und von seinem Turm ist es ja auch nicht weit bis zum Château de Montréal, aus dem der Mann hervorging, der im 17. Jahrhundert den Sankt-Lorenz-Strom erkundet und dem Ort, aus dem Montreal entstand, den Namen seiner Familie gegeben hat.«
»Respekt«, bemerkte Bruno voller Anerkennung, als Ivan mit der Suppenterrine kam. Er war beeindruckt von ihren Recherchen und der Intelligenz, die aus ihrem Gesicht strahlte. Gleichwohl glaubte er eine Anspannung an ihr wahrnehmen zu können, wie bei einer Frau unter Druck. Bei all ihren Fähigkeiten konnte es sie doch nicht nervös machen, Dienste als Fremdenführerin anzubieten, dachte er. Vielleicht gab es eine Verbindung zwischen dem Périgord und ihrer Heimat, von der sie noch nichts wusste. Darauf würde er aber nur per Zufall stoßen können.
»Sie haben, wie es aussieht, Ihre Hausaufgaben gemacht, deshalb zögere ich, auf etwas zu sprechen zu kommen, das Ihnen vielleicht längst bekannt ist. Haben Sie schon einmal vom Duc de Lauzun gehört?«, fragte er.
Abby schüttelte den Kopf. »Nein, ist das ein Name aus dem Périgord?«
»Nicht ganz«, antwortete Bruno, während Clothilde die Suppe austeilte. »Lauzun liegt jenseits der Grenze im Département Lot-et-Garonne. Aber dieser Duc war auch Marquis von Biron, einer stattlichen mittelalterlichen Festung im Süden der Dordogne, nahe der Bastide Monpazier. Und dieser Marquis von Biron zählte gewissermaßen zu den Gründervätern Ihres Landes.«
»War er ein Entdecker?«, fragte sie. »Ich habe noch nie von ihm gehört.«
»Nein, er war zwar Aristokrat, aber trotzdem Soldat von Beruf und kommandierte eine Legion aus Freiwilligen, die an der Seite des Marquis de Lafayette für die Befreiung der Vereinigten Staaten kämpfte. 1781 nahm er mit George Washington und Lafayette an der Belagerung von Yorktown teil. Es kam zu der Schlacht, die die britische Armee unter General Cornwallis zur Kapitulation zwang und die amerikanische Unabhängigkeit besiegelte. Der Herzog hatte sich hervorgetan, weshalb er von Washington und Lafayette für die ehrenvolle Aufgabe auserkoren wurde, dem König in Paris die Nachricht von dem großen Sieg zu übermitteln.«
»Eine tolle Ergänzung meiner Liste«, freute sich Abby. »Wie um alles in der Welt sind Sie auf dieses besondere Stück Geschichte gestoßen?«
»Durch meinen Hund«, antwortete Bruno. »Balzac ist ein Abkömmling der alten königlichen Jagdmeute von Ludwig XIV., aus Cheverny. Vielleicht haben Sie davon gehört, dass der Marquis de Lafayette Bassets in Amerika eingeführt hat. Ein Zuchtpaar machte er George Washington zum Geschenk, der daraufhin weitere Exemplare importieren ließ und mit ihnen die sogenannte Stonewall-Jackson-Zucht ins Leben rief. Ihr entstammen Balzacs Vorfahren, das hat mich veranlasst, der Geschichte von Lafayette und seinem Abenteuer in Ihrem Unabhängigkeitskrieg nachzugehen. Dabei bin ich auf die Memoiren des Marquis von Biron gestoßen.«
»Eine tolle Geschichte«, sagte Clothilde. »War mir aber eigentlich immer schon klar, dass Balzac von Adel ist, und diese polnische Suppe ist so gut, dass sie für ihn gemacht zu sein scheint. Was meinst du, Bruno, ob er sich über ein kleines Schüsselchen freuen würde? Wenn Ivan nichts dagegen hat?«
»Im Gegenteil, auch er würde sich freuen«, antwortete Bruno grinsend. »Balzac bekommt immer etwas vorgesetzt, wenn wir hier sind. Ihm wird das Sauerteigige genauso gut schmecken wie mir. Eignet sich bestimmt prima für einen chabrol.«
Nach diesen Worten goss er in den Rest seiner Suppe ein halbes Glas von Ivans rotem Hauswein von der städtischen Kellerei, rührte mit dem Löffel um, hob dann die Schale mit beiden Händen an den Mund und schlürfte sie leer.
»Chabrol treibt Arzt und Apotheker davon«, intonierte er, worauf Horst und Clothilde es ihm gleichtaten.
Vorsichtig schüttete auch Abby etwas Wein in ihren Suppenrest, blickte zögernd in die erwartungsvolle Runde und trank.
»Interessant«, sagte sie und leckte sich die Lippen. »Schmeckt wirklich gut mit der ausgezeichneten Suppe. Ich bin mit der typisch amerikanischen Kost aus fadem Weißbrot, Zerealien zum Frühstück und industriell hergestellten Käsescheiben aufgewachsen und bin leicht zu begeistern für neue Geschmacksrichtungen.« Sie schenkte Bruno ein flüchtiges Grinsen, wandte sich dann an Clothilde und fragte: »Soll ich ihm unsere Geheimwaffe verraten?«
Clothilde nickte. »Bruno kennt sich gut genug mit Archäologie aus, um das Besondere daran zu schätzen.«
»Ich habe Clothilde bei Grabungen in Virginia kennengelernt, nah meiner Heimat, in einem Ort namens Cactus Hill«, erzählte Abby und lächelte ihrer Freundin zu. »Ich war damals noch in der Schule und hatte eine Lehrerin, die sich sehr für Archäologie interessierte. Sie nahm unsere Klasse mit zu der Ausgrabungsstätte, wo sie an den Wochenenden freiwillig mithalf. Die Ausgrabungen hatten begonnen, und schon die ersten Funde waren so bedeutsam für das Verständnis der amerikanischen Geschichte, dass in den Folgejahren große Anstrengungen unternommen wurden, um weitere Erkenntnisse zu gewinnen.«
Sie warf Clothilde einen warmherzigen Blick zu. »Ich werde nie vergessen, wie wir uns getroffen haben und welchen Eindruck du auf mich gemacht hast – gelehrt, einschüchternd und exotisch, alles auf einmal. Ich war damals zwölf, schon ziemlich in die Länge geschossen; wir waren ungefähr gleich groß. Aber du warst wie ein kleiner französischer Dynamo und hattest diesen sehr süßen Akzent. Du sagtest, die Geschichte der amerikanischen Ureinwohner würde hier gerade neu geschrieben. Das konnte ich kaum glauben, aber ich fing mir das Archäologie-Virus ein und kam mit meiner Lehrerin an den Wochenenden immer wieder. Meist war ich nur zuständig für Kaffee und Sandwiches, aber es gab eine Stelle, an der wir, die jungen Freiwilligen, selbst graben durften – unter Aufsicht von Clothilde.«
Abby legte eine Pause ein, als Ivan die Suppenschalen abräumte und den Hauptgang servierte, für alle gab es Fisch, bis auf Horst, der sich für das Hähnchenschnitzel entschieden hatte. Als sie zu essen anfingen, warf Abby Bruno einen Blick zu und fragte, was er über die frühen menschlichen Siedlungen in Amerika wusste. Bruno ließ sich gerade einen ersten Happen von der Forelle schmecken und fand, dass der Kümmel erstaunlich gut dazu passte. Er war offenbar vorher geröstet worden, und er versuchte herauszufinden, ob das Gewürz eher wie Fenchel oder wie Anis schmeckte. Bruno zeigte auf seinen Mund, um deutlich zu machen, dass er noch kaute. Dann schluckte er und spülte mit einem Schluck Wein nach, bevor er antwortete.
»Nicht viel, aber ich habe gelesen, dass alles während der letzten großen Eiszeit vor elf- oder zwölftausend Jahren anfing, als sich die Gletscher hier bei uns in Frankreich bis über das Loiretal hinausgeschoben hatten«, antwortete er. »Am Polarkreis gab es so viel Eis, dass Menschen die Beringstraße zwischen Sibirien und dem heutigen Alaska zu Fuß überqueren konnten. Während der folgenden Jahrtausende drangen sie bis nach Südamerika vor und machten unterwegs Jagd auf Mammuts und andere große Tiere.«
»Das entspricht der landläufigen Meinung«, entgegnete Abby. »Nun, wir haben bei Cactus Hill menschliche Artefakte entdeckt, Werkzeuge und dergleichen, die auf ein Alter von achtzehn- bis zwanzigtausend Jahren datiert werden konnten. Das war eine Überraschung, weil sich damit die bis dahin vermutete Dauer der menschlichen Besiedlung in Amerika fast verdoppelte. Und dann kam die zweite Überraschung: Manche dieser Werkzeuge sahen genau so aus wie diejenigen aus dem Solutréen in Europa, also ungefähr derselben Zeit. Diese Entdeckung legte die faszinierende Möglichkeit nahe, dass frühe Menschen aus Europa den Atlantik überquert haben könnten, zu Fuß über das Eis oder in Booten entlang der Schelfeisränder, und sich auf ihrer Reise aus dem Meer ernährt haben wie die Inuit.«
»Die Ureinwohner Amerikas könnten also aus Europa eingewandert sein?«, fragte Bruno verwundert. »Ich dachte, es gäbe den DNA-Nachweis, dass die amerikanischen Ureinwohner mit sibirischen Stämmen verwandt sind.«
»Ja, aber es steckt noch mehr dahinter«, erwiderte Abby, und es war ihr anzuhören, wie sehr sie dieses Thema fesselte. »Weitere DNA-Analysen lassen vermuten, dass die frühesten Amerikaner von Polynesien über den Pazifischen Ozean nach Chile und Ecuador eingewandert sind.«
Bruno lachte vor Begeisterung. »Was sind wir Menschen doch für eine außerordentliche Spezies! Wir lassen uns nicht aufhalten. Man zeige uns ein Meer, und irgendein furchtloser Kundschafter wird wissen wollen, wie es auf der anderen Seite aussieht. Aber wie wollen Sie das Ihren Touristen erklären? Werden Sie sie auch in Clothildes Museum führen?«
»Das läge auf der Hand, aber ich möchte ihnen auch einige der Ausgrabungsstätten zeigen, vielleicht angefangen mit La Madeleine, also mit den Ursprüngen des Magdalénien, der Kultur, die auf das Solutréen folgte. Neben dem berühmten Abri gibt es für Touristen an diesem Ort noch sehr viel mehr zu sehen, zum Beispiel die in den Fels gebaute Kirche oder das mittelalterliche Höhlendorf. Und dann wäre da noch das hier.« Abby griff in ihre Schultertasche und holte Repliken von Knochenschnitzereien aus dem Museum von Les Eyzies daraus hervor. »Das kennen Sie wahrscheinlich: dieser Wisent, der sich die Flanke leckt, und hier, die Hyäne auf der Pirsch. Das da sind Harpunen aus Knochen. Und jetzt schauen Sie sich das an.« Sie zeigte ihm Fotos von ganz ähnlichen Knochenschnitzereien und erklärte eins nach dem anderen: »Lakota Sioux, frühes 19. Jahrhundert; Ojibwa, die Darstellung eines Vielfraßes, frühes 20. Jahrhundert; und Harpunen der Inuit, aus dem 19. Jahrhundert und ebenfalls aus Knochen geschnitzt.«
»Verstehe«, sagte Bruno. »Aber kann es nicht sein, dass verschiedene Völker zu verschiedenen Zeiten solche Speere mit Widerhaken erfunden haben, um Fische zu fangen? Ich erinnere mich an eine von Clothildes Vorlesungen, in der davon die Rede war, dass Speerschleudern durchaus in unterschiedlichen Kulturen anzutreffen sind.«
»Richtig«, bestätigte Abby. »Beweise gibt es nicht, aber die Machart lässt auf kulturelle Beziehungen schließen, und das sollte reichen, um die Fantasie zu beflügeln.«
»Ihre Gäste werden bestimmt begeistert sein«, sagte Bruno. Er wandte sich an Horst und Clothilde. »Was ist mit euch beiden? Glaubt ihr, dass während der Eiszeit frühe Menschen den Atlantik überquert haben?«
»Ich würde es gern glauben, aber die Beweislage ist noch zu dünn«, antwortete Horst. »Seit zwanzig Jahren suchen Archäologen an den Ostküsten Amerikas nach eindeutigen Belegen, bislang ohne Erfolg.«
Sie unterbrachen ihr Gespräch, weil Ivan große Portionen von Martas Spezialkuchen an den Tisch brachte. Als die Mahlzeit beendet war, nahm sich Bruno vor, Abby seinen Freunden Fabiola und Gilles vorzustellen und ihr deren gîte zu zeigen. Den Bürgermeister wollte er bitten, sie bei der Bevollmächtigung als Fremdenführerin zu unterstützen, und ihr außerdem sein Exemplar der Memoiren des Duc de Lauzun zu lesen geben.
»Wenn sich dir die Gelegenheit bietet, von Bruno bekocht zu werden, solltest du dir das auf keinen Fall entgehen lassen«, riet Clothilde, als sie sich vom Tisch erhoben.
»Apropos Gelegenheit«, warf Bruno mit Blick auf Abby ein, »hat man Sie schon eingeladen, Horsts sagenhafte Dusche auszuprobieren?«
»Nein, aber den Whirlpool, und der ist toll«, antwortete sie, wirkte aber ein wenig abgelenkt, denn sie schaute plötzlich etwas ängstlich zur Tür hin, als ahnte sie auf der anderen Seite nichts Gutes.
Bruno war aufgefallen, dass sie sich mit dem Rücken zur Wand an den Tisch gesetzt und immer wachsam den Raum im Blick behalten hatte, auch als sie voller Begeisterung von ihren Plänen erzählte. Sie war offenbar kerngesund, hatte aber dunkle Ringe unter den Augen wie nach zu kurzem Schlaf. Eine nervöse Frau mit Sorgen, dachte er. Aber Balzac schien Zutrauen zu ihr gefasst zu haben und hatte sich unter den Tisch an ihre Füße gelegt. Als Horst die Rechnung zahlte und Clothilde schon zur Tür ging, wandte sich Bruno aus einem Impuls heraus an Abby.
»Wenn Sie möchten, können wir uns jetzt das Haus ansehen, das gerade frei wird«, sagte er. »Wir fahren mit meinem Auto, und ich setze Sie dann später am Museum oder vor Horsts Haus ab.«
4
Als sie auf Brunos alten Land Rover zugingen, der immer noch auf dem Platz vor dem Rathaus parkte, fragte Abby: »Was hat es mit dem Steinkreuz auf sich, das den Fluss überragt?«
»Es steht an der Stelle eines alten Nonnenklosters aus dem 10. Jahrhundert«, antwortete Bruno. »Das Kloster war später der erste Konvent, der sich zur reformierten Religion bekannte, als die Protestanten im 16. Jahrhundert von sich reden machten. Sehr zum Missfallen der Katholiken, die mit ihren Truppen die Frauen vertrieben, das Kloster plünderten und mit katholischen Nonnen besetzten. Daraufhin wurden diese von protestantischen Truppen vertrieben, wahrscheinlich sehr brutal, und so ging es weiter Schlag auf Schlag. Das Kloster wurde schließlich aufgegeben und seine Ruinen nach der Revolution dem Erdboden gleichgemacht.«
Bruno legte eine Pause ein und dachte kurz nach. »Kommen Sie mit«, sagte er und führte sie über eine Rampe zum Flussufer hinab. Auf halbem Weg blieb er vor einem mit einem Vorhängeschloss gesicherten Metalltor stehen, hinter dem sich eine kleine, aus Steinen gemauerte Gewölbekammer befand, und zeigte auf die Reste des alten Klosters, die darin aufbewahrt wurden: eine zerbrochene Säule, eine halbe Putte, ein Teil eines Fensterrahmens und ein beeindruckendes Taufbecken aus Marmor. Es war hüfthoch und mit ornamentalen Gravuren geschmückt, die Weinlaub und Blumen darstellten. Zu Brunos Füßen hob Balzac eine Pfote und blickte fast sehnsüchtig auf das Taufbecken, konnte es aber nicht erreichen, weil die Gitterstäbe des Tors selbst für ihn zu eng waren. Er drehte sich zur Seite, hob sein Bein und erleichterte sich höflich immerhin so, dass das Rinnsal die Rampe hinunterlief, weg von seinen menschlichen Begleitern.
»Mehr ist von dem Kloster nicht übrig geblieben«, sagte Bruno. »Aber es gibt noch etwas, das Sie sehen sollten.«
Er führte Abby über das gepflasterte Flussufer zur Brücke und machte sie am ersten Bogenpfeiler auf datierte Markierungen aufmerksam, die vergangene Höchstpegelstände der Vézère anzeigten. Die oberste lag eine Handbreit unter dem Bogenscheitel.
»Meine Güte. 1944 war also der bislang höchste Stand. Da hinten, die andere Seite, wo jetzt die Klinik steht, wird weit überflutet gewesen sein«, sagte Abby.
»Solche Überflutungen haben wir nicht mehr gehabt, seit flussaufwärts mehrere Staudämme gebaut worden sind. Die Vézère entspringt dem Millevaches-Plateau im Zentralmassiv, das fast tausend Meter über null liegt, und fällt auf dem Weg zu uns rund achthundert Meter ab. Es kommt hier gelegentlich immer noch zu extremem Hochwasser, wenn die Staudämme volllaufen und die Schleusen geöffnet werden müssen. Erst letzten Winter standen Teile von Les Eyzies unter Wasser, und in der Nähe von Le Buisson, hinter der Mündung der Vézère in die Dordogne, war die Straße nach