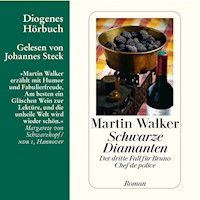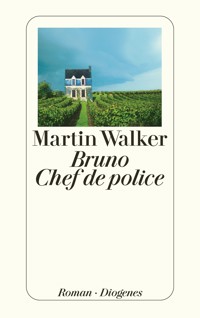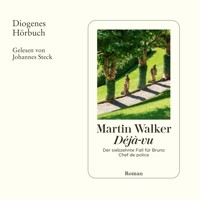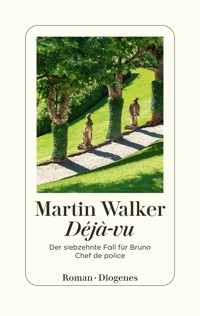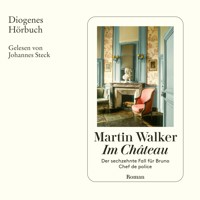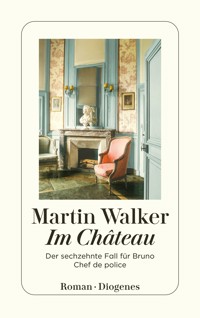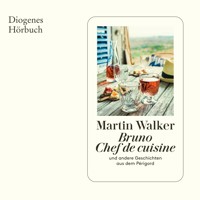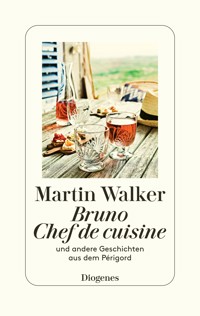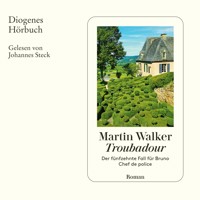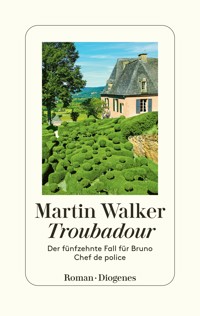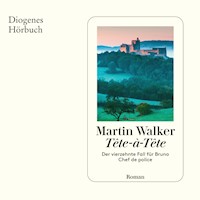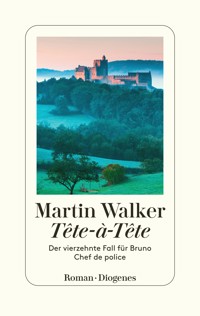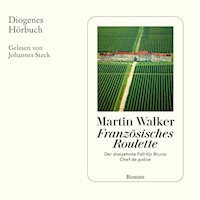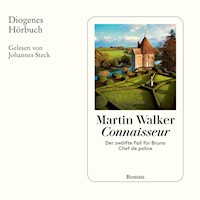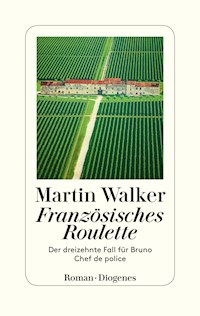
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Krimi
- Serie: Bruno, Chef de police
- Sprache: Deutsch
Im Périgord leben die Menschen lang und glücklich. Darauf spekuliert auch der Witwer Driant, der seinen ganzen Besitz auf ein lebenslanges Wohnrecht in einer schicken Seniorenresidenz setzt. Er weiß nicht, dass sein Roulette-Rad tausende Kilometer weit entfernt von einem russischen Oligarchen gedreht wird. Als Driant kurz darauf stirbt, ahnt nur Bruno das große Spiel dahinter. Seine erste Spur führt ins malerische Château einer Rocklegende.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Martin Walker
Französisches Roulette
Der dreizehnte Fall für Bruno, Chef de police
Roman
Aus dem Englischen von Michael Windgassen
Diogenes
Für Gérard Fayolle und Gérard Labrousse, zwei vorbildliche Menschen und außerordentlich kompetente Bürgermeister, deren Arbeit mir einen Großteil meiner Kenntnisse über das Funktionieren der Demokratie im ländlichen Périgord vermittelt hat
1
Zwei Tage nach der Beisetzung seines Vaters kam Gaston Driant in das Bürgermeisteramt von Saint-Denis, um mit Bruno Courrèges zu sprechen, dem ersten und einzigen Polizisten der Stadt. Gaston, ein langjähriger Bekannter aus dem Tennisclub, wirkte verstört, was sich Bruno damit erklärte, dass er noch unter Schock stand. Der alte verwitwete Driant hatte einen plötzlichen Herztod erlitten und war erst Tage später in seinem entlegenen Haus aufgefunden worden, von Patrice, dem Briefträger, der alten Kunden ab und zu einen Besuch abstattete, um nach dem Rechten zu sehen. Driant hatte ihn immer gern zu einem Gläschen von seiner selbst gemachten gnôle eingeladen, einem berühmt-berüchtigten Schnaps, vor dem Bruno großen Respekt hatte. Nach vergeblichem Anklopfen hatte sich Patrice Einlass durch die Küchentür verschafft. Zwei Katzen sprangen an ihm vorbei in den Garten, worauf ihm ein Gestank entgegenschlug, der ihn zurückfahren ließ. Als er dann sah, was die hungrigen Katzen in ihrer Verzweiflung mit dem toten Bauern angestellt hatten, drehte sich ihm der Magen um. Es dauerte eine Weile, bis er sich erholt hatte und Dr. Gelletreau alarmierte, von dem er wusste, dass er Driants Hausarzt war. Unter freiem Himmel und in frischer Luft wartete er auf dessen Ankunft.
Kaum eine Stunde später war Gelletreau vorgefahren, begleitet von einem Krankenwagen. Nachdem er den Toten untersucht hatte, gab er dessem Sohn ein Rezept für Schlaftabletten und schrieb ihn für drei Tage krank. An der vom Arzt bescheinigten Todesursache – Herzversagen – konnte kein Zweifel bestehen. Wie Gelletreau Bruno später mitteilte, hatte er Driant erst vor einem Monat dringend empfohlen, sich einen Herzschrittmacher einsetzen zu lassen, und einen entsprechenden Eingriff im Krankenhaus in die Wege geleitet.
Als Gaston nun vor Bruno stand, überraschte er ihn mit der entschiedenen Weigerung, sich auf einen Kaffee im Café Cauet einladen zu lassen. »Ich komme in einer dienstlichen Angelegenheit, Bruno; wir sollten also besser hier in deinem Büro bleiben. Eben erst war ich bei dem neuen notaire in Périgueux. Er hatte meiner Schwester und mir einen Brief geschrieben und diesen beim Bestatter für uns hinterlegt. Claudette, meine Schwester, ist extra von Paris angereist. Wir dachten, er wollte uns den Letzten Willen unseres Vaters vorlesen. Aber was er uns dann tatsächlich mitgeteilt hat, hat uns vom Stuhl gehauen. Wie dem auch sei, auf dem Weg zurück hierher haben wir, meine Schwester und ich, beschlossen, dass ich dich als alten Freund aufsuche und deinen Rat einhole. Ich meine, du kennst dich mit den Gesetzen aus, wir haben keine Ahnung.«
Es sei vom Eigentum seines Vaters nichts übriggeblieben, erklärte Gaston. Hinter dem Rücken seiner Kinder hatte Driant Haus und Hof verkauft und alles Geld in eine Versicherung gesteckt, von der er sich erhoffte, für den Rest seiner Tage in einem teuren Seniorenheim unterkommen zu können. Nach Auskunft des notaire wollte er im September dorthin umziehen, einen letzten Sommer aber noch auf der von seinem Vater geerbten ferme verbringen.
»Claudette und ich sind fassungslos, dass Papa uns von alldem nichts gesagt hat«, fuhr Gaston fort. »Völlig unverständlich ist für uns auch, dass er diesen Schickimicki-Notar in Périgueux aufgesucht hat, wo wir, die Familie, doch mit Brosseil immer zufrieden waren. Ich wollte zu ihm, gleich nach der Totenwache im Bestattungsinstitut, doch da wurde mir dann dieser Brief von dem notaire aus Périgueux vorgelegt.«
Bruno nickte verständnisvoll. Brosseil führte schon in dritter Generation das Notariat in Saint-Denis. Er kannte alle Bewohner der näheren Umgebung, die samt und sonders ihre letzten Verfügungen, Eigentumsübertragungen und sonstigen amtlichen Angelegenheiten von ihm beglaubigen ließen. Brosseil war ein verschrobener Typ, sehr etepetete, sowohl was seine Aufmachung als auch seine Manieren anging, und von einer Eitelkeit, die ans Lächerliche grenzte. Aber gerade deshalb fand man ihn liebenswert. Die ganze Stadt machte sich auf wohlmeinende Weise über ihn lustig. Bruno wusste aber auch, dass er seine Aufgaben äußerst gewissenhaft erledigte und so ehrlich war wie der Tag lang.
»Außerdem hätte dieses Seniorenheim überhaupt nicht zu Papa gepasst«, führte Gaston weiter aus. »Meine Schwester hat es gegoogelt. Es handelt sich um ein altes Château, das in ein Hotel umgebaut wurde, um jetzt als extravagante Altersresidenz genutzt zu werden. Die Kosten für einen Heimplatz liegen bei viertausend Euro im Monat und darüber. Ich verdiene nicht halb so viel. Und obwohl Papa tot ist, kassiert dieses Haus das ganze Geld aus der Versicherung. Das kann doch nicht mit rechten Dingen zugehen, oder? Was rätst du uns, Bruno?«
Bruno notierte sich die Namen und Anschriften des Notars, der Versicherungsgesellschaft sowie des Seniorenheims und kopierte den Brief des Notars an Gaston.
»Ich werfe da mal einen Blick drauf«, sagte er. »Wie alt war dein Vater?«
»Im November wäre er vierundsiebzig geworden. Bis auf das, was Gelletreau über sein Herz sagt, war er kerngesund, als ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Das war im März, als ich ihm geholfen habe, die Lämmer zur Welt zu bringen. Apropos, was wird jetzt aus den Schafen, den Enten und Hühnern?«
Mit der Auflösung des hiesigen Sägewerks war Gaston arbeitslos geworden und hatte danach einen Job als Krankenwagenfahrer in Bordeaux angenommen. Bruno hatte ihm ein polizeiliches Führungszeugnis ausgestellt und eine Empfehlung formuliert, in der aufgeführt war, dass Gaston mehrere Jahre bei der Freiwilligen Feuerwehr mitgewirkt und erste Erfahrungen als Notretter erworben hatte. Gaston musste für zwei Töchter sorgen, die noch zur Schule gingen. Nicht zuletzt für sie hatte er nach dem Tod seines Vaters mit einer anständigen Erbschaft gerechnet.
»Hat er dir oder Claudette gegenüber nie etwas von seinen Plänen gesagt?«, fragte Bruno.
Gaston schüttelte den Kopf. »Als wir das letzte Mal zusammen am Tisch saßen und gegessen haben, sprach er davon, dass er so lange wie möglich auf dem Hof bleiben und erst dann ins Altersheim von Saint-Denis gehen wollte, wenn es unumgänglich wäre. Da würde er immerhin unter Freunden und Bekannten sein. Ich weiß nicht, was in ihn gefahren ist.«
»Überlass die Sache mir«, sagte Bruno. »Ich werde mich erkundigen und gebe dir Bescheid, wenn ich etwas herausgefunden habe. Aber so viel kann ich dir schon vorweg sagen: Wenn alte Leute ihren Letzten Willen ändern wollen, müssen ein Arzt und ein Anwalt attestieren, dass sie im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte sind und aus freien Stücken handeln. Wenn eine solche Bescheinigung in eurem Fall nicht vorliegt, könntet ihr Einspruch erheben. Nur, darüber müsst ihr euch im Klaren sein: Gegen einen notaire und eine Versicherungsgesellschaft zu klagen wird einen langwierigen Prozess nach sich ziehen und am Ende womöglich sehr teuer werden.«
»Merde«, knurrte Gaston. »Immer dasselbe. Die Reichen bekommen recht, und unsereins guckt in die Röhre.«
»Wenn es kein Testat gibt, habt ihr das Recht auf eurer Seite. Und du weißt, der Bürgermeister und ich werden euch unterstützen. Mein herzliches Beileid noch mal. Ich habe deinen Papa gemocht. Er saß bei fast allen Rugbyspielen auf der Tribüne und hat an den dîners des Jagdclubs teilgenommen. Und diese gnôle war zwar schwarz gebrannt, aber das beste eau de vie weit und breit. Ich hoffe, du hast noch ein paar Flaschen davon.«
»Eine oder zwei. Den Großteil seines Raketentreibstoffs hat er selbst getrunken, was man ihm nicht verdenken kann«, sagte Gaston und stand auf, um Bruno die Hand zu schütteln.
Brunos erster Weg führte ihn ins Büro des Katasteramts am Ende des Flurs. Dort suchte er die Karte heraus, auf der jede Liegenschaft, deren Eigentümer sowie Details zu den Grundsteuern verzeichnet waren. Für Driants Hof war noch kein neuer Besitzer registriert. Die dazugehörigen Ländereien beliefen sich auf zweiundsechzig Hektar, zum größten Teil Wald, und dazu ein paar karge Weiden oben auf dem Plateau – zum Weinanbau ungeeignet und für eine Schafherde zu klein. Es überraschte Bruno zu erfahren, dass Driant einen Bauantrag für vier neue Häuser auf seinem Land gestellt hatte, gedacht als Unterkünfte für Saisonarbeiter, wie es in dem Antrag hieß. Eine solche Zweckbestimmung wurde häufig vorgetäuscht, wenn in Wirklichkeit der Verkauf von Ferienhäusern beabsichtigt war.
Von Monsieur Sarrail, dem notaire aus Périgueux, hatte Bruno noch nie gehört. Dem Briefkopf aber war zu entnehmen, dass seine Kanzlei an der vornehmen Rue du Président Wilson mitten in der Innenstadt lag. Im selben Gebäude hatte, wie Bruno herausfand, der Agent der Versicherungsgesellschaft sein Büro. Interessant, dachte er. Er besuchte die Website der Seniorenresidenz und staunte, als er ein schönes Château in der Nähe von Sarlat zu Gesicht bekam, eines, das er kannte. Vor fünf oder sechs Jahren hatte ihn der Baron dorthin zum Abendessen eingeladen. Es war gerade zu einem Viersternehotel umgebaut worden und hatte ein Restaurant, das sich um einen Michelin-Stern bemühte. Nach Brunos Geschmack war das Menü eine Spur zu sehr nouvelle cuisine gewesen, die Portionen zu klein und überdekoriert, um kunstvoll und einfallsreich zu wirken. Auf Bruno und den Baron hatten sie einen eher prätentiösen Eindruck gemacht. Es blieb ihr einziger Besuch dort.
Auf der Website der Seniorenresidenz war von medizinischer Vollversorgung die Rede, von einer Betreuung durch ausgebildete Krankenschwestern, Physiotherapeuten und Masseuren sowie einem fest angestellten Arzt, der auch als Vorstandsmitglied fungierte. Sie empfahl sich als »luxuriöses Etablissement für eine anspruchsvolle Klientel nach dem Vorbild eines exklusiven Privatclubs«. Zu der besonderen Ausstattung gehörten ein Kino, ein Kurbad und eine Neun-Loch-Golfanlage. Dass der Geschäftsführer früher für das Pariser Hôtel Crillon tätig gewesen war, wurde ebenfalls als Besonderheit herausgestellt.
Weiter hieß es, dass der Chefkoch seine Lehre in einem Genfer Restaurant, von dem Bruno schon gehört hatte, absolviert hatte und später als Sous-Chef im Pariser Relais Louis XIII Erfahrungen gesammelt hatte. In diesem Feinschmeckertempel war Bruno einmal mit seiner alten Flamme Isabelle zu Gast gewesen und hatte die köstlichsten quenelles gegessen, die ihm jemals serviert worden waren. Wieso um alles in der Welt hätte sich Driant in einer derart noblen Seniorenresidenz zur Ruhe setzen wollen, hätte er doch damit rechnen müssen, von den Mitbewohnern und wahrscheinlich auch vom Personal als einfacher Schafzüchter verhöhnt zu werden? Reservierung auf Antrag, hieß es lapidar.
Bruno fand den Namen des Geschäftsführers auf der Website, rief im Hôtel Crillon in Paris an und verlangte den Sicherheitsbeauftragten zu sprechen. Er stellte sich vor und erfuhr, dass er mit einem ehemaligen détective der Préfecture de Police verbunden war, der über den gemeinsamen Freund Jean-Jacques, den Chefinspektor des Départements Dordogne, von ihm, Bruno, schon gehört hatte. Bruno erklärte, dass er Erkundigungen über eine luxuriöse Seniorenresidenz in seiner Region einzuholen versuche, deren Geschäftsführer angeblich im Crillon gearbeitet habe. Der alte Polizist lachte, als er dessen Namen hörte. Ja, er habe tatsächlich ein paar Monate als Portier in seinem Haus gearbeitet und vor allem die Aufgabe gehabt, das Gepäck der Gäste auf die Zimmer zu tragen und schmutzige Wäsche einzusammeln und zur Reinigung zu bringen. Er sei durchaus tüchtig gewesen, sagte er, wurde aber vor die Tür gesetzt, als sich ein weiblicher Gast darüber beschwerte, dass er ihr seine Dienste als Gigolo anempfohlen hatte.
Bruno rief daraufhin Jean-Jacques im Polizeihauptquartier in Périgueux an und fragte ihn, ob ihm etwas über den notaire oder die Seniorenresidenz bekannt sei und ob die Driant-Geschichte nicht nach Betrug aussehen würde.
»Von dieser Residenz habe ich noch nie gehört«, antwortete Jean-Jacques, »aber vielleicht ist das, was Sie mir da berichten, eine neue Masche unseres notaire. In Paris hat es dergleichen Fälle schon gegeben: Ein notaire geht mit einem Versicherungsvertreter, einem Wirtschaftsprüfer und einem Investmentberater eine Partnerschaft ein und bietet wohlhabenden Leuten finanzielle Beratung an. Das Ganze nennt sich Vermögensverwaltung. Dieser Typ aus Périgueux ist mir allerdings noch nie untergekommen, gehört aber auch nicht wirklich zu meiner Klientel. Ich könnte mich mal diskret mit einem Kollegen der fisc in Verbindung setzen, wenn Sie wollen.«
Bruno bejahte. Fisc war die umgangssprachliche Bezeichnung für die Brigade nationale de répression de la délinquance fiscale. Sie arbeitete manchmal eng mit der Polizei zusammen, war aber im Unterschied zu dieser nicht dem Innenministerium unterstellt, sondern dem Ministerium für Wirtschaft und Finanzen. Bruno erzählte Jean-Jacques, was er von dem gemeinsamen Bekannten im Crillon über den Geschäftsführer der Seniorenresidenz erfahren hatte, und brachte ihn damit zum Lachen.
Bruno ging zu Claire, der Sekretärin der mairie, und fragte, ob Bürgermeister Mangin zu sprechen sei. Der hatte ihn offenbar gehört, weil die Tür zum Vorzimmer halb offen stand, und rief, er solle gleich hereinkommen. Bruno berichtete, was er in Erfahrung gebracht hatte, und fragte den Bürgermeister, ob er etwas über Driants Bauvorhaben wisse.
»Ja, der Rat hat seinen Antrag bewilligt«, antwortete Mangin. »Eine Hand wäscht die andere. Driant war über zwei Legislaturperioden Ratsmitglied gewesen; das war vor Ihrer Zeit, Bruno. Dass unsere Ratsherren Projekte eines Kollegen unterstützen, ist doch klar, und es besteht ja Bedarf an Unterkünften für all die Pensionäre, die bei uns ihren Lebensabend verbringen wollen. Aber was Sie da sagen, klingt in der Tat ziemlich schräg. Ich werde meinen Amtskollegen in Sarlat anrufen und fragen, was er über diese Seniorenresidenz weiß. Dass Driant ausgerechnet dort unterkommen wollte, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.«
»Sie kennen Driants Betrieb«, sagte Bruno. »Was könnte er Ihrer Meinung nach einbringen?«
»Landwirtschaftlich wird ihn wohl niemand mehr nutzen wollen, schon gar nicht für die Schafzucht, zumal Brüssel die Agrarsubventionen für Bergbauernbetriebe eingestellt hat. Driant war wohl einer der Letzten, die von Zuschüssen profitiert haben«, antwortete Mangin. »Das Wohnhaus und die Scheunen dürften an die hundertfünfzigtausend wert sein, aber nur, wenn jemand ein kleines Hotel und gîtes daraus machen würde, was, wenn ich richtig informiert bin, im Antrag schon so formuliert war. Der Kaufpreis wird aber wohl letztlich davon abhängen, in welchem Zustand die Gebäude sind und wie viel investiert werden muss. Aber wenn man es geschickt anstellt, könnte es für Sommergäste ideal sein, zumal man von Driants Hof einen phantastischen Blick hat. Ich schlage vor, Sie gehen zu Brosseil und fragen ihn, ob es seine Richtigkeit mit Driants Mandatswechsel hatte. Danach sprechen wir uns wieder.«
Bruno traf den notaire in dessen Kanzlei an der Rue Gambetta an. Der kleine Mann war fülliger geworden, aber in Anzug und Krawatte so adrett gekleidet wie eh und je. Dass er, wie auch jetzt, meist eine Blume im Reversknopfloch trug, hatte etwas Dandyhaftes. Nur wenige Männer in Saint-Denis trugen Krawatten bei der Arbeit. Selbst der Bürgermeister verzichtete darauf. Nicht zuletzt deshalb galt Brosseil als Sonderling. Er wurde zwar respektiert, aber wirklich sympathisch fanden ihn die wenigsten. Seine Frau zählte zu dem inzwischen sehr klein gewordenen Kreis von Frauen, die keiner geregelten Arbeit nachgingen und sich stattdessen ausschließlich um den Haushalt kümmerten und für ihre Männer täglich ein traditionelles Mittagessen kochten. Sie ging jeden Sonntag in die Kirche und engagierte sich im Rahmen der Action Catholique für wohltätige Projekte.
Bruno kannte Brosseil allerdings auch von einer ganz anderen Seite. Er hatte gehört, dass der kleine Notar ein Star auf der Tanzfläche war und mit seiner Frau zweimal in der Woche einschlägige Lokale in Bergerac und Périgueux aufsuchte, wo sie unter Gleichgesinnten nach Herzenslust ihr Können zeigen konnten. Bruno konnte bestenfalls Walzer tanzen, aber schon der Unterschied zwischen Quickstep und Foxtrott war ihm ein Rätsel. Wenn es denn der Zufall mal so wollte, kreiste er durch den Saal, schritt aus im Rhythmus der Musik und versuchte, der Partnerin nicht auf die Füße zu treten. So auch auf dem letzten Fest der pompiers, als er zum ersten Mal Brosseil die Beine hatte schwingen sehen, und das wahrhaft meisterlich. Pamela, Fabiola und Florence, seine Freundinnen, waren, nachdem sie mit Brosseil einen Walzer aufs Parkett gelegt hatten, mit leuchtenden Augen zum Tisch zurückgekehrt und lobten überschwenglich seine Tanzkunst.
»Das überrascht mich jetzt«, sagte Brosseil als Reaktion auf Brunos Erklärung für seinen Besuch. »Es gehört sich einfach nicht, in den Bezirken anderer Notare zu wildern. Driant war mein Mandant. Und mich nicht einmal darüber in Kenntnis zu setzen, dass er ein neues Testament hat aufsetzen lassen, ist wider alle guten Sitten unseres Berufsstandes. Ich habe das ursprüngliche Testament formuliert und beglaubigt. Wie konnte es überhaupt dazu kommen, dass er diesen Kollegen in Périgueux aufgesucht hat? Schleierhaft ist mir auch, was Driant dazu bewogen hat, seine Kinder zu enterben.«
Ebenso fragwürdig sei der versicherungstechnische Aspekt des Ganzen, fuhr er fort. Driant hätte gut und gern noch fünf bis zehn Jahre leben können; am Ende wären für die Unterbringung in der Seniorenresidenz womöglich insgesamt bis zu einer halben Million Euro fällig gewesen. So viel würde sein Hof mittelfristig nur dann einbringen, wenn man ihn in gîtes umwandelte. Aber dafür müsste man erst einmal mindestens dreihunderttausend investieren; dazu kämen Kosten für laufende Reparaturen, für einen Swimmingpool, Terrassen, einen anständigen Parkplatz, Mobiliar …
»Das rechnet sich nicht. Ich kann nicht glauben, dass eine seriöse Versicherungsgesellschaft einen solchen Deal vorschlägt«, sagte Brosseil, der alle fälligen Investitionen an den perfekt manikürten Fingern abgezählt hatte. »Es sei denn, man wusste, dass der alte Herr ein schwaches Herz hat. Die Versicherung wird in Anbetracht seines Alters mit Sicherheit ein medizinisches Gutachten angefordert haben. Kurzum, ich bin derselben Meinung wie Driants Sohn: An der Sache ist was faul. Haben Sie schon mit Bürgermeister Mangin darüber gesprochen?«
»Er war es, der mir geraten hat, mich an Sie zu wenden. Was wissen Sie über den Kollegen in Périgueux?«, fragte Bruno.
»Nicht viel«, antwortete Brosseil. »Sein Name ist Sarrail. Er scheint erst vor kurzem aus Marseille oder Nizza in unsere Region gezogen zu sein. Wenn er sich eine Kanzlei wie die an der Rue du Président Wilson leisten kann, wird er gut bei Kasse sein. Oder er spekuliert auf einträgliche Geschäfte. Es lassen sich ja viele Pensionäre aus ganz Europa im Périgord nieder, und mit all den neuen Hotels und Restaurants bieten sich ökonomische Perspektiven. Ich werde mich mal umhören. Wenn ich etwas Interessantes erfahre, hören Sie von mir.«
Brosseil dachte nach und tippte mit einem Finger auf seine Lippen. »Es wäre günstig, an die Verträge heranzukommen, die Driant mit der Versicherung und der Seniorenresidenz abgeschlossen hat. Als ich hörte, dass er gestorben ist, habe ich im Zentralen Testamentsregister nachgefragt und erfahren, dass kein neuer Eintrag verzeichnet wurde. Solange das nicht der Fall ist, bleibt das erste Testament gültig. Umso mehr wundert mich, dass sich Driants Sohn an Sarrail gewandt hat und nicht zu mir gekommen ist. Nach dem ursprünglichen Testament, das ja noch gültig sein dürfte, sind er und ich als Vollstrecker benannt. Das heißt, ich könnte eine Kopie aller Verträge anfordern, die Driants Letztem Willen widersprechen. Je mehr ich darüber nachdenke, desto fauler erscheint mir das Ganze.«
»Ja, tun Sie das. Aber könnte es sein, dass Driant kurz vor seinem Tod ein neues Testament hat aufsetzen lassen, das das alte ungültig macht?«, fragte Bruno. »Vielleicht hatte das Zentralregister noch nicht die Zeit, seine Daten auf den neuesten Stand zu bringen.«
»Durchaus möglich, aber normalerweise ist man dort ziemlich schnell. Ich prüfe das. Und wenn Sie das nächste Mal mit Gaston sprechen, fragen Sie ihn doch bitte, warum er zu Sarrail gegangen ist. Und ob der Kontakt zu ihm aufgenommen hat.«
»Soweit ich weiß, hat Sarrail einen Brief für die Geschwister Driant beim Bestatter hinterlegt«, sagte Bruno. Er holte sein Notizbuch aus der Tasche und schrieb die Fragen auf, die Brosseil aufgeworfen hatte. In seinem Hinterkopf tauchte eine weitere Frage auf. Entscheidend war womöglich der von Dr. Gelletreau unterzeichnete Totenschein, der einen Herzinfarkt als Todesursache feststellte. Wäre eine Autopsie vorgenommen worden, hätte Bruno bestimmt davon gehört. Gelletreau mochte den Leichnam in Augenschein genommen haben, aber es war wohl davon auszugehen, dass der Arzt, der fast ebenso alt wie Driant war, einfach sein Formblatt ausgefüllt und sich davon hatte leiten lassen, was er aus der Vorgeschichte seines betagten Herzpatienten wusste. Da dieser nun eingeäschert worden war, würde sich die tatsächliche Todesursache nicht mehr feststellen lassen.
Auf dem Weg zurück in sein Büro überlegte Bruno, ob es angebracht wäre, seine Freundin Fabiola anzurufen, die seiner Meinung nach die beste Ärztin in der Stadt war und immer bereit, ihm zu helfen. Sie in der Klinik anzurufen, wo sie mit Gelletreau zusammenarbeitete, schien ihm aber keine so gute Idee zu sein. Er würde sie ja ohnehin am Abend sehen, wenn sie mit den Pferden zu tun hatten. Dann könnte er sie nach ihrer Meinung fragen. Er wusste, dass sie den älteren Kollegen mochte, auch wenn sie nicht allzu viel Respekt vor seinen fachlichen Fähigkeiten hatte.
Als er sein Büro betrat, klingelte sein Telefon. Es war Brosseil, der ihm mitteilte, dass er noch einmal im Zentralen Testamentsregister angerufen und erfahren hatte, dass Driants neu aufgesetztes Testament, am Freitag voriger Woche unterschrieben und beglaubigt, vorgestern eingereicht worden war. Bruno warf einen Blick auf den Kalender. Am Freitag hatte der Briefträger den alten Driant tot aufgefunden. Am folgenden Dienstag war seine Asche beigesetzt worden. Jetzt war Donnerstag.
»Es scheint, Driant hatte nach der Änderung seines Letzten Willens nicht mehr lange zu leben«, sagte Bruno. »Ab wann ist ein Testament gültig? Ab dem Zeitpunkt der Unterzeichnung oder der Registratur?«
»Sobald es unterzeichnet und beglaubigt wurde«, antwortete Brosseil. »Aber das tut hier nichts zur Sache, denn wir kennen den Todeszeitpunkt nicht genau. Ich habe gerade ein Schreiben an Sarrail aufgesetzt, mit dem ich ihn auffordere, mir die Verträge über den Verkauf von Driants Betrieb und seine Versicherung zukommen zu lassen. Außerdem soll er mir erklären, ob der Verkauf seiner Viehbestände ordnungsgemäß abgewickelt worden ist, nämlich in Übereinstimmung mit geltendem EU-Recht.«
»Erzählen Sie mir mehr«, sagte Bruno, der sich weitere Notizen machte, als Brosseil auf die verwickelten Bestimmungen in Sachen Viehhandel einging, die wahrscheinlich nur ein auf Landwirtschaft spezialisierter notaire überblicken konnte.
»Was, wenn Ihr Kollege in Périgueux und der neue Besitzer diese Bestimmungen missachtet haben?«, wollte Bruno wissen.
»In einem schwerwiegenden Fall könnte der Kaufvertrag für null und nichtig erklärt werden und der eingeschaltete notaire seine Zulassung verlieren. Der neue Besitzer könnte ihn womöglich haftbar machen und verklagen. Allerdings vermute ich, dass sie sich für diesen Fall schon eine Lösung haben einfallen lassen und behaupten werden, Driant hätte sich um die Formalitäten kümmern wollen, wozu er aber dann nicht mehr gekommen ist. Jedenfalls würde ich so verfahren, und dumm sind diese Leute bestimmt auch nicht.«
»Was passiert, wenn Sarrail mit den Dokumenten nicht herausrückt?«
»Notariatsakten bezüglich Eigentumsübertragungen, Viehverkäufen und Testamenten müssen der Präfektur vorgelegt werden und einsehbar sein. So oder so, wir werden Kopien davon bekommen. Ob wir dem notaire etwas anhängen können, ist eine andere Frage.«
2
Bruno hatte keine Ahnung, ob er es im Fall Driant mit einem Verbrechen zu tun hatte oder ob Gaston einfach juristischen Winkelzügen zum Opfer gefallen war, gegen die er nichts unternehmen konnte, es sei denn, er legte Klage ein. Das aber konnte er sich finanziell nicht leisten. Als Polizist vom Land hielt Bruno an einem ungeschriebenen Gesetz fest, das ihn dazu verpflichtete, seinen Nachbarn nach Möglichkeit zu helfen und sich, wenn nötig, auch um deren Vieh zu kümmern. Driants Katzen konnten sich um sich selbst kümmern, aber weil Bruno sich Sorgen um Driants Schafe und Hühner machte, fuhr er in seinem Polizeitransporter über das Hügelland in Richtung Saint-Chamassy und erfreute sich am Anblick des frischen Maigrüns.
Als er den Hof erreichte, sah er einen Lastwagen vor dem Wohnhaus parken. Er gehörte, wie er wusste, Marc Guillaumat, einem älteren Schafzüchter, der ein paar Kilometer entfernt auf der anderen Seite des Tals lebte. Seit der gemeinsamen Schulzeit war er mit Driant eng befreundet gewesen. Bruno fand ihn im Hühnerstall, wo er die Tränke mit Wasser füllte. Er schüttelte ihm die Hand und fragte, ob er helfen könne.
»Nicht nötig, ich bin gleich fertig«, antwortete Marc. »Eigentlich wollte ich nur nach den Lämmern sehen, aber als ich hier ankam, saßen die Hühner und Enten auf dem Trockenen. Die Schafe auf der Weide kommen allein zurecht, es ist ja schon genug Gras nachgewachsen. Aber wegen der vielen Füchse muss sich jemand um die Lämmer kümmern.«
Hinter dem Ententeich standen dicht an dicht mehrere Dutzend Schafe, zusammengetrieben von vier Hütehunden, die jetzt hechelnd auf ihren Bäuchen lagen und die Herde im Auge behielten. Etliche Lämmer hingen an ihren Müttern, die offenbar erst vor kurzem geschoren worden waren. Hier oben auf dem Plateau trugen die Tiere ihre Winterwolle bis tief in den April hinein oder noch länger.
»Zwei der Hunde sind meine. Die beiden anderen, die Hündin und der Welpe, gehörten Driant«, sagte Guillaumat, der Brunos Blicken gefolgt war. »Er hat sie bestens erzogen. Sie machen ihre Arbeit ganz von allein, wie Sie sehen. Weil bislang niemand aufgekreuzt ist, der sie abgeholt hätte, passen sie auf die Lämmer auf, obwohl sie schrecklichen Hunger haben müssen. Seit Gaston das letzte Mal hier war, haben sie wahrscheinlich nichts mehr zu fressen gekriegt. Zum Glück hatte ich ein paar Kekse im Wagen. Darüber sind sie gierig hergefallen.«
Bruno runzelte die Stirn. Es machte ihn wütend, wenn Hunde vernachlässigt wurden.
»Ich hatte gehofft, Gaston würde zurückkommen und mir sagen, was er mit den Tieren vorhat, aber ich habe nichts mehr von ihm gehört. Er hat mir Driants Flinte zur Aufbewahrung gegeben, das war alles. Die Schaftröge waren vollkommen leer, als ich gekommen bin. Trinken können die Tiere ja aus dem Ententeich, aber sehen Sie selbst, der ist auch fast leer. Ärgerlich das Ganze. Wenn ich Gaston das nächste Mal sehe, werde ich ihm ordentlich Bescheid stoßen.«
»Die Sache ist ziemlich verwickelt. Wie’s aussieht, werden Gaston und seine Schwester nichts erben«, sagte Bruno und erklärte, wofür sich Driant entschieden hatte.
»Dass er was Verrücktes anstellt, hatte ich schon irgendwie befürchtet«, entgegnete Guillaumat. »Vor einiger Zeit hatte er eine schicke junge Frau bei sich, als ich zufällig bei ihm vorbeigekommen bin, eine aus dem Ausland, glaube ich. Sie sprach mit Akzent. Sie trug einen kurzen Rock und war ziemlich stark geschminkt. Später traf ich sie noch mal bei ihm. Da wollte ich wissen, wer sie ist. Er sagte, sie sei von einer Versicherungsgesellschaft, aber ich war mir sicher, dass er ein Auge auf sie geworfen hatte. Er war schon immer so was wie ein Schürzenjäger gewesen, und nach dem Tod seiner Frau hat er wohl sehr unter Einsamkeit gelitten. Außer mir und ein paar Kumpels vom Rugbyverein hatte er kaum Freunde. Weil ihm hier draußen die Decke auf den Kopf gefallen ist, hat er sich ständig im Club du Troisième Âge herumgetrieben, vor allem, weil er Frauen treffen wollte.«
»Wann genau haben Sie die junge Frau zum ersten Mal gesehen?«, fragte Bruno.
»Im März zur Lammzeit und dann noch einmal Anfang April, als ich gekommen bin, um zu fragen, wann er die Schafe scheren will. Das haben wir immer zusammen gemacht. Wir waren gut eingespielt. Mit dem Geld aus der Wolle ist er immer in einen dieser Massagesalons in Bergerac gefahren.« Guillaumat gab ein kurzes schnaubendes Lachen von sich. »Wenn er ein paar Gläser intus hatte, gab er dann mächtig an und prahlte, dass er noch so tüchtig wäre wie sein alter Bock.«
Bruno nickte und grinste. »Würden Sie die Schafe übernehmen, wenn der neue Eigentümer sie nicht haben will? Vielleicht lässt er sogar was springen, wenn Sie ihn von der Herde befreien.«
Guillaumat schüttelte den Kopf. »Ich habe keine Weide für sie. Das Gleiche gilt wahrscheinlich auch für die beiden anderen Züchter, die noch hier sind. Ich wüsste auch niemanden, der sie kaufen würde. Wenn wir keine Zuschüsse bekämen, müssten wir verhungern. Ich schätze, der neue Eigentümer wird sie einfach vom Schlachthof abholen lassen.« Der alte Mann legte eine Pause ein und spuckte aus. »Die werden sich schön ärgern, wenn sie feststellen, dass die Schlachtkosten gerade mal den Fleischpreis abdecken, wenn überhaupt.«
»Wie sieht’s mit den Hühnern und Enten aus?«, fragte Bruno. »Womöglich wird der neue Eigentümer nicht einmal wissen, dass es sie gibt.«
»Die Enten würde ich nehmen. Dafür gibt’s vielleicht noch ein paar Euro, aber nicht für die Hühner. Es hat keinen Zweck. Nach den EU-Bestimmungen dürfen wir keine Eier mehr auf dem Markt verkaufen. Die Gänse lass ich mir auch gefallen. Im Dezember kriege ich fünfzig bis sechzig Euro pro Stück.«
»Würden Sie sich bitte um die Schafe kümmern, bis klar ist, welche Pläne der neue Eigentümer hat? Ich werde dafür sorgen, dass Ihre Zeit bezahlt wird.«
»Einverstanden. Alle zwei Tage könnte ich nach dem Rechten sehen.«
»Übrigens, wie haben Sie von Driants Tod erfahren?«, erkundigte sich Bruno.
»Von Dr. Gelletreau. Wir sind uns auf dem Markt begegnet. Das war schon sonderbar. Ich hatte mich nämlich bei ihm erst kurz vorher nach Driant erkundigt, weil der nicht zu erreichen war. Er hat häufiger vergessen, sein Handy aufzuladen. Gelletreau sagte, ich bräuchte mir keine Sorgen zu machen. Driant würde bald einen Herzschrittmacher bekommen.«
Der alte Bauer winkte zum Abschied und fuhr davon. Bruno fand die Haustür unverschlossen. Der Leichengeruch war immer noch deutlich bemerkbar. Also öffnete er alle Fenster und schaute sich um. Jemand hatte den uralten Kühlschrank ausgeräumt, das Geschirr gespült und ins Trockengestell neben der Spüle gestapelt: zwei Weingläser, zwei Wassergläser, zwei Unterteller, zwei Teller und zwei Suppenschalen. Hatte Driant seine letzte Mahlzeit nicht allein zu sich genommen?
Das Erdgeschoss bestand aus vier Räumen – einer Küche, einem primitiven Bad, einem selten genutzten Wohnzimmer mit einer dicken Staubschicht auf dem Fensterbrett und einem unaufgeräumten Büro. Auf dem Schreibtisch stapelten sich ungeöffnete Briefe. Eine enge Stiege führte ins Obergeschoss zu einem großen und zwei kleinen Schlafzimmern sowie einer Abstellkammer, in der mehrere alte Koffer untergebracht waren. An einer Stange hingen Frauenkleider in Plastikhüllen. Sie sahen so altmodisch aus, dass Driants Mutter sie getragen haben mochte, denn zu Lebzeiten seiner verstorbenen Frau waren sie schon längst aus der Mode gewesen. Offenbar hatte Driant in dem großen Schlafzimmer geschlafen, denn das Bett war nicht gemacht, und an einem der Pfosten am Fußteil hing ein schmuddeliger gestreifter Schlafanzug. In einem der beiden Kissen war noch sein Kopfabdruck zu sehen. Das andere schien aufgeschüttelt zu sein. Als Bruno es umdrehte, entdeckte er Flecken, die aussahen, als stammten sie von einem Lippenstift. Er beugte sich darüber und nahm den Hauch eines Duftes wahr. In der Schublade des Nachttischchens fand er ein unbeschriftetes Arzneifläschchen, das rhombenförmige blaue Pillen enthielt, zwei abgegriffene Pornoheftchen und einen Vibrator.
Im Haus gab es offenbar keinen Festnetzanschluss. Ein Mobiltelefon war nirgends zu finden, auch nicht im Durcheinander des Arbeitszimmers, das Bruno gründlich durchsuchte. Allerdings fiel ihm dabei eine Gebührenabrechnung von Orange in die Hände, auf die »bezahlt« gekritzelt war. In einer Schublade fand er ein Scheckheft mit Kontrollabschnitten, die Zahlungen an Orange, das Finanzamt von Saint-Denis und den Supermarkt vor Ort bescheinigten. Bruno steckte das Scheckheft ein und hinterließ eine unterschriebene Quittung. Er notierte sich die Handynummer und rief sie an. Vergeblich. Es meldete sich nicht einmal eine Sprachbox. Seltsam, dachte er. Die Gebühren waren schließlich bezahlt. Weil es im Haus nichts mehr für ihn zu tun gab, suchte er draußen nach den Fressnäpfen der Hunde und füllte sie mit dem Futter, das er in der Scheune fand.
Immer noch verärgert über die Vernachlässigung der Tiere, fuhr Bruno auf direktem Weg nach Périgueux, um Sarrail, den notaire, zur Rede zu stellen. Eine junge Frau im Vorzimmer blickte überrascht auf, als er eintrat, und fragte, ob er einen Termin habe.
»Die Polizei braucht keine Termine, mademoiselle«, entgegnete Bruno und ging an ihr vorbei auf die offene Tür zu, an der Sarrails Name stand.
Er traf einen elegant gekleideten Mann Mitte dreißig an, der in einer Fremdsprache telefonierte. »Da, konietschna vsjow pariadke«, sagte er, was sich für Bruno Slawisch anhörte, vielleicht war es Russisch. Sarrail trug einen Nadelstreifenanzug, ein weißes Oberhemd und eine seidene Krawatte, die sehr teuer aussah. Er saß hinter einem modernen Schreibtisch aus Chrom und Glas, auf dem sich ein großer Computerbildschirm, ein Notizblock und ein Füllfederhalter von Montblanc befanden. Empört, dass ihn jemand störte, richtete er sich auf, bemerkte aber dann Brunos Uniform. Er bedeutete ihm, Platz zu nehmen, und wandte sich wieder ab, um das Telefonat kurz fortzusetzen, legte aber bald auf.
»Monsieur Sarrail?«, fragte Bruno. Der Mann nickte. »Wo haben Sie Russisch gelernt?«
»In der Schule und auch später. Ich habe ein paar russische Mandanten. Und wer sind Sie?«
Bruno reichte ihm seine Karte und erklärte, dass er einer Beschwerde nachgehe. Gaston Driant fechte das neu aufgesetzte Testament seines Vaters an. Ob testiert worden sei, dass der Erblasser im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte war?
»Natürlich, seines fortgeschrittenen Alters wegen habe ich darauf bestanden«, antwortete der notaire in gepflegtem Französisch mit einem leichten Akzent, den Bruno im Sprachraum um Lille oder sogar Belgien verortete. Er machte einen ruhigen, selbstbewussten Eindruck. Hinter ihm hing ein großes Gemälde an der Wand, das kämpfende Superhelden aus Comics zeigte und in grellen Farben – Orange, Rosa und Grün – gemalt war.
Monsieur Driant sei von drei qualifizierten Gutachtern in Périgueux untersucht worden, erklärte Sarrail und nannte diese beim Namen. Der eine war Psychologe am örtlichen Krankenhaus, der zweite ein gewisser Maître Debeney vom Palais de Justice und der dritte François Maunoury, der in seiner nunmehr dritten Amtsperiode als Stadtrat tätig war. Das neue Testament sei nach aller gebotenen Sorgfaltspflicht aufgesetzt worden. Die Gutachter hätten sich davon überzeugt, dass Monsieur Driant aus freien Stücken zu handeln in der Lage gewesen sei. Er, Sarrail, habe den Wortlaut des Testaments laut vorgelesen, worauf Driant im Beisein der Gutachter bestätigt habe, dass dies exakt sein Letzter Wille sei. Er habe den Text noch einmal durchgesehen und schließlich unterschrieben.
»Auf meine Empfehlung hin hat Driant dann, immer noch im Beisein der Gutachter, den Übertragungsvertrag für sein Anwesen, die Abmachungen mit der Versicherung und seinen Antrag zur Unterbringung im Seniorenheim vorgelesen«, fuhr Sarrail fort. »Die schriftliche Billigung des Antrags lag ebenfalls schon vor. Die Gutachter fragten ihn daraufhin, ob ihm bewusst sei, dass er seine Kinder de facto enterbt habe. Er bejahte und begründete seine Entscheidung damit, dass sie auswärts lebten und nur selten zu Besuch kämen; er habe sich nicht darauf verlassen können, dass sie ihn im Alter betreuen würden, also habe er selbst Vorsorge treffen müssen. Er machte auch noch ein paar abfällige Bemerkungen über den Lebenswandel seiner Tochter. Ich hielt es allerdings für angebracht, darauf hinzuweisen, dass seine Kinder nicht gänzlich leer ausgehen würden. Sie erben eine kleine Lebensversicherung, sein Mobiliar, sämtliche persönlichen Gegenstände und sein Fahrzeug. Rechtlich sind die Vereinbarungen absolut wasserdicht, und auch die Gutachter waren überzeugt, dass Monsieur Driant wusste, was er tat. Jeder von ihnen hat das Testament mit unterzeichnet.«
»Wann war das?«, fragte Bruno, dem es schien, als habe Sarrail jedes seiner Worte einstudiert.
»Vor zwölf Tagen.«
»Also unmittelbar vor seinem Tod«, sagte Bruno und legte eine Pause ein, als dächte er nach. »Ist das neue Testament ordnungsgemäß registriert worden?«
»Ja, allerdings erst ein paar Tage später. Das Treffen mit den Gutachtern war an einem Freitagnachmittag. Deshalb konnte ich das Testament erst am Montag beim Zentralregister einreichen. Registriert wurde es dann tags darauf.«
»Wie haben Sie von Driants Tod erfahren?«
»Aus der Sud Ouest. Ich habe sofort einen Brief zu Händen seines Sohnes an das Bestattungsunternehmen in Saint-Denis geschrieben, wo, wie in der Zeitung stand, der Leichnam aufgebahrt war. Worüber genau beschwert sich der Sohn eigentlich? Ich kann mir durchaus vorstellen, dass ihm das neue Testament nicht gefällt, aber das ist nicht ungewöhnlich bei Angehörigen.«
»Waren Sie schon einmal auf Driants Hof? In unserer Gegend ist es üblich, dass ein notaire, der ein Testament aufsetzt, sich von den Eigentumsverhältnissen ein Bild macht.«
»Nein, ich war nicht dort, zumal der Hof nicht Teil des Testaments ist. Er wurde schon dem neuen Eigentümer, der Versicherungsgesellschaft, übertragen. Wie gesagt, die beweglichen Güter sind Erbteil der Kinder und wurden, wenn ich richtig informiert bin, von ihnen bereits abgeholt.«
»Was soll aus den Tieren werden?«, fragte Bruno. »Es handelt sich um mehr als hundert Schafe, fast genauso viele Lämmer und einen alten Bock, ganz zu schweigen von den Enten, Hühnern und Hunden. Wenn sich keiner um sie kümmert, wird es Ärger geben.«
Es entstand eine längere Pause, und Bruno sah, dass der notaire konzentriert nachdachte. Er kritzelte ein paar Notizen auf den Block und antwortete dann: »Auch dafür ist wohl der neue Eigentümer zuständig. Ich werde mich trotzdem darum kümmern und sicherstellen, dass es eine zeitnahe Lösung für die Tiere gibt. Gut, dass Sie mich darauf aufmerksam gemacht haben. Gibt es sonst noch etwas?«
Überzeugt davon, dass dem notaire die Schafe herzlich egal waren, verlangte Bruno nach dem Namen und der Adresse des neuen Eigentümers. Sarrail verwies ihn an den Versicherungsvertreter, der, wie Bruno schon wusste, sein Büro im selben Gebäude hatte.
»Würden Sie mir auch bitte den Namen der jungen Frau nennen, die Monsieur Driant im Auftrag der Versicherung im April besucht hat?«, hakte Bruno nach.
»Ich weiß nicht, von wem Sie sprechen, aber vielleicht kann Ihnen der Versicherungsvertreter Auskunft geben«, erwiderte Sarrail kurz angebunden.
»Gaston hat seinen Vater das letzte Mal vor ein paar Wochen gesehen. Zu dem Zeitpunkt hatte der Alte noch vorgehabt, so lange wie möglich auf seiner ferme zu bleiben und dann, wenn es unumgänglich wäre, ins Altersheim nach Saint-Denis zu gehen, wo er Freunde hat«, sagte Bruno. »Für Gaston ist unerklärlich, warum sich sein Vater plötzlich für die viel teurere Residenz entschieden haben soll.«
»Verstehe«, sagte Sarrail. »Gründe könnte es viele geben, unabhängig davon, dass sich Monsieur Driant bitter über seine Kinder beklagt hat. Da er, gutachterlich testiert, bei klarem Verstand war, habe ich als sein notaire es nicht als meine Aufgabe angesehen, die Wünsche meines Mandanten in Frage zu stellen. An Monsieur Driants Zurechnungsfähigkeit gab es nicht den geringsten Zweifel. Wenn Sie mit einem oder allen Gutachtern sprechen wollen, gebe ich Ihnen gern Namen und Telefonnummern. Eine Kopie des Gutachtens können Sie auch haben. War das alles?«
»Stehen Sie in Kontakt mit diesem Versicherungsagenten?«, fragte Bruno. »Oder hat sein Büro nur zufällig dieselbe Adresse wie Ihre Kanzlei?«
»Monsieur Constant und ich arbeiten manchmal zusammen, wenn ein Mandant in Versicherungsangelegenheiten beraten werden möchte«, antwortete Sarrail vorsichtig. »Wie darf ich Ihre Frage verstehen?«
»Vielleicht teilen Sie ihm mit, dass die mutwillige Vernachlässigung von Lebendvieh strafbar ist. Ich war auf dem Hof und musste sehen, dass die Tiere ohne Futter und Trinkwasser sind. Da sie und die ferme aus öffentlicher Hand subventioniert werden, könnte der Fall rechtlich ernste Folgen nach sich ziehen.«
»Verstehe. Ich werde Monsieur Constant davon in Kenntnis setzen, sobald er von seiner Geschäftsreise zurückkommt. Das, was Sie sagen, ist natürlich nur für sein Unternehmen von Belang, nicht für ihn persönlich und jenseits seiner Zuständigkeit. Haben Sie einen Vorschlag, den ich ihm unterbreiten könnte? Sie haben ja offenbar Erfahrung in Sachen Landwirtschaft und wissen mit Sicherheit mehr darüber als ich.«
Sarrail zog die Kappe von seinem Füllfederhalter und ließ diesen über seinen Notizblock schweben.
Der neue Eigentümer, erklärte Bruno, habe die Möglichkeit, die Tiere entweder zu verkaufen – die dafür in Frage kommenden Märkte seien in der Präfektur aufgelistet – oder zum Schlachthof zu bringen. Zuvor aber müsse er für jedes Tier die nötigen Papiere beibringen und die Genehmigung der zuständigen Behörde einholen. Deren Adresse sei ebenfalls in der Präfektur zu erfahren.
»Das Verbot der Vernachlässigung und Misshandlung von Tieren gilt ebenso für Hütehunde, Enten und Hühner«, führte Bruno weiter aus. »Ob diese noch nach den neuen Bestimmungen für Bergbauernbetriebe subventioniert werden, weiß ich nicht.«
Sarrail notierte nur und sagte nichts.
»Haben Sie Driants Verkauf des Hofes an die Versicherungsgesellschaft notariell beglaubigt?«, wollte Bruno wissen, dem Sarrails Vernehmung immer besser gefiel. »Wenn ja, werden Sie gewiss alle erforderlichen Papiere bezüglich des Viehbestands den zuständigen Behörden, einschließlich des Landwirtschaftsministeriums und der EU-Agrarkommission, übermittelt haben. Und natürlich werden Sie auch sichergestellt haben, dass der neue Eigentümer als Besitzer subventionierten Viehs, dessen Fleisch in den Lebensmittelhandel gelangen könnte, die erforderliche Lizenz erworben hat.«
»Verstehe«, sagte Sarrail, ging aber auf Brunos Frage zum Kaufvertrag nicht ein. »Ich gebe das an Monsieur Constant weiter. Ich bin überzeugt davon, dass Monsieur Driant alle Formalitäten beachtet hat, aber womöglich nicht mehr dazu gekommen ist, die entsprechenden Nachweise zu führen.«
»Ihnen ist hoffentlich klar, Monsieur, dass Verstöße gegen die geltenden Bestimmungen den Verkauf insgesamt in Frage stellen, ganz abgesehen von der rechtlichen Verpflichtung, sich um den Viehbestand zu kümmern. Selbstverständlich werde ich mich noch persönlich mit Monsieur Constant in Verbindung zu setzen versuchen, verlasse mich aber vorläufig darauf, dass Sie ihm die Ernsthaftigkeit der drohenden Konsequenzen klarmachen. Bitten Sie ihn, mich sobald wie möglich anzurufen. Ich wünsche Ihnen noch einen guten Tag, Monsieur Sarrail. Übrigens, herzlich willkommen im Périgord.«
Bruno stand auf und ging. Er versuchte, ein Grinsen zu unterdrücken bei dem Gedanken an hochnäsige Großstädter, die noch lernen mussten, dass auch Tiere Rechte hatten. Gleich neben der Kanzlei lag das Büro des Versicherungsagenten. Die Tür war verschlossen, und auf sein Klopfen meldete sich niemand. Er schrieb eine kurze Notiz auf eine seiner Visitenkarten und forderte Monsieur Constant darin auf, Kontakt zu ihm aufzunehmen. Die Karte schob er unter den Türschlitz.
Zum ersten Mal schöpfte er Hoffnung für Gaston und seine Schwester. Er setzte sich in seinen Transporter und rief seinen Freund Maurice an, der im Veterinäramt der Unterpräfektur von Sarlat zuständig für den Tierschutz war. Er fragte ihn, ob er darüber informiert worden sei, dass Driant seinen Hof verkauft hatte. Nein, antwortete dieser irritiert, weil er eigentlich hätte Bescheid wissen müssen. Bruno übertrieb ein wenig, als er Maurice zu verstehen gab, dass Driants Schafe womöglich verdurstet wären, hätten er, Bruno, und der alte Guillaumat sich nicht um sie gekümmert. Er erzählte Maurice die ganze Geschichte und verabredete sich mit ihm für acht Uhr am nächsten Morgen auf dem Hof.
Daraufhin rief er seine Freundin Annette, eine junge Staatsanwältin aus Sarlat, an und bat sie, den Versicherungsagenten Monsieur Constant unter dem Verdacht der Misshandlung von Lebendvieh vorzuladen. Er selbst werde als Zeuge aussagen.
3
Bruno kehrte zurück in sein Büro und fand eine Nachricht von Brosseil vor mit der Bitte um Rückruf. Er wählte die angegebene Nummer und erfuhr, dass Brosseil soeben von einem Kollegen gehört hatte, dass eines der bekannteren kleinen Châteaus der Region zum Verkauf stehe; als Makler fungiere eine ultraschicke Agentur aus Paris, die vor allem auf Kunsthandel spezialisiert war. Bruno bedankte sich für den Hinweis, lehnte sich in seinem Schreibtischstuhl zurück und schaute durchs Fenster über die alte Vézère-Brücke hinweg auf den Felsrücken, der das Tal im Norden flankierte. Das Château lag am anderen Ende dieser Erhebung, ungefähr fünf Kilometer von Saint-Denis entfernt. Bruno kam manchmal daran vorbei, wenn er mit seinem Pferd ausritt.
Das Anwesen war bekannt als Château Rock, seit es vor etlichen Jahren von dem bekannten Rockmusiker Rod Macrae gekauft worden war, der dort angeblich eine wilde Drogenparty nach der anderen mit schillernden Sternchen und Groupies steigen ließ. Die älteren Leute aus der Region gaben sich empört, die jüngeren fanden es aufregend, weil in Saint-Denis endlich etwas los war. Nicht einmal das Auftauchen einer hochschwangeren Madame Macrae und des biederen Volvo-Kombi, den die Eheleute fuhren, konnte die Phantasien der Nachbarn dämpfen oder die Teenager des Städtchens davon abhalten, heimlich durch das Unterholz zu kriechen, um dem Rockstar aufzulauern. Als Bruno vor über zehn Jahren in Saint-Denis ankam, hatte sich die allgemeine Aufregung allerdings längst gelegt. Inzwischen war man allenthalben froh darüber, eine Berühmtheit zum Nachbarn zu haben, der dem alten Château zu neuem Glanz verhalf.
Umso mehr wunderte es Bruno nun, dass ihm von Macraes Verkaufsabsichten bislang noch nichts zu Ohren gekommen war, ja er konnte kaum glauben, dass die Familie ihn in eine solch wichtige Angelegenheit nicht eingeweiht hatte. Schließlich war er regelmäßig Gast im Château Rock, unter anderem zum Geburtstag der Kinder von Rod und Meghan, die beide am selben Tag, wenn auch drei Jahre auseinander zur Welt gekommen waren. Bruno kannte sie gut, denn sie hatten jahrelang an den Tenniskursen teilgenommen, die er Kindern und Jugendlichen anbot.
Jamie und Kirsty waren in Saint-Denis in die Grundschule gegangen, hatten von dort auf das collège der Stadt gewechselt und waren im Alter von fünfzehn Jahren in ein Internat nach England geschickt worden. Jamie studierte inzwischen am Londoner Royal College of Music, während seine drei Jahre jüngere Schwester Kirsty darauf hoffte, im Herbst an der Edinburgh University ein Studium aufnehmen zu können. Ihren Vater kannte Bruno gut vom Rugbyverein. Rod war zwar nur selten als Zuschauer bei den Spielen, aber stets zugegen, wenn im Vereinshaus auf dem großen Bildschirm Spiele der Six Nations übertragen wurden. Wenn Schottland spielte, spendierte er immer eine Literflasche schottischen Whisky für alle. In Brunos Anfangszeiten hatte Macrae in seinem Studio im Château noch Aufnahmen gemacht und Bruno regelmäßig zu den Partys eingeladen, wenn ein neues Album fertiggestellt war. Aber das war jetzt Jahre her, und Bruno fragte sich, ob Macrae deshalb verkaufen wollte, weil er als Musiker nicht mehr so erfolgreich war. Spontan griff er zum Hörer, um ihn anzurufen. Es meldete sich Meghan, seine Frau.
»Ich habe gehört, dass Sie verkaufen wollen. Sie bleiben uns doch hoffentlich erhalten«, sagte er. »Wir würden Sie vermissen, wenn Sie unsere Gegend verlassen.«
»Ich gehe zurück nach Großbritannien«, antwortete sie. »Was Rod machen wird, weiß ich nicht. Er hat noch keinen Plan. Aber jetzt, da die Kinder außer Haus sind, ist uns das Anwesen zu groß. Wir lassen uns scheiden. Noch kann ich ein neues Leben anfangen. Den letzten Sommer werden wir aber en famille noch hier verbringen.«
»Tut mir leid, das zu hören«, erwiderte Bruno. »Ich hatte gehofft, Jamie und Kirsty würden eines Tages zurückkommen und hier ihre eigenen Familien gründen.«
»Vielleicht tun sie das auch, aber bestimmt nicht im Château Rock. Doch wie gesagt, diesen Sommer werden sie noch hier sein. Jamie wird ein paar Konzerte im Rahmen von Musique du Périgord Noir geben. Und in Rods Studio seine erste CD einspielen. Rod spricht schon davon, dass sein Studio in den letzten Zügen liegt.«
»Dann gehen Sie also nicht im Groll auseinander.«
»Nein, wir werden Freunde bleiben. Das hoffe ich zumindest. Ich mag ihn immer noch sehr, habe aber einfach zu jung geheiratet, Bruno. Rod geht auf die siebzig zu, ich erst auf die vierzig. Ich habe einfach keine Lust, den Rest meines Lebens als seine unbezahlte Krankenschwester zubringen zu müssen.«
»Gehen Sie zurück nach Schottland?«
»Rod vielleicht. Aber ich beginne im nächsten Januar eine Lehrerausbildung an einer Hochschule außerhalb von London. Ich habe doch dieses Fernstudium in Französisch und Spanisch absolviert. In nur einem Jahr könnte ich mich zur Lehrerin qualifizieren. Darauf freue ich mich schon. Wohin ich dann gehe, steht noch nicht fest. Meine Schwester wohnt in Manchester, vielleicht ziehe ich zu ihr.«
Bruno wünschte ihr Glück. Er hatte für Meghan immer viel übriggehabt, auch schon bevor sie sich bereit erklärt hatte, am örtlichen collège Kurse für englische Konversation anzubieten.
»Grüßen Sie bitte Rod von mir. Vielleicht komme ich morgen vorbei, um hallo zu sagen. Sind Jamie und Kirsty schon zurück? Die beiden würde ich auch gern sehen.«
»Kirsty kommt morgen Nachmittag mit dem Flieger, Jamie mit dem Zug aus Paris, zusammen mit ein paar Musikerfreunden. Aber das wird wohl erst in den nächsten Tagen sein. Er hat sich noch nicht festgelegt. Sie sind jederzeit bei uns willkommen, Bruno.«
Als Bruno dem Bürgermeister die Neuigkeit erzählte, bedauerte dieser als gewiefter Lokalpolitiker vor allem, dass kein hiesiger Makler beauftragt worden war.
»Wäre doch besser, solche Angelegenheiten innerhalb der Gemeinde zu regeln«, sagte Mangin. »Kenntnisse aus erster Hand sind wichtig, wie Sie wissen, Bruno. Und es stört mich einfach, dass die Courtage, die bestimmt nicht klein ausfallen wird, an ein Maklerbüro in Paris geht. Wissen Sie, wie viel das Château einbringen soll?«
»Noch nicht«, antwortete Bruno. »Das erfahre ich vielleicht morgen. Ich mache mir vor allem Sorgen um den Weinberg. Wäre jammerschade, wenn uns der verlorengeht.«
Macrae hatte mit seinem Anwesen einen fast fünf Hektar großen Weinberg erworben, der allerdings völlig verwahrlost war. Trotzdem hatte er anfangs davon geträumt, unter dem Namen »Château Rock« seinen eigenen Wein zu keltern. Nach mehreren frustrierenden Jahren, in denen er es mit Teilzeitwinzern probierte, hatte er seinen Weinberg der städtischen Kooperative zur Verfügung gestellt, unter der Bedingung, dass die Erträge geteilt würden. Julien, der die Kooperative führte, und Hubert von der florierenden Weinhandlung der Stadt waren von der Abmachung begeistert gewesen. Sie rechneten damit, mindestens fünfzehn- bis zwanzigtausend Flaschen im Jahr aus Macraes Trauben gewinnen zu können. Macrae sollte dafür fünftausend Euro bekommen und für seinen Eigenbedarf so viele Flaschen, wie er wollte.
»Wenn ich mich recht erinnere, haben wir damals mit Macrae einen bail agricole ausgehandelt«, sagte der Bürgermeister. »Der neue Eigentümer muss damit einverstanden sein oder uns auszahlen.«
Saint-Denis war offiziell eine bäuerliche Gemeinde, was den ansässigen Landwirten besondere Rechte gab. Zum Beispiel durften alle Bewohner außerhalb der zone urbaine Hühner und Gänse, Ziegen und Pferde halten. Neuzugezogene waren manchmal überrascht, gelegentlich sogar verärgert darüber, dass sie keine rechtliche Handhabe gegen Besitzer von Hähnen hatten, deren lautes Krähen in den frühen Morgenstunden sie aus dem Schlaf riss, oder von Eseln, die in der Paarungszeit von morgens bis abends kreischten. Mehr als einmal war es vorgekommen, dass einem neuen Mitbürger, der sich im Umgang mit der Landbevölkerung als wenig nachbarschaftlich erwiesen hatte, mitten in der Nacht eine Schar schnatternder Gänse vor dem Schlafzimmerfenster vorbeigetrieben worden war.
In bäuerlichen Gemeinden konnte man auch einen sogenannten bail agricole erwirken, ein besonderes Pachtverhältnis mit einer Laufzeit von neun Jahren, das automatisch um weitere neun Jahre verlängert wurde, wenn nicht achtzehn Monate vor Ablauf der Frist eine formelle Kündigung erfolgte. Ein solcher Landpachtvertrag war auch dann gültig, wenn er nur mit Handschlag besiegelt wurde; notariell beglaubigt werden musste er nur, wenn die Vertragsdauer zwanzig Jahre überschritt.
»Ein Pariser notaire wird womöglich nicht wissen, wie der Hase bei uns läuft«, murmelte Mangin nachdenklich. »Wann wurde unser Vertrag noch mal verlängert?«
»Vor zwei Jahren im November, gleich nach der vendange, als wir unser städtisches Weinprojekt gestartet haben«, antwortete Bruno. »Er wurde mündlich geschlossen. Wir beide waren Zeugen, als sich Macrae und Julien die Hand gegeben haben.«
»Auch wenn sich Macrae nie auf einer Sitzung hat blicken lassen, gehört er nach wie vor zum Vorstand«, fügte der Bürgermeister hinzu und rieb sich das Kinn, wie immer, wenn er konzentriert nachdachte. »Er unterschreibt auch immer den jährlichen Rechenschaftsbericht, das heißt, er wird den bail agricole nicht vergessen haben.«
»Ich glaube, er ist nur in den Vorstand gekommen, weil Kirsty so gern im Weinberg arbeitet«, sagte Bruno. Er fragte sich, worauf Mangin hinauswollte. Ein Großteil von Brunos Ersparnissen steckte in der städtischen Kooperative, die ein halbes Dutzend Mitbürger in Vollzeit beschäftigte und jedes Jahr einen bescheidenen Gewinn erwirtschaftete. Bald würde der Kredit getilgt sein, den der Bürgermeister aufgenommen hatte, um Juliens insolvent gewordenen Betrieb zu kaufen.
»Kirsty war in all ihren Ferien im Weinberg. Sie hat im Winter beim Rückschnitt geholfen, im Frühling beim Ausgeizen und im September bei der Lese«, fuhr Bruno fort. »Julien hat ihr sogar einen Job angeboten, aber ihr Vater hat darauf bestanden, dass sie die Schule zu Ende macht. Diesen Herbst fängt sie in Edinburgh an zu studieren. Ich vermute, sie wird zur Lese nicht hier sein.«
Mangin winkte ab.
»Wir werden dafür sorgen müssen, dass unsere Pachtzinse in Rechnung gestellt werden für den Fall, dass es zum Verkauf kommt«, sagte er und setzte eine unschuldige Miene auf, die Bruno nur allzu gut kannte. Der Bürgermeister führte offenbar etwas im Schilde. »Wir haben die Pflicht, die Interessen unserer Kooperative zu vertreten. Schließlich hat die Stadt viel investiert und damit zur Wertsteigerung des Weinbergs beigetragen: die toten Stöcke gerodet, neue Reben gepflanzt und Personal ausgebildet. Bevor wir ihn übernahmen, war er ein einziges Gestrüpp. Und jetzt steigert er den Wert des Anwesens beträchtlich.«
Bruno nickte. »Nicht zu vergessen, dass wir die Umstellung auf den biologischen Anbau geschafft haben«, sagte er und grinste, weil Mangin förmlich anzusehen war, in welche Richtung er dachte.
»Allerdings. Der neue Eigentümer wird die ökologische Vorreiterrolle des städtischen Weinbergs anerkennen müssen«, erwiderte der Bürgermeister. »Wenn er eine solche Verantwortung nicht selbst tragen will, wird es das Beste für ihn sein, sich gütlich mit uns zu einigen und den Weinberg gänzlich an uns abzutreten.«
Mangin lächelte. Bruno verstand auch ohne viele Worte, was ein erfahrener Bürgermeister wie Mangin ins Feld führen konnte, um sicherzustellen, dass ein von der Stadt gepachteter Weinberg in öffentlicher Hand blieb oder, besser noch, in deren Besitz überführt wurde.
»Es kommt wohl letztlich darauf an, wer Château Rock kauft«, sagte Bruno. »Ich schätze, es wird wieder jemand aus dem Ausland sein. In dem Fall sollten wir ihn oder sie herzlich willkommen heißen und verständlich machen, dass es im beiderseitigen Interesse wäre, wenn es zu einer dauerhaften, erfolgreichen Partnerschaft käme. Aber wir haben ja noch Zeit. Zum Verkauf kommt es frühestens im Oktober, denn die Macraes wollen noch den ganzen Sommer gemeinsam im Château verbringen.«
»Prima«, sagte der Bürgermeister. »Die Sache bleibt vorläufig unter uns. Sie könnten aber noch Hubert und Julien ins Vertrauen ziehen. Wenn an dem Weinberg noch Verbesserungen gemacht werden müssen, wäre jetzt die Zeit dafür.«