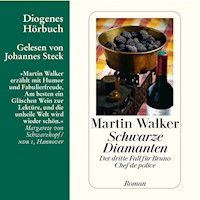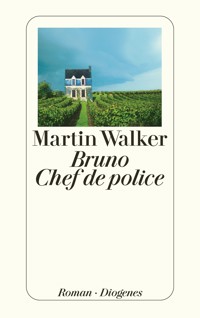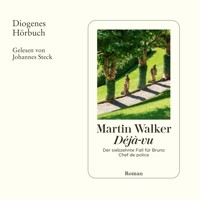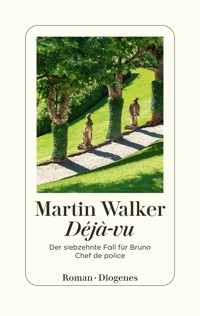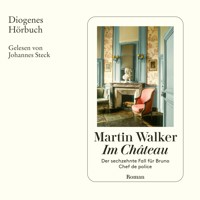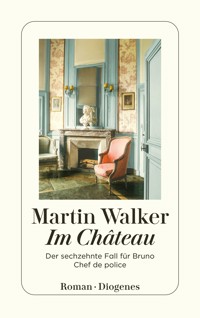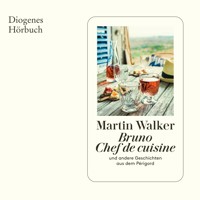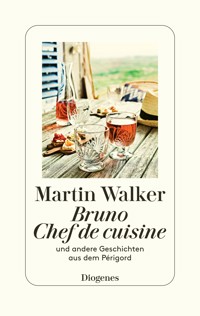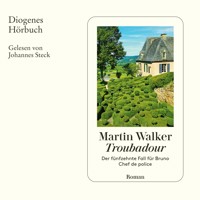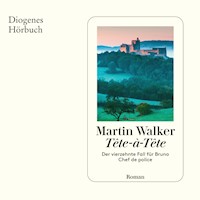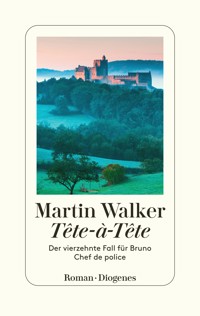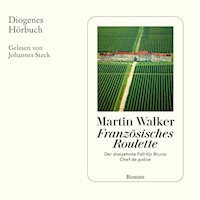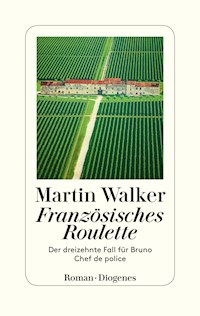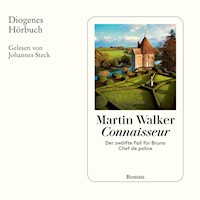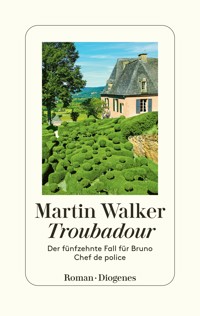
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Bruno, Chef de police
- Sprache: Deutsch
Bruno steckt mitten in den Vorbereitungen für das alljährliche Konzert in Saint-Denis – die Folkband Les Troubadours soll auftreten, die mit ihrem neuesten Hit ›A Song for Catalonia‹ gerade in Spanien für Zündstoff sorgt. Hinweise auf einen geplanten Mordanschlag werden laut. Doch Bruno hat auch anderweitig alle Hände voll zu tun: Er ist zuständig für das Buffet eines Tennisturniers, ein Wildschwein wird über offenem Feuer gebraten, es wird gefeiert und geschlemmt – aber ist es Zufall, dass plötzlich vier junge Tennisasse aus Katalonien so viele Spiele für sich entscheiden?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 442
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Martin Walker
Troubadour
Der fünfzehnte Fall für Bruno, Chef de police
Roman
Aus dem Englischen von Michael Windgassen
Diogenes
Meinen Kolleginnen und Kollegen in der SHAP,
der Société Historique et Archéologique du Périgord,
mit Dankbarkeit und großem Respekt
Mai no esborraran tots els nostres poemes.
Mai van a silenciar les nostres cançons.
Mai poden eradicar tota una cultura,
Els nostres somnis de trobador son massa forts.
Un poble que canta es un poble que viu
I un poble viu mai morr.
Sie werden unsere Poesie niemals zerstören.
Sie werden unsere Lieder niemals zum Schweigen bringen.
Sie können unsere Kultur niemals wegwischen,
Zu stark sind die Träume unserer Troubadoure.
Ein Volk, das singt, ist ein Volk, das lebt,
Und ein Volk, das lebt, kann nicht sterben.
1
Bruno Courrèges, Chef de police der kleinen französischen Ortschaft Saint-Denis und eines Großteils des Vézère-Tals, schaute spätabends mit seinem Basset Balzac noch einmal in seinem Garten nach dem Rechten, als das Handy an seinem Gürtel vibrierte. Er wollte eigentlich direkt danach zu Bett gehen, doch das Display zeigte an, dass es sein Freund Jean-Jacques, der Chef der Kriminalpolizei des Départements Dordogne, war, und Bruno hielt es für besser, den Anruf anzunehmen.
»Du bist noch wach?«, meldete sich die vertraute Stimme. »Gut. Ich bin gleich bei dir. Ich möchte dir etwas zeigen, und du verrätst mir, ob ich mir Sorgen machen muss.«
Commissaire Jean-Jacques Jalipeau war ein stämmiger Bär von Mann, unermüdlich, und ließ sich nie von seinen Pflichten ablenken, noch nicht einmal damals, als auf ihn geschossen worden war, während er versuchte, einen Straftäter festzunehmen. Manche nannten ihn einen »flic der alten Schule«, womit wohl unter anderem gemeint war, dass er schlecht sitzende Anzüge trug, ein Päckchen Gauloises am Tag rauchte, selten seine Schuhe putzte und Journalisten weniger Achtung zollte, als diese mittlerweile erwarteten. Andererseits waren noch nie irgendwelche Übeltäter in Handschellen »zufällig« die Treppe hinuntergestürzt oder mit den Fingern in eine zuschlagende Autotür geraten. Kein einziges Mal hatte sich eine Frau aus seinem Team um eine Versetzung bemüht, und er weigerte sich, an den üblichen Revierkämpfen mit Gendarmen teilzunehmen oder über die Police municipale zu spotten.
Bruno ging ins Haus und räumte das Wohnzimmer auf. Er holte zwei Gläser aus dem Schrank und scrollte auf seinem Handy durch die jüngsten Regionalnachrichten, um eventuell einen Hinweis auf Jean-Jacques’ unerwarteten Besuch zu finden. Ein paar Minuten später flammten die Scheinwerfer des großen Peugeot in der Zufahrt auf, und Bruno trat vor die Tür, um seinen Freund zu begrüßen. Josette, Jean-Jacques’ Chauffeurin und rechte Hand, wendete im Hof und sprang aus dem Wagen. Jean-Jacques brauchte länger, um sich vom Beifahrersitz zu mühen. Er hielt einen kleinen Spurensicherungsbeutel in der Hand.
»Willkommen. Für eine Tasse Kaffee ist es jetzt wohl zu spät«, sagte Bruno. »Wie wär’s mit Tee, Wein oder etwas Stärkerem?«
»Mir könntest du ein Glas von deinem selbst gemachten vin de noix einschenken, gewissermaßen Wein und eau de vie in einem«, antwortete Jean-Jacques. Josette bat um Mineralwasser.
Kaum hatten sie sich mit ihren Drinks im Wohnzimmer niedergelassen, warf Jean-Jacques Bruno den Plastikbeutel zu.
»Du bist doch ein alter Soldat und trägst das Croix de Guerre«, begann er in seiner typisch abrupten Art. »Was kannst du mir zu dieser Patrone sagen, abgesehen davon, dass sie vom Kaliber 12,7 × 108 Millimeter ist und am Patronenboden anscheinend russische Buchstaben eingraviert sind?«
Bruno hatte es tatsächlich geschafft, die Tüte aufzufangen, ohne seinen Drink zu verschütten. So sehr wie Jean-Jacques’ Frage überraschte ihn dessen Zuversicht, dass er, Bruno, über alles Auskunft geben konnte, was mit Krieg, Waffen und militärischen Dingen im Allgemeinen zu tun hatte. Dann fiel ihm wieder ein, dass die Pflicht zu einem Jahr Militärdienst schon lange abgeschafft worden war. Auch Jean-Jacques, der nach einem Universitätsstudium den Polizeidienst angetreten hatte, waren solche Themen erspart geblieben. Von der Tradition aus der Französischen Revolution, der zufolge jeder französische Bürger sich als Soldat ausbilden lassen und bereit sein musste, für Frankreich zu kämpfen, war nicht viel übrig geblieben. Bruno wusste, dass moderne Waffentechnik und Kriegsführung einem Soldaten sehr viel mehr abverlangten, als ein Gewehr abzufeuern, ihm ein Bajonett aufzupflanzen oder eine Handgranate zu werfen. Doch manchmal bedauerte er den Verlust des Prinzips, nach dem jeder Bürger seinem Land eine Pflicht schuldig sei, und er fand es auch schade, dass der Sinn für Gleichheit und nationale Integration, der junge Männer beim Drill, in Kantinen und Kasernen zusammenschweißte, mehr oder weniger abhandengekommen war. Vermutlich, dachte Bruno, war er einer der wenigen Soldaten oder Veteranen, die Jean-Jacques überhaupt kannte.
»Das ist Munition für ein schweres Maschinengewehr sowjetischer Bauart. Sie wurde und wird zum Teil immer noch in der Luftabwehr eingesetzt, kann aber auch Körperpanzerung, Fahrzeuge und Gebäude durchschlagen«, erklärte Bruno und wog die Tüte mit der Patrone in der Hand. »Die Russen waren die Ersten, die sie auch an speziellen Scharfschützengewehren ausprobiert haben, mit Erfolg offenbar, denn es haben sich viele andere ein Beispiel daran genommen. Ein guter Scharfschütze kann mit einer solchen Patrone über eine Distanz von zwei Kilometern und mehr töten. Die Amerikaner haben eine ähnliche Patrone entwickelt, deren Hülse ist nur etwas kürzer.«
»Von so einem Ding bist du in Bosnien verletzt worden?«, fragte Jean-Jacques.
»Nein, dem Himmel sei Dank«, antwortete Bruno und wunderte sich wieder, wie wenig Jean-Jacques in Sachen militärischer Schusswaffen Bescheid wusste. »Ein solches Geschoss hätte mir das Bein und wahrscheinlich das halbe Becken weggerissen. Ich bin von einer Standardpatrone der NATO getroffen worden. Deren Kaliber ist nur etwa halb so groß. Aber auch die hat mich monatelang ans Krankenbett gefesselt. Verrate mir mal, woher du die Patrone hast.«
»Aus einem gestohlenen Auto, einem alten Peugeot, der nach einem Unfall verlassen aufgefunden wurde. Sie lag im Kasten für das Ersatzrad. Das Auto steckte im Graben neben einer kleinen Straße fest, die parallel zur N21 verläuft, nördlich von Castillonnès nahe Issigeac. Die Kennzeichen waren gefälscht. Wir versuchen jetzt, über die FIN mehr zu erfahren.«
»War ein anderes Fahrzeug in den Unfall verwickelt?«
»Nein, es ist mit einem Reh kollidiert und dann in den Graben gefahren, wobei es ein Vorderrad verloren hat. Das Reh ist tot. Vom Fahrer keine Spur. Wir glauben, dass es einen Beifahrer gab. Im Aschenbecher waren Stummel zwei verschiedener Zigarettensorten. Allerdings könnten die auch älter gewesen sein.«
»Ein professioneller Scharfschütze würde keine Kippen zurücklassen«, entgegnete Bruno. »War sonst noch was in dem Wagen zu finden?«
»Jedenfalls kein Gepäck und keine Papiere. Einer der Kollegen am Unfallort ist Jäger und behauptet, an einer alten Decke frisches Waffenöl gerochen zu haben. Es könnte also sein, dass der Besitzer der Patrone ein Gewehr bei sich im Wagen hatte. Und genau das macht mir Sorgen«, sagte Jean-Jacques. »Putain, du sagst, dass man mit einem solchen Ding über zwei Kilometer weit schießen kann?«
»So ist es, ja.« Bruno hatte gepanzerte Fahrzeuge gesehen, die von einigen wenigen dieser schweren Geschosse lahmgelegt worden waren. »Wer solche Munition mit sich führt, ist mit großer Sicherheit militärisch ausgebildet und verfügt auch über ein geeignetes Visier. Gewehre dieser Art werden normalerweise sorgfältig verwahrt, aber ich kann mir vorstellen, dass sie in Kriegsgebieten wie dem Irak, Afghanistan, der Ukraine oder Syrien – überall, wo sowjetische oder russische Waffen zum Einsatz kommen – im illegalen Waffenhandel auftauchen. Für solche Gewehre gibt’s garantiert einen Markt.«
»Du meinst, Terroristen könnten sich dafür interessieren?«, fragte Jean-Jacques.
»Natürlich. Aber auch für die Unterwelt haben solche Waffen einen Wert. Oder sie wandern für viel Geld an passionierte Großwildjäger von Elefanten und Büffeln. Nicht auszuschließen wäre auch die Möglichkeit eines geplanten Attentats. Wahrscheinlich solltest du besser die Leute von der Sicherheit informieren, vielleicht auch die Militärpolizei.«
»Kannst du Genaueres über die Waffe sagen, mit der diese Munition abgefeuert wird?«
»Infrage kommen verschiedene Gewehrmodelle«, antwortete Bruno. »Sie sind allesamt sehr schwer, mit massiver Schulterstütze und einem über einen Meter langen Lauf mit speziellem Dämpfer für das Mündungsfeuer, ohne den einem der Rückstoß die Schulter brechen könnte. Die meisten Scharfschützengewehre sind einschüssig mit Kammerverschluss und einem festen Zweibein zur Auflage. In Amerika werden solche Waffen von Barrett hergestellt; es gibt auch eine kanadische Firma, deren Namen ich aber vergessen habe. Kalaschnikow und Dragunow in Russland, Snipex in der Ukraine, Zastava in Serbien …«
»Putain, Bruno, woher weißt du das alles?«
»Ich interessiere mich halt dafür, spätestens seit ich angeschossen worden bin«, antwortete er. »Als ich im Militärhospital lag, hatte einer der Psychologen die Idee, einen unserer Scharfschützen einzuladen, um sich mit mir darüber zu unterhalten, wie man mich unter Beschuss genommen hatte. Das war eine gute Therapie. Ich habe aufgehört, um mich und meine Verletzung zu kreisen, und über den Scharfschützen nachgedacht wie über ein intellektuelles Problem.«
»Wenn ich richtig verstanden habe, gibt es diese Munition auch für Maschinengewehre.«
»Ja. Die klassische Luftabwehr bei den Sowjets bestand darin, feindliche Flugzeuge durch Raketenbeschuss in eine niedrige Flugbahn zu zwingen und sie dann mit dem Sperrfeuer aus Dutzenden von Maschinengewehren zu durchsieben. Die irakische Division Medina setzte sich so gegen einen Angriff von amerikanischen Apache-Kampfhubschraubern zur Wehr. Einer der wenigen Erfolge der Iraki in diesem Krieg. Die Vietcong schossen mit dieser Munition fünf US-Hubschrauber ab, und als der amerikanische Oberst einflog, um sich ein Bild zu machen, holten sie auch ihn auf den Boden. Wohlgemerkt, diese Waffen brauchen eine Stütze und können nicht wie ein Scharfschützengewehr im Stehen abgefeuert werden.«
»Danke, Bruno, ich halte dich auf dem Laufenden.« Jean-Jacques machte schon Anstalten aufzustehen, als Bruno ihn zurückhielt: »Bevor du gehst, muss ich dir noch etwas sagen«, fügte er schnell hinzu. »Scharfschützen arbeiten nie allein. Sie brauchen sogenannte Spotter, denn der Schütze kann es sich nicht erlauben, den Kopf zu heben und Ausschau zu halten. Er bleibt im Abseits und ruht vollkommen in sich. Zen. Ich habe ein paar von ihnen kennengelernt; sie sind echt speziell, irgendwie mystisch, fast entrückt. Im Einsatz sind sie ganz auf sich konzentriert, auf ihr Visier, ihre Waffe und ihre Spotter. Das Ziel ist völlig irrelevant.«
»Putain, Bruno, das klingt ja geradezu romantisch«, sagte Jean-Jacques nach einem Augenblick, wobei es ihm stimmlich nicht ganz gelang, seinem Ton einen scherzhaften Anstrich zu verleihen.
»Gut, du scheinst allmählich zu verstehen«, erwiderte Bruno. »Und dann noch zu den Visieren. Bei den Distanzen, von denen wir sprechen, müssen sie sehr leistungsfähig und für die entsprechende Waffe kalibriert sein.«
»Lassen die sich ohne Weiteres auftreiben?«
»Visiere für Jäger, ja. Aber für extreme Reichweiten braucht man eine Spezialoptik, die an die dreitausend Euro kostet. Dann hätten wir hier ein ernstes Problem, Jean-Jacques. Dann muss es sich um ein hochrangiges Ziel handeln, vielleicht jemand aus höchsten Regierungskreisen. Und wir müssen bedenken, dass Scharfschützen daran gewöhnt sind, ihren Job unter extrem riskanten Bedingungen auszuüben. Wenn wir sie nicht erwischen, bevor sie auf ihr Ziel anlegen und abdrücken, haben wir versagt. Es ist alles andere als einfach, einen Verdächtigen in zwei oder drei Kilometern Entfernung ausfindig zu machen, bevor es zum Äußersten kommt.«
»Genau solche Dinge muss ich wissen, danke«, sagte Jean-Jacques. Er leerte sein Glas, erhob sich und führte Josette zur Tür. »Danke auch für den Drink und deine Ausführungen. Wir sprechen uns morgen wieder.«
Bruno stand unter dem sternenbedeckten Himmel in seinem Garten, Balzac saß geduldig an seiner Seite, und beide sahen der großen sich entfernenden Limousine hinterher. Bruno gingen die Unterschiede zwischen sich und seinem Freund durch den Kopf. Er war beim Militär gewesen, Jean-Jacques nicht, aber in dieser Hinsicht war er, Bruno, ohnehin anders als die meisten Vertreter seiner Generation, ganz zu schweigen von den jüngeren Franzosen. Bruno konnte den Idealismus hinter der Vorstellung, dass das neue Europa aus der Notwendigkeit, Kriege zu führen, herausgewachsen war, vollkommen nachvollziehen. Doch die helle, friedliche neue Welt, die auf den Kalten Krieg gefolgt war, hatte sich verändert und manche der alten Ängste wieder aufkeimen lassen. Ursache dafür waren nicht nur die neuen Herausforderungen, die der internationale Terrorismus mit sich brachte, sondern auch die alten, traditionellen Kräfte nationaler Ambitionen. Konnte Europa noch darauf hoffen, seinen gemächlichen, pazifistischen Weg weiterzuverfolgen, wenn Russland seine militärischen Muskeln spielen ließ und neue Technologien einsetzte, um im Westen Wahlen zu beeinflussen und die sozialen Medien zu vergiften, oder Nervengas zum Einsatz brachte, um Abweichler in England zu töten?
Bruno dachte auch an China, das zur Supermacht aufgestiegen war, seine Macht in Hongkong und Xinjiang rundheraus behauptete, und an ein Amerika, das sich mehr auf nationale Herausforderungen fokussierte als auf eine Weltfriedensordnung, für die es sich seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs eingesetzt hatte. Konnte dieser große und dauerhafte Frieden erhalten werden, oder würden sich zukünftige Generationen von Franzosen, Deutschen, Briten und anderen wappnen und mobilisieren müssen, um sich gegen feindliche Bedrohungen zu schützen? War die Welt, wie wir sie kennen, in Gefahr?
2
Obwohl Bruno inzwischen auch für einen Großteil des Vézère-Tals zuständig war, verstand er sich immer noch in erster Linie als Chef de police der kleinen Ortschaft Saint-Denis. Er hatte deshalb vor Kurzem die Strecke seiner allmorgendlichen Laufrunde geändert und so gewählt, dass er unterwegs nicht nur seine Stadt sehen konnte, sondern auch einen weiten Abschnitt des Flusses und die großen Klippen, die sich bis nach Les Eyzies und darüber hinaus erstreckten. Sein Amtsbezirk reichte nun bis nach Montignac mit dem neuen Museum für die prähistorischen Höhlenmalereien von Lascaux.
Er begann seine Runde auf dem Pfad durch den Wald vor seinem Haus, bog dann ab und folgte dem weiten Bergrücken, von dem sich wunderschöne Ausblicke boten. Als die Sonne hinter dem Horizont aufstieg, erreichte er den Aussichtspunkt, den er besonders gernhatte. Dort wartete er, bis Balzac zu ihm aufgeschlossen hatte. Das Tal war noch in Nebel gehüllt. Nur der Kirchturm von Saint-Denis ragte daraus hervor und schien in der stillen Luft zu schweben. Die schräg über die Hänge einfallenden Sonnenstrahlen ließen schon die Bögen der alten steinernen Brücke erkennen, und allmählich löste sich der Nebel auf. Bruno legte sich ins Gras, aus dem der feine Tau unter den ersten Sonnenstrahlen verdampfte. Mit flappenden Ohren kam sein Hund herbeigelaufen, kletterte auf seine Brust und leckte ihm überschwänglich Hals und Wange.
Bruno drückte ihn kurz an sich, stand dann auf und machte sich im gemächlichen Laufschritt auf den Rückweg, sodass Balzac ihm folgen konnte. Als die Trüffeleichen am Rand seines Gartens in Sicht kamen, legte er die letzten zweihundert Meter wie immer im Sprint zurück. Im Hof angekommen, schaute er sich nach Balzac um, der sein Bestes gab, um möglichst schnell zur Stelle zu sein. Bruno ging in die Hocke, kraulte die langen, weichen Hundeohren und machte sich dann daran, seine Hühner zu füttern und deren Tränke aufzufüllen. Als er damit fertig war, ging er ins Haus und ließ für Balzac die Küchentür offen. Er setzte den Wasserkessel auf, schaltete das Radio ein und zog seine Joggingsachen aus, um zu duschen. Balzac schlabberte Wasser aus seinem Napf, als Bruno frisch rasiert in seiner Sommeruniform wieder in die Küche kam, um dort die Reste des Baguettes von gestern zu toasten, zwei Eier zu pochieren und Kaffee zu machen.
Auf seinem Handy sah er nach, ob Nachrichten eingegangen waren. Jean-Jacques teilte ihm mit, dass der alte Peugeot anhand seiner FIN identifiziert werden konnte. Er gehörte einem spanischen Touristen, der den Wagen zwei Tage zuvor aus einem Parkhaus in Bayonne als gestohlen gemeldet hatte. Moderne Fahrzeuge waren weniger leicht zu knacken, jedenfalls für Amateure. Bruno zuckte mit den Achseln und widmete sich wieder seinem Frühstück. Jean-Jacques würde sicher anrufen, wenn es Neuigkeiten gab.
Für die Eier stellte Bruno zwei kleine Töpfe auf den Herd, weil er etwas ausprobieren wollte. Er füllte beide bis zur Hälfte mit Wasser und gab dem einen Topf einen Teelöffel Apfelessig hinzu, dem anderen die gleiche Menge Estragonessig. Die Sieben-Uhr-Nachrichten von France Bleu Périgord waren unspektakulär, und Bruno achtete kaum darauf, als er die pochierten Eier aß und versuchte, einen geschmacklichen Unterschied festzustellen. Das Ei mit der Estragonnote fand er ein klein wenig interessanter. In der letzten Nachrichtenmeldung war davon die Rede, dass die spanische Regierung einen Song von Folkmusikern aus dem Périgord auf den Index gesetzt hatte. Die Band namens Les Troubadours kannte Bruno gut.
Auf den Index gesetzt? Er warf einen Blick auf das Radio. Die Sprecherin erklärte, dass die Unabhängigkeitsbestrebungen der Katalanen nach wie vor heftige Reaktionen aus Madrid provozierten. Einige katalanische Regierungsvertreter saßen in Haft, andere waren außer Landes geflohen. Harsche Gerichtsurteile hatten Massenproteste und einen Generalstreik hervorgerufen. Zwar hatte sich die Lage ein wenig beruhigt, aber von Entspannung konnte keine Rede sein. Die EU hatte klargemacht, dass sie ein unabhängiges Katalonien nicht anerkennen würde, doch die Frage, ob sich eine Region das Recht auf Souveränität herausnehmen durfte, war ungelöst. Jedenfalls war der konfliktträchtige Song für Katalonien ab sofort in Spanien verboten.
Bruno fragte sich, ob ein solches Verbot überhaupt durchgesetzt werden konnte. Dass sich die Rundfunkanstalten daran hielten, war zu erwarten, aber man konnte doch wohl kaum Leute bestrafen, die das Lied sangen, vor sich hin pfiffen, es sich im Internet anhörten oder auf ihr Handy luden. Das Verbot würde wahrscheinlich erst recht auf den Song aufmerksam machen. Und das Verbot ließ außerdem vermuten, dass das katalanische Problem die Regierung in Madrid nervöser machte, als sie zugeben wollte.
Da er die Band gut kannte, hielt es Bruno für durchaus möglich, dass er in den Fall irgendwie hineingezogen werden würde. Die Nachrichtensprecherin erklärte, dass der Song auf Französisch gesungen wurde, aber dann auf Katalanisch sowie dem eng verwandten Okzitanisch, der alten Sprache des Périgord und weiter Teile des Südwesten Frankreichs, wiederholt wurde. Bruno schätzte die kleine, aber hingebungsvolle Gruppe derjenigen, die diese Mundart pflegten. Heutzutage war sie allerdings nur noch für eine Handvoll älterer Menschen Muttersprache, wenngleich auch noch immer viele Wörter in der Landwirtschaft und auf den Wochenmärkten verwendet wurden. Manche seiner Freunde meldeten sich am Telefon mit einem okzitanischen Gruß, und immer mehr Bars und Restaurants suchten sich okzitanische Namen.
Von Les Troubadours war Bruno sehr angetan. Ihr Repertoire bestand aus geschickt modernisierten mittelalterlichen Liedern über Liebe, Krieg und Ritterlichkeit, die sie auf Okzitanisch vortrugen. Er freute sich schon, sie Ende der nächsten Woche wieder live zu hören, wenn sie auf seine Einladung hin bei dem alljährlichen Sommerkonzert am Flussufer von Saint-Denis spielen würden. Zu den angenehmen Aufgaben seines Amtes gehörte die Organisation öffentlicher Veranstaltungen wie Feuerwerksinszenierungen, Landwirtschaftsmessen, Angelwettbewerbe und eben auch Konzerte. Doch noch nie zuvor hatte eines dieser Events eine politische Note gehabt.
Die Unabhängigkeitsbestrebungen der Katalanen waren in Frankreich bislang kaum zur Kenntnis genommen, geschweige denn unterstützt worden, nicht einmal im Südwesten des Landes mit seinen über die Grenze der Pyrenäen hinweg reichenden historischen Verbindungen zum Nachbarland. Das Baskenland erstreckte sich entlang der Atlantikküste vom Fluss Ebro in Spanien bis zur Garonne in Frankreich. Am Mittelmeer hatte sich von Barcelona im Süden bis hoch nach Limoges und im Osten im Languedoc und der Provence eine eigenständige katalanisch-okzitanische Kultur entwickelt. Dass die Regierung Spaniens den Basken und Katalanen ein großzügiges Maß an Autonomie einräumte, fand in Frankreich große Aufmerksamkeit, zumal auch hier Basken, Korsen und Bretonen einen ähnlichen Status für ihre Regionen anstrebten. Bruno hatte vor Kurzem gehört, dass sich nun auch im Elsass eine kleine Gruppe hervortat, die für einen unabhängigen neuen europäischen Staat am Rhein zwischen Frankreich und Deutschland warb.
Den Versuch, ein Lied zu verbieten, fand Bruno nicht nur dumm, sondern auch kontraproduktiv, zumal sich in den sozialen Medien alle über alles Mögliche ausließen. Er fragte sich, wie viele Hörer der Morgensendung sich nun den Song auf ihr Handy laden würden, was auch er vorhatte. Nach dem Wetterbericht begann das Vormittagsprogramm tatsächlich mit dem »verbotenen« Song für Katalonien. Es war eine einfache, eingängige Melodie, leicht mitzusummen. Bruno begriff erst nach einer Weile, was die Moderatorin gemeint hatte mit der Erklärung, dass die drei Strophen denselben Text hätten, aber in drei verschiedenen Sprachen vorgetragen wurden.
Bruno hörte die Stimme von Flavie heraus, der Bandleaderin, die eine Citole spielte, die mittelalterliche Version einer Gitarre. Normalerweise trat sie mit drei Männern auf, von denen einer eine dreisaitige Rebec spielte, eine Kleingeige, die an die Achsel gelegt wurde. Ein zweiter Musiker entlockte einem uralten Blasinstrument flötenartige Töne, während der dritte den Takt dazu auf einer Batá-Trommel schlug, einer zylinderförmigen, beidseitig bespielbaren Trommel, die auf seinem Schoß lag. Die Seite mit dem größeren Fell hatte einen tiefen, bassigen Klang und wurde mit der Hand angeschlagen, die kleinere Seite mit einem Schlägel, den der Trommler Arnaut aus dem Schenkelknochen einer Gans hergestellt hatte.
Vincent, der Rebec-Spieler, war Musiklehrer und lebte in Sarlat, zusammen mit seinem Partner Dominic, der für sein Blasinstrument den mittelalterlichen Namen Gemshorn verwendete. Dominic arbeitete im Sommer als Fremdenführer und leitete den Rest des Jahres einen kleinen Verlag, der Bücher zur Lokalgeschichte, Reiseführer und gelegentlich auch die ein oder andere Sammlung okzitanischer Gedichte herausgab. Er arbeitete von zu Hause aus und verlegte seit einiger Zeit auch CDs von Musikern aus der Region, darunter Les Troubadours, womit er so viel Erfolg hatte, dass er und Vincent von der kleinen Wohnung in Sarlat auf einen alten Bauernhof am Stadtrand umgezogen waren.
Zusammen mit Arnaut, einem gelernten Elektriker mit kleiner Firma, hatten sie eine Scheune mit Zuschüssen des Départements zu einem Aufnahmestudio umgebaut. Hier konnten sie zwölf CDs auf einmal brennen, von Les Troubadours und anderen lokalen Bands, die dann auf Konzerten verkauft wurden. Sie hatten zwei Schulabgänger angestellt und machten mit einem Designer und einer Druckerei zur Untermiete einen bescheidenen Gewinn. Ihr Geschäftsjahr, dachte Bruno, würde mit dem Song für Katalonien wahrscheinlich durch die Decke gehen.
Ihm und den meisten anderen war schon lange klar, dass Arnaut hoffnungslos in Flavie verliebt war. Leider war er klein, gedrungen und ungewöhnlich stark behaart, ein Mann, der sich eigentlich zweimal am Tag rasieren musste. Sein Spitzname in der Schule war »Tal« gewesen, kurz für Neandertaler. Trotz seines geschäftlichen Scharfsinns und seines wichtigen Beitrags am wachsenden Erfolg von Les Troubadours hatte Flavie, wie Bruno wusste, ihm deutlich zu verstehen gegeben, dass sie nur einen geschätzten Freund in ihm sah.
Mit ihrer römischen Nase und den ausgeprägten Wangenknochen war sie nicht unbedingt schön im herkömmlichen Sinne. Doch auf der Bühne hatten ihr langes dunkles Haar, die schlanke Figur und ihre enorm ausdrucksstarken Augen, insbesondere bei guter Beleuchtung, einen unvergleichlichen Effekt. Ihre Sprechstimme war fast so bezwingend wie ihr Gesang, weich, tief und sexy. Sie hatte die vielleicht schönsten Hände, die Bruno je gesehen hatte, und auf der Bühne und auch jenseits davon bewegte sie sich mit graziler Anmut. Gespräche mit ihr konnten jedoch ermüdend sein, weil sie meist politische Themen aufs Tapet brachte. In ihren rigoros grünen Einstellungen ließ sie zwei ungewöhnliche Ausnahmen gelten: Sie aß für ihr Leben gern Fleisch und war eine begeisterte Jägerin und außerordentliche Schützin. Sie hatte sich geschworen, niemals Kinder zu bekommen, weil die Welt ohnehin schon überbevölkert war, und versuchte, sich ausschließlich biologisch zu ernähren. Bruno sei, wie sie schon oft erklärt hatte, einer ihrer Lieblingsfreunde, da er einen Garten hatte, Hühner hielt und sich fast vollständig selbst versorgte. Als Einziges bemängelte sie, dass er nicht überall auf seinem Eigentum Solarpanels installiert hatte, sondern nur auf dem Scheunendach, das dem Haus und Garten abgewandt war.
Bruno ließ sich ihre Neckereien gern gefallen und genoss die Gesellschaft der Truppe. Nach dem Sommerkonzert in Saint-Denis bewirtete er sie immer mit einem einfachen Abendessen bei sich zu Hause. Es war inzwischen Tradition, dass er zuerst seine selbst gemachte Gazpacho auftischte, dann Spaghetti mit Fleischbällchen und Salat aus dem Garten. Zum Abschluss servierte er ein Dessert, das ihm seine Freundin Pamela gezeigt hatte und das in England »Apricot Fool« genannt wurde. Bevor er sich auf den Weg zum Konzert machte, halbierte und entkernte er ein Kilo Aprikosen und schmorte sie vorsichtig mit dem Saft von zwei frischen Orangen, einem kleinen Glas Honig und drei Zimtstangen an. Waren die Früchte später abgekühlt, nahm er die Zimtstangen aus dem Topf und rührte die Zesten von zwei Zitronen in einen großen Topf griechischen Joghurt, den er dann unter die Aprikosen hob. Serviert wurde der Nachtisch in Weingläsern.
Als der Song im Radio endete, schickte Bruno Flavie eine SMS, dass er sich sehr darauf freue, sie am Freitagabend auf der Bühne zu sehen, und dass wohl mit massenhaft Gästen zu rechnen sei. Er spülte sein Frühstücksgeschirr, ließ Balzac auf dem Beifahrersitz seines Polizeitransporters Platz nehmen und machte sich auf den Weg zum Reitstall, um sein Pferd Hector zu bewegen. Er hatte seine Zufahrt noch nicht verlassen, als sein Handy vibrierte und Flavies Name auf dem Display erschien.
»Gratuliere, ihr habt einen Hit gelandet«, meldete er sich spontan, wurde aber von ihr mit aufgeregter, fast panischer Stimme unterbrochen.
»Bruno, ich habe Angst, schreckliche Angst«, sagte sie. »Du ahnst nicht, was auf unserer Website los ist, es gibt sogar Morddrohungen. Viele attackieren uns auf Twitter und behaupten, wir hätten Spanien den Kulturkrieg erklärt.«
»Das sind Idioten, gelangweilte Teenager, die nur über andere herziehen wollen«, erwiderte Bruno und erinnerte sich an einen Artikel, in dem die Rede davon war, dass Hetze in den sozialen Medien fast immer ein kurzlebiges Phänomen war.
»Nein, irgendeine rechte Zeitung titelt genau mit diesen Worten. Auch sie spricht von einem Kulturkrieg, beschuldigt uns, die Katalanen aufzuhetzen, und fordert von der französischen Regierung, dass sie uns den Saft abdreht. Und die Angriffe gegen Joël, unseren Songwriter, sind noch schlimmer. Eine andere Zeitung hat sein Foto auf der Titelseite als Steckbrief abgebildet und fragt: ›Ist dieser Mann Spaniens gefährlichster Feind?‹ Das sind keine gelangweilten Teenager, Bruno. Da steckt schon mehr dahinter.«
»Das tut mir leid, Flavie, das muss alles schrecklich für euch und Joël sein, aber ich finde, ihr solltet die Sache trotzdem nicht allzu ernst nehmen«, entgegnete er, was aber selbst für ihn wenig überzeugend klang. »Wenn euch das beruhigt, könnten wir für zusätzliche Sicherheit beim Konzert sorgen. Wo bist du jetzt?«
»In Bordeaux, im Fernsehstudio von France 3. Wir machen da eine Aufnahme und werden dann für die Nachrichten interviewt. Die Redaktion hat die schlimmsten Kommentare gesammelt, die bei uns angekommen sind. Wenn ich sie lese, könnte ich kotzen. Und jetzt ist auch die spanische Regierung involviert. Kannst du dir das vorstellen, dass eine Regierung in Europa einen Song verbietet? Das darf doch alles nicht wahr sein, Bruno. Wir sind völlig vor den Kopf gestoßen und nicht mehr sicher, ob wir das Konzert überhaupt spielen sollen.«
Bruno versuchte, ihr gut zuzureden, musste aber gleichzeitig an Jean-Jacques denken, wie er ihm die Patrone in der Beweismitteltüte gezeigt hatte, eine Patrone für Scharfschützen, die in einem in Spanien zugelassenen und hier im Périgord aufgefundenen Auto sichergestellt worden war. Wenn er das gegenüber Flavie erwähnte, würde sie das Konzert bestimmt sofort absagen. Dabei war kaum vorstellbar, dass eine so schreckliche Waffe gewissermaßen auf ein einfaches Lied gerichtet werden konnte. Aber was, wenn es sich um mehr als einen bizarren Zufall handelte? Waren seine Freunde wirklich in tödlicher Gefahr? Sein Verstand konnte sich über diesen Gedanken nur lustig machen, aber tief im Innern rührte sich instinktive Vorsicht, und seine alte Schusswunde an seiner Hüfte, die ihm ein Scharfschütze beigebracht hatte, fing plötzlich wieder an zu schmerzen, was in den Sommermonaten noch nie der Fall gewesen war.
3
Pamela, seine ehemalige Geliebte und immer noch sehr gute Freundin, sattelte gerade das Warmblut, als er den Hof erreichte. Fabiola und Gilles waren auch schon zur Stelle. Miranda, die Mitbetreiberin des Reitstalls, half ihren beiden Kindern auf die Ponys. Ihr Vater Jack Crimson war aus dem Haus gekommen, um ihnen nachzuwinken. Jeder der Erwachsenen hatte ein zweites Pferd am Führstrick, als Pamela allen voran den üblichen Weg einschlug, den Hang auf den Höhenrücken hinauf, der eine schnelle Gangart zuließ und wunderschöne Ausblicke auf das Vézère-Tal und die alte steinerne Brücke von Saint-Denis bot.
»Du kennst doch die Gruppe Les Troubadours, Bruno«, sagte Gilles, als sie eine Pause einlegten und das Panorama genossen. »Dass die spanische Regierung gegen sie vorgeht, könnte eine gute Story für mich sein. Aber was für eine Publicity! Kaum zu glauben …«
Bruno kannte Gilles seit vielen Jahren. Das erste Mal waren sie sich während der Belagerung von Sarajevo begegnet, als Bruno, damals noch in der französischen Armee, einer kleinen Einheit der UN-Blauhelme zugeteilt worden war und Gilles als Reporter für Libération gearbeitet hatte. Später schrieb er für Paris Match, die auflagenstärkste Wochenzeitschrift Frankreichs, und berichtete unter anderem aus Saint-Denis über den Mord an einer reichen Erbin. Dass er dabei Bruno wieder über den Weg lief, war ein glücklicher Zufall für beide. Gilles lernte bei der Gelegenheit auch Fabiola kennen, eine Ärztin an der Klinik von Saint-Denis. Er verliebte sich in sie und beschloss, im Périgord zu bleiben. Inzwischen schrieb er hauptsächlich Bücher, manchmal aber auch noch als freier Mitarbeiter für Paris Match. Bruno nannte ihm Flavies Telefonnummer und sagte ihm, dass ihre Band am Freitag auftreten werde.
»Wegen dieser Katalonien-Geschichte kommen die Leute wahrscheinlich in Massen. Wir sollten uns schon früh auf den Weg machen. Oder könntest du, Bruno, ein paar Plätze für uns reservieren?«, fragte Pamela.
»Ich habe schon daran gedacht, ein paar Extraplätze für Medienvertreter und hiesige Politiker frei zu halten«, sagte Bruno und nahm sich vor, seine Kollegin Yveline zu bitten, ein paar Gendarmen als Ordnungskräfte abzustellen.
»Womöglich kommt’s zu einer Demo«, meinte Gilles. »Die spanische Grenze ist nur drei, vier Autostunden weit entfernt, und so manche Katalanen könnten die Gelegenheit nutzen, um Aufmerksamkeit zu erregen.«
Bruno nickte und musste daran denken, dass Demonstrationen nicht selten Gegendemonstrationen provozierten. Er würde die sozialen Medien im Auge behalten müssen, um herauszufinden, ob Flavies Konzert jenseits der Grenze größeres Interesse erregte. Fabiola hatte schon einen Blick auf ihr Smartphone geworfen, und was sie sah, verblüffte sie offenbar so sehr, dass sie einen Pfiff ausstieß. Sie war außerordentlich geschickt mit ihrem Telefon, sehr viel mehr als Bruno. Ihre Daumen flogen nur so über das Display, wenn sie Nachrichten schrieb, während Bruno immer noch mit einem Finger den Buchstaben nachjagte.
»Ihr glaubt es nicht – das Lied wird so oft abgerufen, dass die Website von Périgord Bleu abgestürzt ist«, sagte sie. »Mal sehen, was bei Spotify passiert.« Sie verstummte, während ihre Finger über das Display huschten. »Nicht zu fassen. Die Downloads sprengen alle Rekorde. Wir haben hier offenbar den ersten Megahit in der Geschichte von Saint-Denis. Mal sehen, ob die Website der Band zu erreichen ist … Nein, die ist auch überlastet.«
»Twitter ist ebenfalls voll von dem Thema«, sagte Gilles, der sein eigenes Smartphone befragte. »Mon Dieu, hier stehen ziemlich böse Kommentare auf Spanisch, viele davon zielen auf Joël Martin, den Songwriter, ab. Ich habe ihn vor Jahren einmal interviewt, als das Katalonien-Problem zum ersten Mal große Wellen schlug. Die Leute bezeichnen ihn hier als Spaniens Staatsfeind Nummer eins, als Apologeten des katalanischen Terrors und als Werkzeug französischer Diplomatie, die Spanien schwächen wolle, indem sie das Unabhängigkeitsbestreben der Katalanen unterstützt.« Gilles blickte auf und fügte hinzu: »Wir unterstützen sie doch gar nicht, oder?«
»Wir haben uns geweigert, katalanische Minister auszuliefern, aber der Grund dafür war doch, dass der Vorwurf des Landesverrats, den die spanische Regierung ins Feld geführt hat, nicht dem europäischen Recht entsprach«, sagte Fabiola.
»Ich sollte mich wohl besser in der Mairie blicken lassen, den Bürgermeister informieren und mit der Gendarmerie entscheiden, ob das Konzert unter den gegebenen Umständen wie geplant stattfinden kann oder nicht«, sagte Bruno und lenkte sein Pferd auf den Pfad zurück zum Stall.
»Vergiss das Tennisturnier nicht. Wir haben morgen ein Spiel«, erinnerte ihn Pamela. »Und falls für das Konzert Arbeit am Computer anfällt, kannst du ja Florence um Hilfe bitten.«
Bruno nickte, winkte und entfernte sich im Trab. Florence, die Naturkundelehrerin am örtlichen collège, hatte mit Abstand am meisten Ahnung, was alles Digitale betraf. Der von ihr ins Leben gerufene Computerklub für zwölf- bis sechszehnjährige Schülerinnen und Schüler, war ein voller Erfolg. Ganz zu Anfang hatte sie alte Rechner vor der déchetterie, dem Recyclinghof, gerettet und den Jugendlichen gezeigt, wie man sie überholen und nachrüsten konnte. Das erste gemeinsame Projekt war die Entwicklung einer Software, um die Mailinglisten aller Stationen von Stadtpolizei und Gendarmerie im gesamten Département zu verwalten und alle Ansprechpartner direkt kontaktieren zu können. Sie wurde wenig später erweitert um die Möglichkeit, auch alle Fremdenverkehrsämter, Hotels und Autovermietungen mit nur einer Mail zu erreichen, schließlich sogar noch Rundfunkanstalten, Presseagenturen und Zeitungsredaktionen.
Das erste von den Kindern und Jugendlichen eigenständig entwickelte Computerspiel fand zwar keine Abnehmer, veranlasste aber ein großes IT-Unternehmen in Paris, Florences Computerklub mit ihren ausrangierten Rechnern zu beliefern, jedes Mal, wenn in der Firma ein Upgrade fällig war. Florence durfte außerdem darauf hoffen, dass das Unternehmen dem ein oder der anderen ihrer Schützlinge ein Praktikum anbieten würde, wenn diese das lycée durchlaufen hatten. Bruno war voller Respekt für diese beeindruckende Frau und ihr freundschaftlich eng verbunden. Inzwischen war er so etwas wie ein Ehrenpate für ihre Zwillinge Daniel und Dora.
Manchmal, wenn sich ihre Blicke trafen, glaubte er, ein Knistern zu spüren, doch hielt er sich ihr gegenüber entschieden zurück, weil er bei seiner alten Regel bleiben wollte, nie mit einer Frau, die in Saint-Denis wohnte, eine Liaison anzufangen. Nur mit Pamela hatte er sich zu einer Ausnahme hinreißen lassen, was er wohl nur deshalb nicht bereuen musste, weil es ihr mit viel Fingerspitzengefühl und Finesse gelungen war, die Affäre in eine feste, dauerhafte Freundschaft umzuwandeln. Eine solche Frau war Florence, wie er vermutete, wohl eher nicht. Sie war jünger, früh geschieden und hatte zwei Kinder, sicher erwartete sie für ihre Kinder und sich selbst von einem möglichen Partner, dass er sich komplett auf sie einließ. Doch solange auch nur ein kleiner Teil von Brunos Herz noch immer an Isabelle im fernen Paris hing, fühlte er sich dazu nicht in der Lage.
Zurück in der Mairie, verabredete Bruno ein Treffen mit Yveline, um mit ihr die notwendigen Maßnahmen für einen reibungslosen Ablauf des Konzertes abzusprechen, wenn es denn zustande kommen sollte. Dann meldete er sich kurz im Büro des Bürgermeisters, der nach den Morgennachrichten ebenfalls reges Interesse an der Veranstaltung zeigte. Der Bürgermeister war stolz darauf, fließend Okzitanisch zu sprechen, und behauptete, dass ihm dies bei den Wahlen die Stimmen der ländlichen Bevölkerung sicherte. Bruno wusste allerdings, dass Mangin ein Faible für mittelalterliche Gedichte und Lieder hatte, von denen er viele auswendig vortragen konnte. Im Übrigen war er es gewesen, der vorgeschlagen hatte, Flavie und ihre Gruppe für ein Konzert zu buchen.
Er hatte sie auf der alljährlichen Gala von SHAP, der Société Historique et Archéologique du Périgord, gehört und – unabhängig davon – Bruno wenig später dazu überreden können, selbst dem Verein aus Gelehrten und Geschichtsbegeisterten beizutreten, der einmal im Monat in einem eleganten mittelalterlichen Stadthaus in Périgueux zusammenkam. Die Interessen des Vereins reichten von den Neandertalern und Cro-Magnon-Menschen, die einst die Region besiedelt hatten, bis ins Mittelalter, als sich das Herzogtum Aquitanien fast über den gesamten Süden Frankreichs ausgedehnt hatte. Die Könige in Paris hatten wiederholt versucht, die mehr oder weniger unabhängigen Gebiete der Krone anzuschließen, doch erst während der Regentschaft des Sonnenkönigs Ludwig XIV. im späten 17. Jahrhundert brachten sie die Region unter ihre Kontrolle.
»Ah, Bruno, uns steht wohl eine neue vergonha ins Haus«, grüßte Mangin. Er betonte den Ausdruck genüsslich und grinste, als er die Verblüffung im Gesicht seines Chef de police wahrnahm. »Sie wissen nicht, wovon ich spreche? Mit der vergonha wurde unser Volk geschmäht. Viele erinnern sich noch daran, dass unsere Großeltern und Urgroßeltern in der Schule gedemütigt und bestraft wurden, wenn sie es wagten, ihre Muttersprache zu sprechen, unser Okzitanisch, das älter ist als Französisch. Und jetzt will man auch noch unsere Lieder verbieten.«
Bruno setzte sich auf einen Stuhl, bereit für eine von Mangins Geschichtslektionen, die er nicht ungern über sich ergehen ließ. Sie waren immer interessant und meist lehrreich.
»Warum haben die Mächtigen in Paris versucht, die okzitanische Sprache zu verbieten?«, fragte er.
»Initiatorin war natürlich wie immer die Kirche, die uns nie verzeihen konnte, dass im Südwesten zwei einflussreiche häretische Gruppierungen von sich reden machten und an katholischen Dogmen rüttelten: die Katharer im Mittelalter und die Protestanten während der Reformation. Dann kam die Revolution, und der aufständische Priester Abbé Grégoire versuchte, bei den Nationalisten mitzumischen; auch er forderte ein Land, eine Sprache, eine Rechtsprechung. Napoleon war einverstanden, zumindest im Prinzip. Abbé Grégoire aber wollte mehr, nämlich die Abschaffung aller regionaler Mundarten und Dialekte, der bretonischen wie der baskischen, okzitanischen oder provenzalischen, und das, obwohl die meisten Franzosen damals anders sprachen als die Bewohner von Paris. Nach der großen Niederlage von 1870 spitzten sich die Auseinandersetzungen um eine verbindliche Landessprache weiter zu. Alle sollten Pariser Französisch sprechen, damit unsere Streitkräfte den Befehlen ihrer Offiziere folgen konnten, wobei man aber vollkommen außer Acht ließ, dass die großen Siege Napoleons von Soldaten erstritten wurden, die Okzitanisch, Bretonisch und vieles andere sprachen. Stattdessen versuchte man unseren Leuten einzureden, dass sie sich für unsere Mundart zu schämen hätten, eine Sprache, aus der große Dichtung und Musik hervorgegangen sind, eine Kultur, die das Feudalsystem zivilisiert und uns das Ideal der Ritterlichkeit nahegebracht hat.«
Bruno hüstelte, um ihn diskret zu unterbrechen. Der Bürgermeister hätte wohl sonst kein Ende gefunden. »Diesmal sind es nicht die Mächtigen in Paris, Monsieur le Maire, auch nicht die Kirche. Es ist die spanische Regierung, die wir eigentlich ignorieren müssten. Das Problem ist nur, wie wir der Menschenmenge Herr werden sollen, die Les Troubadours mit ihrem Konzert anziehen werden.«
»Ich bin ganz zuversichtlich, dass Sie die Sache gut managen, Bruno«, erwiderte Mangin unbekümmert. »Nun, Sie wissen doch, dass Okzitanisch die Muttersprache unserer großen Eleonore war, der Herzogin von Aquitanien, der einzigen Frau, die einen französischen und dann einen englischen König zum Gemahl genommen hat.«
»Ja, Monsieur, ich weiß auch, dass sie die Mutter des unsterblichen Ritters Richard Löwenherz war.«
»Dessen Muttersprache ebenfalls Okzitanisch war, auch wenn er dann König von England wurde«, ergänzte der Bürgermeister triumphierend und fügte hinzu: »Und er war selbst ein Troubadour.«
»War es nicht Charles de Gaulle, der gesagt hat, England sei eine missratene französische Kolonie?«, fragte Bruno.
»Nein, das war Georges Clemenceau«, korrigierte Mangin und bedachte Bruno mit einem strengen Blick. »Wollen Sie mich auf den Arm nehmen?«
»Gott bewahre, Monsieur le Maire«, antwortete Bruno grinsend. »Ich wollte mich nur als Ihr beflissener Schüler zeigen. Zurück zu unserem eigentlichen Thema. Da wir nur wenige Stunden Autofahrt von der spanischen Grenze entfernt sind, halte ich es für angebracht, die Sicherheitsfrage ernst zu nehmen. Selbst wenn die Politik nicht involviert wäre, ist es eine große Herausforderung, eine solche Menschenmenge im Griff zu behalten.«
»Ja, die Politik macht mir Sorgen«, gab der Bürgermeister zu. »In Spanien ist eine schwache Minderheitsregierung im Amt, und bald stehen Neuwahlen an. Die Parteispitzen müssen sich erklären, denn auf beiden Seiten, links wie rechts, wird der Druck zunehmen, insbesondere durch diejenigen, die sich einen Karrieresprung erhoffen. Jeder wird sich als härter und entscheidungsfreudiger darstellen als die verschlafene Regierung. Es könnte heiß hergehen.«
»Deshalb überlasse ich alles, was mit Politik zu tun hat, Ihnen«, sagte Bruno.
»Na schön, ich werde mit der Präfektin sprechen. Und verlasse mich darauf, dass Sie sich mit Ihren Freunden bei den Sicherheitsbehörden in Paris und Périgueux kurzschließen. Aber unsere Linie ist ganz klar: Die spanische Regierung mag ein Lied in ihrem Land verbieten, aber sie kann uns nicht vorschreiben, was wir uns anhören oder nicht. Und erst recht kann sie nicht vorschreiben, was unsere Leute singen und was nicht.«
4
Auf dem Weg in sein Büro wäre er fast mit Florence zusammengestoßen. Sie kam aus dem Fahrstuhl gesprungen, wirkte dabei völlig aufgelöst und wedelte mit einem braunen Briefumschlag herum, als wäre er eine Waffe.
»Bonjour, Florence«, sagte Bruno und trat auf sie zu, um sie zu begrüßen. »Ich wollte dich anrufen und dich bitten, mir beim Downloaden eines Songs zu helfen. Wie geht’s den Zwillingen?«
»Danke, gut, aber deswegen bin ich nicht gekommen.« Sie marschierte in sein Büro, schob ihn in einen Stuhl vor seinem Schreibtisch, schloss die Tür und lehnte sich mit dem Rücken dagegen. »Lies das!«, sagte sie und warf ihm den Briefumschlag zu.
Bruno sah auf den ersten Blick, dass er von einem Gefängnis nahe Lille im Norden Frankreichs abgeschickt worden und an die Adresse des regionalen Lehrerverbandes zu ihren Händen adressiert war. Das war ungewöhnlich. Er forderte sie auf, selbst Platz zu nehmen, zog einen handgeschriebenen Brief aus dem Umschlag und las.
Liebe Florence,
ich habe Verständnis dafür, dass Du mich seit unserer Scheidung nicht mehr sehen möchtest, will Dir aber dennoch sagen, dass meine Strafe wegen guter Führung in Kürze auf Bewährung ausgesetzt wird, sodass ich bald freikomme. Ich wäre froh, wenn wir eine freundschaftliche Lösung finden könnten, damit ich meine Kinder treffen und in regelmäßigen Abständen sehen darf.
Trotz unserer Scheidung bleibe ich ihr Vater. Irgendwann werden sie von sich aus fragen, wer ich bin. Es wäre wohl in ihrem besten Interesse, und wie ich glaube vielleicht auch in Deinem und meinem, wenn sie mich eher früher als später kennenlernen.
Ich habe mit dem Seelsorger der hiesigen Anstalt gesprochen, einem sehr hilfsbereiten Priester, der sich dafür einsetzen will, dass ich bei der von der Action Catholique geleiteten Tafel in Bergerac Arbeit finde. In einer Online-Zeitung habe ich gelesen, dass Du in die Dordogne gezogen und in den Vorstand des regionalen Lehrerverbandes gewählt worden bist. An den habe ich deshalb meinen Brief adressiert.
Ich gratuliere Dir herzlich zu dem neuen Leben, das Du Dir aufgebaut hast. Vielleicht erlaubst Du mir, Dich nach meiner Entlassung zu besuchen und unsere Kinder zu sehen. Wir könnten dann versuchen, uns auf eine Besuchsregelung zu einigen.
Ich muss wohl nicht sagen, wie schrecklich leid mir tut, was zwischen uns vorgefallen ist. Vom Alkohol, der zu unserer Scheidung und meiner Gefängnisstrafe geführt hat, bin ich jetzt immerhin geheilt. Die ganze Schuld liegt allein bei mir und meinem selbstzerstörerischen Verhalten. Ich kenne Dich als liebevolle und großzügige Frau, kann aber nicht von Dir erwarten, dass Du mir verzeihst.
Sicher wird es Dir schwerfallen, an meine Läuterung zu glauben, das ist nur allzu verständlich. Von Pater Parvin, dem Anstaltsseelsorger, und Monsieur Raspail, dem Gefängnisdirektor, darf ich Dir aber ausrichten, dass sie gern bereit sind, etwaige Bedenken Deinerseits zu zerstreuen. Ich habe die Gefängnisbibliothek betreut und anderen Insassen bei ihrem Förderunterricht geholfen. Außerdem habe ich dank Pater Parvin zu meinem Glauben an Gott und die Kirche zurückgefunden.
Bitte, sei so gut, und nimm meine demütige und tief empfundene Entschuldigung für das, was ich Dir angetan habe, an. Es geht mir nicht um eine Rückkehr in unsere Ehe. Ich habe verstanden, dass dieser Teil unseres Lebens abgeschlossen ist. Aber unseren Kindern zuliebe hoffe ich sehr, dass, wenn Du mir auch nicht verzeihen kannst, Du ihnen immerhin doch erlaubst, ihren Vater kennenzulernen, der inzwischen ein anderer Mann geworden ist.
Aufrichtig und voller Zuneigung, Casimir
Bruno las den Brief zweimal. Das erste Mal war er einfach nur verblüfft; beim zweiten Mal beschlich ihn der Verdacht, dass die sehr sorgfältigen Formulierungen wohl nicht zuletzt auf das Familiengericht Eindruck machen sollten. Die Sache als solche war völlig neu für ihn. Als er Florence kennengelernt hatte, war sie schon geschieden gewesen. Von ihrem Ex-Ehemann hatte sie nie gesprochen. Sie arbeitete damals zum Mindestlohn auf dem Trüffelmarkt von Sainte-Alvère als Hilfskraft und war für alles Mögliche zuständig, wenn sie nicht gerade damit beschäftigt war, ihren übergriffigen Chef abzuwehren. Florence hatte Bruno geholfen, einen Fall betrügerischen Trüffelhandels aufzudecken und später auch bei der Zerschlagung eines Pädophilenrings dem auch ihr Chef angehörte, der sich daraufhin das Leben nahm.
Als Bruno erfuhr, dass sie ein abgeschlossenes Chemiestudium hatte, verhalf er ihr zu einer Anstellung als Lehrerin in Saint-Denis. Dieser Schritt veränderte ihr Leben von Grund auf. Sie war jetzt ein angesehenes Mitglied der Gesellschaft und gehörte zu Brunos Freundeskreis, der sich einmal in der Woche auf Pamelas Reiterhof zum Abendessen traf, für das reihum immer jemand anderes sorgte. Bruno hatte ihren Zwillingen das Schwimmen beigebracht und freute sich schon darauf, ihnen zusammen mit etlichen anderen Kindern im Ort Tennisunterricht zu geben. Manchmal dachte er, dass sie fast so etwas wie der Ersatz für eigene Kinder waren. Dazu hatte er es selbst noch nicht gebracht, vor allem wohl, weil er sich anscheinend immer in unabhängige Frauen verliebte, die nicht geneigt waren, sich an einen Ehemann und Kinder zu binden. Bis auf den notaire von Saint-Denis wusste niemand, dass Bruno ein Testament aufgesetzt und Florences Kinder zu den Alleinerben seines bescheidenen Anwesens, seines alten Land Rovers und seiner Anteile am städtischen Weinberg bestimmt hatte.
»Du hast nie erwähnt, warum du dich hast scheiden lassen«, sagte er und schaute sie an. Sie hatte wieder ihren Mädchennamen Pantowsky angenommen, und er wusste, dass sie aus einer polnischen Familie stammte und in einer der Bergarbeiterstädte in Nordfrankreich zur Welt gekommen war. Dazu passte, dass Casimir, der Absender des Briefes, dem Namen nach ebenfalls polnischer Herkunft zu sein schien.
»Ist das nicht vollkommen logisch, angesichts dessen, wo mein Ex-Mann gelandet ist?«, fragte sie. »Zum Glück wart ihr alle diskret genug, um mich nicht in Verlegenheit zu bringen. Ich habe versucht, den ganzen Schlamassel hinter mir zu lassen und ein neues Leben anzufangen. Umso unerträglicher ist es, dass er herkommen und sich in das Leben meiner Kinder einmischen will. Er ist ein gewalttätiger, gefährlicher Mann.«
»Willst du mir vielleicht erzählen, was damals passiert ist?«, fragte Bruno.
Florence straffte die Schultern und nickte. »Wir waren zusammen auf der Uni. Casimir studierte Biologie und war zwei Semester weiter als ich«, fing sie zu berichten an.
Casimir Maczek stamme aus einer polnischen Familie und sei in einer Nachbarstadt aufgewachsen, erklärte sie. Ihre Eltern hätten einander aus einem Ortsverein und Kirchengruppen gekannt. Sie seien alle sehr fromm gewesen, gingen jeden Sonntag in die Kirche und sprachen zu Hause Polnisch. Die Großväter hätten in einer Panzerdivision gedient, zum Ende des Kriegs an der Seite der Briten gekämpft und später in einer französischen Kohlenmine Arbeit gefunden. Als Florence ihr Studium begann, war Casimir bereits ein Star sowohl in der Fußball- als auch der Hockeymannschaft der Universität, ein gut aussehender und sehr beliebter Student. Sie wurden ein Paar.
Florence stockte und drückte den Rücken durch. Dann holte sie tief Luft und blickte Bruno direkt in die Augen.
»Ich war noch Jungfrau, als wir uns kennenlernten, und kann wirklich nicht sagen, ob ich tatsächlich in ihn als Person verliebt war oder bloß in die Vorstellung, einen attraktiven jungen Typen zum Freund zu haben«, sagte sie und schluckte. »In meinem letzten Studienjahr wurde ich schwanger. Casimir hatte seinen Abschluss gemacht und für ein Pharmazieunternehmen in Lille zu arbeiten angefangen. Auf Druck unserer beider Familien haben wir geheiratet, obwohl weder ihm noch mir der Sinn danach stand. Eine Abtreibung kam aber in der eng verwobenen, gläubigen polnischen Gemeinschaft überhaupt nicht infrage.
Wir waren beide nicht glücklich«, fuhr sie fort. »Ich musste mich auf meine Abschlussprüfungen konzentrieren, war aber gestresst, und mir war ständig schlecht. Ich wohnte auf dem Campus und besuchte Casimir an den Wochenenden in seiner möblierten Wohnung. Uns war beiden klar, dass es ein Fehler war. Er fing an zu trinken. Manchmal schlug er mich, immer an Stellen, die man nicht sehen konnte. Ich hatte schreckliche Angst davor, dass er versuchte, eine Fehlgeburt auszulösen. Als ich alles meiner Mutter erzählte, bekam ich nur zu hören, dass ich mir mein Bett selbst gemacht hätte und mich damit nun abfinden müsse.«
Bruno schloss die Augen und versuchte, seinen Zorn in Zaum zu halten. »Warum ist er im Gefängnis gelandet?«, fragte er.
»Er hat immer mehr getrunken und ist dann jedes Mal auf mich losgegangen. Eines Nachts bin ich in ein Frauenhaus in Lille geflohen, wo ich in Sicherheit war. Dann hat Casimir seinen Job verloren, als die Firma, für die er gearbeitet hat, an ein amerikanisches Unternehmen verkauft wurde, das auf eine weitere Forschungsabteilung im Ausland verzichten wollte. Für seine Kündigung lieferte er selbst den Grund, weil er betrunken ins Labor kam, weshalb er auch noch auf eine Abfindung verzichten musste.
Eines Tages war Casimir dann mit ein paar Fußballfreunden essen«, fuhr Florence mit flacher Stimme fort. Ihr Blick war auf das Fenster gerichtet, als wäre es ihr unmöglich, bei dem, was sie zu berichten hatte, Bruno ins Gesicht zu sehen. Casimir habe wieder einmal zu viel getrunken, sagte sie. Er sei nach dem Essen zu einem Supermarkt gefahren, um für das Wochenende einzukaufen. Beim rückwärts Ausparken habe er die Kontrolle über sein Auto verloren und sei mit voller Wucht gegen ein anderes parkendes Auto geprallt, in das ein älteres Ehepaar gerade seine Einkäufe lud. Er tötete den Mann und verletzte die Frau so schwer, dass sie beide Beine verlor. Er beging Fahrerflucht, verursachte einen zweiten Unfall und leistete Widerstand, als ihn die Polizei festnehmen wollte. Er drosch mit seinem Hockeyschläger so heftig auf zwei Beamte ein, dass einer ins Krankenhaus gebracht werden musste. Am Ende bekam er eine Strafe von acht Jahren Haft aufgebrummt, vier für fahrlässige Tötung unter Alkoholeinfluss, vier für den tätlichen Angriff auf Polizeibeamte.
»Im Frauenhaus arbeitete eine freundliche Anwältin. Sie half mir bei der Scheidung, von der mich meine Eltern abzubringen versuchten. Sie wollten, dass ich zu Casimir stehe«, sagte sie. »Aber ich weigerte mich. Ich hatte genug, von ihm und von ihnen. Wäre ich der Richter gewesen, hätte er sehr viel mehr als acht Jahre bekommen. Ich blieb an der Uni, machte meinen Abschluss, brachte die Zwillinge zur Welt und gab der Anwältin zu verstehen, dass ich wegziehen wolle. Ich dachte an Kanada, aber die Anwältin hatte Verwandtschaft hier unten im Südwesten und vermittelte mir einen Job auf dem Trüffelmarkt von Sainte-Alvère. Den Rest kennst du.«
Bruno stieß einen lauten Seufzer aus. Er wusste nicht, was er sagen sollte, und musste an seine erste Begegnung mit Florence in dem kleinen Büro auf dem Markt denken. Sie hatte damals ganz anders ausgesehen, niedergeschlagen und nachlässig gekleidet. Erst im Nachhinein war ihm bewusst geworden, dass sie absichtlich ihre Attraktivität verborgen hatte, um den Avancen ihres Vorgesetzten vorzubeugen. Bruno erinnerte sich, dass er sie bei ihrer ersten Begegnung gefragt hatte, ob sie am Arbeitsplatz belästigt werde, und er sah noch vor sich, wie ihre Augen zornig funkelten, als sie, plötzlich völlig verändert, geantwortet hatte: »Ich kann damit umgehen. Er ist ein Schwein, aber auch ein Feigling.«
Eine neue Arbeitsstelle, ein neues Leben und neue Freunde in Saint-Denis hatten aus Florence eine andere Frau gemacht. Pamela und Fabiola hatten sie unter ihre Fittiche genommen, sie gingen gemeinsam zum Pilates, zum Friseur, in Wellnessbäder und auf Shoppingtrips nach Bordeaux. Florence kleidete sich inzwischen elegant und sah blendend aus. Der Erfolg ihres Computerklubs hatte sie selbstbewusst gemacht, wie auch ihre Arbeit als Lehrerin, und weil sie auf dem collège-Gelände günstig wohnen konnte, stand sie nun auch finanziell gut da. Sie war eine attraktive, tüchtige Frau, eine wunderbare Mutter für ihre Zwillinge, eine teure Freundin und als Sopranistin im Kirchenchor sehr geschätzt.
Plötzlich dachte Bruno zurück an einen Moment am Anfang des Sommers, als er Dora und Daniel das Schwimmen beigebracht hatte. Nachdem sie es geschafft hatten, zum ersten Mal selbstständig die gesamte Länge des Pools zu durchschwimmen, war Florence, begeistert über ihren Erfolg, ins Wasser gesprungen und hatte die Arme um ihn geworfen. Er sah sie wieder vor sich, in ihrem grünen Bikini, und spürte ihre Brüste auf seiner Brust. Nicht dass sie ihn auch nur im Geringsten ermutigt hatte, vielleicht wegen seiner früheren Beziehung zu ihrer Freundin Pamela; möglich auch, dass sie von seinen gelegentlichen Intermezzi mit Isabelle gehört hatte, der Polizistin, seiner großen Liebe, die einer verheißungsvollen Karriere wegen nach Paris gegangen war.
»Wo sind Daniel und Dora jetzt?«, fragte er.
»In der maternelle«, antwortete sie. Zwar war Ferienzeit, doch weil es viele berufstätige Mütter gab, blieb die Kindertagesstätte geöffnet, und die Kinder freuten sich, miteinander spielen zu können.
»Ist der Brief das Erste, was du seit der Scheidung von Casimir gehört hast?«
»Das Erste seit seinem Verfahren. Ich musste vor Gericht aussagen, über seine Trinkgewohnheiten Auskunft geben, wie er mich geschlagen und eingeschüchtert hat, dass ich Angst hatte … Ich werde nie den Blick vergessen, den er mir dort zugeworfen hat.«
»Das stand alles schon in der Anklage?«
Florence nickte. »Als Casimir verhaftet worden war, kam eine Polizistin ins Frauenhaus, um mich, die Leiterin des Hauses und die Ärztin, die mich untersucht und versorgt hatte, zu vernehmen. Ich hatte mich gleich, nachdem er mir zum ersten Mal ins Gesicht geschlagen hatte, dorthin geflüchtet. Er hatte mir die Nase gebrochen und einen Zahn ausgeschlagen. Die Staatsanwältin versicherte mir, dass es die Scheidung erleichtern würde, wenn ich umfassend vor Gericht aussage.«
»Und jetzt nimmt Casimir wieder Kontakt auf, behauptet, sich von Grund auf geändert zu haben, und will die Kinder sehen«, fasste Bruno zusammen. »Sein Brief ist so formuliert, als hätte er schon die Anhörung vor dem Familiengericht im Sinn. Er bekennt sich schuldig und übernimmt die Verantwortung für seine Taten. Hältst du für möglich, dass er tatsächlich ein anderer geworden ist?«
»Keine Ahnung, ist mir auch egal, ob er es ernst meint oder nicht. Jedenfalls will ich ihn nicht in der Nähe meiner Kinder sehen«, antwortete sie heftig. »Weder jetzt noch irgendwann, da kann er noch so viel von seinem angeblich wiedergewonnenen Glauben schwätzen. Er hat in meinem Leben nichts mehr verloren. Ich bin hierhergekommen, um ihm zu entfliehen, und hätte es nicht für möglich gehalten, dass er mich ausfindig macht.«
»Wir sollten mit unserer Freundin Annette sprechen«, sagte Bruno. Sie war Richterin der sous-préfecture und spezialisiert auf Familienrecht. »Sie wird dich beraten können. Darf ich mir eine Kopie von Casimirs Brief machen und sie um Hilfe bitten? Und weißt du noch den Namen des