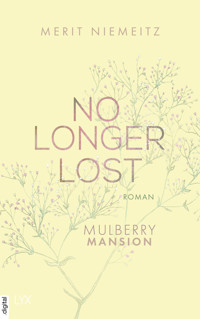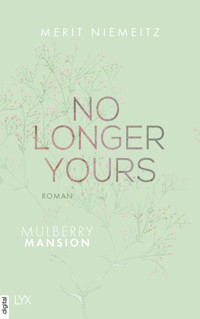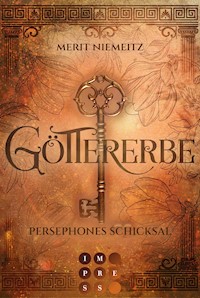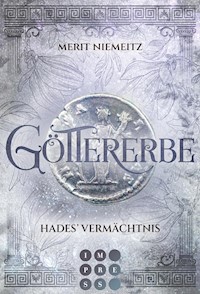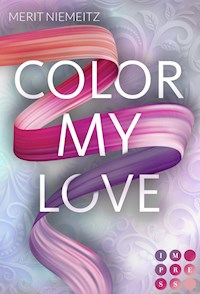11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Evergreen Empire
- Sprache: Deutsch
Ich habe nie aufgehört, von dir zu träumen
Von klein auf wurde Odell Evergreen darauf vorbereitet, eines Tages das Parfüm-Imperium seiner Familie zu übernehmen. Nur bei seiner besten Freundin Emmeline konnte er sich fallen und mal nicht seinen Kopf, sondern sein Herz entscheiden lassen. Gemeinsam haben sie alles über Düfte und einander gelernt, ihre Träume und ihren ersten Kuss geteilt - bis Odell sie plötzlich von sich gestoßen hat. Doch als sein Vater bei einem Unfall stirbt, braucht er dringend Emmelines Hilfe. Denn um CEO zu werden, soll er ein eigenes Parfüm kreieren. Trotz der jahrelangen Funkstille stimmt Emmeline zu, ihm zu helfen. Und als sie zusammenarbeiten, ist auf einmal alles wieder da: die Erinnerungen, die Gefühle und dieser zerbrechliche Traum von einem Wir ...
»Niemand schreibt atmosphärischer, mit mehr Wortgewandtheit und Emotion als Merit Niemeitz. Ich habe alles gefühlt.« SARAH SPRINZ
Band 1 der EVERGREEN-EMPIRE-Trilogie
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 729
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
INHALT
Titel
Zu diesem Buch
Leser:innenhinweis
Widmung
Playlist
Prolog
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Epilog
Danksagung
Die Autorin
Die Bücher von Merit Niemeitz bei LYX
Impressum
MERIT NIEMEITZ
Delicate Dream
Roman
ZU DIESEM BUCH
Schon von klein auf wurden die Geschwister Odell, Keaton und Marigold Evergreen darauf vorbereitet, eines Tages das luxuriöse Parfüm-Imperium ihrer Familie zu erben. Stets an ihrer Seite: Emmeline Verwood, die Tochter der Haushälterin, die über einen nahezu perfekten Geruchssinn verfügt. Als ältester Sohn wurde Odell besonders streng erzogen, um später die Geschäftsführung von seinem Vater zu übernehmen. Nur bei Emmeline konnte er sich fallen lassen und mal nicht auf seinen Kopf, sondern sein Herz hören. Mit ihr hat er all seine Träume geteilt und seinen ersten Kuss – bis er sie plötzlich von sich gestoßen hat. Doch als sein Vater bei einem Unfall ums Leben kommt, muss Odell nicht nur ein millionenschweres Unternehmen führen, sondern soll auch noch ein eigenes Parfüm entwerfen. In seiner Verzweiflung wendet er sich nach jahrelanger Funkstille an Emmeline und schlägt ihr einen Deal vor: Er finanziert ihr das Studium, im Gegenzug hilft sie ihm, einen Duft zu kreieren. Womit jedoch keiner von beiden gerechnet hat, sind die Erinnerungen und die Gefühle, die auf einmal wieder hochkommen. Dabei hatte Odell diese aus gutem Grund verdrängt, denn Emmeline war schon immer sein größter, aber unerreichbarer Traum …
Liebe Leser:innen,
dieses Buch enthält potenziell triggernde Inhalte. Deshalb findet ihr hier eine Triggerwarnung.
Achtung: Diese enthält Spoiler für das gesamte Buch!
Wir wünschen uns für euch alle das bestmögliche Leseerlebnis.
Eure Merit und euer LYX-Verlag
Für Marie.
Für die Sommersprossen und Sekundenzeiger, für alles, was wir waren, sind und sein werden.
PLAYLIST
Just Another Thing We Don’t Talk About – Tom Odell
Two people – Gracie Abrams
Nostalgia – Suki Waterhouse
We Don’t Eat – James Vincent McMorrow
Big Jet Plane – Angus & Julia Stone
Memory Lane – Haley Joelle
perfume – mehro
If I Weren’t Me – Katherine Li
right where you left me – Taylor Swift
Pluto Projector – Rex Orange County
Cornflower Blue – Flower Face
The Feels – Labrinth
Tomorrow Never Came – Lana Del Rey, Sean Ono Lennon
Time Comes in Roses – Bess Atwell
The Alcott – The National, Taylor Swift
Never Get Over You – Stephen Dawes, Dylan Conrique
Missionary Feelings – Hazlett
Delicate – Taylor Swift
Rich Man – KEØMA
Everywhere, Everything – Noah Kahan, Gracie Abrams
Still Feel It All – MARO
Ready to Go – Noah Cyrus
Everything Works Out in the End – Kodaline
Agape – Bear’s Den
I Love You. It’s A Fever Dream. – The Tallest Man On Earth
Evergreen – Richy Mitch & The Coal Miners
PROLOG
Odell
Alles auf der Welt hat einen Geruch.
Mit dieser Gewissheit war ich aufgewachsen, ich hatte sie geglaubt, gefühlt, gelebt. Meine Gedankenräume waren gefüllt von Düften – nicht unbedingt denen von Gegenständen oder Materialien, eher denen verschiedener Momente.
Früher wurde uns beigebracht, ihre Zusammensetzungen in die winzigen Bestandteile aufzuspalten. Sonntage rochen bei uns nach frisch aufgebrühtem Schwarztee, nach geschmolzener Zimtbutter über warmem Toast, nach dem Mahagoniholz unseres Tischs und den Rosen, die vor dem Fenster des Esszimmers wuchsen. Umarmungen dufteten nach dem Haar unserer Mutter: nach Veilchen, einem Hauch Sonnencreme und einfach … Mum. Unser Elternhaus nach einer Mischung aus den Ölfarben der Gemälde in den Fluren, sonnenerwärmtem Parkett, dem herben Rasierwasser unseres Vaters, Maris blumigem Shampoo und Keatons Bonbons, die er irgendwann nur noch lutschte, um zu verbergen, dass er heimlich geraucht hatte. Als hätte er es nicht besser gewusst, als hätten wir alle es nicht immer besser gewusst, wo das doch die allererste Wahrheit war, die uns beigebracht worden war: Düfte lügen nicht, und sie lassen sich nicht auslöschen, höchstens unterdrücken. Und alles, was man unterdrückt, kommt irgendwann wieder an die Oberfläche, nicht wahr?
Wir hatten es früh gelernt: Düfte waren kein schlichtes Anhängsel von etwas oder jemandem. Sie waren eigenständig und eigenwillig, konnten sich von ihrem Träger lösen, mit anderen verbinden, etwas Neues formen und dabei trotzdem individuell bestehen bleiben. Wenn alles andere verschwand, selbst in völliger Dunkelheit, Stille oder Starre, waren sie noch da. Und die Gefühlserinnerungen, die sie hinterließen, blieben auch dann, wenn sie selbst längst verflogen waren. Genau deswegen waren sie das Zentrum jedes Moments und das Herz unserer Welt. Meiner Welt.
Trotzdem gab es Zeiten, in denen ich sie mir wegwünschte. Nicht nur die Gerüche, einfach alles. Die friedlichsten Minuten meiner Tage waren die, in denen ich die Welt um mich herum ausblenden, kurz innehalten und durchatmen konnte.
Das Räuspern meines Fahrers riss mich aus der Trägheit, die gerade angefangen hatte, es sich in meinen Muskeln bequem zu machen. Widerwillig blinzelte ich und stellte fest, dass wir angehalten hatten. Dämmriges Mittagslicht hing über den Häuserdächern und kroch durch die abgedunkelten Scheiben zu uns in den Wagen. Der Himmel hatte sich wieder zugezogen, dabei konnte es nicht lange her sein, dass wir das Büro in Westminster verlassen hatten.
Verzögert erwiderte ich Nathaniels Blick im Fahrerspiegel und rang mir ein Lächeln ab. »Danke. Und bis später.«
Ich schloss den obersten Knopf meines Hemdes, ehe ich die Tür öffnete und ausstieg. Es war schon Ende März, aber die Temperaturen waren noch so kühl, dass ich trotz des Jacketts zu frösteln begann. Womöglich lag das allerdings nur daran, dass ich heute kaum etwas gegessen hatte. Mein Bauch fühlte sich flau an, vermutlich, weil ich vorm Losfahren meinen dritten Kaffee auf leeren Magen getrunken hatte. Er hatte so laut geknurrt, dass Nathaniel beiläufig vorgeschlagen hatte, bei einer Bäckerei anzuhalten. Ich hatte abgelehnt. Hunger war kein angemessener Grund für Verspätungen. Es gab keine angemessenen Gründe für Unzuverlässigkeit.
Auch wenn ich immer noch nicht ganz verstand, was ich hier überhaupt zu suchen hatte. Das Gebäude, zu dem mich mein Vater bestellt hatte, lag in Mayfair, angrenzend an die Bond Street. Wir hatten schon länger darauf gewartet, dass eine geeignete Immobilie frei wurde, um eine neue Verkaufsfiliale eröffnen zu können. Es war logisch gewesen, dafür in der edelsten Einkaufsstraße Londons zu suchen. »Umgebenvondenangesehensten,exklusivstenMarkenderWelt –wowäreEvergreenbesseraufgehoben?«, hatte mein Vater mit diesem Lächeln gesagt, das von außen betrachtet leicht als überheblich verstanden werden konnte. Ich wusste, was es wirklich war: stolz. Charles Evergreen war stolz auf das Unternehmen, das bereits seit hundertfünfzig Jahren von seiner Familie geführt wurde und dessen Geschäftsführer er seit rund zwanzig Jahren war. Und wie hätte er es auch nicht sein können? EvergreenEmpire war seit Jahrzehnten die umsatzstärkste Parfümmarke Großbritanniens, und auch weltweit gehörte sie zu den führenden Unternehmen. Jeder Mensch in diesem Land hatte bereits von uns gehört oder, besser gesagt, gerochen.
Mein Vater erwartete mich direkt vorm Eingang des Hauses, das momentan alles andere als luxuriös aussah. Ein Gerüst umschloss die cremeweiße Fassade, Plastik verdeckte die Fensterflächen. Die Umbaumaßnahmen liefen noch, wir planten die Eröffnung erst Ende des Jahres. Es war nicht Dads Aufgabe, hier regelmäßig nach dem Rechten zu sehen, aber es fiel ihm schwer, die Kontrolle abzugeben. Etwas, das ich von ihm geerbt hatte. Oder gelernt. Manchmal konnte ich diese beiden Dinge nicht mehr auseinanderfühlen.
Er lächelte, als er mich bemerkte. Die Ärmel seines Hemdes waren hochgekrempelt, das Jackett hatte er sich über die Schulter gehängt, sein dunkles Haar ordentlich aus der Stirn gestrichen. Wie jedes Mal weigerte ich mich, über die grauen Strähnen darin nachzudenken. »Da bist du ja.«
»Ich bin nicht zu spät, oder?« Beunruhigt warf ich einen Blick auf meine Uhr, die unter meinem Ärmel hervorblitzte. Der Termin mit dem Bauleiter war erst in zehn Minuten.
Dad schüttelte den Kopf und legte mir eine Hand auf den Rücken. Wir waren fast gleich groß, ich hatte neben ihm trotzdem immer das Gefühl, ein wenig zusammenzuschrumpfen. Vielleicht war das so, wenn man es sich ein Leben lang antrainiert hatte, zu jemandem aufzusehen. »Komm, ich will dir etwas zeigen, bevor wir mit Mr Bingham über die Fortschritte sprechen.«
Im Inneren erwartete uns eine Baustelle. Der Boden war mit Planen ausgelegt, überall verteilt standen Schleif- und Bohrmaschinen, Kabelrollen und Säcke voll abgerissener Tapete, eine Schicht aus Staub und Putz schwebte über allem.
Wir grüßten ein paar Arbeitende im Vorbeigehen, ehe mein Vater zielstrebig auf ein hinten gelegenes Zimmer zusteuerte. Skeptisch betrachtete ich das Absperrband, das die Tür verklebte und unter dem er, ohne zu zögern, durchtauchte. »Dürfen wir hier überhaupt rein?«
»Wir haben dieses Gebäude gemietet, schon vergessen? Außerdem dauert es nicht lang.« Er schmunzelte und bedeutete mir, ihm hinterherzukommen.
Der Raum war nicht allzu groß, auf den ersten Blick unauffällig. Weiße unverputzte Wände, Nussbaumparkett, das durch das darüberliegende Plastik matt glänzte, keine Fenster, nur eine Tür nach nebenan. Stirnrunzelnd sah ich Dad an, er zeigte nach oben. Erst als ich seinem Wink folgte, begriff ich, worauf er hinauswollte.
Im großen Kontrast zum restlichen Haus wirkte dieses Deckengewölbe bereits fertig. Ein Kunstwerk aus Pastelltönen: goldene Farbkleckse zwischen graublau getupften Wolkenbäuchen, darüber feine Spritzer in einem dunklen Rosaton. Ein falscher Himmel mitsamt Unwettergeräuschen, weil dahinter deutliches Poltern zu hören war. »Was machen sie da oben?«
»Sie haben vor Kurzem Wände eingerissen, ich nehme an, die müssen abgetragen werden.« Dad winkte ab und deutete abermals hinauf. »Sieh richtig hin. Schön, nicht wahr?«
Ich nickte nur, weil ich nicht wusste, was er hören wollte. Die Gestaltung der Verkaufsräume hatte eine Agentur übernommen, das war nichts, was in mein Aufgabengebiet fiel. Fakten, Daten, Entscheidungen – daraus bestand die Seite unseres Unternehmens, auf der ich mich aufhielt.
»IchbinderKopfvonEvergreen«, hatte Dad früher oft gesagt. Seit ein paar Monaten war aus dem Ich ein Wir geworden. Das warme Gefühl, das mich dabei jedes Mal überkam, war die beste Entschädigung dafür, dass mein eigener Kopf mit jedem weiteren Tag in dieser Rolle mehr schmerzte, weil er so vieles aufnehmen musste.
»Ich habe Bingham gebeten, die Decke so gut wie möglich zu erhalten«, erklärte er jetzt und musterte die Stuckzierden direkt über uns. »Irgendwie erinnert sie mich daran, wie oft wir früher die Zimmerdecke deiner Schwester neu gestrichen haben. Ihr Geschmack war schon immer so wechselhaft wie das Wetter.« Er hob die Mundwinkel zu einem ungewöhnlich sanften, fast traurigen Lächeln, das ich in letzter Zeit ab und zu auf seinem Gesicht entdeckte.
Ich wandte mich jedes Mal ab, wenn es auftauchte. Auch diesmal starrte ich stattdessen auf die glänzenden Spitzen meiner Lederschuhe. »Und ihre Launen«, murmelte ich zynisch.
Sofort drückte sein Blick gegen meine Schläfe. »Wann hast du sie zuletzt gesehen?«
Und du?, wollte ich im ersten Moment erwidern. Ich habe keine Zeit für so was, im zweiten. Beides blieb unangenehm schmeckend auf meiner Zunge kleben. Das passierte seit Kurzem öfter: Mein Mund kam mir vor wie eine Fliegenfalle, in der sich Wörter verfingen. Bittere Buchstabenleichen, die ich auch jetzt kommentarlos herunterschluckte. Es hätte nichts gebracht, sie auszusprechen.
Dad wusste, wie mein Alltag aussah: Er war es, der ihn gestaltete. Seit meinem Abschluss in Oxford bestand mein Leben aus wenig Schlaf und viel Koffein, aus Abenden, an denen ich von der Wohnungstür meines Appartements direkt ins Bett fiel, und Tagen, in denen sich Verhandlungen, Vertragsprüfungen und Planungsgespräche nahtlos aneinanderreihten. Ich wollte mich nicht darüber beschweren. Die Arbeit für Evergreen Empire war mein Geburtsrecht und meine Lebenspflicht. Sie war das, was mich ausmachte und was meinen Platz in dieser Welt bestimmte. Sie war alles, was ich hatte. Alles, was ich war.
An all das hätte ich meinen Vater erinnern können, aber wir wussten beide, dass nichts davon etwas damit zu tun hatte, warum ich meine Geschwister lange nicht gesprochen hatte. Also verschränkte ich nur die Arme und betrachtete den Schmutz auf den Bodenleisten.
Dad machte einen Schritt auf mich zu. »Wo wir schon dabei sind … Ich fände es schön, wenn wir uns alle wieder regelmäßiger treffen würden. Außerhalb der Arbeit, meine ich.« Die Art, wie seine Stimme leiser und ruhiger wurde, machte klar, dass er von der Rolle meines Vorgesetzten in die meines Vaters übergehen wollte. Ich fragte mich seit Jahren, ob ihm nicht bewusst war, dass es dabei keinen Unterschied gab. Nicht für mich. »Einmal die Woche zusammen frühstücken, zum Beispiel. Wie früher immer sonntags.«
Sonntags. Ich blinzelte, das Wort verfing sich zwischen meinen Wimpern und verschwamm zu Bildern. Allein diese Erwähnung zog eine erinnerungsbestickte Leinwand in mir auf. Auch wenn es schwer war, Vergangenes durch reine Gedankenkraft riechen zu können, war es dennoch grausam einfach, es zu fühlen.
»Rosehill ist so leer ohne euch«, fügte er hinzu, als ich nicht antwortete. »Ihr fehlt mir. Unser Zuhause fehlt mir.«
Mein erster Impuls war es, nachzugeben und mich darauf einzulassen. Immerhin war ich daran gewöhnt zu tun, was er sagte. Weil ich ihm vertraute und außerdem wusste, dass es von mir erwartet wurde. Aber hierbei ging das nicht. Bei der Vorstellung, wöchentlich in unser Elternhaus zurückzukehren, verkrampfte sich alles in meiner Brust. Nicht nur wegen der Menschen, die nicht mehr dort waren. Vor allem wegen des einen Menschen, der noch da war. Der einfach nie gegangen war – in jeder verdammten Hinsicht. Es gab einen guten Grund dafür, warum ich meine Besuche in Rosehill seit Jahren so sporadisch und kurz wie möglich hielt.
»Es ist doch eh nicht mehr wie früher. Mum ist tot.« Meine Stimme stolperte nach rund viereinhalb Jahren nicht mehr über diesen Satz, mein Herz immer noch. Genervt zog ich den Kragen meines karierten Jacketts zurecht und drückte einen Handballen auf meine Brust. »Mari macht ihr Ding, und wenn wir uns sehen, ist es, als würde ich eine Fremde anstarren. Keaton ist über achttausend Kilometer entfernt und führt ein Leben, das ich nicht im Geringsten kenne, weil er nicht mal drangeht, wenn ich anrufe.«
Da war etwas Trübes in Dads Blick, das ich in letzter Zeit ebenfalls öfter dort entdeckte. Jedes Mal war es wie ein Schlag in den Magen, weil das Gefühl dahinter das Letzte war, das ich auslösen wollte. Enttäuschung. »Wir sind trotzdem noch eine Familie, Odell.«
Ich zuckte mit den Schultern und stemmte mich gegen den Drang, mich zu entschuldigen. Es war nicht mein Fehler, wie sich die Dinge verändert hatten. Ich hatte nicht das Land verlassen wie Keaton. Ich war nicht in eine Subwelt aus Oberflächlichkeiten geflohen wie Mari. Ich war geblieben. Bei Dad. Für Evergreen. »Kann sein. Aber was bedeutet das überhaupt?«
Mein Vater öffnete den Mund, doch er kam nicht mehr dazu, etwas zu erwidern.
Alles auf der Welt hat einen Geruch.
Es dauerte dreiundzwanzig Jahre, bis ich lernte, dass das nicht stimmte. Dass es etwas gab, das völlig geruchlos war: Gefahr.
Wenn ich später an diesen Moment vor dem Moment zurückdachte, dann war da nur der Duft des trockenen Baustaubs, der in Flusen durch den Raum tänzelte, und der meines Aftershaves, dessen beißender Minzbestandteil sich mir bereits den ganzen Morgen in die Schläfen grub. Darunter noch schwach Londons Straßengeruch, zusammengesetzt aus regenfeuchtem Asphalt, dem Mandelduft blühender Schneeforsythien, atemerschwerenden Abgasen und etlichen Parfümnuancen, die mir im Laufe des Tages an vorbeieilenden Personen begegnet waren und sich in meine Anzugfasern gegraben hatten. Da war nichts Vergorenes, nichts Penetrantes, nichts, das mich im Ansatz davor gewarnt hätte, was passieren würde. Der Sinn, auf den ich mein ganzes Leben lang am allermeisten vertraut hatte, ließ mich im Stich.
Zuerst hörte ich es: das Poltern über uns, so laut, dass ich zusammenzuckte, ein unverständliches Rufen jenseits der Wände, das plötzlich heftiger werdende Pochen meines Herzschlags in meinen Ohren. Mein Blick schoss nach oben, fing den blaugrauen Putz ein, der auf uns hinabrieselte: aufbrechende Wolken, aus denen sich Staubschnee löste. Dann zur Seite, in das Gesicht meines Vaters: aufbrechende Züge, durch die ein Gefühl schimmerte, das ich dort noch nie gesehen hatte und nicht verstehen konnte. Ich nahm seine Hand an meinem Ellbogen wahr, ich sah, dass seine Lippen sich bewegten, aber ich hörte nichts bis auf den Lärm über uns, und ich spürte nichts bis auf das Beben, das durch das Gebäude und auf mich überlief.
Da war keine Vorahnung in mir, da war keine Angst. Da war nur ein seltsam klarer Moment, bevor alles in Staub und Schmerz versank. Ein einziger Gedanke, der sich in meinem Kopf ausdehnte und alles einnahm: In der Sekunde, bevor der falsche Himmel über uns zusammenstürzte, wusste ich, dass er eine ganze Welt unter sich begraben und zerstören würde.
Meine Welt.
1
Emmeline
Welcher Ort wärst du?
Ich war sechzehn gewesen, als uns diese Frage in der Schule gestellt worden war. Wir schrieben unsere Antworten auf Zettel und hängten sie an die Tafel. Meine Klassenkameraden wählten die Namen von schillernden Großstädten oder exotischen Inseln, die sie größtenteils nur gedanklich bereist hatten – ein Ausdruck davon, wie fremd man sich selbst in diesem Alter noch war. Zwischen ihren wirkte mein Zettel wie ein Fehler. Ein einzelnes Wort darauf, das allen etwas sagte, auch wenn viele sich bemühten, es aus ihrem Wortschatz zu streichen. Friedhof.
Ich erinnerte mich an das Lachen meiner Sitznachbarin ebenso wie an den besorgten Blick meiner Lehrerin, die danach das Gespräch mit mir suchte. Das war einer dieser Momente, in denen ich begriff, dass ich manche Dinge anders sah, als es vielleicht üblich gewesen wäre.
Friedhöfe waren für mich nie bedrückend oder schmerzhaft gewesen. Ich hatte nie an Tod oder Trauer gedacht, wenn ich an den Grabsteinen entlangspaziert war. Eher daran, dass immer etwas blieb, selbst wenn man ging. Menschen füllten diese Orte mit Rückblicken auf diejenigen, die sie hier besuchten. Mit Kopfbildern und Gefühlen, durch die sie nach wie vor mit ihnen verbunden waren, auch wenn sie nicht mehr zusammen sein konnten. Friedhöfe speicherten Erinnerungen. Und ich … ich tat das eben auch.
Ich erinnerte mich an alles. Schon immer und für immer. Damals war ich dankbar dafür gewesen, aber damals waren mir meine Erinnerungen auch alle wertvoll vorgekommen. Winzige Diamantsplitter, die ich in meinen Gedankenschatullen verwahrte und mehr liebte als alles andere. Mittlerweile dachte ich, dass genau darin das Problem lag. Womöglich war es ein Zeichen von Armut, wenn Erinnerungen das Kostbarste waren, was man hatte.
Wahrscheinlich war das der Grund, aus dem ich in den zurückliegenden Jahren nur zu zwei Anlässen einen Friedhof betreten hatte. Nicht freiwillig, sondern weil es manchmal die einzige Möglichkeit war, einem Menschen zum letzten Mal zu zeigen, dass man ihn liebte.
Allein bei diesem Gedanken bäumte sich der Schmerz, der in den vergangenen Tagen ein wenig abgeflacht war, erneut auf. Ich drängte ihn zurück, indem ich mich auf meine Umgebung konzentrierte. Und zwar so, wie ich es am besten konnte. Ich verlangsamte meine Schritte, schloss die Augen, legte den Kopf in den Nacken und atmete tief ein.
Meine Nase juckte, wie immer, wenn sich etliche Gerüche miteinander verwoben. Es fühlte sich an, als würde sie versuchen, jeden einzelnen davon in seine winzigen Bestandteile aufzudröseln. Ich konnte es schlecht steuern und überhaupt nicht verdrängen. Manchmal war dieser permanente Aufmerksamkeitsdieb etwas hinderlich, in Augenblicken wie diesem war ich dankbar dafür, dass er schon immer Teil von mir war. Innerhalb von Sekunden zeichnete mein Geruchssinn das in meinem Bewusstsein nach, was ich gerade noch gesehen hatte. Den Efeu, der über den Steinplatten wucherte, das Moos, das die einst goldenen Gravuren sattgrün färbte, die feingliederigen Farne, die sich über die Pfade zwischen den Gräbern beugten. Ein in jeder Hinsicht buntes Bild, das sich in mir ausbreitete und kurz davon ablenkte, wie grau und blass mir alles seit Wochen vorkam.
Ich atmete ein letztes Mal durch und öffnete dann die Augen, um meinen Schritt zu beschleunigen. Auch wenn der Highgate Cemetery mittlerweile wieder gepflegter war als vor einigen Jahrzehnten, war es deutlich: Die Natur eroberte sich diesen Fleck Erde stetig zurück. Vielleicht wollte sie beweisen, dass inmitten all der Toten noch etwas Lebendiges existierte. Das hier war der nostalgischste Ort Londons und als Kind einer meiner liebsten gewesen. Bis ich begriffen hatte, dass Erinnerungen nicht nur tröstlich und schön waren. Manchmal waren sie eine Grenzziehung zwischen einem Damals, das man mit einem Immer verwechselt hatte, und einer Zukunft, die man nie gewollt hatte. Vermutlich ergab das Sinn: Diamanten konnten aus Asche gewonnen werden. Warum sollten sie nicht wieder zu solcher zerfallen können?
Ich umfasste das Medaillon an meinem Hals und bog eilig in einen wurzelüberzogenen Waldweg, gesäumt mit Steinkreuzen, aufgebrochenen Grabplatten und Engelsstatuen. Die Trauerfeier fing in einer Dreiviertelstunde an, und ich hatte Mari versprochen, etwas früher da zu sein.
Sobald ich den höhergelegenen westlichen Teil der Anlage erreichte, ragten immer mehr Mausoleen aus dem Boden hervor. Der Highgate Cemetery erhielt die Trennung von Arm und Reich über den Tod hinaus aufrecht. In dem Bereich, in dem ich mich gerade bewegte, wurden seit dem frühen 19. Jahrhundert nur die wohlhabendsten Menschen beerdigt. Die Gräber der Evergreens, einer der vermögendsten Familien Englands, waren seit Generationen hier. Meine Großeltern hingegen waren im östlichen Teil begraben. Ich hätte mich auch ohne dieses Wissen fehlplatziert gefühlt, sobald sich die Kapelle vor mir aufbaute.
Das Tor war geschlossen, mehrere Sicherheitsangestellte standen davor. Ich nannte dem Einlasskontrolleur meinen Namen und versuchte, die Reporter in einigen Metern Entfernung auszublenden, während ich darauf wartete, dass er ihn mit der Gästeliste abglich. Eine Gästeliste für eine Beerdigung. Das war eines dieser Dinge, die nur in der Welt der High Society Sinn ergaben. Auch nach all den Jahren fühlte es sich noch surreal an, dass diese sich in Teilen mit meiner überschnitt.
Trotz der Aprilsonne am ungewohnt blauen Himmel begann ich, in meinem schwarzen Strickkleid zu frösteln, als ich mich der Menschenmenge vor dem Eingang der Kapelle näherte. Ich sah Mari schon von Weitem. Sie stand etwas abseits neben einer Säule, in einem Kleid aus schwarzem Samt, das enger und kürzer war, als es vermutlich im Knigge vorgeschrieben war. Aber Mari interessierte die Meinung anderer in der Regel nicht, sonst hätte sie sich nicht demonstrativ von den Trauergästen distanziert. Ein paar waren entfernte Mitglieder der Familie, weitaus mehr gehörten zum Geschäftskreis von EvergreenEmpire oder waren Teil von Londons Oberschicht: Unternehmer, Politiker, Medienberühmtheiten – kurzum Menschen, deren einzige offensichtliche Gemeinsamkeit Geld war.
Mein Innerstes zog sich vor Mitgefühl und Zuneigung zusammen, während ich auf Mari zulief. Alles an ihr strahlte aus, wie allein sie sich trotz der Anwesenheit der Gäste fühlte. Allein und vor allem alleingelassen.
»Menschen können auf verschiedene Arten zu Gespenstern werden«, hatte sie letztens gesagt. Bei dem Telefonat, in dem sie mir davon erzählt hatte, dass keiner ihrer Brüder an der Beerdigung ihres Vaters teilnehmen würde. Ich hatte ihre Verbitterung verstanden, dennoch löste der Gedanke dahinter irgendwie Erleichterung in mir aus. Heimgesucht zu werden fühlte sich für mich trotz allem manchmal, in schwachen Momenten, wie nach Hause kommen an.
»Hey«, meinte ich und legte eine Hand auf ihren Unterarm, sobald ich bei ihr angelangt war. Ihr offenes Haar duftete stärker als sonst nach ihrem Parfüm.
Sofort spaltete sich der komplexe Duft in meinem Bewusstsein in seine Bestandteile auf. Freesien, Vanille und Cashmeran: Wörter, die in meinen Gedanken zu Erinnerungen wurden, die in Gefühlskleider hineinschlüpften und sich darin in mir ausstreckten. Mein Kopf war bunt, mein Herz schwer, als ich blinzelte. Aubade von Evergreen, ein intensiver, manchmal fast drückender Duft, der mir an Mari falsch vorkam, weil er ursprünglich der ihrer Mutter gewesen war. Bei Susannes Trauerfeier hatte ich ihn das erste Mal an meiner besten Freundin wahrgenommen. Im Laufe der vergangenen viereinhalb Jahre hatte ich mich daran gewöhnt, aber heute tat es fast so weh wie damals, ihn zu riechen. Ein Parfüm konnte den Anwesenheitsschatten von Menschen heraufbeschwören, die nicht mehr da waren. Manchmal war das tröstlich, manchmal kaum erträglich.
»Entschuldige, dass ich so spät bin. Ich hab einen Umweg genommen, um den Kopf frei zu bekommen.« Was natürlich nicht funktioniert hatte. Seit Maris Anruf vor anderthalb Wochen war mein Inneres voller Erinnerungsasche. Jeder Satz war ein Hammerschlag gegen die Wände meiner Selbstbeherrschung gewesen, die ich fast sechs Jahre lang mühsam aufgebaut hatte, um bestimmte Dinge aus meinem Bewusstsein auszusperren. Und mit ihnen war so viel mehr zerfallen.
»Nicht schlimm. Ich bin froh, dass du da bist.« Ihr Gesicht war geschminkt und wirkte trotzdem nackt. Da war kein schützender Schleier oder Schatten einer Hutkrempe wie bei der Beerdigung ihrer Mutter. Ihre blauen Augen waren weder verquollen, noch wichen sie den Blicken aus, die sie aus der Ferne betrachteten. Maris Verteidigungsstrategie war seit langer Zeit Angriff.
Ich stellte mich so vor sie, dass den Anwesenden die Sicht auf sie genommen wurde. Sofort sanken ihre Schultern zwei Zentimeter hinab. »Natürlich bin ich da. Er war für mich das, was einem Vater am nächsten gekommen ist.« Sacht stupste ich sie in die Seite, ihre bevorzugte Art, umarmt zu werden. »Und du bist quasi meine Schwester, das weißt du.«
»Tja, du auch meine – mehr als meine Brüder Brüder sind.« Sie lächelte auf diese spezielle, resigniert wütende Weise, die ich nur von ihr kannte. Wie immer, wenn unsere Gespräche dieses Thema streiften.
»Es ist nicht seine Schuld, dass er nicht hier sein kann«, erinnerte ich sie leise.
Mir war klar, dass Mari wusste, welchen ihrer Brüder ich meinte. Sie hatte selbst vergebens versucht, mit den Ärzten nach einer Lösung zu suchen, als der Termin der Beerdigung nicht mehr aufgeschoben werden konnte.
»Diesmal nicht.« Mari ließ ihre Kette durch ihre Hand gleiten, als wäre jede einzelne Perle ein Aber-damals-schon.
Ich warf einen Blick über meine Schulter, doch die anderen Gäste waren außer Hörweite. Wäre da nicht das gedämpfte Stimmengewirr gewesen, das bis zu uns hinüberwehte, hätten sie wie gleich aussehende, dunkel lackierte Pappaufsteller wirken können. »Warst du in den letzten Tagen bei ihm?«, hakte ich beiläufig nach, weil ich nicht fragen konnte, was ich eigentlich wissen wollte. Wiegehtesihm?Kommterdamitklar,dasserdasKrankenhausnichtverlassenkann,umheutehierzusein?WanndarfernachHause?Istihmbewusst,dassichjedenTaganihndenke? Die letzte Frage war die, die ich am wenigsten aussprechen konnte. Es gab schlicht keine Antwort darauf, die ich hören wollte.
Mari nickte. »Aber keine Ahnung, wie es ihm genau geht. Die Ärzte sagen mir nichts. Ich glaube, er hat dafür gesorgt, und er selbst würde vor mir nicht mal Schwäche zugeben, wenn einzig und allein meine Niere ihm das Leben retten könnte. Du kennst ihn.«
Tu ich nicht, dachte ich. Nicht mehr. Der Gedanke war unangenehm pelzig und belegte meine Zunge. Irgendwie auch mein Herz. Irgendwie alles.
»Voraussichtlich wird er nächste Woche entlassen. Es wird ihm wieder gut gehen. Oder zumindest … besser.«
Dir auch, wollte ich sagen. Uns allen.
Ich tat es nicht, aus Angst, dass es sich wie eine Lüge anfühlen würde. Momentan kam es mir vor, als könnte nie wieder irgendetwas weniger schlimm werden. Wie auch? Charles war tot. Mari und ihre Brüder hatten keinen Vater und damit keine Eltern mehr. Meine Mutter keinen Arbeitgeber mehr. Und sie und ich womöglich bald kein Dach mehr über dem Kopf.
Wir lebten seit fünfzehn Jahren auf dem Anwesen der Evergreens. Genauso lang war Mum dort als Haushälterin angestellt und meine Kopfbildantwort auf die Frage nach meinem Zuhause eine weiße, rosenumwachsene Villa in Hampstead gewesen. Die Hammerschläge, als Mari mir von dem Unfall erzählt hatte, hatten auch gegen diese Vision geklopft. Sie splitterte bereits, und ich ahnte, in den nächsten Wochen würde sie ganz kaputtgehen.
Mum und ich waren davon überzeugt, dass die Geschwister Rosehill verkaufen würden. Bestimmt würde keiner von ihnen dort einziehen, nicht, nachdem sie alle vor Jahren daraus geflüchtet waren. Ich machte ihnen keinen Vorwurf deswegen, aber bei dem Gedanken, dass dadurch meine Mutter ihre Vollzeitbeschäftigung, ich meinen Nebenjob und wir beide unser Zuhause verlieren würden, verkrampfte sich alles in mir.
»Du könntest ihn besuchen.«
Ich zuckte schwach zusammen und erwiderte Maris forschenden Blick. Kann ich nicht, dachte ich. Statt es auszusprechen, kniff ich nur die Lippen zusammen.
»Ich mein ja nur. Das würde ihm viel bedeuten.«
»Hat er das gesagt?« Mein Puls beschleunigte sich, meine Wangen wurden warm, ich schämte mich so dafür.
»Nein. Aber ihr nehmt eure Namen ja auch seit Jahren nicht mehr in den Mund. Es ist trotzdem offensichtlich, dass ihr sie noch im Kopf habt.«
Nicht im Kopf, im Herzen, dachte ich und hasste mich dafür. Weil es kitschig war und trotzdem stimmte – zumindest, was mich betraf. Das Ding in meiner Brust kam mir seit sechs Jahren selbst in den erfüllendsten Momenten ein bisschen verlassen vor, und das hatte mir eines klargemacht: Manchmal war die Abwesenheit von etwas – oder jemandem – präsenter als alles andere. Und dieser eine Mensch, der war eben mein ganz persönliches Herzgespenst.
Deswegen sprach ich seinen Namen nie aus. Ich hatte Angst, dass diese fünf Buchstaben etwas verraten würden, das ich mich nicht mehr traute zu sagen oder zu denken, aber immer noch fühlte. So sehr. Zu sehr. Namen konnten auch zu Friedhöfen werden, wenn sie zu viele Erinnerungen speicherten.
Das war der Punkt: Selbst wenn es ihm, trotz allem, was ich glaubte, etwas bedeuten würde, mich im Krankenhaus zu sehen, könnte ich es nicht. Er hatte uns jede Bedeutung vor langer Zeit entzogen. Ein Besuch bei ihm würde sich wie die Suche nach etwas anfühlen, das ich längst verloren hatte.
»Oder willst du das wieder verheimlichen, als wäre es eine Straftat?«, setzte Mari hinterher.
Ich zupfte einen Fussel von meinem Kleiderärmel, um sie nicht ansehen zu müssen. Mir war klar, was sie damit andeutete. Das neuste von vielen Geheimnissen, die wir gemeinsam gesammelt hatten. »Du hast es mir versprochen«, flüsterte ich.
Mari seufzte und lehnte sich mit dem Rücken gegen die Säule der Kapelle, stützte den Blockabsatz ihres Schuhs daran ab. »Richtig. Und ich halte mich daran und schweige. Es ist ja eh niemand mehr da, der zuhören würde.«
Die Art, wie sie bei diesen Worten in Richtung Kapelle blickte, rief mir ins Gedächtnis, worum es heute wirklich ging. Ich griff nach Maris Hand und verschränkte unsere Finger miteinander, auch wenn ich wusste, dass ihr solche bedeutungsvollen Berührungen manchmal schwerfielen. Diesmal zog sie sich nicht zurück, sondern erwiderte den Druck.
»Was ist denn mit Keaton?«, fragte ich vorsichtig. »Hast du ihn noch mal angerufen?«
Sie rieb sich mit dem freien Daumen über den Nasenrücken. »Wozu? Da kann ich genauso gut auf diesem Friedhof mit den Toten reden.«
»Sag so was nicht. Er ist …«
»Nicht hier.« Ihre Hand bebte in meiner. »Er ist wieder zurück in Kalifornien, weil er es nicht mal zwei Wochen in England aushalten konnte, um auf die Beerdigung unseres Vaters zu gehen.«
Ich strich über ihren Handrücken. »Menschen trauern unterschiedlich, Mari. Menschen sind unterschiedlich.« Geschwister ganz besonders. Wenn mich das Aufwachsen an der Seite der Evergreen-Kinder eines gelehrt hatte, dann das. Ich verstand Keatons Umgang mit dem Tod seiner Eltern ebenso wenig wie Mari, aber ich weigerte mich, wie sie zu denken, dass es ihm schlichtweg egal war.
»Hm.« Mari nickte und nahm ihre Hand aus meiner. »Manchmal zu unterschiedlich, um sich zu verstehen.«
Bevor ich etwas dazu sagen konnte, hörte ich die Schritte hinter uns. Im nächsten Moment berührte mich meine Mutter am Rücken. »Da seid ihr ja.« Sie küsste erst mich auf die Wange, dann zog sie Mari in die Arme. »Wenn du heute irgendetwas brauchst, lass es mich wissen, mein Schatz.«
Meine beste Freundin spannte sich erst sichtlich an, schloss schließlich aber die Augen und erwiderte die Umarmung. »Danke, Darleen«, antwortete sie, als sie sich wieder voneinander lösten. »Für alles. Ich hoffe, du weißt, dass wir …«, ihre Stimme brach, sie räusperte sich, »dass ich euch nie im Stich lassen würde. Sobald das alles vorbei ist, schauen wir …«
»Das ist jetzt nicht wichtig, Liebes«, fiel Mum ihr sanft ins Wort. Dabei war es natürlich wichtig. Trotz des guten Gehalts, das meine Mutter von Maris Eltern erhalten hatte, waren unsere Rücklagen gering. Mum hatte ihr Erspartes immer in meine Zukunft investiert. Erst in meine Schulausbildung, dann in mein Studium an der University of London. Auch wenn ich mir seit Jahren etwas dazuverdiente, hätte ich mein Leben ohne ihre Unterstützung nicht finanzieren können. Meine Mutter hatte immer alles getan, damit es mir an nichts fehlte, ohne auch nur eine Sekunde an sich zu denken.
Und wie dankst du es ihr?
Ich wusste nicht, was stärker pochte: mein Gewissen oder mein Herz, das vor Traurigkeit schwer wurde, als ich Mum betrachtete. Ihre grünen Augen schimmerten tränenfeucht, das taten sie seit anderthalb Wochen durchgehend.
»Dieser Tag ist nicht dafür da, um nach vorn zu sehen. Er ist dafür da, um Abschied zu nehmen.« Sie streichelte Mari über die Wange, ehe sie zurückwich. »Ich gehe ein paar Leute begrüßen und frage, ob ich noch irgendetwas tun kann. Wir sehen uns gleich.«
Mari rang sich ein Lächeln ab. Ihr Kiefer war dabei so angespannt, dass ich ihren Schmerz fast selbst fühlte. Sie sah Mum nach, bis diese zwischen den versammelten Gästen verschwunden war. Mit jedem Gesicht, das ihr Blick streifte, verschloss sich ihr eigenes weiter. Als sie sich wieder auf mich konzentrierte, war keine Regung mehr darin zu erkennen. »Wo wollt ihr gleich sitzen?«
Ich lächelte schwach. Maris Worte und Handlungen waren oft doppellagig. Man musste genau hinsehen, um zu erkennen, was sich wirklich dahinter verbarg. So war sie immer gewesen. Sie sagte nicht, wenn sie Hilfe brauchte oder sich nach irgendeiner Form von Unterstützung sehnte. Vielleicht war das so, wenn man als jüngstes von drei Kindern aufgewachsen war und immerzu die älteren Brüder vor Augen hatte, die in allem weiter und besser zu sein schienen. Mari war mit dem Drang groß geworden, die Dinge allein hinbekommen zu können. Ich versuchte seit fünfzehn Jahren, ihr zu zeigen, dass Können nicht immer Müssen bedeutete.
Erneut griff ich nach ihrer Hand. »Ich bleib bei dir.«
Mari erwiderte den Druck, ein stummes Danke, das nicht nötig war. Nicht nur, weil sie meine beste Freundin war. Auch, weil ich eben ich war. Wenn alle gingen, war ich die, die blieb.
Früher hatte ich gedacht, das wäre die sicherste Möglichkeit, um etwas zu halten. Um sich selbst zu halten. Doch seit einer Weile stand ich da, sah mein Leben und das all der anderen vorbeiziehen und bekam von Tag zu Tag mehr das Gefühl, dass das nicht stimmte. Man konnte sich auch im Stillstand verirren. Wenn sich alles um einen herum so veränderte, dass man irgendwann nicht mehr wusste, wo oder wer man war. Oder wohin und … zu wem man gehörte.
Vielleicht speicherten Friedhöfe nicht nur Erinnerungen, sondern auch Verluste. So wie ich auch. Das würde zumindest erklären, warum ich mich seit Jahren so verloren fühlte.
2
Odell
Alpenveilchen-Aldehyd, Amber, Cashmeran, Geraniol …
Feiner Schmerz schoss durch meine Schläfe und riss die Gedankenkette in der Mitte durch.
Ich presste einen Handballen dagegen und versuchte, mich zu konzentrieren, aber die fehlenden Duftstoffe fielen als lose Perlen durch die Ritzen meines Bewusstseins und rollten ins Nirgendwo. Dorthin, wo seit Wochen so vieles verschwand. Manches auf einen Schlag, manches schleichend, sodass ich es erst bemerkte, wenn ich aus einer Routine heraus danach tastete und meine innere Hand ins Leere griff.
Frustriert kniff ich mir in die Nasenwurzel, ehe ich mir bewusst machte, wo ich stand. Mit dem nächsten Atemzug richtete ich mich auf und verschränkte die Hände hinter dem Rücken. Mein Blick fokussierte sich auf die Reflexion meines Gesichts, die in einen beruhigenden Blauton gegossen war. Das kirchenbunte Mosaikglas wölbte sich über mir zu einer Kuppel, die sich über die Brücke in der vierten Etage zwischen den Flügeln des Unternehmensgebäudes spannte. Wenn man die Themse auf der nahe gelegenen Lambeth Bridge überquerte, konnte man bereits von Weitem die Ausbuchtung des Dachs erkennen. Es erhob sich gläsern und rund wie der Deckel eines aufwendig geschliffenen Flakons über Westminster.
Die Brücke, auf der ich stand, war ebenfalls aus Glas. Als Kind hatte ich Angst davor gehabt. Ein unsichtbarer Boden bedeutete für mich einen unsicheren Boden. »Das Einzige, was du mit Sicherheit kontrollieren kannst, bist du selbst. Du musst lernen, deinen eigenen Füßen mehr zu vertrauen als allem anderen«, hatte Dad einmal gesagt, als er meine Beunruhigung bemerkt hatte, während wir zu seinem Büro liefen. Vielleicht hatte er damit sogar recht gehabt, das Problem war nur: Momentan traute ich mir selbst deutlich weniger als dem Glasboden unter mir. Aber ich würde nicht zulassen, dass irgendjemand das mitbekam. Ich war kein Kind mehr. Auch wenn die Blicke, die sich aus allen Stockwerken in meinen Rücken brannten, höchstwahrscheinlich genau das in mir sahen.
Mein Nacken prickelte, am liebsten hätte ich eine Hand darin vergraben. Stattdessen zwang ich mich, unbeeindruckt nach draußen zu sehen. Ich versuchte es zumindest, aber mein Fokus blieb an meinem Gesicht hängen.
Mein Leben lang war mir gesagt worden, ich würde aussehen wie mein Vater. Dasselbe dunkelbraune Haar, dieselben Augen in ähnlicher Farbe, derselbe schmale Nasenrücken, dieselben Grübchen in der rechten Wange. Fotos meiner Kindheit ließen sich kaum von denen seiner unterscheiden. »Gruselig«, hatte Mari dazu immer gesagt, doch ich hatte es eher beruhigend empfunden. Indem ich Dad älter werden sah, blickte ich in meine Zukunft. Nicht nur in der Art, wie sich sein Gesicht veränderte, einfach in allem, was er war. Alles, was er getan hatte, sollte ich auch irgendwann tun. Alles, was er gewusst hatte, sollte ich auch irgendwann wissen. Alles, was er gewesen war, sollte ich auch irgendwann sein.
Das war der Plan gewesen. Unser Plan, an dem wir festgehalten hatten, seit ich ein Kind gewesen war. Doch jetzt, wo er hatte loslassen müssen, war alles lose. Es ergab Sinn, dass ich mir selbst nur noch planlos vorkam.
Ich verdrängte das aufsteigende Gefühl, das an diesem Gedanken hing, und fokussierte meine verwaschenen Züge. Unsere Züge. Der Blauton ließ sie weicher werden, vielleicht waren es in diesem Moment deswegen eher seine als meine. Seltsam, dass eine Reflexion auch das zeigen konnte, was man gern in sich selbst sehen würde. Was man gern wäre. Oder, in meinem Fall: Was man von nun an sein musste.
Wie passend, dass ich mich vorhin ausgerechnet an dieses Parfüm zu erinnern versucht hatte und daran gescheitert war: Oblivion by Charles Thomas Evergreen. Der erste Duft, der unter Dad als Geschäftsführer herausgebracht worden war und deswegen seinen Namen trug. Und der, den er ab diesem Zeitpunkt zu seinem gemacht hatte.
Als Kind war das meine liebste Einschlafgeschichte gewesen. Mum hatte unzählige Male an meinem Bett gesessen und mir davon erzählt. Wie Dad eines Abends nach Hause kam und sie schon von der Tür aus riechen konnte, dass etwas anders war. »Der Duft seines Lächelns lag in der Luft, bevor er das Zimmer betreten hatte«, hatte sie gesagt und mir mit dem Daumen über den Mundwinkel gestrichen. Diese Geste war mir wie ein Versprechen vorgekommen: darauf, dass ich – wenn ich es richtig machte – dieses Lächeln eines Tages auch tragen würde.
Ich versuchte, mich daran festzuhalten, aber meine Mundwinkel fühlten sich auch rund zwei Wochen nach meiner Entlassung noch wund an. Manchmal, wenn ich sie reflexartig anhob, spürte ich, wie sie leicht einrissen. Als würde mein Körper mich sofort auf schmerzhafteste Weise daran erinnern wollen, dass es keinen Grund mehr gab, sich zu freuen. Und keinen Grund mehr, an alten Versprechen festzuhalten.
Selbst der Name von Dads Lieblingsparfüm schien mich nur noch zu verspotten. Oblivion: der Zustand, in dem man sich nicht darüber bewusst ist, was um einen herum geschieht. Der, in dem ich seit vier Wochen festhing.
Ich hatte das Gefühl, mich in einer Blase zu befinden. Egal, wohin ich sah, alles verschwamm hinter Milchglas. Egal, mit wem ich sprach, in meinem Inneren blieb dieses dumpfe Rauschen. Egal, wohin ich ging, ich prallte gegen Wände. Ich suchte verzweifelt nach einer Öffnung, nach irgendetwas, das mich mit der Welt verband, doch da war nichts. Ich war allein – und nicht mal darauf, auf mich, konnte ich mich noch verlassen.
Ein neuer Versuch. Ich schloss die Augen. Legte den Kopf in den Nacken. Weitete die Nasenflügel. Atmete tief ein. Und aus. Und ein. Und wartete. So, wie ich seit Wochen wartete. Auf etwas, das einfach nicht passierte. Auch jetzt nicht.
Am liebsten hätte ich vor Frust geschrien, als das Erste, das ich von meiner Schwester wahrnahm, ihre Schritte waren. Absätze auf Glasboden, mein Herzschlag, der sich unweigerlich dem entschlossenen Gang anpasste. Es hatte Zeiten gegeben, da hatte mich ihre Nähe gelassener werden lassen. Mittlerweile bedeutete Maris Anwesenheit in der Regel nur noch eins: Schwierigkeiten.
Ich bemühte mich trotzdem um ein Lächeln, als ich mich ihr zuwandte, und bereute es sofort. Etwas Warmes rann von meinen Mundwinkeln zwischen meine Lippen, ich schluckte, bevor es meine Zunge erreichte. Mein Verstand schaffte es auch allein, das zu begreifen: Lächeln bedeutete neuerdings, Blut zu schmecken.
Ich hätte mir die Mühe sparen können, Mari beachtete mich eh kaum. »Weißt du, warum es so klar ist, dass diese Brücke von Männern gebaut wurde?«, fragte sie ohne Begrüßung, ehe sie neben mir anhielt. »Sie ist sexistisch. Ganz Evergreen kann mir unter den Rock gucken.«
Ich betrachtete ihr Outfit – schwarz schimmernder Satinrock, ebenso kurz wie der Pullover, der ihren Bauchnabel frei ließ, dazu Boots mit Blockabsatz, die sie so groß machten, dass sie mir bis zur Schulter reichte. Mehr Haut als Stoff, Maris bevorzugte Rüstung. Ein Teil von mir hätte ihr gern mein Jackett über die Schultern gelegt, aber ich wusste nur zu gut, dass sie es, ohne zu zögern, übers Geländer geworfen hätte.
»Du könntest dir eine Hose anziehen«, schlug ich stattdessen vor. Oder weitergehen. Geh einfach weiter. Geh einfach … weg. Ich schämte mich dafür, das zu denken. Es zu fühlen.
Mari stieß ein Schnauben aus und strich sich das dunkle Haar über den Rücken, sodass das fingernagelgroße Tattoo unterhalb ihres Schlüsselbeins sichtbar wurde. Es zeigte ein rundes, unruhiges Motiv, das ich nie ganz in seine Details zerlegen konnte. Ich hatte mir allerdings auch keine allzu große Mühe gemacht. Mari war grandios darin, Fragen aufzuwerfen, und noch viel besser darin, die Antworten für sich zu behalten.
»Ich lass mir nicht sagen, was ich anzuziehen habe. Weder von einem Gebäude noch von einem Haufen Patriarchen. Diese Brücke ist eine Metapher, das weißt du, oder? Sie soll Frauen zu verstehen geben, dass es in diesem Bereich des Unternehmens keinen Platz für sie gibt.«
»Mari.« Ich konnte es nicht verhindern, meine Hand wanderte erneut zu meiner Nasenwurzel. Eigentlich war ich geübt darin, meine Schwester auszublenden, aber gerade ertrug ich das einfach nicht. Der Termin der Besprechung, die bald anfing, hing seit Wochen über uns. Kein Schwert, eher ein Krug mit Eiswasser, der ab und zu einzelne Tropfen auf mich hinabfallen ließ und ein unangenehmes Brennen in meinem Nacken auslöste. Fast schlimmer als das der Aufmerksamkeit, die ich in diesem Moment spürte.
Mari verdrehte die Augen, ließ es jedoch darauf beruhen. Stattdessen umfasste sie das Geländer und lehnte sich vor, um hinabzublicken. An den Seiten konnte man die Gänge der tiefer liegenden Stockwerke erahnen, unter uns befand sich der Marmorboden mit Schachbrettmuster des Eingangsbereichs. »Sie beobachten dich, wenn du hier stehst.«
»Sollen sie.« Es war mir nicht nur egal, es war mir wichtig. Jeder Angestellte von Evergreen sollte sehen, dass ich hier war. Dass ich am Leben und – was vermutlich für viele von ihnen wichtiger war – bei der Arbeit war. Auch wenn ich noch nicht offiziell zurück war, würde meine Anwesenheit im Büro bemerkt werden.
»Warum machen wir es hier? Warum nicht in Rosehill?«
Meine Hand wanderte zu dem Knoten meiner Krawatte, dabei wusste ich, dass die Enge, die dieses Wort in mir auslöste, in mir selbst entstand. »Eine Testamentsverkündung ist ein geschäftlicher Termin. Das passt besser ins Büro.«
»Und das ist der einzige Grund? Ich frage nur, weil du – soweit ich weiß – nicht dort warst, seit Dad …«
»Falls es dir entgangen ist, ich war beschäftigt«, fiel ich ihr barsch ins Wort. Meine Stimme hallte bis in die Tiefe, und ich bildete mir ein, dass sich sofort weitere Blicke auf mir niederlegten. Hastig fixierte ich mein Fenstergesicht. Sei ruhig, sei bedacht, sei freundlich. Sei wie Dad. Sei … Dad. »Es wurde sich doch um alles gekümmert, oder nicht? Ich habe Hayden gebeten, das Nötigste in die Wege zu leiten.«
Es war paradox: Emotionale Ereignisse zogen die meisten Formalitäten nach sich. Die Organisation einer Beerdigung, das Aussortieren der persönlichen Besitztümer und Unterlagen, die Übertragung etlicher Verträge und die Übernahme laufender Kosten auf aktive Konten … Ich fragte mich, ob die Gesellschaft sich das ausgedacht hatte, damit Menschen nicht in eine Trauerschockstarre fielen. Und auch, ob ich mich anders – lebendiger – fühlen würde, wenn ich die Chance gehabt hätte, mich selbst darum zu kümmern.
»Ja. Natürlich hast du das.« Das bittere Lächeln, das an Maris Tonfall hing, zog den Knoten um meinen Hals enger.
Ich räusperte mich. »Bringen wir erst mal diesen Termin hinter uns, okay? Danach müssen wir uns eh überlegen, wie wir mit alledem verfahren.«
»Denkst du etwa darüber nach, Rosehill zu verkaufen?«
Ich denke gar nicht daran. Ich wagte es nicht, den Satz auszusprechen. Nur ihn zu denken zerpflückte seine Bedeutung zu Lügenkonfetti, weil die Wahrheit eben war: Ich dachte immerzu daran. All die Stunden allein in diesem Krankenhauszimmer hatten eine Tür in meinem Bewusstsein aufgestoßen, die ich die vergangenen Jahre mühsam zugehalten hatte. Und jetzt war alles wieder da. Die weiß gestrichene Fassade mit den Pilastern und Schmuckleisten, der rosendurchwebte Umhang über dem Eingang, den man bereits von Weitem sehen und riechen konnte. Der weitläufige Garten mit all seinen Geheimnisorten, der Leuchtturm, das Laboratorium, unser hauseigenes Museum und unsere Kinderzimmer: Maris falscher Himmel, Keatons Geheimfächer unter den Dielen, meine Holzkiste in der Schreibtischschublade.
Gerade an Letzteres dachte ich ständig. Weil ich ständig an sie dachte. Jedes Mal, wenn ich meinen Gedanken erlaubte abzuschweifen, sammelten sie sich an einem einzigen Punkt. Nicht direkt an Rosehill, aber an jemandem, der so eng damit verknüpft war, dass sich die Gefühle für beide längst verwoben hatten. Traurigkeit, Wut, Schuld. Und etwas deutlich Weicheres, Glänzendes, das sich zwischen all diese düsteren Fäden gesponnen hatte und dem ich mich nicht traute einen Namen zu geben.
Entschieden kniff ich die Augen zusammen, bis die aufsteigenden Bilder verblassten. »Ich werde jedenfalls nicht dort einziehen. Du etwa?«
Mari verzog den Mund zu einem unechten Grinsen, das die Lücke zwischen ihren Vorderzähnen betonte. Sie musste nicht antworten, wir wussten beide, dass sie nicht ohne Grund gleich an ihrem achtzehnten Geburtstag zu drei Freundinnen in Soho gezogen war. »Vielleicht will Keaton das ja tun«, erwiderte sie zynisch. »Wenn er überhaupt so lang bleibt, dass er einen Übernachtungsplatz braucht.«
Ich warf einen Blick auf meine Armbanduhr. Ein paar Kratzer auf dem Ziffernblatt, mehr hatte sie nicht davongetragen, als die Welt über mir zusammengebrochen war. Es hatte mich lächerlich wütend gemacht, als ich das gesehen hatte, trotzdem ertrug ich es nicht, sie auszutauschen. Sie war das letzte Geschenk meiner Mutter gewesen. Und sie funktionierte noch einwandfrei und bestätigte mir das, was ich schon geahnt hatte: Es war Viertel nach acht und unser Bruder damit wieder mal zu spät.
»Hast du mit ihm geredet?«
»Das letzte Mal, als er hier war, um dich zu besuchen.« Im Krankenhaus. Sie sprach die zwei Wörter nicht aus, aber sie waren trotzdem da. Sie hafteten auf meiner Haut, in Form der letzten Schatten der Infusionseinstiche an meinen Armen und der Narbe, die nach dem Nähen der tiefsten Kopfverletzung schräg über meinem Ohr entstanden war. Und sie hafteten unter meiner Haut, in Form von Erinnerungen, die sich in meine Netzhaut tätowiert hatten: farb- und konturlos, aber so gefühlsintensiv, dass ich mich kaum traute, die Augen zu schließen. »Seitdem nicht mehr. Es würde mich nicht mal wundern, wenn er das hier verpasst.«
»Er wird kommen. Das ist ein Pflichttermin.«
Mari bedachte mich mit einem Blick, der zwischen Mitleid und Abscheu hing. »Und mit denen kennst du dich aus, nicht?«
»Und du? Weißt du noch, was das ist?«, konterte ich und bereute es im nächsten Moment. Ein Teil von mir wollte den Vorwurf zurückziehen, doch ich wusste, dass es nichts gebracht hätte. Wenn Mari sich ungerecht behandelt fühlte, wertete sie jeden Versuch der Schlichtung als weiteren Angriff. Und sie fühlte sich meistens ungerecht behandelt, das war ein Relikt unserer Kindheit.
Mari war nicht nur das einzige Mädchen, sondern auch die Jüngste von uns. Knapp drei Jahre trennten sie von Keaton, etwa viereinhalb von mir. In Mums Augen war sie das Nesthäkchen gewesen, in Dads die Prinzessin, in Keatons die Kleine, in ihren eigenen das fünfte Rad am Wagen. Für mich war sie immer einfach Mari gewesen. Mari, mit der seit einiger Zeit nichts mehr einfach war.
Sie machte eine Bewegung auf mich zu und funkelte mich an. Ihr Lidschatten hatte das gleiche matte Silber wie die Perlen ihrer Kette. Mums Augen, Mums Kette, aber eindeutig Dads Art, andere mit Blicken sezieren zu können. »Ich bin hier, oder nicht? Ich wäre öfter hier, wenn man mich in den letzten Jahren hier gewollt hätte.«
»Mari.«
»Was? Es stimmt doch. Der Einzige von uns, der hier je erwünscht war, warst du.«
Am liebsten hätte ich gelacht. Hätte ihr gesagt, dass die Selbstverständlichkeit, mit der ich mich im Unternehmen bewegte, nichts war, was mir geschenkt worden war. Dass ich hierfür alles gegeben und alles andere aufgegeben hatte. Dass sie ihr Studierendenleben, das weniger aus Bibliotheken als aus Bars bestand und mit Partynächten, exklusiven Events und Wochenenden in den Ferienhäusern ihrer Freundinnen gefüllt war, hätte vergessen können, wenn sie ein richtiger Teil von Evergreen hätte sein wollen. »Nein«, sagte ich stattdessen betont nüchtern. »Ich war einfach immer der Einzige von uns, der all das ernst genommen hat. Der hierfür gelebt hat. So wie Dad.«
»Du wärst auch fast hierfür gestorben.« So wie Dad. Die letzten drei Wörter hingen ungesagt und doch deutlich spürbar zwischen uns. Weitere Gefühlstattoos, die sich in meine Lungenflügel gestochen hatten und jeden Atemzug brennen ließen.
Ich atmete Asche, wenn ich gedanklich darübertastete. Also tat ich es nicht. »Bringen wir erst mal diesen Termin hinter uns«, wiederholte ich tonlos.
Sie setzte zu einer Erwiderung an, als ein Geräusch hinter uns aufkam: das Zufallen der Notfalltür am Ende des Flurs. Zu dieser Tageszeit war die Führungsetage von Evergreen noch so gut wie leer, nicht nur deshalb wusste ich auf Anhieb, wer es war. Es gab nur eine Person, die freiwillig durch das fensterlose Treppenhaus in den vierten Stock hochkam.
Keaton hasste die verglasten Aufzüge vielleicht sogar noch mehr als Mari diese Brücke. Er konnte es nicht leiden, beobachtet zu werden, weswegen er schon als Kind lieber den Umweg über die Notfalltreppe gegangen war, als sich dreißig Sekunden in einen der Glaskästen zu stellen. »Ich weigere mich, Exponat zu spielen. Sollen diese Leute doch in eine echte Ausstellung gehen. Oder von mir aus in einen Zoo. Ich mache mich sicher nicht für sie zum Affen.«
Ich konnte nicht zählen, wie oft ich diese Worte in verschiedenen Ausführungen von ihm gehört hatte. Dafür konnte ich die Jahre zählen, in denen ich sie nicht mehr gehört hatte – weil Keaton sich schlichtweg geweigert hatte, dieses Gebäude überhaupt noch zu betreten.
Viereinhalb Jahre. Rund vierundfünfzig Monate. Es war mir ab dem ersten Tag wie ein halbes Leben vorgekommen. Jetzt kam es mir wie ein ganz anderes vor. Vielleicht war er mir deswegen fremder als je zuvor, als ich ihm entgegensah.
Windzerzaustes Haar, schwarze Stoffhose, das Shirt am Kragen ausgeleiert, sodass eine feingliederige Silberkette darunter hervorblitzte, Turnschuhe und Bomberjacke – alles daran war so leger, dass ich ein Stirnrunzeln nicht unterdrücken konnte.
Während Mari und ich deutlich nach unserem Vater kamen, mit Ausnahme von Maris Augen, sah Keaton insgesamt unserer Mutter viel ähnlicher. Er hatte ihr hellbraunes welliges Haar, ihren Mund und ihre Art, damit zu lächeln. Charmant, leicht verträumt, manchmal ein wenig überheblich, als wüsste er genau, dass er Dinge wahrnahm, die für andere unsichtbar waren. Keaton war mir immer ein Rätsel gewesen, an dessen vollständiger Lösung ich gescheitert war, egal, wie nah wir uns gestanden hatten. Seit er vor fast vier Jahren England verlassen hatte, um entgegen der Familientradition in Stanford zu studieren, hatte ich das Gefühl, dass es für ihn schlichtweg keine Lösung gab.
Wir begrüßten uns nicht. Das taten wir nie, seit er damals ohne Verabschiedung gegangen war. Er lächelte uns nur an: nicht sonderlich breit, nicht sonderlich ehrlich.
Für einen unangenehm intensiven Moment blieb es zwischen uns still. Schritte und Stimmengewirr drangen von unten zu uns hinauf, ab und zu das Geräusch ankommender Aufzüge oder das Telefonläuten am Empfang, mehr war da nicht. Die Morgensonne brach durch die Mosaikkuppel und bewarf uns mit Farbflecken. Die Narbe an meinem Kopf juckte durch die Wärme stärker, meine Zunge unter all den nichtssagenden Wörtern auch. Ich hätte mich gern gekratzt, ich hätte gern gehustet, am liebsten wäre ich einfach gegangen. Es war absurd: Alles um uns herum war lichtdurchflutet und transparent, aber wenn ich meine Geschwister ansah, war es, als würde ich gegen Betonwände starren.
»Hier hat sich nichts verändert«, stellte Keaton schließlich fest. Der Satz, den ich oft mit Erleichterung dachte, klang bei ihm nach derselben Abneigung, die ich auch in seinen Augen erkannte. Sein Blick glitt nach unten zu den Menschen, die wie Ameisen über den schwarz-weißen Marmorboden huschten. Ich konnte trotzdem nicht verhindern zu denken, dass er nicht von ihnen sprach. Sondern von uns.
Der Gedanke kränkte mich, weil es einfach nicht wahr war: Alles hatte sich verändert. Das, was sich in diesem Moment zwischen uns ausdehnte, was sich seit Jahren jedes Mal zwischen uns ausdehnte, wenn wir uns trafen, war nicht immer dort gewesen. Wir waren mal anders gewesen. Wir waren … mehr gewesen. Mehr als bloße Statisten im Leben der anderen, die nicht wussten, ob ihnen überhaupt noch Sprechtext zustand. Ich trauerte nicht darum, schon lang nicht mehr, aber es machte mich wütend, dass Keaton diese anderen Zeiten offenbar in seinen Erinnerungen ausradiert hatte, als hätte es sie nie gegeben.
Ich schluckte mehrmals, um nichts dazu zu sagen. Wir stritten nie – ich stritt nie. »Starke Emotionen zu fühlen ist eine Stärke«, hatte Dad mir beigebracht. »Sie zu zeigen ist in den meisten Fällen eine Schwäche.«
»Du hast dir den Bart rasiert«, stellte Mari fest, während sie Keaton musterte. Ich glaubte, ebenfalls Wut in ihren Zügen zu sehen, doch das bedeutete nichts. Sie hatte sich dort vor Jahren eingenistet, sodass sie mittlerweile genauso zu ihrem Gesicht gehörte wie das Muttermal neben dem Nasenflügel. »Gute Entscheidung.«
»Ich freu mich auch, dich zu sehen, Mari. Wie …« Keaton verstummte, als sie sich abwandte und die Brücke in Richtung der Besprechungsräume verließ. Betont langsam, als wollte sie uns klarmachen, dass das keine Flucht, sondern eine Entscheidung war. Ein Zeichen. Keaton seufzte und lehnte sich mit dem Rücken gegen das Glasgeländer. »Und weg ist sie. Hab ich sonst was verpasst?«
Wir haben keine Zeit, um vier Jahre aufzuholen. Ich sagte es nicht laut, ich schob nur den Ärmel meines Jacketts hoch, um ihm das Ziffernblatt zu zeigen. Keine rhetorische Geste, ein ernst gemeinter Hinweis. Keaton trug weder eine Armbanduhr noch ein Handy bei sich. Zumindest war das früher so gewesen. Er hatte schon als Kind jeden Ansatz von Kontrolle derart stark abgelehnt, dass diese Macken zu Persönlichkeitszügen geworden waren. »Du bist zu spät.«
Er grinste schief. »Ich bin davon ausgegangen, dass du mir eine Zeit hast zukommen lassen, die eine halbe Stunde vor dem eigentlichen Termin liegt. Hab ich mich geirrt?«
Meine Mundwinkel zuckten hinauf, der Schmerz blieb diesmal erträglich. »Gut, dass du zurück bist.«
Sein Lächeln wurde schwächer, er legte mir eine Hand auf die Schulter. Kurz nur, flüchtig, wie der Blick, mit dem er mich bedachte. »Gut, dass du noch da bist.«
Wir schwiegen, aber ich wusste, was wir beide dachten: anders als Dad. Seit dem Unfall hatte keiner von uns dreien das ausgesprochen. Zumindest erinnerte ich mich nicht daran.
Die Zeit im Krankenhaus verschwamm in meinem Kopf zu einem undurchsichtigen See aus Körperschmerz und Gedankentaubheit. Meine erste Erinnerung an Keaton war graustichig wie das Licht, das durch die Fensterscheiben meines Einzelzimmers hereingekrochen war. Sein Schemen dicht vor dem Glas, die fast kinnlangen Locken hinter die Ohren gestrichen, der Blick müde und leer auf mir. Ich hatte ihn über ein Jahr nicht gesehen und im ersten Moment den albernen Gedanken, ich wäre doch tot. Das hätte seine Anwesenheit besser erklärt als alles andere. Es war nicht so, als wäre er für mich gestorben gewesen. Er war nur eben nicht mehr Teil meines Lebens. Minutenlang hatten wir einander still angesehen, während sich dieses ungesagte Wissen zwischen uns verdichtet hatte. Schmerz zwischen den Fugen, Trauer und Wut und Ohnmacht als Mörtel für eine Wahrheit, von der ich mir nichts mehr wünschte, als dass sie bröckelte: Dad war tot, ich beschädigt, alles andere auch. Unsere Familie, unser Unternehmen, unsere Welt.
Und Keaton hatte halbherzig gelächelt und gesagt: »Tut mir leid, aber diese Frisur steht dir gar nicht.«
Mein Lachen hatte nach einem Schluchzen geklungen. »Sie haben nur die eine Seite rasiert. Vielleicht werden sie für die andere nicht bezahlt.«
Mit einem Seufzen war er zu mir gekommen. Mein kleiner Bruder, der nie größer und älter gewirkt hatte als in diesem Moment. »Ich mach es umsonst. So kann ich dich nicht rumlaufen lassen.«
Eine halbe Stunde später war das Waschbecken voll mit dem Rest meines Haars gewesen. Ich wusste nicht, ob es der unvertraute Anblick meines rasierten Schädels und der vernähten Schnitte oder die Anstrengung des Sitzens gewesen war, was mich dazu gebracht hatte, mich mehrmals zu übergeben. Alles, woran ich mich noch erinnern konnte, war die wütende Stimme des Arztes und Keatons träges Lächeln, mit dem er den Ärger über sich hatte ergehen lassen. Das war etwas, das er unsere gesamte Kindheit über einstudiert hatte.
Er lächelte es jetzt wieder, als ahnte er, was gleich auf ihn zukommen würde. »Komm«, meinte er und stieß sich vom Geländer ab. »Bringen wir es hinter uns.«
3
Odell
Der Besprechungsraum, den ich für diesen Termin gebucht hatte, lag am Ende des Flurs. Frangipani stand auf dem Schild neben der Tür. Sämtliche Büros im Unternehmensgebäude waren nach einer Duftnote benannt, die wir für unsere Parfüms verwendeten. Direkt neben diesem lag das von Dad: Vetiver. Er hatte den Namen ausgesucht, als er dort eingezogen war, und ich wusste, dass ich bald einen eigenen wählen musste. Weil es nun meins war, auch wenn ich es kaum über mich brachte, es zu betreten. Dads Abwesenheit pochte so stark zwischen den Wänden, als wäre sie in dem Moment zum Herzen des Zimmers geworden, in dem seines aufgehört hatte zu schlagen.
Das war das, was von ihm geblieben war, worin er mich allein zurückgelassen hatte: ein Nichts. Natürlich wusste ich, dass das nicht stimmte. Dass er mir deutlich mehr hinterlassen hatte. Eine Aufgabe, eine Pflicht, eine Erwartung: Evergreen Empire in seinem Sinne weiterzuführen.
Auch ohne die Testamentsverkündung war mir klar, dass mir seine Position zufallen würde. Das war eine Tradition, und Evergreen lebte von Traditionen: Die Geschäftsführung wurde von einem Erstgeborenen zum nächsten weitergereicht.
Mein Leben lang war ich darauf vorbereitet worden, dass es eines Tages dazu kommen würde, aber es gab ein Problem mit solchen Floskeln. Niemand warnte einen davor, dass eines Tages manchmal jetzt, sofort bedeutete. Dass es manchmal nur eine falsche Entscheidung, einen falschen Moment, einen Einsturz eines falschen Himmels entfernt war.
Meine Schläfen pochten, während ich einen der Stühle am Besprechungstisch hervorzog. Es spielte keine Rolle. Ich war bereit, ich musste bereit sein. Eine andere Wahl hatte ich nicht. Ich würde Dad nicht enttäuschen. Nicht ich auch noch.
Bei dem letzten Gedanken sah ich zur Seite. Mari saß direkt vor der breit verglasten Fensterfront, in der London im graugelben Morgenlicht versank. Sie scrollte durch ihr Handy, aber ihrem angespannten Gesichtsausdruck nach machte sie das nur, um uns nicht ansehen zu müssen. Mein Blick wanderte an ihr vorbei über die dunkelgrünen Wände, hinauf zur Decke, die mit goldenen Ornamenten bemalt war. Mein Magen verkrampfte sich, hastig wandte ich mich ab.
In dem Moment, in dem Keaton sich drei Plätze weiter hinsetzte, tauchte ein Mann im Rahmen auf. Mitte fünfzig, grauer Anzug, eine Aktenmappe vor der Brust. Er lächelte uns zu, während er die Tür hinter sich schloss. »Guten Morgen.«
»Mr Salford, danke, dass Sie es so früh einrichten konnten.« Ich stand auf und hielt ihm meine Hand hin, die er drückte. Etwas zu intensiv, genau wie seine Musterung.