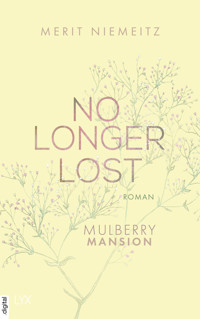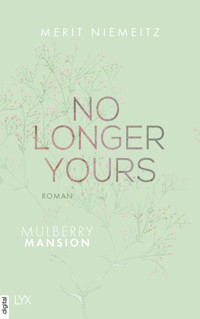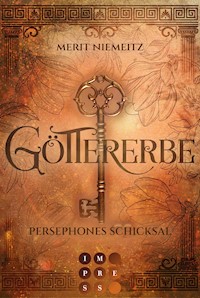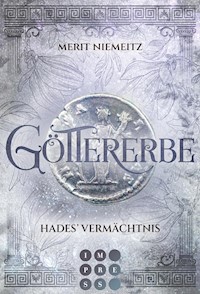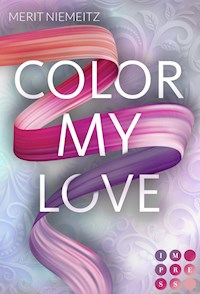11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Evergreen Empire
- Sprache: Deutsch
Ich habe dieses endlose Ende in mir, aber du fühlst dich nach Anfang an
Keaton fühlt sich schon lange wie ein Außenseiter in seiner Familie. Am liebsten würde er dem Parfüm-Imperium den Rücken kehren, wäre da nicht das Testament seines Vaters. Als er nach einer Möglichkeit sucht, das Erbe auszuschlagen, stößt er auf ein Geheimnis, das ihn zur Familie von Kenna führt - einem der gefragtesten It Girls Londons. Um diese Spur zu verfolgen, bucht Keaton sie als Model für eine große Werbekampagne von Evergreen, rechnet aber nicht damit, dass hinter Kennas sorgenfreier Fassade eine verletzliche junge Frau steckt, die ihn immer mehr fasziniert. Und plötzlich könnte die Wahrheit nicht nur Keatons Leben auf den Kopf stellen, sondern auch das zarte Band zwischen Kenna und ihm zerstören.
»Niemand gibt Emotionen und Figuren diese unendliche Tiefe und grenzenlose Echtheit, wie Merit es tut. Ihre Worte erinnern mich immer wieder daran, dass es das Richtige ist, man selbst zu sein.« BOOKS.OF.LUI über PURE PROMISE
Band 3 der EVERGREEN-EMPIRE-Trilogie, der neuen New-Adult-Reihe von Merit Niemeitz
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 751
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
INHALT
Titel
Zu diesem Buch
Leser:innenhinweis
Widmung
Playlist
Prolog
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Epilog
Danksagung
Die Autorin
Die Bücher von Merit Niemeitz bei LYX
Impressum
MERIT NIEMEITZ
Eternal Ending
Roman
ZU DIESEM BUCH
Alles in Keaton Evergreens Leben fühlt sich nach einem Ende an: der Tod seiner Eltern, die Beziehung zu seinen Geschwistern und der Job im Familienunternehmen. Am liebsten würde er dem Parfüm-Imperium den Rücken kehren, wäre da nicht die Bedingung im Testament seines Vaters. Denn sollte er gehen, verlieren auch seine Geschwister ihre Anteile. Da kommt Keaton einem Geheimnis auf die Spur, das ihm eine Möglichkeit bieten könnte, das Erbe auszuschlagen, ohne Mari und Odell zu schaden. Und dieses führt ihn zur Familie von Kenna Reading – einem der gefragtesten It Girls Londons. Kenna ist schön, beliebt und Keatons Chance, sein Leben endlich selbst in die Hand zu nehmen. Kurzerhand bucht er sie als Model für eine große Werbekampagne von Evergreen, um ihrer Familie näherzukommen. Womit er allerdings nicht gerechnet hat, ist, dass sich hinter Kennas sorgenfreier Fassade eine verletzliche junge Frau verbirgt, die ihm ähnlicher ist als gedacht. Keaton spürt eine so starke Verbindung zu Kenna wie zu niemandem zuvor. Und plötzlich gerät sein Plan ins Wanken, denn die Wahrheit könnte nicht nur sein Leben auf den Kopf stellen, sondern auch das zarte Band zerstören, das zwischen Kenna und ihm entsteht und sich seit langer Zeit zum ersten Mal wie ein Anfang anfühlt.
Liebe Leser:innen,
dieses Buch enthält potenziell triggernde Inhalte. Deshalb findet ihr hier eine Triggerwarnung.
Achtung: Diese enthält Spoiler für das gesamte Buch!
Wir wünschen uns für euch alle das bestmögliche Leseerlebnis.
Eure Merit und euer LYX-Verlag
Für uns beide.
Für all das Gefühlte, das ungesagt bleibt.
PLAYLIST
End of Beginning – Djo
Model, Actress, Whatever – Suki Waterhouse
Bloodline – Luke Hemmings
6/10 – dodie
mirrorball – Taylor Swift
A Memory Away – Matt Maeson
Boy With The Blues – Delacey
Homesick – Noah Kahan
Lie to Me – Morgan Harper-Jones
Scared To Start – Michael Marcagi
Keaton’s Song – Soko
chance with you – mehro
Brutally – Suki Waterhouse
Black Friday – Tom Odell
Perfect Portrait of Young Love – The 502s
The Mountain Is You – Chance Peña
The Prophecy – Taylor Swift
Notting Hill – Specific Coast
Something Went Wrong – Hayden Calnin
No one gets what they wanted – James Vincent McMorrow
The First Train Home – Hazlett
Pink Skies – Zach Bryan
London Too – Haley Joelle
White Magnolias – Bear’s Den
Right now – Gracie Abrams
Goodbye Evergreen – Sufjan Stevens
PROLOG
Keaton
Alles auf der Welt hat ein letztes Mal.
Klingt simpel? Ist es auch.
Ich glaube, dass wir das eigentlich von Anfang an wissen. Wir wissen, dass alles, was wir beginnen, enden wird. Wir wissen, dass jeder Mensch, den wir treffen, irgendwann auf die eine oder andere Weise wieder gehen wird. Wir wissen, dass jeder Lebensabschnitt mit einer Kante abschließen wird, hinter der er im Nichts verschwindet. Wir wissen sogar, dass das letztlich auch für uns selbst gelten wird.
Was wir nicht wissen, ist das Wann. Es gibt keine Vorzeichen für letzte Male, weder die kleinen noch die großen. Es passiert einfach so, und erst viel später stehen wir da, blicken zurück und erkennen all die Enden wie Kerben in unserem Leben, über die wir gedanklich stolpern, wenn wir nach schönen Erinnerungen tasten.
Das hier waren meine tiefsten: das letzte Mal, dass ich auf dem Dach unseres Leuchtturms stand und so sicher war, diese Welt unter mir würde für immer dieselbe bleiben. Das letzte Mal, dass ich mit Odell und Mari durch die Heckengänge unseres Irrgartens rannte, an dieser Schwelle zwischen Kindheit und Jugend, Sonnenschlieren am Himmel, Schmutzschlieren auf den Wangen, Glücksschlieren in mir. Das letzte Mal, dass ich Evergreen Empire betrat und mich trotz all der transparenten Scheiben tief im Inneren behütet fühlte, als hätte das Universum mir eine schützende Vitrine aus Panzerglas gebaut. Das letzte Mal, dass ich mit Mum in ihrem Atelier stand und ihr assistierte, mit unzähligen Farbsprenkeln auf den Händen, geschummelte, aber alles bedeutende Muttermale, die uns stärker als jedes Gen miteinander verbanden.
Ich könnte ewig so weitermachen, wir alle könnten das. Jeder von uns hat eine fortlaufende Schleife von letzten Malen in sich. Das ist es, woraus das Leben besteht: aus einer endlosen Kette aus Enden. Das Grausame daran? Man erkennt ein letztes Mal eben immer erst als solches, wenn es zu spät ist.
Vielleicht wäre ich nie vom Dach ins Haus geklettert, hätte ich gewusst, dass ich nicht mehr zurückkehren könnte, weil ich bald lernen würde, dass die Welt unter mir nie die gewesen war, die ich in ihr gesehen hatte. Vielleicht hätte ich meine Geschwister dazu gebracht, den Irrgarten nie zu verlassen, wäre mir da schon klar gewesen, dass wir uns außerhalb von ihm irgendwann nicht nur verirren, sondern auch verlieren würden. Vielleicht wäre ich in unserem Unternehmensgebäude geblieben, auch wenn ich mich damals darin oft beengt gefühlt hatte, hätte ich da schon geahnt, dass einsperrende Panzerglaswände besser waren als jene, die zersplitterten – und einen dabei ebenfalls zerstörten.
Und vielleicht, oder eher ganz sicher, hätte ich Mums geliebte Konzentrationsstille an jenem Tag im Atelier unterbrochen, hätte ich kommen sehen, dass es die letzte Chance dafür gewesen wäre. Ich hätte ihr alles erzählt. Das, was ich schon immer gewusst, aber nie gesagt hatte, weil ich dachte, mir bliebe noch so viel Zeit. Und, wenn ich gekonnt hätte, vor allem das, was ich erst kurz darauf erfahren und was all die zuvor gedachten und gefühlten Worte aussaugen und mit neuer, giftiger Bedeutung füllen würde.
Ich hätte ihr die Wahrheit gesagt, ein letztes Mal.
Das Ironische daran war, selbst wenn ich es getan hätte, letztlich hätte das nichts geändert. Zehn Tage später wäre sie so oder so gestorben. Kein Konjunktiv der Welt kam gegen ein geplatztes Aneurysma an.
Mein Blick blieb an den Sprenkeln auf meinem Sweater hängen, während ich die Wohnungstür aufschloss. Jedes Mal, wenn ich welche sah, hielt ich es für Farbe – bis mir einfiel, dass ich seit über vier Jahren nicht mal mehr im Geheimen malte. Es war nur Kaffee, den ich verschüttet hatte, als mein Handy in der Straßenbahn geklingelt hatte. Odells Name auf dem Display, eine bleierne Gefühlswelle aus Reue und Traurigkeit, die alles in mir überrollte. Es war über dreieinhalb Jahre her, dass ich London verlassen und den Kontakt zu meiner Familie weitestgehend abgebrochen hatte, mein großer Bruder hörte trotzdem nicht auf, mich an meinen Geburtstagen anzurufen. Ebenso wenig wie ich damit, ihn mit einer knappen Nachricht abzuweisen. Ich wusste, dass ich ihn damit verletzte, aber das war die einzige Möglichkeit, um ihn zu schützen. Das Leben war paradox – und beschissen. Alles, was ich wollte, war, ihm die letzten Male zu ersparen, die mir das gezeigt hatten.
Ich zog die Jacke aus, während ich die Tür hinter mir zuwarf. Das Loft, in dem ich wohnte, befand sich in North Beach, einem der beliebtesten Viertel San Franciscos, das auch als LittleItaly bekannt war. Als ich vor ein paar Monaten nach dem Bachelorabschluss in Stanford vom Campus hergezogen war, hatte ich mich für diesen Bezirk entschieden, weil er durch die Lage auf einem Hügel häufiger wolkenfrei war als alle anderen. Heute nervte mich selbst der blaue Himmel. Früher hatte ich Geburtstage geliebt. Es war mir vorgekommen, als dürfte man an ihnen tun und lassen, was man wollte, ohne sich vor irgendjemandem rechtfertigen zu müssen. Keine Erwartungen, keine Pflichten, nur vierundzwanzig Stunden Freiheit. Mittlerweile hasste ich jede einzelne Minute. An diesen Tag denken hieß, an alle vorangegangenen denken, an Kindheit und Jugend und Damals. An alles, was ich versuchte zu vergessen, seit ich England verlassen hatte. Geburtstage bedeuteten keine Freiheit mehr, sie sperrten mich in ein Gedankengefängnis, dem ich nicht entkommen konnte.
»Lil?« Ich warf die Jacke über das Sofa im Flur, während ich auf den offenen Wohnbereich zulief. Das Appartement war lichtdurchflutet wie ein Atelier, doch die einzigen Gemälde malte die Sonne beim Untergehen an die unverputzten Wände. Sie blendete mich, als ich auf den Durchgang zutrat – bis sich jemand in den Rahmen stellte.
»Hallo, Geburtstagskind.« Lily strahlte mich an, ihr grau gefärbtes Haar flimmerte silbrig, so wie das Piercing in ihrem linken Nasenflügel.
Ich seufzte. »Was muss ich tun, damit du das sein lässt?«
Als ich mich zu ihr hinabbeugte, um sie zu küssen, wich sie mir aus. »Warte.« Sie schob mich weg, einen ungewohnt verlegenen Ausdruck in den braunen Augen. »Du hast Besuch.«
Genervt legte ich den Kopf zurück. »Ernsthaft? Ich hab Dylan gesagt, ich hab keine Lust, was zu unternehmen, ich …«
Meine Stimme stockte, weil ich es da roch: Alpenveilchen, Cashmeran, Vetiver, zig Bausteine, die ein bestimmtes Parfüm bildeten. Mein Magen zog sich zusammen und dann auseinander, verschiedene Emotionen zerrten daran.
Die grausamste Veränderung der Welt war die einer Duftbewertung. Mein Leben lang war mir dieser Geruch vertraut gewesen. Er hatte Schutz bedeutet, Vertrauen, Zuhause. Und jetzt? Jetzt verspannte sich alles in mir beim ersten Atemzug.
Ich ließ Lily los, als ein Schatten über den Boden hinter ihr fiel. Er machte einen Schritt in mein Sichtfeld hinein, etwas schlug mir in den verkrampften Magen.
Mein Vater sah mich an, und ich wollte mich übergeben.
War das nicht wirklich zum Kotzen?
»Schön, dich zu sehen, Keaton.« Er lächelte mir zu, aber ich sah die Angespanntheit in seinen Zügen. Da waren mehr Fältchen als beim letzten Mal, als ich ihn gesehen hatte.
Wie lang war das her? Zehn, elf Monate? Ich hatte Unterlagen aus Rosehill gebraucht und es nicht vermeiden können, ihm in der Villa über den Weg zu laufen. Ein zehnminütiges Treffen, das mich seitdem ebenso verfolgte wie all die anderen. In meinem Kopf wiederholten sich permanent unzählige Momente meiner Kindheit und Jugend, und mit jedem Mal rieben sich feine Bedeutungsspäne ab. Meine Erinnerungen renovierten sich auf falscheste Weise, was dabei herauskam, war nichts weiter als eine Ruine.
»Was willst du hier?« Meine Stimme klang hart und kalt, mein Herz fühlte sich genauso an.
Lily lachte holprig auf. »Gott, du kannst echt so gar nicht mit Überraschungen umgehen.« Sie legte mir einen Arm auf den Rücken und grub die Finger in meinen Sweater, als wollte sie mir einen Stoß in seine Richtung geben.
Es war so seltsam, dass Menschen dich nackt gesehen haben konnten, aber keine Ahnung davon hatten, wie es in dir aussah. Ich konnte nirgendwohin gestoßen werden, ich lag bereits am Boden. Ich lag dort seit über vier beschissenen Jahren, und der Grund dafür stand vor mir und sah mich mit einem Blick an, der ihm nicht zustand. Gekränkt, traurig, enttäuscht.
»Es ist doch toll, dass er sich die Zeit genommen hat, um herzufliegen.« Lily lächelte Charles zu, offen und aufrichtig, weil sie so war. Immer ehrlich, immer direkt, immer das Gegenteil von mir – und meinem Vater. Das war einer der Gründe gewesen, aus denen ich mich vor rund zwei Jahren zu ihr hingezogen gefühlt hatte, als wir uns auf einer Collegeparty begegnet waren. Jetzt war es der, wegen dem ich sie gern aus dem Raum gezogen hätte. »Das Leben als so erfolgreicher Anwalt stelle ich mir stressig vor. Keaton hat erzählt, wie beschäftigt Sie mit der Kanzlei sind.«
Mein Vater blinzelte. »Hat er das?« Sein Blick schwenkte zu mir. Es kostete mich alles an Kraft, nicht wegzusehen. Nicht aus Scham, sondern aus Wut. Ich spürte seine Verurteilung, dabei stand es ihm nicht zu, über Unehrlichkeit zu richten. Nicht, wenn seine Lügen der Grund für meine waren.
Lily nickte. »Und dass Sie sich gewünscht hätten, er würde ebenfalls Jura in Oxford studieren. Ich kann Ihnen nur sagen, dass ich wirklich froh bin, dass er stattdessen hergekommen ist und Sie ihn sein Ding machen lassen. Und nur weil er nicht bei Ihnen arbeiten will, heißt das ja nicht, dass Sie keine Familie mehr sind. Keaton hat nur einen Vater, und Sie haben nur ein Kind, also …«
Die zweite Lüge. Die Wut in mir kroch jetzt doch in Scham über – was mich noch wütender machte. »Lil.« Ich atmete aus, senkte die Stimme. Nichts hieran war ihre Schuld, alles daran seine und vielleicht meine, weil ich ihm ähnlicher war, als ich ertragen konnte. »Würdest du uns einen Moment geben?« Es klang gepresst, doch Lily war nicht gut darin, solche Zwischentöne herauszuhören. Sie glaubte das, was jemand sagte. Sie war im wahrsten Sinne gutgläubig, weil sie selbst ein guter Mensch war. Und deswegen merkte sie nicht, dass ich keiner war.
»Ja, klar. Ihr habt bestimmt viel zu besprechen, und ich muss eh zum Pilates.« Sie wandte sich an Charles und wechselte zu einem verschwörerischen Ton. »Keaton sollte das eigentlich nicht wissen, weil er an Geburtstagen furchtbar grummelig wird, aber wir gehen später mit Freunden was essen. Sie kommen doch mit, oder?«
Ich hätte gern gelacht oder laut Nein geschrien oder irgendetwas getan, aber ich schaffte es nicht, mich zu regen. Nichts hiervon ergab Sinn. In all der Zeit, die ich in den USA lebte, war niemand aus meiner Familie bei mir aufgetaucht. Mein Vater hatte immer gewusst, wo ich wohnte, schließlich liefen die Abrechnungen der Miete über ihn, aber nicht mal er hatte Anstalten gemacht, mich zu besuchen. Und jetzt … was? Flog er elf Stunden her, um mir zum Geburtstag zu gratulieren? Ihm musste bewusst sein, dass ich lieber von der Golden Gate Bridge gesprungen wäre, als auch nur einen Abend mit ihm an einem Tisch zu sitzen.
Es war ihm tatsächlich bewusst. Ich erkannte es an der Art, wie er Lily anlächelte. Höflich, aber distanziert – strikte Professionalität, um ja keine Emotionen zu zeigen. »Ein anderes Mal, aber vielen Dank für die Einladung. Es war schön, dich kennenzulernen.«
»Gleichfalls. Keaton redet nie viel von England, aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass er mich mal einlädt, Sie zu besuchen.« Sie sah zu mir auf, doch ihr Blick kam nicht bei mir an. Wie auch, wenn ich doch eigentlich am Boden lag.
Ich hörte Charles’ Antwort kaum, ebenso wenig wie Lilys Verabschiedung. Ihre Lippen auf meiner Wange, ich war so weit weg. Alles fühlte sich falsch an. Vielleicht passierte das, wenn sich zwei Welten überlappten, die nicht zusammengehörten. Sie erschufen eine Parallelwelt, die nichts mit der Realität zu tun hatte. Vielleicht bewies mir dieser Moment aber auch nur, was ich seit Jahren versuchte zu verdrängen: dass ich längst in einer Parallelwelt lebte. Das war es, was passierte, wenn man ein schlimmes Geheimnis hütete, nicht wahr? Alles veränderte sich – allerdings nur für dich. Das war die reinste Form von Einsamkeit.
Erst als die Wohnungstür ins Schloss fiel, zwang ich mich zurück in den Augenblick. Mein Vater stand nach wie vor mitten im Raum. Zwischen dem Esstisch, auf dem Lilys Perlenkästen für ihren Schmuck lagen, den sie auf Wochenmärkten verkaufte, und der Sofalandschaft voll von ihren selbst bestickten Kissen. Sie wohnte nicht offiziell hier, aber irgendwie schon. Es war einfach passiert, so wie vieles in meinem Leben. Wenn ich ehrlich war, war ich schon immer eher passiv gewesen. Einfach, weil ich wusste, dass man die entscheidenden Dinge sowieso nicht steuern konnte. Was immer passiert, passiert. Dieser Satz hatte mich durch meine Jugend getragen und am Ende unter sich begraben.
Ein paar Sekunden lang sahen wir einander schweigend an, dann räusperte Charles sich. »Du hast eine Freundin?« Er deutete auf das Sofa, ich blieb stehen. Die Zeiten, in denen er mir befehlen konnte, was ich tun sollte, waren vorbei.
Ich lächelte zynisch. »Richtig, du dachtest ja immer, dazu wäre ich nicht fähig, was?«
Er hob die Schultern, die wie gewohnt in einem Anzug steckten. Ganz in Schwarz, fast wie bei Mums Beerdigung. Ich fragte mich, ob er auch immer noch dort festsaß. Ob er sich auch immer noch so schuldig fühlte, dass er es kaum ertrug, in einen Spiegel zu sehen. Ich hoffte es.
»Bist du es? Du belügst sie offensichtlich.«
»Von wem ich das wohl habe, hm?«
Er ging nicht auf meinen Spott ein. »Dass du nicht mit oder von mir reden willst, gut. Aber wieso hast du ihr nichts von Evergreen oder von Odell und Mari erzählt?«
Ich verschränkte die Arme, drehte mit dem Daumen an einem der Ringe an meiner Hand. Die Tinte blitzte ständig darunter hervor, der Anblick bohrte jedes Mal den Phantomschmerz der Nadelstiche, durch die das Schwarz entstanden war, in mein Inneres. Vier Tintenringe für die Ewigkeit für vier Menschen, die ich auf die eine oder andere Weise verloren hatte. Ich hatte mir diese Tattoos stechen lassen, um Mum und meine Geschwister und das Ich, das ich mit ihnen gewesen war, nicht zu vergessen, und verdeckte sie seitdem, weil ich das Erinnern nicht aushielt. Selbst dafür war ich zu schwach. Genau deswegen lautete die Antwort auf Charles’ Frage: Weilichnichtkonnte.
In meiner Familie hing alles zusammen, wir führten kein Parfüm-Imperium, wir waren es. Unsere Kindheit hatte im Schatten unseres Erbes gestanden, jeder Schritt im Jetzt war auf dieses eine Ziel in der Zukunft ausgerichtet gewesen. Das Schlimme daran war, dass ich die Richtung nie auch nur eine Sekunde angezweifelt hatte. Ich hatte einfach gespürt, dass dieser Weg genau der richtige für mich gewesen war, vielleicht sogar der einzige. Ganz gleich, wie sehr mich unsere hauseigene Duftausbildung oder die Events in der Öffentlichkeit manchmal genervt hatten, ich hatte den Kern dieses Lebens nie angezweifelt – weil er sich auch wie meiner angefühlt hatte. Wie ein Sinn, der nur uns gehörte, in zweifacher Hinsicht: die Möglichkeit, mehr von der Welt zu erleben, und der Grund, auf ihr zu sein. Womöglich kam ich mir deshalb so leer und verloren vor, seit ich diesen Weg hatte verlassen müssen.
Meine Geschwister und ich waren im Grunde bilingual aufgewachsen, doch die Sprache der Düfte konnte man niemandem begreiflich machen, der sie nicht von klein auf gelernt hatte. Ich hätte versuchen können, Teile davon für Lily zu übersetzen, aber das hätte alles, was ich mir hier aufgebaut hatte, kaputt gemacht. Das hätte mich kaputt gemacht, noch mehr, als ich es ohnehin schon war. Hätte ich von unserem Unternehmen oder meiner Familie erzählt, hätte das zu viel über mich verraten – über das Ich, das ich in London zurückgelassen hatte.
»Das hier hat nichts mit ihnen zu tun.«
Ungläubig sah er mich an. »Das hier ist dein Leben.«
Ich grub die Finger in meine Ellenbogen. »Genau.«
»Du solltest deine Geschwister nicht für etwas bestrafen, was nur uns betrifft. Sie vermissen dich. Wir alle tun das.«
Am liebsten hätte ich gelacht, aber eigentlich war es ja nur traurig. Ich hatte nichts hiervon gewollt; ich hatte nie zu diesem Menschen werden wollen. Ich hatte meine Familie nie verlieren wollen. Meine Kindheit, mein Leben, meine Zukunft … mich. Ich versuchte nur, das Beste aus dem absolut Schlimmsten herauszuholen. Für Mari und Odell.
»Ich tue ihnen einen Gefallen«, erwiderte ich tonlos und fixierte einen staubigen Sonnenlichtstreifen auf dem Boden. »Egal, wie sehr ich mich bemühe, ich bin kein so guter Lügner wie du. Und ich will ihnen die Wahrheit nicht antun.«
»Keaton.« Er machte einen Schritt auf mich zu, ich wich zwei zurück.
»Ich wiederhole: Was willst du hier?«
Charles blieb stehen, es fühlte sich trotzdem an, als würde er näher kommen. Es lag an dem Geruch, der sich immer stärker im Zimmer ausbreitete. Oblivion – ein Zustand, in dem man nicht wusste, was um einen herum passierte. Das erste Parfüm, das unter Charles’ Geschäftsführung von Evergreen Empire herausgebracht wurde und deswegen seinen Namen als Anhang trug. Mittlerweile fühlte sich selbst diese Bezeichnung wie ein Seitenhieb an. Als wollte er seine Familie allein mit seinem täglichen Duft verhöhnen.
Ich wollte das nicht riechen. Ich wollte nicht mehr atmen. Ich wollte weg. Nur … wohin? Ich war ans andere Ende der Welt geflohen, und es hatte nichts gebracht. Fünf Minuten mit ihm, und ich war wieder der Siebzehnjährige, der in einem Treppenhaus stand, über sich Licht aus Kronleuchtern, in sich die dunkle Erkenntnis, dass man jemanden ein Leben lang vor Augen haben und nicht im Ansatz kennen konnte.
»Ich dachte, du würdest nächstes Semester deinen Master beginnen, aber ich habe keine Bescheinigung dazu erhalten.«
Ich schwieg, nur meine Mundwinkel hoben sich an. Mein Körper konnte das besser als mein Inneres: sich an unsere ganz eigenen Reflexe erinnern. Mein Vater schimpfte, ich lächelte. Er schrie, ich schwieg. Er erteilte mir Hausarrest, ich schlich mich raus. Er versuchte, mich zu erziehen, ich lernte, mich in mich selbst zurückzuziehen.
»Wir hatten eine Abmachung.« Sein Ton blieb ruhig, doch die Vene auf seiner Schläfe trat leicht hervor. Niemand konnte sie so gut hervorlocken wie ich. »Ich unterstütze dich während deines Studiums hier, wenn du danach zurück nach London kommst und wir endlich darüber sprechen. Ich wollte dir Zeit geben, aber jetzt sind es vier Jahre und …«
»Und es hat sich nichts geändert«, fiel ich ihm ins Wort. »Ich komme nicht zurück. Ich zahle das Geld in Raten ab, du kannst gern meine Konten sperren, aber ich komme nicht zurück.«
Wie auch? Es gab kein Zurück mehr. Die Vergangenheit war eben kaputt, jeder Versuch, nach dem zu greifen, was meine Familie und ich einst gehabt hatten, würde mich in Scherben fassen lassen. Und das hatte ich schon zu oft getan. Ich blutete seit Jahren aus, ich war ja kaum mehr da.
Charles’ Kiefermuskulatur verspannte sich. Ich konnte ihm ansehen, was er alles sagen wollte – und er mir sicher, dass nichts davon mich umgestimmt hätte. Schließlich atmete er durch. »Du kannst mich so sehr hassen, wie du willst, das ändert für mich nichts. Ich werde mich immer um dich sorgen und dich immer lieben.« Seine Augen auf mir, braun wie Odells, dicht bewimpert wie Maris, ich war so froh, dass sie nichts mit meinen zu tun hatten. »Ich bin dein Vater.«
Ich lachte bitter. »Glaub mir, ich weiß. Es vergeht kein Tag, an dem ich mir nicht wünschte, es wäre anders.« Mit einer ausufernden Handbewegung trat ich beiseite und deutete ihm den Weg zur Tür. So war ich früher auf mein Zimmer verbannt worden, so verbannte ich ihn aus meinem Leben.
Kurz zögerte er noch, dann nickte er und kam auf mich zu. Dicht neben mir blieb er stehen. Sein Blick an meiner Schläfe, Oblivion zwischen uns, meine Augen brannten, obwohl ich die Luft anhielt. »Alles Liebe zum Geburtstag, Keaton. Ich hoffe wirklich, dass es dir hier gut geht. Und dass du irgendwann nach Hause kommst und wir darüber sprechen.«
Es gibt kein Zuhause mehr, dachte ich. Und nichts zu besprechen. Ich sagte es nicht, ich sagte gar nichts, ich sah ihn nicht mal mehr an. Ich blieb einfach dort stehen und fixierte San Franciscos Februargesicht hinter dem Fenster, das von diesigem Nachmittagslicht zerfressen wurde.
Charles ging, sein Duft blieb noch eine lange, ätzende Weile. So wie dieses Gefühl in meiner Brust, das ich erst später verstehen würde.
Alles auf der Welt hat ein letztes Mal.
Und man konnte es spüren, wenn sich die Kerbe eines solchen in einen schlug. Denn das hier war eines. Das letzte Mal, dass mein Vater und ich uns sahen oder auch nur ein Wort miteinander wechselten.
Rund einen Monat später würde meine Schwester mich anrufen – viermal, bis ich es über mich brachte, dranzugehen. Sie würde mir von einem Unfall erzählen, der den Boden, auf dem ich schon so lang lag, unter mir wegziehen würde. Ich würde fallend nach England fliegen und am Krankenhausbett meines Bruders zu einem Gott beten, an den ich nicht glaubte, damit er überlebte, und wieder nach San Francisco fliehen, sobald ich sicher war, dass er das tat. Ich würde versuchen, mich auf meine Zukunft zu konzentrieren, bis meine Vergangenheit mich am Fußgelenk packte und zurückzerrte. Zurück nach London, zurück nach Rosehill, zurück in das Leben eines Menschen, der gestorben war, noch bevor seine Eltern dasselbe getan hatten.
Ich würde am Ende tun müssen, was mein Vater gewollt hatte: zurückkehren. Und doch würde ein Teil von mir während alledem hierbleiben. In einem Loft in North Beach, in einem letzten Mal, das tiefere Spuren hinterließ als alle anderen zuvor. Seine Kerbe war ein solcher Abgrund, dass ich es schlichtweg nicht schaffen würde, hinauszuklettern.
Das war die finale Lektion, die mein Vater mich lehrte: Es gibt letzte Male, die wiederholen sich auf ewig. Es gibt Enden, die enden nie.
1
Keaton
Neunzehn Monate später
Es gab eine kurze Zeitspanne zwischen Schlaf und Wachsein, in der ich nicht alles absolut beschissen fand.
Flüchtige Sekunden, in denen mein Bewusstsein noch so traumzersetzt und träge war, dass ich vergessen konnte, wo und als wer ich die Augen öffnete. An manchen Tagen hielten sie länger an als an anderen. An manchen war ich schon schlecht gelaunt, bevor ich die Lider anheben konnte.
Zum Beispiel dann, wenn ich davon geweckt wurde, dass mir die Bettdecke weggezogen wurde.
»Guten Morgen, Sonnenschein.«
Ein Luftzug auf meiner nackten Brust, dann erneutes Stoffrascheln und grelles Licht, das in mein Gesicht fiel. Der Intensität nach ging es schon auf Mittag zu, aber da ich erst gegen fünf Uhr morgens in Rosehill angekommen war, fühlte ich mich nicht im Geringsten ausgeschlafen.
»Verschwinde aus meinem Zimmer, Mari.« Ohne die Augen zu öffnen, warf ich das Kissen zum Fenster, das meine Schwester gerade hörbar öffnete. Es polterte, vermutlich hatte ich die schmutzige Kaffeetassensammlung auf dem Schreibtisch getroffen.
»Das würde nur die Hälfte deines Problems lösen«, erwiderte eine andere Stimme neben mir trocken.
Irritiert blinzelte ich und entdeckte Odell, der mit den Fußspitzen einen Kleiderhaufen auf dem Boden zusammenschob.
»Was zur …« Mühsam setzte ich mich auf und rieb mir mit den Handballen über die Augen.
Bedauerlicherweise änderte das nichts daran, dass meine Geschwister beide im Raum standen und sich skeptisch umsahen. Seit ich unsere Haushälterin darum gebeten hatte, sich nicht mehr um mein Zimmer zu kümmern, sah es darin meistens genauso durcheinander aus, wie ich mich fühlte.
Es war nicht so, als würde ich das Sammelsurium aus benutztem Geschirr und umherliegender Kleidung genießen, aber gerade das gefiel mir. Ich wollte mich nicht an einem Ort wohlfühlen, an dem ich gegen meinen Willen festgehalten wurde. Selbst wenn es durch meine eigene Hand geschah – meinen Geschwistern zuliebe, obwohl ich mich derzeit nicht daran erinnern konnte, warum ich ihnen einen Gefallen tun wollte.
»Was sucht ihr hier?«
»Etwas sehr Seltenes. Ein Gespräch mit dir.« Mari grinste spöttisch und setzte sich auf die Kante des Schreibtischs.
Ächzend ließ ich mich auf die Matratze zurückfallen und strich den Bund meiner Boxershorts glatt. »Muss das jetzt sein? Es ist Samstag, und falls es euch entgangen ist: Ich habe noch geschlafen.«
»Das ist leider der einzige Zeitraum, in dem man dich hier verlässlich vorfinden kann. Und wir müssen reden.« Odell stellte sich an das Bettende, ich fixierte die Decke.
»Über Privatsphäre? Sehr gern.«
Aus dem Augenwinkel nahm ich wahr, wie Mari ihre Perlenkette durch die Finger gleiten ließ, silbrige Pünktchen tanzten auf ihrer sommergebräunten Haut. Was Farbsprenkel für mich waren, waren diese Perlenschatten für sie: ganz eigene Muttermale. Es war Mums Kette gewesen, mit Ausnahme der goldenen Perle, die erst seit ein paar Monaten zwischen den anderen saß. Ich hatte sie sofort bemerkt, ebenso wie die Tatsache, dass meine Schwester seit geraumer Zeit nicht mehr Mums Parfüm trug, sondern eines, das zu dominant war, um von Evergreen Empire zu stammen.
Odell und ich hatten beide anfangs die Nase darüber gerümpft, aber wir übten uns darin, diesen Duft von Midville ebenso wie seinen Erben in diesem Haus – und dem Bett unserer Schwester – zu dulden. Das war es wert, wenn man bemerkte, wie glücklich Mari die Anwesenheit all dieser Midville-Details machte. Ich bemerkte auch das, so wie vieles, ich sagte nur wenig dazu. Mir war klar, dass mich das unaufmerksam und gleichgültig wirken ließ, immerhin wurde mir genau das oft vorgeworfen – das war der Sinn dahinter. Ich hatte das bereits früh erkannt: Je weniger Menschen dir zutrauten, desto weniger erwarteten sie von dir. Unterschätzt zu werden war ziemlich bequem.
»Es ist Ende September«, meinte Mari vielsagend.
Ich hätte mir am liebsten etwas über den Kopf gezogen, aber leider hatte ich ja weder Decke noch Kissen. Da war nur ich auf einem grauen Laken mit der grellroten Erkenntnis, worauf das hier hinauslief. Ich hätte den Weg dorthin abkürzen können, doch ich wollte nicht. Das Ziel war eine Sackgasse, auf die ich seit anderthalb Jahren zusteuerte und für die ich einfach keinen Ausweg finden konnte.
Müde legte ich einen Arm über mein Gesicht. »Danke für die Information, aber ich habe seit einer Weile ein Handy. Ganz modern, mit Datumsanzeige.«
»Du hast deinen Abschluss offiziell vor fast genau zwei Jahren erhalten.« Odells Ton blieb ruhig und bestimmt, unverkennbar gefärbt von dieser angeborenen Autorität, die er von unserem Vater geerbt hatte. Ich nahm es ihm nicht übel, es war nicht seine Schuld.
Im Grunde beneidete ich ihn sogar darum, welche Teile er abbekommen hatte. Manchmal kam es mir vor, als hätte Odell bei seiner Geburt alle guten Gene unserer Eltern mit sich genommen. Anderthalb Jahre lagen zwischen uns, zu wenig Zeit, um das Angebot wieder aufzustocken. Das, was für mich noch übrig geblieben war, waren nur billige Restposten gewesen. Aber vielleicht konnte ich den Genen auch nicht die Schuld an meiner inneren Beschaffenheit geben. Vielleicht lag die wieder mal ganz allein bei mir. Weil man war, was man tat, und weil das bei mir in den entscheidenden Momenten immer das gewesen war: nicht genug.
»Ich hab dein Zeugnis gesehen«, fuhr Odell eindringlich fort. »Und Mr Salford hat das auch.«
Meine Mundwinkel zuckten. »Scheint so, als würde unserem Justiziar ein Gespräch über Privatsphäre ebenfalls guttun.«
Mari seufzte ungeduldig. »Schon klar, du hast keinen Bock auf das alles, aber du kennst die Erbauflagen. Wir müssen spätestens zwei Jahre nach unserem Abschluss bei Evergreen anfangen, sonst …«
»Ja doch«, unterbrach ich sie gereizt. Ich kannte dieses Sonst besser als jedes andere Wort. Schließlich dachte ich permanent darüber nach. Bleib ruhig, bleib hier, bleib brav, sonst verlieren Odell und Mari Evergreen und damit das, was ihnen am wichtigsten ist. Sonst ist da noch etwas, das du dir nie verzeihen wirst.
Das Testament legte fest, dass drei Evergreen-Geschwister gemeinsam im Unternehmen arbeiten mussten, andernfalls verflog auch der Anspruch der anderen beiden darauf – und auf das Erbe allgemein. Im Gegensatz zu den anderen wusste ich, wieso unser Vater diese Klausel aufgesetzt hatte. Ihm war klar gewesen, dass ich ohne sie keine Sekunde gezögert hätte, meinen Anteil auszuschlagen.
Du kannst mich nicht zwingen, zurückzukommen. Das hatte ich ihm rund ein Jahr vor seinem Tod geschrieben, als ich seine ständigen Anrufe nicht mehr ausgehalten hatte. Tja, am Ende hatte er doch einen Weg gefunden und mich dadurch in ebendiese Sackgasse katapultiert. Laut den Erbauflagen musste ich dieses Spiel ein Jahrzehnt lang mitspielen, wenn ich meine Geschwister nicht schachmatt setzen wollte. Anderthalb Jahre waren rum, blieben noch achteinhalb. Wenn ich Evergreen und damit London verlassen durfte, wäre ich zweiunddreißig. Ich musste daran glauben, dass das nicht zu spät für einen Neuanfang war, auch wenn sich jeder Tag bis dahin wie ein eigenes kleines Ende anfühlen würde.
Ergeben nahm ich den Arm runter und hievte mich hoch, lehnte mich gegen das Kopfende. »Also, was erwartet ihr von mir? Dass ich direkt loslege und unsere Büros putze?«
Odell schüttelte den Kopf, mir entging nicht, dass sich seine Haltung entspannte. Es war so seltsam, dass meine Geschwister nach wie vor damit zu rechnen schienen, ich könnte hinwerfen. Sie hatten immer noch nicht verstanden, dass ich nur ihretwegen hier war. Ebenso, wie ich nur ihretwegen gegangen war.
»Ich habe abgeklärt, dass du Montag anfängst.«
Ich schluckte, mein Mund schmeckte nach dem Alkohol der letzten Nacht. Ein bisschen auch nach dem Lippenstift der Frau, die ich geküsst hatte. Burgunderrot wie das Shirt, das ich ihr auf der Toilette des Safe Space ausgezogen hatte, wie die Kratzer auf meinem Unterarm, die sie beim Kommen hinterlassen hatte. Ich zog sie mit dem Blick nach, um meine Geschwister nicht ansehen zu müssen. »Und wo?«
»Das kannst du selbst entscheiden. Wir könnten …«
»Sagt mir einfach, wo ich wann sein soll.« Ich würde nicht so tun, als hätte ich hierbei eine Wahl. Als würde ich irgendwas hiervon wollen. Ich würde es geschehen lassen, mehr auch nicht.
Odell und Mari tauschten einen Blick, offensichtlich waren sie darauf vorbereitet. Meine Schwester hob die Schultern. »Dann kommst du mit ins Marketing. Wir können für die Jubiläumskampagne Unterstützung gebrauchen.«
Allein das Wort ließ mich den Mund verziehen. Dieses Jahr war Evergreen Empire nicht nur 150 Jahre alt geworden, in Kürze wurde auch das 750. Parfüm herausgebracht. Unsere Marketingabteilung saß seit Monaten an der Ausarbeitung eines Werbekonzepts, was ich wusste, weil Mari seit ihrem Arbeitsantritt vor ein paar Wochen ständig davon redete.
Sie hatte schon immer gewusst, in welcher Abteilung sie später einsteigen wollte, im Gegensatz zu mir. Selbst als ich noch aus freien Stücken geplant hatte, bei Evergreen anzufangen, hatte ich mir keine Gedanken darüber gemacht. Da war dieses naive Urvertrauen gewesen, dass sich die Dinge schon richten würden – im wahrsten Sinne, nämlich in genau die Richtung, die für mich richtig war. Marketing wäre vermutlich nicht meine erste Wahl gewesen, aber was spielte das noch für eine Rolle, wenn Evergreen für mich nur noch ein Irrgarten voller falscher Abzweigungen war? Letztlich war Werbung die professionalisierte Form von Lügen, nicht wahr? Wahrscheinlich war ich dort hervorragend aufgehoben.
»Von mir aus. Könnt ihr jetzt abhauen?«
»Klar.« Mari bückte sich nach dem Kissen neben sich und warf es mir zu. »Aber nur, damit du dich fertig machen kannst. In Vorbereitung auf deinen ersten Arbeitstag wirst du mir nämlich heute dabei helfen, in Dads Büro nach hilfreichen Sachen für die Kampagne zu suchen.«
Ich stöhnte. »Muss das …«
»Ja«, unterbrach Odell mich gelassen und zog die Tür auf. »Ich würde auch mitmachen, aber ich muss gleich los. Emmelines Zug kommt bald an.«
»Du darfst also Wochenende machen, ja?« Mein Spott klang nur halbherzig, weil es mich im Grunde freute, dass Odell sich wieder mehr auf sein Privatleben konzentrierte. Vor allem, seit er mit Emmeline zusammen war und grundsätzlich weniger dachte und dafür mehr fühlte.
»Fang erst mal an, zu arbeiten, dann reden wir über Pausen.« Er trat nach draußen. »Tu, was unsere Schwester dir sagt. Außerhalb des Unternehmens ist sie fürs Erste deine Vorgesetzte.« Seine Stimme verebbte mitsamt seinen Schritten auf dem Flur.
»Du hast ihn gehört. Also steh auf, geh duschen und zieh dir was an, das diesen peinlichen Knutschfleck an deinem Hals kaschiert.« Mari bedachte mich mit einem mitleidigen Blick, ehe sie zur Tür ging. »Man könnte meinen, du wärst der Jüngste von uns.«
Ich widersprach ihr nicht, weil sie recht hatte. Das war die logische Folge, wenn ein Teil von einem für immer siebzehn blieb.
Es gab dieses Kinderspiel, Der Boden ist Lava, das ich schon zu Schulzeiten gehasst hatte. Ich hatte jedes Mal verloren, weil ich nicht eingesehen hatte, mich ohne realen Grund damit zu beeilen, auf irgendeine Bank zu springen.
Ich musste immer daran denken, wenn ich Rosehills erstes Stockwerk betrat. Das, in dem das Schlafzimmer unserer Eltern, Charles’ Büro mitsamt hauseigenem Labor und Parfüm-Museum von Evergreen und Mums Atelier lagen. Jeder dieser Räume tat aus anderen Gründen weh. Der Boden war Lava, die Luft war Lava, mein Inneres war Lava – und selbst wenn ich es versucht hätte, gab es vor dieser Gefühlsglut kein Entkommen. Ich verbrannte mit jeder Sekunde, die ich in dieser Etage war, weswegen ich es weitestgehend vermied.
Vielleicht wäre ich auch diesmal abgehauen, hätte Mari nicht mit warnendem Blick in ihrer Zimmertür gelehnt, als ich aus dem Bad kam. Keine zehn Minuten später saßen wir im Büro unseres Vaters auf dem Teppich vor dem Schreibtisch. Mari zog Kisten aus dem Regal und schichtete sie vor mir auf, während sie mir erklärte, wonach wir suchten.
Ich hörte nur mit einem Ohr zu. Der Plan war, das neue Parfüm, das nächstes Frühjahr auf den Markt kam, dafür zu nutzen, an die Bedeutung der Marke Evergreen zu erinnern. Die Werbung für den Duft sollte dementsprechend eine für das gesamte Unternehmen werden. Dafür wollten sie auf irgendeine Weise auch Erinnerungsstücke in Form von Zeitungsartikeln, Fotos und Ähnlichem mit einfließen lassen.
Odell hatte mir letztens eine Probe des Parfüms gezeigt: Oud, Veilchen, Maiglöckchen, Himbeere und Vanille, ein sanfter, blumiger Duft, der zunächst unauffällig und fast zu flüchtig wirkte, an den man sich aber noch Stunden später erinnerte, selbst wenn man nur seine Abwesenheit bemerkte. Dazu passend hatte unser Parfümeur Samson in Absprache mit dem Vorstand den Namen gewählt: Eonian. Etwas Unendliches, etwas, das ewig anhält. Eine Erinnerung daran, wie Evergreen Empire sich selbst sah. Eine Verspottung dessen, was ich fühlte, weil ich deswegen hier festsaß.
»Schau mal.« Mari reichte mir ein Foto, das an einer Seite eingerissen war. Ich hätte es gern vollständig zerfetzt, als ich erkannte, was darauf zu sehen war. Meine Geschwister, unsere Eltern und ich. Es war eine offizielle Aufnahme, die Tapete im Hintergrund gehörte nicht zu Rosehill, sondern zum Claridge’s – einem Luxushotel in Mayfair. Ich hätte das nicht bemerken müssen, um zu wissen, was für ein Bild das war.
Zwischen meinen Schulterblättern kribbelte es, genau an der Stelle, an der Charles’ Hand auf dem Foto lag. Eine verdeckte Mahnung, stillzustehen, zu lächeln, zu gehorchen. Zu tun, was er wollte. Das war das letzte Mal gewesen, dass ich das getan hatte. Fast zumindest. Mit einer Ausnahme, die ich am meisten bereute.
Mari tippte auf das Foto. »Erinnerst du dich daran? Diese Gala war eines der ersten Events, auf das ich mitdurfte. Und das letzte, bevor …«
Mum starb. Wir dachten diese Wörter beide, vermutlich öfter, als wir vor dem anderen zugeben würden. Alle Sätze endeten damit, denn alles endete damit, richtig? Oder … nein, im Grunde tat es das wirklich schon vorher. Auf dieser Gala. In einem Treppenhaus mit rotem Teppich, unter einem Kronleuchter an einer stuckbesetzten Decke.
Dort verlor ich meine Kindheit.
Dort erkannte ich, dass alles, was ich über meine Familie zu wissen geglaubt hatte, eine Lüge war.
Dort erfuhr ich, dass mein Vater eine Affäre gehabt hatte.
Es kostete mich meine gesamte Kraft, diesen letzten Satz auch nur zu denken. Seit fast sechs Jahren schichtete ich Stein um Stein darauf, um ihn in der Tiefe meines Bewusstseins festzuhalten. Um ihn für mich zu behalten. Um ihn von meinen Geschwistern fernzuhalten.
Ich blinzelte mehrmals, doch die Bilder blieben. Sie schoben sich vor dieses eine, das vor mir lag. Das letzte Familienfoto, das es von uns gab. In jeder Hinsicht.
Ich kniff die Augen zusammen und war wieder dort.
Meine Schritte hallten auf dem Boden wider, als ich vom Balkon zurück in den Flur bog, von dem aus man in den Ballsaal im Erdgeschoss gelangte. Die Wirkung der zu schnell gerauchten Zigarette in meinem Kopf; weich pochende Watte, die sich um meine Gedanken gewickelt hatte und die Aussicht, den Abend auf dieser sterbenslangweiligen Spendengala zu verbringen, fast erträglich wirken ließ.Dabei war es kein Gras, nur Nikotin. Dads enttäuschten Blick könnte ich aushalten, immerhin übte ich das seit siebzehn Jahren, Mums Besorgnis war schwerer zu ertragen. Nur ihr zuliebe war ich überhaupt hier, auf die angemessenste Weise, die ich hinbekam. Natürlich war diese in den Augen meines Vaters nicht ausreichend, aber auch das übte ich seit Jahren.
Ich war das Mittelkind, in nichts der Größte oder Beste, aber auch nie der Schützens- oder Unterstützenswerteste, in allem der Durchschnitt. Das Minimum war meine Komfortzone, aus der ich mich nicht mehr hinausbewegte, seit ich erkannt hatte, dass das weder nötig war noch irgendetwas brachte. Ich war mit meiner Geburt auf den für mich vorhergesehenen Platz auf der Welt gesetzt worden. Im Grunde musste ich nichts tun, um ihn zu erreichen oder zu halten. War das unfair? Klar. War es außerdem bequem? Absolut. Dass ich gelegentlich bei irgendwelchen albernen Events im Anzug posieren musste, war ein geringer Preis dafür, das war mir bewusst. Ätzend fand ich es ab und zu trotzdem.
Ich stolperte fast über meinen offenen Schnürsenkel, als ich um eine Ecke bog und ihn sah. Reflexartig blieb ich stehen. Ich hatte damit gerechnet, dass mir mein kurzes Abtauchen Ärger einhandeln würde, aber nicht, dass Dad sich extra dafür auf die Suche nach mir begeben würde. Doch da stand er, wenige Meter entfernt an einem anderen geöffneten Balkon, von dem aus man auf Mayfair blicken konnte.
Erst als er eine Bewegung zur Seite machte, erkannte ich, dass er nicht allein war. Eine Stehlampe neben der Tür war an, Lichtstreifen formten ein goldenes Band, das die beiden Personen noch enger aneinanderschnürte. Mein Vater und eine Frau, die mir vage bekannt vorkam, auch wenn ich es nicht schaffte, ihr einen Namen zuzuordnen.
Alles, was ich mit Sicherheit über sie wusste, war, dass sie nicht meine Mutter war. Weswegen es keinen Sinn ergab, dass sie die Hände am Revers meines Vaters liegen hatte. Nicht so, als wollte sie es richten, eher so, als wollte sie sich damit aufrecht halten. Vielleicht, weil ihr Inneres ebenso sehr wankte wie ihre Stimme.
»Es tut immer noch weh, sie zu sehen. Euch … alle.«
»Ich weiß. Für mich ist das auch nicht leicht. Aber manche Dinge kann man nicht mehr ändern, man muss einfach mit ihnen leben. Wir haben beide eine Familie zu schützen. Ich liebe sie, und du liebst ihn, Bee. Ihr liebt einander. Das ist das Richtige. Alles andere war ein Fehler.«
Schon als Kind hatte ich festgestellt, dass ich manchmal nicht erklären konnte, was oder warum ich etwas empfand – oder aber es nicht schaffte, auf eine Tatsache mit einer Emotion zu reagieren. Da war dieser Spalt zwischen meinem Verstand und meinem Herzen, ein schmaler Grenzstreifen, in den sich manche Erlebnisse verirrten. Sie blieben entweder auf der einen oder auf der anderen Seite hängen, sodass ich nicht sofort gleichzeitig über sie nachdenken und etwas durch sie empfinden konnte.
Das hier, das fühlte ich, ehe ich es begriff.
Etwas zerbrach. Etwas um mich herum. Etwas in mir. Die Luft bestand aus Scherben, ich hielt sie an, obwohl ich mir lieber etwas anderes hätte zuhalten sollen: meine Ohren.
Die Frau gab einen erstickten Ton von sich. »Tu nicht so, als hätte es nichts bedeutet. Es waren viele Fehler.«
Ihre Hände fielen von ihm ab, er legte seine auf ihre Schultern und zog sie näher an sich heran. »Das Entscheidende ist die Zeitform. Wir wissen es beide, diese Affäre ist schon lang vorbei.«
Affäre. Dieses Wort öffnete einen winzigen Spalt im Grenzzaun, die Momentbedeutung kletterte in meinen Verstand. Stolpern. Mein Herz und meine Füße, weil ich gleichzeitig begriff und zurückwich. Ich stolperte über diese Wahrheit und meinen Schnürsenkel. Meine Hände auf dem kalten Boden, Schürfwunden auf und unter der Haut. Ich wusste es schon da: Ich würde nie wieder richtig aufstehen.
Mein Vater fuhr herum, unsere Blicke prallten aufeinander. Ich hörte trotzdem nicht auf, zu fallen. Nicht mal, als ich mich aufrappelte, umdrehte und losrannte.
»Keaton!«
»Keaton?« Maris Hand auf meiner Schulter, eine andere in meinen Erinnerungen an derselben Stelle.
Ein fester Griff, ein Herumdrehen, als ich zwei Schritte vom Anfang der Treppe entfernt war. Sein Gesicht, jedes Detail mehr als vertraut, alles daran fremd. Das war nicht mein Vater. Das war jemand, den ich nicht kennen wollte.
»Keaton, hör zu. Erzähl deiner Mutter nichts hiervon. Das, was du da gerade mitbekommen hast, ist lang vorbei, es hat keine Bedeutung für uns.«
»Hallo?« Mari schnippte vor mir in die Luft, ehe sie auf das Foto deutete. »Erinnerst du dich nicht mehr?«
»Wie kannst du das sagen? Wie … wie konntest du das tun?«
Ich schüttelte Maris Hand ab, die andere blieb. Glühend und schwer und ewig. Jedes Erinnerungsdetail dieser Nacht war ein Brandzeichen, das ich nie loswerden würde. »Doch.«
»Ich verstehe, wie du dich gerade fühlst, aber …«
»Du warst an dem Abend so mies drauf, weil du lieber auf irgendeine Party wolltest.«
»Du verstehst gar nichts! Mein Leben lang … hast du mir etwas von Moral und Anstand und Loyalität erzählt. Und währenddessen fickst du eine andere Frau?«
»Aus Protest hast du Sneaker statt Anzugschuhe angezogen. Dad war so sauer auf dich.«
»Keaton, nicht in diesem Ton.«
Ich lächelte schmal. »Wie so oft.«
»Du hast mir nichts mehr zu sagen.«
»Und dann bist du irgendwann verschwunden, um zu rauchen. Ein klassischer Keaton.«
»Doch. Und deswegen hörst du auf mich, verstanden? Sag deiner Mutter nichts. Du würdest ihr das Herz brechen.«
Meine Atmung wurde flacher, ich zerrte am Kragen meines Shirts. »Was du nicht sagst.«
»Ich? Ich würde ihr das Herz brechen?«
»Mum war ziemlich besorgt, also ist Dad dich suchen gegangen. Er hat dich aber nicht gefunden, oder?«
»Ich liebe sie. Und sie liebt mich. Wir lieben euch. Das ist die einzige Wahrheit, die wichtig ist.«
Mein Kehlkopf wummerte, meine Stimmbänder reagierten von selbst. Wenn man es gut genug trainierte, war lügen wie atmen. Man konnte nicht mehr von allein damit aufhören. Mit einem Unterschied: Man erstickte langsam, aber sicher daran, ohne dass es jemand mitbekam. »Nein.«
»Weißt du noch, was du mir bei diesem unsäglichen Aufklärungsgespräch eingetrichtert hast? Die schlimmste Art von Mann ist die, die denkt, sie könnte sich alles erlauben.«
»Du bist nicht wiedergekommen.«
»Du verstehst das nicht.«
»Nein.« War ich tatsächlich nicht. Manchmal verließ man einen Raum, ohne zu wissen, dass man sich hinter einer Tür verlieren würde. Manchmal sogar, ohne sich zu bewegen. Reglos stehend in einem verwinkelten Treppenhaus vor den Augen eines Menschen, der siebzehn Jahre lang ein Fixpunkt im Leben gewesen war.
»Zum Glück. Ich will nicht diese Art von Mann sein. Ich will nicht sein wie du.«
»Du bist einfach abgehauen.«
»Sag es ihr nicht. Ich bitte dich. Mach nicht kaputt, was wir haben.«
»Tja. Klassischer Keaton, was?« Ich kniff die Augen zusammen, Lichtkreise durchzogen das Schwarz, ich wünschte, sie hätten diese Erinnerung endlich überblenden können. Dabei wusste ich es doch: Für die schlimmste Art von Enden galt kein endlich. Sie gingen weiter und weiter und weiter.
»Es ist schon kaputt. Und das ist allein deine Schuld.«
»Keaton?«
»Keaton, bitte.«
»Keaton!«
Maris Hand an meiner Schulter ließ mich blinzeln. Mühsam starrte ich in ihr angespanntes Gesicht. »Was?«
»Das Foto. Du machst es kaputt.«
Klassischer Keaton, was? Langsam senkte ich den Blick auf das zerknitterte Bild zwischen meinen Fingern. Eine scharfe Kante lief über meinen Körper, das einzige Anzeichen eines Bruchs in mir, den ich seitdem für mich behielt.
Was wäre gewesen, wenn?
Ich stellte mir diese Frage so oft. Was wäre gewesen, wenn ich an jenem Abend in den Saal zurückgekehrt wäre und Mum und meinen Geschwistern erzählt hätte, was ich gehört hatte? Was wäre gewesen, wenn ich es meiner Mutter später in Rosehill gestanden hätte? Was wäre gewesen, wenn ich meinen Vater tags darauf beim gemeinsamen Essen gezwungen hätte, es selbst auszusprechen? Was wäre gewesen, wenn … ich mutiger gewesen wäre?
Ich hätte meine Familie verletzt, ich hätte ihnen aufgebürdet, was ich selbst kaum tragen konnte, und letztlich hätte es nichts hieran geändert: Mum wäre trotzdem zehn Tage später tot gewesen. Ich wusste das. Ich konnte nur nicht aufhören, mich zu fragen, ob es dennoch besser gewesen wäre. Ob ich dadurch besser gewesen wäre. Ein besserer Mensch. Ein besserer Mann. Weniger … wie mein Vater.
Ich würde es nie erfahren, denn ich hatte nichts davon gemacht. Weil ich nicht wusste, was ich tun sollte. Weil ich nicht wusste, was das Richtige wäre, wenn alles so unglaublich falsch war. Weil ich wütend war und verwirrt und entsetzt und verzweifelt und feige. So feige. Ich tat gar nichts, weil ich das am besten konnte. Ich wartete. Einen Tag, zwei, drei … eine Woche. Zehn Tage. Zu lang.
Die ganze Zeit über fühlte ich dieses Geheimnis wie eine Bombe in mir, die jeden Moment explodieren würde. Ich rechnete nicht damit, dass etwas anderes zuerst platzen könnte. Dieses winzige Aneurysma im Kopf meiner Mutter.
Die andere Bombe, die tickte immer noch. Ich spürte sie, jede einzelne Sekunde. Das war einer der Gründe dafür, dass ich seit meiner Rückkehr die meiste Zeit außerhalb dieses Hauses verbrachte. Ich durfte nicht in Maris und Odells Nähe sein, wenn sie hochging.
Meine Schwester musterte mich. Sie hätte es nie direkt ausgesprochen, aber ich wusste, dass sie sich um mich sorgte. »Alles klar bei dir?«, hakte sie betont sachlich nach. »Du wirkst irgendwie … abwesend.«
Grob wischte ich verbliebenen Schlafsand aus meinen Augenwinkeln. Wenn ich Glück hatte, klebten die Reste der Damals-Fetzen darin und ließen mich wenigstens eine Weile in Ruhe. »Ich bin einfach noch nicht richtig wach. Das kommt davon, wenn ihr mich aus dem Bett werft und zu solchem Scheiß zwingt.«
Mari schnaubte und hievte sich hoch. »Gut, jetzt klingst du mehr nach dir. Ich mach uns Tee.«
Genervt warf ich das Foto zurück in die Kiste. »Ich will Kaffee.«
»Schön für dich. Du bekommst aber Tee.«
Während ihre Schritte auf dem Flur verklangen, stand ich auf und setzte mich an den Schreibtisch. Lieber wühlte ich mich durch öde Geschäftsakten als weiter durch Lügenbilder einer ach so heilen Familie.
Ich öffnete die oberste Schublade und nahm einen Stapel Papiere heraus. Dem ersten Blick nach waren es nur Kopien von Rechnungen, deren Originale sich wahrscheinlich in den Ordnern hinter mir befanden, und Gesprächsprotokolle von Telefonaten, die Charles eher bei Evergreen hätte führen sollen, wenn er so was wie Feierabend gekannt hätte.
Ich blätterte sie durch und blieb mit den Fingern an einer umgeknickten Ecke hängen. Reflexartig zog ich das Blatt hervor. Nur eine Seite, nicht mal bis zur Hälfte gefüllt, die Schrift verblasst, das Papier dünn. Vermutlich handelte es sich um den Durchschlag eines Briefs.
Ich wollte ihn mit den anderen Unterlagen zurück in die Schublade legen, als ich das erste Wort las. Mein ganzer Körper erstarrte, nur mein Blick flog über die paar Zeilen.
Bee.
Wie ich bereits letzte Woche am Telefon sagte, sehe ich keinen Sinn in weiteren Treffen. Wir haben eine Entscheidung getroffen, wir sollten uns daran halten und nach vorn sehen. Ich weiß, dass er mein Sohn ist, und will das Beste für ihn, alles andere spielt keine Rolle. Charles
Meine Sicht verschwamm, ich kniff die Augen zusammen, aber an den Worten änderte sich nichts. Ebenso wenig daran, dass sie alles veränderten. Wenn sie das bedeuteten, was ich dachte. Wie von selbst griff ich nach meinem Handy.
Das kann nicht sein, beruhigte ich mich, während ich den Browser aufrief und zwei Wörter eintippte. So wie in jener Nacht nach der Gala, nachdem ich Stunden gebraucht hatte, bis ich dieses Gesicht im Internet wiedergefunden hatte und es mit einem Namen verknüpfen konnte.
Beatrice Reading.
Mein Finger schwebte über der Tastatur, ehe ich es über mich brachte, ein weiteres Wort einzugeben. Eines, an das ich in Verbindung mit dieser Frau nie gedacht hatte.
Die Medien waren voll mit Bildern von Bee, ihrem Mann und ihrem Kind. Einer Tochter, die sie als Baby adoptiert und zu einem lächerlich perfekten Vorzeigeexemplar der britischen Prominenz erzogen hatten. Man konnte nicht in England leben, ohne permanent mit der Existenz dieser Menschen konfrontiert zu werden. Genau deswegen war ich sicher: Es gab kein zweites Kind. Es gab keinen Sohn.
Ich gab die vier Buchstaben trotzdem ein. Klickte auf Enter. Lehnte mich zurück. Atmete. Und hörte damit auf, als die Ergebnisliste auftauchte und mir dieses Wort direkt aus dem ersten Treffer entgegenstarrte.
Ein Artikel, der vor einigen Monaten anlässlich der Premiere von Beatrice’ neustem Film erschienen war. Londons Lieblingsfamilie stand in der Headline, über einem Foto der von mir meistgehassten Familie dieser Stadt. Einer dreiköpfigen Familie. Ich wollte es dabei belassen, aber mein Blick schwang reflexartig tiefer.
Das Traumpaar der britischen Filmwelt, Beatrice und Rupert Reading, mit ihrer ebenfalls ans Rampenlicht gewöhnten Tochter, Kenndrea (20). Das Ehepaar hat außerdem einen Sohn, Theodore (17), der im Gegensatz zu seiner Adoptivschwester noch keinen Fuß in die Welt der Öffentlichkeit gesetzt hat und als wohlbehütetes Geheimnis der Familie gilt.
Ich ließ das Handy los. Nicht sinken, fallen. Das, was mein Magen tat, als er hinabsackte. Mir wurde übel, mein Puls beschleunigte sich, gleichzeitig blieben meine Gedanken klar und geordnet. Wenn alles, was man einst zu wissen geglaubt hatte, bereits als Lüge enttarnt worden war, kam einem jede noch so abwegig erscheinende Wahrheit logisch vor.
Jede Familie hatte Geheimnisse, richtig? Wie es aussah, teilte meine sich eins mit einer anderen. Ein uneheliches Kind meines Vaters, ein weiteres Geschwisterkind für mich.
Der Gedanke beruhigte meine Atmung ein wenig, ein Reflex, den dieses Wort – Geschwister – auslöste, ohne dass ich es verhindern konnte. Weil sie dasselbe taten.
Das gilt nicht für ihn, du weißt nichts über diesen Typen, rief ich mir in Erinnerung.Ebenso wenig wie der Rest der Welt, wie ich nach wenigen Minuten begriff. Alles, was das Internet bei der Suche nach Theodore Reading ausspuckte, waren ein paar alte Kinderfotos und Randnotizen in Artikeln über seine Adoptivschwester, zu der er angeblich ein inniges Verhältnis pflegte.
Fast hätte ich bei diesen Worten gelacht. Ich kannte Kenndrea Reading nicht, aber das musste ich auch nicht, um sicher zu sein, dass man sie nicht gut genug kennen konnte, um irgendetwas Inniges mit ihr zu haben. Diese Frau war in allem, was sie preisgab, oberflächlich. Eine schöne Hülle, eine perfekte Illusion. Da war kein Funken Inneres in dem, was sie vor anderen tat oder … war.
Das Dröhnen in meinem Kopf wurde stärker, je länger ich auf den Bildschirm starrte und immer wieder ihrem Gesicht begegnete. Ich wusste, woran das lag. Daran, dass mein Bewusstsein versuchte, diese eine Erinnerung abzuspielen, die ich mit ihm – mit ihr – verband. Diesen einen Moment, in dem ich sie nicht durch eine schützende Schicht aus Leinwandmaterial, Plakatpapier oder ausreichend Entfernung betrachtet hatte. Diesen einen Augenblick, in dem ich den Fehler gemacht hatte, unsere persönliche vierte Wand zu durchbrechen und ihr näherzukommen, obwohl ich mir geschworen hatte, das nie zu riskieren.
Ich war mir immer sicher gewesen, Kenndrea Reading und ich hätten nichts gemeinsam. Wie hätte ich ahnen sollen, dass ihr Bruder auch meiner war? Dass Mari, Odell und ich wegen ihm nicht mehr drei Geschwister waren, sondern … vier?
Meine Schläfen begannen zu pochen, diesmal hing die Erkenntnis im Grenzbereich auf Seiten meines Verstandes fest. Ich begriff, was das bedeutete, bevor ich wirklich etwas empfand. Mein Herz fühlte sich leer und kühl an, in meinem Kopf ging ein Gedanke in Flammen auf.
Ein vierter Evergreen war auch das: eine Möglichkeit für mich, keiner mehr sein zu müssen.
2
Kenndrea
Nichts irritierte mich so sehr wie ein Spiegel.
Ich beobachtete mich dabei, wie ich mit den Fingerkuppen über meine Wangenknochen tastete, die Struktur meines Kiefers nachzeichnete, meinen Nasenrücken hinauffuhr. Jedes Mal, wenn ich an einem Spiegel vorbeikam, musste ich zumindest kurz hineinsehen. Und jedes Mal fragte ich mich ein und dasselbe: Darf einen etwas so Vertrautes nach einundzwanzig Jahren noch derart verwirren?
Vielleicht konnte etwas nur Sinn ergeben, wenn man seinen Ursprung kannte. Und das tat ich nicht. Ich wusste nicht, von wem ich diese Nase hatte. Wer ein Lächeln auf einem ähnlichen herzförmigen Mund geübt hatte, kupferrotes Haar gekämmt und Sommersprossen auf dem ganzen Gesicht gezählt hatte. Wer sich im Spiegel aus gleichen Augen entgegengesehen hatte, bevor ich meine geöffnet hatte. Hellblau, pastellblau, blassblau.
Blass. Prüde. Verklemmt. Langweilig.
Die Wortkette zurrte sich um meinen Hals und drehte mein Gesicht zur Kommode neben dem Waschbecken. Von hier aus konnte ich die Headline des Artikels auf dem Tablet nicht lesen, daran denken musste ich trotzdem permanent seit einer Woche.
»Schön wie ein Bild, steif wie ein Brett.«
Ex-Freund von It-Girl packt aus: So tickt Kenndrea Reading jenseits der Kameras
Eine Schlagzeile, vier Schlaglöcher darin, in die ich bei jedem Lesen hineinstürzte.
It-Girl. Als wäre ich ein Ding. Ex-Freund. Als wären wir mehr gewesen als ein Drei-Treffen-Versuch. Steif. Als wäre mein Inneres nicht zerrupft wie ein aufgeschlitztes Daunenkissen. Schön. Als würde das irgendetwas bedeuten.
Ich schämte mich für den letzten Gedanken, weil er so wahr war. Schönheit war ein konstruiertes Gesellschaftskonzept, ein bedeutungsloses Wort. Doch wenn alles Positive, was man über mich sagte, war, dass ich schön war – was verriet das über mich? Was war ich dann noch?
Wenn man Leo fragte, nichts Nennenswertes.
Auf die Frage, in welchem Bereich Leo die Zukunft seiner Ex-Freundin nach ihrer derzeitigen Auszeit sieht, lacht er. »Ganz ehrlich? Sie würde sich einen Gefallen damit tun, sich komplett neu zu orientieren. Der richtige Name ersetzt kein Talent. Kenna ist ein nettes Mädchen, aber irgendwie ist alles, was sie tut, auch ein bisschen egal.«
Ein bisschen egal. Ich wünschte, diese Worte wären mir das auch. Ich hatte sie im Laufe der Jahre eigentlich oft genug gelesen, gehört und gedacht. In den Augen der Welt war ich nichts weiter als ein privilegiertes Nepo-Baby: das Kind berühmter Eltern, das durch deren Kontakte und Bekanntheit erleichterte Startbedingungen für die eigene Karriere gehabt hatte. Für sie war der Grund für jede noch so kleine Filmrolle, jeden Model-Job, jede Songwiedergabe und jeden Auftritt in der Öffentlichkeit ausschließlich mein Name. Mein Name, der für viele nicht mal wirklich mir gehörte. Er war nichts Angeborenes, er war etwas Geschenktes.
Sie hatte nur Glück. Sie verdient nichts davon. Sie ist so austauschbar. Sie ist so egal.
Es sollte mich nicht kümmern, was die Menschen in der Presse oder den sozialen Netzwerken dachten, niemand von denen kannte sie wirklich. Aber für mich war dieses Sie ein Ich, und sich selbst sollte man kennen, oder? Wieso glaubte ich dann leichter fremden Worten über mich, als eigene zu finden?
Kennst du dich denn?
Mein Herz pochte schwer, wie immer, wenn diese Stimme in meinem Kopf auftauchte. Sie war lauter als alle anderen, und schlimmer. Denn wenn sie zurückkam, kehrte auch der Moment zurück, in dem ich sie gehört hatte. Oder eher: Ich kehrte dorthin zurück. Und das nur, um mich ein weiteres Mal und noch ein bisschen mehr zu verlieren.
Manchmal fiel es mir schwer, einen Unterschied zwischen einer Filmszene und einem realen Moment zu erkennen.
In diesem Augenblick zum Beispiel war ich nicht sicher, ob das Lachen, das ich hörte, wirklich meins war oder zu einer Rolle gehörte, in die ich reflexartig hineingeschlüpft war. Das würde erklären, warum der Ton zu hoch und laut klang wie etwas, das ich nicht mit meinem Inneren in Einklang bringen konnte. Ich ließ es ersterben und hielt mit Mühe das dazugehörige Lächeln aufrecht. Es ziepte an meinen Mundwinkeln, als würde es nicht richtig passen, aber ich wusste, dass das niemandem auffiel. Dafür gefiel es ihnen.
Die wohlwollende Art, wie die Frau, eine Bekannte meiner Eltern, mich ansah, machte das mehr als deutlich.»Wir gehen schon mal rein«, meinte sie und hakte sich bei ihrer Begleitung unter. »Sehen wir uns drinnen?«
»Natürlich, ich komme sofort.« Ich deutete zum Eingang des Dorchester, in dem die Spendengala stattfand. Die Gala, auf der ich meine Eltern vertreten sollte und auf der ich es exakt zehn Minuten ausgehalten hatte, bevor ich die Blicke auf mir nicht mehr hatte ertragen können. Trotzdem würde ich gleich wieder reingehen und lächeln – weil es sich so gehörte, weil ich hierhergehörte. Auch wenn es sich manchmal nicht so anfühlte. Ich musste es nicht empfinden, ich musste es nur glaubhaft rüberbringen, richtig?
»Ich freue mich schon seit Wochen auf diesen Abend.« Ich winkte ihnen nach, und erst in dem Moment, in dem sich die Tür zwischen uns schloss, ließ ich los. Meine Hand fiel hinab, meine Mundwinkel auch, ich konnte spüren, wie jedes bisschen falsche Freude aus meinen Zügen verschwand. So was passierte oft, wenn ich von Gesellschaft ins Alleinsein überging. Es kam mir vor, als wäre ich eine Marionette, deren Fäden losgelassen wurden. Ich hasste das, weil ich wusste, was dieses Bild aus mir machte. Eine leblose Puppe.
»Muss anstrengend sein.«
Die Stimme ließ mich herumfahren. Hin zu einer Stelle ein paar Meter neben der Tür, wo jemand an dem Gebäude lehnte. Ich sah ihn nicht richtig, der Strahl der Außenbeleuchtung brach sich an einem Fassadenbalken über ihm. Schlecht sitzender Anzug, schmutzige Lederschuhe, Silberringe an der Hand, mit der er sich an der Wand hinter sich abstützte. Sein Gesicht lag im Schatten, trotzdem spürte ich seinen Fokus auf mir. Etwas daran irritierte mich. Es war nichts Anziehendes, eher … etwas Ausziehendes. Sein Blick auf mir, und ich fühlte mich nackt.