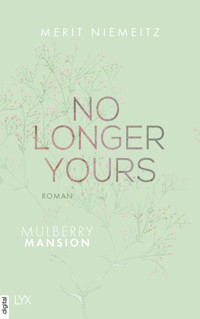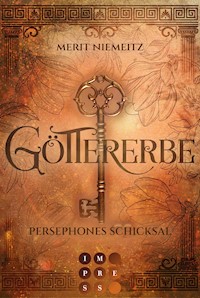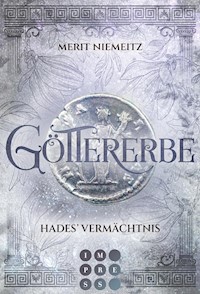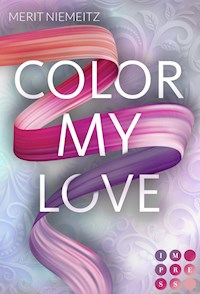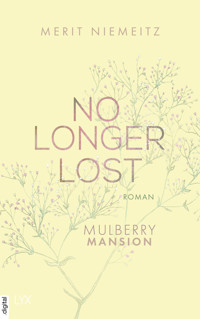
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Mulberry Mansion
- Sprache: Deutsch
Kannst du einen Menschen lieben, bei dem du dachtest, es wäre unmöglich?
Die Fördergelder für die Mulberry Mansion werden gekürzt! Psychologiestudentin May würde alles tun, um ihr Zuhause zu retten, selbst den einen Menschen um Hilfe bitten, den sie absolut nicht ausstehen kann - Wesley Hastings, "König" der Windsbury University und Sohn der Vizekanzlerin. Völlig überraschend willigt Wes ein, bei seiner Mutter ein gutes Wort für die Villa einzulegen - einziger Haken: May soll an seinem Psychologieexperiment teilnehmen mit der These: Kann man jeden Menschen lieben? Sie stimmt dem Deal zu, denn sie kann sich nicht vorstellen, sich in jemanden wie Wes zu verlieben. Doch durch das Projekt erkennt sie, dass hinter der Fassade des reichen Jungen so viel mehr steckt. Dennoch darf May ihre Gefühle für Wes niemals zulassen ...
"Die Geschichte von May und Wes ist wie ein Marmeladenglas gefüllt mit bunten Momenten: eine ganz besondere Liebe, bestehend aus Poesieworten, die einfach nur heilen und inspirieren." @ MARIESLITERATUR
Band 2 der MULBERRY MANSION-Reihe von Merit Niemeitz, der großen Entdeckung beim LYX-Pitch
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 694
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhalt
Titel
Zu diesem Buch
Leser:innenhinweis
Widmung
Playlist
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
Epilog
Danksagung
Die Autorin
Die Romane von Merit Niemeitz bei LYX
Impressum
Merit Niemeitz
No Longer Lost
MULBERRY MANSION
Roman
Zu diesem Buch
May Little ist die gute Seele der Mulberry Mansion. Für ihre Mitbewohnenden hat sie stets ein offenes Ohr und eine Tasse Tee parat. Seit sie für das Psychologiestudium ihre Familie zurückgelassen hat, ist das alte Herrenhaus ihr Zuhause geworden. Doch als die Universität unerwartet die Fördergelder kürzt, können die Reparaturen nicht mehr bezahlt werden. May würde alles für die Villa tun, selbst den einen Menschen um Hilfe bitten, den sie absolut nicht ausstehen kann – Wesley Hastings, »König« der Windsbury University und Sohn der Vizekanzlerin. Die beiden sind im selben Psychologiekurs, und May sieht in Wes nichts weiter als einen arroganten, egoistischen Jungen mit zu viel Geld. Daher überrascht es sie, dass er einwilligt, bei seiner Mutter ein gutes Wort für die Mulberry Mansion einzulegen – allerdings für eine Gegenleistung: May soll an seinem Uniprojekt mit dem Thema Kann man jeden Menschen lieben? teilnehmen. Sie ist fest davon überzeugt, dass das Experiment zum Scheitern verurteilt ist, weil Wes und sie nicht unterschiedlicher sein könnten. Doch durch das Projekts erkennt sie, dass hinter der Fassade des reichen Jungen so viel mehr steckt. Dennoch darf May ihre Gefühle für Wes niemals zulassen …
Liebe Leser:innen,
dieses Buch enthält potenziell triggernde Inhalte. Deshalb findet ihr hier eine Triggerwarnung.
Achtung: Diese enthält Spoiler für das gesamte Buch!
Wir wünschen uns für euch alle das bestmögliche Leseerlebnis.
Eure Merit und euer LYX-Verlag
Für Kevin und die Möwen in Berlin.
Absurd und schön, absurd schön.
Playlist
About Today – The National
Under Water – AVEC
Stay Alive – José González
Blue Hours – Bear’s Den
Why Worry? – Dire Straits
champagne problems – Taylor Swift
come out and play – Billie Eilish
False Alarms – Noah Reid
Little Bother – King Princess, Fousheé
I Am a Rock – Simon & Garfunkel
Movement – Hozier
A Troubled Mind – Noah Kahan
Block me out – Gracie Abrams
Make It Right – Benjamin Amaru
Delicate – Damien Rice
I Should Go – Solo Version – James Vincent McMorrow
Downtown – Lilla Vargen
Fine Line – Harry Styles
I Should Live in Salt – The National
Strangers – J-pag
Wait for You – Ocie Elliott
Iris – Go-Jo
Wings – Luca Firth
You Might Find Yours – Tom Rosenthal
Kann man jeden Menschen lieben?
Ein Experiment zur Psychologie der Zuneigung
Hintergrund:
In der Sozialpsychologie wird Liebe als Einstellung definiert, die sich durch affektive (gefühlsbetonte), kognitive (gedankenbetonte) und verhaltenstechnische Elemente auszeichnet. Forschende gehen davon aus, dass innerlich veranlagte Aspekte wie Sympathie sowie äußerlich veranlagte wie Attraktivität zwar Effekte sind, die eine anfängliche Anziehung fördern, allerdings keine Voraussetzung für die Bildung von Zuneigung darstellen. Zentraler für diese ist die Bereitschaft, ehrlich miteinander zu interagieren, um dem Gegenüber die Möglichkeit zu geben, Verständnis und darauf aufbauend ein Gefühl der Verbundenheit zu entwickeln. Die dadurch entstehende psychische Intimität begünstigt wiederum (sofern beide grundlegend sexuelle Anziehung gegenüber anderen Menschen empfinden) physisches Verlangen und führt letztlich zu einem geistigen und körperlichen Zustand, der allgemeinhin als Verliebtheit bezeichnet wird.
Hypothese:
Unter gewissen Grundvoraussetzungen (räumliche Nähe, ähnliche Lebensumstände und Altersspanne etc.) ist es möglich, für jeden Menschen, der sich einem komplett und ohne Vorbehalte öffnet, tiefgehende Gefühle zu entwickeln.
Aufbau und Durchführung*:
Die Proband:innen treffen sich regelmäßig über einen Zeitraum von drei Monaten hinweg. Es werden hundert beispielhafte Fragen vorgegeben, die um weitere ergänzt werden, die durch Gespräche und Erlebnisse entstehen. Über die gegenseitige Beantwortung dieser hinaus beziehen die Proband:innen einander in die wichtigsten Bereiche ihres Lebens ein: Freunde, Alltag, Familie, Alleinsein (FAFA). Dies geschieht durch Erzählungen und durch aktive Teilnahme. Abgeschlossen wird das Experiment mit einem vierminütigen Blickkontakt, durch den die gebildeten Gefühle füreinander gefestigt und erkannt werden. Oberste Prämisse des Experiments stellt allumfassende Ehrlichkeit dar, sowohl beim Reden als auch beim Zuhören. Dies bedeutet: Es werden keine vorführenden Nachfragen gestellt, es findet kein Bewerten, vor allem kein Herabwerten, und kein (Vor-)Verurteilen statt. Alle Gedanken, Gefühle und Bedürfnisse des Gegenübers werden vorbehalt- und diskussionslos akzeptiert.
Bist du bereit, dich zu verlieben?
Prof. Allison Dixon
Lehrstuhl für Sozialpsychologie
Institut für Psychologie
Windsbury University
* Der Fragenkatalog sowie weitere Anforderungen zur Durchführung und Dokumentation können den Anlagen entnommen werden.
1. Kapitel
MAY
Ich war nie gut im Vergessen.
Schon als Kind konnte ich mir Dinge merken, die andere als unwichtig einstuften. Die Art, wie das Gemüse im Supermarkt angeordnet war, die Reihenfolge der eingestaubten Gewürzdosen im Regal meiner Großmutter, die Farben jedes Fensterrahmens in unserer Straße.
»Dein Gedächtnis ist ein Segen«, hatte meine erste Klassenlehrerin zu mir gesagt, weil ich jedes Gedicht innerhalb weniger Stunden auswendig lernen konnte. Ich hatte lang gedacht, dass sie recht hatte. Dass es mich zu einem besseren Menschen machen würde, mich an Dinge zu erinnern.
Je älter ich wurde, desto mehr konzentrierte sich meine Erinnerungsfähigkeit auf einen bestimmten Menschen: Angus’ Stundenplan und seine Freizeitaktivitäten, die Daten seiner Klassenarbeiten, auf wen ich zuerst tippen musste, wenn er sich mit einem Freund gestritten hatte, seine bevorzugte Art, Müsli zu essen (immer die Milch zuerst, eine Prise Zimt, die Rosinen vorher raussuchen). Mein Kopf wurde zu einem Glas für die Details in Angus’ Leben. Und selbst jetzt, obwohl ich seit zweieinhalb Jahren keine neuen Erinnerungen hineinwarf, waren sie alle noch da.
In letzter Zeit war ich mir gerade deshalb nicht mehr sicher, ob mein gutes Gedächtnis wirklich ein Segen war. Ich wünschte oft, ich wäre besser im Vergessen. Ich wünschte, ich könnte Erinnerungen selektieren und die aus meinem Gedankengewebe zupfen, die wehtaten. Und ich wünschte vor allem, ich könnte das für die Menschen tun, die ich liebte.
Mein Blick wanderte von der Eichenholzplatte vor mir, auf der unsere pastellfarbenen Becher standen, über die umliegenden Stühle und Tische hinweg bis zu dem Tresen, an dem Elsie gerade einen Teller entgegennahm.
Sie hatte ihr Haar zu einem Dutt gebunden, trug einen Hoodie über lockeren Boyfriend-Jeans und alles an diesem Bild tat mir weh. Wenn ich an Elsie dachte, kamen mir zuerst Tüll und Spitze in den Sinn, dazu hohe Schuhe und dunkler Lippenstift. Sie liebte es, ein Mittelpunktmensch zu sein, ohne dabei je egozentrisch zu wirken. Ich hatte das auf Anhieb an ihr bewundert. Mittelpunkte beunruhigten mich, weil man von dort aus nicht in alle Richtungen gleichzeitig blicken konnte. Elsie hingegen hatte, seit ich sie kannte, nie Angst vor dem Unvorhersehbaren gehabt, vor Überraschungen, vor freiem Fall. »Nur weil etwas Schlimmes passieren könnte, heißt das nicht, dass es passieren wird«, hatte sie immer wieder gesagt, wenn ich mich darum bemüht hatte, ihr eine unbedachte Aktion auszureden. Und sie hatte recht behalten. All die Szenarien, die mein Sorgenkopf sich für sie ausgemalt hatte, waren nicht eingetreten.
Bis zu diesem einen Mal. Dieses Mal hatte Elsies freier Fall mit einem Aufprall geendet und sie war noch nicht wieder aufgestanden. Seit etwas über einer Woche sah ich ihr dabei zu, wie sie versuchte, sich selbst aus dem Mittelpunkt heraus in Ecken zu drängen – und wie sie daran scheiterte. Auch jetzt.
Die Typen am Tisch neben dem Tresen hatten Elsie bemerkt, einer von ihnen deutete auf sie und raunte seinem Freund etwas zu. Dieser lachte und rief ein paar Worte in Elsies Richtung, die im Mahlen der Kaffeemaschine und der Jazzmusik untergingen. Ich wusste, dass sie sie trotzdem gehört hatte, weil sich ihre Schultern verspannten. Sie drehte sich jedoch nicht zu ihnen um, sondern reichte dem Barista das Geld und kam dann auf unseren Tisch zu.
Ich rang mir ein Lächeln ab, als sie sich gegenüber von mir auf ihren Stuhl direkt an einer Säule sinken ließ. Die Wände waren mit unverputztem Backstein ausgelegt, was dem Café etwas Ursprüngliches verlieh. Über uns hingen passend dazu Industrie-Glühbirnen an einem Stahlträger und warfen gelbe Kreise auf das Holz. Das delicate lag am Rand von Windsburys Stadtkern. Elsie hatte es ausgesucht, vermutlich hatte sie gehofft, hier keinem Kommilitonen über den Weg zu laufen.
Ehe ich entscheiden konnte, ob ich den Vorfall mit den beiden Typen ansprechen sollte, schob Elsie den Apfelkuchen in die Mitte des Tischs und reichte mir eine der Gabeln. »Also, wie läuft es in eurem Palast? Gibt’s schon was Neues wegen der Förderung?«, fragte sie betont gleichmütig.
Sofort wurde meine Sorge um sie von einer anderen überspült. Ich dachte an den Umschlag, den ich heute Morgen aus dem rostroten Briefkasten der Mulberry Mansion gefischt hatte. Ich hatte nur einen Blick auf das Wappen der Universität werfen und den dünnen Briefbauch befühlen müssen, um zu wissen, dass wir erneut gescheitert waren.
Pünktlich zum Semesterbeginn hatten wir den ersten dieser Briefe erhalten – um einiges dicker und doch mit einer recht simplen Aussage: Das neue Semester an der Windsbury University begann nicht nur mit einem Wechsel des Vizekanzleramts, sondern auch mit einer Umstrukturierung der finanziellen Mittel. Darunter die Fördergelder für studienbegleitende Projekte, zu denen auch das Wohnprojekt rund um die Mulberry Mansion zählte.
Ich hatte den Brief fünfmal lesen müssen, ehe ich sicher gewesen war, mich nicht zu irren: Unsere Förderung wurde um dreißig Prozent gekürzt. Dreißig Prozent von einer Summe, die sowieso schon nur knapp ausreichte, um die laufenden Kosten unseres eigensinnigen Zuhauses zu decken. Die größten Renovierungen hatten wir zwar im letzten Semester abgeschlossen, als wir gemeinsam mit den Bewohnenden anderer Villen, die der Visionary Housing Foundation unterstanden und an Studierende nahe gelegener Universitäten vermietet worden waren, an einem Wettbewerb teilgenommen hatten. Innerhalb von ein paar Monaten hatten wir versucht, die Mulberry Mansion bestmöglich instand zu setzen. Doch obwohl wir mit dem Ergebnis mehr als zufrieden gewesen waren, hatte die Jury unsere Villa nicht zur Siegerin gekürt – und uns damit auch nicht das Preisgeld gegeben, das wir gut hätten gebrauchen können. Denn noch immer war das Haus weit davon entfernt, intakt zu sein. Es war alt und ein wenig angeknackst und brauchte Pflege und Liebe, um nicht auseinanderzubrechen. Und Geld. Sosehr es mir missfiel, das zuzugeben: Wir brauchten Geld. Also hatten meine Mitbewohnenden und ich mehrere Versuche unternommen, uns mit der neuen Universitätsleitung rund um Livia West in Verbindung zu setzen. Bislang ohne Erfolg.
»Nein«, erwiderte ich verzögert auf Elsies Frage. »Auf unser letztes Anschreiben kam nur wieder ein Verweis auf die wohldurchdachte Umstrukturierung der Gelder zurück. Unterzeichnet vom Sekretariat, wir haben es also nicht einmal bis ganz nach oben geschafft.«
Elsie schob die Teigkrümel auf dem Teller hin und her. Ich wusste, dass sie den Kuchen sowieso nicht anrühren würde. Seit Tagen aß sie nur das Nötigste, dabei war sie diejenige gewesen, die mir in der Woche unseres Kennenlernens erklärt hatte, dass Nachmittagskuchen eine ebenso wichtige Mahlzeit wie Frühstück wäre.
»Und was bedeutet das?«, fragte sie.
Ich hob die Schultern. Dieser Satz klang als unhörbares Echo in der Villa, seit der erste Brief eingetroffen war. Wir sprachen ihn nie laut aus, weil sich Antwortlosigkeit besser verleugnen ließ, wenn man die Frage gar nicht erst in den Mund nahm. »Dass wir es weiter probieren werden. Eine Weile kommen wir schon über die Runden, aber wenn sie unsere Förderung nicht wieder erhöhen, können wir auf Dauer unmöglich alle Kosten decken. Und das würde bedeuten …«
Ich brach ab, als ich die Typen bemerkte, die gerade noch am Tisch gesessen hatten und jetzt draußen am Fenster vorbeiliefen. Einer von ihnen klopfte gegen die Scheibe dicht an Elsies Kopf. Sie zuckte zusammen und fixierte die letzte Insel Milchschaum in ihrer Tasse. Ich sah ebenfalls nicht hinaus. Das musste ich auch nicht, um die Gesten der beiden zu verstehen.
Wenn Willow oder Avery hier gewesen wären, wäre mindestens eine von ihnen schon auf dem Weg nach draußen gewesen, um den Typen – in Willows Fall – eine Ansage mit sechzig Prozent Fluchanteil zu machen oder – in Averys Fall – eine strafrechtliche Erklärung des Begriffs Belästigung vorzutragen. Ich hingegen streckte meine Hand nach Elsies aus, die sich um den himmelblauen Becher verkrampft hatte.
Sie kniff die Lippen zusammen und atmete hörbar durch die Nase aus. Ihr blasses Gesicht war mit feinen Sommersprossen besprenkelt, die dieselbe Farbe wie ihr Lidschatten hatten. Ich wusste, dass er teuer gewesen war und dass sie ihn aufgetragen hatte, um sich selbst daran zu hindern, zu weinen. Ich wusste auch, dass sie trotzdem kurz davor war, es zu tun. Ich wusste es und ich verstand es und es tat mir so weh, dass ich am liebsten auch geweint hätte.
»Wollen wir doch lieber zu dir gehen?«, fragte ich leise, als die Typen endlich weitergegangen waren und Elsie in sich zusammensackte.
Sie schüttelte den Kopf und entzog mir ihre Hand. »Dann kann ich auch gleich die Uni wechseln. Das ist jetzt mein Leben, ich muss damit klarkommen.«
»Es wird nicht ewig so sein«, flüsterte ich, obwohl die Tische um uns herum alle frei waren. »Die Leute werden das bald vergessen haben.«
Elsie lächelte bitter, ohne aufzusehen. »Das hier ist Windsbury, May. Ein Sexvideo, das mitten in der Uni aufgenommen wurde, ist so ziemlich das Aufregendste, das hier seit fünfzig Jahren passiert ist.«
Manchmal wäre ich gern eine bessere Lügnerin. Ich hätte ihr am liebsten gesagt, dass das nicht stimmte, dass unsere Kommilitonen in ein paar Tagen aufhören würden, darüber zu sprechen. Dass ich nicht auch nach einer Woche noch täglich Gesprächsfetzen auf den Fluren auffing, in denen es um dieses Video ging. Dass ich nicht sehen würde, wie Leute auf dem Campus Elsie anstarrten – mit Hohn, Verachtung oder einer unterschwelligen Gier in den Augen, teilweise auch mit einer Mischung aus allem. Ich hätte sie gern vor der Wahrheit beschützt, aber Elsie war zu sensibel, um nicht zu bemerken, dass sie von ihr umzingelt war.
»Du könntest immer noch Anzeige erstatten«, schlug ich stattdessen vor.
Sie schnaubte, ein kläglicher Ton. Mit beiden Händen zerrte sie die Ärmel ihres Hoodies hinunter, sodass ihre Finger unter dem Stoff verschwanden. »Wozu? Damit die Uni-Leitung das Video zu sehen bekommt und noch dazu mein Geständnis hat, dass tatsächlich ich darauf abgebildet bin? Du weißt genau, für wen das letztlich Konsequenzen hätte. Die würden ihn nicht rauswerfen. Nicht, wenn seine Familie jährlich Unsummen an Spendengeldern in die Uni steckt.«
Wieder hätte ich gern gelogen und ihr widersprochen. »Das ist alles nicht fair.«
»Nein. Trotzdem ist es wahr.« Elsie presste die Augen zusammen, als würde sie spüren, wie sich die Tränen darin aufbauten.
Ihre Lider schimmerten ebenso wie der Asphalt vor dem Caféfenster. Es war Anfang März und der Frühling begann, sich mit trägen Bewegungen in Windsbury auszubreiten. Ich liebte diese Jahreszeit, doch jetzt gerade fühlte sich alles so sehr nach Winter an, dass ich meine Hände um den tröstlich warmen Teebecher schloss.
»Wieso sagst du es nicht endlich?«, fragte Elsie nach einer Weile tonlos.
Ich runzelte die Stirn. »Was denn?«
»Na: Ich hab es dir gleich gesagt.« Sie lachte und schniefte zeitgleich, wischte sich mit dem Ärmel über die Nase. »Denn das hast du. Du hast mir gesagt, dass ich mich nicht auf einen von denen einlassen soll, du hast mir gesagt, dass ich nicht zu dieser Party gehen soll. Und ich war so bescheuert und hab es dennoch gemacht.«
»Das ist trotzdem nicht deine Schuld«, widersprach ich ernst. »Nichts davon. Er hat das Video verbreitet. Er und seine Freunde, die sich ständig egoistisch und gemein und verantwortungslos benehmen. Es ist allein ihre Schuld, dass du das jetzt durchmachen musst.«
Meine Worte fühlten sich unangenehm erhitzt an. Wut war kein Gefühl, das ich oft verspürte, und wenn ich es tat, konnte ich schlecht damit umgehen. Aber in letzter Zeit war ich oft wütend. Wütend auf den Typen, der Elsie in diese Situation gebracht hatte, einfach weil Menschen wie ihm sämtliche Konsequenzen egal waren. Weil ihnen alles egal war. Weil sie es gewöhnt waren, dass die Folgen ihrer Handlungen von ihren Eltern unter handgestickte Teppiche oder Marmorsockel gekehrt wurden.
Elsie schüttelte den Kopf. »So einfach ist das nicht. Er hat mich zu nichts gezwungen, ich wollte es. Nennen wir es beim Namen: Ich hatte freiwillig Sex mit Lucas Fox auf einer beschissenen, illegalen Party im Foyer des Wirtschaftswissenschaftsgebäudes, direkt unter einer Überwachungskamera. Ich bin selbst schuld.«
»Das ist nicht wahr.« Meine Stimme klang belegt. Schon als Elsie mir am Morgen danach von der Party erzählt hatte, hatte ich diese unangenehme Mischung aus Vorahnung und Sorge gespürt. Lang bevor sie erfahren hatte, dass Lucas und sie von einer Kamera aufgezeichnet worden waren, indem sie auf dem Campus auf widerliche Weise von einer Gruppe Kerle angesprochen wurde, die genau dieses Überwachungsvideo auf ihren Handys hatten und es ihr breit grinsend zeigten.
Elsie hatte sich nicht bemüht herauszufinden, wie die Aufnahme ihren Weg von der Universitätskamera auf die Handys der Hälfte der Studierenden der WU gefunden hatte. Sie hatte nicht einmal versucht, mit Lucas darüber zu sprechen. Im Grunde war das auch nicht nötig. Ein Blick auf ihn und seine Freunde und man wusste, dass er kein Problem damit hatte, dass es einen Videobeweis von Elsies und seiner gemeinsamen Nacht gab. Oder dass dieser immer weiterschwingende Kreise über den Campus zog, als hätte man einen Stein über die Oberfläche eines Sees hüpfen lassen. Und das konnte für mich nur eines bedeuten: Er hatte ihn selbst geworfen.
Ich war so wütend auf ihn. Und auf mich, weil ich Elsie nicht davor bewahrt hatte. Schon in dem Moment, in dem Elsie, Avery und ich vor ein paar Monaten erstmals vor dem Cinematic, einem Club in der Innenstadt, mit Lucas Fox gesprochen hatten, hatte ich geahnt, dass diese Begegnung Schatten hinter sich werfen würde. Ich hatte nur nicht gedacht, dass sich diese so fest an Elsies Fersen heften würden.
Die Freundesgruppe, der Luke angehörte, war Teil der Campuselite, aber es stimmte, was man sagte. Es war nicht alles Gold, was glänzte. Manchmal war es nur Dunkelheit, die vorteilhaft lackiert worden war.
»Hör auf, so nett zu sein, May. Sei doch wenigstens ein bisschen wütend oder enttäuscht oder … genervt von mir. Ich hab Scheiße gebaut, okay? Ich weiß genau, dass du das auch denkst.«
»Das würde ich nie tun. Du bist meine beste Freundin.«
Sie lächelte freudlos. »Vielleicht solltest du dir das noch mal überlegen. Sonst denken die Leute bald, dass du genauso ein Flittchen bist wie ich.«
»Hey.« Streng suchte ich ihren Blick. »Sag so was nicht über dich. Es ist nichts verkehrt daran, Sex zu haben, wenn du das willst. Und du kannst nichts dafür, dass er das, was nur euch etwas angeht, mit der halben Uni geteilt hat. Du bist so viel besser als Lucas Fox. Oder seine Freunde. Oder jeder Mensch auf diesem Campus, der es wagt, dich deswegen zu verurteilen.«
»Das scheinen die aber anders zu sehen. Die begaffen mich, als wäre ich eine Prostituierte in einem Amsterdamer Rotlichtviertel-Schaufenster, während sie ihn jetzt nur noch mehr feiern, als wäre er ein verdammter Popstar.« Ihre Unterlippe bebte, die ersten Tränen bauten sich in ihren Augen auf. »Die Leute zeigen nie auf ihn, immer nur auf mich. Selbst die aus meinen Kursen reden über mich, wenn sie denken, ich bekomme es nicht mit. Das ist demütigend und ich … fühl mich so allein damit.«
Ich neigte mich über den Tisch, bis die Schleife meines Kleiderträgers fast in den Kuchen hineinhing. »Bist du aber nicht. Du hast mich. Und du wirst sehen, diese ganze Sache ist bald vergessen.«
»Versprochen?«, wisperte sie.
In diesem Moment sah sie nicht aus wie eine zweiundzwanzigjährige Medienkommunikationsstudentin, sondern wie ein kleines Mädchen, das Angst vor Monstern unter ihrem Bett hatte. Wieder musste ich an Angus denken. An all die Abende, an denen ich ihn ins Bett gebracht und auf seiner Matratzenkante gesessen hatte, bis er eingeschlafen war. »Bleibst du hier, bis Mum zurück ist?«, hatte er jeden Abend gefragt, und ich hatte jedes Mal erwidert: »Versprochen.« Ich konnte nicht zählen, wie viele Nächte ich auf seinem Zimmerboden verbracht hatte, um mein Versprechen nicht zu brechen.
»Versprochen«, sagte ich mit aller Entschiedenheit, die ich aufbringen konnte. Das war keine Lüge, durfte es einfach nicht sein. »Alles wird gut, El. Wir halten uns einfach in Zukunft fern von diesen Menschen, okay? Auch versprochen?«
Sie lachte erneut, immerhin bauten sich die Tränenberge in ihren Augen wieder ab. Eine einzelne bronzeschimmernde Spur rann über ihr Kinn. »Versprochen. Aber als bräuchtest du diese Erinnerung. Du machst immer alles richtig. Dir würde so was nie passieren.«
Ich mache nicht immer alles richtig, dachte ich und schluckte es mühsam mit Kräutertee herunter. An manchen Worten klebten Erinnerungen und an diesen welche, die ich wirklich, wirklich gern vergessen hätte.
Die Sonne blich bereits aus, als ich mich auf den Weg zur Villa machte. Ich stieg am Stadtrand aus dem Bus und lief den Rest. Die Felder, die die schmale Landstraße säumten, begannen allmählich, sich aus ihrem Wintergrau zu schälen. Auf den ersten fing der Raps an, seine grünen Triebe auszubilden. Je näher ich der Mulberry Mansion kam, desto ruhiger wurde die Welt. Die Straße verzweigte sich in dünne Kieswege und die paar Reifenspuren, die ich entdeckte, stammten mit Sicherheit von unseren Autos.
Der Wind strich um meine nackten Waden und unter die Wolljacke. Es war eigentlich noch zu früh für meine Sommerkleider, ich ertrug es allerdings keinen Tag länger als nötig, warme Sachen zu tragen. Ich war kein Wintermensch, ich war ein Sommermädchen. Ich liebte frische Luft an Haut, das Grün, das um sich griff, den sanften Silberfilm der Sonne, der sich über dem Boden ergoss.
Aber es war erst Anfang März, der Wald, an dem ich vorbeilief, warf seine Schatten auf mich und in meinem Kopf krochen die von dem Gespräch mit Elsie. Ich wusste, dass ich mir ihren Schmerz nicht aneignen durfte, doch ich konnte nichts dagegen tun, dass ich ihn spürte.
Manchmal kam es mir so vor, als wäre mein Herz ein Sorgenmagnet. Wenn es jemandem nahekam, zog es automatisch all den Schmerz dieses Menschen an und wob es zwischen seine eigenen Fasern. Ich hätte das ohne zu zögern akzeptiert, wenn das im Umkehrschluss bedeutet hätte, dass es aus dem Herzen des anderen verschwand. Doch viel zu oft war geteiltes Leid nicht halbes Leid, sondern einfach nur doppeltes.
Elsie litt und ich litt, aber ich konnte ihr ja doch nicht helfen. Ich konnte nicht rückgängig machen, dass sie auf diese Party gegangen war und mit Lucas geschlafen hatte. Ich konnte nicht rückgängig machen, dass er – wie oder wieso auch immer – dafür gesorgt hatte, dass das Video sich verbreitete. Ich konnte nichts tun, außer für sie da zu sein, und obwohl ich wusste, dass das kein Nichts war, fühlte es sich momentan nicht nach einem Genug an. Und das machte mich so hilflos und traurig, dass ich am liebsten schon wieder geweint hätte.
Ich drängte den Druck beiseite und nahm mein Handy aus der Korbtasche, die bei den Sachen gewesen war, die Avery und Eden letzten Herbst vom Dachboden der Villa geholt hatten. Ich hatte einen der eingerissenen Henkel durch übrig gebliebenen Vorhangstoff in Wolkengrau ersetzt. Angus’ Lieblingsfarbe, eine permanente Erinnerung an etwas, das ich sowieso nie vergessen würde.
Ich atmete tief durch, rief seinen Namen auf dem Handy auf und presste es an mein Ohr. Ich wusste genau, was jetzt kommen würde. Zweiundzwanzig Sekunden Tuten, eine Sekunde Stille, die kurze, ruppige Ansage seiner Stimme, die nicht mehr beinhaltete als seinen Namen.
Angus Little.
Noch ein Piepston, ein winziger Stich in mein Herz und dann meine Stimme, die sich bemühte zu verbergen, wie weh es tat, in eine Maschine zu sprechen, wenn ich meinen kleinen Bruder vermisste.
»Hey, Gus. Ich weiß, es ist früher als sonst, aber ich laufe gerade nach Hause und dachte, dann kann ich auch gleich anrufen. Ich hab mich nach der Uni noch mit Elsie getroffen, ihr geht es momentan nicht so gut.«
Ich blieb stehen, betrachtete das Dach des Waldes. Die Baumwipfel streckten sich nach den Wolken aus, als wollten sie diese mit ihren Astfingern zerrupfen. Ich hätte das auch gern gemacht. Ich hätte mir gern Wolkenwatte in eins meiner Kleider als Schutzschicht genäht, damit diese Welt mich nicht mehr so verletzen konnte, einfach indem sie war, wie sie war.
»Weißt du noch, als du meintest, ich wäre ein Elefant? Ich weiß, dass du das gesagt hast, weil ich dir früher so … groß vorkam, aber ich glaub, ich hätte wirklich gern eine Elefantenhaut. Die Menschen sind oft so gemein zueinander und ich hab das Gefühl, dass das schlimmer wird, je älter man wird. Als würde man Empathie verlernen. Ich hoffe, dass du nur Menschen um dich hast, die das nie verlernen. Und ich hoffe, dass du das nie verlernst. Und ich hoffe …« Meine Stimme knickte weg. Und ich hoffe, dass es ein Universum gibt, in dem du dir meine Nachrichten anhörst.
Ich atmete tief durch und legte den Kopf in den Nacken, blinzelte hinauf. Das Frühlingsblau war von weißen fasrigen Schlieren durchzogen. Zirruswolken, Angus’ Lieblingswolken.»An meinem Himmel hängen heute übrigens Federwolken, aber ich glaub nicht, dass es bald regnet. Dafür ist es viel zu schön. Wie … fluffige Federwolken, wattebedecktes Windsbury, maihafter März.« Ich stockte und lächelte matt. »Schon gut, ich weiß, dass du es albern findest, wenn ich das mache. Ich hör jetzt auch auf, ich bin fast bei der Villa. Hab dich lieb, Gus. Pass auf dich auf. Bis morgen.«
Ich legte auf und ging weiter. Zweiundzwanzig Sekunden nach dem Wählen bis zur Mailboxansage, zweiundzwanzig Sekunden nach dem Auflegen, bis ich den Nachhall dieses Schmerzes beiseiteschieben konnte. Zurück in die Herzkuhle, die er sich vor zweieinhalb Jahren gegraben hatte.
Ich hatte es vor den anderen nie ausgesprochen, aber einer der Gründe, warum ich mich bei dem Wohnprojekt beworben hatte, war der Name der Villa gewesen. Mulberry Mansion. Zwei Wörter, die sich im Mund anfühlten, als würde man einen Bonbon herumrollen, und vor allem eine Alliteration. Mittlerweile eine meiner liebsten.
Immer wenn ich das Tor öffnete und auf den Kiesweg zwischen die Maulbeerbäume trat, blieb ich kurz stehen. Obwohl ich seit Monaten hier lebte, überkam mich jedes Mal ein Anflug von Ehrfurcht, Dankbarkeit und Zuneigung, sobald ich die Villa aus der Ferne betrachtete.
Die dunkle Backsteinfassade, die mit Efeu überwuchert war und in ein paar Wochen zusätzlich wieder unter blühendem Blauregen verschwinden würde, die Art, wie die Sonne in etlichen Fenstern reflektiert wurde, als würde das Haus einem zuzwinkern, die Kaminfinger, aus denen in den letzten Monaten ständig Rauch gestiegen war. Je größer die Villa vor mir wurde, desto mehr löste sich die Schwere meiner Gedanken. Ein Zuhause war im besten Fall immer auch eine Zuflucht, manchmal am allermeisten vor sich selbst.
»Hallo«, flüsterte ich, als ich bei der Mulberry Mansion angekommen war. Ich strich über die splittrige blassblaue Haustür und warf einen Blick auf unser gleichfarbiges Wappen, das darüberhing. Acht winzige Initialen um das große Doppel-M herum geritzt, eine permanente Erinnerung daran, dass wir zusammengehörten. Das Haus und wir, seine Bewohner und Bewohnerinnen, weil es ohne das Haus nie ein Wir gegeben hätte und es deswegen immer ein Teil von uns sein würde.
Drinnen wurde ich sofort von diesem einzigartigen Duft der Villa begrüßt. Er hatte sich verändert, seit wir hier waren. Das Staubige, leicht Kühle war verblasst, darüber hatten sich die Gerüche unserer Jacken, Parfums und Waschmittel gelegt. Ein Jasmin, den Maxton zum Überwintern reingeholt hatte, verbreitete herben Duft im Flur, Versailles’ Heu- und Federgeruch aus dem Salon legte sich fein darunter. Und aus der Küche kam … der von Tomatensoße.
Ich runzelte die Stirn und warf einen Blick auf meine Uhr. Eigentlich war ich heute mit Kochen dran, es war aber auch erst kurz nach fünf. Dennoch stand Avery am Herd und sah vom Topf auf, als ich kurz darauf die Küche betrat.
»Hi.« Sie lächelte mir zu und klopfte den Holzlöffel am Rand ab, ehe sie ihn darüberlegte.
»Hey.« Mein Blick wanderte von der köchelnden Nudelsoße hin zu dem Stapel Teller, der schon zum Decken bereitstand. »Wollten wir heute früher essen?«
»Nein.« Sie stützte sich mit den Händen an der Holzkante der Arbeitsplatte ab. »Ich hatte nur keine Lust mehr zu lernen und dachte, so kann ich mein schlechtes Gewissen kompensieren.«
Sie grinste schief, was jedoch nicht den leichten Schatten verbergen konnte, der sich in ihrem Blick abzeichnete, ehe sie meinem auswich. Besorgt musterte ich sie. Avery hatte sich das braune Haar zu einem Knoten gebunden, einige lose Strähnen umrahmten ihr schmales Gesicht. Sie hatte klassische Züge und sehr ernste Augen, das war das Erste, was ich damals gedacht hatte, als ich an der Haustür in sie hineingestolpert war. Seit ein paar Wochen hatte sich der Ausdruck in ihnen erhellt. Fast so, als würden die Bernsteinsprenkel stärker leuchten, seit Avery und Eden wieder Avery und Eden waren.
Jetzt wirkte sie seltsam angespannt. Ihre Finger klopften ungleichmäßig auf das Holz, das sie umklammert hielt, ein eindeutiges Zeichen dafür, dass sie irgendetwas beschäftigte. Ehe ich nachfragen konnte, kam sie mir zuvor. »Wie geht’s Elsie?«
Ich hatte meinen Mitbewohnenden nicht von Elsie und Lucas erzählt, aber obwohl sie sich in ganz anderen Kreisen als die beiden bewegten, hatten sie von dem Video gehört. Ich war nicht sicher, ob einer von ihnen es auch gesehen hatte, doch ich wusste, dass alle darüber entsetzt gewesen waren.
In unserer Villenblase war die Campuswelt manchmal so weit weg, dass man beinahe vergaß, wie grausam sie sein konnte. Hier war alles noch heil. Mir war bewusst, wie absurd das auf Außenstehende wirken musste. Acht Studierende, die mit einem Huhn in einer großen alten Villa mitten im grün gewebten Nirgendwo lebten. Unser Zuhause bestand aus gemusterten Tapeten, Ornamenten an den Decken, dunklen Dielen, mottenlöchrigen Teppichen und Samtmöbeln. Aus gemeinsamen Essenszeiten, regelmäßigen Spiele- und Leseabenden, unendlich vielen Stunden, die wir jeder für sich und doch alle zusammen in unserem Wohnzimmer verbrachten, aus Barfußspaziergängen durch den Garten und stillen Lerntagen im Wald. »Das muss doch furchtbar langweilig sein«, hatte eine Kommilitonin mal zu mir gesagt, als ich von unserem Alltag erzählt hatte. Aber es war nicht langweilig. Es war gemütlich, natürlich und … friedlich. Es verband alles, was ich liebte.
Das, was Elsie gerade passierte, wäre wie vieles andere vom Campus an unserer Blase abgeprallt, wenn sie nicht meine beste Freundin gewesen wäre. Ich hatte ihren Schmerz hierhergebracht – ein dünner Riss im Villenglas. Er würde erst wieder heilen, wenn Elsie anfing zu heilen. Die Frage war nur, wann das sein würde.
»Elsie geht es … unverändert, denke ich.« Ich stellte meine Korbtasche auf einem der Hocker des Küchentresens ab, den Eden und Helen gezimmert hatten.
Avery strich sich die Ponyfransen aus der Stirn und verschränkte die Arme vor der Brust. »Und sie ist sich sicher, dass sie diesen Kerl nicht anzeigen will? Was er getan hat, ist nicht nur abscheulich, sondern auch illegal. Ich könnte mich ein bisschen schlaumachen, welche Ansätze eine Anklage verfolgen könnte. Vielleicht würde ihr das Mut machen.«
Ich lächelte schwach und begann, die benutzten Kaffeetassen vom schnellen Vor-der-Uni-Frühstück zu stapeln und zur Spüle zu tragen. »Lieb von dir, aber ich glaube, das würde nichts bringen. Sie hat Angst, dass sie von der Uni fliegt, wenn herauskommt, dass sie dort war. Außerdem reden wir hier von Lucas Fox. Es gibt nicht viel, was sich Typen wie er nicht erlauben können.«
Avery kaute auf ihrer Unterlippe herum, als suchte sie nach einem rechtlichen Schlupfloch. Nicht zum ersten Mal, allerdings wie immer mit demselben Ergebnis: Es gab keins. Sie stieß ein frustriertes Seufzen aus. »Das macht mich so wütend.«
»Ich weiß. Aber es ist Elsies Entscheidung, wie sie damit umgehen will.« Ich knuffte sie in die Seite, ehe ich nach dem Kochlöffel griff und die Soße umrührte. Sie roch auffallend stark nach Thymian, unser Mitbewohner Beckett würde mit Sicherheit einen halben Nervenzusammenbruch bekommen.
»Richtig. Sag ihr trotzdem, dass ich ihr jederzeit helfen würde, wenn sie es sich anders überlegt, okay?«
»Mach ich.« Ich legte den Löffel wieder beiseite. »Wo steckt Eden?«
Sofort lichtete sich der dunkle Ausdruck auf Averys Gesicht, ihre Kanten wurden weicher. Willow spottete oft, dass sie das Bedürfnis hatte, Avery eine Papiertüte über den Kopf zu ziehen, wenn diese auch nur an Eden dachte, aber ich fand das schön. Es gab nicht vieles, was attraktiver war, als wenn man jemandem Liebe ansehen konnte.
Bis heute war ich nicht sicher, was in den letzten Monaten genau zwischen den beiden passiert war. Die ersten Wochen nach Averys Einzug waren sie sich aus dem Weg gegangen, nur um sich heimlich gegenseitig zu beobachten. Irgendwann hatte sich die Atmosphäre zwischen ihnen entspannt und kurz darauf beinahe elektrisch aufgeladen. Knapp vor Weihnachten hatten sie sich kurzzeitig getrennt, aber seit Silvester waren sie nicht mehr auseinanderzudenken. Ich hoffte, dass das von Dauer war. Ich hatte es selten erlebt, dass zwei Menschen so unübersehbar gut füreinander waren – einfach, indem sie füreinander dawaren.
»Er ist arbeiten. Celine ist krank und David brauchte jemanden für die Hörbuchaufsicht.«
»Und du bist nicht hingefahren, um ihm zuzuhören?«
Avery verzog den Mund, als wäre es ihr unangenehm, dass sie und Eden so oft zusammensteckten. Ehe sie antworten konnte, schob sich Willow durch den Türrahmen zum Esszimmer in die Küche. Ihrem Lachen nach hatte sie meine Frage gehört. Es wunderte mich nicht, Willow konnte leicht verplant und durch den Wind sein, aber sie hatte ein ausgesprochen bemerkenswertes Gespür für die Dinge, die nicht für sie bestimmt waren.
»Wozu sollte sie hinfahren?«, meinte sie jetzt mit einem anzüglichen Grinsen. »Sie bekommt immerhin allabendlich eine Gratiskostprobe. Wobei ich darauf wetten würde, dass Vorlesen nicht das Bevorzugte ist, was er mit seinem Mund anstellt, wenn die Türen sich schließen.«
Ich biss mir in die Wange, während Wärme hineinkroch. Willow hatte durchaus recht – wenn jemand das beurteilen konnte, dann ich. Da mein Zimmer genau zwischen Averys und Edens lag, spielte es keine Rolle, in welchem davon sie ihre Zeit verbrachten: Ich war immer irgendwie zu nah dran.
Avery verzog ihren Mund noch weiter. »Vielen Dank, Willow.«
»Gern geschehen. Braucht ihr hier noch lang? Beckett und Sienna diskutieren über etwas, was ich nicht kapiere, Maxton besprüht sein Grünzeug und mir wird langsam bedrohlich langweilig. Wenn das so weitergeht, fange ich noch an, Edens staubtrockene Unilektüre zu lesen, und wisst ihr noch, wie böse er letztens auf mich war, als ich das Lesezeichen verschoben hab?« Sie verdrehte die Augen. »Also bitte, erlöst mich und kommt jetzt rüber.«
»Rüber?« Verständnislos sah ich von Willow zu Avery, die wieder schuldbewusst wirkte. »Wollt ihr jetzt schon essen?«
Avery schüttelte den Kopf. »Wir haben auf dich gewartet, weil wir was besprechen wollen.«
Sofort spannte sich mein Körper an. Normalerweise war ich diejenige, die die Gruppentreffen einberief. Meistens, wenn irgendetwas im Haus kaputtgegangen war – was leider immer noch regelmäßiger passierte, als wir uns bald würden leisten können. »Oh, nein. Was ist passiert?«
»Nichts.« Avery drehte den Herd runter und legte den Deckel auf den Topf. »Wir wollen nur was bereden. Eigentlich alle zusammen, aber da Eden arbeiten ist und Helen noch in der Uni feststeckt … wird es auch so gehen.«
»Muss ich mir Sorgen machen?«, fragte ich, als würde das eine Rolle spielen. Als würde ich mir nicht immer Sorgen machen.
»Nein, gar nicht.« Averys Lächeln war so verkrampft, dass ich nur noch unruhiger wurde.
Zögerlich folgte ich den beiden ins Wohnzimmer. Beckett und Sienna saßen auf einem der Sofas und unterhielten sich, Maxton stand auf einem Hocker neben der verglasten Terrassentür und wischte mit einem Lappen über die Blätter einer der Pflanzen, die in Tonkübeln von der Decke hingen. Der Garten hinter der Scheibe färbte sich in der ansetzenden Dämmerung bläulich, unser Wohnzimmer durch die alten Lampen orangestichig. Ich bezweifelte, dass es einen schöneren Komplementärkontrast geben könnte.
»Da sind wir«, verkündete Avery und setzte sich neben Sienna aufs Sofa. Maxton und Willow nahmen auf dem anderen Platz, ich ließ mich auf einen der Sessel sinken.
»Okay, was ist los? Hab ich was falsch gemacht?«
Sienna lachte. »Bitte, May. Wann würdest du je etwas Falsches tun?«
Zweimal an einem Tag das gleiche Kompliment, das sich wie ein Vorwurf anfühlte. Ich verschränkte meine Hände im Schoß. »Was ist dann?«
»Es ist nur wegen der Fördergelder.« Maxton wischte sich die erdigen Finger am Lappen ab. »Wir haben eine Idee, wie wir es schaffen können, dass uns die Universität doch noch zuhört.«
Ich runzelte die Stirn, entspannte mich aber ein bisschen. Das war immerhin kein neues Problem. »Wir werden einfach noch einen Brief schreiben. Solang wir freundlich bleiben und ihnen unsere Lage erklären …«
»Du weißt, wir lieben dich«, unterbrach Beckett mich mit sanftem Spott in der Stimme, »aber mit Freundlichkeit kommt man in manchen Bereichen des Lebens nicht weit.«
Jetzt war ich nur noch verwirrt. »Also wollt ihr unfreundlich werden?«
Willow zog die Beine aufs Sofa und legte das Kinn auf den Knien ab. »Ich hätte absolut nichts dagegen, faule Eier gegen Livia Wests Auto zu werfen.«
Ich lächelte schwach. »Ich befürchte, das würde sie nicht einmal sonderlich interessieren. Sie hat wahrscheinlich einige zur Auswahl.«
»Genau.« Siennas Lächeln wurde verschlagener. »Und das ist der Punkt. Wir brauchen etwas, das Livia West interessiert, wenn wir wollen, dass sie uns zuhört.«
Ich spannte mich an. Wegen der Worte, in denen dieser vielsagende Unterton mitschwang, und wegen der Blicke der anderen, die ich jetzt endlich deuten konnte.
Sie sprachen nicht von etwas.
Sie sprachen von jemandem.
»Nein.« Entschieden schüttelte ich den Kopf. »Das geht nicht. Auf keinen Fall!«
»Ich hab euch gesagt, dass sie begeistert sein wird.« Avery trommelte mit den Fingerspitzen auf der Lehne des Sofas. Jetzt wusste ich immerhin, warum sie so schuldbewusst gewirkt hatte: Sie wusste ganz genau, dass das für mich keine Möglichkeit war.
Beckett seufzte gedehnt. »Das könnte aber leider unsere einzige Chance sein. Spätestens in ein paar Monaten haben wir sonst echt ein Problem.«
Ich grub die Finger in den Sessel. Allein bei dem Gedanken an diesen Menschen krampfte sich jeder Muskel in mir zusammen. »Glaubt mir. Wenn das unsere einzige Chance ist, dann haben wir bereits verloren.«
Maxton sah mich interessiert an. »Wieso? Er könnte ein gutes Wort für uns bei ihr einlegen. Er könnte …«
»Es ist egal, was er könnte«, fiel ich ihm leise ins Wort. »Er wird es nicht tun. Er würde uns nie helfen.«
»Woher willst du das wissen, bevor du ihn gefragt hast?« Es klang weder herausfordernd noch genervt. Eine einfache Frage, auf die ich eine einfache Antwort hatte.
»Manche Dinge weiß man einfach.«
Elsie behauptete oft, ich sah in jedem etwas Gutes, auch wenn es gar nicht da war. »Du projizierst deine eigene Seele auf alle anderen. Du willst in jedem eine Sonne sehen, dabei sind manche Menschen einfach kleine Monde, die dein Licht reflektieren«, hatte sie bei einem unserer ersten Treffen gesagt, mit dieser seltsamen Mischung aus Zuneigung und Besorgnis, mit der sie mich noch heute ab und zu ansah. Als wüsste sie, dass ich früher oder später verletzt werden würde. Aus dem einfachen Grund, dass ich jedem Menschen bereitwillig ein Messer in die Hand drücken würde, weil ich darauf vertraute, dass er nicht zustechen würde. Ich wusste, dass ich gutgläubig war, und ich war es gern, aber auch ich hatte meine Grenzen. Und er war jenseits von ihnen, so weit weg, dass kein Sonnenlicht ihn erhellen könnte.
Wesley Hastings war keine Sonne, nicht einmal ein Mond – er war ein Schwarzes Loch.
Lang bevor ich ihn aus der Nähe gesehen hatte, hatte ich gewusst, wer er war. Ein Sohn aus gutem Hause, einem der besten Englands, um genau zu sein. Ein Mensch, dessen Familie so viel altes Geld hatte, dass sich die Nachkommen seit Generationen nur darum Gedanken machen mussten, wie sie es am besten anlegen und ausgeben konnten. Jemand, der damit aufgewachsen war, dass ihm alle Türen offenstanden, einfach weil er war, wer er war.
All das war noch kein Grund, ihn nicht zu mögen. Man suchte sich nicht aus, in welche Familie man hineingeboren wurde, und der Name sagte nichts über die Persönlichkeit aus. Aber das eigene Verhalten schon. Und Wesley gab mir seit zweieinhalb Jahren beinahe jeden Tag einen Grund, ihn nicht zu mögen. Genauso oft sah ich ihn nämlich in unseren gemeinsamen Psychologiekursen. Und selbst wenn ich nicht ständig miterlebt hätte, wie er die Seminare durch seine Unaufmerksamkeit oder offen zur Schau gestelltes Desinteresse störte, hätte ich ihn nicht mögen können.
Nicht, wenn er ein Freund des Menschen war, der dafür verantwortlich war, dass Elsie in diesem Moment vermutlich in ihrem Wohnheimbett lag und Lidschattentränen auf ihr Kopfkissen weinte. Denn Lucas Fox bewegte sich, seit ich auf der WU war, in demselben Kreis. Und dieser hatte einen klaren Mittelpunkt: Wesley Hastings.
»Vielleicht irrst du dich in ihm«, setzte Sienna an. »Vielleicht ist er unter dieser Schickimicki-Fassade ja so ein richtig guter Kerl, der heimlich Kaviar an Obdachlose verteilt und nichts lieber tut, als ein paar arme Studierende davor zu bewahren, in einem alten Haus zu erfrieren.«
»Ich irre mich nicht in ihm. Es war sein bester Freund, der ein Sexvideo von sich und meiner besten Freundin dem ganzen Campus geschickt hat, wisst ihr nicht mehr? Jemand, der so etwas gutheißt, dabei mitmacht oder es auch nur toleriert, ist niemand, der anderen aus reiner Herzensgüte hilft.«
Die anderen schwiegen und tauschten betretene Blicke aus. Willow durchriss die Stille zuerst. »Sie hat recht. Ich würde auch lieber das Erfrieren akzeptieren, als diesen Mistkerl um Hilfe zu bitten.«
»Außerdem hätte er sicher kein Interesse daran, irgendwas für mich zu tun. Er kennt nicht einmal meinen Namen. Wir sitzen zwar in denselben Kursen, aber ich habe noch nie wirklich mit ihm gesprochen.«
»Stimmt nicht ganz«, warf Avery ein. »Vorm Cinematic. Als Luke und Elsie sich zum ersten Mal …« Sie brach ab und räusperte sich. »Wesley war auch da, weißt du nicht mehr? Er hat dich erkannt.«
»Doch, das weiß ich noch. Genau wie die Tatsache, dass er quasi sämtliche Monate des Jahres aufgezählt hat, weil er sich nicht an meinen Namen erinnern konnte.« Meine Stimme machte einen leichten Knicks vor Wut.
Averys Lächeln wurde sanfter. »Er wusste genau, wie du heißt, May.«
»Dann hat er sich bewusst dazu entschieden, stattdessen gemein zu sein. Was es nur schlimmer macht. Ich meine, wie stellt ihr euch das vor? Ich frage ihn, ob er bei seiner Mutter ein gutes Wort für uns einlegt, und biete ihm im Gegenzug an, sein nächstes Essay zu schreiben?«
Beckett verzog den Mund zu einem verschmitzten Grinsen. »Oder du bietest ihm was anderes an.«
Willow funkelte ihn quer über den Couchtisch an. »Schlägst du ihr gerade vor, sich für die Villa zu prostituieren?«
Beschwichtigend zwinkerte er ihr zu. »Ich dachte eher an ein Jahresabo ihrer Schokoladenmuffins. Die sind nämlich echt göttlich.«
Ich rang die Hände, die immer noch bebten. »Ihr wisst, wie wichtig mir dieses Haus ist. Und ihr. Aber … das ist zu viel. Bitte, verlangt das nicht von mir.«
Maxton schüttelte den Kopf und stand auf, ging zurück zu den Pflanzen. »Wir verlangen gar nichts von dir. Es war nur eine Idee, aber wenn das unangenehm für dich ist, finden wir einen anderen Weg.« In seiner Stimme lag nach wie vor kein Funken Vorwurf oder Genervtheit, ebenso wenig in den Blicken der anderen.
Ich fühlte mich trotzdem schuldig. »Tut mir leid.«
Avery winkte ab. »Es muss dir nicht leidtun. Ehrlich, wir hätten nicht damit anfangen sollen.«
Sienna grinste breit und stieß mit ihrem Fuß gegen Willows Bein. »Vielleicht schicken wir einfach unser Kätzchen zu ihm. Wahrscheinlich wäre er nach zehn Minuten so genervt von ihr, dass er alles tut, um sie loszuwerden.«
Willow angelte nach der Fernbedienung, die auf dem Couchtisch lag. »Ich fasse diesen Möchtegern-Halbgott nicht mal mit der Kneifzange an. Von solchen Männern hält man sich am besten fern, glaubt mir.«
Maxton warf ihr einen kurzen Blick zu, ehe er auf den Hocker stieg und nach einem Pflanzenblatt griff. »Wir bekommen das schon hin. Mach dir keine Gedanken«, sagte er in meine Richtung.
Ich lächelte schwach, während sich die anderen nach und nach in ihre Beschäftigungen vertieften. Ich wusste, dass das Thema sich damit für sie erledigt hatte. Weil wir eben so waren: Wir waren einander ein Zuhause, und ein Zuhause akzeptierte dich so, wie du warst. So waren wir, aber … ich war immer noch ich.
Ich war May Little. Bereits als Baby hatte ich beinahe permanent Sorgenfältchen auf der Stirn gehabt und daran hatte sich auch mit zweiundzwanzig nichts geändert. Ich machte mir immer Gedanken. Es war unmöglich, sie abzustellen, sie waren mehr als bloße Worte, sie gingen so viel tiefer. Die seltsame Wahrheit war: Ich dachte in Gefühlen und ich dachte zu viel. Und vieles davon, an manchen Tagen das meiste, tat weh.
2. Kapitel
MAY
Normalerweise fiel es mir leicht, mich auf die Uni zu konzentrieren. Sobald ich in meinen Kursen oder Vorlesungen saß, schaffte ich es, meine Gedanken so leise zu drehen, dass ich mich auf den Lehrinhalt fokussieren konnte.
Ich hatte mir das jahrelang antrainiert, weil von meinen Leistungen zu viel abhing. Zwar hatte ich mit der Annahme an der WU auch ein Teilstipendium für mehrere Jahre erhalten, aber dieses musste jedes Semester aufs Neue formell beantragt und genehmigt werden. Sollten meine Noten nicht mehr gut genug sein, würde die finanzielle Unterstützung wegfallen – etwas, das ich mir nicht leisten könnte. Also verdrängte ich jeden Tag für ein paar Stunden die Sorgen über die zwei Orte, die ich mein Zuhause nannte, und versank in Fachbegriffen, Statistiken und Modellen.
Eigentlich klappte das immer. Nur heute schweiften meine Gedanken permanent ab. Fort von den Grundsätzen der Sozialpsychologie, von meiner Dozentin, von meinen Kommilitonen – hin zu dem einzigen von ihnen, mit dem ich in noch keinem Seminar ein Wort gewechselt hatte.
Wesley Hastings saß schräg hinter mir mit dem Rücken zu einem der gewölbten Fenster. Direkt in der Sonne, direkt im Fokus, ohne irgendetwas tun zu müssen. Und er tat wirklich nichts, zumindest nichts von dem, was er hätte tun sollen. Er war zehn Minuten zu spät gekommen und hatte nicht einmal seinen Block aufgeschlagen. Stattdessen lag sein Handy auf seinem Oberschenkel und er scrollte über den Bildschirm.
Ich war sicher, dass es unserer Professorin aufgefallen war, aber sie kommentierte sein Benehmen mit keinem Wort. Als hätte sie ihn bereits aufgegeben, weil sie wusste, dass er das ebenfalls getan hatte.
Ich spürte einen Stich der Frustration, während ich mich immer wieder umdrehte und ihn betrachtete. Seit wir zusammen studierten, hatte Wesley keinen Hehl daraus gemacht, dass ihm seine Noten egal waren. Er besuchte zwar die Kurse, hielt sich an die Abgaben und kam überall durch, aber immer nur mit dem allernötigsten Aufwand. Dabei war ich mir sicher, dass er deutlich besser hätte sein können. So wenig ich auch von seinem Verhalten hielt: Wesley war klug. Andernfalls hätte er nie alle Klausuren bestehen können, während er in den Seminaren nicht aufpasste. Niemand kam ohne große Mühe durch Statistik, wenn er nicht über eine bemerkenswerte Auffassungsgabe verfügte. Und das machte im Grunde alles nur noch unerträglicher. Es war nicht schlimm, wenn einem das Lernen nicht lag – doch es war so enttäuschend zu wissen, dass er es nicht einmal versuchte.
Als die Stunde beendet wurde, zuckte ich ertappt zusammen. Die aufgeschlagene Seite meines Blocks wies nur das Datum und eine Handvoll unzusammenhängender Notizen auf. Ich drehte mich zu meiner Sitznachbarin, um sie zu fragen, ob ich ihre abfotografieren durfte, aber sie war schon an der Tür. Frustriert schob ich meine Sachen in die Korbtasche.
In dem Moment, in dem ich aufstand, hatte sich der Raum schon geleert. Die Professorin nickte mir zu, ehe sie ging, und dann war ich allein. Allein mit dem jungen Mann, der noch immer auf seinem Platz saß und auf sein Handy blickte.
Je näher ich der Tür kam, desto zaghafter wurden meine Schritte. Ich wusste, ich könnte einfach gehen. Die anderen hatten gestern verstanden, warum ich nicht mit Wesley sprechen wollte, und sie hatten es akzeptiert. Und selbst wenn ich es tun würde, würde es nichts bringen. Er würde mir nie helfen, er würde nie etwas Nettes tun.
Der Gedanke schmeckte unangenehm bitter und löste ein leichtes Schuldgefühl in mir aus. Ich mochte es nicht, so absolut zu denken – schon gar nicht über Menschen. Vielleicht irrte ich mich. Vielleicht hatte selbst Wesley Hastings irgendwo tief in sich einen Kern von Gutherzigkeit, der ihn dazu bringen würde, Mitgefühl für unsere Situation zu empfinden. Vielleicht war es auch einfach keine große Sache für ihn, mit seiner Mutter zu sprechen. Vielleicht würde Wesley mich überraschen. Vielleicht, vielleicht, vielleicht.
Es gab nur einen Weg, das herauszufinden, und mein Zuhause war es wert, ihn zu gehen, auch wenn er mir mehr als steinig und unbequem vorkam.
Ich riss alle Vielleichts und mich selbst zusammen, dann ging ich auf Wesleys Platz zu. Er sah immer noch nicht von seinem Handy auf, vermutlich hatte er nicht mal bemerkt, dass die Stunde längst vorbei und der Raum leer war.
Die Sonne färbte seine Haare golden, selbst seine Wimpernfächer schimmerten. Der grüne Pullover, den er trug, hatte einen weiten Kragen, der eine fast gerade Linie Leberflecken an seinem Hals offenlegte. Unter dem Stoff waren die Muskeln seiner Schultern und Oberarme zu erkennen. Seine Haut war makellos, seine Lippen gleichmäßige Wellen, seine Nase gerade und schmal, seine Wangenknochen wirkten gemeißelt wie die der Skulpturen in den Arkadenhöfen des Instituts.
Wesley war auf eine Weise attraktiv, die sich kaum in Worte fassen ließ. Mein Vater hatte früher immer gesagt: »Schön ist kein Adjektiv für Menschen, sondern eines für Gebäude.« Erst als ich Wesley das erste Mal gesehen hatte, hatte ich das Gefühl gehabt, das richtig zu verstehen. Er war, rein äußerlich, schön – anders ließ es sich nicht ausdrücken. Aber eine schöne Fassade sagte nichts über die Inneneinrichtung eines Gebäudes aus und ein schönes Gesicht nichts über die Seele eines Menschen. Und genau deswegen bedeutete Fassadenschönheit für mich nichts.
Ich blieb einen Schritt vor dem Tisch stehen und holte tief Luft. »Wesley Hastings?«
Er blinzelte und legte sein Handy auf den Tisch, ehe er zu mir aufsah. Für einen Moment schien er verwirrt, als wüsste er nicht, wer ich war. Dann hob er die Augenbrauen. »Wenn du das so sagst, verspüre ich den Drang, es zu verneinen und durchs Fenster abzuhauen.«
Ich umfasste den Henkel meiner Tasche fester und bemühte mich, gelassen zu klingen. »Musst du nicht. Ich wollte dich nur fragen … hast du kurz Zeit?«
»Klar.« Er lehnte sich im Stuhl zurück und verschränkte die Arme vor der Brust. Dabei lächelte er auf diese spezielle oberflächlich freundliche und gleichzeitig gelangweilte Art, die nur sehr selbstüberzeugte Menschen beherrschten. Alles daran zog den Knoten in meinem Bauch fester zu, noch bevor er weitersprach. »Was gibt’s, June?«
Ich hatte es versucht. Ich hatte es wirklich, wirklich versucht. Aber Wesley war kein Vielleicht. Er war ein Niemals und ich würde mich nicht lächerlicher machen, als ich mich in diesem Moment sowieso schon fühlte.
Ich sah ihn ein paar Sekunden lang an, dann schüttelte ich den Kopf und drehte mich wortlos um. Mein Brustkorb vibrierte unangenehm, als ich den Seminarraum und kurz darauf das Gebäude verließ. Die Arkaden schimmerten bronzefarben, meine Schritte hallten laut auf dem Boden wider. Die Sonne sammelte sich im freien Hof und ließ das Gras und das Wasser des Springbrunnens golden leuchten. Normalerweise wäre ich kurz stehen geblieben und hätte den Anblick genossen. Unser Institut war ein Mini-Kosmos innerhalb der Uni und ich liebte alles daran. In diesem Moment wollte ich trotzdem nichts lieber, als ihn hinter mir zu lassen.
Ich befand mich in der Mitte des überdachten Gangs, als ich die Schritte hinter mir wahrnahm. Aus irgendeinem absurden Impuls heraus wusste ich, dass sie zu Wesley gehörten. Wahrscheinlich, weil sie so gelassen und gleichzeitig entschieden klangen – als hätte er ein Ziel, aber fühlte sich zu erhaben, es anzuvisieren.
»Warte«, erklang seine Stimme im nächsten Moment.
Ich reckte nur das Kinn und ging entschlossen auf die Tür zu, die sich am Ende des Gangs befand.
»May, jetzt warte.« Wesley hatte mich eingeholt und blieb zwei Schritte vor mir stehen. Seine Umhängetasche war offen, seine Jacke hatte er sich unter den Arm geklemmt. Er atmete nicht einmal schwer, nur sein Haar war vom Rennen zerzauster als zuvor.
Ich funkelte zu ihm auf. »Du kennst meinen Namen also doch? Ruf den Notarzt, ich kollabiere gleich vor Glück.«
Er runzelte die Stirn. »Dafür, dass du etwas von mir willst, bist du ganz schön zynisch.«
»Ich bin nicht zynisch. Und ich will nichts von dir.«
»Das klang vor zwei Minuten aber noch anders.«
Ein Teil von mir wollte einfach an ihm vorbeigehen. Wenn Wesley es mit einem Satz schaffte, mich so … wütend werden zu lassen, dann wollte ich nicht wissen, was ein richtiges Gespräch auslösen würde. Außerdem bemerkte ich bereits die Blicke der Vorbeilaufenden durch die offenen Bogen hindurch. Wesley musste nicht im Licht stehen, um zu leuchten. Menschen wie er waren Reklametafeln, immerzu herausstechend, immerzu sichtbar. Und ich wollte nicht, dass uns jemand zusammen sah, auch wenn das hier nur ein kurzes Gespräch werden sollte. Ich wollte nicht mit Wesley Hastings in Verbindung gebracht werden, nicht einmal in einem einzigen Gedanken eines fremden Menschen. Aber mir war auch klar, dass sich eine bessere Gelegenheit nicht ergeben würde.
Ich gab mir einen Ruck und bemühte mich um einen ruhigeren Tonfall. »Ich will nichts, ich brauche es.«
»Noch besser.« Wesley grinste und lehnte sich mit dem Rücken gegen den Bogen, sodass die eine Hälfte seines Gesichts in die Sonne, die andere in den Schatten fiel. Sonnenfinsternis, Mondfinsternis, einfach Finsternis. »Also, was ist jetzt? Ich wollte mir eh einen Kaffee holen, wir könnten kurz ins Halo gehen.«
Ich stolperte jedes Mal über den Namen des Cafés, das sich im Psychologie-Institut befand. Es war nach dem sozialpsychologisch geprägten Halo-Effekt benannt, der einen systematischen Fehler in der Personenbeurteilung aufgrund einzelner Merkmale beschrieb. Beliebtestes Beispiel des Effekts war die Tatsache, dass physische Attraktivität oftmals dazu führte, dass den betroffenen Personen weitere positiv besetzte Eigenschaften angedacht wurden, solche wie Intelligenz, Tiefsinnigkeit oder Güte. In diesem Moment fand ich es absurd, dass ausgerechnet Wesley Hastings diesen Ort vorschlug. Er war reich und schön, aber der Halo-Effekt wirkte dennoch nicht auf mich. Nicht nach allem, was ich über ihn und seine Freunde wusste.
»Nein, ich möchte nicht mit dir gesehen werden.«
»Okay … Autsch?«
Ich wusste selbst, wie unhöflich das klang, und sofort kroch eine Entschuldigung auf meine Zunge. Ich schluckte mehrmals, bis sich nur ein winziger Rest davon in meiner Stimme verfing. »Das ist auch gar nicht nötig. Es geht schnell. Hast du schon mal von der Mulberry Mansion gehört?«
»Die alte Villa am Waldrand, klar. Cleverer Schachzug von der Uni, das Ding an ein paar verzweifelte Studierende zu vermieten, um Renovierungskosten zu sparen.«
Er schnaubte spöttisch und ich spürte, wie sich mein Magen zusammenzog. Andere bekamen Bauchweh, wenn sie Angst oder Stress hatten, ich vor allem dann, wenn jemand gemein wurde.
»Danke für deine Besorgnis, aber wir sind nicht verzweifelt. Wir lieben es dort.«
Er verzog den Mund, entsetzt und mitleidig, aber nicht im Geringsten schuldbewusst. »Du wohnst in dem Ding?«
Ich nickte knapp. »Und ich will auch noch in Zukunft dort wohnen, allerdings wurde uns gerade gesagt, dass unsere Fördergelder gekürzt werden.« Ich konnte förmlich dabei zusehen, wie er begriff. Seine Miene verschloss sich, als würde er Vorhänge zuziehen, meine Stimme wurde schneller, um durch den letzten Spalt hindurchzuhuschen. »Wenn wir aber nicht den üblichen Zuschuss bekommen, dann können wir die anfallenden Reparaturen schon bald nicht mehr bezahlen, und das würde bedeuten, dass … wir auf Dauer nicht sicher dort leben können.«
Als das letzte Wort heraus war, schwieg er kurz. Dann hob er mechanisch die Mundwinkel. »Und jetzt bittest du mich um ein Darlehen?«
»Du weißt, worauf ich hinauswill.« Ein paar Studierende kamen an uns vorbei, ihre Blicke kribbelten unangenehm auf meiner Haut. Ich zupfte einige Strähnen aus dem Zopf, der vorn über meiner Schulter hing. Sobald der Frühling kam, wurden mir meine Haarbänder schnell zu warm, jetzt hätte ich gern eins aufgehabt, um es tief in meine Stirn zu ziehen. Als die anderen an uns vorbeigegangen waren und Wesley nach wie vor schwieg, fügte ich hinzu: »Wir wissen immerhin beide, wer über die Verteilung der Fördergelder mitbestimmt, oder?«
»Hm«, machte er nur.
Ich konnte nicht sagen, was in ihm vorging. Sein Blick lag auf meinem Gesicht, als würde er über etwas ganz anderes nachdenken. Es hätte mich nicht gewundert, wenn er längst nicht mehr zuhörte. Jetzt musste ich es trotzdem durchziehen. »Meine Freunde dachten, dass du mit deiner Mutter sprechen und ihr unsere Situation erklären könntest. Unsere eigenen Kontaktversuche verlaufen leider bislang im Nichts.«
Er lächelte spöttisch. »Das kann ich mir vorstellen. Livia ist viel beschäftigt.«
Livia, nicht Mum. Mein Bauch krampfte sich erneut leicht zusammen. Ich bekam nämlich auch Bauchweh, wenn jemand litt. Und irgendetwas an der Art, wie er ihren Namen sagte, klang verletzt, bitter und … traurig. Ich stemmte mich mit aller Kraft gegen das aufkommende Brennen. »Sie wird trotzdem ab und zu Zeit mit ihrem Sohn verbringen, oder?«
»Weniger, als du vermutlich denkst. Aber … ja.« Sein Blick strich über mein Gesicht, wanderte über meinen mit Blüten verzierten Kragen und endete an meinem geflochtenen Zopf. Ich hatte ihn mit einem Stück himmelblauen Satingeschenkband in der Farbe meines Kleides zugebunden, und irgendetwas daran ließ Wesley die Stirn runzeln.
Ich musste dem Drang widerstehen, den Zopf auf meinen Rücken zu werfen. Entschieden räusperte ich mich, bis Wesley wieder in meine Augen sah. »Also, wärst du bereit, das zu tun? Ich würde dir auch Notizen geben, die du ihr vorlesen kannst, damit du dir nicht zu viele Umstände machen musst.«
Ich hörte selbst, wie genervt ich klang, deswegen wunderte es mich nicht, als Wesley erneut die Augenbrauen hob. »Du gibst dir echt gar keine Mühe hiermit. Wie konnten deine Freunde denken, es wäre eine gute Idee, dich zu schicken?«
Gute Frage. Ich wich seinem irritierten Blick aus und senkte meinen auf unsere Füße. Wesleys gepflegte Lederschuhe, meine Lackschuhe, die ihren Glanz durch den Wald und den Staub der Villa verloren hatten. »Ich will mir keine Mühe machen, wenn ich weiß, dass es keinen Sinn hat. Und ich hab ihnen schon gesagt, dass du niemals jemandem helfen würdest, wenn nichts für dich dabei herausspringt.«
Wesley lachte heiser. »Und noch mal autsch. Du bist ja richtig auf Krawall aus. Was habe ich dir getan, dass du so wütend bist?«
Ich hätte es ihm zu gern gesagt. Ich hätte ihm gern an den Kopf geworfen, wie ekelhaft es war, was sein bester Freund getan hatte, und wie charakterlos ich es fand, dass er so etwas hinnahm und unterstützte. Aber Elsies Gefühle waren hierbei wichtiger als meine und ich wusste, dass sie nicht gewollt hätte, dass ich Lucas oder einen seiner Freunde damit konfrontierte. Also sah ich bemüht ausdruckslos in sein Gesicht. »Irre ich mich denn?«
Er zögerte, dann neigte er den Kopf. »Vielleicht kann ja etwas für mich dabei herausspringen.«
Unwillkürlich wich ich einen halben Schritt zurück. »Überlege dir jetzt gut, was du sagst.«
Wesley stutzte und im nächsten Moment lachte er auf. So laut, dass der Ton im Bogen widerhallte und eine Gänsehaut in meinem Nacken auslöste. »Oh, bitte. Ich muss wirklich keine Frauen erpressen, damit sie mit mir schlafen.«
Womit er vermutlich recht hatte. Selbst ich bekam das Gerede auf dem Campus mit, und ich hatte Wesley auch schon öfter mit irgendeinem Mädchen in der Uni gesehen. Er machte nichts, was andere nicht auch tun würden, und doch fiel es so viel mehr auf. Manchmal tat mir das leid. Es musste anstrengend sein zu wissen, dass alles, was man tat, das Potenzial dazu hatte, Gesprächsthema zu werden.
»Wofür dann?«, hakte ich mit warmen Wangen nach.
»Wenn mich nicht alles täuscht, ist Dixon ein ziemlicher Fan von dir. Wie hast du die letzten Semester bei ihr abgeschnitten?«
»Fünfundsiebzig Prozent.«
»Hm.« Er nickte, als hätte er das längst gewusst. »Sie lässt mich vielleicht durchfallen.«
»Möglicherweise hält sie es für störend, dass du ständig zu spät kommst oder dein Handy interessanter findest als ihren Lehrstoff.«