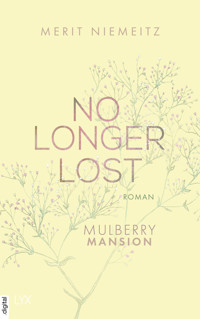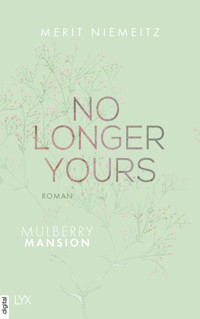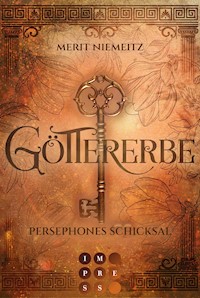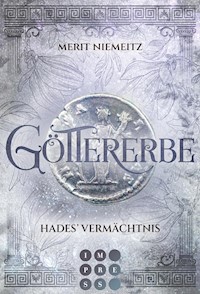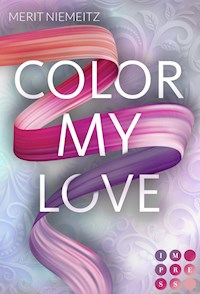11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Evergreen Empire
- Sprache: Deutsch
Ich verspreche es dir auf makelloseste, aufrichtigste, reinste Weise
Die kleine Schwester, die einzige Tochter, das Partygirl - Marigold Evergreen musste schon immer darum kämpfen, ernst genommen zu werden. Auch als sie im Parfüm-Imperium der Familie arbeiten will, verweigert ihr Bruder Odell ihr den begehrten Job. Um seine Meinung zu ändern, greift Mari zu drastischen Mitteln: Sie wendet sich an Benedict Midville - Sohn des größten Konkurrenzunternehmens, verzogener Playboy und für ihre Familie der meistgehasste Mann in Londons High Society. Der Plan: eine Fake-Beziehung mit ihm eingehen, bis Odell alles zu tun bereit ist, um die beiden zu trennen. Das Versprechen: sich auf keinen Fall verlieben. Doch was, wenn die vorgespielten Gefühle auf einmal das Echteste sind, was Mari und Benedict je empfunden haben?
»Wieder einmal und doch ganz neu hat Merit durchweg gezaubert. Mit ihren Worten. Ihren Ideen. Ihrer wundervoll einzigartigen Weise, Charaktere zum Leben zu erwecken.« BOOK.WIDE über DELICATE DREAM
Band 2 der EVERGREEN-EMPIRE-Trilogie, der neuen New-Adult-Reihe von Merit Niemeitz
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 748
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
INHALT
Titel
Zu diesem Buch
Leser:innenhinweis
Widmung
Playlist
Prolog
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Epilog
Danksagung
Die Autorin
Die Bücher von Merit Niemeitz bei LYX
Impressum
MERIT NIEMEITZ
Pure Promise
Roman
ZU DIESEM BUCH
Marigold hatte es als jüngstes Kind und einzige Tochter der Evergreens nie leicht. Seit ihrer Kindheit kämpft sie darum, von ihren Brüdern und ihrem Vater ernst genommen zu werden, aber die sehen in ihr nur das sorglose Partygirl. Als sie nach dem Tod ihrer Eltern mit ihren Brüdern das Parfüm-Imperium erbt, hofft sie, sich endlich beweisen zu können. Doch ihr großer Bruder Odell verwehrt ihr den begehrten Marketing-Job im Unternehmen. Um seine Meinung zu ändern, wendet Mari sich an Benedict Midville – Sohn und Juniorchef des größten Konkurrenzunternehmens. In der Londoner High Society gilt Benedict als arroganter, verzogener Playboy – also der perfekte Kandidat, um Odell zu provozieren. Benedict hingegen kann sich keine negativen Schlagzeilen mehr erlauben, nachdem seine Mutter gedroht hat, ihn beim nächsten Fehltritt nach Frankreich zurückzuschicken. Deshalb kommt ihm Maris Angebot wie gerufen, um sein Image aufzupolieren. Der Plan: eine Fake-Beziehung eingehen. Das Versprechen: sich auf gar keinen Fall ineinander verlieben. Das Problem: Mari und Benedict halten ihre Schutzmauern zwar hoch, aber je näher sie sich kommen, desto mehr beginnen diese zu bröckeln – und desto echter werden die vorgespielten Gefühle.
Liebe Leser:innen,
dieses Buch enthält potenziell triggernde Inhalte. Deshalb findet ihr hier eine Triggerwarnung.
Achtung: Diese enthält Spoiler für das gesamte Buch!
Wir wünschen uns für euch alle das bestmögliche Leseerlebnis.
Eure Merit und euer LYX-Verlag
Für Almedina,
weil du immer Teil meiner Wahrheit sein wirst.
PLAYLIST
My Mind – Suki Waterhouse
Flying :)) – Tom Odell
Difficult – Gracie Abrams
Reputation – Lucy Frost
Stay cool – James Vincent McMorrow
game – Zeph
Man Man – anaïs
Soldier, Poet, King – The Oh Hellos
I’m Different Now – Rosie Darling
Male Fantasy – Billie Eilish
Part Time Lovers – Hazlett
Running Away – Genevieve Stokes
lightning – mehro
Cannonball – PJ Harding, Noah Cyrus
Technicolour Beat – Oh Wonder
Jealous of Paris – Haley Joelle
life’s been boring – ryman leon
Accidentally in Love – Cole Swensen
Kissing In Swimming Pools – Holly Humberstone
Was There Nothing? – Ásgeir
Brother – Fran Lusty
Loneliness – Bear’s Den
peace – Taylor Swift
Back to You – Flower Face
Promise – Ben Howard
Evergreen – Skott
PROLOG
Marigold
Alles auf der Welt hat zwei Seiten.
Meine Mutter hatte mir diesen Satz schon früh gesagt, aber ich hatte ihn erst später verstanden. Als Kind war ich davon überzeugt gewesen, dass sich alles im Leben klar in Richtig und Falsch unterteilen ließ. In Hell und Dunkel. In Wahrheit und Lüge. Ich dachte, es würde zählen, wenn man ehrlich war. Wenn man zu seinen Gedanken und Gefühlen stand und sie mit anderen teilte – ich glaubte, das würde ausreichen, um so gesehen zu werden, wie man war.
Doch das stimmte nicht. Letztlich war alles immer eine Frage der Perspektive. Jeder Augenblick, den wir erlebten, beruhte auf Wahrnehmung. Keine Erinnerung war ein Abbild der Realität, weil unsere individuellen Empfindungen wie Filter darüberlagen. Und jeder Mensch entschied selbst, was er zu seiner eigenen Wahrheit erklärte.
Es war wie mit Gerüchen: Nicht nur, dass sie für jede Person etwas anderes bedeuten konnten, ein Parfüm wirkte auch auf jeder Haut unterschiedlich. Düfte waren der beste Beweis dafür, dass es keine Objektivität gab. Alles im Leben war persönlich gefärbt. Zwei Menschen konnten einen Moment teilen, aber sie würden ihn niemals auf dieselbe Weise erfahren oder später daran zurückdenken. Egal, wie nah wir jemandem zu stehen glaubten, es gab eine Schicht der Distanz, die wir nie überwinden können würden. Unsere eigene Wahrnehmung war das, was uns von allen anderen trennte. Wir waren immer ein bisschen allein mit unserer Art, die Welt zu sehen. Und uns selbst.
In diesem Fall zum Glück. An Morgen wie diesem ertrug ich meinen Anblick nämlich selbst kaum. Widerwillig blinzelte ich in den bodentiefen Spiegel neben dem Bett. Das Blau meiner Augen war verwaschen, das der Ringe darunter deutlich dunkler. Meine Wimperntusche hatte schwarze Krümel auf meinen Lidern verteilt, sie juckten.
Ich wischte mir über die trockene Haut und angelte nach dem Glas auf meinem Nachttisch. Wäre ich wacher gewesen, hätte ich es sicher gerochen. So merkte ich es erst beim Schlucken: Die Flüssigkeit darin schmeckte schal und bitter. Kein Wasser, abgestandener Sekt. Ich würgte und stellte das Glas so ruckartig zurück, dass es umkippte. Tropfen rannen über die Nachttischkante auf den cremefarbenen Teppich, ich schaffte es nicht, mich aufzuraffen, um sie aufzuhalten.
Legst du es darauf an, alles zu verkomplizieren?
Ich zuckte zusammen, so plötzlich war Odells Stimme in meinem Kopf. Es war knapp eine Woche her, dass ich diese Worte gehört hatte, aber selbst in der Erinnerung klangen sie unangenehm bohrend. Ich hatte verstanden, was er wirklich meinte. Etwas, das ich in den letzten Jahren immer wieder auf verschiedene Weisen gehört hatte: Legst du es darauf an, alles kaputt zu machen?
Meine Gedankenerwiderung lautete jedes Mal: Nein, ich fürchte, das bin einfach ich.
Vielleicht gab es Menschen wie meinen ältesten Bruder, die alles zusammenhielten. Und Menschen wie mich, die alles zerstörten. Mit einem falschen Satz, einer falschen Handlung, einem falschen … Gefühl. Es war keine Absicht, ich konnte es schlicht nicht kontrollieren. In meiner Brust nistete diese Flamme, die ständig aufloderte und sämtliche Vernunft und Zurückhaltung zerfraß. Ich war impulsiv und hatte meine Emotionen schlecht unter Kontrolle. Ich hatte mich schlecht unter Kontrolle.
Sonst hätte ich gestern nach der ersten Flasche Sekt definitiv aufgehört zu trinken. Ich rollte mich auf den Rücken und stöhnte, als meine Schläfen pochten. Es wurde schlimmer, sobald es jenseits meiner Zimmertür klingelte.
Ich presste mir die Hände auf die Ohren. Es war Freitagmorgen, laut der Uhr neben meinem Schrank kurz vor zehn. Evie und Quinn waren sicher schon auf dem Weg zur Uni, wo ich auch hätte sein sollen. Anders als zwei meiner Mitbewohnerinnen studierte ich nicht an der University of London, sondern am University College London. Mit dem Auto waren es nur rund zehn Minuten von Soho nach Bloomsbury, wenn ein Abend allerdings zu lang geworden war, fühlte sich der Ausblick auf mehrere Stunden in Seminarräumen wenig reizvoll an. In weiser Voraussicht hatte ich meinen Fahrer gestern schon für den gesamten Tag abbestellt.
Es klingelte abermals an der Wohnungstür, kurz darauf kamen Schritte im Flur auf. Offensichtlich war Penn noch da. Sie war die Einzige von uns, die diesen Winter bereits ihren Bachelorabschluss gemacht und sich erst mal eine Auszeit genommen hatte. Mehr als verdient angesichts der Tatsache, dass sie als Jahrgangsbeste abgeschlossen hatte.
»Hey, Mr Evergreen. Immer eine Freude, Sie zu sehen.« Die Stimme meiner Freundin drang so laut durch die Wände, dass ich zusammenzuckte. Eigentlich nahm Penn Rücksicht darauf, wenn der Rest von uns länger schlief, aber das war eindeutig ein Notfall. Nein, schlimmer: Es war mein Vater.
Sofort schoss ich in die Höhe und bereute es, als sich der Kopfschmerz zu Schwindel aufbäumte. Ich drückte einen Handballen gegen meine pochende Stirn, während ich mich aus dem Bett hievte und nach einem herumliegenden Pullover langte. Er roch nach Quinns Zigaretten, ich zerrte ihn mir trotzdem über das Nachthemd und kämmte mit den Fingern mein wirres Haar, während die Stimmen näher kamen.
»Ganz meinerseits, Penelope.« Das war definitiv Dad, auch wenn ich keine Ahnung hatte, was er hier wollte. Normalerweise hätte er längst im Büro sein müssen – da war er so gut wie immer.
»Ignorieren Sie bitte das Chaos. Ich übernehme die volle Verantwortung dafür. Mari räumt uns ständig hinterher, leider bin ich unverbesserlich.«
Dad schmunzelte hörbar. »Netter Versuch, aber ich kenne meine Tochter. Ist sie da?«
Ich verzog den Mund und kickte die leere Sektflasche unter das Bett, auch wenn sich dadurch weitere Tropfen in den Teppich fraßen.
»In ihrem Zimmer«, bestätigte Penn, offenbar nur noch ein paar Schritte davon entfernt. »Die anderen haben gestern lang gelernt, vielleicht schläft sie noch.«
Netter Versuch, dachte ich diesmal selbst, weil Dad es mit Sicherheit auch tat. Ein Blick in unser Wohnzimmer, in dem sich bestimmt noch die Gläser und Sushi-Schalen stapelten, und er könnte sich vorstellen, wie wir den Abend verbracht hatten.
Ich schaffte es gerade noch so, das Fenster über meinem Bett aufzureißen, da klopfte es auch schon. Mein »Ja?« klang krächzend, Dad hörte es dennoch und öffnete die Tür.
Er trug wie gewohnt einen Anzug – dunkles Grau, schwarze Krawatte, keine einzige Falte im Stoff. Dafür umso mehr auf seiner Stirn, als er mich musterte. Für einen Moment huschte ein trüber Schatten über sein Gesicht. Ich kannte diesen Ausdruck zur Genüge, und ich hasste ihn. Sorge hing immer mit Enttäuschung zusammen – zumindest in meiner Familie.
»Guten Morgen, Mari.«
»Hey, Dad.« Ich rang mir ein Lächeln ab und ließ es zu, dass er mich auf den Kopf küsste. Auch wenn ich wusste, dass er es dadurch umso deutlicher roch: den Alkohol, der seine Duftfingerabdrücke auf meiner Haut hinterlassen hatte, den kalten Rauch, der dasselbe im Pullover getan hatte. Ich hätte ihm sagen können, dass zumindest Letzteres nichts mit mir zu tun hatte, aber ich sparte mir die Mühe. So war das eben, nicht? Die Wahrheit spielte keine Rolle, wenn dein Gegenüber sich bereits ein Bild gemacht hatte, das er zu dieser erklärt hatte.
Ich wich einen Schritt zurück, näher ans offene Fenster. Mit der Märzkühle kroch auch der Duft nach frisch gemahlenem Kaffee aus dem Frühstücksrestaurant gegenüber und der von blühenden Forsythien ins Zimmer. »Was willst du denn hier?«
»Mir ist zu Ohren gekommen, dass du Anthony heute freigegeben hast. Ich wollte nur sehen, was der Grund dafür ist, dass du die Uni ausfallen lässt.«
Das war einer der Nachteile, wenn dein Chauffeur sowie all deine Abrechnungen über deinen Vater liefen: Er hatte jederzeit Einblick in meine Fahrten und Konten. Zwar sagte er selten etwas dazu, doch Momente wie dieser riefen mir in Erinnerung, dass er sie überwachte. Ich beschwerte mich nicht darüber, immerhin war es meine Entscheidung, sein Geld anzunehmen. Trotzdem nervte es mich gelegentlich.
»Fühl mich nicht so gut.«
Dad betrachtete mich kurz, dann legte er den Kopf in den Nacken und sah hinauf. Unsere Wohnung war ein schlichter Altbau, die Decken waren nicht stuckverziert, lediglich weiß. Ich hatte nicht mal eine Lampe anbringen lassen, obwohl ich seit fast anderthalb Jahren hier lebte. Keine falschen Sonnen, keine falschen Erinnerungen. Mein Vater sah sie trotzdem – alles davon.
»Vermisst du deinen Himmel ab und zu?«
In meiner Brust zwickte es, ich umfasste meine Ellbogen. »Ich bin kein Kind mehr, Dad.«
»Das ist mir klar. Aber man muss nicht aus allem herauswachsen, weißt du?«
»Sucht man sich nicht immer aus.«
Er wandte mir den Blick zu. Da waren tiefe Fältchen um seine Augen, ich glaubte, sie waren neu. Ich fühlte mich schuldig, als wären es winzige Striche für jeden Anruf, den ich nicht annahm oder nach wenigen Worten beendete, für jedes Essen, das ich kurzfristig verschob, für jede Abrechnung, die bei ihm auf dem Tisch landete. Für alles, was meinem Vater klarmachte, dass ich nicht mehr das Mädchen war, das er großgezogen hatte.
Ich liebte ihn nach wie vor, aber ich hatte verlernt, das auszusprechen. So wie ich verlernt hatte, ihn zu umarmen oder ein Gespräch mit ihm zu führen, das über die kommenden Events von Evergreen Empire oder Uniprüfungen hinausging. Ich hatte verlernt, eine Tochter zu sein. Wir hätten über die Gründe dafür reden müssen, offen und ehrlich, doch auch das hatte ich verlernt.
»Manchmal aber schon«, sagte er sanft. »Manchmal redet man sich ein, dass man bestimmte Dinge loslassen muss, weil das leichter ist, als nach einem Weg zu suchen, sie besser zu fassen zu bekommen.«
Das Zwicken in meiner Brust wurde stärker, ich reckte das Kinn. »Ich bin zu fertig für einen Philosophie-Crashkurs. Was willst du mir sagen?«
Er trat zur Seite, musterte meinen Schreibtisch, ein Chaos aus benutzten Kaffeetassen, Statistikbüchern und offenen Schmuckschatullen. Mums Perlenkette lag in der ganz oben, ich wusste, er sah sie beim Antworten an. »Odell und du habt euch gestritten?«
Großartig. Früher war mein ältester Bruder derjenige gewesen, der meine Missgeschicke vor unseren Eltern auf sich genommen hatte. Mittlerweile nahm er offenbar mit Petzen vorlieb. »Hat er das gesagt?«
»Nein. Meine Sekretärin hat euch gehört, als ihr letztens in meinem Büro aufeinandergetroffen seid.«
»Es war kein Streit.« Mit Odell konnte man nicht streiten – ich schon gar nicht. Er behielt immer einen kühlen Kopf, ich verglühte innerhalb von Sekunden in Gefühlshitze.
Dad strich über den angetrockneten Kopf einer Rose, die in einer leeren Crémant-Flasche stand. »Eure Mutter hat sich so darüber gefreut, als sie erfahren hat, dass du ein Mädchen wirst, weißt du? ›Mit zwei großen Brüdern wird sie ein Leben lang beschützt werden.‹«
Beinahe hätte ich gelacht. »Danke, kein Bedarf. Ich kann selbst auf mich aufpassen.«
»Das ist mir bewusst. Ich hoffe nur, dass dir bewusst ist, dass das nicht immer nötig ist.« Er drehte sich wieder zu mir. »Du kannst über alles mit mir reden. Und mit deinen Brüdern auch.«
Ich hätte so viel dazu sagen können, aber ich war es leid. Nach Mums Tod war ich diejenige gewesen, die sich in vielerlei Hinsicht die Seele aus dem Leib geschrien hatte. Jeder Wutanfall, jeder Streit, jede Provokation war ein Flehen gewesen, mich anzuhören. Doch das hatten sie nicht getan. Auf ihre eigene Weise hatten sie sich alle drei die Ohren zugehalten. Und jetzt, über vier Jahre später, hatte ich kein Interesse mehr daran, meine Stimme auf diese Art zu erheben. Es gab Dinge, die ich niemandem erzählte. Weil ich gelernt hatte, dass es häufig keinen Unterschied machte, es zu tun. Die Wahrheit reparierte nicht immer alles. Manchmal ging sie nur selbst bei dem Versuch kaputt. Und wenn du richtig Pech hattest, zerstörte sie einen Teil von dir gleich mit. Es stimmte, was ich gesagt hatte: Ich passte auf mich auf. Auch, indem ich meine Wahrheiten für mich und damit ganz behielt.
Also schwieg ich und starrte auf die Sektpfütze neben meinen Zehen, bis Dad das Thema mit einem Seufzen beiseitewischte. »Würdest du Sonntag zum Frühstück nach Rosehill kommen? Ich könnte Odell auch fragen.«
Und was dann?, wollte ich erwidern. Stellen wir eine Kerze für Mum auf und schalten Keaton via Videocall dazu, damit er kurz darauf so tut, als würde die Verbindung abbrechen? »Ich kann nicht.« Der Satz war zu ehrlich, also schob ich eine Lüge hinterher. »Hab ein Treffen für ein Uniprojekt. Vielleicht ein anderes Mal.«
»Natürlich, das verstehe ich.« Dads Lächeln verriet, dass er mich durchschaute. In einem früheren Leben hätte er mir das nicht durchgehen lassen. Er hätte darauf bestanden, dass ich vorbeikam, mir ins Gewissen geredet oder mit dem Sperren meiner Kreditkarte gedroht, die effektivste Strafe, seit ich dem Hausarrest entflohen war. Nur, dass es sich oft eben doch noch so anfühlte, als würde ich in diesem Haus festsitzen. Als würde ich ihm einfach nicht entkommen, ihm und all den Erinnerungen, die es beherbergte.
In diesem Leben strich er mir nur übers Haar, eine Geste, deren Routine uns im Laufe meines Erwachsenwerdens verloren gegangen war und die sich jetzt fremd anfühlte. Dann wandte er sich ab.
Ich gab mir einen Ruck. »Dad?«
Er hielt in der Tür inne, drehte sich zu mir um. Morgenblasses Licht besprenkelte seine Züge, er wirkte müder und älter, als ich ihn je zuvor gesehen hatte. Mir wurde erneut übel, auf eine Weise, die ich nicht dem Kater anlasten konnte.
Es liegt nicht an dir, wollte ich sagen. Es liegt daran, dass ich fast weinen muss, wenn ich Odells Parfüm in der Tube rieche, obwohl ich weiß, dass er so gut wie nie mit den Öffentlichen fährt. Es liegt daran, dass ich Keatons Instagram-Profil jeden Tag stalke, mir aber eher einen Finger abschneiden würde, als auf seine Posts zu reagieren. Es liegt daran, dass Mums Kette schwerer wiegt, als sie dürfte, und genau deswegen das ist, was mich das Kinn höher heben lässt. Es liegt daran, dass ich dich nicht ansehen kann, ohne zu bemerken, dass etwas an mir dich traurig macht. Es liegt daran, dass ich wütend auf euch bin. Auf euch alle. Ich ertrage das, ich brauche das vielleicht sogar, doch ich kann nicht damit umgehen, wie sich diese Wut aufweicht, wenn ich Zeit mit euch verbringe – dass sie zu etwas wird, das ich ihr nicht zugestehen will. Denn vor allem liegt es an mir. An dem Ich, dem ich seit meinem Auszug mühsam entkommen bin, und daran, dass ich Angst habe, Rosehill und ihr könntet ihm dabei helfen, mein jetziges Ich einzuholen.
Ich senkte den Blick. »Ein anderes Mal, versprochen.«
»Ist das ein reines Versprechen?«
Diese beiden letzten Wörter waren ein Erinnerungskloß, der sich in meinem Hals verkeilte und es unmöglich machte, etwas zu erwidern. Ich war acht oder neun gewesen, als ich bemerkt hatte, dass mein Vater dazu neigte, seine Versprechen zu brechen. »Ich bin pünktlich zum Essen zu Hause, versprochen. Ich lese dir heute Abend noch was vor, versprochen. Ich werde mir dein Schulkonzert keinesfalls entgehen lassen, versprochen.« Er hatte sie gebrochen, nicht immer, aber oft. Also hatte ich ihn schließlich dazu aufgefordert, mir nichts mehr zu versprechen, wenn er nicht hundertprozentig sicher war, es halten zu können: »Ich will keine makelhaften Versprechen mehr, ich will nur noch die reinen, die unzerstörbar sind.« Ab diesem Zeitpunkt hatte Dad mir deutlich weniger versprochen. Aber wenn, hatte er es auch wahr gemacht.
Ich schluckte, der Kloß blieb in meinem trockenen Hals stecken. Ein einziges Wort drängte sich daran vorbei, sodass es aufgeraut aus meinem Mund schlüpfte. »Ja.«
Dad sah mich an, als würde er noch etwas erwidern wollen, dann nickte er nur, wandte sich ab und ging.
Alles auf der Welt hat zwei Seiten.
Ein paar Tage später würde ich wieder daran denken. Im Krankenhaus, auf dem absurd weich gepolsterten Sessel im Wartezimmer. Ich würde in diesem Albtraum aus Perlmuttweiß sitzen und diesen schwarz leuchtenden Satz vor Augen haben. Ich würde daran denken, dass er diesmal nicht zutraf.
Dieser letzte Moment zwischen Dad und mir hatte keine zwei Seiten. Er war keine Medaille, er war ein Stein, der, noch bevor der Arzt zu uns kam, dieses unerträgliche Begreifen in mein Bewusstsein hineinschlug:Mein letztes Versprechen an Dad war das makelhafteste von allen gewesen, und ich würde das nie gutmachen können.
Er würde nie wieder in meiner Wohnung auftauchen.
Er würde mich nie wieder ansehen oder anlächeln.
Er würde mir nie verraten, was er in unserem letzten geteilten Augenblick hatte sagen wollen.
Er war gegangen, und er würde nicht zurückkommen.
Also, egal wie ich es drehte und wendete, es änderte nichts daran, welche Wahrheit an diesem Moment haftete: Du hättest es besser machen müssen. Du hättest besser sein müssen. Du hättest riskieren müssen, ehrlich zu sein – wenigstens dieses eine Mal.
Was hätte es schon ausgemacht, wenn ein Teil von mir dabei zersplittert wäre? Alles andere war das ja auch.
1
Marigold
Zehn Monate später
Hier fängt es an.
Ich wich zurück, bis der Schriftzug auf Höhe meiner Stirn war. Violettstichiges Rot, das den Namen My Mind trug. Ich strich mit dem Daumen über ebenjene Gravur an der Kappe, ehe ich den Lippenstift zurück in meine schwarze Samttasche steckte. Das alles, ohne den Blick vom Spiegel zu lösen. Die Buchstaben waren schief und teilweise so dick, dass sie kaum lesbar waren. Ich fühlte dennoch, wie sich der Knoten in meiner Brust lockerte, als ich sie mehrmals überflog.
»Eine Diskussion gewinnst du im Kopf.« Dad hatte mir diesen Satz unzählige Male gesagt, vorzugsweise, wenn ich mit tränenüberströmtem Gesicht oder wuterhitzten Wangen vor ihm gestanden hatte. »Du wirst deinen Punkt nie durchsetzen, wenn du mit Ausrufezeichen um dich wirfst. Keine Emotionen, keine Schwäche, verstehst du?«
Ich hatte mich lang gegen diese Aussage gewehrt. Wenn man mit zwei älteren Brüdern aufwuchs, musste man laut sein, um überhaupt gehört zu werden. Es erschien mir komplett widersprüchlich, bei den Dingen, die mir am wichtigsten waren, die Stimme zu senken. Aber besondere Pläne erforderten besondere Maßnahmen.
Hier fängt es an.
Behutsam tastete ich über meine Stirn, als könnte ich den Abdruck der Worte dadurch in meine Haut brennen. Andere Menschen sagten sich ihre Glaubenssätze vor dem Spiegel auf, ich schrieb sie direkt darauf. Geschriebenes verinnerlichte man besser als Gesprochenes, richtig? Ich glaubte daran – an mich. Ich hatte eine Stimme, und sie verdiente es, gehört zu werden. Heute war der Tag, an dem sich alles ändern würde. Ich würde mich zusammenreißen und so leise reden, dass Odell mir einfach zuhören musste. Was paradox klang und doch völlig Sinn ergab, wenn man meinen ältesten Bruder kannte.
Odell Charles Evergreen teilte sich nicht nur den zweiten Vornamen mit unserem Vater, sondern auch viele seiner Ansichten. Ich gab ihm keine Schuld daran, immerhin hatte Dad ihm diese jahrelang eingetrichtert. Von seiner Geburt an hatte festgestanden, dass er eines Tages der Kopf von Evergreen Empire sein würde, natürlich war er die Definition eines Kopfmenschen. Er war darauf trainiert worden, sich von Verstand und Vernunft leiten zu lassen. Und jemandem, der so viel Wert auf Kontrolle legte, imponierte man eben nur, indem man sich selbst kontrollierte. Auch wenn das etwas war, das mir schon immer schwergefallen war.
Heute würde es anders sein. Heute würde ich anders sein, um ihn davon zu überzeugen, mir endlich die Chance zu geben, die ich verdammt noch mal verdiente.
Hier fängt es an. Ich las den Satz ein letztes Mal, dann zerrte ich ein paar Papiertücher aus dem Spender und trat an den mit funkelnden Mosaiksteinchen besetzten Spiegel. Grob wischte ich den Lippenstift weg, bis die Worte nur noch in meinen Gedanken aufleuchteten.
Türkisblaues Licht schwamm aus den wuchtigen Deckenlampen im Speiseraum, als ich zurückkehrte. Das Licht im Colourmind, einem angesagten Frühstücksrestaurant in Soho, veränderte seine Farbe im Stundentakt. Die Tatsache, dass das der dritte Wechsel seit unserer Ankunft war, machte deutlich, dass ich bald losmusste.
Als wir noch zu viert zusammengelebt hatten, waren wir mehrmals die Woche hier gewesen. Seit ich vor rund neun Monaten gezwungenermaßen zurück nach Hampstead gezogen war, um den Erbbedingungen unseres Vaters nachzukommen, verpasste ich diese meist spontan einberufenen Treffen öfter. Etwas, das die anderen mir gern in unserem Gruppenchat vorhielten, weswegen ich an diesem Dienstagmorgen hergefahren war. Trotz meines späteren Termins, der seit Wochen wie ein Hochhaus aus meiner Gedankenstadt herausragte und einen permanenten Schatten über alles andere warf.
»Gut, dass du wieder da bist«, verkündete Quinn, sobald ich in Hörweite des Tischs war. Er befand sich an einer Wand, von der unzählige nackte Glühbirnen hinabhingen. Ein Vorhang aus Licht, klassisch in Warmgelb im Gegensatz zur bunten Hauptbeleuchtung. »Wir haben gerade über dein Liebesleben gesprochen.«
»In meiner Abwesenheit?« Ich setzte mich auf meinen Platz neben Evie. Während ich weg gewesen war, hatte sie aus den Resten ihres Omeletts einen Smiley gebastelt – ihrer Meinung nach die einzig erträgliche Art, etwas übrig zu lassen, ohne die Angestellten zu kränken.
»Sei fair: Deine Anwesenheit hat dahingehend kaum Auswirkung auf unseren Informationsstand.« Penn sah mich vielsagend über den Rand ihrer Tasse an. Ihr schwarzer Kaffee roch so bitter, dass ich glaubte, ihn selbst zu schmecken. Vielleicht lag das aber auch an ihren Worten. Oder eher an dem, woran ich dabei denken musste.
Es stimmte, ich behielt die Details meines Liebeslebens meistens für mich. Allerdings führte ich auch keines, das diesem Namen gerecht wurde. Nicht, dass es mich störte – es war meine Entscheidung –, doch fehlende Liebe bedeutete nicht, dass einem immer der Hass erspart blieb.
»Du musst uns nichts sagen«, meinte Evie und verzog ihren Mund zu einem ähnlichen Lächeln wie dem auf ihrem Teller. Ihre Lippen waren fast ebenso herzförmig wie ihr Gesicht, und das ergab so viel Sinn, wenn man sie kannte. »Aber neugierig sind wir natürlich schon. Wie läuft’s denn mit Drew?«
Mir entwich ein Schnauben. Ich hatte Drew in einer Bar in Brixton kennengelernt, in der wir vor ein paar Wochen gewesen waren. Ein schlichter Laden mit billigem Schnaps und schlechter Musik – meine Wahl, wenn auch nicht meine beste. Ich ging gern ab und zu dort aus, wo niemand erkannte, dass mein Kleid mehr gekostet hatte als die Inneneinrichtung. Das machte es leichter, meinen obersten Grundsatz einzuhalten: Kein Sex mit Leuten aus der High Society.
Meine Freundinnen zogen mich oft damit auf, was für enttäuschende Erfahrungen ich gemacht haben musste, wenn ich niemandem aus unseren Kreisen zutraute, mich zufriedenzustellen. Ich ließ sie in dem Glauben, dass meine Entscheidung auf fehlende Orgasmen zurückzuführen war, solang sie mich in unbekanntere und deutlich günstigere Bars und Clubs begleiteten. Auch wenn das dafür sorgte, dass sie solche Nachfragen überhaupt erst stellten.
Drew war Barkeeper in besagtem Laden gewesen, hatte einen netten Eindruck gemacht und außerdem einen wolkenförmigen Pigmentfleck am Hals gehabt – einer dieser offensichtlichen Makel, für die ich eine Schwäche hatte. Also hatte ich, als er mich nach meiner Nummer gefragt hatte, gedacht: Warum nicht? Eine Nacht in seinem Appartement, drei verpasste Anrufe seinerseits und eine Nachricht meinerseits später kannte ich die Antwort darauf.
Wortlos rief ich den Chat auf und hielt Penn mein Handy über den Tisch hin. Sie las nicht laut vor, ich hörte die Worte trotzdem zum wiederholten Male, seit ich sie gestern Abend gesehen hatte. Du hältst dich auch für was Besseres, nicht? Arrogante Schlampe.
Penns münzgraue Augen verengten sich mit jeder Sekunde mehr. »Pluspunkt für das Verwenden von Satzzeichen und Groß- und Kleinschreibung, Minuspunkte für mangelnde Kreativität, ein überempfindliches Ego und schlechte Manieren.«
»Zeig mal her.« Quinn neben ihr langte nach dem Smartphone. »So ein Arsch«, meinte sie kurz darauf und reichte es an Evie weiter. Sie klang empört, aber nicht überrascht, was bezeichnend für den durchschnittlichen Dating-Erfahrungsschatz zwanzigjähriger Frauen war.
Evie zwirbelte eine blonde Haarsträhne zwischen ihren Fingern und schürzte bedauernd die Unterlippe. »Und ich dachte, er wäre einer von den Netten.«
»Sie sind immer nett, bis zum ersten Nein.« Ich griff nach meinem Sektglas, das ich bisher bewusst nicht angerührt hatte. Kühler Kopf hin oder her, ich brauchte dringend etwas, um das aufglimmende Wutfeuer in mir zu löschen.
»Was hattest du ihm eigentlich geschrieben?« Penn sah auffordernd zu Evie, vermutlich, weil sie ahnte, dass ich damit nicht so einfach herausrücken würde.
Unsere Freundin verzog noch vor dem Vorlesen den Mund. »Vielen Dank für das Angebot, aber ich habe momentan keine Kapazitäten für weitere Treffen. Trotzdem war es sehr nett, dich kennengelernt zu haben. Alles Gute weiterhin.«
»Alles Gute weiterhin?« Penn kräuselte die Stirn, dabei hatte das Zusammenleben mit ihr deutlich zu meiner formellen Wortwahl beigetragen. Ihre Mutter war Professorin für Geschichte und Literatur in Cambridge. Penn hatte schon als Kleinkind am Frühstückstisch Diskussionen über die sprachlichen Besonderheiten aller Epochen geführt. Ihre Vorliebe für eine gewählte Ausdrucksweise konnte sie daher ebenso wenig verbergen wie Quinn ihre chronische Langeweile, sobald sie länger als zwei Minuten schweigen musste.
Immerhin wirkte diese jetzt gut unterhalten. Sie drehte grinsend am Piercing in ihrem Nasenflügel. »Gott, du bist grausam.«
»Ich bin ehrlich. Und höflich«, korrigierte ich. »Was man von Drew nicht behaupten kann.«
»Sollen wir ihm eine Lektion erteilen?«, fragte Penn unpassend sachlich. »Vielleicht würde Jonna für uns eine Kontaktanzeige mit seiner Nummer in der Times schalten.«
»Ich bin sicher, Jonna würde so ziemlich alles für dich machen.« Quinn biss grinsend in die letzte dekorative Erdbeere von ihrem Pancake-Teller.
Penn verdrehte die Augen, widersprach jedoch nicht. Sie war zu clever, um nicht zu bemerken, wie ihre aktuelle Was-auch-Immer sie ansah. Bedauerlicherweise hielt Penn ihre Beziehungen gern zwanglos und vor allem kurz. Meistens traf sie sich mit Leuten, die nur für einen absehbaren Zeitraum in London waren. So wie Jonna, eine schwedische Journalismus-Studentin, die ein Praktikum bei der Zeitung machte.
»Wir könnten auch hungrige Ratten im Keller seiner Bar aussetzen und ihn zusammen mit ihnen da unten einsperren. Vielleicht findet er über den Verlust seiner Zehen ja seinen Anstand wieder.« Evie reichte mir das Handy und hob die Schultern, als sie unsere skeptischen Blicke bemerkte. »Was? Für irgendwas muss meine True-Crime-Obsession ja gut sein.«
»Danke für eure kreativen Ansätze, aber er ist die Mühe nicht wert.« Mit einer geübten Bewegung wischte ich über den Bildschirm, um die Nummer zu blockieren. Ich tat mich schwer damit, meine Meinung zurückzuhalten, allerdings würde sie nichts an seiner ändern. Ich würde meine Energie nicht an so jemanden verschwenden, ich brauchte sie für Dinge, die ich beeinflussen konnte. Heute ganz besonders.
»Sie hat recht. Es gibt andere Männer, mit denen wir uns beschäftigen können.« Quinn fuhr sich durch die rotbraunen Locken, ehe sie das Kinn in einer Hand abstützte und mich angrinste. »Zum Beispiel deine Brüder.«
Beinahe hätte ich den kalten Tee wieder ausgespuckt, an dem ich gerade genippt hatte. Er war sowieso zu bitter, mit Sicherheit hatte er zu lang gezogen. »Okay, ich lege ein Gesprächs-Veto ein, das ertrage ich echt nicht.« Ich kannte Quinn gut genug, um einzuschätzen, dass sie nicht an einem Austausch über Unternehmensstrategie interessiert war. Ihrer Meinung nach waren Männer am unterhaltsamsten, wenn sie nicht redeten. Ich sagte ihr oft, dass das sexistisch wäre, aber sie berief sich jedes Mal auf ihren Erfahrungsschatz, und den konnte ich ihr schlecht absprechen. Wobei ihr Männergeschmack eindeutig Teil des Problems war.
»Oh, komm schon.« Sie nahm mir das Handy ab, damit ich sie ansah. »Es ist ein Fakt, dass die beiden ziemlich gut aussehen. Wie oft müssen wir dich noch anbetteln, sie mal mitzubringen?«
»Darf Odell dann auch seine Freundin mitbringen?«
»Sie ist doch eh kaum in London, oder?« Sie schlürfte mit vielsagendem Blick an ihrem Gimlet. »Der Ärmste muss einsam sein.«
»Es geht ihm bestens.« Ich spannte den Kiefer an, um nicht noch mehr hinterherzuschieben. Zum Beispiel, dass solche Sachen nicht witzig waren, selbst wenn es dabei nicht um meinen ältesten Bruder und meine beste Kindheitsfreundin gegangen wäre.
»Schon gut, du weißt, dass das nur ein Scherz ist«, kam Evie ihr beschwichtigend zuvor. »Außerdem gibt es ja noch den zweiten Bruder. Ich erinnere mich dumpf, dass meine Cousine meinte, Keaton wäre zu Schulzeiten sehr empfänglich für Gesellschaft gewesen.«
Eine nette Umschreibung dafür, dass mein zweiter Bruder in seiner Jugend gefühlt wöchentlich neu ausgelost hatte, an welchem Mädchen er interessiert war. Wäre er eine Frau gewesen, hätte man dafür eine Menge weniger schmeichelhafte Wörter gekannt. War er aber nicht, weswegen die einzigen wertenden Kommentare dazu die unserer Mutter gewesen waren, wenn sie mitbekommen hatte, dass erneut ein Mädchen wegen Keaton geweint hatte.
Seit wir wieder in Rosehill lebten, wurde er auffällig oft von Lily angerufen – mit der er angeblich in Stanford zusammen gewesen war. Ich hatte meine Zweifel daran, es erschien mir realistischer, dass er mit ihr eine Bank ausgeraubt und sich mit dem Geld abgesetzt hatte, als dass er eine Beziehung mit ihr geführt hatte.
Vermutlich durfte ich mir darüber kein Urteil erlauben, immerhin hatte ich bisher selbst keine gehabt, aber wenn es Männer gab, die ich kannte, dann waren es eben meine Brüder. Odell war ein Perfektionist, nah an der Grenze zum Kontrollfreak, der extrem schlecht darin war, über seine Gefühle zu sprechen, weil er sie oft selbst überhörte. Seit er wieder mit Emmeline zusammen war, glaubte ich, dass sich das tatsächlich verbessern könnte – auch, weil sie laut meiner Freundin vieles ausdiskutierten.
Keaton allerdings war absolut konfliktunfähig. Man konnte keine Diskussion mit ihm führen, ohne dass er kryptisch wurde oder sich so sehr verschloss, dass man im wahrsten Sinne gegen eine Wand redete. Ich konnte mir keine Frau vorstellen, die die Geduld hatte, seine Fassade aus Spott und verwirrender Zweideutigkeit nach einer Tür abzuklopfen.
»Das ist lang her, mittlerweile ist Keaton zum Einzelgänger mutiert. Ihr müsst euch anderweitig umsehen.«
»Wie wäre es mit diesem Prachtexemplar, wäre der nicht was für dich?« Quinn hielt mir mein Handy hin, auf dem sie während meiner Pause herumgescrollt hatte. Sie hatte die Webseite einer dieser unsäglichen Boulevardzeitungen aufgerufen und herangezoomt, sodass das Foto fast den gesamten Bildschirm einnahm.
Es war schwer zu sagen, was markanter hervorstach: die Wangenknochen im finster dreinblickenden Gesicht oder die Bauchmuskeln unter dem nassen Hemd. Offensichtlich hatte dieser junge Mann es für eine gute Idee gehalten, in der Themse schwimmen zu gehen. Das war immer unklug, aber nachts im Winter und – den leeren Flaschen am Bildrand nach – betrunken war es regelrecht dämlich. Nicht, dass es mich überrascht hätte, immerhin wusste ich genau, wer das war. Es war lächerlich: schlechte Lichtverhältnisse, schlechte Qualität, schlechte Bildvoraussetzungen in Form seiner Mimik und der ganzen Situation, trotzdem schaffte dieser Types, unleugbar gut auszusehen. Ich ließ den Blick tiefer wandern und hätte fast gelacht, als ich die mehr als treffende Schlagzeile entdeckte: Le Beau ou la Bête?
So paradox Benedict Midville auf diesem Bild und auf den ersten Blick generell wirkte, so eindeutig war letztlich die Antwort auf diese Frage. Alles, wirklich alles, was er von sich – dem Teil, auf den es ankam – zeigte, gab sie.
»Sehr witzig.« Ich schob das Smartphone von mir weg. So wie ich seit über einem Jahr konsequent alles und jeden aus meiner Nähe entfernte, das oder der mit dem verzogenen Sprössling des Midville-Parfüm-Imperiums zu tun hatte.
»Du meinst: sehr heiß. Gib’s zu, selbst besoffen schafft er es, unverschämt attraktiv auszusehen. Und wie man hört, weiß er damit«, Quinn machte eine vage Geste, die vermutlich seine Erscheinung umfassen sollte, »auch noch umzugehen.« Ihr Blick schwankte zwischen Verzückung und Bedauern, dabei war ich sicher, dass sie unter anderen Umständen über seine offensichtlichen Charakterschwächen hinweggesehen hätte, um seine körperlichenStärken auszukosten. Immerhin hatte sie recht, man erzählte sich viel Zweifelhaftes über ihn, aber eines schien lächerlich einstimmig: Der Sex mit ihm musste ausgesprochen gut sein.
»Vielleicht bezahlt er die Frauen dafür, das zu behaupten«, warf Evie ein, während sie so freundlich zu einem Kellner hinauflächelte, dass dessen Ohren rot anliefen.
»Ich würde mich als Testobjekt anbieten.« Quinn bedachte mich mit betont wehleidigem Blick. »Aber ich darf ja nicht.«
Ich verdrehte die Augen und exte meinen Sekt. Diese Themenauswahl machte Nüchternheit zunehmend unerträglich. »Ihr dürft tun, was ihr wollt. Ich bin nicht eure Chefin.«
Penn sah mich mit diesem strengen Blick an, der mich an meine Professoren erinnerte. Mit Sicherheit hatte sie sich den bei ihrer Mutter abgeschaut. »Du bist aber unsere Freundin. Dein Feind ist unser Feind.«
»Ich hab euch nie dazu aufgefordert, euch von Midville fernzuhalten. Weder von den Parfüms noch von seinem Erben«, erinnerte ich sie nicht zum ersten Mal, seit Benedict London und damit auch unsere Welt betreten hatte.
Es hatte nicht lang gedauert und schon war es so gut wie unmöglich geworden, eine Party oder ein Event zu besuchen, auf dem er nicht auftauchte. Ich hatte von Anfang an einen weiten Bogen um ihn geschlagen, aus vielen Gründen, aber ich hatte von meinen Freundinnen nie erwartet, mir zu folgen. Trotzdem war ich dankbar dafür, dass keine von ihnen je mit ihm in Kontakt getreten war. Das hatte ich jedoch nie gesagt, ich war nicht sonderlich gut darin, mich zu bedanken. Außerdem war es letztlich zu ihrem eigenen Besten: Typen wie Benedict bedeuteten nichts als Ärger, selbst dann, wenn sie nicht der größte Konkurrent deiner Familie waren.
»Euch sollte allerdings von ganz allein klar sein, dass keine Wangenknochen der Welt ein solches Benehmen attraktiv werden lassen können«, schob ich deswegen hinterher und erntete ein kollektives Grinsen.
Quinn lehnte sich zu mir vor und zog gekonnt die linke Augenbraue hoch. »Also sind sie dir aufgefallen.«
Ich sparte mir eine Antwort, indem ich Quinn mein Handy abnahm und einen Blick darauf warf. Es war kurz vor elf, in einer guten halben Stunde würde es anfangen. »Zahlt ihr für mich mit?«, fragte ich und stand auf. »Ich muss los.«
»Uh, richtig. Der große Tag.« Evie drückte sacht meinen Arm, eine unserer bevorzugten Verabschiedungen. Ich war im Umarmen besser als im Bedanken, das bedeutete nicht, dass ich es sonderlich gern tat. »Mach sie fertig, Chestnut.«
Sie strahlte mich so unverhohlen stolz an, dass ich ihr den Spitznamen nicht mal übel nehmen konnte. Keine Ahnung, warum genau meine Freundinnen angefangen hatten, mich mit einer Kastanie zu vergleichen, aber ich fragte lieber gar nicht erst nach.
»Viel Glück«, riefen Quinn und Penn synchron und so laut, dass sich die Leute am Nachbartisch zu ihnen umdrehten. Sie kümmerten sich nicht darum, das taten sie nie. Einer der Gründe, aus denen ich sie so gernhatte.
Ich lächelte nur, ehe ich mich in Richtung Garderobe aufmachte. Ich wusste, sie meinten es gut, doch ich brauchte kein Glück. Glück war ein Sprungbrett für jene, die nicht an die Leiter herankamen, um selbst hochzuklettern. Aber ich war groß und stark genug, und vor allem eins: bereit.
Während ich das türkisblaue Licht zurückließ und in Londons grauen Januaratem eintauchte, war ich mir so sicher damit. Meine Gedanken gehörten mir, meine Handlungen gehörten mir, mein Leben gehörte mir, ich gehörte mir. Ich wusste, wer ich war, und ich holte mir, was mir zustand.
Hier fängt es an.
2
Marigold
Das muss aufhören.
Der Gedanke bäumte sich in mir auf, ich ballte unter dem Tisch eine Hand zur Faust und kniff die Augen zusammen, als könnte ich ihn damit zerdrücken. Vergebens. Noch ehe ich blinzelte, öffnete sich mein Mund.
»Das ist der absolut beschissenste Schwachsinn, den ich jemals gehört habe.« Meine Stimme vibrierte so stark, dass sie verzerrt klang. Es wunderte mich nicht, immerhin hatte ich eine Viertelstunde lang versucht, sie zurückzuhalten. So lang hatte unser Marketingleiter die Ergebnisse unserer zielgruppenerörternden Marktforschungsstudie vorgestellt.
Er hatte aufgebauschte Wörter verwendet, aber die These, die er damit zum Ausdruck brachte, war platt: Frauen benutzen Parfüm in der Regel, um begehrenswert zu wirken.
Mr Young lehnte sich in seinem Stuhl zurück. Der Hemdkragen schnitt in seinen Hals, ich sah die pochende Schlagader darüber hervortreten. Sein Blick blieb dennoch unerträglich förmlich. Es war absurd: Werbung macht nichts anderes, als gezielt Gefühle in den Konsumierenden zu wecken, indem sie deren Sehnsüchte, Hoffnungen und Wünsche erkennt und ein Versprechen ihres Erfüllens mit dem Produkt verknüpft. Es gibt nichts Emotionaleres als Werbung. Trotzdem sprachen diese Männer darüber, als wäre es ein rein rational kalkulierbares Geschäft. Und als hätten sich seine Regeln nicht in den letzten Jahrzehnten gewandelt, dabei hatte sich so vieles in unserer Gesellschaft und dadurch auch in den Menschen verändert.
»Es ist eine faktenbasierte Tatsache …«
»Es ist sexistisch«, fiel ich ihm ins Wort und neigte mich über den Konferenztisch aus dunklem Kirschholz. »Sie können mir erzählen, was Sie wollen, aber ich versichere Ihnen, dass ein Großteil der Frauen diesen Ergebnissen vehement widersprechen würde.«
»Unsere Studien …«
»… arbeiten mit Suggestivfragen, die darauf abzielen, dass Ihnen bestätigt wird, was Sie hören wollen. Sie wollen nichts Neues lernen. Sie wollen Ihre alten, überholten Glaubenssätze rechtfertigen. Vor sich selbst und vor diesem Vorstand.« Meine Zunge stolperte über die letzten Worte, so schnell rutschten sie mir über die Lippen. Mein Verstand wisperte mir zu, dass ich es gut sein lassen sollte, aber ich konnte nicht. Denn es war eben nicht gut – es war absolut scheiße. »Und das funktioniert großartig, weil kein Mitglied dieses Vorstands Interesse daran hat, umzudenken. Das würde nämlich bedeuten, dass Sie auf andere, eventuell jüngere, in Ihren Augen unerfahrenere und – Gott bewahre – eventuell sogar weibliche Personen hören müssten. Was natürlich nicht mit Ihren Ansichten zusammenpasst. Richtig?«
Mr Young erwiderte nichts. Er starrte mich nur aus verengten Augen an, als würde er versuchen, mich mit reiner Willenskraft zu zerquetschen. Ich reckte das Kinn und ließ den Blick über die anderen am Tisch wandern. Die Männer betrachteten mich mit unverhohlen skeptischen oder, was ich schlimmer fand, gutmütig spöttischen Gesichtsausdrücken. Die anwesenden Assistentinnen sahen konzentriert auf ihre Tablets – wie so oft, wenn eine Diskussion zu hitzig wurde. Es machte mich wütend. Alles daran machte mich so wütend, dass ich am liebsten geschrien hätte. So laut, bis sie mir endlich alle richtig zuhören mussten. Mein Inneres glühte, als mein Fokus am anderen Tischende hängen blieb.
Odells Miene war verschlossen, aber ich kannte ihn gut genug, um die winzigen Schlüssellöcher zu finden. Die Falte zwischen seinen Brauen, die gerade Linie seines Mundes, die seine Wangengrübchen verschluckte, seine Finger, die zum Hemdkragen wanderten, als wäre er versucht, den obersten Knopf zu öffnen. Mein Bruder zeigte seine Wut anders als ich. Verbergen konnte er sie vor mir trotzdem nicht.
Mit einem Räuspern sah er zur Wanduhr über der Tür. »Ich denke, wir sollten dieses Thema verschieben. Für heute haben wir die wichtigsten Anliegen geklärt. Oder hat noch jemand etwas zu ergänzen?«
Ich hätte es liebend gern getan, aber ich brachte plötzlich keinen Ton mehr heraus. Nicht wegen Odells offensichtlicher Anspannung, sondern wegen dem, was mir dadurch in Erinnerung gerufen wurde. Was ich heute eigentlich vorgehabt und was ich mir gerade selbst erschwert hatte – vermutlich so sehr, dass ich die daran hängende Möglichkeit keinen Zentimeter anheben könnte.
Odells Blick blieb auf mir liegen, während sich der Raum leerte. Die Art, wie sich die Falte zwischen seinen Augen vertiefte, war ein Befehl, sitzen zu bleiben. Aus Prinzip stand ich auf und verschränkte die Arme. Erst als wir so gut wie allein waren, wandte sich mein Bruder an seine Assistentin. »Geh schon vor, okay? Ich muss hier noch kurz was besprechen.«
Ich biss die Zähne aufeinander, während Hayden den Raum verließ und mir dabei einen unangenehm mitfühlenden Blick zuwarf.
»Was?«, rutschte es mir heraus, sobald sie die Tür hinter sich zugezogen hatte. Es klang bissiger als geplant. Das war alles anders gelaufen als geplant, verdammt. Wieso hatten wir ausgerechnet heute dieses Thema besprechen müssen? Im Laufe der letzten Monate hatte ich gelernt, mich bei vielem zurückzuhalten, doch wie schaffte man das bei Dingen, die man schlicht nicht aushalten konnte?
Odell blieb ein paar Schritte vor mir stehen. Zwei Sekunden lang sah er mich prüfend an, dann runzelte er die Stirn. »Hast du etwa getrunken, bevor du hergekommen bist?«
Ganz kurz wünschte ich mir, seine Geruchsnerven wären noch nicht wieder völlig intakt. Der Gedanke war steinschwer und dunkel, ich versenkte ihn schnell in den Tiefen meines Bewusstseins. Die feine Vibration, die er dabei hinterließ, löste trotzdem eine Schamwelle in mir aus. »Nur ein Glas Sekt. Ich war brunchen.«
Odell hob einen Mundwinkel. »Klar. Ein Frühstück an einem Dienstagmorgen geht natürlich nicht ohne Alkohol.«
Es wäre mir lieber gewesen, er hätte sauer oder enttäuscht gewirkt, nicht so unendlich resigniert. Er sah sich bestätigt in etwas, das nicht stimmte. Etwas, das ich nicht war. Das war nicht fair. »Ich bin nicht betrunken«, erwiderte ich bemüht ruhig. Meine Stimme schlingerte trotzdem, als würde sie in einem Rest Wuthitze ausrutschen. Mein Herz tat das auch, es beschleunigte sofort wieder, sobald ich an die letzte halbe Stunde dachte. »Und selbst wenn ich es wäre, hätte ich immer noch mehr Verstand als diese Typen stocknüchtern. Du hättest was sagen müssen.«
»Ich wollte etwas sagen, glaub mir, aber ich habe dir versprochen, dich nicht mehr vor dem Vorstand zu unterbrechen, richtig?« Sein Blick fügte hinzu: Dabei wäre es besser für dich gewesen.
Ich verstand nicht, wie er das nicht begreifen konnte: Es ging hierbei nicht um mich. Es ging um Evergreen Empire. Darum, dass viele unserer Ansätze längst überholt waren und das bald genauso für unser Unternehmen gelten würde, wenn wir nichts daran änderten. »Du bist feige, Odell. Du kannst mir nicht erzählen, dass du es richtig findest, wenn diese alten Männer irgendwelche …«
»Marigold, jetzt sei doch mal still.«
Ich zuckte zusammen. Nicht wegen des scharfen Untertons, sondern wegen der Art, wie er meinen vollen Namen aussprach. Es hatte nur eine Person gegeben, die mich so genannt hatte – wenn sie mich hatte zurechtweisen wollen. Von allem, was Odell von unserem Vater übernommen hatte, verübelte ich ihm das am meisten. Ich hätte es ihm sagen können, vielleicht sogar müssen, aber ich tat es nie. Ich wollte nicht zugeben, dass es einen Stich in meiner Brust auslöste, wenn er diese drei Silben sagte. Und im Grunde war ich dankbar dafür, dass die Reaktion auf den leisen Schmerz jedes Mal ein sehr viel lauteres Gefühl war: Wut.
Odell holte tief Luft, senkte die Stimme. »Entschuldige. Ich will nicht streiten, schon gar nicht hier, aber dein Verhalten gerade war unmöglich.«
Meine Finger zitterten, ich drückte sie flach auf den Stoff meines Rocks. »Ich hatte recht.«
»Darum geht es doch gar nicht. Es geht um die Art, wie du auftrittst. Wie sollen sie dich ernst nehmen, wenn du dich …« Er stockte, ich lächelte grimmig.
»Was? Wenn ich mich lächerlich mache?«
Odell zwickte sich in die Nasenwurzel, ehe er den Ärmel seines karierten Jacketts hochschob und auf die Uhr blickte. »Ich habe jetzt keine Zeit dafür.«
Er ging an mir vorbei, ich drehte mich mit ihm um. »Du hast nie Zeit.«
Odell blieb stehen, wandte mir langsam den Kopf zu. Trotz des weißen Winterlichts, das durch die Fensterfront direkt in sein Gesicht fiel, wirkten seine Augen dunkler als sonst. Eine Mischung aus büroüblicher Erschöpfung und mari-üblicher Gereiztheit lag darin. »Verstehst du eigentlich, was hier momentan los ist? Unsere Zahlen stagnieren seit Monaten, und dafür gibt es keinen denkbar schlechteren Zeitpunkt. Wenn es stimmt und Midville noch dieses Jahr eine Damenduftkollektion ankündigt, werden unsere Absätze mit Sicherheit fallen. Wir müssen unsere Position auf dem Markt jetzt festigen, damit Valerie Midville und ihr arroganter Sohn gar nicht erst auf die Idee kommen, sie könnten uns gefährlich werden. Also sieh es mir nach, wenn ich keine Zeit habe, weil ich arbeite.«
»Ich will auch arbeiten, ich will …« Meine Stimme stockte, ich zögerte. Auch wenn ich das hier anders geplant hatte, würde ich jetzt nicht kneifen. Mit einem tiefen Atemzug zwang ich mich zu einem ruhigen Ton. »Ich würde gern mitkommen. In das Marketingmeeting, das heute Nachmittag ansteht. Zur Planung der künftigen Werbestrategie.«
»Woher weißt du von dem Meeting?« Seine Irritation hielt nicht lang, dann schloss er die Augen und stieß ein einzelnes Wort aus: »Emmeline.« Dafür, dass es sein liebstes war, klang es in diesem Moment ziemlich frustriert.
Ich zuckte mit den Schultern. Emmeline hatte mir nicht verboten, ihm zu verraten, dass ich diese Information von ihr hatte. Sie war einer der wenigen Menschen, die sich noch nie etwas von meinem großen Bruder hatten sagen lassen. Glücklicherweise konnte nicht mal ihre Verliebtheit etwas daran ändern. »Ich hab ein Recht darauf, zu wissen, wie wir die Strategie unseres Unternehmens ausrichten, oder nicht?«
Er wich nach hinten. »Du wirst in der Vorstandssitzung davon erfahren, sobald es dingfest ist.«
»Odell …«
»Nein.« Er schüttelte den Kopf. »Tut mir leid, aber nach diesem Auftritt kannst du nicht von mir erwarten, zu glauben, du wärst schon bereit dafür, für uns zu arbeiten.«
»Du meinst für dich.«
»Ich meine, was ich sage. Du bist ein Teil von Evergreen, und das weißt du. Aber solang du dich nicht besser im Griff hast, beschränkt sich das auf deine Anwesenheit in Vorstandsmeetings.« Seine Stimme wurde sanfter, sein Blick auch. Das war einer der seltenen Momente, wenn er sich darum bemühte, den Geschäftsführer dem großen Bruder unterzuordnen. Doch was nützte mir das? In jeder dieser Rollen nahm er mich nicht ernst. Es war nicht wichtig, ob er mich bevormundete, weil er sich um das Unternehmen sorgte oder um mich. Er würde mich nie als etwas anderes ansehen als seine kleine, chaotische, impulsive Schwester. Er würde mir nie von sich aus eine Chance geben. Ich musste sie mir nehmen und beweisen, dass ich sie verdiente.
»Und was, wenn ich keine Lust mehr darauf habe, wie ein Requisit hier rumzusitzen?«, fragte ich herausfordernd. »Wenn ich die Erbauflagen verletze, indem ich nicht mehr an den Sitzungen teilnehme, verlierst du auch alles. Dann verlieren wir alle alles.« Immerhin war das genau das, was Dad uns mit seinem Testament hinterlassen hatte: den Zwang, sowohl innerhalb von Evergreen Empire als auch im privaten Rahmen zusammenzubleiben. Bei der Verkündung hatten wir alle drei keinen Hehl daraus gemacht, wie wenig begeistert wir davon waren, aber wir hielten es – und uns – trotzdem aus.
»Das wirst du aber nicht tun«, antwortete Odell gelassen. »Ich weiß, wie wichtig dir Evergreen ist. Du wirst nicht riskieren, unser Unternehmen zu verlieren, und du würdest ihm nie bewusst schaden. Ebenso wenig wie ich. Also sorge ich dafür, dass du es nicht versehentlich tust.«
Er lächelte mir noch mal zu, schief, aber Grübchen hervorlockend. Als Kind hatte ich das geliebt. Dass ich immer erkennen konnte, ob es ein Lügenlächeln oder ein ehrliches war. Der Welt konnte er etwas vormachen, seiner Familie nicht. Mittlerweile war ich mir damit nicht mehr sicher. Ich fühlte mich seit langer Zeit von ihm betrogen.
Schweigend blieb ich zurück, während Odell aus dem Konferenzraum verschwand. Er ließ die Tür offen stehen und schloss mich doch aus. Ein seltsames Gefühl kauerte sich in meiner Brust zusammen. Das Feuer war erloschen, ich kam mir ausgekühlt und unangenehm nackt vor.
»Falls es dich tröstet: Ich fand deine Ansage gut.«
Ich fuhr herum und entdeckte Keaton auf einem Stuhl in der Ecke, halb verborgen hinter einem riesigen Bildschirm. Er hatte die Arme hinter dem Kopf verschränkt und die Beine übereinandergeschlagen. Alles daran wirkte an diesem Ort ebenso fehlplatziert wie sein Jeans-Hoodie-Sneaker-Outfit.
»Odell hat recht, und die Art, wie du sie geäußert hast, war drüber, aber im Kern war es wahr.«
Verständnislos starrte ich ihn an. Bei der Sitzung hatte er mir schräg gegenübergesessen, ich hatte gedacht, er wäre danach direkt gegangen. Keaton verhielt sich so, als wäre jede Sekunde, in der er Unternehmensluft atmen musste, ein Säuretropfen in seiner Lunge. Alles an ihm strahlte aus, wie ätzend er es hier fand. »Hast du das alles mit angehört?«
»Leider ja. Hab den richtigen Zeitpunkt verpasst, um zu gehen.« Er stand auf und schlenderte auf mich zu. »Und dann wollte ich nicht unhöflich sein und mich einmischen.«
Fast hätte ich gelacht. Keaton war es egal, ob er unhöflich war, er ging schlichtweg konsequent jeder Art von Drama aus dem Weg. »Was auch immer.« Dieser resigniert klingende Satz war so eng mit meiner Erinnerung an ihn verknüpft, dass er mir jedes Mal durch den Kopf schoss, wenn wir uns sahen. In den letzten Monaten hatte er sich etwas verändert, so wie Keaton, seit er damals verschwunden war. Was auch immer mit ihm los war.
»Dir ist das echt alles komplett egal, oder?«
»Wäre ich dann hier?« Er lächelte. Keaton hatte keine Grübchen oder andere Mimik-Schlüssellöcher, durch die ich einen Blick in sein Inneres erhaschen konnte. Ich ahnte trotzdem, dass sein Lächeln kein Zeichen echter Freude war.
»Bist du das denn?« Ich musterte ihn: die angespannten Schultern, die Finger, die an seinen Ringen drehten, die Schatten unter seinen Augen, die je nach Lichtfall die Farbe wechselten und doch seit Monaten nur blass wirkten. Der Blick daraus, der meinen mied, als fürchtete er, ich könnte etwas herauslesen, das nicht für mich bestimmt war. Es hätte mir eh nichts gebracht. Keaton war immer grandios darin gewesen, in einer Geheimsprache zu kommunizieren, die niemand übersetzen konnte. Wenn er es drauf anlegte, war er ein unlösbares Rätsel. Ich war eine gute Lügnerin, Keaton hingegen bestand aus unsagbar vielen winzigen Bruchteilwahrheiten. Was er zeigte, war echt, aber es reichte nie aus, um ein Gesamtbild zu formen. Man konnte ihn nicht vollständig verstehen. Vielleicht wollte ich das auch nur denken, weil es dieses Gefühl erträglicher machte, das sich seit geraumer Zeit in mir ausdehnte: Ich kannte Keaton mein Leben lang, aber seit seiner Rückkehr war er mir fremd.
»Mir kommt es vor, als wärst du nie ganz zurückgekommen.«
Er schüttelte den Kopf, eine seiner Haarsträhnen fiel leicht gelockt in seine Stirn. Sie waren wieder zu lang geworden. Anders als Odell dachte ich nicht, dass das ebenso wie sein gesamtes Auftreten bei den Sitzungen ein Akt der Rebellion war. Ich war sicher, dass es ihm einfach egal war, ob die Angestellten über ihn redeten oder die anderen Vorstandsmitglieder ihn mit einem Naserümpfen bedachten. Es musste so sein. Denn wenn es ihm egal gewesen war, dass er uns nach Mums Tod ohne ein Abschiedswort verlassen und über vier Jahre lang jeden Kontakt weitestgehend gemieden hatte – wenn wir ihm so verdammt egal gewesen waren –, dann musste ihm alles andere erst recht egal sein.
»Du weißt gar nichts, Mari«, erwiderte er leise. »Nicht mal, wie gut du es eigentlich hast, weil du dich aus dem ganzen Scheiß hier noch raushalten kannst.«
»Du hast nicht drüber nachgedacht, in welchen Bereich du gehen willst, oder?«
»Nein.«
Unschlüssig musterte ich ihn. Laut den Erbauflagen mussten Keaton und ich uns nach unserem jeweiligen Abschluss innerhalb von zwei Jahren für eine Abteilung entscheiden und die Arbeit darin aufnehmen. Keaton blieb damit weniger als ein Jahr. »Du hast nicht mehr viel Zeit.«
Er hob den Blick. »Keine Sorge. Ich werde euer Erbe nicht aufs Spiel setzen.«
Ich verschränkte die Arme, weil ich sie lieber nach ihm ausgestreckt hätte und wir so etwas nicht machten. Darin waren Keaton und ich uns immer ähnlich gewesen. Wir umarmten uns ungern, wir sagten uns nicht, dass wir einander liebten, manchmal, wahrscheinlich zu oft, zeigten wir es nicht mal. Aber ich wusste, dass ich es tat. Ich konnte dieser Tatsache nicht entkommen, obwohl ich es auf viele Weisen versucht hatte. Das, was meine Geschwister für mich waren, war wie ein Anker in meiner Brust. Ganz gleich, wie sehr mein Inneres im Laufe meines Lebens durchgewirbelt worden war, dieses Gefühl blieb unverändert. Trotz allem, selbst wenn ich vielleicht jemanden liebte, den es nicht mehr gab, und gleichzeitig jemanden, den ich nicht mehr kannte. Ich hätte Keaton, ohne zu zögern, eine Niere gespendet, aber mir lieber beide herausgerissen, als zuzugeben, wie sehr ich ihn jahrelang vermisst hatte. Das Echo dieses Gefühls hallte jedes Mal durch mich, wenn wir einander wie jetzt ansahen.
»Ist dir schon mal in den Sinn gekommen, dass das nicht das Einzige ist, worüber wir uns Sorgen machen?«, fragte ich stattdessen.
Er hörte eine Spur vom Gedachten heraus, ich sah es. Ein ungewohnt zarter Ausdruck legte sich über seine Züge. »Weißt du noch, als ich mit sechzehn beim Rauchen auf dem Leuchtturm ausgerutscht bin? Es hatte geregnet, und ich war ziemlich high, keine gute Mischung. Ich hab mich erst wieder gefangen, als ich direkt an der Dachkante stand.«
»Klar.« Für einen Moment hatte ich gedacht, er würde springen. Selbst aus der Ferne war mir dieser seltsame Ausdruck auf seinem Gesicht aufgefallen: die bekannte Gleichgültigkeit mit einer Prise … Neugierde. Es hatte fast überrascht gewirkt, als würde es ihn verblüffen, wie er in diese Situation gekommen war, und noch viel mehr, was sie in ihm auslöste. Dass sie es schaffte, überhaupt etwas in ihm auszulösen. Keaton war unsere ganze Kindheit über so gelassen gewesen, dass es an Langeweile gegrenzt hatte. Manchmal dachte ich, seine eigenen Gefühle irritierten ihn, sobald er sie richtig realisierte.
»Ich frag mich immer noch, was gewesen wäre, wenn ich gesprungen wäre.« Er bemerkte meinen unruhigen Blick und winkte ab. »Nicht, weil ich sterben wollte. Nur, weil es mich interessiert hätte, was passiert wäre. Ich denke oft an solche Momente. Die, in denen ich Entscheidungen getroffen hab, seien sie noch so klein. Ich kann nicht aufhören, mich zu fragen, wie mein Leben verlaufen wäre, wenn ich ab und zu andere gewählt hätte.«
Ich grub die Finger in meine Ellbogen, auch wenn ich die dünne Seide meines Blousons damit beschädigte. »In dem Fall hättest du dir die Beine gebrochen. Oder Schlimmeres.«
Er grinste verschmitzt. »Ja, vermutlich. Weißt du, warum ich es nicht getan habe?«
»Weil ein Funken Verstand in dir übrig war?«
»Weil du unten standest und mir etwas zugerufen hast. Du warst kreidebleich, dein Gesicht hat richtig geleuchtet. Ich hab nicht mal verstanden, was du geschrien hast, aber ich hab gesehen und … keine Ahnung, gespürt, dass du Angst um mich hattest. Deswegen bin ich wieder ins Haus geklettert. Deswegen würde ich das immer tun, Mari. Wegen dir und wegen Odell.« Er hob die Hand, als wollte er sie auf meine Schulter legen, ließ sie dann doch wieder fallen. Das machte er oft, seit er zurück war, und irgendwie taten diese aufgegebenen Berührungen mehr weh als jene, die er nicht mal anfing. Es war, als wären diese Impulse noch da, aber er entschied sich bewusst dagegen, ihnen nachzukommen. Er entschied sich bewusst gegen uns. »Also macht euch keine Sorgen um mich. Ich komme klar, und ich bleibe hier. Das ist alles, was zählt, richtig?«
Ist es nicht, dachte ich, doch ich schaffte es nicht, so viel Ehrlichkeit auszusprechen. Nicht, wenn er wieder nur in Rätseln sprach. »Ich versteh das nicht.«
»Dann sag ich dir jetzt das, was ich Odell auch schon gesagt habe: Das musst du nicht.« Er verstaute die Hände in der Vordertasche seines Hoodies und wich zurück. »Und was den Rest angeht: Die Auflagen sind deutlich. Eines Tages muss unser Bruder dich arbeiten lassen.«
Mir entwich ein halblautes Schnauben. Ich studierte Management Science im zweiten Jahr von insgesamt drei. Das bedeutete, ich hatte noch mindestens anderthalb Jahre vor mir, bis ich Odell mit einem Abschluss in der Hand dazu zwingen könnte, mich arbeiten zu lassen. Wenn ich mich nicht dazu entschied, zusätzlich einen Master zu machen. Aber ich wollte nicht mehr warten. Ich wollte mich jetzt in dem Unternehmen einbringen, das meine Zukunft bedeutete – damit Odell und all die anderen Männer der Führungsriege sie mir nicht kaputt machten, ehe sie überhaupt angefangen hatte.
»Bis dahin beende dein Studium, genieß dein Leben. Darin bist du doch echt gut, wie man hört.«
Wie man hört. Die drei Wörter waren schlimmer als alle anderen, die ich heute gesagt bekommen hatte. Schlimmer als Drews arrogante Schlampe, was immer noch in meinem Hinterkopf hin- und hersprang, schlimmer als Odells Marigold. Denn das Schlimmste war, dass Keaton es nicht mal böse meinte. Es lag keine Abscheu darin, keine Anklage, keine Wut oder Sorge. Es war ihm egal, was man über mich erzählte. Weil ich ihm eben wirklich egal war. Er hatte vier Jahre meines Lebens verpasst. Die entscheidenden Jahre, weil ich in ihnen entschieden hatte, wer ich sein wollte und wer ich nicht mehr sein konnte. Wenn er so oft über seine eigenen Entscheidungen nachdachte, hätte er sich dann nicht auch für meine interessieren müssen? Hätte er sich nicht fragen müssen, was mich zu dem Menschen gemacht hatte, der ich heute war? Hätte er sich nicht … irgendetwas fragen müssen, statt es einfach hinzunehmen? Ich hätte ihm diese Fragen nicht beantwortet, natürlich nicht, aber es traf mich härter als geahnt, dass er sie nicht mal stellte.
Hätte er mich richtig angesehen, hätte er womöglich etwas davon bemerkt. Doch er ging blick- und berührungslos an mir vorbei. »Du bist noch früh genug in diesem Glaskasten gefangen, glaub mir.«
Zu meinem sechsten Geburtstag hatte ich ein Puppenhaus bekommen, bestehend aus drei Stockwerken, in die man von außen hineinsehen konnte. Es hatte nur eine Puppe dafür gegeben. Olivia, zeigefingergroß, dunkelbraunes Haar und blaue Augen. Mum hatte sie mir genäht, und ich hatte mich immer gefragt, ob die Ähnlichkeit zwischen Olivia und mir beabsichtigt gewesen war. Ich hatte mich auch gefragt, warum sie keine Puppen für den Rest der Familie gemacht hatte. Ob das ein Zeichen für das Verstehen meiner Eltern gewesen war, dass ich mich oft genau so in Rosehill fühlte: allein.
Ich hatte nie gefragt, sie hätten das als Geständnis aufgefasst, über das ich eh nicht sprechen wollte. Immerhin hatte ich meine ganze Kindheit über versucht, mir nicht anmerken zu lassen, dass es mich kränkte, wenn Odell und Keaton mich nicht mitspielen ließen, wenn Dad die Bürotür vor meiner Nase schloss oder wenn ich Mum mit traurig stillem Gesicht in ihrem Atelier fand und sie meinen Nachfragen auswich. Monate nach ihrem Tod hatte ich das Puppenhaus weggeschmissen. In dem Sommer, in dem Odell längst wieder in seine Wohnung in Oxford gezogen war und Keaton gerade England verlassen hatte. Ein einsames Haus hatte mir gereicht.