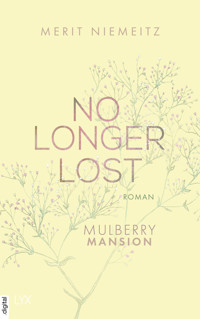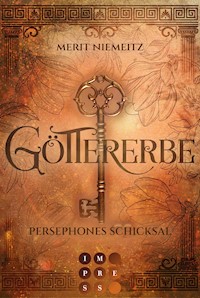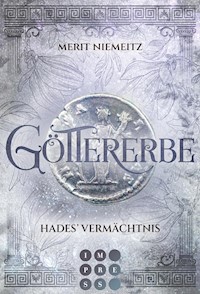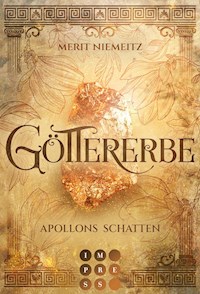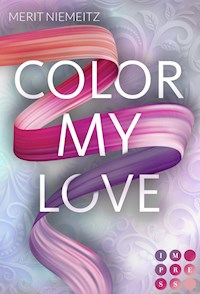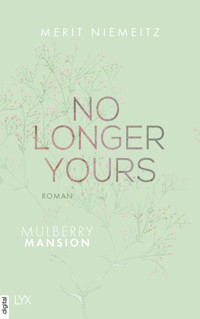
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Mulberry Mansion
- Sprache: Deutsch
Sie glaubt nicht an zweite Chancen - Bis sie ihn wiedertrifft
Avery kann ihr Glück kaum fassen: Sie hat tatsächlich eins der begehrten Zimmer der Mulberry Mansion ergattert! In einem Wohnprojekt der Universität sollen Studierende die alte englische Villa wieder instand setzen. Aber Averys Freude wird jäh gedämpft, als sie feststellen muss, dass einer ihrer Mitbewohner kein anderer ist als ihr Ex-Freund Eden, der ihr vor zwei Jahren beim Abschlussball das Herz brach. Aus dem warmherzigen Jungen von damals ist ein verschlossener junger Mann geworden, der alle auf Abstand hält. Doch während sie gemeinsam die Mulberry Mansion renovieren, kommen plötzlich Gefühle hoch, über die Avery eigentlich längst hinweg war, oder etwa nicht?
"Die Geschichte von Avery und Eden tut auf die beste Weise weh und gleichzeitig so, so gut: Was Merit hier erschaffen hat, ist einer der bewegendsten und authentischsten New-Adult-Romane, die ich je lesen durfte." LENA KIEFER, SPIEGEL-Bestseller-Autorin
Band 1 der New-Adult-Reihe von Merit Niemeitz, der großen Entdeckung beim LYX-Pitch
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 690
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhalt
Titel
Zu diesem Buch
Leser:innenhinweis
Widmung
Playlist
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
32. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
Epilog
Danksagung
Die Autorin
Die Romane von Merit Niemeitz bei LYX
Impressum
Merit Niemeitz
No Longer Yours
MULBERRY MANSION
Roman
Zu diesem Buch
Avery braucht dringend Abstand von allem, besonders von ihrer Familie. Deshalb kann sie ihr Glück kaum fassen, als sie an die Windsbury University wechseln darf – und zudem noch eins der begehrten Zimmer in der Mulberry Mansion erhält. In einem Wohnprojekt der Universität sollen Studierende das alte englische Herrenhaus wieder instand setzen. Die Jurastudentin ist sofort von der Villa fasziniert, von ihrer efeuberankten Fassade, dem verwunschenen Garten und der Bibliothek im Schuppen. Auch mit ihren Mitbewohner:innen versteht sie sich auf Anhieb gut – bis sie dem letzten im Bunde begegnet: ihrem Ex-Freund Eden. Eden, ihre erste große Liebe, der sie nach dem Tod ihres Vaters tröstete. Eden, der sich vor zwei Jahren ohne Grund beim Abschlussball von ihr trennte. Eden, der ihr Herz trotz allem immer noch schneller schlagen lässt. Doch aus dem warmherzigen Jungen von damals ist ein verschlossener junger Mann geworden, der alle auf Abstand hält. Obwohl sie Eden nicht verzeihen kann, dass er ihr Herz in tausend Stücke zerbrochen hat, kommen bei der gemeinsamen Renovierung der Mulberry Mansion Gefühle in Avery hoch, über die sie doch eigentlich längst hinweg war …
Liebe Leser:innen,
dieses Buch enthält potenziell triggernde Inhalte. Deshalb findet ihr hier eine Triggerwarnung.
Achtung: Diese enthält Spoiler für das gesamte Buch!
Wir wünschen uns für euch alle das bestmögliche Leseerlebnis.
Eure Merit und euer LYX-Verlag
Für Silja.Für immer.
Playlist
September Skies – Benjamin Amaru
when was it over? – Sasha Alex Sloan feat. Sam Hunt
In My Head – Maisie Peters
From Eden – Hozier
supposed to – BLÜ EYES
I miss you, I’m sorry – Gracie Abrams
I’m Not Yours – Angus & Julia Stone
Green Light – Lorde
Middle of My Mind – Tom Rosenthal
In And Out of Love – Oh Wonder
Nicest Thing – Kate Nash
Back to You – Selena Gomez
Light Years – The National
Still – AVEC
Love You Twice – Lilla Vargen
I Lied – Lord Huron feat. Allison Ponthier
Anyway – Noah Kahan
Now & Then – Lily Kershaw feat. Goody Grace
A Little Closer – FINNEAS
Changes – Langorne Slim & The Law
Die Mulberry Mansion sucht dich!
Gemeinsam mit der Visionary Housing Foundation rufen wir unsere Studierenden dazu auf, Teil eines einzigartigen Wohnprojekts zu werden! Die Familie Conteville – eines der ältesten Adelsgeschlechter Englands – hat ihre ehemaligen Nebenwohnsitze der VHF gestiftet, um aus einem Stück ihrer Vergangenheit eine Zukunft für alle zu schaffen.
Die Villen werden jeweils einer nahe gelegenen Universität zur Verfügung gestellt, um langfristig zu günstigem Wohnraum für Studierende aufgebaut zu werden.
Eine dieser Villen ist die Mulberry Mansion, die sich im Einzugsbereich unserer Universität befindet. Mit großer Freude können wir daher verkünden, dass unsere Studierenden die Möglichkeit haben, sich für einen Wohnplatz in diesem altehrwürdigen Anwesen zu bewerben! Erbaut im frühen 19. Jahrhundert, begeistert die Villa seit jeher Architektur- und Geschichtsvernarrte im ganzen Land. Nun soll dem seit Langem leer stehenden Haus wieder Leben und Liebe eingehaucht werden. Hierfür wird die erste Generation studierender Bewohner:innen eingeladen, zu einem geringen Mietpreis einzuziehen und dem geschichtsträchtigen Haus mit vereinten Kräften zu neuem Glanz zu verhelfen.
Am Ende des kommenden Wintersemesters wird eine von der Stiftung gestellte Jury alle Häuser und ihre Bewohner:innen besuchen und die Villa mit den beachtlichsten Fortschritten zusätzlich mit einem Preisgeld küren, das zum weiteren Auf- und Ausbau genutzt werden soll.*
Du wolltest schon immer an etwas Bleibendem mitarbeiten? Du möchtest dich in einem Team nicht nur handwerklich, sondern auch sozial einbringen und bist davon überzeugt, dafür genau die richtigen Fähigkeiten mitzubringen? Dann bewirb dich jetzt, und vielleicht kannst du schon bald dazu beitragen, aus diesem besonderen Haus ein Zuhause zu machen. Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
Windsbury University Windsbury, England
* Weitere Details der Wettbewerbs- sowie der Bewerbungsbedingungen können den Anlagen entnommen werden.
1. Kapitel
AVERY
Neuanfänge hatten verschiedene Gesichter.
Das konnte zum Beispiel ein Zugticket in eine fremde Stadt sein, die fern von allem lag, was man kannte. Vielleicht ein Arbeitsvertrag für eine Stelle, die einen Sprung ins kalte Wasser bedeutete. Oder auch ein Karton mit Sachen von einem Menschen, der so sehr Teil von einem geworden war, dass man ohne ihn fürs Erste auf dem schmalen Grat zwischen Alleinsein und Einsamkeit balancieren würde.
Das Gesicht meines Neuanfangs war eine doppelflügelige Holztür, deren blassblaue Farbe schuppig abblätterte. Der Griff war golden und wirkte rostig, ebenso wie die Beschläge, die das aufgesprungene Holz im Rahmen hielten. Der steinerne Vorsprung, der über die oberste der drei Eingangsstufen ragte, war überwuchert von abblühendem Blauregen. An der Hausfassade wechselte er sich mit Efeu ab, der einen großen Teil der rotbraunen Steine bedeckte, aus denen das riesige Haus gebaut war.
Nicht Haus, korrigierte ich mich innerlich sofort. Nicht umsonst hieß dieses Gebäude Mansion – es war wahrhaftig eine Villa. Und zwar die schönste, die ich je gesehen hatte.
Sie war dreistöckig, wobei ich vermutete, dass das oberste Stockwerk einen Dachboden beherbergte. In jeder Etage gab es mehrere hohe Fenster, die meisten von Vorhängen verhüllt. Im ersten Stock waren zwei Erkerausbuchtungen zu sehen, genau so platziert, als hätte der Architekt dem Haus eigene Augen geben wollen. Vielleicht fühlte ich mich deswegen so beobachtet, seit ich das Anwesen betreten hatte.
Abermals warf ich einen Blick über meine Schulter. Auf dem Kiesweg, der zurück zum bronzefarbenen Tor führte, das das Gelände von der Straße abschnitt, war niemand zu sehen. In der Einfahrt neben dem Eingang standen allerdings mehrere Autos, und unter einem der Bäume lehnten ein paar Fahrräder.
Ich hatte die buschigen Kronen schon von Weitem gesehen. Sie ragten als stumme Wächter hoch über das Gatter hinaus, zehn Stück insgesamt. Ich hatte sie gezählt, während ich über den Weg gelaufen war, der auf die Villa zuführte. Ein unebener Pfad, über den sich von beiden Seiten knöchelhohes Gras hermachte. Um die Baumstämme herum lagen ein paar schwarzrote Früchte, an den Ästen selbst hingen keine mehr.
Es war bereits Mitte September, und somit war die Erntezeit für Maulbeeren vorbei. Ich wusste das, weil ich mir während des Packens Dokumentationen über die süßsäuerlichen Beeren angesehen hatte, denen das Herrenhaus seinen Namen verdankte. Vielleicht, weil ich die Ablenkung benötigt hatte, vielleicht, weil ich noch viel dringender das Gefühl gebraucht hatte, irgendetwas über mein neues Zuhause zu wissen, ehe ich herkam.
Denn das war diese Villa von heute an.
Die Mulberry Mansion war mein neues Zuhause.
Es war einige Monate her, dass ich in meiner Uni über einen Flyer-Aushang der Windsbury University gestolpert war. Werde Teil eines einzigartigen Projekts hatte in der Überschrift gestanden. Darunter war das Foto einer Villa abgebildet, die aussah, als wäre sie das Set eines altmodischen Gruselfilms. Das windschiefe Dach, die schmalen Kaminfinger, die aus ihm emporschossen, die geschwungenen Fenster, die efeuumrankte Fassade … Bei dem Anblick hatte sich etwas tief in mir geregt, doch ich hatte es ignoriert und die Ausschreibung fast wieder vergessen. Erst ein paar Wochen später, als das Fundament meines Lebens zerbröckelte, suchte ich online nach dem Wohnprojekt.
Ich überflog den Artikel nur kurz, ehe ich auf den Button klickte, der zur Bewerbung führte. Mein Kopf schwirrte von einer halben Flasche Wein, dazwischen hingen die Fetzen des letzten Gesprächs mit meiner Schwester und darüber – leuchtend rot und grell – nur ein Gedanke: Weg. Weg, weg, weg.
Vielleicht dachte ich nicht einmal darüber nach, was es für Konsequenzen haben würde, wenn ich tatsächlich angenommen wurde. Doch vor rund zwei Monaten war die Zusage in mein E-Mail-Postfach geflattert, und dann war alles ganz schnell gegangen. Mit der Annahme beim Wohnprojekt wurde gleichzeitig der Antrag auf Universitätswechsel genehmigt, danach musste ich nur noch mein Wohnheimzimmer kündigen, mich ummelden und die paar Menschen verabschieden, die ich ins Herz geschlossen hatte. Ich hatte mein gesamtes Leben in Redcar verbracht, dann ein Jahr an der nahe gelegenen Teesside University studiert. Es hätte mir schwerer fallen müssen, fortzugehen. Aber das, was mich hielt, war weniger als das, was mich wegdrückte.
Und jetzt war ich hier. An einem Ort, den ich seit Jahren immer wieder in meinen Gedanken besucht hatte – aber nie so. Nie allein. Immer … mit ihm.
Ich verdrängte den Gedanken zum wiederholten Mal. Ein Teil von mir hatte gehofft, er würde sich auflösen, sobald ich es geschafft hatte, Windsbury und die Mulberry Mansion zu erreichen. Als würde ab da alles irgendwie von selbst laufen.
Dennoch stand ich seit zehn Minuten vor der Eingangstür und schaffte es nicht, mich zu rühren. Ich hätte nur die Hand heben müssen, um den goldenen Klingelknopf zu betätigen, der in die Mauer eingelassen war. Stattdessen umklammerte ich die Riemen meines Rucksacks fester, legte den Kopf in den Nacken und atmete durch.
Es war später Nachmittag, und die Sonne kroch bereits auf den Wald zu, der hinter dem Anwesen lag. Orangerote Schlieren zogen sich über das Herbstblau. An meinen Kleidern haftete der Geruch der mehrstündigen Busfahrt, die ich hinter mir hatte. Kalter Rauch von den Pausen-Zigaretten meines Sitznachbars, das Plastik der Sitzbezüge, abgestandene Luft, die nach Schweiß, Schlaf und Benzin gleichermaßen schmeckte. So muss Einsamkeit riechen, hatte ich vorhin gedacht, als ich mit dem Kopf gegen die Scheibe gelehnt eingedöst war.
Jetzt wurde sie überdeckt vom letzten Duft des Blauregens, der sich mit der Herbstluft und all dem Grün um mich herum vermengte. Ganz leicht darunter konnte ich den Geruch der Villa erahnen – ausgekühlter Stein, altes Holz. Ich versuchte, diese Kombination als Zuhause in mir abzuspeichern. Wünschte, ich könnte den anderen, der dieses Etikett trug, verdrängen. Vanilleseife, Meersalz, Kamillentee.
Meine Augen begannen sofort zu pochen, und ich riss sie auf. Erneut fokussierte ich die morsch wirkende Eingangstür mit der blätternden Farbe. Flieder-trifft-Veilchen, hätte Lexi dazu gesagt. Es kribbelte in meinen Fingern, ihr ein Foto zu schicken, aber als ich an unseren Chat dachte, flimmerte ihre letzte Nachricht wieder vor meinen Augen.
Du verlässt nicht wirklich die Stadt, ohne ein Wort zu sagen, oder? Du weißt genau, wie weh du ihr damit tust.
Erhalten hatte ich die Nachricht vor ein paar Tagen und danach jede Minute damit gerechnet, Lexi vor meiner Zimmertür zu finden. Aber sie kam nicht. Was kam und nicht wieder ging, war das Echo dieser Nachricht. Dreimal hatte ich eine Antwort getippt, immer etwas in Richtung wie: Sei nicht so dramatisch, Alexandra.
Lexi hasste ihren vollen Namen, ebenso sehr wie sie es hasste, wenn ich zumachte und gefühlskalt wurde. Ich war gut darin. Es war keine Absicht, es passierte einfach: Wenn mein Inneres vor Gefühlen überquoll, dann machte etwas in mir die Grenzen dicht, sodass nichts davon mehr nach außen drang.
Ich war nicht immer so gewesen. Meine Mutter sagte oft, als Kind hätte ich mein Herz auf der Zunge getragen. Wenn Lexi und ich früher gestritten hatten, dann hatten wir einander derart angeschrien, dass wir tagelang heiser gewesen waren. Später hatte ich gelernt, dass es manchmal klüger war, seine Gefühle herunterschlucken. Und vor rund drei Jahren hatte ich mein ganzes Herz verschluckt, weil es so sehr auf meiner Zunge angeschwollen war, dass ich keine Luft mehr bekommen hatte. Seitdem schrie ich nur noch innerlich.
Diese Nachricht hätte Lexi wütender werden lassen als jede konfrontative Aussage. Ich hatte sie nicht abgeschickt, ebenso wenig wie die Antwort, die ich zwar gedacht, aber niemals niedergeschrieben hätte: Ihr habt mir zuerst wehgetan.
Beides hätte sie dazu gebracht, das Gespräch weiterzuführen – und das war keine Option für mich. Es gab nichts mehr zu sagen. Ein Neuanfang brauchte nicht nur ein passendes Gesicht, sondern vor allem einen klaren Cut.
Neue Stadt, neue Universität, neue Haustür.
Ich straffte die Schultern und hob die Hand, doch bevor ich klingeln konnte, flog die Tür auf.
Die junge Frau prallte fast gegen mich. Im letzten Moment bemerkte sie mich und stoppte in der Bewegung, sodass die Pflanze in ihren Armen kurz in ihr Gesicht gedrückt wurde.
»Oh«, sagte sie atemlos und musterte mich irritiert, sobald sie es wieder aus dem Geäst befreit hatte.
Sie trug ein gestreiftes Shirt und darüber eine weitgeschnittene, dunkle Latzhose. Ihr schwarzes Haar war mit einem pastellfarbenen Band hochgebunden. Zuckerwatte-trifft-Pfingstrose, wisperte Lexis Stimme in meinem Kopf, ehe ich sie hastig verscheuchte und mich auf die Fremde vor mir konzentrierte.
Ihre grünen Augen weiteten sich unter meinem Anblick, dabei bestand ihr ovales Gesicht sowieso fast nur aus ihnen. »Bist du Avery?«
»Schätze schon.« Ich rang mir ein Lächeln ab und versuchte, die Anspannung aus meinen Zügen zu vertreiben. Erste Eindrücke waren nicht meine Stärke, aber vielleicht konnte ich ja auch damit hier neu anfangen.
Keine Ahnung, warum es mich so überforderte, sie zu sehen. Mir war gesagt worden, dass die anderen Bewohner und Bewohnerinnen schon seit ein paar Wochen hier waren. Soweit ich wusste, hatten sie, anders als ich, bereits in Windsbury gewohnt, sodass niemand von ihnen erst einen größeren Umzug organisieren musste.
»Wir hatten dich erst morgen erwartet.«
»Ich weiß. Ich habe mich mit der Auszugsfrist beim Wohnheim verschätzt und dachte, ich komme eher. Ich wollte anrufen, aber ich war mir nicht sicher, wen, und … tut mir leid, wenn das irgendwelche Umstände bereitet.« Ich verzog den Mund, weil ich selbst bemerkte, wie formell ich schon wieder wurde.
Doch sie lächelte nur. »Quatsch. Ich hätte dich einfach gern vorbereiteter willkommen geheißen. Aber je früher du hier bist, desto besser.« Vorsichtig stellte sie den Tontopf ab, in dem die vertrockneten Reste einer Rosenstaude standen. Sie folgte meinem Blick und seufzte. »Meine Schuld. Ich hab das arme Ding vor einer Woche im Vorratsraum vergessen, als ich nach einem Untertopf gesucht habe. Ich wollte sie gerade heimlich beerdigen, bevor Maxton etwas davon mitbekommt.«
»Maxton?«
Sie nickte und zupfte ein Blütenblatt aus dem Topf, das sofort zerbröselte. Bedauernd ließ sie es auf die Stufe zwischen uns rieseln. »Unser Gartenjunge. Er ist immer so unfassbar gelassen, aber wenn es um Pflanzen geht, wird er richtig streng.« Sie klopfte die Hände an der Latzhose ab und sah mich an. »Wie stehst du zu Umarmungen, Avery?«
Unsicher erwiderte ich ihren forschen Blick. »In Maßen finde ich sie ganz nett?«
»Klasse.« Sie lächelte breit, ehe sie sich über die Pflanze beugte und mich in die Arme schloss. So innig, dass ich mich irgendwie nicht einmal versteifen konnte. Ihr Haar roch nach Honig, ihre Stimme in meinem Ohr klang ähnlich golden und samten. »Ich bin May. Es freut mich so, dass du endlich da bist. Ohne dich hat es sich die letzten Wochen noch nicht richtig angefühlt.«
Steif tätschelte ich ihren Rücken. Das hier war eine wenig maßvolle Umarmung, aber etwas ließ mich ahnen, dass May keine Freundin von halben Sachen war. Ihre Herzlichkeit war so greifbar, dass ich eher das Gefühl hatte, eine alte Freundin wiederzusehen, als eine völlig Fremde kennenzulernen. Und immerhin würde ich mit dieser Frau – und sechs anderen Menschen – von heute an ziemlich viel Zeit verbringen.
Also erwiderte ich die Umarmung, bis ich den beißenden Geruch wahrnahm, der hinter ihr aus der geöffneten Tür kroch. »Es riecht angebrannt.«
May löste sich von mir und schnupperte. »Verdammt, du hast recht. Die Scones.« Sie drehte sich um und legte die Hände als Trichter um den Mund. »Willow?«, rief sie laut ins Haus. Als keine Antwort kam, seufzte sie unterdrückt. »Wieder mein Fehler. Ich hatte sie gebeten, ein Auge auf den Ofen zu haben.«
Mit langen Schritten hechtete sie über die Türschwelle und verschwand in der Villa. Ich blieb einen Moment unsicher stehen, dann schob ich die verstorbene Pflanze etwas beiseite, griff nach meiner zweiten Tasche und folgte ihr.
Zwei Schritte hinein, dann blieb ich wie angewurzelt stehen. Für ein paar Sekunden stand ich hinter der Schwelle und starrte in das weite Foyer. Am Ende der Eingangshalle bauten sich zwei dunkle Holztreppen auf, zwischen ihren Füßen lag eine Tür, die vermutlich in den Keller hinabführte. Allein dieser Anblick war so imposant, dass ich mich davon zugleich angezogen und eingeschüchtert fühlte.
Im Vorbeigehen ließ ich den Blick über die mit Schnitzereien verzierten Geländer wandern, ehe ich nach links bog. Immer dem Geruch angekokelten Gebäcks nach. Darunter konnte ich trotzdem wahrnehmen, wie das Haus roch: so groß und alt und … verlassen. Ein drückendes Gefühl machte sich in mir breit, eine Art Heimweh, die ich nicht verstand.
Noch während ich das erste Mal durch die Villa lief, wusste ich, dass ich mich später an nichts davon genau würde erinnern können. Es war zu viel, um es als Ganzes aufnehmen zu können. Die Mulberry Mansion zu betreten fühlte sich an, als würde ich einen Granatapfel aufspalten und auseinanderklappen. Da waren so viele winzige, glänzende Kerne, die sich innerhalb von Sekunden vor mir auffächerten.
Das Innenleben des Hauses zersetzte sich vor meinen Augen in seine Details. Etliche Mosaikbildfetzen, die an mir vorbeirauschten: Tapeten mit auffälligen Musterungen in gedeckten Farben, dunkel gestrichene Wände, dazwischen aufwendig geschnitzte Holzvertäfelungen und Wandlampen mit fast blinden Glasschirmen und orangestichigem Licht. Eine Steinbüste mit halbem Kopf, taillengroße Vasen mit getrocknetem Weizen darin, eine geöffnete Sitzbank, aus der mottenzerfressene Stoffe hervorquollen. Ein Chaos aus Besonderheiten.
Es war alles ein bisschen verstaubt, das Licht dämmrig, aber trotzdem sah ich es schon in diesem Moment: wie schön und besonders dieses Haus einmal gewesen war. Und wie es wieder werden könnte, wenn wir uns Mühe gaben. Ein dumpfes Kribbeln der Vorfreude breitete sich unter meiner Müdigkeit und Anspannung aus. Das hier war einer dieser Orte, die aus so viel mehr als aus Steinen, Lehm und Holz bestanden. Da lag etwas Helles, Glänzendes, Sternenstaubähnliches unter der Oberfläche, etwas, das eher einer Energie entsprang als einem Material. Man musste nur den Schmutz abkratzen, den die jahrelange Einsamkeit hinterlassen hatte.
Ich fand May in der großen Wohnküche, wo sie hustend über einem Blech schwarzer Teigklumpen stand. Feiner Rauch stieg wolkenweise aus dem geöffneten Ofen und blieb über dem Herd hängen.
Mays Gesichtsausdruck schwankte zwischen Unzufriedenheit und Resignation. Mit spitzen Fingern nahm sie eins der Gebäckstücke und betrachtete es kurz, ehe sie es zurück aufs Blech fallen ließ. Der harte Ton des Aufpralls löschte jeden Funken Hoffnung, dass das Zeug essbar war.
»Das sind jetzt eher Stones als Scones. Du isst nicht zufällig gern Steine?«, fragte sie mich höflich.
Bedauernd schüttelte ich den Kopf. »Nur an Feiertagen.«
»Ich vermute, man könnte sie getrost bis Weihnachten hier rumliegen lassen, ohne dass sie ihre Form verändern.«
Ich musste grinsen und zerrte mir den schweren Rucksack von den Schultern. Sofort setzte ein sachtes Pochen zwischen meinen Nackenwirbeln ein. Morgen früh würden mir vermutlich sämtliche Muskeln meines Körpers wehtun. Ich lehnte den Rucksack neben die Reisetasche an die Wand, dann sah ich mich interessiert um. Der Küchenboden war mit blassblau geblümten Fliesen ausgelegt, von denen einige gesprungen waren. Eine Wand war mit einer Küchenzeile ausgestattet: ein großer Herd mit acht Platten, eine Spüle mit rostendem Becken, eine Arbeitsplatte, deren Holzmaserung durch Brandflecke ergänzt wurde. Die Wand darüber war apricotfarben gestrichen und an etlichen Stellen durch Fettspritzer beschmutzt.
Es hatte etwas von einer dieser Landhausküchen aus einem der Kataloge, die meine Mutter so gern las. Vielleicht dachte ich das aber auch nur, weil ich bereits auf den ersten Blick drei Vasen mit herbstlichen Wildblumen entdeckte und weil aus dem Kastenradio neben dem Fenster ein blechern klingendes Lied aus den Sechzigern ertönte.
Mays Haar stieß mehrmals an herabhängende Stangen von Knoblauch und Peperoni, während sie mit einem Topflappen über dem Blech herumwedelte. Ich ging zum Fenster, das hinter dem Küchentisch lag und von den Zweigen eines Zwetschgenbaums verdeckt wurde. Kaum dass ich es einen Spalt geöffnet hatte, drängten sich die Äste herein, als hätten sie ewig auf Einlass gewartet. May warf mir einen dankbaren Blick zu, als die frische Luft den Brandgeruch durchbrach.
»Was stinkt hier so?«, fragte jemand vom Türrahmen. Eine Frau mit kinnlangem Haar war darin aufgetaucht. Sie trug eine runde Drahtbrille und über ihren Kleidern eine Schürze, die mit Farbspritzern besprenkelt war. Ein paar davon waren auch auf ihren bronzeschimmernden Wangen zu sehen.
May deutete wortlos auf das dampfende Blech, die Frau zog ihre markanten Augenbrauen hoch. »Ich dachte, Willow behält den Ofen im Blick.«
May seufzte noch einmal. »Schon klar, das war mein Fehler.« Sie sahen einander kurz an und grinsten schief.
Dann schnupperte das Mädchen in Richtung des Blechs, ehe es die Nase rümpfte. »Tja. Schätze, für die erbarmt sich nicht einmal mehr Helen. Und das heißt schon was.« Ihr Grinsen wurde breiter, bis sie den Kopf drehte und mich bemerkte. »Huch, stehst du da schon lang?«
»Nicht lang. Ich bin gerade angekommen. Avery, hi.« Unsicher, wie ich sie begrüßen sollte, winkte ich in ihre Richtung.
Sie beobachtete es belustigt, dann nickte sie mir zu. »Sienna. Freut mich, dass du endlich da bist. Wir können jede Hand gebrauchen. Eigentlich nehme ich sogar deine Füße. Und all deine anderen Gliedmaßen.« Sie machte einen Schritt auf mich zu und hob abschätzend die Hände, als wollte sie mich vermessen. »Oh, klasse. Du hast eine schlanke Taille. Du könntest in diesen verdammten Kamin passen.«
»Wie …?«, setzte ich perplex an, aber May unterbrach mich mit einem Stöhnen.
»Lassen wir sie erst einmal ankommen, bevor wir sie als lebendige Putzbürste benutzen. Sonst haut sie uns direkt wieder ab.« Sie kam zu mir und legte mir eine Hand auf die Schulter. »Komm, ich stelle dir die anderen vor.«
Wir verließen das Haus über die Veranda, die an den riesigen Wohnraum angrenzte. Schon als wir diesen durchquerten, wusste ich, dass ich mich hier wohlfühlen würde. Er war zwar viel zu groß für ein einziges Zimmer, aber das Zusammenspiel aus altmodischen Samtmöbeln, einem Klavier samt Hocker, tannengrünen Wänden und einem Backsteinkamin erzeugte sofort das Gefühl von Gemütlichkeit in mir.
Und während ich noch dabei war, diesen Eindruck abzuspeichern, eröffnete sich die Rückseite des Anwesens vor uns – und ich blieb erneut ruckartig stehen. Der Garten war … es passte in kein Wort, was er war.
Mir war nicht bewusst gewesen, wie groß das Gelände war, das zur Villa gehörte, und ich hätte mir den Garten niemals so vorgestellt: verwildert und verwunschen, ein weitläufiges Dickicht aus Geäst und allerlei Farbtönen.
May hielt ebenfalls kurz inne, direkt zwischen den Verandapfosten, die von Kletterrosen bewachsen waren. »Unglaublich, oder? Als hätte man ein Bilderbuch aufgeschlagen.«
»Absolut«, erwiderte ich und hörte selbst, wie überfordert es klang. Das hier war schön. So schön, dass ich am liebsten meine Kamera aus dem Rucksack geholt und versucht hätte, den Anblick festzuhalten. Ich war mir sicher, morgen früh würde der Garten nicht mehr genau so aussehen – weil er viel zu lebendig war, um im Stillstand zu verharren.
May lächelte und wies mir, ihr zu folgen. Direkt hinein in ein Nest aus Blütenduft und Blätterrauschen. Ich verstand nicht viel von Pflanzen, aber hier musste es mehrere Hundert verschiedene Arten geben. Es roch so grün und satt, nach Blättern, Blüten und dem Harz des angrenzenden Waldes. Die letzten Reste der Sonne legten das knöchelhohe Gras zu unseren Füßen in Flammen. Trotz der herbstlichen Temperaturen entdeckte ich etliche Spätblüher und bemühte mich darum, sie nicht niederzutrampeln. Ab und zu blitzte etwas hinter dem Grün auf: ein paar Statuen aus hellem Stein, ein verwitterter Pavillon, eine zerbröckelt wirkende Mauer, ein Schuppen mit grasüberwachsenem Dach.
Im ganzen Garten erkannte ich kein System, keine bewusst angelegten Beete oder Pfade. Alles wirkte so, als hätte die Natur die Gestaltung vor Jahrzehnten wieder übernommen. Und vermutlich war ja genau das auch der Fall.
May redete den ganzen Weg über, aber ich war schon damit überfordert, ihren Schritten zu folgen, bei ihren Worten versuchte ich es gar nicht erst. Sie bewegte sich so zielstrebig durch den Garten, als wüsste sie genau, hinter welchem Baum wir die anderen finden würden.
Was anscheinend sogar stimmte, denn als wir einen knorrigen Weidentunnel verließen, ragten zwei Apfelbäume vor uns in die Höhe. Jemand – ich vermutete, ein Mann – stand weit oben auf einer Holzleiter. Sein Kopf war in der Baumkrone verschwunden, sodass wir nur seine Beine in einer dunklen Jeans sehen konnten. Obwohl es kaum mehr als fünfzehn Grad waren, trug er keine Schuhe. Seine Zehen schimmerten bläulich, so wie die Glockenblumen, die um die Füße der Leiter herum wuchsen.
Ab und zu ächzte der Baum auf, und ein Ast segelte zu Boden. Ich wich einem von ihnen gerade so aus, ehe er mit einem satten Geräusch im Gras versank und einige Blumen abknicken ließ. Ein paar rote Äpfel lagen ringsherum, als hätte der Baum sie in einem Schutzreflex abgeworfen. Dabei war auch die Erntezeit für dieses Obst eigentlich schon vorüber. Dieser Herbst war zwar mild, aber dennoch spürte man mit jedem Atemzug, dass der Sommer verblasst war.
»Maxton!«, rief May durch ihre Trichterhände.
Er schien uns nicht zu hören. Statt einer Antwort ließ er uns einen weiteren morschen Baumarm zukommen. Er verfehlte Mays Fuß knapp, sie sprang hastig einen Schritt zurück.
Ehe sie erneut rufen konnte, schoben sich die tief hängenden Äste des zweiten Baums auseinander. Eine junge Frau tauchte dahinter auf und kam auf uns zu. Sie hielt das Kerngehäuse eines überreifen Apfels in der Hand und kaute, während ihr Blick von May zu mir wanderte.
»Besuch?«, fragte sie mit vollem Mund und strich sich mit einer Hand die wilden Locken aus dem Gesicht. Das strahlende Goldblond stand im extremen Kontrast zu ihren tiefbraunen Augen. Sie trug Sneaker, Leggins und einen übergroßen Sweater, der ihre langen Beine betonte. Heiß, dachte ich im ersten Moment. Sie ist heiß, ohne es darauf anzulegen.
»Mitbewohnerin«, korrigierte May mit erhobener Stimme, um den Krach über uns zu übertönen. »Avery – Willow. Willow – Avery.« Sie lächelte mir zu. »Wenn du Willow mal suchst und sie tatsächlich hier ist, dann findest du sie mit neunzig Prozent Wahrscheinlichkeit in der Nähe dieser Beine.« May deutete auf den unteren Teil des Menschen, der auf der Leiter stand, eine Stufe höher jetzt. Er hatte die Knie angewinkelt, um das Gleichgewicht zu halten. Dennoch wankte sein Körper leicht, während das Geäst über uns knarrend keuchte.
Willow grinste, nicht im Geringsten verlegen wirkend. »In den wenigen anderen Fällen findest du mich in meinem Zimmer, wo ich mich im Kleiderschrank vor May verstecke.« Sie zwinkerte mir zu, dann ging sie auf die Leiter zu. Ohne Vorwarnung streckte sie sich und zwickte dem Typen in die Ferse. Er zuckte zusammen und trat nach hinten aus, was sie mit einem Lachen quittierte.
»Verdammt, Willow«, ertönte eine dumpfe Stimme von oben, dann begann er, hinabzusteigen.
Willow begegnete meinem besorgten Blick mit einem Schulterzucken. »Wenn Maxton in seiner Pflanzenwelt abtaucht, schaltet er auf Durchzug. Ich hätte auch einen Apfel nach ihm werfen können, aber das fand er beim letzten Mal gar nicht witzig.«
Im nächsten Moment hatte Maxton festen Boden erreicht und drehte sich zu ihr um. Er wirkte nicht einmal genervt, eher tief resigniert. »Eines Tages verbuddle ich dich im Gemüsebeet.«
Es brauchte nur ein paar Sekunden, dann erkannte ich, was May vorhin gemeint hatte: Maxton wirkte tatsächlich durch und durch gelassen. Alles an ihm strahlte eine fast greifbare Ruhe aus. Er war groß, sicher eins fünfundneunzig, sein Körperbau eher schmal als muskulös. Seine Haut war leicht gebräunt und das wirre, etwas zu lange Haar kastanienbraun, was seine hellblauen Augen betonte. An seiner Schläfe saßen einige Leberflecken und zwei weitere im rechten Mundwinkel, den er gerade ganz sacht anhob.
Willow grinste zu ihm auf und tätschelte seinen nackten Unterarm. Ebenso wenig wie Schuhe schien er eine Jacke zu benötigen. »Dann weiß ich wenigstens, dass du mich täglich besuchst. Fairer Deal.«
Mehr als diesen Moment brauchte es nicht, und ich war mir sicher, dass sie sich schon länger als ein paar Monate kannten. Die Verbundenheit und Zuneigung zwischen ihnen war so spürbar, dass meine Nervosität von ganz allein abflachte.
Zumindest, bis May sich räusperte und damit die Aufmerksamkeit auf uns zog. »Maxton, das ist Avery. Unsere letzte Mitbewohnerin.«
Da Maxton in einer Hand noch die Säge hielt, verzichtete ich erneut auf ein formelles Händeschütteln. Stattdessen winkte ich wieder – und kam mir dabei allmählich wirklich komisch vor.
»Hey«, sagte Maxton freundlich in meine Richtung. Dann runzelte er die Stirn und fuhr sich mit dem Handrücken über die Schläfe. Eine feine Spur Schmutz blieb an seiner Haut haften, aber niemand wies ihn darauf hin. Vielleicht, weil dieses Bild schon zu gewohnt war. »Dachten wir nicht, sie kommt morgen?«
»Dachten wir«, bestätigte May.
Willow warf den Apfelrest über ihre Schulter. »Gut, dass du früher gekommen bist. May hätte uns andernfalls gezwungen, Spalier zu stehen und dich mit Rosenblättern zu bewerfen.«
Maxton bedachte Willow mit einem warnenden Blick. »Finger weg von meinen Rosen, Catkin.«
Ich musste lächeln. Catkin, das Weidenkätzchen, war nichts, was ich auf Anhieb mit dieser durch und durch selbstbewusst und tough wirkenden Frau in Verbindung gebracht hätte. Ihrem Gesichtsausdruck zufolge war sie von dem Kosenamen auch nicht sonderlich begeistert.
Aus dem Augenwinkel nahm ich den leichten Röteschleier auf Mays Wangen wahr. Vermutlich musste sie gerade ebenfalls an die tote Rosenstaude denken, die sie vor der Haustür abgestellt hatte. »Als ob du irgendetwas tust, was ich dir sage. Meine Scones hast du da drinnen ja wohl schnöde im Stich gelassen«, fügte sie an Willow gerichtet hinzu.
Diese verzog den Mund und vergrub eine Hand in ihren Locken, während sie an uns vorbei zum Haus sah. »Shit, tut mir leid. Komplett vergessen.« Sie deutete mit dem Daumen auf Maxton. »Er hat mich abgelenkt, er kommt nämlich nicht ohne mich klar.«
Maxton sah sie ungläubig an. »Ich versuche seit fünfzehn Minuten, dich wieder loszuwerden.«
Willow seufzte und zwinkerte in meine Richtung. »Hör nicht hin, das ist seine ganz spezielle Art, nett zu sein. Man gewöhnt sich daran. Jedes Mal, wenn er die Augen verdreht, fühle ich mich überaus geliebt.«
Ich schaffte nur ein halbes Lächeln. Die Anspannung des Tages wandelte sich allmählich in Erschöpfung um, die sich wie ein Rucksack auf meinen Schultern niederließ.
May schien zu bemerken, dass mein Repertoire an Small Talk bereits erschöpft war. Sie hakte sich bei mir unter und lächelte warm zu mir auf. »Weiter geht’s.«
Ich verabschiedete mich von den anderen und folgte ihr bereitwillig zurück durch den Garten. Ein Teil von mir wollte gern den Rest des Anwesens erkunden, doch der größte sehnte sich danach, das Gesicht in einem Kissen zu vergraben und für ein paar Sekunden lang innezuhalten.
Als wir die Verandatür erreicht hatten, ließ May mich vorangehen, ehe sie sie mit Schwung zurück ins Schloss zerrte. Die warme Luft des Heizstrahlers, der neben dem Sofa stand, lockerte meine verkrampften Muskeln. Und meine Zunge.
»Also«, sagte ich bemüht fröhlich, »fehlen nur noch drei, oder?«
Sieben Mitbewohner erschien mir plötzlich wie eine riesige Zahl. Im Wohnheim hatte ich mir Küche und Bad mit einem Dutzend anderer geteilt, aber das war etwas anderes gewesen. Hier waren wir nicht einfach Mitbewohner, die sich beim Kommen und Gehen zuwinken und ansonsten aus dem Weg gehen konnten. Wir waren alle hier, weil wir dafür ausgewählt worden waren, aus diesem Haus etwas Neues zu erschaffen. Wir hatten ein gemeinsames Ziel, und dafür mussten wir wohl oder übel zusammenarbeiten. Ich würde mehr Zeit mit diesen Menschen verbringen als mit meinen Kommilitonen, mehr als mit den Freunden, die ich womöglich am Campus kennenlernte. Dieses Haus – mitsamt seinen Bewohnern – würde zum Zentrum meines Privatlebens werden.
Ich hatte das so gewollt, sonst hätte ich mich nicht beworben, doch jetzt bereitete es mir auf einmal Angst. Normalerweise machte ich mir keine Gedanken darüber, von anderen gemocht zu werden. Entweder, es passte, oder eben nicht. Aber das hier … das musste passen. Ich wollte das so sehr. Einen Neuanfang. Ein neues Zuhause. Ein neues Ich. Ich wollte meinen Kopf mit so vielen neuen Erinnerungen füllen, dass die alten unter ihrem Gewicht zerbröselten. Wahrscheinlich war das der ausschlaggebende Grund dafür gewesen, mich für dieses Projekt zu bewerben. Wenn ich mich mit all meinem Herzen dieser Villa widmete, dann vergaß ich womöglich, dass es eigentlich nur noch wehtat. Meine Welt war auseinandergefallen, aber hier konnte ich dabei mithelfen, etwas anderes zusammenzuhalten.
Wenn ich allerdings wollte, dass May und die anderen mich mochten, sollte ich vermutlich aufhören zu winken und anfangen zu reden.
May rückte im Vorbeigehen einen Lampenschirm auf einem Beistelltisch zurecht. »Richtig. Helen ist irgendwo hier im Haus. Wir hatten heute Morgen schon wieder einen Kurzschluss, und sie kennt sich als Einzige mit so was aus. Ihre Familie führt seit Urzeiten einen Elektrikerbetrieb. Sie hat auch ein Händchen für Autos, falls du da mal ein Problem haben solltest.«
»Kein Auto, kein Problem.«
May warf mir einen Blick über ihre Schulter zu. Der Flur war durch etliche Kisten an den Wänden so verengt, dass wir nicht mehr nebeneinander laufen konnten. »Kein Auto? Wie bist du hergekommen?«
»Mit dem Bus. Und die letzten Kilometer bin ich gelaufen.« Was meine Füße mir mit jedem Schritt in Erinnerung riefen. Ich trug meine bequemsten Sneakers, trotzdem spürte ich jeden Zeh pochen.
Wir hatten die Küchentür erreicht, und ich hievte mir den Rucksack umständlich über die Schultern, ehe ich meine Reisetasche anhob. Als May danach greifen wollte, lehnte ich dankend ab. Sie zupfte nachdenklich an ihrem Haarband.
»Hast du deswegen so wenig Gepäck? Weil du es nicht transportieren konntest?«
»Nein, ich … brauche einfach nicht so viel«, erwiderte ich vage. Das war leichter, als zu erklären, dass ich an den Rest meiner Sachen nicht herankam. Zwar hatte ich während des Studiums im Wohnheim gelebt, aber ich war an den Wochenenden und auch oft unter der Woche nach Hause gefahren. Das meiste von meinem Zeug befand sich noch immer in meinem alten Kinderzimmer. Bei dem Gedanken an das Foto von meinem Vater und mir, das dort auf meinem Nachttisch stand, überkam mich ein solches Wehmutsgefühl, dass ich kurz die Augen zukneifen musste.
»Alles klar.« May sah mich an, als wollte sie etwas dazu sagen, doch dann wandte sie sich ab und stieg die Treppe hinauf. »Die anderen beiden Jungs sind unterwegs. Beckett besteht darauf, dass wir einmal die Woche einen Großeinkauf machen. Wenn der Kühlschrank nicht zum Bersten gefüllt ist, wird er richtig dramatisch. Du weißt schon, er rauft sich die Haare und verkündet, dass er nicht für einen Haufen Banausen kochen will und dass sein italienischer Urururgroßvater sich im Grabe umdrehen würde und so weiter und so fort.« Sie schnaubte belustigt, während ich versuchte, mit ihr Schritt zu halten.
Die Treppe mündete im ersten Stock in einem Flur, der zu beiden Seiten um Ecken lief. Daneben führte sie eine weitere Etage hinauf, doch wir bogen direkt nach rechts. Die Dielen knarrten unter unseren Schritten. Ein paar löchrige Lampenschirme hingen über Glühbirnen an den Wänden und warfen dämmriges Licht auf uns. Am Ende des Flurs lag ein Fenster, das von einer Plastikplane verdeckt wurde. Sie hob sich sacht unter dem Druck des Herbstatems, der sich von draußen gegen die undichte Scheibe drängte.
»Kocht Beckett denn immer?«, hakte ich konzentriert nach. Am liebsten hätte ich mein Notizbuch aus dem Rucksack geholt, um mir ein paar Dinge aufzuschreiben. May umarmt gern. Sienna will mich in einen Kamin stecken. Maxton liebt Pflanzen. Willow darf man keine Ofenaufsicht anvertrauen. Helen repariert Elektrik. Beckett ist kochwütig. Nicht zu vergessen: Avery benimmt sich seltsam und winkt gern.
»Offiziell haben wir einen Plan dafür«, erklärte May. »Inoffiziell hat derjenige, der dran ist, so gut wie immer einen nervösen Beckett hinter sich stehen, der die ganze Zeit bemüht arglose Nachfragen stellt. So was wie: Meinst du, das ist genügend Salz? Findest du, dass Rosmarin wirklich zu einer Tomatensoße passt? Wann genau magst du die Kartoffeln aus dem Ofen holen?« Sie warf mir einen Blick über ihre Schulter zu, ihr ganzes Gesicht lächelte. »Sein Vater ist Chefkoch in einem Londoner Edelrestaurant. Die Liebe zum Kochen ist also vermutlich vererbt. Ich rate dir: Fang niemals eine Diskussion über die Pro- und Contra-Seiten von Thymian und Oregano an.«
Ein zarter Staubflaum löste sich unter ihren Schritten und wirbelte mir ins Gesicht, ich hustete in meine Armbeuge. »Ist notiert«, erwiderte ich mit kratziger Stimme.
Vor einer Tür in der Mitte des Flurs hielt May inne und drückte die Klinke herunter. Ein leicht abgestandener Geruch schlug mir in die Nase, als ich ihr hineinfolgte.
Cremefarbene Wände, eine roségoldene Borte, die einmal ringsherum verlief, ein paar Farbwirbel auch an der hohen Decke. An einigen Stellen löste sich die Tapete und hing wie welke Blütenblätter hinab. Das Herzstück des Zimmers war der Erker. Die gewölbte Ausbuchtung war großflächig verglast, sodass man einen weiten Blick auf die Einfahrt des Hauses und die dahinterliegenden Felder hatte.
Ansonsten war das Zimmer so gut wie leer. An der rechten Wand stand ein Holzbett, das frisch bezogen wirkte, auf der anderen Seite ein Schrank aus Nussbaumholz mit filigranen goldenen Türgriffen. Die feine Spur eines Holzwurms verlief längs über den Korpus, ansonsten sah er unversehrt aus. Der restliche Raum war frei, und während ich hindurchlief, fühlte ich mich in seiner Leere ein wenig verloren.
»Wir haben uns die Zimmer per Zufall zugeteilt, als wir eingezogen sind. Da du nicht da warst, haben wir deinen Namen mit ausgelost, ich hoffe, das ist okay für dich.« May sah mir dabei zu, wie ich auf die Fenster zuging. »Wir dachten, das wäre am fairsten. Das Haus hat natürlich einige Zimmer mehr, aber wir haben die acht ausgesucht, die am ehesten als bewohnbar durchgehen. Kein Schimmel, halbwegs dichte Fenster, kein Mottenbefall, schließbare Türen – so was eben. Bei einigen der anderen ist es momentan noch schwer vorstellbar, dass jemand dort freiwillig einziehen würde, selbst wenn wir sie in Schuss gebracht haben.«
Ich nickte und blieb vor dem Erkerfenster stehen. Die weiße Farbe des Rahmens blätterte ab, ich spürte einen Luftzug, der durch die Scheibe drang und meine herauswachsenden Ponysträhnen in meine Stirn zupfte. Hinter der Scheibe verschwamm das Grün der Maulbeerbäume mit dem Gold eines Senfmeers am Feldweg. Über all die Herbstfarben legte sich die Reflexion meines Gesichts. Mein dunkelbraunes Haar war von der Fahrt strähnig geworden, ich spürte die verfilzten Stellen, ohne sie zu berühren. Meine Augen waren mit blassblauen Ringen unterlegt, die Bernsteinsprenkel in den Iriden fast nicht mehr zu sehen, und meine Lippen waren an mehreren Stellen aufgesprungen wie überreife Früchte.
Ich tastete nach dem eingerissenen Mundwinkel und bemerkte Mays fragenden Blick im Glas. Schnell rang ich mir ein Lächeln ab und drehte mich zu ihr um. Ich konnte nicht mal sagen, ob sie in den letzten Minuten noch etwas gesagt hatte. »Entschuldige bitte.« Müde rieb ich mir über das Gesicht. »Ich bin so fertig. Die letzten Wochen waren … anstrengend. Aber das klingt alles perfekt. Und ich liebe das Zimmer. Danke.«
May nickte verständnisvoll. »Du musst dich nicht entschuldigen. Das ist bestimmt viel auf einmal für dich. Komm erst mal in Ruhe an. Glaub mir, du wirst früh genug mitbekommen, wie dieses Haus tickt. Und wir natürlich. Ich weiß einfach, dass du prima zu uns passen wirst. Dein Bewerbungsessay war großartig. Die Bedeutung von Gerechtigkeit für modernes Zusammenleben – ziemlich beeindruckend.«
»Du hast es gelesen?«
Es überraschte mich eher, als dass es mir unangenehm war. Mein Essay war sowieso nicht besonders persönlich geworden. Ich hatte lediglich versucht, die bisherigen Erkenntnisse meines Jurastudiums als Prämissen für ein gelungenes Zusammenleben anzuwenden. Da ich weder über nennenswerte handwerkliche noch über herausragend soziale Fähigkeiten verfügte, war das das einzig Nennenswerte, was ich zu diesem Projekt beisteuern konnte. Vermutlich war es gar nicht so schlecht, wenn die anderen gleich wussten, dass sie mir am besten keinen Hammer in die Hand drückten, ohne mir eine dazugehörige Handlungsanweisung zu geben.
Mays Wangen erröteten, ihr Lächeln wurde zerknirschter. »Entschuldige. Noch so eine Sache, die wir ohne dich entschieden haben. Das Gremium hat uns die Gewinner-Essays zukommen lassen, für den Fall, dass wir sie miteinander teilen wollen. Du weißt schon, damit wir uns besser kennenlernen und einschätzen können, was wir für dieses Projekt mitbringen. Keiner hatte etwas dagegen, aber ich glaube, bis auf Sienna und mich hat sich niemand dafür interessiert. Du kannst unsere natürlich auch lesen. Sie liegen unten im Wohnzimmer.«
»Okay, danke.« Ich streifte meine Jacke ab, auch wenn ich direkt zu frösteln begann. Die Heizung neben dem Fenster gluckerte zwar leise, aber die Wärme, die von ihr ausging, verlor sich sofort in dem weiten Zimmer.
May hielt auf der Türschwelle inne. »Ich bin heute mit Kochen dran und wollte ein Curry machen. Du hast eine Erdnuss-Allergie, richtig?«
Ich grinste schief. »Du bist echt gut informiert.«
Mehr Farbe schoss in ihre Wangen. Es biss sich mit ihrem Haarband, machte sie aber nur noch sympathischer. Mays Körper war ein schlechter Lügner, und ich ahnte, dass das auch für ihr Inneres galt. Und wenn es etwas gab, wonach ich mich im Moment sehnte, dann war es Aufrichtigkeit.
»Ich bin nur gern vorbereitet.« Sie deutete auf mein Gepäck, das ich neben dem Bett abgestellt hatte. »Ich würde dir meine Hilfe beim Auspacken anbieten, aber …«
»Ich komme klar«, bestätigte ich.
»Dachte ich mir. Dann gehe ich jetzt und verstecke die Pflanzenleiche vor Maxton. Wir essen so gegen acht, wenn ich es schaffe, fertig zu werden, bevor Beckett wieder hier ist. Wenn was ist, ruf mich.«
»Mach ich. Und, May?«
Sie drehte sich erneut im Rahmen um. »Ja?«
Dieses Mal war mein Lächeln aufrichtig. Und ich hoffte, es war ansatzweise so warm wie ihres. »Danke.«
Sie winkte ab. Schon jetzt war ich sicher, dass May jemand war, der dazu neigte, alles für andere zu machen, ohne etwas im Gegenzug dafür zu erwarten. »Wir freuen uns wirklich, dass du da bist, Avery«, sagte sie sanft. »Du wirst sehen, dieses Haus macht es einem unmöglich, sich nicht zu verlieben.«
Sie ging und schloss die Tür hinter sich. Die plötzliche Stille legte sich watteweich über meine Ohren. Da waren nur das Gluckern der Heizung, das leise Ächzen der Fenster und die Dielen, die unter meinen Schritten knarrten, als ich zum Bett lief. Ich ließ mich rücklings auf die Matratze fallen und versank in der weichen Bettwäsche. Sie roch nach Rosen-Waschmittel, nach warmem Holz und irgendwie auch ein bisschen nach angebrannten Scones. Ich schloss die Augen und atmete ein. Zuhause,dachte ich. Zuhause, Zuhause, Zuhause. Bevor ich es schaffte, daran zu glauben, schlief ich ein.
2. Kapitel
AVERY
Ich wachte auf, als es draußen bereits dunkelte. Die Dämmerung hatte sich als Tuch hinter dem großen Fenster ausgebreitet und verwischte die Umgebung zu einer Collage aus tiefem Blau und Schatten.
Im flackernden Licht der Nachttischlampe öffnete ich meinen Rucksack. Während sich in meiner Reisetasche meine Klamotten befanden, war mein Rucksack mit meinen Uni-Unterlagen und den wenigen Sachen gefüllt, die ich im Wohnheim bei mir gehabt hatte.
Vorsichtig griff ich nach dem Marmeladenglas, das ich in einen Schal gewickelt hatte. Das Etikettier-Schild, auf dem die Jahreszahl stand, hatte sich durch den Transport ein wenig abgerollt. Ich glättete die Seiten und schüttelte das Glas einmal, sodass die gefalteten Zettel sich neu vermischten.
Es war bereits September, das Jahr fast vorbei, trotzdem war das Glas nicht einmal zur Hälfte voll. Fünfzehn oder zwanzig Zettel – fünfzehn oder zwanzig Glücksmomente in neun Monaten. Ich versuchte, nicht an das Notizbuch in meinem Rucksack zu denken, das die gleiche Jahreszahl trug und so viel mehr gefüllt war. Schattenablage, hatte meine Therapeutin damals dazu gesagt. Und so eine hatte ich in den vergangenen Monaten mehr gebraucht als ein Glas für die schönen Momente.
Glücksbewahrer. Das Wort war in meinem Kopf, bevor ich mich dagegen wehren konnte. Ein Hauch der Stimme klebte noch daran, die es damals zum ersten Mal gesagt hatte. Diese verdammte Stimme, die ich auch nach zwei Jahren nicht vergessen konnte. Ich versuchte, nicht daran zu denken, welches Gesicht dazu gehörte. Oder welches Gefühl. Allein der Anblick des Glases drückte sich so unangenehm in meine Brust, dass ich es schnell neben dem Bett abstellte.
Einen besseren Platz hatte ich momentan sowieso nicht dafür. Ich hätte meine eigenen Möbel mitbringen dürfen, aber im Wohnheim hatte ich keine gehabt, und für die in meinem Elternhaus galt dasselbe wie für meine restlichen Sachen: Ich konnte sie nicht holen.
Immerhin hatte ich Glück gehabt, und viele der ursprünglichen Möbel der Mulberry Mansion waren uns mit dem Haus überlassen worden. Solang mein Zimmer ein Bett hatte, konnte ich mit allem leben. Auch wenn mir der leichte Schmerz in meinem Rücken jetzt schon deutlich machte, dass es ratsam wäre, die Matratze auszutauschen. Vielleicht konnte ich bald auf einem Flohmarkt außerdem ein günstiges Regal und einen Schreibtisch kaufen. Das wären zumindest ein paar neue Möbel für diesen Neuanfang in einem alten Haus.
Ich klaubte einige frische Sachen aus meiner Tasche, griff nach dem Handtuch, das auf meinem Bett lag, und machte mich auf die Suche nach einem Bad.
Ich fand es direkt gegenüber von meinem Zimmer: groß und weiß gefliest, mit einer Wanne direkt unter dem Fenster, die mich an alte Schwarz-Weiß-Filme erinnerte. Der goldene Hahn war verschnörkelt, die Keramik an etlichen Stellen in einem Spinnenbeinmuster gesprungen. Das Fenster ging zum Garten hinaus, und am liebsten hätte ich mich in die Wanne gelegt und eine Weile auf die blauschwarzen Blätterdächer gestarrt.
Stattdessen ging ich zu der Dusche auf der anderen Seite neben dem Waschbecken. Einzig die Aussicht auf heißes Wasser konnte mich dazu bringen, mich in diesem unbeheizten Raum auszuziehen. Keine dreißig Sekunden später wurde ich bitterlich enttäuscht. Ich drehte den Hahn probehalber in beide Richtungen voll auf, doch das Einzige, was herauslief, war eiskaltes Wasser. Ich biss die Zähne aufeinander und wusch mich hastig mit dem nächstbesten Duschgel, das ich auf der Ablage ergreifen konnte. Als ich aus der Kabine stieg und mich in das Handtuch wickelte, glaubte ich, den Duft an mir auszumachen, der vorhin in Mays Haar gehangen hatte.
Nachdem ich in meine frischen Kleider geschlüpft war, meine Haare notdürftig trockengerubbelt und ein freundliches Lächeln im beschlagenen Spiegel geprobt hatte, verließ ich das Bad wieder.
Auf dem Weg nach unten streckte die Geräuschkulisse des Hauses bereits ihre Hände nach mir aus. Leises Stimmengewirr, das Zuknallen einer Tür, Geschirrgeklapper. Der Geruch nach Curry überlagerte sogar den der Rosmarinzweige, die auf dem Beistelltisch am Ende der Treppe in einer Vase standen.
Kurz vor der Küche blieb ich stehen und atmete tief durch. Das sind deine neuen Mitbewohner,murmelte ich mir innerlich zu, also gib dir Mühe. Sei einfach nett.
Ich wünschte, ich hätte kein Mantra dafür gebraucht, aber ich kannte mich zu gut. Es war mir schon immer schwergefallen, auf fremde Menschen zuzugehen. Mein Vater hatte früher immer gesagt, ich hätte eine angeborene Skepsis gegenüber der Welt. Bei ihm hatte das wie eine liebenswerte Macke geklungen, aber mittlerweile wusste ich, dass sie mich oft von anderen abschottete. Ich war nicht wie May. Ich umarmte niemanden, den ich nicht kannte. Ich stellte mich lieber zehn Meter entfernt in eine Ecke und beobachtete ihn, bis ich wusste, was ich von ihm hielt.
»Es ist okay, vorsichtig zu sein«, hatte mein Vater mir einmal gesagt. »Aber lass nicht zu, dass die Vorsicht dir die Chance auf die schönsten Erlebnisse stiehlt. Manches lässt sich eben nicht vorhersehen, sondern erst dann, wenn man mittendrin steckt.«
Die Erinnerung wummerte in meinem Kopf und löste einen Schmerz aus, der in meine Brust sickerte. Ich vergrub die Finger in den übergroßen Ärmeln meines Pullovers. Er war alt und der Saum mit Löchern verziert, aber ich würde ihn niemals hergeben. Erinnerungen waren das Einzige, was ich von meinem Vater noch hatte. Und seine Pullover waren welche, in die ich schlüpfen konnte.
Ich drückte die Nase kurz an meine Schulter, obwohl der Stoff seit fast drei Jahren nur nach mir roch. Ich war zwanzig Jahre alt, aber in diesem Moment schwappte das Heimweh so heftig über mich hinweg, dass ich mich am liebsten wieder im Bett verkrochen hätte. Dabei hatte ich alles getan, um das Zuhause, das ich in diesem Moment vermisste, hinter mir zu lassen. Alles, was ich jetzt machen musste, war, einen Schritt über die Schwelle dieses neuen zu wagen.
Ich holte erneut tief Luft, dann gab ich mir einen Ruck und ging in die Küche.
May stand am Herd und rührte in einem riesigen Kochtopf, Sienna sammelte sauberes Besteck aus dem Abtropfgitter an der Spüle, und Willow und eine weitere junge Frau saßen am Küchentisch. Sie stellte sich mir mit einer sanften, fast kindlichen Stimme als Helen vor. Ihre roten Haare waren zu zwei Zöpfen geflochten, und ihr rundliches Gesicht war von Sommersprossen übersät. Auf ihrem karierten Hemdkleid waren ein paar Ölflecken, aber es schien sie nicht zu kümmern.
Mir fiel auf, dass ich niemanden hier gesehen hatte, dessen Kleidung ganz sauber gewesen war. Ich mochte das. Für meine Kommilitonen an der alten Uni waren Klamotten immer eine Art Statussymbol gewesen. In einer Blase aus gebügelten Hemden und Blusen, die nach Perlenohrringen verlangten, hatte ich mir zu oft irgendeinen Spruch über meine weiten, sichtlich in die Jahre gekommenen Pullover anhören müssen. In dieser Villa hingegen schienen sich alle darüber einig zu sein, dass Kleider vor allem Gebrauchsgegenstände waren.
Ich stellte mich neben May, um Wärme vom Herd abzufangen. Meine feuchten Haare reichten mir genau bis zu den Schultern und tropften gleichmäßig auf den Kragen meines Pullovers. »Haben wir eigentlich kein heißes Wasser?«
»Doch, klar, aber in unserem Bad musst du am Hahn ruckeln, damit es sich richtig einstellt.« May verzog entschuldigend den Mund. Etliche schwarze Strähnen hatten sich aus dem Haarband gelöst, und ihr Gesicht war von der Kochhitze rot geworden. »Ist ein bisschen kompliziert, ich hätte dir das vorher zeigen sollen.«
»Kein Ding. So bin ich wenigstens halbwegs wach. Ich fühl mich eh schon schlecht, weil ich eingeschlafen bin. Die Fahrt hat mich ziemlich ausgelaugt, aber ich verspreche feierlich, dass ich ab morgen früh ein vollwertiges Mitglied in diesem Haus sein werde.«
»Mach dir keinen Kopf.« Sienna griff nach einer Schüssel aus dem Wandschrank über uns, um den Reis umzukippen. »Was das angeht, hat Willow die Latte der Erwartungen echt niedrig gehängt.«
»Hey«, protestierte diese entrüstet. »Wer von uns telefoniert denn hier seit Wochen dem Strom-, Gas-, Internet- und gefühlt jedem anderen Anbieter des Landes hinterher?«
»Das muss man ihr lassen«, raunte Sienna in meine Richtung. »Leuten auf die Nerven gehen kann sie.«
Willow hörte sie dennoch. »Ich bevorzuge den Ausdruck sie mit meinem Charme bezirzen, okay? Deswegen frieren wir uns seit einer Woche immerhin nur noch eine Hälfte unserer Hintern ab.«
Ungläubig sah ich sie an. »Es war hier noch kälter?«
Ich hätte nicht gedacht, dass die gluckernden Heizungen bereits eine Verbesserung des Problems waren. Klar, die Villa hatte lang leer gestanden, aber ich hatte vermutet, die Uni und die Stiftung hätten dafür gesorgt, dass die essenziellen Dinge funktionierten, ehe sie uns einziehen ließen. Wir waren nach wie vor Studierende und keine ausgebildeten Handwerker.
»Und ich fürchte, es wird noch deutlich kälter werden.« May warf einen sorgenvollen Blick zum Fenster. Im Dunkeln wirkten die Zweige des Zwetschgenbaums wie ineinander verschlungene Finger. »Der Spätsommer war mild, aber dieses Haus absorbiert irgendwie jegliche Wärme. Wir müssen uns überlegen, wie wir dämmen, ehe der Winter kommt.«
»Na, zum Glück haben wir nicht schon genug offene Baustellen.« Willow prostete mir mit ihrem Weinglas zu. »Du wirst dich morgen früh beim Schreckensbericht vermutlich fragen, wo du hier gelandet bist. Am besten, du wartest mit dem Auspacken. Ich könnte absolut verstehen, wenn du es dir anders überlegst.«
Ehe ich antworten konnte, knallte im Flur eine Tür zu. Kurz darauf setzte ein Scheppern ein, das schließlich um die Ecke bog und in die Küche kam. Begleitet wurde es von einem Typen mit dunkelblondem Haar, der gleichzeitig mehrere Einkaufstüten und einen Kasten Bier vor der Brust trug. Die Flaschen schlugen bei jedem Schritt aneinander und übertönten fast sein Fluchen.
»Heiliger Sankt irgendwas – könntet ihr bitte mal darauf achten, wenn jemand klingelt?«
Willow verdrehte unbeeindruckt die Augen. »Die Klingel ist kaputt, Einstein. Das haben wir heute Morgen festgestellt.«
»Haben wir?« Er runzelte die Stirn und hievte den Kasten auf den Tisch, sodass Helens Wasserglas fast umfiel.
Sie zog es weg und bedachte ihn mit einem weichen Lächeln. »Haben wir. Allerdings vor deinem ersten Kaffee, vor dem du ja bekanntlich nicht dazu in der Lage bist, Informationen abzuspeichern.«
»Verstehe – ihr ignoriert also meine klar kommunizierten Bedürfnisse.« Unsanft ließ er die Tüten zu Boden gleiten, sodass ein Netz Kartoffeln und mehrere Stangen Porree auf den Boden rutschten. Dann hob er den Kopf an und entdeckte mich. Innerhalb weniger Sekunden flatterte sein Blick eingehend über mich. Schließlich pfiff er durch die Zähne. »Bitte sagt mir, dass sie nur zu Besuch ist.«
Verwirrt drehte May sich zu ihm um. »Wieso?«
Er lächelte mir charmant zu. Die Art, wie sich die Fältchen um seine grünbraunen Augen dabei vertieften, machte deutlich, dass das etwas war, was er öfter tat. »Weil ich’s nicht ertrage, mit noch einem hübschen Mädchen unter einem Dach zu wohnen, von dem ich mich fernhalten muss.«
Willow schnaubte. »Übertreib es nicht, Beck. Ich habe nicht genug Wein getrunken, um so was zu ertragen.«
Er beugte sich vor und blinzelte unter dichten Wimperfächern auf sie hinab. »Bloß kein Neid, meine Süße. Du weißt genau, ich hätte dich längst dazu gebracht, mit mir auszugehen, wenn ich weniger Angst vor dir hätte. Oder vor deinem Schatten, der nahezu immer eine Gartenschere in der Hand hält. Und wenn der erste Grundsatz unserer hauseigenen Gesetzessammlung nicht wäre: Don’t fuck the company.«
Sie drückte ihn mit der Hand an seiner Stirn von sich weg, aber ich sah trotzdem, dass sie lächeln musste. »Du spinnst. Unsere hauseigene Gesetzessammlung ist eine Papierserviette, die bereits jetzt anfängt auseinanderzufallen. Trotzdem: Du kannst sie dir gleich ebenso aus dem Kopf schlagen wie mich. Das ist Avery Sterling. Unsere neue Mitbewohnerin. Avery, das ist Beckett – wie er leibt, lebt und uns täglich auf die Nerven geht.«
»Verdammt.« Bedauernd musterte er mich. »Du bist doch viel zu hinreißend für jemanden, der Jura studiert.«
Ich schob die Hände hinter meinen Rücken, um nicht wieder zu winken. »Ihr wisst alle wirklich gut Bescheid über mich.«
Willow nippte grinsend an ihrem Wein. »Na aber sicher, May hat uns ja auch allabendlich aus deiner Polizeiakte vorgelesen.«
May warf mir einen schuldbewussten Blick zu. »Sie übertreibt. Ich wollte nur, dass du dich gleich so richtig dazugehörig fühlst. Damit du nicht das Gefühl hast, etwas verpasst zu haben, nur weil du später angekommen bist.«
»Das ist nett von dir, ehrlich.« Ich meinte es so, auch wenn alles, was ich denken konnte, war: Zum Glück steht nicht alles über mich in meinen Bewerbungsunterlagen. Es gab Dinge, die wollte ich mit niemandem teilen. Ein klarer Cut musste immer für beide Seiten gelten, ich wollte eine verdammte Schlucht zwischen Damals und Jetzt.
Willow blies sich eine Locke aus der Stirn. »Gibt ja auch nichts Schöneres, als irgendwo anzukommen, wo ein Haufen Fremder direkt deinen Lebenslauf auswendig kennt.«
»Wir sind keine Fremden. Wir gehören jetzt zusammen.« May stellte sich auf die Zehenspitzen, um an eine Glasschüssel aus dem Schrank zu kommen. Ich kam ihr zuvor. Für irgendetwas mussten meine eins achtundsiebzig ja gut sein.
»Die acht Musketiere, ein Klassiker.« Willow fasste sich theatralisch ans Herz, ehe sie stirnrunzelnd zur Tür blickte. »Apropos, wo steckt denn unser hauseigener Sonnenschein?«
Beckett verdrehte die Augen und verstaute den Sack Kartoffeln in einem Tonkrug auf der Anrichte. »Am Auto. Er hat heute ganz besonders prächtige Laune. Jemand muss uns auf dem Parkplatz gestreift haben, die Längsseite seines Wagens ist jetzt mit hübschen Kratzern verziert.«
May drehte sich mit der vollen Curry-Schüssel zum Küchentisch um. »Soll ich mal nach ihm sehen? Das Essen ist fertig.«
Beckett winkte ab und nahm ihr die Schüssel aus den Händen, nur um sie an Sienna weiterzugeben, die gerade aus dem Wohnzimmer zurückkam. »Der kommt schon rein, wenn er bemerkt hat, dass der Wagen sich nicht neu lackiert, nur weil er ihn finster anstarrt«, meinte er gelassen. »Außerdem ist Maxton zu ihm gegangen. Wenn es jemanden gibt, der ihn dazu bringt, es gut sein zu lassen, dann er.«
Ich biss mir auf die Unterlippe, um nicht zu lachen. Das da draußen musste dann wohl Mitbewohner Nummer sieben sein. Immerhin versprachen diese Gesprächsfetzen niemanden, der sonderlich viel Small Talk von mir einfordern würde.
Beckett und Helen räumten zügig die schnell verderblichen Lebensmittel in den Kühlschrank, ehe wir in den Essbereich zwischen Küche und Wohnzimmer gingen. Vor einem der Fenster stand ein langer Tisch, den Sienna mit Geschirr, Besteck und einigen Kerzenleuchtern aus Messing gedeckt hatte. Das goldene Licht flackerte gemeinsam mit dem schwachen Schein der Deckenlampe in der Glasscheibe und verlieh dem Raum etwas Gemütliches. Der Garten draußen war gänzlich von der Nacht verschluckt worden, fast so, als hätte sich die Welt auf unser Haus reduziert.
Unser Haus. Ich kostete erst die Worte, dann den Wein, den Willow mir eingeschenkt hatte. Er war schwer und löste ein behagliches Gefühl von Wärme in meiner Magengrube aus. Meine Muskeln entspannten sich, und als Beckett sich auf den Stuhl neben mir setzte, musste ich mich nicht einmal dazu zwingen, zu lächeln.
»Irgendwie schräg. Ich hätte eher vermutet, du wärst ein Kerl«, teilte er mir mit.
»Wieso das?« Mein Name war zwar geschlechtsneutral, aber in meinen Unterlagen war auch ein Foto angefügt. Etwas ließ mich allerdings ahnen, dass Beckett sich nie für die Essays interessiert hatte. Er wirkte nicht unbedingt wie jemand, der sonderlich viel Wert auf Vorbereitung legte. Eher wie jemand, den man mitten in der Nacht anrufen könnte, damit er mit einem zum Flughafen fuhr, sich vor die Anzeige der Abflüge stellte und spontan das Ziel für einen Kurztrip auswählte.
Er hob die Schultern und reichte May seinen Teller, damit sie ihm Reis auftat. »Na, allein wegen der Verteilung. Das ist doch irgendwie unfair so. Fünf gegen drei.«
Sienna setzte sich auf seine andere Seite und schnippte ihm gegen den Arm. »Das ist sexistisch, Beck. Wir wurden unabhängig von unserem Geschlecht ausgewählt, schon vergessen? Eine Festmachung am biologischen Status würde nämlich bedeuten, dass man bestimmte Klischeekonstrukte der Begriffe ›männlich‹ und ›weiblich‹ aufrechterhält.« Sie stützte ihr Kinn auf eine Hand und lächelte ihn süffisant über den Rand ihrer Brille hinweg an. »Und versteh das nicht falsch, Darling, aber während du ständig hinter dem Herd stehst, hat Helen heute wieder einmal den Sicherungskasten repariert.«
»Man kann keinen Sicherungskasten reparieren, Sienna«, sagte Helen mit erröteten Wangen. Offenbar war ihr die komplimentbehaftete Aufmerksamkeit unangenehm.
»Mann nicht, du schon.« Sienna grinste. »Genau das sage ich ja.«
»Du übertreibst«, murmelte Helen und fügte dann an Beckett gewandt hinzu: »Aber wobei brauchst du denn bitte männliche Unterstützung, Beck? Als ich letztens Fußball mit dir ansehen wollte, bist du während der ersten Halbzeit eingeschlafen.« Sie reichte Sienna einen Teller mit Curry. Der würzige Duft entlockte meinem Magen ein leises Knurren.
Entrüstet stieß Willow Helen in die Seite. »Ich bitte dich! Bei der Wahl des sonntagabendlichen Nachtischs zum Beispiel: Crème brulée oder Mousse au Chocolat – ganz klassische Geschlechterkampf-Frage!«
Sienna lachte laut, Helen und ich versuchten zumindest, es zu kaschieren.
»May?«, fragte Beckett trocken. »Steht in unserer Hausordnung etwas, das mir verbietet, Willow für ein paar Stunden in den Schuppen zu sperren?«
May hatte bereits sieben Teller mit Essen gefüllt, jetzt tat sie sich selbst auf und ließ sich dann auf einen Stuhl schräg gegenüber von mir sinken. »Ich befürchte, bei Freiheitsberaubung wiegt die Verfassung unseres Landes mehr als die, die ich vor zwei Wochen nach einer halben Flasche Wein auf eine Papierserviette gekritzelt habe.«
»Na, zum Glück haben wir jetzt unsere persönliche Rechtsberaterin im Haus.« Er nickte mir feierlich zu. »Miss Sterling, was sagen Recht und Justiz?«
»Dass man nie auf leeren Magen über das Begehen einer Straftat diskutieren sollte«, sagte ich todernst.
Momentan wollte ich nicht an mein Studium denken. Mir blieben noch etwa sechsunddreißig Stunden, bis mein neues Semester anfing.
May grinste mir zu und hob ihr Glas. »Vernünftig.« Sie nahm einen Schluck, dann stand sie schon wieder auf. »Ich hole die beiden jetzt. Das Essen wird sonst kalt.«