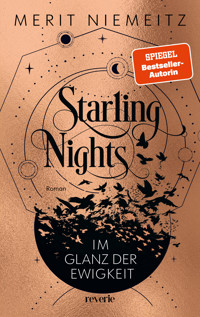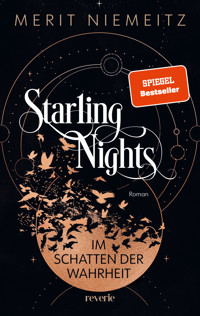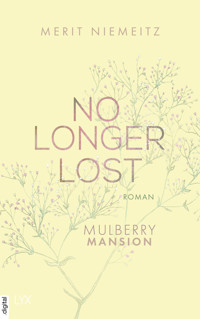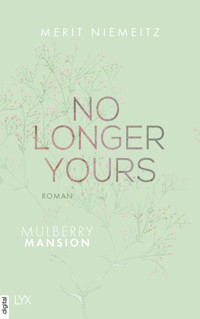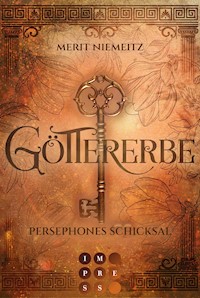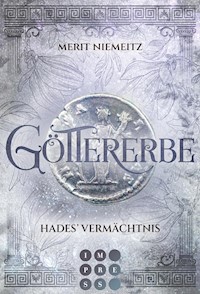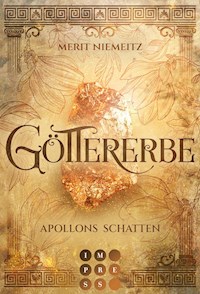
7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carlsen
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
**Wenn die Zukunft dein schlimmster Feind ist** Lia glaubt ihr eigenes Schicksal zu kennen. Schließlich durchlebt die Yorker Studentin seit sie denken kann Zukunftsvisionen. Aber dann passiert eines Nachts etwas Unvorstellbares: Lia wird von mysteriösen Fremden entführt. Voller Entsetzen erfährt sie, dass die Mythen über die griechischen Götter real sind und sie selbst ein Teil davon ist. Doch die Offenbarung ihres wahren Erbes zeigt auch, dass dieses ihren Tod bedeuten könnte. Allein der Mann, der ihr ärgster Gegner sein sollte, scheint Lia noch retten zu können. Aber in dem göttlichen Spiel um Macht verschwimmen die Grenzen zwischen Freund und Feind nur allzu leicht … Textauszug: Vespers Atem stockte. Ich spürte seine Wärme, als meine Finger über seinen Arm wanderten. Der Muskel spannte sich an und er zog mich mit der anderen Hand an sich. Er neigte den Kopf zur Seite, sein Atem streifte meine Schläfe. Als ich seine Lippen schon fast auf meinen spürte, hielt er inne. »Ich kann das nicht tun«, meinte er heiser. »Hast du Angst vor mir?« »Ich habe keine Angst davor, dich zu küssen.« Er umfasste meine Hüfte, drückte mich ein Stück von sich weg. »Ich habe Angst davor, nicht mehr aufzuhören, wenn ich damit angefangen habe.« Für all die Göttinnen, die ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen. //Dies ist der erste Band der magischen Buchreihe »Göttererbe«. Alle Bände der Fantasy-Liebesgeschichte bei Impress: -- Göttererbe 1: Apollons Schatten -- Göttererbe 2: Hades' Vermächtnis -- Göttererbe 3: Persephones Schicksal Diese Reihe ist abgeschlossen.//
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Impress
Die Macht der Gefühle
Impress ist ein Imprint des Carlsen Verlags und publiziert romantische und fantastische Romane für junge Erwachsene.
Wer nach Geschichten zum Mitverlieben in den beliebten Genres Romantasy, Coming-of-Age oder New Adult Romance sucht, ist bei uns genau richtig. Mit viel Gefühl, bittersüßer Stimmung und starken Heldinnen entführen wir unsere Leser*innen in die grenzenlosen Weiten fesselnder Buchwelten.
Tauch ab und lass die Realität weit hinter dir.
Jetzt anmelden!
Jetzt Fan werden!
Merit Niemeitz
Göttererbe 1: Apollons Schatten
**Wenn die Zukunft dein schlimmster Feind ist**
Lia glaubt ihr eigenes Schicksal zu kennen. Schließlich durchlebt die Yorker Studentin seit sie denken kann Zukunftsvisionen. Aber dann passiert eines Nachts etwas Unvorstellbares: Lia wird von mysteriösen Fremden entführt. Voller Entsetzen erfährt sie, dass die Mythen über die griechischen Götter real sind und sie selbst ein Teil davon ist. Doch die Offenbarung ihres wahren Erbes zeigt auch, dass dieses ihren Tod bedeuten könnte. Allein der Mann, der ihr ärgster Gegner sein sollte, scheint Lia noch retten zu können. Aber in dem göttlichen Spiel um Macht verschwimmen die Grenzen zwischen Freund und Feind nur allzu leicht …
Wohin soll es gehen?
Buch lesen
Vita
© privat
Merit Niemeitz wurde 1995 in Berlin geboren und lebt noch immer dort, in einer Wohnung mit unzähligen Flohmarktschätzen, Pflanzen und Büchern. Seit ihrer Kindheit liebt sie Worte und schreibt ihre eigenen Geschichten. Während und nach ihrem Studium der Kulturwissenschaft arbeitet sie seit Jahren in der Buchbranche und möchte eigentlich auch nie etwas anderes tun.
Kapitel 1
Konnte man bei einem Sturz von einer Leiter aus drei Metern Höhe sterben? Je länger ich an mir hinabsah, desto wahrscheinlicher erschien es mir.
Im Second Star gab es keinen Teppichboden, nur unbarmherziges, wenn auch wunderschönes Nussbaumparkett. Ein falscher Tritt, ein Moment der Unsicherheit, eine unüberlegte Entscheidung und – zack! – alles vorbei. Ich horchte in mich hinein, suchte nach einem Gefühl der Angst, aber da war nichts.
Ich dachte oft über das Sterben nach. Vermutlich öfter, als eine Zwanzigjährige das tun sollte.
Kopfschüttelnd riss ich den Blick von der Tiefe los und konzentrierte mich auf die Buchrücken, die in dem Regal vor mir standen. Ich stellte mich auf die Zehenspitzen, um ein weiteres Werk zurück an seinen Platz zu schieben. Es war nicht allzu klug, auf den dünnen Sprossen zu balancieren, aber das spielte für mich keine Rolle. Ich würde nicht fallen. Wenn, dann wüsste ich das längst.
Müde rieb ich mir die Augen, die vom umhertanzenden Staub trocken geworden waren. Die Anstrengung der Woche nagte an meinen Muskeln und ich sehnte mich nach einem heißen Bad und meinem Bett. Doch obwohl mein Körper deutlich nach Schlaf schrie, fürchtete ich mich gleichzeitig davor.
Ich hatte Angst, dass sich in den Tiefen meines Bewusstseins noch der Rest des Traums der vergangenen Nacht versteckte. Des Traums, den ich in verschiedenen Varianten seit Wochen durchlebte. Die Details veränderten sich, aber der Kern blieb verstörend gleich. Jedes Mal war da derselbe gut aussehende Mann an meiner Seite und jedes Mal lief es früher oder später auf dasselbe hinaus: Wir küssten uns. Auf eine absolut nicht jugendfreie Art. Ich war mir hundertprozentig sicher, dass wir auch weitergehen würden – wenn ich nicht ein ums andere Mal rechtzeitig aufwachen würde. Immer wenn ich mit hitzigen Wangen und einem unangenehmen Ziehen im Unterleib in meinem zerwühlten Bett hochschreckte, hätte ich mich vor Scham am liebsten gehäutet.
Entschieden verdrängte ich die Gedanken und linste auf meine Armbanduhr. Es war halb neun, in dreißig Minuten konnte ich den Laden schließen und irgendetwas schrecklich Unerotisches machen, um mein Unterbewusstsein zu reinigen.
»Ich weiß nie, ob ich dich bewundernswert oder bemitleidenswert finde.«
Ich zuckte so sehr zusammen, dass ich beinahe das Gleichgewicht verloren hätte und doch noch von der Leiter gefallen wäre. Im letzten Moment umklammerte ich die oberste Sprosse und sah über meine Schulter.
Dort unten, ein paar Meter vom Ende der Treppe entfernt, stand ein junger Mann neben dem Kassentisch und lächelte breit zu mir auf. Mein Blick tastete über die attraktiven Züge mit dem kantigen Kinn und den tiefdunkelbraunen Augen. Obwohl ich dieses Gesicht sehr mochte, war es momentan das letzte, das ich sehen wollte.
»Hey, Lex.« Mit einem bemühten Lächeln stieg ich die Leiter wieder hinab. »Und wie darf ich das verstehen?«, fügte ich hinzu, als ich unten angekommen war und mir die Hände an der dunklen Jeans abklopfte.
Lex grinste und lehnte sich gegen den lichterkettenumwickelten Baumstamm, der neben dem Kassentisch stand und dessen Äste bis hoch zur Decke reichten. »Es ist Freitagabend und du bist an dem einzigen Ort in York, an den sich keine Menschenseele verirrt.«
»Zu deiner Information: Ich habe allein in der letzten Stunde drei Bücher verkauft.« Ich sah ihn vielsagend an und rollte die Leiter zurück an den Anfang des Regals.
»Du weißt, dass es nicht zählt, wenn du an dich selbst verkaufst, oder?«
Lex’ spöttische Stimme brachte mich dazu, ihm die Zunge herauszustrecken. Dabei hatte er leider recht. Vor- und Nachteil meines Aushilfsjobs gleichermaßen war es, dass ich ständig auf neue Bücher stieß, in die ich mich Hals über Kopf verliebte, sodass mir nichts anderes übrig blieb, als sie zu kaufen. Vermutlich hatte ich, seit ich hier aushalf, mehr Geld ausgegeben als verdient.
Während ich zum Tisch ging, musterte ich Lex beiläufig.
Er trug wie so oft Schwarz – dunkle Stoffhose, eng anliegendes Shirt und darüber eine ausgebeulte Bomberjacke. Der Wind hatte sein dunkelbraunes Haar zerzaust und seine Wangen etwas gerötet. Schon als ich ihn das erste Mal gesehen hatte, hatte ich an James Dean in Denn sie wissen nicht, was sie tun denken müssen.
Hastig wandte ich den Blick ab, als die Erinnerung des Traums der vergangenen Nacht durch meinen Kopf zuckte. Noch immer spürte ich seine Berührungen auf meinem Körper so deutlich, als wären seine Fingerkuppen in Magma getunkt gewesen. Solche Träume waren mir sowieso schon unangenehm. Aber wenn sie meinen besten und genau genommen einzigen Freund einschlossen, waren sie nur peinlich. Verlegen rieb ich mir übers Gesicht und lief um den Verkaufstisch herum, um Abstand zwischen uns zu bringen.
»Du siehst müde aus. Hattest du eine wilde Nacht?«, fragte Lex arglos und nahm sich ein paar Nüsse aus dem Schälchen Studentenfutter, das auf dem Tisch stand.
Meine Wangen wurden wärmer und ich schob die neuen Bücher in den Rucksack, um ihn nicht ansehen zu müssen. »Absolut. Ich hatte ein heißes Date mit meinem Essay über antike Mythologie.« Immerhin war das nur zur Hälfte gelogen. Ich hatte tatsächlich bis spät abends an meinem Essay gesessen.
Zwar hatte ich danach lange geschlafen, aber ich fühlte mich so gerädert, als hätte ich kein Auge zugetan. Vermutlich war auch mein Unterbewusstsein während des Traums so peinlich berührt gewesen, dass es sich nicht entspannen konnte.
Lex musterte mich aufmerksam. Sein Blick glitt von meinen eisblauen Augen hin zu meinem Mund, der leicht bebte. Schnell presste ich die Lippen aufeinander und wandte mich ab. Reiß dich zusammen, befahl ich mir streng.
Lex und ich hatten uns vor ein paar Monaten in der Kaffeeschlange des Uni-Cafés kennengelernt. Ich hatte mein Geld vergessen, was mir natürlich erst aufgefallen war, als der Becher schon vor mir gestanden hatte. Und während ich hochrot angelaufen und zusammenhangslose Entschuldigungen gemurmelt hatte, hatte sich dieser junge Mann neben mich gestellt und für mich bezahlt. Das hatte die Situation zwar nicht weniger peinlich gemacht, mir aber dennoch einen ersten Freund an dieser riesigen Uni verschafft.
Ich war vor einem Jahr fürs Studium nach York gezogen und tat mich schwer damit, in den überfüllten Seminaren Anschluss zu finden. Im Grunde legte ich es auch nicht darauf an. Ich hatte kein Interesse an tiefergehenden Freundschaften. Zumindest hatte ich das geglaubt, bis ich Lex über den Weg gelaufen war. Mit ihm war alles von Anfang an so einfach gewesen, dass ich mich nicht dagegen hatte wehren können oder wollen. Ich hatte ihm vom ersten Moment an vertraut, so, als würden wir einander schon ewig kennen. Wir trafen uns im Café zur Mittagspause, lernten zusammen in der Bibliothek, kochten abends und sahen uns Filme an oder gingen aus und erkundeten diese verwinkelte Stadt. Wir waren rein platonische Freunde. Es war perfekt, wie es war. Zumindest in der Realität. Mein gestörtes Traum-Ich würde daran bestimmt nichts ändern, das würde ich nicht zulassen.
Mit einem bemühten Lächeln erwiderte ich seinen forschen Blick. »Aber heute habe ich das Essay abgegeben und bin diesen anstrengenden Liebhaber endlich los«, meinte ich gut gelaunt und entlockte ihm damit ein leichtes Grinsen.
»Worüber hast du geschrieben?«
»Über Kassandra.«
Lex zog die Augenbrauen nach oben. »Und jetzt noch die längere Version für diejenigen unter uns, die keine nerdigen Geschichtsfreaks sind.«
Ich warf eine Nuss nach ihm, die er gekonnt aus der Luft fing und sich in den Mund steckte. Dabei sah er mich so auffordernd an, dass ich widerwillig ausholte. »Kassandra war eine Tochter des trojanischen Königs Priamos. Sie wurde vom Gott Apollon mit der Gabe des Weissagens beschenkt, weil er in sie verliebt war. Als sie trotzdem nichts von ihm wissen wollte, hat er das Ganze um den Fluch ergänzt, dass ihr niemand jemals glauben würde, was sie vorhersagte.« Meine Stimme wurde immer leiser, bis sie schließlich ganz versagte. In den letzten Tagen hatte ich so viel über Kassandras Geschichte gelesen, dass es sich anfühlte, als hätte es sie wirklich gegeben … als hätten wir einander gekannt. Und nicht nur deswegen konnte ich mich besser in sie hineinfühlen, als ich es tun sollte.
Lex runzelte die Stirn. »Ziemlich unschönes Schicksal.«
Ich lächelte schief. »Davon gibt es in der griechischen Mythologie eine ganze Menge.«
»Ein Grund mehr, aus dem ich nicht verstehe, warum du so etwas Dröges studierst.«
»Geschichte ist nicht dröge«, widersprach ich entschieden. »Sie ist lebhafter als alles andere.«
»Genau genommen ist sie ziemlich tot. Im Grunde ist alles, womit du dich rund um die Uhr beschäftigst, längst vergangen.« Er machte eine vielsagende Handbewegung, die den ganzen Laden einschloss.
Diesmal traf ihn die Erdnuss direkt an der Schläfe. Mit einem leisen Klacken fiel sie auf das Holz zwischen uns. Lex warf mir einen amüsierten Blick zu und steckte sie sich trotzdem in den Mund.
»Hör auf, dich über mich lustig zu machen«, warnte ich ihn. »Ich mag das Vergangene einfach. Es ist viel kontrollierbarer als die Zukunft.« Kaum dass das letzte Wort gesprochen war, hätte ich mir am liebsten auf die Zunge gebissen. Das passierte mir oft vor Lex. Ich sagte mehr, als ich sollte. Erneut sah ich auf meine Armbanduhr. Das goldene Ziffernblatt zeigte nicht nur die Uhrzeit an, sondern in einer kleinen Aussparung im oberen Bereich eine weitere Zahl. Die winzige 181 sprang direkt in mein Herz und grub sich mit spitzen Nägeln hinein. Ich schob den Ärmel des Pullovers über das dünne Lederarmband und konzentrierte mich wieder auf Lex. »Außerdem kann nicht jeder etwas so Geistloses wie Wirtschaft studieren.«
Er fasste sich theatralisch ans Herz. »Autsch, das saß. Und ich dachte, wir wären Freunde.«
Mein Herz stolperte und ich bemühte mich um ein Lachen – es klang ebenso erbärmlich, wie ich mich fühlte. »Freunde halten sich nicht von der Arbeit ab. Was willst du hier?«
»Ich dachte, ich nehme einen kleinen Umweg, um dich zu fragen, ob du heute nicht doch mitkommen möchtest.«
Lex war im Gegensatz zu mir ein überaus sozialer Mensch.
In der Uni sah ich ihn ständig in wechselnder Begleitung, seine Freizeit verbrachte er allerdings meist mit seinen Mitbewohnern oder mir. Warum er das tat, verstand ich noch immer nicht. Ich hatte mein Leben lang enge Freundschaften vermieden, daher wusste ich, dass ich kein Naturtalent darin war. Und so gern ich Lex auch hatte, es gab diese Tage, an denen selbst er mir zu viel war. Insbesondere heute, da ich nicht ausblenden konnte, dass ich vergangene Nacht davon geträumt hatte, ihm sein Shirt auszuziehen.
»Bedaure, aber mir ist heute wirklich nicht danach, in den Pub zu gehen, mich mit euch zu betrinken und mir Ezras neueste Frauengeschichten anzuhören.«
Lex schüttelte den Kopf, doch überrascht wirkte er nicht. »Du bist ein Einsiedlerkrebs, Lia.«
»Und damit bin ich voll und ganz zufrieden. Grüß die Jungs von mir.« Ich machte eine scheuchende Handbewegung.
Lex seufzte und ging zur Tür. »Na gut. Ich ruf dich morgen an und berichte, was du Spaßbremse verpasst hast.«
Ich verdrehte erneut die Augen, aber da hatte er schon den Laden verlassen. Zurück blieb der Duft seines zitronigen Aftershaves, der sich unter den vertrauten Geruch der Bücher mischte und ein leichtes Kribbeln in meinem Körper auslöste.
»Reiß dich zusammen!«, wiederholte ich laut, ehe ich mich daran machte, weiter aufzuräumen. Ich würde mir heute definitiv einen blutigen Horrorfilm vor dem Schlafen ansehen. Jeder Albtraum war mir lieber, als davon zu träumen, mit Lex rumzumachen.
Als ich den Laden kurz darauf abschloss, war von seinem gemütlichen Zauber kaum noch etwas zu erahnen. Allein die Leuchtköpfe der Lichterkette, die um den Eingang geschwungen war, wurden in den dunklen Scheiben wie Sterne reflektiert. Es war zwar erst September, doch durch das beständige Grau des Himmels wirkte die Dämmerung in York düsterer als in anderen Städten. Die Fenster des Bistros gegenüber leuchteten goldgelb, ansonsten schmiegten sich die Häuser in dem schmalen Hof gefügig in die einsetzende Dunkelheit.
Fröstelnd schlug ich den Kragen des Mantels hoch und stopfte mein schwarzes Haar darunter, um die kühle Luft fernzuhalten. Ich mochte diese Jahreszeit – das sanfte Umschwingen der Natur, die bunten Farben, die gemächlich über das Sommergrün hinwegschwemmten. Ich lebte zwar erst seit einem Jahr hier, aber ich wusste, dass im Herbst andere Touristen kamen: die gemütlicheren, die einen Hang für alte Buchhandlungen in verwinkelten Gassen hatten. Für das Geschäft war das günstig, auch wenn ich nichts dagegen hatte, den Laden für mich zu haben. Lex hatte recht, das Second Star war einer der wenigen Orte in York, an denen es noch Ruhe gab. Ein blinder Fleck in einer Stadt, in der sich rund ums Jahr Menschen aus aller Welt tummelten. Ich liebte alles an meiner persönlichen Oase der Stille: den Geruch des Papiers, das weiche Licht der Deckenlampen, die meterhohen Buchregale. Wenn ich an ihnen hinaufsah, wurde mir bewusst, wie viele Geschichten es auf der Welt gab. Und wie unbedeutend meine in diesem Kosmos war – wie nichtig die Sorgen waren, die mir manchmal so verschlingend vorkamen.
Das Buchgeschäft lag am Rande des Stadtkerns und zu dieser Uhrzeit waren die schmalen Straßen verlassen. Ich musste lediglich einer Gruppe lachender Mädchen ausweichen, die sich untergehakt hatten und eine Flasche Wein herumreichten. Ihre hohen Absätze schlugen wie winzige Hämmer auf den Asphalt ein, als sie Richtung Innenstadt davoneilten.
Für einen Moment spürte ich das Flackern von Wehmut in meiner Brust. Ich verscheuchte es hastig. Alles, was ich brauchte, waren ein Bad, ein Glas Rotwein und ein geliehenes Leben, das zwischen zwei Buchdeckeln auf mich wartete. Jede einzelne Welt bot mir einen neuen Unterschlupf, eine Zuflucht vor meinen Gedanken und dem Chaos in mir.
Als ich gerade um eine Ecke bog, spürte ich ihn. Den Schwindel. Abrupt blieb ich stehen und stützte mich an der Backsteinwand ab. Es fühlte sich an, als würden sich meine Gedanken krampfhaft zusammenziehen, um Platz für etwas anderes zu schaffen. Meine Sicht verschwamm, ich schloss die Augen. Ich kannte dieses Gefühl gut genug, um zu wissen, dass ich es nicht ignorieren sollte. Ganz gleich, wie lästig es war, es hatte mir schon oft unangenehme Situationen erspart. Genau genommen hatte es mir das Leben gerettet. Mehrmals. Erst vor wenigen Tagen hatte es mich davor bewahrt, von einem Auto überfahren zu werden.
Widerwillig presste ich zwei Finger gegen meine Schläfen und ließ mich in das Loch fallen, das sich in mir aufgetan hatte. Die Quelle des Tosens in mir.
***
Die Gasse wand sich wie ein dunkler Fluss durch die Nacht. Im offenen Fenster über mir bewegte sich sacht ein Windspiel, die Glöckchen flochten ihre Melodie zwischen den Widerhall meiner Schuhe auf dem Asphalt. Ich nahm sie erst nicht wahr, die anderen Schritte, die sich mir näherten – zügig und entschieden. Ich zog den Kragen meines Mantels höher, drückte mich näher an die Wand, um Platz zu machen.
Meine Schritte wurden langsamer, die anderen schneller. Ein leichter Windzug an meinem Haar, ein Außertaktgeraten meiner Füße, dann umfasste jemand meine Schulter und riss mich herum, drückte mich in einer einzigen fließenden Bewegung gegen die Backsteinwand.
Ich atmete laut aus, schrie aber nicht, starrte nur hinauf in das Gesicht, das sich dicht über meines beugte. Ein kantiges Kinn, eine schmale Narbe an der Wange, braunes Haar und Dreitagebart. Ein Lächeln, freundlich, ein wenig zerknirscht. »Tut mir leid«, sagte er, in der warmen Stimme aufrichtiges Bedauern. Noch bevor ich etwas erwidern konnte, presste sich seine Hand auf meinen Mund. Mit ihr ein Tuch, das nach Säure und ewigem Schlaf roch.
Meine Arme schossen hinauf, versuchten ihn wegzuschlagen, mein Schrei ertrank im nassen Stoff, mein Körper wurde unter seinem festen Griff weich und schwer. Und dann war da … nichts. Nichts als Schwärze und Stille.
***
Keuchend riss ich die Augen auf. Mein Inneres taumelte noch immer, aber meine Gedanken klärten sich allmählich.
Das war übel. Wirklich übel.
Ein Blick nach vorn genügte, um mich erkennen zu lassen, wie nah diese Szene war. Diese Gasse war die, die ich gerade gesehen hatte. Nicht dieselbe Höhe, aber doch dieselbe Straße. Wenn ich weitergehen würde, würde ich mit Sicherheit an einem Windspiel im Fenster vorbeikommen. Und dann würde sich ein attraktiver, offensichtlich psychopathischer Kerl auf mich stürzen und mich betäuben. Ich hatte zwar keine Ahnung, wieso er das tun sollte, aber ich wusste, dass er es tun würde. Mein Herzklopfen beschleunigte sich und mir wurde so übel, dass ich mich am liebsten auf dem Asphalt zusammengekauert hätte. Doch dafür blieb jetzt keine Zeit.
Was ich gesehen hatte, würde passieren – wenn ich weiterlief. Wenn ich jetzt umdrehte, änderte das zwar den Ablauf, aber das bedeutete nicht, dass dieser Typ nicht an anderer Stelle auftauchen würde. Dass ich wusste, wo und wann er mich überfallen würde, konnte ein Vorteil sein.
Entschlossen richtete ich mich auf und wischte mir mit dem Handrücken den kalten Schweiß von der Stirn. Die zwei Bücher, die nicht in meinen Rucksack gepasst hatten, umklammerte ich vor der Brust, dann ging ich mit langsamen Schritten weiter. Weiter hinein in die dunkle Gasse, die nichts als Gefahr für mich barg. Warum zum Teufel musste ich auch in dieser menschenverlassenen Gegend arbeiten? Und warum hatte ich nicht eingewilligt, Lex zu begleiten? Selbst ein überfüllter Pub und Ezras selbstgefällige Anekdoten wären mir lieber gewesen als das hier. Hätte ich doch nur … Weiter kam der unnütze Gedanke nicht.
In diesem Moment hörte ich das sachte Klingeln über mir. Mein Blick glitt zum offenen Fenster mit dem Windspiel, ehe ich mich wieder auf die Straße vor mir fokussierte. Und dann waren die Schritte da.
Er gab sich keine Mühe, leise zu sein. Warum auch? York war eine große Stadt, man konnte nicht damit rechnen, allein zu sein. Nur weil jemand in derselben Gasse lief, bedeutete das nicht, dass er einem etwas antun wollte. Ein nervöses Lachen kitzelte in meinem Hals, ich schluckte es herunter und drängte mich an die Wand, umklammerte die Bücher fester. Panik kroch in meine Muskeln, aber ich zwang mich gelassen weiterzugehen. Wenn ich anfing zu rennen, würde ihn das womöglich dazu bringen, sein Vorgehen zu ändern.
Die Schritte wurden lauter, mein Herzschlag auch. Ich wartete, bis ich den Windhauch an meinem Haar spürte, dann fuhr ich auf dem Absatz herum und schmetterte die Bücher mit voller Kraft in das Gesicht des Mannes, der dicht hinter mir war. Ein erstickter Schrei ertönte, aber ich wartete nicht ab, um zu sehen, ob der Schlag ausgereicht hatte. Ohne zu zögern, ließ ich die Bücher fallen und rannte los – um die Ecke und in die nächste Gasse hinein.
Das Problem mit dem Verändern der Zukunft lag darin, dass man nicht mehr sagen konnte, was danach passierte. Ein winziger Unterschied im Ablauf stellte alles auf den Kopf. Ich wusste nur, dass ich möglichst schnell weg von hier musste. Diese Ecke Yorks besaß kaum Läden, die noch aufhatten. Ich musste einen Ort mit anderen Menschen finden, von denen mich keiner betäuben wollte. Bis zur Hauptstraße waren es nur wenige Hundert Meter, wenn ich es dort in einen der Pubs schaffte, hatte ich eine Chance.
Der Mantel wehte um meine Waden, als ich durch die Nacht rannte. Mein Puls hämmerte in meinen Ohren, ich konnte unmöglich ausmachen, ob er mir folgte. Ich horchte nach dem Schwindel in mir, aber da war nichts. Erleichtert sprintete ich um eine weitere Ecke und … prallte gegen etwas.
Hände schlossen sich um meine Oberarme und hielten mich fest. Meine Füße standen zwar still, aber mein Herz raste weiter, daher brauchte ich einen Moment, bis ich es schaffte, ihn anzusehen. Fahrig tastete mein Blick über das dunkle Shirt hinauf in ein Gesicht. Ein ziemlich schönes Gesicht. Goldblonde Locken, mandelförmige Augen und ein sanft geschwungener Mund, der allerdings zu einem Strich verzogen war. Als er meinen fassungslosen Ausdruck sah, lächelte er. Etwas schief und eher grimmig als freundlich.
»Mich hast du nicht kommen sehen, hm?«
Die Angst schloss sich mit kalten Fingern um mein Herz. Hektisch versuchte ich mich von ihm loszumachen, aber er hielt mich ungerührt fest. Sein Blick glitt über meinen Kopf hinweg und blieb an etwas hängen, das sein Lächeln breiter werden ließ. »Ist sie gebrochen?«, fragte er.
Ein ersticktes Stöhnen ertönte und brachte mich zum Zusammenzucken. »Hör auf zu grinsen, Ves. Sonst breche ich dir gleich weit mehr als die Nase.«
Ich fuhr herum – zumindest, so gut es ging –, während der Typ noch immer meinen Arm umklammert hielt. Der junge Mann, dem ich die Bücher ins Gesicht geschmettert hatte, stand nur wenige Schritte von uns entfernt. Er hatte ein Taschentuch vor die Nase gepresst, aber das Blut hatte sich längst durch den Stoff gefressen. Seine Augen funkelten, als er meinen Blick auffing. Reflexartig wich ich vor ihm zurück und stieß erneut gegen den Kerl in meinem Rücken. Ich versuchte mich loszureißen, aber er lockerte seinen Griff kein bisschen.
»Wer seid ihr? Was wollt ihr von mir?« Ich bemühte mich um einen barschen Tonfall. Wut war besser als Angst. Das eine schürte den Drang zu handeln, das andere stürzte mich in einen Zustand der Lähmung.
Der Mann löste das Tuch von seiner Nase. Sie war bereits blutverkrustet, ich sah fort. »Fürs Erste nur, dass du still bist und mitkommst«, sagte er beherrscht.
Beinahe hätte ich hysterisch gelacht. »Bedaure. Das ist nicht ganz das, was ich im Sinn habe.«
Ich kniff die Augen zusammen, versuchte dem Schwindel in mir nachzuspüren. Diesem Sog, von dem ich mich normalerweise, so gut es ging, fernhielt. Jetzt sehnte ich mich danach, mich ihm hinzugeben. Nur kurz, um einen Weg zu finden, die beiden loszuwerden. Doch … da war nichts. In mir war alles still.
»Vorsicht«, warnte der Mann hinter mir.
Goldlöckchen lächelte gelassen auf mich herab. »Keine Sorge. Sie kann mich nicht sehen. Wie wir es uns gedacht haben.«
O Gott, nein. Er konnte unmöglich von mir wissen.
Als er meinen panischen Gesichtsausdruck sah, wurde sein Blick weicher. »Hör zu, Cassy. Wir werden dich mitnehmen – auf die eine oder andere Art«, teilte er mir freundlich mit.
Leider verstand ich absolut gar nichts – weder warum er dachte, mein Name wäre Cassy, noch warum er mich verdammt noch mal entführen wollte. »Wie bitte?«, brachte ich entsetzt hervor.
Er zuckte mit den Schultern. »Du kannst die Sache für uns alle erleichtern, indem du einfach freiwillig in unser Auto steigst, oder aber …«
Weiter kam er nicht, weil ich in diesem Moment mit ganzer Kraft ausholte, ihm ans Schienbein trat und gleichzeitig den Ellbogen gegen seinen Kehlkopf rammte. Er keuchte auf und ließ mich los – beides vermutlich eher aus Überraschung als vor Schmerz. Ehe er sich sammeln konnte, war ich losgerannt.
Hinter mir hörte ich jemanden fluchen, aber das Rauschen in meinen Ohren war zu laut, als dass ich mich darauf konzentrieren konnte. Über meinem Kopf spannten sich bunte Girlanden und aus einem beleuchteten Fenster drang leise Klaviermusik, ansonsten war die Gasse ganz still. Was hätte ich in diesem Moment für eine der Touristengruppen gegeben, die ich sonst verfluchte. Meine Hände rutschten an dem kalt-feuchten Backstein ab, als ich um eine Ecke rannte. Gerade noch rechtzeitig bremste ich ab, ehe ich gegen eine Bauabsperrung prallen konnte.
Ich wusste, dass ich verloren war, noch bevor ich mich umdrehte. Der blonde Mann stand ein paar Schritte von mir entfernt und musterte mich stirnrunzelnd. In mir bahnte sich ein Schluchzen an, aber ich schluckte es hinunter und ballte die Hände zu Fäusten.
»Das war nicht sehr nett, Cassy.« Genervt rieb er sich über den Kehlkopf.
»Mein Name ist nicht Cassy. Ihr verwechselt mich mit jemandem«, brachte ich verzweifelt hervor und hielt auf die Wand zu, als er näher kam. Hinter ihm tauchte der andere auf und sah prüfend die Gasse hinab.
Sein Freund kam weiter zu mir und bedachte mich mit einem unpassend freundlichen Lächeln. »Keine Sorge, wir wissen genau, wer du bist.«
Mein Blick verharrte an seiner Hand, die etwas aus seiner Jackentasche herausholte. Als ich erkannte, was es war, wimmerte ich leise und presste mich dichter an den Backstein. Er blieb nah vor mir stehen. Selbst in dem schwachen Licht des Bauzauns schimmerten sein Haar und seine Augen um die Wette. Seine unbestreitbare Attraktivität machte all das noch absurder.
»Halt jetzt lieber still oder das wird unnötig wehtun.«
Panik biss mir in die Muskeln und ich versuchte nach ihm zu schlagen. Problemlos fing er meine Hand ab und zog mich mit einer Drehung an sich heran, bis mein Rücken an seinen Oberkörper gepresst war.
»Und wieder wählt sie das Oder«, murmelte er an meinem Ohr.
Ich zuckte zusammen, als er mir mit einem Griff das Haar aus dem Nacken hob.
»Bitte nicht«, flehte ich, aber da spürte ich schon, wie er die Spritze in meine Haut schob und den Kolben durchdrückte.
Es dauerte keine fünf Sekunden, bis es begann. Die Dunkelheit zerrte mit bleibesetzten Händen an meinen Sinnen, zog sie an sich, bis alles in mir verschwamm. In einem letzten Impuls zuckten meine Muskeln auf und ich versuchte mich gegen seinen Griff zu stemmen. Vergebens.
Noch bevor ich etwas sagen konnte, sackte alles in mir zusammen. Mein Körper in seine Arme, mein Inneres in das Tosen in mir. Eine neue Art von Schwindel. Eine, die alles verschluckte.
Kapitel 2
Ich wachte auf, weil jemand mir gegen die Schläfen trat. Stöhnend drehte ich mich um und umklammerte meinen Kopf. Es dauerte kurz, bis ich begriff, dass die Schmerzquelle in mir selbst saß. Wie viel hatte ich gestern getrunken? Verdammt, es war jedes Mal eine miese Idee zu versuchen, mit Lex und den anderen mithalten zu wollen.
»Nie wieder Alkohol«, murmelte ich und rieb mir über die schweißfeuchte Stirn.
Ein weiches Lachen ertönte und ließ mich erstarren. Nein, nein, nein! So betrunken konnte ich nicht gewesen sein. Das durfte nicht passiert sein. Es kostete mich alles an Überwindung, mir nicht die Decke über den Kopf zu ziehen, sondern vorsichtig zu blinzeln.
Ich rechnete fest damit, Lex zu sehen. Stattdessen sah ich erst einmal nur eine wild gemusterte Tapete. Die bunten Rechtecke waren so chaotisch angeordnet, dass mir ein wenig schummrig wurde. Das hier war nicht meine Wohnung. Und auch nicht Lex’. Irritiert ließ ich den Blick weiterschweifen, vorbei an einem schmalen Nachttisch, auf dem Plastikblumen in einer Vase standen, hin zu einem Fenster, dessen Rollo heruntergezogen war, und einer danebenliegenden Tür.
O Gott. Warum wache ich in einem Motelzimmer auf?
Als meine Augen weitertasteten, erstarrte ich.
Auf dem Sessel, der ein paar Meter vom Bett entfernt stand, saß jemand. Nicht irgendjemand. Ein blond gelockerter, ziemlich amüsiert wirkender Typ, der mir unangenehm bekannt vorkam. Er hatte die Arme vor der Brust verschränkt und begegnete meinem Blick, indem er die Augenbrauen hinaufzog.
»Gut geschlafen, Cassy?«
Seine Stimme riss mich endgültig ins Hier und Jetzt. Augenblicklich schoss ich in die Höhe, mit einem Schlag war alles zurück. Ich hatte keinen Kater, mein Kopfschmerz musste eine Nachwirkung des Mittels sein, das mir dieser Psychopath gespritzt hatte, um mich zu entführen. Meine Zunge fühlte sich von all den Worten, die ich sagen wollte, bleischwer an, aber ich schaffte es nicht, sie loszulösen.
Es gab eine Sache, die wichtiger war als alles andere. Langsam ließ ich die Decke sinken, die ich beim Hochschrecken mitgerissen hatte.
Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht.
Ich hielt die Luft an und sah an mir hinab, ließ den Blick über den grauen Pullover hin zu dem Stoff der Jeans und den flauschigen Socken gleiten. Bis auf Schuhe und Mantel war ich vollständig bekleidet. Vor Erleichterung hätte ich beinahe angefangen zu weinen.
»Wir haben dir nichts getan.« Goldlöckchens Stimme klang weicher und als ich es schaffte, ihn anzusehen, wirkte auch sein Gesichtsausdruck weniger spöttisch.
Ich schnaubte und tastete nach der Stelle in meinem Nacken. Die verletzte Haut wummerte sacht auf. »Ich denke, da haben wir verschiedene Maßstäbe.«
»Das war die einzige Möglichkeit, dich mitzunehmen, ohne halb York auf uns aufmerksam zu machen.« Er zuckte mit den Schultern. »Du bist erstaunlich wehrhaft.«
»Dafür, dass ich eine Frau bin?«, fragte ich bissig. Ich wollte gar nicht wissen, wie viele Vergleichsmöglichkeiten er hatte, um eine solche These aufzustellen. Wo zum Teufel war ich da nur hineingeraten?
»Dafür, dass du keine Ahnung hast, wer du bist. Hast du mal Kampfsport gemacht?«
Dachte er ernsthaft, er hätte ein Recht darauf, Fragen zu stellen? Wütend richtete ich mich weiter auf, schlug die Decke beiseite und zog meinen verrutschten Pullover zurecht.
»Mich würde mehr interessieren, wer du bist. Und warum, um alles in der Welt, ihr mich hierhin verschleppt habt. Und wo ›hierhin‹ eigentlich ist. Und …«
Ich brach ab, weil mir in diesem Moment etwas ins Gesicht flog. Hastig griff ich nach dem dunklen Shirt und funkelte zu Goldlöckchen hinüber. Er grinste – ein Mundwinkel wanderte dabei etwas höher als der andere, aber selbst das sah unverschämt gut aus. Das war doch nicht normal – wieso durfte ein Psychopath so attraktiv sein?
»Zieh dich um! Wir müssen los.«
»Und wenn ich nicht mitkommen will?«, zischte ich und warf das Shirt zurück.
Er fing es problemlos ab. »Ich bitte dich nicht um Erlaubnis.«
»Tja, ich verwehre sie dir trotzdem.« Wütend stand ich mit einem Schwung vom Bett auf. Ein leichter Schwindel setzte ein, aber ich ignorierte die hellen Pünktchen vor meinen Augen und ging auf die Tür zu.
Ich versuchte es zumindest, kam aber nur zwei Schritte weit, bis er vor mir stand. So nah, dass ich den Kopf in den Nacken legen musste, um ihm ins Gesicht sehen zu können. Die Belustigung war nicht ganz aus seinen Zügen verschwunden, aber jetzt erkannte ich dort noch etwas anderes. Anspannung und einen Funken … Warnung?
»Ich habe keine Zeit für Spielchen«, teilte er mir ruhig mit. »Also, entweder ziehst du dich jetzt um und kommst mit mir oder ich sehe mich dazu gezwungen, beides ohne deine Einwilligung für dich zu übernehmen. Und ich an deiner Stelle«, er neigte sich zu mir herunter, bis seine Nasenspitze fast meine berührte, »würde es nicht noch einmal auf das Oder ankommen lassen.«
Hitze schoss in meine Wangen und ich biss die Zähne fest aufeinander, um sie nicht alternativ in die Hand zu graben, die mir das Shirt entgegenhielt. Vermutlich blieb mir erst einmal keine Wahl, als mitzuspielen. Wer auch immer das war, er wusste, was ich konnte. Und aus irgendeinem Grund funktionierten meine Fähigkeiten nicht in seiner Nähe. Ich war vielleicht wehrhaft, aber ich war keine Superheldin. Gegen einen 1,90 Meter großen, breitschultrigen Kerl mit ausgeprägtem Ego hatte ich keine Chance. Ich musste auf eine bessere Möglichkeit warten, um abzuhauen.
Mühsam beherrscht riss ich ihm das Shirt aus der Hand. »Wird das eine Peepshow oder bekomme ich noch mehr?«
Erneut zuckte ein Grinsen über sein Gesicht und er wich einen Schritt von mir zurück. »Der Rest liegt im Bad. Das übrigens keine Fenster hat.« Er bedachte mich mit einem vielsagenden Blick und ich versuchte, nicht allzu ertappt auszusehen. »Ich warte hier. Und beeil dich.«
Fünf Minuten später war ich mir sicher, dass diese Typen mich mit jemanden verwechselten. Die Kleidung war viel zu groß. Die schwarze Stoffhose hielt nur, weil ich den Gürtel aus meiner Hose so eng schnürte, wie ich konnte, das Shirt und der Kapuzenpullover schlackerten um meinen Oberkörper und verhöhnten das bisschen, das ich an Kurven hatte. Skeptisch starrte ich in den Spiegel über dem Waschbecken. Ich hatte versucht die Reste der Schminke bestmöglich zu beseitigen, als Folge dessen sah ich aus wie eine wandelnde Leiche. Mein Teint hing immer zwischen Vampirblässe und Lebensmittelvergiftung fest und ohne meinen Lidstrich und das Rouge war das unübersehbar. Die Betäubung hatte dazu nichts Gutes beigetragen. Meine blauen Augen wirkten stumpf und meine Mundwinkel waren eingerissen. Und trotz alledem – und ich hasste es – wusste ich, dass ich noch immer gut aussah. Wenn ich mich so betrachtete, dann erkannte ich für einen flüchtigen Augenblick, was die Menschen in mir sahen, die mich täglich so auffällig anstarrten. Meine Züge waren nahezu vollkommen symmetrisch, die Wangenknochen ausgeprägt, die Nase gerade und der Mund so freundlich geschwungen, dass nicht auffiel, wie selten ich damit lächelte. Ich wurde oft schön genannt, aber es bedeutete mir nichts. Dieses Gesicht war eine Maske und ich konnte sie einfach nicht ablegen. Es zog Menschen an, die ich doch nur von mir stoßen musste. Manchmal war ich mir sicher, dass das Universum mich nur so hatte aussehen lassen, um mich noch mehr zu quälen. Und da das wohl nicht gereicht hatte, hatte es nun beschlossen mich entführen zu lassen. Ich seufzte und kämmte mir mit den Fingern notdürftig das Haar, dann verließ ich das Bad.
Goldlöckchen lehnte an der Tür, als hätte er damit gerechnet, dass ich versuchen würde, an ihm vorbeizurennen. Er musterte mich und sein Grinsen vertiefte sich erneut. »Du bist ein bisschen dünner, als Leander geschätzt hat.«
»Kommt darauf an. Wenn wir uns bei einer Hip-Hop-Meisterschaft einschleichen wollen, komme ich mir passend gekleidet vor.«
Er bedachte mich mit einem irritierten Blick. Vielleicht entsprach mein Verhalten nicht seinen Erwartungen. Meinen, um ehrlich zu sein, auch nicht. Vermutlich hätte ich das Ganze ernster nehmen und als Bedrohung erkennen sollen. Aus irgendeinem Grund spürte ich jedoch keine Angst mehr in seiner Nähe. In der dunklen Gasse hatte er um einiges gefährlicher gewirkt als vor dieser albernen Tapete. Ich war vor allem wütend und genervt.
Herausfordernd zog ich eine Augenbraue hoch. Etwas, das ich ziemlich gut konnte. »Können wir jetzt gehen?«
Er stieß sich von der Tür ab und kam auf mich zu. Seine Augen verdunkelten sich, als wollte er bewusst darüber hinwegtäuschen, dass er aussah wie ein Männermodel, das in seiner Freizeit gern surfte, und nicht unbedingt wie ein skrupelloser Massenmörder. »Wenn du versuchst abzuhauen«, setzte er an und ich musste mir ein Stöhnen verkneifen.
»… wirst du ganz furchtbar wütend werden und mich über deine Schulter werfen oder betäuben oder andere wahnsinnig bedrohliche und männliche Dinge tun«, beendete ich seinen Satz genervt. »Ich habe es kapiert, Goldlöckchen.«
Er schüttelte leicht den Kopf und musterte mich skeptisch. »Gut. Und nenn mich nicht so. Mein Name ist Vesper.«
Bevor ich ihn daran erinnern konnte, dass ich auch nicht Cassy hieß, hatte er sich abgewandt und öffnete die Tür. Das helle Sonnenlicht stach mir in die Augen und ich kniff sie stöhnend zusammen. Plötzlich erschien mir das muffige, abgedunkelte Motelzimmer doch recht angenehm.
Vesper blinzelte nicht einmal. Die Sonne ließ sein Haar golden flimmern, als trüge er einen Heiligenschein oder eine Krone aus Licht. »Los jetzt!«
***
Insgeheim hatte ich die leise Hoffnung gehabt, wir würden uns noch in York befinden. Hätte das Motel irgendwo in der Stadt gestanden, hätte ich mich nur auf die Straße stellen und laut um Hilfe schreien müssen. Ein Blick auf die Umgebung reichte jedoch aus, um festzustellen, dass wir uns weit außerhalb von York befanden.
Vor der Tür zeichnete sich ein weitläufiger Parkplatz ab. Das Motel war in U-Form um diesen herumgebaut, etwa dreißig allesamt geschlossene Türen konnte ich sehen. Insgesamt standen rund ein Dutzend Autos auf der Asphaltfläche, aber nur ein einziger Mensch vor einem davon.
Ich erkannte ihn sofort, obwohl er längst nicht mehr blutete. Mit verschränkten Armen lehnte er an einer schwarzen Motorhaube. Eine Sonnenbrille in den Haaren, ein Lächeln auf den Lippen. Er trug dieselben Kleider wie vergangene Nacht und so zerknittert, wie sein Gesicht wirkte, hatte er kaum geschlafen.
»Guten Morgen«, meinte er freundlich, als wir vor ihm stehen blieben. Zu freundlich, angesichts der Tatsache, dass ich nicht freiwillig hier war und ihm außerdem beinahe die Nase gebrochen hatte. Er musterte mich und verzog das Gesicht. »Bisschen groß die Sachen, was?«
Ich ignorierte ihn, Vesper hingegen schlug ihm im Vorbeigehen gegen die Schulter. »Dein Augenmaß ist wirklich hervorragend, Leander.«
Dieser verdrehte die Augen. »Die Auswahl in diesem Souvenirshop war nicht gerade berauschend. Und ich dachte, ich kaufe lieber ein paar Männerklamotten, als ein ›Party und Bier – drum sind wir hier‹-Shirt.«
Ich runzelte die Stirn und sah mich noch einmal um. In der Ferne konnte ich grüne Berge erkennen. Berge, die mir nicht im Entferntesten bekannt vorkamen. Es musste Vormittag sein, in der Luft hing der Rest morgendlicher Dämmerung und es war so frisch, dass ich unter dem dünnen Hoodie zu frösteln begann und mich nach meinem Mantel sehnte. Leider hatte Goldlöckchen mir meine eigenen Kleider allesamt abgenommen. Lediglich die Turnschuhe hatte ich anziehen dürfen. Wozu das alles gut sein sollte, hatte er mir nicht verraten.
»Wo sind wir?«, fragte ich, während Vesper den Kofferraum öffnete und eine Tasche hineinwarf.
»In der Nähe von Perth«, erwiderte Leander.
Fassungslos starrte ich ihn an. »Wir sind in … Schottland?«
»Bis nach Australien haben wir es über Nacht leider nicht geschafft.« Er lächelte mich so verschmitzt an, als hätte er mich mit einem Roadtrip zum Geburtstag überrascht. Gruselig.
»Könnt ihr mir endlich erklären, was das hier soll? Was wollt ihr von mir?« Ich bemühte mich um einen freundlichen Tonfall, auch wenn ich am liebsten geschrien hätte. »Ich bin eine Studentin, die in einem winzigen Appartement wohnt und in einer Buchhandlung jobbt und ich habe keine reiche Familie. Wenn ihr Geld wollt …«
»Wir wollen kein Geld von dir«, unterbrach Vesper mich genervt. Als ich aufsah, war er dabei, sich einen anderen Pullover überzuziehen. Für den Bruchteil eines Moments konnte ich den Ansatz seiner Leistenmuskulatur sehen. Schnell konzentrierte ich mich auf Leander. »Sondern?«
»Es geht nicht darum, was du hast, sondern um das, was du kannst.«
»Was ich … kann?« Ein Teil von mir betete, dass ich das gestern falsch verstanden hatte. Es ergab keinen Sinn, dass sie davon wussten. Niemand wusste davon.
»Deine Visionen«, erwiderte Leander leichthin und löschte damit den letzten Funken Hoffnung.
Vision – das war nicht das Wort, das ich dafür benutzte. Es klang zu sehr nach einer Begabung, nach einem Segen, nach einem außergewöhnlichen Talent. Für mich war es nichts davon. Es war ein Fluch. Ein Fluch, der mich alles kostete.
Ja, ich verdankte es dieser Fähigkeit, dass ich einige Unfälle vermieden hatte, doch sie war auch der Grund, warum es kein richtiges Leben war.
Der Schwindel in mir war da, seit ich denken konnte, aber je älter ich wurde, desto lauter und verschlingender zeigte er sich. Dieser Abgrund in mir zehrte an meinem Bewusstsein.
Ein Teil von mir war ihm längst verfallen, war verschwunden in einer Dunkelheit, aus der er nie wieder zurückkommen würde. Ich versuchte den Rest von mir von dort fernzuhalten, ließ mich nur in das Tosen sinken, wenn es so zunahm, dass ich begriff, dass es der Warnung diente. So wie gestern Nacht. Nur dass dieses Mal etwas schiefgegangen war. Der Schwindel hatte mich nicht schützen können. Nicht vor diesem Typen. Und auch jetzt war es immer noch still in mir.
Ich verschränkte die Arme vor der Brust und beschloss kurzerhand mir das Leugnen zu sparen. »Ich kann euch nicht die Zukunft vorhersagen, wenn ihr das denkt. So funktioniert das nicht. Ich kann es nicht kontrollieren.« Es kontrolliert mich, dachte ich grimmig.
Leander schüttelte den Kopf. »Auch darum geht es nicht. Wir benötigen einfach deine Hilfe … bei etwas.«
»Meine Hilfe«, wiederholte ich gedehnt. »Euch ist klar, dass ich nach dieser Aktion nicht unbedingt darauf aus bin, euch zu helfen? Hättet ihr nicht einfach fragen können?«
Vesper warf den Kofferraum mit einem lauten Knall zu. »Ich bin sicher, da hättest du direkt zugestimmt, nicht? Du bist ja ein wahnsinnig warmherziger Mensch.«
»Tu nicht so, als würdest du mich kennen«, zischte ich und funkelte ihn über das Auto hinweg an.
Er zuckte mit den Schultern und öffnete die Tür auf der Fahrerseite. »Wir beobachten dich seit einer Weile, Cassy. Ich habe noch nie ein Mädchen in deinem Alter gesehen, das so verbittert und abweisend ist wie du.«
Die Verachtung in seiner Stimme ließ mich zurückzucken.
Es sollte mich nicht kümmern, was er dachte, aber aus irgendeinem Grund trafen mich seine Worte. Vermutlich weil es nicht das erste Mal war, dass ich sie hörte. Und weil ich wusste, dass es stimmte. Seit Jahren hatte ich mir antrainiert so zu sein. Ernst, verschlossen und abweisend. Ich trug meine Unnahbarkeit wie eine Rüstung. Ich musste das tun. Nur in Lex’ Nähe hatte ich mich getraut, etwas von dem zu zeigen, was darunter lag.
»Ihr habt mich beobachtet? Und das kommt euch nicht ein bisschen gestört vor?« Mein Kopf spulte einige Momente der vergangenen Tage ab, aber ich konnte mich nicht daran erinnern, diese Typen vor gestern Abend je gesehen zu haben. Da war zwar das vage Gefühl eines Erkennens gewesen, als ich in Vesper hineingerannt war, aber ich konnte beim besten Willen nicht sagen, woher es rührte.
»Doch, durchaus. Du wirst sehen, dass an dieser Sache so einiges gestört ist«, erwiderte Leander gelassen lächelnd.
»Glaub uns, das Stalking war keineswegs freiwillig. Ich könnte mir Spannenderes vorstellen, als den ganzen Tag zwischen Büchern zu hocken«, fügte Vesper hinzu.
Ich lachte heiser auf. Das wird ja immer besser. »Tut mir echt leid, dass ich nicht unterhaltsamer bin. Wieso habt ihr euch nicht jemand anderen gesucht für … das hier?«
»Uns blieb keine Wahl. Und jetzt sei still! Wir müssen los.« Ohne ein weiteres Wort stieg er ein und zog die Tür zu.
Leander sah mich entschuldigend an, dann stieß er sich von der Motorhaube ab und nickte mir zu. »Nach dir.«
Wir kletterten hinten rein. Vermutlich war es ihnen zu riskant, mich allein dort sitzen zu lassen, und ich konnte es ihnen nicht verübeln. Mein Gehirn suchte unaufhörlich nach einer Möglichkeit, dieser durch und durch kranken Situation zu entgehen.
»Vorausgesetzt, ich willige ein, euch zu helfen: Wie lange wird diese Sache dauern?«, fragte ich diplomatisch, nachdem wir den Parkplatz verlassen hatten.
»Das sollte dich nicht kümmern«, kam die nüchterne Antwort von vorn.
Hitze schoss in meine Wangen, ich presste die Fingernägel in die Oberschenkel. »Entschuldige, dass ich ein Leben habe. Außerdem gibt es Menschen, die mich vermissen und nach mir suchen werden.«
Vesper schnaubte. »Ach, echt? Wer denn? Deine unzähligen Freunde oder deine riesige, dich liebende Familie?«
Ein weiterer schmerzhafter Stich. Ich blinzelte und sah aus dem Fenster. Aus den Augenwinkeln bemerkte ich, wie Leander missbilligend in den Fahrerspiegel starrte.
Vesper seufzte, doch als er wieder sprach, klang seine Stimme sanfter. »Wir haben uns darum gekümmert. Dein Chef hat eine E-Mail mit einer Krankschreibung erhalten, Gleiches gilt für deine Dozenten. Und deine Zimmerpflanzen sind Sukkulenten, sie werden vorerst ohne dich überleben.«
Ich stutzte. Die Gekränktheit wich aus meinem Körper, zurück blieben Verblüffung und … Wut. »Ihr habt euch in meinen Mailaccount gehackt? Und ihr wart in meiner Wohnung?«
Er gab sich keine Mühe, auf den Vorwurf einzugehen. »Und wir haben deinem Freund eine Nachricht geschrieben, dass du kurzfristig verreisen musstest und dein Handy eine Weile auslassen wirst.«
Das erleichterte mich wirklich. Ich wollte nicht, dass Lex sich Sorgen machte. Und das würde er, wenn ich einfach so verschwand. Ganz gleich, wie sehr ich anfangs versucht hatte ihn auf Abstand zu halten, mittlerweile verging kein Tag, an dem wir nicht voneinander hörten.
»Lex ist nicht mein Freund. Nicht so jedenfalls«, widersprach ich leise und pflückte einen Fussel vom Hoodie.
Leander lachte. »Wissen wir. Wenn er das wäre, wären wir vermutlich nicht hier.«
Verständnislos starrte ich ihn an, aber er war zu beschäftigt damit, Vespers grimmigen Blick durch den Spiegel zu erwidern, um auf mich zu achten. Als er sich zu mir drehte, lächelte er verschmitzt.
»Wie gesagt«, raunte er mir zu, »so einiges an dieser Sache ist gestört. Aber leider unumgänglich.«
Ich konnte mich nicht entscheiden, ob ich das Lächeln erwidern oder ihn am Pulloverkragen packen und durchschütteln sollte.
Ehe ich eine Wahl treffen konnte, tätschelte Leander meine Schulter. »Lehn dich einfach zurück und genieß die Fahrt. Andere zahlen für so eine Rundreise einen Haufen Geld.«
Er zwinkerte mir zu, dann wandte er sich ab und sah aus dem Fenster, wo ein buntes Meer an Bäumen vorbeizog.
***
Wir fuhren bis zum Mittag durch, ehe wir das erste Mal an einer winzigen Tankstelle anhielten. Leander stieg aus, um zu tanken. Meine Beine sehnten sich nach ein wenig Bewegung, aber als meine Finger am Türgriff lagen, sprang die Sicherung ein. Ich hob den Blick und begegnete Vespers verengten Augen im Rückspiegel.
»O bitte. Was ist, wenn ich mal auf die Toilette muss?«
»Musst du nicht.«
»Ich denke, das kann ich besser beurteilen als du.«
Ich versuchte mir nicht anmerken zu lassen, dass er recht hatte. Wie sollte ich auf die Toilette müssen, wenn ich seit über fünfzehn Stunden keinen Schluck getrunken oder etwas gegessen hatte?
Einen Moment lang starrten wir einander fest in die Augen, dann hob er die Brauen. »Gut. Dann begleite ich dich.«
»Ist das dein Ernst?«
»So oder gar nicht.«
Dann eben gar nicht. Missmutig ließ ich mich im Sitz zurücksinken und starrte aus dem Fenster, bis Leander zurückkam. Vesper wartete kaum, bis er die Tür zugezogen hatte, ehe er wieder losfuhr.
»Hier, du musst hungrig sein.« Leander hielt mir ein abgepacktes Sandwich hin.
Ich starrte kurz darauf, dann wieder in sein aufforderndes Gesicht. »Nein danke«, erwiderte ich kühl und wandte mich zum Fenster. Ganz bestimmt würde ich nichts essen, was diese Verrückten mir anboten. Auch wenn sich mein Magen wie eine Höhle ohne Boden anfühlte.
Vespers Blick bohrte sich durch den Rückspiegel auf mich. »Iss! Dein Körper sieht nicht unbedingt so aus, als hätte er viele Reserven, und wir brauchen dich in körperlich guter Verfassung.«
Ich prustete. »Echt? Ist das der Grund, warum ihr mich betäubt und verschleppt habt? Damit ich in guter Verfassung bin?«
Vesper verlangsamte das Tempo, als er auf eine rote Ampel zurollte. Wir fuhren durch einen kleinen Ort, an der nächsten Straßenecke sah ich ein Bistro mit ein paar Sitzplätzen auf dem Bürgersteig und daneben ein Postkartenlädchen. »Wir haben dir die Wahl gelassen, erinnerst du dich? Ich hätte es auch gern vermieden, dich zum Auto zu tragen. Du bist zwar dünn, aber kein Fliegengewicht.«
Und das war der Moment, in dem die Sicherung in mir durchbrannte und alle Vernunft erstickte. »Weißt du was? Du hast recht.« Ich lächelte ihm grimmig zu. »Ich treffe einfach viel zu gern meine eigenen Entscheidungen.«
Bevor ich intensiver darüber nachdenken konnte, riss meine Hand die Tür auf, während die andere den Gurt löste. Ich hörte Leander fluchen, aber in diesem Augenblick war ich bereits aus dem Auto gehechtet.
Zwar fuhr Vesper langsam, weil er gerade erst die Ampel passiert hatte, aber der Aufprall auf den Asphalt tat dennoch unfassbar weh. Der Stein drückte mir alle Luft aus den Lungen und für einen Moment war ich mir sicher, ich würde sterben – da war kein Sauerstoff mehr in mir. Mein Körper war ein Vakuum, um mich herum nichts als Schwärze. Es dauerte vier, fünf schmerzhafte Sekunden, bis die Welt zu mir zurückkehrte.
Glücklicherweise war die Straße kaum befahren. Obwohl – fast wäre es mir lieber gewesen, von einem anderen Auto überrollt zu werden, als wieder zurück in das zu steigen, das in ein paar Metern Entfernung zum Stehen kam. Schwer atmend rappelte ich mich auf die Knie und stöhnte, als mein offenes Fleisch den Asphalt berührte. Mir war klar, dass mir nicht viel Zeit blieb. So schnell es meine wackeligen Beine zuließen, taumelte ich auf das Bistro zu, vor dem ein älteres Pärchen in der Mittagssonne saß. Ich war mir nicht sicher, ob sie gesehen hatten, was passiert war, meine Sicht flimmerte.
»Hey!«, schrie ich. »Helfen Sie mir!« Meine Stimme verlor sich in der Luft. Ich musste näher ran. Ich musste … Der Gedanke fiel in sich zusammen, als sich das Licht vor mir veränderte. Zwischen dem Bistro und mir baute sich wie aus dem Nichts eine meterhohe grell leuchtende Wand auf. Es war, als wäre die Sonne in einen riesigen Spiegel gefallen und würde von diesem reflektiert.
Ich erstarrte und blinzelte, aber es half nichts: Das Bistro, der Bürgersteig, die Menschen, die mir das Leben retten könnten, ich konnte nichts davon erkennen.
Plötzlich schloss sich eine Hand um meinen Mund und jemand schob sich dicht von hinten an mich heran. »Das war ein verdammter Fehler, Cassy«, knurrte Vespers Stimme an meinem Ohr.
Ich versuchte halbherzig mich von ihm loszumachen, aber als er den Druck auf meinen Mund erhöhte, ließ ich die Muskeln erschlaffen. Meine Augen klebten an der Wand aus Licht, die noch immer glänzend zwischen mir und einem möglichen Ausweg stand. Das, was mit mir passierte, fiel offensichtlich nicht auf. Niemand würde mir helfen.
Vesper brauchte keine zehn Sekunden, um mich zurück zum Auto zu schleifen und grob hineinzustoßen. Ich wehrte mich nicht mehr, mein ganzer Körper zitterte vor Verwirrung und dem abfallenden Adrenalin.
Leander schüttelte unzufrieden den Kopf und schnallte mich wieder an. »Ich hatte echt gehofft, wir könnten das anders angehen. Aber da wir den Auftrag haben, dich unbeschadet mitzubringen, und du nicht wirkst, als wäre das auch deine oberste Priorität, lässt du uns leider keine Wahl.«
Ehe ich verstand, worauf er hinauswollte, hatte Vesper schon ein dünnes Seil um meine Handgelenke geschwungen. Er zog es so fest, dass ich schmerzerfüllt keuchte. Vesper ignorierte es und machte einen Knoten hinein, dann bückte er sich und band die anderen Enden um meine Fußgelenke. Der Abstand dazwischen war so gering, dass ich mich nach vorn beugen musste.
»Du tust mir weh«, zischte ich kraftlos. Die Fesseln schnürten bereits jetzt mein Blut ab.
Vesper sah zu mir auf – aus diesen großen hellen Augen, die dennoch so dunkel wirkten. »Glaub mir«, erwiderte er bedrohlich leise, »wenn ich dir wirklich wehtun möchte, merkst du es.«
Er richtete sich auf und verharrte mit seinem Gesicht dicht vor meinen. Ich erkannte die Anspannung in jedem winzigen Fleckchen Haut.
»Also lass es lieber nicht darauf ankommen und tu so etwas nie wieder, verstanden?«
Ich zwang mich dazu, ebenso wütend zurückzufunkeln. »Ich wüsste nicht wie. Meine Bewegungsfreiheit ist ein wenig eingeschränkt und vermutlich sterben meine Hände und Füße eh bald ab.«
»Gut«, erwiderte Vesper unwirsch und kontrollierte mit einem groben Ruck die Fesseln meiner Hände. Die offenen Innenflächen stießen dabei aneinander, ich stöhnte.
»Ves«, meinte Leander beschwichtigend und fing sich dafür einen warnenden Blick ein.
»Pass einfach besser auf sie auf, klar?« Ohne eine Antwort abzuwarten, knallte Vesper die Tür neben mir zu und stieg wieder ein.
Ich ließ den Kopf gegen den Vordersitz sinken und schloss die Augen. Das Adrenalin war ganz verebbt und allmählich durchzogen die Ausmaße des Sturzes meinen Körper. Die offene Haut an meinen Knien und Händen brannte und ein drückender Schmerz schwappte in unregelmäßigen Wellen mein linkes Bein hinauf. Ich spürte, wie sich Tränen aus meinen Augen lösten, als mein Bewusstsein der Erschöpfung nachgab und ich in einem dämmrigen Schlaf glitt.
***
Ich wachte auf, als kühle Luft auf meine Stirn kletterte. Im Schlaf war mein Kopf gegen das Fenster gesackt, das einen Spalt offen war. Ich blinzelte mehrmals, bis ich feststellte, dass es erstaunlich still war. Wir fuhren nicht mehr und das Auto war leer. Für einen kurzen Moment überkam mich der Impuls, die Tür aufzustoßen und wegzurennen. Beides scheiterte, da ich nach wie vor gefesselt war und Leander am Auto lehnte.
»Sind wir da?«, murmelte ich und versuchte mir mit der Schulter die juckende Nase zu reiben.
Er sah durch das Fenster zu mir hinein. »Nein. Wir sammeln nur noch jemanden ein.«
»Jemanden wie mich oder jemanden wie euch?«
Nicht, dass ich einer anderen Person gewünscht hätte, ebenfalls entführt zu werden, aber es hätte mich dennoch erleichtert, nicht mehr allein mit diesen Typen zu sein.
Leander bedachte mich mit einem halbherzigen Lächeln. »Niemand ist wie du, Cassy.« Ehe ich antworten konnte, hatte er sich wieder aufgerichtet und gegen das Auto gelehnt.
Wir hatten in einer Straße geparkt, in der sich etliche Häuser aus dunklem Stein aneinanderreihten. Die Bilderbuchvorgärten wirkten so harmlos, dass mir meine Situation noch absurder vorkam.
Nach ein paar Minuten öffnete sich die Tür des Hauses, vor dem wir standen. Vesper trat heraus, eine Reisetasche in der Hand und begleitet von einer jungen Frau. Sie reichte ihm kaum bis zur Brust, musste aber etwa in seinem Alter sein. Ihr karamellfarbenes Haar fiel ihr in Stufen um das rundliche Gesicht und hüpfte immer wieder auf und ab, als sie neben ihm über die Straße lief.
Kurz darauf wurde die Tür auf der anderen Seite aufgerissen und sie steckte den Kopf ins Wageninnere.
»Aber hallo«, meinte sie mit einem strahlenden Lächeln.
Ich blinzelte mehrmals und musterte sie schweigend. Sie hatte eine Stupsnase, Sommersprossen und münzrunde Augen. Wäre da nicht der schelmische Ausdruck in ihnen gewesen, hätte sie ziemlich unschuldig aussehen können.
»Du bist ja wahnsinnig schön. Ich hätte irgendwie gedacht, du würdest … mystischer aussehen.«
Verständnislos starrte ich sie an. »Entschuldige. Mein zweiter Kopf ist in meiner Tasche.«
Vesper und Leander hatten sich längst wieder ins Auto gesetzt und sahen die junge Frau auffordernd an. Sie ignorierte die Männer und strich sich grinsend eine Haarsträhne hinter das Ohr, die sofort wieder hervorsprang.
»Mit diesem kannst du dich auf jeden Fall sehen lassen. Ich bin übrigens Clio.«
Mit einem Ächzen ließ sie sich neben mir auf die Rückbank fallen und zog die Tür zu. Sofort startete Vesper den Motor.
»Ich würde sagen, dass es mich total freut, dich kennenzulernen, aber das wäre gelogen«, murmelte ich.
Clio lachte – so schallend und echt, dass selbst meine Mundwinkel aufzuckten. »Ich mag sie jetzt schon.«
»Du solltest dich gar nicht erst an sie gewöhnen«, sagte Vesper gereizt von vorn.
Ein ungutes Gefühl machte sich in mir breit und ich biss mir auf die Zunge, um ihn nicht zu fragen, wie er das meinte.
Clio verdrehte die Augen und warf mir einen entschuldigenden Blick zu. »Ves meint es nicht so. Und eigentlich ist er auch viel netter. Ein richtiger Goldjunge.« Sie lehnte sich vor und fuhr ihm schnell durch die hellen Locken.
»Es ist nicht alles Gold, was glänzt.« Vergebens versuchte ich die Fesseln zu verrutschen. Die Haut darunter war aufgeschürft, so eng hatte der Goldjunge sie angelegt.
Clio gluckste. »Ihr hattet einen richtig guten Start, was?«
Ich schnaubte und hob die Hände – so gut es ging. »Seine Umgangsformen sind nicht so mein Ding.«
Sie sah zu meinen gefesselten Handgelenken und tiefer. Entrüstung huschte über ihr schönes Gesicht.
»Jungs, was habt ihr mit ihr gemacht? Sie blutet.«
Leander warf uns einen zerknirschten Blick zu. »Das war nicht unsere Schuld. Sie hat sich aus dem Auto geworfen.«
Clio verzog das Gesicht und tätschelte mir den Kopf.
Ich musste mich davon abhalten, ihr in die Hand zu beißen. Sie wirkte nett, aber meine Nerven waren ziemlich gespannt.
»Könnt ihr ihr das verdenken? Das muss doch extrem viel sein für sie. Ich meine, ich wüsste auch nicht, wie ich reagieren würde, wenn ich so etwas erfahren müsste.«
Verständnislos starrte ich in ihr mitleidiges Gesicht.
»Wovon sprichst du?«, fragte ich in dem Moment, in dem von vorn kam: »Sei still, Clio!«
Sie blickte zu Vesper, der sie warnend im Rückspiegel ansah. »Sagt mir jetzt nicht, dass ihr es ihr nicht erklärt habt.«
»Du kennst die Anordnung«, erwiderte Vesper.
Sie stöhnte genervt. »Es ist mir egal, was Zeo sagt. Ihr könnt dieses arme Ding doch nicht entführen, ohne ihr zu sagen warum!«
»Können wir und haben wir. Und du wirst daran auch nichts ändern, es sei denn, du hast Lust, dich vor ihm zu rechtfertigen.«
Sie lieferten sich ein Blickduell, aber schließlich verdrehte Clio die Augen und sah mich zerknirscht an.
»Entschuldige, Süße.« Sie sah auf meine Fesseln hinab. »Dann nehme ich dir wenigstens die wieder ab.«
»Clio«, setzte Vesper gepresst an, aber sie unterbrach ihn mit einem lauten Schnalzen ihrer Zunge.
»Vergiss es, Ves! Ich werde nicht die nächsten Stunden neben einem gefesselten Mädchen sitzen, das ganz offensichtlich Schmerzen hat. Du weißt genau, dass ich das nicht kann.«
»Sie hat keine Schmerzen«, erwiderte Vesper genervt, aber in dem Blick, der im Spiegel nach mir tastete, konnte ich so etwas wie Unsicherheit aufflackern sehen.
Ich biss die Zähne zusammen und starrte auf Clios Finger, die sich geschickt an meinen Fesseln zu schaffen machten.
»Wer von uns kann das besser beurteilen, hm?«, fragte sie dabei spöttisch.
Kurz darauf hatte sie das Seil entfernt und ich richtete mich vorsichtig auf. Heißer Schmerz schoss in meine Wirbelsäule und vermischte sich mit dem der aufgeriebenen, teils blutenden Stellen.