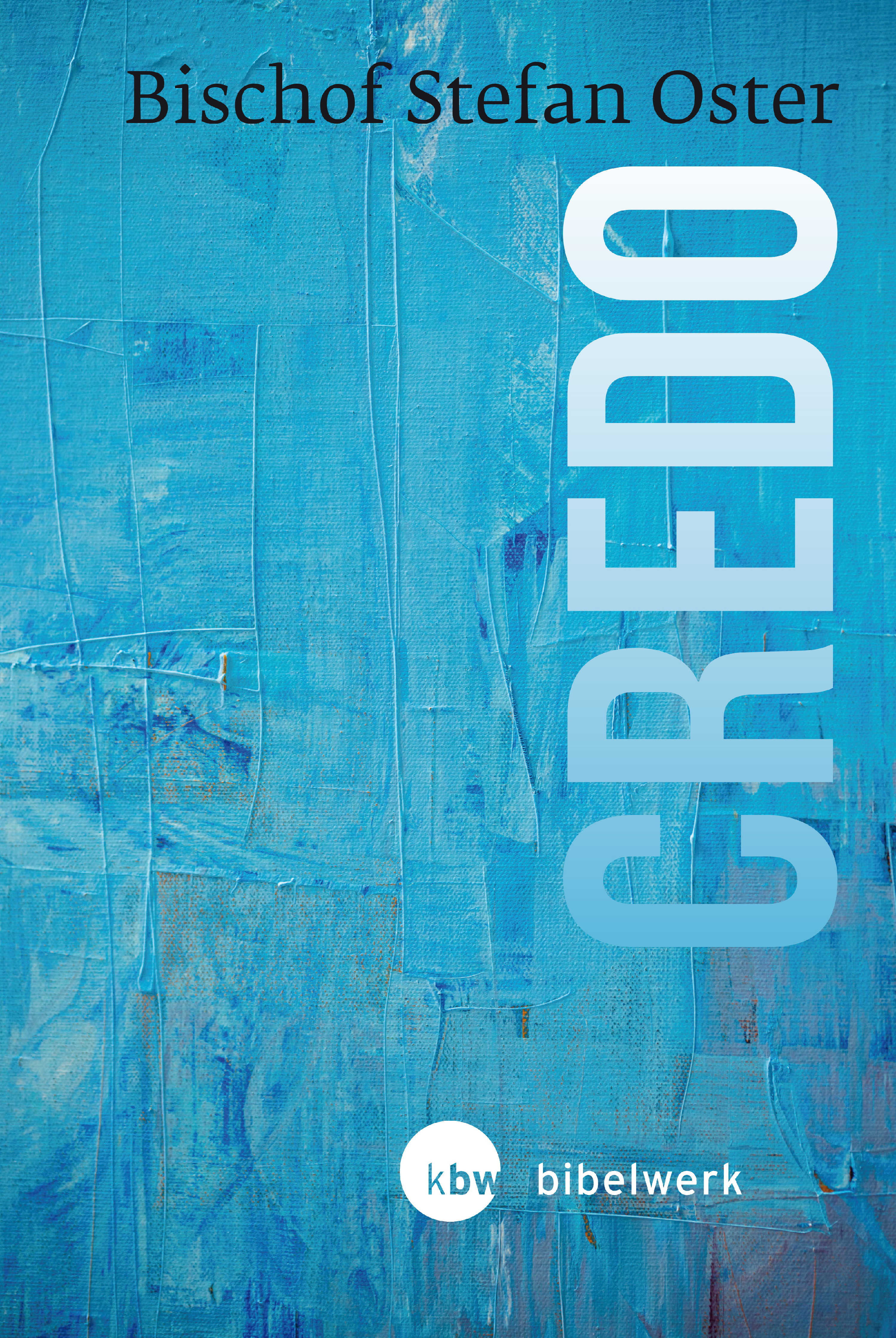Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Ein junger Mann trifft einen Bischof mit außergewöhnlichem Lebenslauf – das Ergebnis ist ein packendes Gespräch über die großen Lebensfragen junger Menschen. Wofür will ich mich einsetzen? Wie finde ich den richtigen Weg? Welchen Sinn finde ich in dem, was ich tue? Jugendbischof Stefan Oster lädt mit seinen sehr persönlichen, auch herausfordernden Antworten auf einen Berufungsweg ein, der die Nachfolge Jesu nicht den "Profis" überlässt. Er ist überzeugt: Jeder Mensch hat seine persönliche Berufung von Gott.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 172
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Stefan Oster | Rudolf Gehrig
Den ersten Schritt macht Gott
Über Erfüllung, Berufung und den Sinn des Lebens
Originalausgabe
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2021
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
Die Bibeltexte sind entnommen aus:
Die Bibel. Die Heilige Schrift
des Alten und Neuen Bundes.
Vollständige deutsche Ausgabe
© Verlag Herder, Freiburg im Breisgau 2005
Umschlaggestaltung: Gestaltungssaal, Rohrdorf
Umschlagmotiv: © BLUR LIFE 1975/shutterstock
E-Book-Konvertierung: Carsten Klein, Torgau
ISBN E-Book Epub 978-3-451-82436-4
ISBN E-Book PDF 978-3-451-82437-1
ISBN Print 978-3-451-39122-4
Inhalt
Vorwort Bischof Stefan Oster SDB
Vorwort Rudolf Gehrig
Jeder hat eine Berufung
Gott macht keine Angst
Er ist da, er geht mit, er bleibt da
An Krisen wachsen
So bleibt die Berufung frisch
Ein paar praktische Tipps zum Schluss
Über die Autoren
Vorwort Bischof Stefan Oster SDB
Vor drei Jahren hat Rudolf Gehrig in Passau angeklopft mit der Frage, ob er mit mir eine Reihe von Interviews machen könne für den Fernsehsender EWTN. Es sollte um Berufung gehen und darum, ob und wie es möglich ist, den Weg zu erkennen, den Gott mit einem Menschen gehen möchte. Ich bin mir nicht sicher, ob das, was ich zu sagen versucht habe, für andere hilfreich ist oder tatsächlich auch eine gewisse Allgemeingültigkeit beanspruchen kann. Sehr sicher bin ich mir aber, dass es zahllose Menschen gibt, die es hätten tiefer oder besser verstehbar oder wahrhaftiger sagen können. Oder andere, die noch viel wesentlichere Aspekte gesehen und gesagt hätten. Aber nun ist es so geworden, wie es ist.
Rudolf Gehrig ist ein junger, gläubiger Journalist, der sich besonders auch über seinen eigenen Weg viele Gedanken gemacht hat – um dann einen authentischen Weg aus dem Glauben in die Ehe zu finden. Aber er hat und hatte so seine Fragen, gute Fragen – und daher gilt: Wenn die Antworten etwas taugen, dann sind sie vor allem durch die Fragen von Rudolf hervorgeholt worden und durch die Art seines Hörens und Weiterdenkens. Ein Mensch ist dem anderen immer Sonne und Sonnenblume zugleich, Kranker und Krankenpfleger, Bettler und Almosengeber. Auf dem Weg des Glaubens gibt es im Grunde Geben und Empfangen nie so verteilt, dass der eine nur Geber, der andere nur Empfänger wäre. Vielmehr ist wirkliches Geben immer Empfangen und wirkliches Empfangen zugleich ein Geben – vor allem im Angesicht des Geheimnisses, um das wir kreisen und dem wir alle unser Leben verdanken. Möge er, der für uns Mensch geworden ist, damit wir tiefer verstehen, was Menschsein wirklich bedeutet und wohin unsere Menschenwege uns führen können, in allem gepriesen und verherrlicht werden – auch durch die Zeilen dieses Buches.
Passau, am 22. Oktober 2020, dem Gedenktag des heiligen Papstes Johannes Paul II.
Vorwort Rudolf Gehrig
»Gott, was willst du eigentlich von mir?«
Immer und immer und immer wieder habe ich diese Frage gestellt. Mal nachts unter freiem Sternenhimmel, mal mitten am Tag an einem Wegkreuz, beim Radfahren, beim Lesen, beim Computerzocken, mal während eines besonders ehrfürchtigen Moments in einer von Weihrauch erfüllten Kirche, mal nach Gesprächen mit Freunden, oft nach den ersten zerbrochenen Teenagerbeziehungen und meistens verzweifelt, den Blick nach oben gerichtet, dorthin, wo Gott sich vermutlich gerade aufhielt und sich ins Fäustchen lachte, weil ich mein Leben nicht auf die Kette bekam. So zumindest stellte ich mir das in diesen Momenten vor.
Ich bin ganz selbstverständlich mit dem Glauben aufgewachsen, als Katholik im katholischen Teil Unterfrankens, im kleinen Örtchen Serwichhausen, wo sich Fuchs und Rasenmähertraktor Gute Nacht sagen. Ich verdanke meinen Glauben der Prägung und dem Vorbild meiner Eltern, die schon früh mit meinen Geschwistern und mir vor dem Schlafengehen beteten und uns sonntags mit in die Heilige Messe nahmen. Ich war als Kind fasziniert vom »lieben Heiland«. Es war für mich selbstverständlich, dass es einen liebenden Gott gibt, der das Beste für mich will. Und doch musste auch ich erst eine persönliche Beziehung zum Allmächtigen aufbauen. Gott und ich, wir kamen gut miteinander klar, solange ich in die Kirche und ab und zu mal zum Beichten ging – und bei den wichtigen Europapokalspielen meines Herzensvereins Werder Bremen in der Schlussviertelstunde inbrünstig ein Vaterunser nach dem anderen betete, während ich mit einem Ohr an meinem Radio hing und auf das erlösende Tor wartete. Ja, zu dieser Zeit spielte Werder noch in der Champions League, und ja, ich habe irgendwann aufgehört, für erfolgreiche Fußballspiele zu beten – und frage mich ab und zu, in einem schwachen Moment, ob die heutige traurige Tabellensituation meines Vereins damit zusammenhängt. Aber das ist eine andere Geschichte.
Jedenfalls: Solange ich Gott nur einmal pro Woche in der Heiligen Messe besuchen musste und ich ihn in meinen kindlichen Stoßgebeten – mit meinem Liebeskummer, meiner Angst vor Mathearbeiten und mit meiner inständigen Bitte, dass Tim Wiese nächstes Mal gegen Juventus Turin den Ball einfach festhält – behelligen konnte, gab es nie ein Problem zwischen Gott und mir. Klar, ich machte mir auch Gedanken um meine Zukunft, wollte erst Feuerwehrmann, dann Tierschützer und schließlich Schriftsteller werden. Ich dachte, Gott würde mir bei all dem schon irgendwie helfen. Außerdem wäre es sehr nett, wenn der Allmächtige, der Schöpfer des Himmels und der Erde, mir noch irgendwie dabei helfen könnte, dass sich die Dorfschönheit endlich in mich verlieben würde. Oder wenigstens ihre Cousine. Ansonsten wäre ich ihm sehr verbunden, wenn er sich weitgehend aus meinem Leben heraushielte. Denn irgendwie hatte ich auch ein bisschen Angst davor, dass er vielleicht mehr von mir und für mich wollte, als ich zu geben bereit war.
Ich habe sehr lange ministriert und bin auch dann noch weiterhin in die Sonntagsmesse gegangen, als meine Freunde und Schulkollegen schon nicht mehr gingen. Immer wieder ist die Frage aufgetaucht: »Warum bist du eigentlich so fromm? Willst du später mal Pfarrer werden?«
Ab einem bestimmten Punkt war es genau diese Frage, die mir Angst gemacht hat. Möchte Gott, dass ich Priester werde?
Lange bin ich vor der Frage davongelaufen, was Gott von mir will. Ich musste auf teilweise unnötig schmerzhafte Art und Weise lernen, dass Gott mir zu aller Zeit die völlige Freiheit lässt. Eine Berufung ist keine Form von unausweichlichem Schicksal; denn meine größte Angst bestand darin, dass ich einem anderen Weg folgen würde, als Gott für mich vorgesehen hatte, und ich dann als »Strafe« todunglücklich werde. Was, wenn Gott mich zum Priester beruft, ich aber ein Mädchen kennenlerne, das ich heiraten möchte? Wird dann meine Ehe zwangsläufig scheitern? Was, wenn ich mich als Schriftsteller – oder wenigstens als Journalist – versuche, aber Gott mich eher als Autor von Glückskeks-Weisheiten vorgesehen hat? Wird dann alles, was ich versuche, zwangsläufig in einem Debakel enden?
Die eigene Berufung zu suchen, zu finden und ihr zu folgen, ist nichts für Weicheier. Manchmal läuft das ganz unspektakulär. Ich beneide die Menschen, die von Anfang an schon wussten, was ihr Weg ist, und diesen auch konsequent gehen. Andere Menschen – und dazu gehört zum Beispiel Bischof Stefan Oster – haben einen abenteuerlichen Weg hinter sich. Bei wieder anderen ist einfach nur Chaos angesagt – so zumindest war es bei mir.
Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich 2017 die Möglichkeit hatte, Bischof Stefan Oster in Passau zu treffen und mit ihm für den katholischen Fernsehsender EWTN die Serie Rudolf will’s wissen – Wie erkenne ich Gottes Plan für mein Leben? zu drehen. Die Serie ist jetzt schon einige Male bei EWTN gelaufen. Dennoch fragen immer wieder Leute bei uns an, ob es die ganzen Sendungen nicht auch einzeln in Schriftform gebe. Und so habe ich mich irgendwann hingesetzt und alles abgetippt. Dabei ist mir aufgefallen, dass an einigen Stellen noch viele Fragen offengeblieben waren und ich – warum auch immer – nicht weiter nachgefragt habe. Manches kommt einem einfach erst Jahre später …
Dem Herrn Bischof ging es übrigens ähnlich, auch er hatte, als er die Abschrift las, das Gefühl, noch das ein oder andere ergänzen zu können. So ist dieses Buch entstanden. Wir haben das vorhandene Material genommen und ergänzt.
Ich glaube und hoffe, dass die Erkenntnisse und Ratschläge von Bischof Oster vielen Menschen helfen werden, die auf der Suche nach der eigenen Berufung sind. Das Buch soll aber nicht nur eine Hilfe sein, um eine mögliche Priester- oder Ordensberufung zu klären. Wie wir von Bischof Oster noch erfahren werden, hat jeder Mensch eine bestimmte Berufung – die Krankenschwester genauso wie der BWL-Student, die Harvard-Professorin ebenso wie der Baukranführer. Vielleicht ist sich nicht jeder seiner Berufung zu jeder Zeit bewusst, andere stehen noch am Anfang ihrer Suche. All jenen wird dieses Buch hoffentlich ein paar hilfreiche Impulse mitgeben.
Bei der Abschrift unserer Fernsehserie haben wir unser Gespräch in der Schriftform etwas mehr der hochdeutschen Sprache angepasst, da er, der gebürtige Oberpfälzer, und ich, der Exilfranke, im Laufe des Interviews mehr und mehr in unseren jeweiligen Dialekt »abgedriftet« sind. Wer mag, kann sich das im Original gerne noch einmal anhören und sehen: Die komplette Serie ist online abrufbar in der Mediathek von EWTN.TV und kann auf Spendenbasis als DVD bestellt werden.
Weil zu viel Fernsehen aber ungesund ist und eventuell viereckige Augen verursacht, allen Lesern jetzt erst einmal viel Freude mit diesem Buch!
Köln, am 8. Oktober 2020
Jeder hat eine Berufung
Grüß Gott, Herr Bischof! Ich freue mich sehr, dass ich mit Ihnen über ein Thema sprechen darf, das mich schon sehr lange beschäftigt: das Thema Berufung. Wann haben Sie zum ersten Mal tatsächlich den Ruf Gottes in Ihrem Leben verspürt?
Ich glaube, es war, als ich als Siebzehnjähriger in Taizé war. Das war in Frankreich, in dieser ökumenischen Gemeinschaft, wo ich gespürt habe, dass Beten, Gottesdienst feiern, mit gläubigen Menschen zusammenzusein mehr ist als etwas, das sich nur in dieser Welt und nur auf dieser Ebene abspielt. Da ist der Horizont, der Himmel aufgegangen.
Berufung, das wird immer noch vor allem mit einer geistlichen Berufung gleichgesetzt. Was ist der Unterschied zwischen einer Priesterberufung und einem »normalen« Beruf? Gibt es überhaupt einen Unterschied zwischen Beruf und Berufung?
Die Berufung zum priesterlichen Dienst ist eine Berufung, bei der man spürt: Der Herr legt seine Hand auf mich und zieht mich ganz an sich – mit einem Bild gesprochen. Er will nicht nur einen Ausschnitt meines Lebens, nicht nur bestimmte Stunden meines Tages, sondern das hat etwas mit »Er will mich ganz« zu tun. Natürlich kann man sagen, das will er von jedem Menschen. Aber jeder Mensch ist in seiner Lebenssituation jeweils unterschiedlich. Ich glaube, Gott spricht in Lebenssituationen hinein, in denen jemand zu so einer Antwort befähigt ist, und zieht ihn dann an sich. Also ja, es gibt einen Unterschied.
Ist mein Leben durch eine solche Berufung dann nicht schon von Anfang an vorherbestimmt? Habe ich unter der Voraussetzung überhaupt eine Chance, meinen eigenen Willen zu verwirklichen?
Ja, natürlich. Nur ist die Frage gar nicht so einfach zu beantworten, was eigentlich der eigene Wille ist. Wir glauben ja – ausgehend von dem, was wir über das Verhältnis zwischen Gott und Mensch zu verstehen meinen –, dass der Mensch dann am glücklichsten ist, wenn er das zu wollen lernt, was Gott will – mit seinem eigenen Willen. Das ist schon ein Geschehen der Freiheit, und Gott respektiert zutiefst die Freiheit des Menschen. Es gibt aus meiner Sicht nicht eine Art Vorherbestimmung im Sinne von: Gott weiß ohnehin mit absoluter Sicherheit jeden Schritt, den wir tun; zumindest nicht so, als würde er uns kalt und berechnend durchschauen. Denn er ist ja zuerst ein Liebender, der will, dass unser Leben gelingt. Manche denken auch: Er sieht in uns etwas voraus, und wenn wir das nicht genau so machen, wie er das sieht, dann wäre unser Leben gescheitert. Aber in dieser Enge, meine ich, dürfen wir das nicht sehen, weil Gott die Freiheit respektiert und den Weg eines jeden Menschen mitgeht. Aus der Schrift wissen wir, dass er ein Gott der Geschichte ist, der sich auf die Geschichte seines Volkes einlässt und auf die Geschichte der einzelnen Menschen. Aber wenn das so ist, dann ist der Ausgang der Geschichte, in der es Freiheit gibt, nicht einfach so festgelegt, dass darin dem Menschen nur sein Schicksal bliebe – und wenn es noch so positiv wäre. Was wir über den Ausgang der Geschichte wissen, ist, dass Gott alles in der Hand hält, dass er das erste und letzte Wort hat – und dass er am Ende die Geschichte zum Guten führt. Aber eben so, dass darin unsere Freiheit zutiefst respektiert wird. Und deshalb wirbt Gott um uns, um unsere Freiheit. Um Freiheit kann man nur werben, Freiheit kann man nicht erzwingen – und dann steht da immer wieder die Frage: Höre ich diesen Ruf und antworte ich? Wie antworte ich auf diesen Ruf?
Ich bin also erst dann richtig frei, wenn ich das will, was Gott will?
In unserem christlichen Sinne ist dies die eigentliche Form der Freiheit, ja.
Aber das bedeutet zunächst einmal Unterwerfung.
Ja, es bedeutet im Grunde so etwas wie Kapitulation. (Lacht.) Aber die Kapitulation bezieht sich auf den Teil in mir, den Paulus »das Fleisch« nennt. Fleisch ist nicht einfach die Leiblichkeit, sondern die Dimension des ganzen Menschen in mir, der mit Gott nicht wirklich etwas zu tun haben will. Ein Mensch also, der ohne Gott ganz er selbst sein will – und in diesem Sinne ein großes Misstrauen gegen jede Form von Außen- oder Fremdbestimmung hat, weil er meint: »Gott überfremdet mich und er will irgendwas mit meinem Leben, was ich gar nicht will.«
Aber zu verstehen, dass der liebende Gott wirklich mich meint und mich wachsen lassen und in die Erfüllung, in die Freiheit führen will, das setzt voraus, dass ich sage: »Herr, dein Wille geschehe.« Das beten wir in jedem Vaterunser.
Wieso gibt uns Gott dann den freien Willen überhaupt, wenn wir letztlich doch das tun sollen, was er sich für uns ausgedacht hat?
Wir sind geschichtliche Wesen, also immer im Werden. Und auf der Basis unserer Freiheit und unserer Vernunft können wir Entscheidungen treffen, die dieses Werden gelingen oder misslingen lassen. Und wenn Gott für freie Wesen das Beste will, dann geht es dabei in jedem Fall um die Qualität von Beziehung, einfach weil wir Beziehungswesen sind. Das heißt, ein Mensch, der die Freundschaft mit Gott sucht und leben lernt, der kann damit in eine Qualität von Freiheit und Beziehung finden, die das Kostbarste in seinem Leben sein wird. Und eine in Freiheit gewählte und aus Freiheit gelebte Freundschaft ist doch ungleich kostbarer und wertvoller als, sagen wir: das Hängen einer Marionette an Gottes Allmacht, gezogen durch Fäden, die sie fremdsteuern. Freiheit zielt auf eine Qualität von Beziehung, die ohne diese Freiheit niemals zu haben wäre.
Schauen Sie auf menschliche Beziehungen: Es gibt ohne Zweifel eher oberflächliche und tiefere Beziehungen. Und wenn sie gelingen, machen tiefe Beziehungen nicht abhängiger, sie machen freier. Sie helfen, zu werden, wer wir selbst sind. Um wie viel mehr gilt das für unsere Beziehung zum Schöpfer des Universums?
Viele Menschen glauben an ein Schicksal, also dass ihr Weg schon vorgezeichnet ist. Was halten Sie davon?
Schicksal kann man christlich interpretieren. Das ist ein Begriff, bei dem wir spüren, dass es so etwas wie eine Fügung im Leben gibt, in der Geschichte, und wir sind ein Teil davon. Auch von dem, was uns vorgegeben ist: Unsere Eltern und Geschwister, unser Leib, unsere Talente, die Kultur, die Sprache und die Landschaft, in der wir leben. All das sucht sich keiner aus – das ist schicksalhaft. Und mitten darin, in diesem Schicksalhaften, kann ich mich in Freiheit in Beziehung zur Welt und zu den anderen und zu mir selbst entfalten. Im gelingenden Fall erleben wir, dass Schicksal zum Entfaltungsort meiner Freiheit und meines Weges wird, es fügt sich – oder im Glauben gesprochen: Wir erkennen, wie er es fügt. Wenn wir als Christen also glauben, Gott Vater hat die Welt in der Hand und leitet sie auf ein gutes Ende zu, auch mein Leben, dann bekommt mein »Schicksal« eine christliche Füllung und Sinn.
Wie sieht dann wohl mein Schicksal aus? Hat Gott ein bestimmtes Ziel für mein Leben vorgesehen? Geht mein Leben den Bach runter, wenn ich von diesem vorgeschriebenen Plan abweiche?
Nein, so darf man das nicht sehen. Wir treffen ja täglich viele, viele Entscheidungen, kleinere und größere. Und darin wachsen und reifen wir hoffentlich so, dass wir fähig werden, auch große Entscheidungen für unser Leben zu treffen. Die Berufswahl kann zum Beispiel dazugehören, die des Ehepartners, aber vor allem das Ja zu Gott, zu Jesus. Und manchmal können auch kleinere Entscheidungen und Weichenstellungen in meinem Leben große Konsequenzen haben – und ich spüre nach und nach, wie wichtig das damals war. Größere Entscheidungen betreffen etwa Situationen, in denen ich spüre, da gibt es einen Zug zur Ganzhingabe, eine Sehnsucht in mir, eine Anziehung, die sagt: Ich gebe mich da ganz hinein, das ist es wert! Und natürlich ist es dabei möglich, vorher noch einmal abzubiegen und sich für etwas anderes zu entscheiden, was weniger herausfordert. In so einem Fall könnte es dann kommen, dass ich einen wichtigen Moment im Leben verpasst habe, sodass es mir lange nachhängt, mich so entschieden zu haben. Manchmal spürt man, dass dann eine gewisse Tragik über einem Leben liegt, weil jemand eine Möglichkeit, die Gott in einen hineingelegt hat, nicht ergriffen hat. Obwohl Gott sie einem zugetraut und zugemutet hätte.
Gott lässt mich dann im Stich?
Nein, das heißt nicht, dass Gott einen verlässt. Aber man wählt einen anderen Weg. Ich kenne Menschen, die so unterwegs waren: Da hat man immer gespürt, dass sie am Ende doch nicht ganz zufrieden waren, sie wollten vielleicht doch irgendwie mehr, sie haben manchmal auch ihre Umgebung überfordert. Solche Dinge spürt man dann. Das hat ein bisschen was Tragisches. Aber es ist nicht so, dass mein Leben komplett vergeigt ist, wenn ich mich anders entscheide. Es hat dann vielleicht mehr Narben, weniger Geschmeidigkeit, es wirkt vieles mühseliger, eben ein wenig tragisch, weil sich schon gezeigt hat, was es hätte werden können. Aber nein, Gott verlässt die Seinen nicht.
Auch nicht bei der Entscheidung zwischen Gut und Böse?
Das ist noch mal eine andere Frage. Wenn ich mich dramatisch für das Böse entscheide, dann kann mein Leben dramatisch verloren gehen, davon bin ich überzeugt. Aber nicht, wenn Sie sagen, ich wähle jetzt die Ehe, die Beziehung, einen weltlichen Beruf – und werde nicht Priester oder Ordenschrist. Das sind ja keine in sich bösen oder schlechten Sachen, sondern gute Sachen! Aber ja, es gibt schon einen bestimmten Zug, den Gott einem unter bestimmten Lebensumständen zutraut und zumutet.
Aber es kann Gott doch nicht gefallen, wenn er mich beispielsweise für eine Priesterberufung vorgesehen hat, ich mich aber lieber in eine Beziehung stürze?
Ich weiß nicht, ob »gefallen« hier die richtige Kategorie ist. Gott liebt und hört nicht auf zu lieben. Er will das Beste für mein Leben. Und er hört nicht auf, das zu wollen, gleich wie ich mich entscheide. Ich glaube übrigens auch, dass es zu eng gedacht wäre zu meinen: Gott legt eine bestimmte Berufung in mein Herz, und dann entscheidet sich Glück oder Unglück meines Lebens daran, ob ich sie ergreife oder nicht. Ich glaube eher, der Lebensweg entfaltet sich, der Mensch wächst, reift – und dann bieten sich im Leben Momente, da eröffnen sich Wege, die man wählen kann. Nach der Schrift schaut Gott wie ein liebender Vater dem wegziehenden, dem »verlorenen« Sohn hinterher – und er sieht vielleicht, wie er sich verrennt. Er lässt ihn aber gehen, wartet und hofft und schickt Unterstützung, in jedem Fall Liebe.
Wenn sich der jüngere Sohn im Gleichnis nun nicht im Schweinestall bekehrt hätte oder nur ein wenig? Wenn er zum Beispiel im fremden Land geblieben und ein anständiges Leben angefangen hätte, hätte ihn der Vater dann weniger geliebt? Nein. Er hätte wohl immer noch gewartet, wohl auch Unterstützung geschickt. Aber er wäre weniger einflussreich gewesen als nun, da der Sohn richtig nach Hause gekommen ist – und im Haus seines Vaters seinen neuen Platz empfängt.
Um das herauszufinden, braucht es manchmal ganz schön Zeit. Sie selbst sind Radiomoderator gewesen, hatten eine Freundin. Jetzt sind Sie Priester, Ordensmann und Bischof und haben Ihre Berufung gefunden – sind all die Jahre davor »Zeitverschwendung« gewesen?
Dafür gibt es keine einfache Antwort. (Überlegt einen Moment.) Auf der einen Seite kenne ich einen salesianischen Mitbruder, der war immer schon in einer sehr guten Weise »unschuldig«. Nicht im Sinne von naiv, sondern in dem Sinne, dass man da spürt: Der hat ein reines, heiles Herz. Der ist mit 19 Salesianer geworden und ein so guter, tiefer, menschennaher und dem Herrn naher Priester. Man soll sich nicht vergleichen, aber …
… Sie tun es trotzdem?