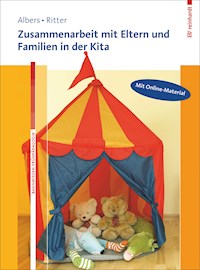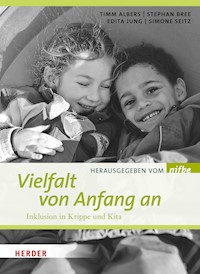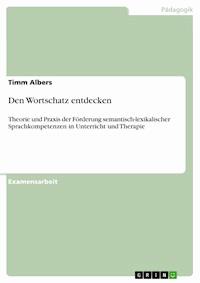
36,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Examensarbeit aus dem Jahr 2002 im Fachbereich Pädagogik - Heilpädagogik, Sonderpädagogik, Note: 1,0, , Sprache: Deutsch, Abstract: Angesichts der sich ständig verändernden begrifflichen Strukturierungsprozesse in der kindlichen Wortbedeutungsentwicklung stellt sich die Frage, wie sich die Begriffssysteme der Schülerinnen und Schüler dem Sprachsystem der Erwachsenen annähern können, wie sie begriffliche Kriterien entwickeln und verallgemeinern, Begriffe ordnen und miteinander vernetzen. Ein Zugang zum Begriffssystem der Kinder erschließt sich nur über eine Analyse der kindlichen Begriffskriterien. Die epigenetische Entwicklungstheorie (vgl. SZAGUN 2001, 14) bildet dabei das Fundament entwicklungsgemäßer Betrachtung von Wortbedeutungsentwicklung im Kontext Schule. Schlüsselwörter: Wortbedeutung, Begriffssystem, Begriffskriterien, Sprachförderung im Unterricht In view of a continuous alteration of the child’s semantic concepts, the question occurs, how children manage to achieve semantic markers and establish organized structures of the meaning of terms and words. Analyzing the child’s language-system helps us to understand the process of language acquisition of children with specific language impairments. An epigenetic theory of development (SZAGUN 2001, 14) implies a process-orientated view on the child’s language system and provides the basis of intervention in school. Keywords: language acquisition, level of the lexicon, semantic markers, epigenetic theory
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2007
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2013 GRIN Verlag GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt bei www.grin.com
INHALT
1 Einleitung
2 Aufbau des kindlichen Lexikons
3 Wortbedeutungsentwicklung
3.1 Epigenetische Entwicklungstheorie
3.2 Semantische Merkmaltheorie- oder Begriffsorientierung?
3.3 Entwicklung der Terminologie: Begriff, Wort, Bedeutung
3.4 Prozesse beim Aufbau von Begriffen
3.5 Strukturierungsprozesse
4 Der Sprachhandlungsansatz
5 Theorie-Praxis-Bezüge
6 Zum Problem der Diagnostik
7 Individuelle Prozessanalyse und Wortbedeutung
7.1 Analyseebenen
7.2Allgemeiner Aufbau des Förderplans
7.3 Exemplarische Darstellung von Förderplänen
7.3.1 Ausführlicher Förderplan (Niklas)
7.3.2 Kurzförderplan (Bert)
7.3.3 Kurzförderplan (Henrik)
7.3.4 Kurzförderplan Nina
7.3.5 Kurzförderplan (Max W.)
7.3.6 Kurzförderplan (Florian)
7.3.7 Kurzförderplan (Anton)
8 Unterrichts- und Therapieplanung
8.1 Thema der Einheit
8.2 Ziel der Einheit
8.3 Prozessuale Ziele der Unterrichtseinheit (PZ)
8.4 Anmerkungen zur Lerngruppe
8.4.1 Gruppe 1 (Niklas, Bert, Henrik)
8.4.2Gruppe2 (Nina, Florian, Max W., Anton)
8.5 Struktur der Einheit
8.6 Didaktische Überlegungen
8.7 Sachstrukturanalyse
8.8 Lernvoraussetzungen (LV)
8.9 Sprachbehindertenpädagogische Differenzierungsmaßnahmen
8. 10 Methodische Überlegungen
9 Dokumentation der Einheit
9.1 Unterrichtsblock 1:
9.2 Unterrichtsblock 2:
9.3 Unterrichtsblock 3:
10 Schlussbetrachtung zum Bezug von Theorie und Praxis
11 Anhang
11.1 Einheitsbegleitendes Buch ‚Baobab’
12 Literatur
12.1. Sach- und Bilderbücher
13 Glossar
1 Einleitung
Wörter sind im Spracherwerbsprozess als zentrale Bausteine anzusehen. Mit dem Erwerb von Wortbedeutungen sind neben dem Aufbau des Wortschatzes weitere grundlegende Spracherwerbsschritte verknüpft. Eine linguistische Betrachtung von Sprache als Zusammenspiel der vier sprachlichen Ebenen (Morphologie und Syntax, Phonetik und Phonologie, Pragmatik und Kommunikation, Semantik und Lexikon) verdeutlicht eindrucksvoll die wechselseitige Beeinflussung sprachlicher Kompetenzbereiche. Der Stellenwert der Entwicklung semantisch-lexikalischer Sprachkompetenzen (z.B. der Erwerb von Wortbedeutungen) im Gesamtkomplex der Sprachentwicklung lässt sich nachweisen, wenn man den Spracherwerbsprozess auf den unterschiedlichen sprachlichen Ebenen skizziert:
Mit der Produktion erster Wörter beginnt eine ständige Regularisierung und Systematisierung der kindlichen Aussprache. Das in der Phase des Erwerbs des phonologischen Systems „rapide Anwachsen des Wortschatzes“ (Hacker 1999, 22) führt einerseits zur differenzierten Ordnung der Aussprache, andererseits ermöglicht die Systematisierung der Aussprache wiederum die Produktion neuer Wörter. Diese rasante Erweiterung des Lexikons hat wiederum Einfluss auf die morphologisch-syntaktische Entwicklung: Mit neuen Wörtern können zunehmend komplexere Sätze gebildet werden. Umgekehrt zeigen Untersuchungen zu den semantischen und syntaktischen „bootstrapping“ - Strategien (Glück 2002, 29; Rothweiler 2001) den Einfluss semantisch-lexikalischer Sprachkompetenzen auf die Grammatikentwicklung: Kinder nutzen demnach semantische Informationen zur schnellen Identifizierung von Wortarten und Klassifizierung von Wörtern. Mit der Erweiterung des Lexikons erweitern sich schließlich auch die pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen des Kindes, während durch die Interaktion mit der Umwelt wiederum neue Wörter erworben werden. Dieser Kreislauf des Spracherwerbs beginnt und endet mit der Entdeckung neuer Wörter und Wortbedeutungen und der damit verbundenen Regularisierung der kindlichen Sprache.
Der Auslöser des in dieser hoch sensiblen Phase des Spracherwerbs einsetzenden Wortschatzspurts (vgl. 2001, 50) ist nicht eindeutig erklärbar, gerade die wechselseitige Beeinflussung der sprachlichen Ebenen scheint hierfür jedoch eine entscheidende Rolle zu spielen, daher sollte auch eine linguistisch-kategorisierende Betrachtung der Sprache stets die Interdependenz sprachlicher Ebenen berücksichtigen.
Mit dem vorliegenden Buch wird beabsichtigt, die Möglichkeiten der Förderung semantisch-lexikalischer Sprachkompetenzen im Spracherwerbsprozess theoretisch zu fundieren und für die unterrichtliche und pädagogisch-therapeutische Praxis zugänglich zu machen. Die Bezugswissenschaften Linguistik und Entwicklungspsychologie werden durch das didaktische Konzept der kooperativen Sprachbehindertenpädagogik (Ahrbeck / Schuck / Welling 1992) erweitert, um im pädagogischen Kontext Schule und Therapie Anwendbarkeit zu erreichen. Im Vordergrund einer entwicklungspsychologischen Herleitung steht dabei der begriffsorientierte Ansatz der Wortbedeutungsentwicklung nach Gisela Szagun.
Am Beispiel einer Unterrichtseinheit zum Thema „Tiere in Afrika“ können allgemeine Förderprinzipien und konkrete Handlungsmöglichkeiten für Unterricht und Therapie abgeleitet werden. Der Forderung individueller Lernprozessdiagnostik wird durch exemplarische Darstellung von Förderzielen in individuellen Entwicklungsplänen entsprochen.
2 Aufbau des kindlichen Lexikons
Der Aufbau des Wortschatzes ist eine komplexe Erwerbsaufgabe, die weit mehr erfordert, als das Abspeichern von Buchstaben- bzw. Lautfolgen mit der zugehörigen Bedeutung.
Nach aktuellem Forschungsstand werden Wortbedeutungen unter Berücksichtigung interagierender psychischer, sozialer, kognitiver, motorischer und sprachlicher Faktoren in hochorganisierten Netzwerken im „mentalen Lexikon“ (Dannenbauer 1997, 4; Rothweiler 2001, 28) abgelegt. Paradigmatische Bedeutungsrelationen ökonomisieren den Zugriff und die Speicherung semantisch-lexikalischer Einheiten und können als ein Erklärungsansatz für die Strukturierung des Lexikons herangezogen werden. Für Nomina stellt auf der Grundlage dieser Annahme die Begriffsrelation von „Ober- und Unterbegriffen (Hyperonymie und Hyponymie)“ (Linke / Nussbaumer / Portmann 1996, 145) eine nachvollziehbare Organisationsstrategie dar. So ordnen wir auf dem Hintergrund unseres prozessual erworbenen Weltwissens lexikalische Einträge wie GORILLA, PAVIAN und SCHIMPANSE nach individuellen Kriterien (z.B. perzeptuelle, funktionale, kognitiv-sprachliche Prinzipien) relativ schnell und sicher dem Oberbegriff AFFEN zu, wobei es mehr oder weniger prototypische Vertreter gibt, die eine kriteriengeleitete Zuordnung zu dieser Klasse erschweren oder erleichtern. Über diese Strukturiertheit des mentalen Lexikons erklärt sich nicht nur die enorme Kapazität, sondern auch die Geschwindigkeit lexikalischer Zugriffe in der Sprachverarbeitung. Der Erwerb lexikalischer Einträge führt zu einer Strukturierung und Vernetzung des Lexikons, während umgekehrt die Struktur des Lexikons einen Einfluss auf die Speicherung neuer Elemente hat.
In der Wortbedeutungsentwicklung, der Annäherung des kindlichen Begriffssystems an das konventionelle zielsprachliche System, werden Begriffe und deren Organisation in Netzwerken durch Prozesse der ständigen Modifikation und Erweiterung bedingt. Aufgrund der Darstellung dieser Faktoren wird deutlich, dass die Bedeutungsmerkmale bei Kindern individuell sind und somit nicht „den definitorischen Merkmalen des Erwachsenenbegriffs entsprechen“ (2000, 142) können. Die Wortbedeutungsentwicklung ist vielmehr ein Entwicklungsprozess, in sich das Begriffssystem des Kindes in der Interaktion mit seiner Umwelt der konventionellen Zielsprache annähert.
Aus dieser Perspektive lässt sich bereits ein entscheidender didaktischer Grundsatz für Unterricht und Therapie ableiten: Das reine Üben von Wörterlisten, vergleichbar beispielsweise mit dem klassischen Vokabellernen, ist für die Kinder wenig hilfreich, weil sich Wortbedeutungen entwickeln müssen, nicht auswendig gelernt werden. Auch Erwachsene wissen, dass sich neue Vokabeln leichter einprägen lassen, wenn sich emotionale, perzeptuelle oder kognitive Zuschreibungen, sogenannte „Eselsbrücken“ mit dem Begriff verbinden lassen.
Kinder werden im pädagogischen Kontext somit immer als Akteure der Sprachentwicklung gesehen, Lehrkräfte und Therapeuten als Begleiter auf der Entdeckungsreise zum Wortschatz.
Vor diesem Hintergrund stellt der begriffsorientierte Ansatz nach Gisela Szagun ein schlüssiges Erklärungsmodell für die Wortbedeutungsentwicklung dar, weil er entwicklungspsychologische Annahmen berücksichtigt und nicht allein als Instrument zur Beschreibung einzelner Bedeutungen oder formal-sprachlicher Kriterien, sondern zur Analyse von Bedeutungsrelationen im Kontext der kindlichen Entwicklung herangezogen werden kann.
Auf dieser wissenschaftstheoretischen Basis stellt die vorliegende Arbeit die Umsetzung einer begriffsorientierten, sprachbehindertenpädagogisch begründeten Förderung auf der semantisch-lexikalischen Ebene am Beispiel der Unterrichtseinheit „Tiere in Afrika“ in den Vordergrund. Die Schülerinnen und Schüler aktivieren, modifizieren und erweitern in sinnvollen Bedeutungszusammenhängen ihre Begriffsnetze unter Rückgriff auf Organisationsstrategien hinsichtlich paradigmatischer Bedeutungsrelationen.
Für die Verknüpfung der dargestellten Theorie mit einer pädagogischen Praxis liefert der Sprachhandlungsansatz (vgl. Kapitel 3.) die Leitfragen für einen Unterricht, der sich dem Anspruch sprachbehindertenpädagogischer Professionalität stellt:
Wie ist das individuelle mentale Lexikon der Schülerinnen und Schüler organisiert?
Welche Möglichkeiten bietet sprachbehindertenpädagogischer Unterricht, Einblicke in den individuellen Verstehens- und Produktionsprozess bezüglich kriteriengeleiteter Begriffsbildung der Schülerinnen und Schüler zu erlangen und auf dieser Grundlage konventionellen Begriffsrelationen anzunähern?
Welche Bedingungen sind an die semantisch-lexikalische Förderung spezifisch sprachentwicklungsgestörter Kinder geknüpft? Welche Konsequenzen ergeben sich? Welche Grenzen zeigen sich auf?
3 Wortbedeutungsentwicklung
3.1 Epigenetische Entwicklungstheorie
Zentrale Aussagen nativistischer Sprachentwicklungstheorie beziehen sich auf Sprache als angeborene Fähigkeit, die funktionell, anatomisch autonom und modular ist (vgl. Szagun, 2001, 53). Analog zur Entwicklung eines Organs, entwickelt sich diesem Erklärungsansatz zufolge auch Sprache unter ausreichender Stimulation durch die Umwelt nach einem größtenteils vorgezeichneten genetischen Plan. Durch genetische Präformation werden aus nativistischer Sicht auch spezifische Sprachentwicklungsstörungen bestimmt, die sich im „langsameren Spracherwerb und erheblichen Schwächen der Kinder insbesondere im morphologischen und syntaktischen Bereich“ (ebd., 56) äußern.
In der spracherwerbstheoretischen Diskussion besteht zwar Einigkeit darin, dass Sprache eine angeborene Fähigkeit des Menschen ist, für eine entwicklungspsychologische Betrachtung des Spracherwerbs steht jedoch die Fragestellung im Vordergrund, inwieweit diese Fähigkeit mehr oder weniger fertig und vorbestimmt ist, oder ob sich die Fähigkeit aus der Interaktion zwischen genetisch bedingter Reifung und den Erfahrungen mit der Umwelt entwickelt (ebd., 63). Gerade der Aspekt der Entwicklungsbezogenheit fehlt in der nativistischen Theorie und lässt diesen Ansatz für die Betrachtung der Wortbedeutungsentwicklung im sprachbehindertenpädagogischen Kontext wenig hilfreich erscheinen.
Vertreter der epigenetischen Systemtheorie sehen dagegen menschliches Verhalten als Resultat genetisch gesteuerter Reifungsprozesse und der Interaktion mit der Umwelt. Weder die genetischen noch die ökologischen Faktoren bestimmen in direkter Weise menschliches Verhalten, es sind die „dynamischen Interaktionen selbst, die die psychologischen Strukturen, oder das Verhalten, schaffen“ (ebd., 14). Dies bedeutet, dass das entstandene Verhalten weder direkt aus den genetischen Informationen, noch aus den Informationen der Umwelt ableitbar ist. Durch die Interaktion dieser dynamischen Systeme selbst entstehen unter Rückgriff auf die verfügbaren Handlungs- und Denkmuster neue Formen (vgl. Piaget 1967 zit. in 2001, 14). Wichtig bei diesen Prozessen der Assimilation und Akkommodation ist, dass sie gleichzeitig an der Erkenntnisbildung wirken, sich ergänzen und ein Gleichgewicht anstreben. Sowohl das Subjekt als auch das Objekt verändern sich in diesem Interaktionsprozess, wobei die stabilisierende Assimilation und die verändernde Akkommodation sich ausbalancieren. Piaget nennt diesen Balanceakt "Äquilibration" (vgl. Zürcher 2005).
Neuere Forschungen zu konnektionistischer Modellierung bestätigen und präzisieren diese epigenetischen Grundannahmen (vgl. Dell et al. 1999, 517ff.; Westermann 2000, 69ff.; 2001, 32ff.). Konnektionistische Modelle kognitiver Prozesse sind stark vereinfachte Modelle der Informationsverarbeitung im Gehirn, die eine genaue Betrachtung von Entwicklungsabläufen ermöglichen. Das Lernen erfolgt demzufolge in neuronalen Netzen, sich selbst organisierenden Systemen, die aus einfachen Strukturen komplexes Verhalten hervorbringen. Interessant für entwicklungspsychologische Fragestelllungen ist die Parallele zwischen konnektionistischen Netzen und der epigenetischen Entwicklungstheorie. Die Vorstellung Piagets vom Entwicklungsprozess als Assimilation und Akkommodation (Piaget 1970 zit. in 2001, 35; siehe auch 2.4.) wird im konnektionistischen Modell bestätigt. Für die Entwicklung der Kinder bedeutet dies, dass einem Verhalten, das äußerlich diskontinuierlich und als neue Qualität erscheint, den inneren Repräsentationen gemäß ein Prozess zugrunde liegt. „Das Netz assimiliert Eingaben an seinen bestehenden Zustand, akkommodiert sich an neue Eingaben und schafft so Veränderungen in seinen inneren Repräsentationen“ (Szagun 2001, 35). Im Unterschied zu Piagets Vorstellung gehen konnektionistische Modelle vom übergangslosen Erkenntnisprozess aus, in dem das Entwicklungsziel erreicht wird, ohne dass das Kind bestimmte Entwicklungsstufen und Erwerbsphasen erreicht. Dies hat Konsequenzen für die Diagnostik und die Spezifizierung von Unterrichtszielen.
Aus der epigenetischen Entwicklungstheorie lassen sich Kernannahmen für die Betrachtung von Wortbedeutungsentwicklung im entwicklungsbezogenen sprachbehindertenpädagogischen Kontext entwickeln:
Aus netzwerktheoretischer und epigenetischer Sicht können Begriffstrukturen nur durch Aktivierung schon bestehender Strukturen erweitert werden.
Die individuellen Begriffstrukturen von Kindern unterscheiden von den zielsprachlichen Begriffstrukturen der Erwachsenen. Der Aufbau von Begriffsstrukturen entwickelt sich über eigenaktive Prozesse der Assimilation und Akkommodation an konventionelle Begriffsstrukturen.
Entwicklungspsychologisch fundierte Theorie, die Wortbedeutungsentwicklung als Teil der Gesamtentwicklung beim Kind sieht, macht sprachbehindertenpädagogisches Handeln erst möglich und sinnvoll, da man von sich verändernden und veränderbaren Strukturen ausgeht
Unter Berücksichtigung dieser Hypothesen wird deutlich, dass bei der Betrachtung von Wortbedeutungsentwicklung ein entwicklungsbezogenes Modell obligat ist, auf deren Grundlage entwicklungspsychologische Annahmen überprüft und pädagogisch-intervenierende Maßnahmen abgeleitet werden können. Dieses Modell erfordert entwicklungspsychologisches „Handwerkszeug“, um diese Hypothesen im sprachbehindertenpädagogischen Handlungsfeld - der Herstellung des Theorie-Praxis-Bezugs - zu dokumentieren, diskutieren und nicht zuletzt auch für Unterricht und Therapie nutzen zu können.
3.2 Semantische Merkmaltheorie- oder Begriffsorientierung?
Der Erwerbsprozess des willkürlichen, für die Zeichenbenutzer einer Sprachgemeinschaft verbindlichen Zeichensystems Sprache, erfordert kognitive Voraussetzungen, die Piaget in seiner Entwicklungstheorie erläutert. Im Spracherwerb durchläuft das Kind demnach verschiedene Stufen der Entwicklung zum Erwerb der Symbolfunktion. Von großer Bedeutung ist in diesem Zusammenhang die Entwicklung von Objektpermanenz, in dem das Kind eine geistige Vorstellung eines Objekts erlangt und dieses vom eigenen Selbst und Handeln lösen kann. Mit der Entwicklung der Symbolfunktion erlangt das Kind die Fähigkeit, sich erkannte Realitäten durch Vorstellungsbilder, Gegenstände oder Wörter geistig präsent zu machen. Über Prozesse der Nachahmung entwickelt sich allmählich die innere Repräsentation einer abwesenden Realität. Äußere Nachahmung durch das Nachmachen von Bewegungen oder Lauten entwickelt sich zur inneren Nachahmung, der ersten Form von Symbolisierung einer erkannten Realität. Dies sind wichtige kognitive Entwicklungsprozesse, die dem Spracherwerb zugrunde liegen.