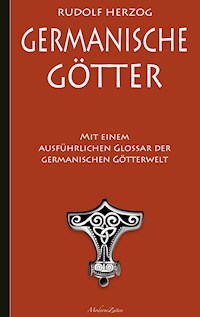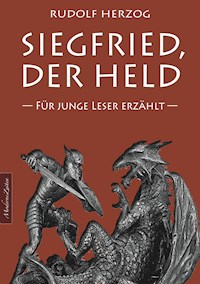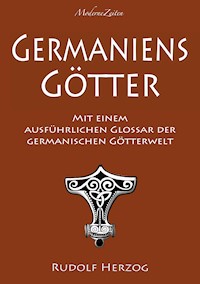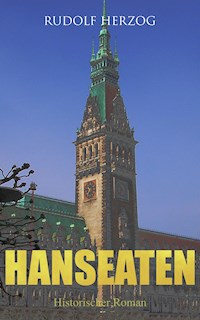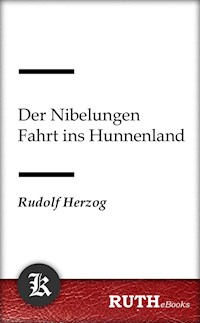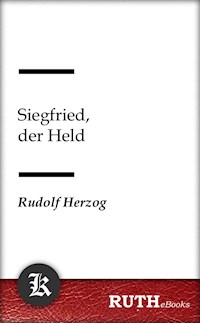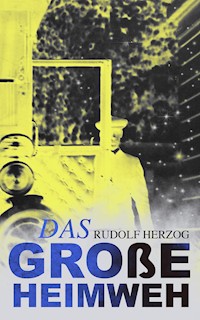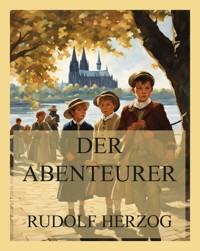
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Der Abenteurer" von Rudolf Herzog ist die Geschichte eines Sängers, der den Folgen eines ungewöhnlichen künstlerischen Temperaments nicht entgehen konnte. Ein Mann mit sehr wandelbarem Geschmack, dem die Bindung an seine Heimat wie die stickige Luft eines Gefängnisses vorkommt, ein Geschöpf des Augenblicks, geboren für die Schönheit, die Freude und die Sinnenfreuden des Lebens, ist eben schlecht geeignet, die Rolle zu spielen, die ihm die Vorsehung in Gestalt des Autors zugedacht hat. Bis zum bitteren Ende wird er von einer ihn anbetenden Ehefrau geliebt, deren erhabene, selbstlose Zuneigung keinen Raum für Fehlersuche lässt. Obwohl er in die Ferne schweift und seine "Rückfälle" in den Stand der Ehe immer seltener werden, grüßt ihn seine Frau stets mit einem frischen Lächeln und empfängt ihn in ihrem besten Gewand. Es ist ein ebenso trauriges wie desillusioniertes Bild, das der kluge deutsche Autor seinen Lesern zeichnet, und es endet, wie das Heimatdrama es manchmal tut, mit einem tragischen Scheitern der "Wiedergutmachung". Rudolf Herzog gehörte zu den beliebtesten deutschen Autoren des frühen 20. Jahrhunderts.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 415
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Der Abenteurer
RUDOLF HERZOG
Der Abenteurer, R. Herzog
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN: 9783988681577
www.jazzybee-verlag.de
INHALT:
I.1
II. 12
III. 23
IV.. 34
V.. 47
VI. 60
VII. 72
VIII. 83
IX.. 95
X.. 108
XI. 121
XII. 134
XIII. 145
XIV.. 158
XV.. 171
XVI. 183
XVII. 195
XVIII. 207
XIX.. 218
XX.. 230
I.
Jenseits der Schiffsbrücke, auf der Deutzer Seite, hockten die spielmüden Kinder auf der Kaimauer, drückten die heißen Gesichter gegen die Eisenstäbe und blickten durch die Umzäunung über den Strom hinweg auf das langgestreckte, halbmondförmige Köln. Ein paar verlorene Strählchen der Wintersonne glitzerten noch auf dem Wasserspiegel, suchten vergebens zueinander zu gelangen, verquirlten langsam in der Strömung und erloschen als glimmende Pünktchen ... Ein silbriger Ton blieb in der Luft zurück. Jene überraschende Klarheit, die vor dem letzten Verdämmern noch einmal die Seele der Menschen wie die Seele der Natur erfüllt und alle Bilder in scharfen Konturen erstehen läßt. Gegiebelt und gezackt, die Türme des Domes und der Kirchen wie deutende Finger gen Himmel gestreckt, zog sich die altersgraue Silhouette Kölns den Rhein entlang.
Es war still auf der breiten Wasserstraße. Die ungefügen Lastkähne, die Schlepperzüge und die hochbordigen Passagierdampfer lagen zusammengedrängt im Hafen wie eine müde Herde, hielten Wintersruh und warteten auf besseren Pegelstand. Nur die kleinen Lokalboote huschten schwalbenflink von Ufer zu Ufer, fühlten sich als alleinige Herren des Stromes, ließen den Rauch noch schwärzer hinter sich dreinqualmen und Dampfpfeife und Schiffsglocke doppelt hell und grell erklingen. Legten sie an, um neue Passagiere abzuwarten, so zog das Schweigen über den Strom und duckte sich der alten, mächtigen Rheinstadt zu Füßen.
»Sie is schon mal versunken gewesen,« sagte das kleine Mädchen, das zwischen den beiden Knaben auf der Deutzer Kaimauer hockte, hob die Schultern, als ob es ein Gruseln verspürte, und blickte mit glänzenden Augen geradeaus.
»So dumm,« höhnte ihr Nachbar zur Linken, schob die bunte Gymnasiastenmütze in den Nacken und spuckte ins Wasser.
»Der alte Klaus hat es mir doch erzählt,« ereiferte sich die Kleine. »Zwei Bauern hatten Köln verflucht, weil sie von den Kölner Kaufleuten betrogen worden waren. Da verschwand die Stadt vor ihren Augen.«
»Is ja zu dumm,« beharrte der Aufgeklärte. »Wo käm’ sie denn auf einmal wieder her?«
»Die Bauern haben sie wieder herausgebetet, weil sie doch sonst ihr Gemüs’ nicht absetzen konnten.«
»Sieh mal, wie schlau. Wenn das wahr wär’, hätten doch die Kölner die Bauernklüngels, wie sie das nächste Mal in die Stadt kamen, ohne viel Fisimatenten aufgeknüpft. Uzerei ließen die sich vom Gemüsbauer nicht gefallen.«
»Gott, ich weiß es doch,« sagte die Kleine pikiert und drehte ihm den Rücken zu. —
Die Dämmerung rührte die Stadt an. Die Gassen und Straßen wichen wie hinter einem Schleier zurück. Nur die Türme hielten stand und bildeten weithinaus die Wahrzeichen, in langem Sichelkranz die erhabene Masse des Domes flankierend. Hellebardiere im Dienste der Majestät.
Die Kleine seufzte. Ihr zweiter Begleiter, der sich aus seiner Träumerei nicht herausgerührt hatte, fuhr hastig herum.
»Ist dir kalt?«
Sie schüttelte den schwarzen Lockenkopf. Ein feuerrotes Seidenband trug sie durch das Haar gezogen.
»Hach, es is so schön ...« Und nach einer Pause: »Ich kann alle Türm’ zählen. Und jeder Turm weiß eine Geschichte. Ich möcht’ sie alle kennen ...«
»Frag mich,« bat der andere und strich sich das rötliche Haar unter den Hutrand.
Der Buntbemützte maß ihn mit dem Blick des Patrizierjungen. »Du weißt doch höchstens in eurer Synagoge Bescheid!«
»Hab’ ich dich gefragt oder den Moritz?« fuhr das Mädchen auf.
»Frag mich nur,« sagte der ältere. Er war blaß geworden und sah unruhig auf das Mädchen. »Der Laurenz kann ja nach Hause gehen, wenn’s ihm hier nicht paßt.«
»Geh du doch. Immer drängst du dich uns auf. In Sekunda wollen sie dich wohl nicht?«
»Untertertianer,« sagte der andere und zuckte mit der Lippe.
»Judenjung.«
»Das ist keine Beleidigung.« Er wandte sich dem Mädchen zu, das erwartungsvoll hinhorchte. »Ich werd’ mir doch den schönen Abend nicht verprügeln.«
»O — —,« machte die Kleine verblüfft. »Ich hätt’ aber gern gesehen, wie der Laurenz mal Wichs’ gekriegt hätt’.« Und dann sprang sie mit der Raschheit der Kinderempfindungen auf ihr altes Thema: »Sieh mal, der Dom! Is es wirklich wahr, daß den ersten Baumeister der Teufel geholt hat?«
»Das ist eine Legende,« erklärte Moritz Lachner. »Weil der Bau nie fertig wurde, erzählten sich die Leute, Meister Gerhard von Ryle, der Bauherr, habe hoch oben auf dem Domkran mal mit dem Teufel gewettet, daß er schneller mit dem Dombau fertig sein würde, als der Teufel einen Kanal von Trier nach Köln graben könne. Meister Gerhard aber hätte durch die Schwatzhaftigkeit seiner Frau die Wette verloren und sich vom Turmgerüst in die Tiefe gestürzt. Das wäre der Grund gewesen, weshalb kein neuer Stein mehr hätte fassen wollen.«
»Weil die Wette sündhaft war,« triumphierte Laurenz Terbroich. »Alle Künstler sind Sünder.«
Moritz Lachner warf einen schnellen Blick auf die kleine Spielgefährtin, die gerade in die rotgewordenen Hände blies.
»Weiter, Moritz. Und der große Sankt Martin nebenan? Davor könnt’ ich mich fürchten.«
»Der ist so trotzig aufgebaut, weil er früher auf einer Insel stand und sich gegen das Wasser wehren mußte.«
»Waren wirklich keine Räuber drin?«
»Man sagt, schottische Mönche hätten die Kirche gleichzeitig als Wohnhaus für sich gebaut. Wie ein schottisch Kastell. Ob das wahr ist, muß ich erst noch untersuchen.«
Laurenz Terbroich klatschte sich vor Vergnügen auf die Schenkel. »Der Moritz. Der Moritz Lachner will es untersuchen! Morgen sag’ ich es dem Herrn Erzbischof!«
»Rechts vom Dom, da liegt Sankt Gereon. Schnell, Moritz, was weißt du davon?«
»Auf dem Platz, auf dem diese Kirche steht, wurde der Hauptmann Gereon mitsamt seiner thebaischen Legion niedergemetzelt, weil er und seine frommen Soldaten nicht vom Christenglauben lassen wollten.«
»Huih! — So düster sieht die Kirch’ auch grad’ aus.«
»Die Geschichte macht dem Lachner besonders viel Spaß,« behauptete der Untertertianer frech. »Eine ganze Legion Christen! Abgemurkst!«
»Wenn du von Sankt Martin nach links guckst, Terbroich,« sagte der und blies die schmalen Nasenflügel auf, »so siehst du den Rathausturm. Das ist der schönste Turm von Köln, ja der schönste von ganz Deutschland. Frag nur deinen Ordinarius. Und der ist euch Patriziern zu Ehren gebaut worden.«
»Du willst dich wohl wieder einschmeicheln?«
»Euch zu Ehren. Weil euch das Volk glücklich allzusammen festgenommen und ins Kittchen gesteckt hatte. Und von der Buße, die ihr habt zahlen müssen, errichteten die Zünfte diesen schönen Rathausturm.«
»I ja,« echote Terbroich, »und neben diesem schönen Rathaus liegt die Judengasse, und weil nun der Rathausturm gar so schön geworden war, wurde diese Nachbarschaft nicht mehr als passend befunden, und man fegte sie sauber und euch all zusammen zu den Toren hinaus, wo ihr bis zur französischen Revolution liegen bleiben konntet. I ja.«
»Du hast ja — überraschende Geschichtskenntnisse,« stammelte Lachner.
»Die hab’ ich mir extra dir zu Ehren eingepaukt, weil du so sehr unseren Verkehr suchst.«
»Euren — Verkehr?«
»Zankt euch doch nachher,« rief die Kleine ungeduldig und trippelte nervös auf den Mauerquadern. »Was ist das mit den elftausend Jungfrauen?«
Und dienstfertig belehrte Moritz Lachner: »Sie liegen zu Sankt Ursula. Im Norden der Stadt. Von hier aus kannst du das uralte Kirchlein nicht sehen. Es war ein Heidenprinz, der wollte die Tochter des Königs von Britannien zur Frau oder das Land mit Krieg überziehen. Da sagte sich die fromme Ursula ihm zu, aber unter der Bedingung, daß er Christ würde und sie mit elftausend Jungfrauen des Landes eine Wallfahrt nach Rom machen dürfe. Als sie aber vom Papst zurückkam und in Köln landen wollte, das von den Hunnen belagert wurde, wurde sie mit allen ihren Begleiterinnen von dem wüsten Heidenvolk erschlagen.«
»Gewiß, weil sie die häßlichen Soldaten nicht heiraten wollten.«
»Wenn sie nicht einen Prinzen zum Bräutigam gehabt hätt’, hätt’ sich die Ursula wohl nicht besonnen,« warf Laurenz Terbroich skeptisch ein. »Darin sind sich alle Mädchen gleich.«
»Ja, einen Prinzen — —,« sagte die Kleine gedehnt und sah den hübschen, vornehmen Jungen mit flimmernden Augen an.
»Soll ich weitererzählen?« fragte Moritz Lachner hastig. »Dort drüben, am Neumarkt, liegt Sankt Aposteln. Eine arme Rittersfrau hatte Zwölflinge bekommen —«
»Er lügt,« sagte Laurenz Terbroich, »Zwölflinge kriegen nur Kaninchen.«
»Zwölf Knaben,« fuhr Lachner eilig fort, als fürchtete er, um seinen Erzählerposten zu kommen. »Und weil sie sie nicht ernähren konnte, wollte sie sie ertränken lassen. Aber der Herr Erzbischof fand die Kinder am Wasser und nahm sie mit und erzog sie zu Stiftsherren und gründete für sie die Kirche zu den Aposteln, da die doch auch zwölf gewesen waren. Und mehr nach Süden, siehst du, da liegt Sankt Maria im Kapitol. Das ist auf demselben Platz gebaut, aus dem die alten Römer, als sie noch in Köln wohnten, ihr Regierungsgebäude hatten, und die Frau vom König Pippin, die ihren Stiefsohn Karl Martell in Köln gefangen hielt, liegt darin begraben. Und in der Kirche Sankt Alban wird eine Hostie verwahrt, die im Munde eines Gottesleugners plötzlich zu Fleisch wurde. Aber interessanter ist die Albertuskapelle in Sankt Andreas. Die enthält die Gebeine von dem großen Dominikanergelehrten Albertus Magnus. Der konnte hexen und zaubern und war doch ein Heiliger und der Lehrer von Thomas von Aquino, dem in dem spitzfindigen Franziskaner Duns Scotus ein gefährlicher Gegner entstand. Der Duns Scotus aber liegt nebenan in der Minoritenkirche und —«
»Nu hör doch nur endlich auf,« unterbrach ihn Laurenz Terbroich ärgerlich. »Daß du zum Herrn Pater in die Katechisierstund’ gehst, kannst du uns doch nicht weismachen.«
Da schwieg der Lachner.
Auf der Schiffsbrücke wurden die Laternen hochgezogen. Die Stadt war langsam in der Dunkelheit verschwunden. Nur die Masse des Domes hob sich gespenstisch, einer rätselhaft übernatürlichen Erscheinung gleich, gegen den Abendhimmel ab. Und als hätten die Laternen der Schiffsbrücke das Zeichen gegeben, so blitzte es am jenseitigen Ufer auf, und die Lichter liefen die Hafenstraßen entlang bis zur alten Trutzburg Kölns, dem Bayenturm, entzündeten sich in der Rheinstraße und drangen weiter ins Herz der Stadt, kreuz und quer durch die Gassen der Altstadt in die Prunkstraßen der Neustadt. Und aufs neue trat die Silhouette Kölns hervor, in roten, magischen Dunst gehüllt. Gegiebelt und gezackt, von deutenden Türmen und Basiliken überragt. Von dem tiefen Atemzug der Vergangenheit erfüllt und dem heißen Pulsschlag seiner Gegenwartskinder. Die ewige Sagenstadt am Rhein ...
»Ha,« rief die Kleine und lief am Geländer entlang, um den Lichtern zu folgen, »wenn ich könnt’, wie ich möcht’ — möcht’ ich ganz Köln haben.«
»Ich will es dir schenken,« sagte Lachner atemlos und griff nach ihrer Hand.
»Du — —? Was willst du denn werden?«
»Historiker.«
»Was ist das: Historiker?«
»Geschichtsschreiber.«
»Märchen und so?«
»Die Geschichte der Menschen und ihrer Städte.«
»Ich übernehm’ die Fabriken vom Vater,« sagte Laurenz Terbroich und legte den Kopf in den Nacken. »Teppichwebereien. Ein Ballen Teppiche bringt mehr ein als hundert Ballen Geschichtenbücher.«
»Wahrhaftig?« fragte die Kleine verblüfft.
»Wenn’s dem Lachner seine Geschichten sind: mehr als tausend Ballen.«
»Du, Laurenz, dann werd’ ich deine Frau.«
»Ich weiß nicht, ob das meine Eltern erlauben.«
»Och, sieh mal! Der stolze Laurenz! Mein Vater ist mehr als der deine!«
»Das fragt sich doch.«
»Das fragt sich nicht! Mein Vater ist ein Doktor und — und —«
»Ein Künstler,« sagte Moritz Lachner, »ein großer Künstler.«
»Deshalb heißt du auch so komisch,« meinte Laurenz mit einem schiefen Blick. »Du hast nicht mal einen richtigen Christennamen.«
»Ich heiße Carmen! Das bedeutet: das Lied, wenn du das noch nicht in der Schule gelernt hast. Weil ich sein schönstes Lied wär’, sagt mein Vater. Darum.«
»Ist denn der Herr Doktor Otten überhaupt dein Vater?« nörgelte der Junge.
»Was sagst du?«
»Nu, weil er doch nie in Köln bei euch ist.«
»Was —?«
»Und überhaupt. Künstler haben nie richtige Frauen, und daher auch keine richtigen Kinder.«
Da war die Kleine an ihn heran.
»Au, au! Katze! Du hast gekratzt!«
Wie der Wind flog sie zurück. Wütend rannte der Junge hinter ihr drein. Sie erwischte Moritz Lachner beim Ärmel und zerrte den schwerfälligen Freund zwischen sich und dem Verfolger hin und her. »Nimm mich auf!« keuchte sie. Da beugte er sich nieder und nahm sie Huckepack. »Drauf, drauf!« triumphierte sie von ihrem hohen Sitz, und Moritz Lachner vergaß seine Untersekundanerwürde und stürzte sich wie ein Kriegselefant, der eine Amazonenkönigin trägt, auf den Feind.
Nun hatte sie dem Gegner die Mütze vom Kopf gerissen und warf sie, aufjauchzend, mitten auf den Straßendamm.
Da machte sich der Barhäuptige an Lachner, der seine Hände, die der Reiterin als Steigbügel dienten, nicht freibekommen konnte, und bearbeitete mit den Stiefelspitzen die Schienbeine des Gegners.
Moritz Lachner kniff die Lippen zusammen und gab keinen Laut.
Blitzschnell bog sich das Mädchen herab und griff mit beiden Händen in das weiche, schwarze Haar des Angreifers.
»Au, au! Carmen! Loslassen!«
»Werd’ ich deine Frau? Ja oder nein!«
»Loslassen! Maria Joseph!«
»Werd’ ich deine Frau?«
»Ja! Jawohl!« —
Da glitt das Mädchen an Lachners Rücken nieder, rannte auf den Straßendamm, hob die weggeschleuderte Mütze auf und klopfte säuberlich den Staub heraus. Mit kleinen, wiegenden Schritten kam sie zurück, den Arm vorgestreckt. »Hier ist sie,« sagte sie und sah den wiedergewonnenen Freund von unten herauf an. »Sie is wirklich nicht schmutzig geworden.«
»Gib her,« knurrte der Laurenz grob, riß ihr die Mütze aus der Hand und stülpte sie auf den Kopf. Dabei verzog er das Gesicht.
»Hab’ ich dir arg weh getan, Laurenz?«
»Ich blut’,« sagte der Junge wehleidig und tippte mit dem Finger auf die Schläfe. »Du hast mich gekratzt.«
»Zeig!« Sie hob sich auf den Fußspitzen und betrachtete aufmerksam den Riß an seiner linken Schläfe.
»Hast du kein Pflasterpapier?«
»Ich hab’ keins.«
»Und du, Moritz? Gott, so mach doch.«
Moritz Lachner holte umständlich ein großes Bügelportemonnaie aus seiner Hosentasche hervor und brachte ein Blättchen englisch Pflaster zum Vorschein. Bevor er es präsentieren konnte, hatte die Kleine es ihm schon aus der Hand genommen und angeleckt. Er stand beiseite und sah zu.
»Neig dich, Laurenz. So — —!« Sie pappte das Pflästerchen über seine Schläfe. »Jetzt bist du ein Ritter, Laurenz, und trägst eine Narbe, deiner Dame zu Ehren. So — —! Und deine Dame gibt dir dafür einen Kuß.«
Sie legte ihm die Hände über die Ohren und küßte ihn mit ungeschickten Kinderlippen.
»Komm,« sagte der Junge, »wir laufen in die Stadt. Da ist es jetzt am amüsantesten.«
Er nahm das Mädchen bei der Hand, lief mit ihr zur Schiffsbrücke, erlegte ritterlich für sie mit das Brückengeld, und dann galoppierten sie über die ächzenden, schaukelnden Planken. —
Moritz Lachner stand noch immer auf demselben Fleck. Langsam stieg ihm das Blut aus den Wangen bis in die Stirn. Er nahm sein rundes Filzhütchen ab und strich mechanisch über sein rötliches Haar. Er schämte sich ... Da war er, der vierzehnjährige Untersekundaner, mit diesem zwölfjährigen hochmütigen Bengel und der kleinen zehnjährigen Carmen hierhergelaufen, statt hinter den geliebten Büchern zu sitzen. Nur, weil der Junge ein Patriziersohn und das Mädchen ein Künstlerkind und — ja doch — und schön war. Dr. Joseph Ottens, des berühmten Sängers und modernen Rezitators Otten Tochter! Und er hatte ihr Geschichten erzählt, den ganzen Nachmittag lang, und alle seine Weisheit vor ihr ausgekramt. Und Pferd gespielt und sich von dem wütenden Laurenz um ihretwillen die Beinkleider verderben lassen. Und zum Schluß sein englisch Pflaster geopfert und zugesehen, wie der bekämpfte Rivale noch dazu einen Kuß erhielt. Und dann — —
Es stieg ihm feucht in die Augenwinkel.
Dann hatte man ihn stehen lassen. In der Freude hatte man ihn vergessen. — —
In der Ferne sah er sie über die Schiffsbrücke laufen. Sie jagten sich und rannten gegen ein paar Brückenarbeiter, die hinter ihnen herschimpften. Noch einen Augenblick kämpfte er mit sich. Dann senkte er den Kopf und trabte hinterher.
»Sie weiß noch nicht, daß ihr Vater heut kommt und im Gürzenich singt,« beschwichtigte er seine Scham. »Das muß ich ihr noch sagen ...«
»Heut kann ich bis wenigstens acht Uhr draußen bleiben,« verriet die Kleine ihrem Freunde Laurenz, als sie die Brücke verließen. »Mutter gab keine Antwort, als ich sie fragte. Sie war den ganzen Tag so still. Da bin ich echappiert.«
Sie drückten sich an der Rheingasse vorbei. Schmal und hochgiebelig, mit schweren Balkenlagen und reichem, altkölnischem Schnitzwerk stand das Haus der Ottens. In der Haustür lehnte trotz des Winterabends ein untersetzter Mann mit grauem Stoppelbart, fest in ein gestricktes Wollenkamisol eingeknöpft, eine Schiffermütze auf dem Kopf. Er rauchte aus einer dünnstieligen holländischen Tonpfeife und blies die Kringel über die Gasse.
»Der alte Klaus,« flüsterte die Kleine. »Komm schnell.« Und sie tauchten in den Schatten der nächsten Häuser und entflohen auf den Heumarkt.
Der Schiffer nahm behutsam die Pfeife aus dem Mund und blinzelte hinter ihnen her. »Materdeies, dat wor doch uns Carmche? Mit dem Nixnotz, dem junge Terbroich?« Und er schüttelte mißbilligend den grobgeschnitzten Kopf.
Eben bog eine neue Gestalt um die Ecke, sah sich suchend um und wollte eiligst verschwinden.
»Der Lachners Moritz,« knurrte der Alte befriedigt. »He, du Moritz, op de Heumarkt sinn se. Dat du mr got oppaßt op et Carmche.«
Moritz Lachner fuhr herum. Ertappt und verärgert. »Was geht das mich an?« fragte er trotzig. »Ich bin doch nicht ihre Kinderfrau?«
»Un ich sagen der nor dat ein: dat du mr got oppaßt.« Damit schob er die Pfeife ruhig zwischen die gespitzten Lippen.
»Ich geh’ nach Haus,« sprach der Junge vor sich hin, und nahm doch den Weg zum Heumarkt, »ich geh’ auf der Stelle nach Haus, auf der Stelle.« Nun hatte er das Reiterstandbild Friedrich Wilhelms des Dritten erreicht, des ersten Preußenkönigs in Rheinlanden. Er kroch gebückt um das Eisengitter herum und lugte nach allen Seiten. Enttäuscht erhob er sich. »Sie werden auf den Altenmarkt gelaufen sein,« überdachte er. »Aber ich geh’ jetzt nach Haus.« Und dann lief auch er auf den Altenmarkt.
Dort entdeckte er sie, wie sie Hand in Hand über den Platz bummelten.
»Ich will mich nicht aufdrängen,« murmelte er, »ich will nicht.«
Am Jan-van-Werth-Brunnen hatte er sie erreicht.
»Du,« hörte er die Kleine sagen, »das is der Jan un et Griet.«
Laurenz lachte.
»Weshalb lachst du denn nur?«
»Als der Jan Reitergeneral geworden war, hat er et Griet sitzen lassen.«
»Soo —! Und als der Jan noch als Bauernknecht auf dem Kümpcheshof in Köllen diente, da hat die Bauerntochter, et Griet, ihm einen Korb gegeben. Ätsch!«
»Und dann ist et Griet eine alte verschrumpelte Appelfrau geworden, und der Jan zog als ein stolzer Reitersgeneral durch das Severinstor in Köln ein, und da saß et Griet vor seinem Appelkram und briet sich Kastanien.«
»Weiter.«
»Der Jan van Werth kriegte eine große Schadenfreude —«
»Das ist nicht wahr!«
»Er hielt aber doch sein Pferd an und sagte: Och, Griet, wer et hätt’ gedonn!«
»Und et Griet ließ sich nicht foppen und sagte: Och, Jan, wer et hätt’ gewoß’!«
Nun lachten sie miteinander.
»Wenn ich dich sitzen lass’, wirst du et Griet!«
»Du aber noch lang’ nicht der Jan!«
Er galoppierte mit steifen Beinen auf sie zu, salutierte und schnarrte: »Griet, wer et hätt’ gedonn!«
Und sie wischte sich das Näschen, grämelte und piepte alsbald: »Jan, wer et hätt’ gewoß’!«
»Ich fang’ dich!«
»Möchtste wohl — kriegst mich nicht!«
»Griet, wer et hätt’ gedonn!« schrie er und suchte sie zu haschen.
»Jan, wer et hätt’ gewoß’!« jauchzte sie zurück und entkam ihm um das Denkmal herum.
Atemlos, lachend und aufkreischend, rasten sie hin und her. Jetzt streckte er die Hand nach ihren flatternden Locken, und sie fiel ihm in die Arme. Mit dem letzten Sprung waren sie gegen Moritz Lachner geprallt.
»Was fällt dir ein?« wütete Laurenz Terbroich und ballte die Faust. »Bist du denn so dickfellig, daß du nicht merkst, daß wir dich nicht haben wollen? Scher dich in euren Laden! Da kannst du deinem Alten helfen, Hasenfelle verkaufen.«
»Jawohl, geh nach Haus,« echote zornig die Kleine.
Moritz Lachners Augen irrten vom einen zum andern, unablässig von einem zum andern. Zum ersten Male kam ihm die Erkenntnis von der Grausamkeit der Kinderseele. Ihm war grenzenlos elend zu Sinn.
»Was stehst du noch?« schnaubte der Patrizierjunge.
»Ja, was stehst du noch?« zürnte die Kleine.
»Der Klaus,« stotterte Moritz, »der alte Klaus hat mich hergeschickt. Damit dir nichts passiert, Carmen.«
»Sag dem Klaus,« höhnte Laurenz, »er solle sich um seine Nase kümmern, damit sie nicht windschief wird.«
»Ja, sag ihm das!« jubelte die Kleine.
Moritz Lachner zog tief die Luft durch die Nasenflügel. Seine Augen suchten unruhig am Boden. Er rang mit einem Entschluß und fand die Worte nicht. Dann trat er vor und faßte der kleinen Carmen Hand.
»Carmen — ich hätt’ dir noch was zu sagen ...«
»Sag’s mir morgen.«
»Nein, heute. Dein Vater kommt nach Köln. Vielleicht ist er schon da. Er singt heut abend im Gürzenich.«
Sie starrte ihn an. Ungläubig. Begierig. »Der — Vater? — Der meine —?«
»Verlaß dich drauf.«
Sie schüttelte den Kopf. »Ich glaub’s nicht. Die Mutter hätt’s gesagt.«
»Vielleicht, daß er sich nicht hat anmelden können ...«
Hinter ihnen kicherte jemand. Es war Laurenz Terbroich.
Mit sprühenden Augen fuhr sie zu ihm herum.
»Du sollst nicht lachen!« Und sie stampfte mit den Füßen wie eine Wilde. Da brach sein Lachen ab.
»Du,« sagte Moritz und machte ein fröhliches Gesicht, »um halb acht beginnt das Konzert. Jetzt ist es sieben. Wollen wir zum Gürzenich laufen. Wenn er aus dem Wagen steigt, kriegen wir ihn zu sehen.«
»Du willst mich uzen.«
»Wenn du’s nicht glaubst, da an der Säule kleben die Plakate.«
Ehrfürchtig gingen sie hin und lasen. »Liederabend von Dr. Joseph Otten. Im Saale des Gürzenich.« Zweimal und dreimal lasen sie. Das Mädchen erschauerte und blickte mit fiebrigen Augen auf das Papier. »Der Vater — —« Und wortlos trollten sie sich durch die Martinsstraße nach dem Wunderbau mittelalterlicher Gotik, einst »der Herren Tanzhaus«, dem Gürzenich.
Eine Horde Gaffer drängte sich an der Eingangstür: Frauen in Umschlagtüchern, Kinder auf dem Arm; Kleinbürger, die zum Abendschoppen strebten; Eckensteher in Schiffermütze und buntgestickten Plüschpantoffeln. Der Joseph Otten sang! Auf den Jupp waren sie stolz. Es war »ene Köllsche Jung«!
Die Kinder hatten sich in die vordere Reihe gedrängt. Die kleine, schlanke Carmen hielt sich fest an Moritz Lachners Hand. Wagen auf Wagen fuhr vor. Herren in vornehmer Haltung, Damen in großer Konzerttoilette entstiegen ihnen und eilten, durchs Portal zu kommen. Denn die Zaungäste kritisierten scharf und laut. »Jessesmarijusepp, die hätt’ sich äwer fies fein angedonn.« »Süch ens, die meint, sie wär’ em Huchsommer. Madam, Sie werde sich verkühle!« »Achtung, Här, der Kopp oder der Zylinder!«
»Das war mein Vater,« sagte Laurenz Terbroich, als der geradgereckte Herr, dem der Zuruf gegolten hatte, im Portal verschwunden war.
Es schlug halb acht. In raschem Trab kam ein Wagen heran und hielt. Ein hochgewachsener, früher Vierziger sprang elastisch heraus, gab dem Kutscher Weisung und wandte sich dem Eingang zu. »Guten Abend, Herr Doktor Otten,« scholl es hinter ihm her. Da wandte er sich lachend um, grüßte mit dem Schlapphut und winkte mit der Hand. Im Begriff, ins Portal zu treten, blickte er noch einmal über die Schulter, als sei ihm vorhin irgend etwas aufgefallen. Sein stahlblaues Auge traf die Kinder, suchte die erglühende Carmen heraus. Eine Erinnerung ging durch seinen Blick, ein Erkennen. Ein Aufstrahlen, und ein Nicken hüben und drüben. Dann war er im Gürzenich verschwunden. — —
»Das war mein Vater,« sagte die Kleine triumphierend zu Laurenz Terbroich. Und die beiden liefen hinter dem Volk her, um zu hören, was gesprochen würde.
Moritz Lachner blieb allein vor dem Gürzenich zurück. Seine Seele war mit dem bewunderten Manne hineingegangen, und er wartete, daß er sie ihm wieder herausbrächte. — —
II
Im ersten Stockwerk des Ottenschen Hauses waren seit Beginn der Dämmerung die Rouleaus herabgelassen. Die rotbeschienenen Säume verrieten, daß in der Wohnung frühzeitig die Lichter angezündet worden waren. Hin und wieder zeichnete sich hinter den Vorhängen der Schattenriß einer Frau, der erst kürzer, dann länger verweilte und sich wieder verlor ...
Der alte Klaus hatte in der Haustür seine Pfeife ausgeraucht. Während er von dem langen, dünnen Tonstiel ein Stück abbrach, um ein frisches Mundstück zu bekommen, trat er auf die Gasse und blinzelte zu den Fenstern des Stockwerks hinauf. Kopfschüttelnd stopfte er mit dem Daumen den Pfeifenkopf, brachte den überflüssigen Tabak sorgsam wieder in der Hosentasche unter, knickte ein Bein, um an dem gespannten Schenkel ein Schwefelholz in Brand zu setzen, schmatzte den ersten Rauch aus dem Rohr, spuckte und ging kopfschüttelnd ins Haus hinein. Als sich die Haustür schloß, erschien hinter dem beleuchteten Vorhang hastig der Frauenschatten, verharrte einen Augenblick reglos und schwand.
Von den Türmen der Stadt schlug es halb acht Uhr. Die hohe Kastenuhr im Eßzimmer der Wohnung tat gleichzeitig einen dumpfen Schlag. Die Frau, die an der geschweiften Säule des breiten, flämischen Büffetts lehnte, hob einen Moment den Kopf, als ob noch etwas folgen müsse. Und schon pinkte hell aus dem Nebenzimmer eine Rokokouhr.
»Alles geht seinen geregelten Gang,« dachte sie und legte die Hände wie einen Reif um die Stirn, als sollten widerspenstige Gedanken zur Ruhe gebracht werden. Dann ließ sie müde die Arme sinken.
»Er kommt nicht,« sagte sie laut. »Nun könnte ich eigentlich die Lampen löschen.«
Ihr Kleid raschelte, als sie ein paar Schritte tat. Sie sah an ihm hinab. Es war ein weißer Brokat, der die kräftige Gestalt fest umschloß. Ohne einen Ausschnitt zu zeigen, ließ er den Hals frei. Eine Kette großer, blaßroter Korallen hing über der Brust. Nur dieser eine, erlesene Schmuck.
Sie strich mit der Hand über den Stoff.
»Wie lang’ ist das her,« kam ihr in den Sinn, »daß ich dies Kleid zum erstenmal trug. Er wollte mich in keinem anderen sehen. Jedesmal sollte ich es tragen, wenn er heimkehrte, jedesmal wie eine Braut ... Das Kleid ist wie neu geblieben. Ich hab’ es also nicht oft zu tragen gehabt.« —
»Ach, nicht so!« wies sie sich selbst zurecht. »Ich hab’s gewußt. Und ich freu’ mich doch, daß es so ist, wie’s auch ist.«
Sie ging in ruhigen, gleichmäßigen Bewegungen durch das Zimmer. Ihre Augen hatten den Hausfrauenblick zurückgewonnen, und ihre Hände suchten Beschäftigung, rückten an den blumengefüllten Kristallvasen, dem schönen Tafelporzellan, und ruhten nicht, bis eine neue Harmonie die festliche Anordnung schmückte. Von der Balkendecke herab streckte der massive Leuchter sechs lampenbewehrte Arme ins Zimmer. Alle Lichter brannten. Der ganze Raum war voll Erwartung.
Als die Frau den Blick hob, ging ein Lächeln über ihr Gesicht. An der Wand hing ein Bild, das Bild eines Mannes in Havelock und Schlapphut. Aus lachenden Augen schaute er in die Welt.
Sie trat näher heran. Sie betrachtete es, als wäre es ihr ein Neues.
»Man kann das Bild nicht ansehen, ohne froh zu werden ...«
»Liebster — —«
Dann wandte sie sich zum Tisch zurück, hob die Arme und drehte die Gashähnchen der Lampen ab. Bei der letzten zögerte sie, und der Arm blieb gereckt. Leise knisterte an ihrem Leib die Seide.
»Vielleicht kommt er doch noch. Dann soll es wenigstens nicht ganz dunkel sein in seinem Haus.«
Und noch einen Blick über die Tafel werfend, ging sie mit ihrem ruhigen Schritt ins Nebenzimmer, setzte sich an ihr Arbeitstischchen und nahm ein Kinderkleidchen in den Schoß, das der Ausbesserung bedurfte.
Acht schlug es von den Türmen, und dumpf und hell befleißigten sich die Uhren in der Wohnung, nicht hinter den beamteten Kameraden zurückzubleiben.
»Jetzt hat er die ersten Lieder gesungen,« sagte die Frau und ließ die Arbeit sinken. »Nun wird er gefeiert ...« — »Gott im Himmel,« unterbrach sie sich, »acht Uhr! Und Carmen ist noch nicht im Hause. Wie konnt’ ich nur über den Vater das Kind vergessen.«
Sie öffnete das Fenster und lehnte sich hinaus. Die Rheingasse lag still. Sie horchte angestrengt in das Dunkel, aber nur das Rauschen des Rheinwassers, das gegen das Bollwerk schwankte, fing sie auf.
»So lang’ ist sie doch noch nie ausgeblieben,« murmelte sie. »Und gerade heute ... Wär’ doch das Kind hier.«
Noch ein paar Minuten blieb sie. Dann schloß sie das Fenster. Sie schauerte in den Schultern und wußte nicht, ob es von der Winterluft oder einem Angstgefühl kam. »Gerade heute ... Ich hätte es daheim halten sollen. Wenn er nun gekommen wär’.« Dabei fiel ihr der alte Klaus ein, und sie atmete erleichtert. »Er wird das Kind bei sich haben. Nun wird’s aber Zeit, daß ich es hol’ — —«
Der alte Klaus Gülich saß in seinem Stübchen zu ebener Erde, das ihm als Hausmannswohnung angewiesen war, spießte mit dem Taschenmesser das letzte Stückchen eines Käses auf und schaute dabei verlorenen Blickes in sein Schoppenglas Wein. Irgend etwas suchte er in seinen Erinnerungen, und das forderte Zeit, denn er hatte auf ein langes Leben zurückzuschauen und war ein gutgerechneter Siebziger.
»I ja,« nickte er vor sich hin, »die hätt’ ming Frau werde müsse, dat wor ene leckere Puht. On lew hät die mich gehatt, esu lew wie keen Minsch op der Welt. Wenn ich mich doch, Düwel noch ens, op ehre Name besinne künnt’!«
Es klopfte. Und gleich ein zweites Mal.
»Angtreh!« rief er ärgerlich und streckte das Kinn vor.
»Guten Abend, Klaus. Ist das Kind bei Ihnen?«
»Uns’ Carmche?«
»Also auch hier nicht. Und es ist acht Uhr vorbei. Es wird ihm doch nichts zugestoßen sein? Klaus, was meinen Sie?«
»Ich meine, et Carmche is augenblicks lebendiger als sing Mutter.«
»Wissen Sie das bestimmt?« Sie legte dem Alten die Hand auf die Schulter, und der Alte spürte durch das gestrickte Kamisol, wie diese lange, schlanke Frauenhand zitterte.
»No, no, no,« beschwichtigte er und erhob sich so schnell, wie es ihm die müden Füße erlaubten. »Wat sinn denn dat för Sache? Jung’ Frau, jung’ Frau! Dat wor doch früher uns’ Art nit? Nerve! Setzen Se sich ens en der Sessel. Su, ganz gemötlich — —«
Sie ließ es sich gefallen, daß er sie in den Sessel drückte. In ihrem weißen Kleide saß sie und bot ein seltsames Bild zu der schlichten Umgebung.
»Nun sagen Sie, wo Sie Carmen gesehen haben.«
»Se is mit Terbroichs Laurenz op der Heumarkt gelaufe. Auch möglich, zum Gürzenich. Un weil ich den vörwetzige Rotzjung, den Terbroichs Laurenz, nit leide mag, hann ich den Lachners Moritz hingerhärgeschickt. Dä paßt op.« Und mit väterlicher Fürsorge fuhr er fort: »Sie dürfe sich beruhige, Frau Otten. Et passiert nix.«
»Ich schäm’ mich,« sagte sie plötzlich. »Ich darf doch nicht die Ruhe verlieren.«
Der Alte sah sie respektvoll an.
»Un do meint manch eine, dat wör alle Dag Zuckerlecke, Danze un Kirmeß.«
»Es ist viel mehr, Klaus.«
»Sie hann ooch nix öwermäßig zo lache.«
»O doch, das wißt ihr andern nur nicht.«
»Jung’ Frau,« meinte der Alte ruhig, »wenn ich dodrop et heilige Sakrament nehme künnt’, säßen Sie jetz nit beim ahle Klaus em Stübche.«
Einen Augenblick blieb es still zwischen ihnen. Dann sagte die Frau mit dem Versuch eines scherzenden Lächelns: »Sie haben mich vorhin wohl belauscht? Klaus, das war die Vorfreude.«
»Der Herr Joseph is äwwer nit gekumme,« beharrte der Alte.
»Er hat nicht gekonnt, Klaus. Gestern hat er in Frankfurt gesungen und bis vor wenigen Tagen in München. Ich hab’ doch einen Brief bekommen, in dem er mir alles schrieb.«
»Der Herr Doktor is zwei Johr von Kölle fort gewese. Da is et mit enem Breef nit gedonn.«
»Ach, Klaus, er wollte ja auch vor dem Konzert noch herkommen, wenn er den richtigen Zug bekäm’. Aber die Menschen hängen sich ja alle so an ihn und wollen ihn feiern. Das seh’ ich ein.«
»Ich nit, ich weiß Gott nit. Een Stündche hätt’ hä sich schon abspleiße könne.«
»Für so kurze Zeit will er den Haushalt nicht beunruhigen.«
»Un die Hausfrau? Die duht er auf die Weis’ weniger beunruhige.«
»Ach, Klaus, die Hausfrau — —«
Der Alte stutzte. Er blinzelte ein paarmal mit den Augen und blickte in die Stubenecke.
»Ich bin seine Cousine. Daß ich ebenfalls Otten heiße, macht die Sache nicht anders.«
»Ihr seid sing Frau. Cousine kennt der Joseph Otten nit.«
»Nein,« sagte sie, und es flog ein Schimmer über ihre Augen, »die kennt er nicht.«
Der Alte sah verblüfft auf. Dann kratzte er sich hinter den Ohren. »Ich hann woll jet Dommes gesagt?«
»Nein, nein. Es war schon recht so. Seine Frau bin ich, und ich hab’ ihn und die Carmen. Das ist ein glückliches Gefühl, Klaus, und ich hab’s immer und immer, auch wenn er jahrelang fort ist. Gerade deshalb. Da hab’ ich für ihn mitzusorgen, denn ohne Sorge kann ich doch nicht sein. Er ist ein Wandervogel, Klaus, er muß in alle Welt schweifen und singen, singen und weiter schweifen, aber wenn er heimkommt, bringt er auch das Glück der ganzen Welt ins Haus. Welche Frau kann das sagen ...?«
»Sie haben ihn arg lieb, den Jupp,« sagte der alte Klaus. Er hatte hochdeutsch sprechen müssen.
Sie lehnte sich zurück, damit er ihr Gesicht nicht sähe. Die Seide spannte sich. Es war Kraft in dem Frauenkörper.
»Und Sie — Klaus?«
»Ich hann ihn doch schon zu de Nönncher gedrage, als hä noch en Dotz wor un et Stillsitze lerne sollt.«
»Er hat es nicht gelernt, Klaus.«
»Enä. Un öwer et Paternosterbete is hä auch nit herausgekomme.«
»Manchen schadet das nicht, Klaus. Es gibt Menschen, die können tun, was sie wollen, und es ist, als trügen sie ein heimlich Gebet in sich. Da wird schön, was bei anderen häßlich wäre.«
»Mr nennt dat: eine Schutzengel. Äwwer de Schutzengel sinn Sie.«
Sie schüttelte nur den Kopf.
»Das steckt im Menschen selbst drin. Das ist das Geheimnis unseres Herrgotts, weshalb. Wir sollen nicht fragen und doch glauben. Glaube macht selig. Ich bin’s.«
»Nä, nä,« sagte der Alte zweifelnd, »ich würd’ doch lewer ens beim Jupp op der Busch kloppe. Hä wor fröher schon ene Dorchgänger.«
»Und doch haben Sie ihn gern gehabt.«
»No ja, hä wor ooch keene gewöhnliche Dorchgänger, hä wor su ene staatse Dorchgänger. Ohne Fisimatente. Hä däht niemals die Unwohrheit sage, ooch als Jung nit. Wenn se ihn attrapierte, sagt hä geradheraus: Geweß, so is dat gewese. Un dann lachten hä, und et blew nix anders öwrig, mer moßt mitlache.«
Die Frau im Sessel hatte seltsam strahlende Augen bekommen. Sie sah einen wilden Jungen vor sich.
»Als er zu uns nach Koblenz kam, Klaus, war er schon der berühmte Doktor Otten, von dem alle Zeitungen schrieben. Nicht immer gutes. Aber daraus machte er sich nichts. Dickköpfen muß man eine Sache hundertmal sagen, bevor sie dahinterkommen, meinte er, wenn es Angriffe regnete. Man muß die Menschen zu ihrem Glück zwingen. — Mich hat er nicht zu zwingen brauchen. Als er es einmal sagte, glaubte ich es.«
»Su ne Hanak!« lobte der Alte den jungen Freund. »Mr konnt ihm nix affschlage.«
»Sie haben die ganze Jugend mit ihm verlebt, Klaus.«
»Ich wor zuerst beim ahle Otten Knecht op enem Kohlenschiff. Später word ich von der Firma als Schiffer angestellt. Och, jung’ Frau, un wenn ich dann mit mingem Schiff im Hafen lag, am Bayeturm, dat wor en Gedöhns. Dann kamen der Jupp mit singer Freundschaft, un ich moßt Harmonika spille un ihne Schabau zu drinke gewe un allerhand Stückelcher un lustige Krätzcher verzälle, un zum Schluß dähte se et ganze Schiff op der Kopp stellen. Wenn ich se denn flöck beim Schlafittche nehme wollt, sprung der Jupp — ich kreeg als immer ene Schlaganfall — in Hos und Kamisol pardautz in et Wasser, un singe beste Kamerad, der Drickes, der Kochs Heinrich, der heut geistlicher Här un Professor is, pardautz hinger ihm drein, im Lewen un im Sterwen, un wuppdich krabbelten se in der Nache, dä am Schiff hing, sägten mit ihre Taschenmetz dat Tau dörch, packten de Ruderstang un gingen heidi. Dazu dähten sie dat Räuwerlied singe: ›Ein freies Leben führen wir!‹ Nor der Dritte von dem Kleeblatt, der Medardus Terbroich, der feinen Här von der Ringstraß, dä esu fromm is un su ville Milliöncher us singe Arbeiter rusquetscht, dat wor als früher ene heimtückische Grielächer. Meist wor er der Anführer, wenn et galt, mr ene Schabernack zu spille, un wenn hä dat Kreppchen glücklich eingerührt hatt’ und der Jupp un der Drickes woren als im Wasser, wofor die Bangbüx en Scheu hatt’, un ich kamen herangelaufen, ihn zu versolle, maacht der Medardus esu e spitz Gesicht und unschullige Äugelcher und säht seelenruhig: ›Sieh, Klaus, dort flüchtet das böse Gewissen. Ich hann et nit gedonn. Ich gonn fott.‹ Wupp, wor he weg.«
Die Frau im Sessel lächelte. Sie hatte nur die Hälfte von der Erzählung gehört. Sie sah den wilden Jungen vor sich und horchte auf seine Stimme.
»Haben Sie ihn denn nie verprügelt, den Joseph?«
Der Alte lachte in sich hinein. »Ach Frau, de Jupp kannt’ ming schwache Seit’. Ich heißen doch Klaus Gülich. Un de Gülichs waren als kleine Leut’ bereits vor ville hundert Johr in Kölle. Un et is als arg lang her, do hät ein Nikolaus Gülich, ein Manufakturwarenhändler, Rebelljon in Kölle gemach’ un die vornehme Häuser plündere un Ratsherre verhafte und köppe lassen. Bis et Blättche sich gewandt hat un der Nikolaus Gülich sich attrapiere ließ. Op enem freie Platz, der danach der Gülichsplatz genannt worde is, is dann der große Verbrecher sälwer geköppt worde. Äwwer weil hä esu ’ne Berühmtheit gewesen is, hann die Kölner ihm en Säul’ op der Gülichsplatz gesetzt, obe dropp der affgeschlagene Kopp in Bronce. Un ich hann als noch en ahl Buch, dat is mr heilig wie die Bibel, denn dadrin steht et zu lesen: ›eine Säule zu des Ächters ewiger Schande mit einer Aufzählung der Untaten und Verbrechen desselben allda errichtet.‹ Dat Buch hann ich geerwt, un dat is e Glöck, denn als die Franzose nach Kölle kumme sin, die gerad ihre König geköppt hatte, wollten sie dat mit de Säul’ nit un hann se ömgestürzt, un de schöne Broncekopp, dä doch von rechtswege in der Familig hätt’ bleiwe müsse, is nach Paris gekumme. Un op den ahl Nikolaus Gülich bin ich ärg stolz gewesen, un der Jupp hät dat gewoß’, un nach jedem schläächte Uz is der Jupp gekumme und hät mich beim Händche genomme un gesagt: ›Flöck, Klaus, jetzt gonn mr op der Gülichsplatz. Da mußte mr von dingem Ahnherr verzälle. Ich kann et als garnich erwarte.‹Dä Nixnotz!« —
»Und dann hat er in Bonn und Leipzig studiert,« nahm die Frau nach einer Weile das Gespräch auf, »Geschichte und deutsche Literatur, und ist der Doktor Joseph Otten geworden.«
»Ja, ja ... Phantasie hät hä gehatt.«
»Und überall in Deutschland hat er Vorträge gehalten, und überall war ein Aufsehen, weil er die Seele der Gedichte lebendig machen wollte über die Form.«
»Dat verstonn ich nit.«
»Vom Gedichte-Rezitieren kam er zum Lieder-Gesang. Den alten Singsang reformieren wollte er, die Töne wieder mit Gedanken füllen. Da hat er aufs neue studiert und studiert, bei den großen Meistern in Frankfurt und in Mailand, denn er mußte alles kennen lernen und ließ nicht ab, bis er alles kannte. Zehnmal soviel hat er gearbeitet als die anderen, und als es ihm gelungen war, nannten es die Trägen und die Gedankenlosen — Glück!«
»Un wenn et so wör! Stolz is hä nit geworde, de Jupp, ene echte Köllsche Jung mit dem Härz op dem rechte Fleck is hä gebliwwe. Wie der ahl Otten gestorwe is un die Firma is opgelöst worde, da hät hä zuerst an mich gedacht. ›So, Klaus,‹ säht der Herr Doktor, ›jetz bis du minge Hausverwalter. Un wenn du nix zu donn häs, kannste de Fremden op dem Rhein erömgondeln. Den Nachen kannste behalten.‹ Nee, nee, nix op minge Jupp Otten.«
Die Frau im Sessel beugte sich vor. Sie zählte die Glockenschläge. »Neun Uhr, Klaus. Jetzt halt’ ich’s nicht mehr aus.«
Der Alte nahm seine Schiffermütze vom Riegel. »Bong. Ich gonn ens zum Lachner in de Obenmarspforten, nachkucke.«
Da wurde heftig an der Hausschelle gezogen. Der alte Klaus hängte seine Mütze wieder an den Riegel. Die Frau war schon auf dem Hausflur.
»Kind — — Kind — —,« brachte sie nur hervor, nahm das Mädchen bei der Hand und lief mit ihm die Treppe hinauf.
»Mutter! Hör doch! Ich hab’ den Vater gesehen!«
»Komm, komm — —!«
Oben in ihrem Zimmer kniete sie vor der Kleinen nieder und nestelte ihr das Mäntelchen aus. »Mir solch eine Angst zu machen. Wegzubleiben. Ohne Erlaubnis ...«
»Aber ich hab’ doch den Vater gesehen!«
»Das konntest du doch gar nicht wissen, als du fortliefst. Ich hab’ dir doch nichts gesagt.«
»Ja, weshalb hast du mir denn nichts gesagt?«
»Weil der Vater dich überraschen wollte. Weil er sehen wollte, wie artig du seist. Ganz erfrorene Hände hast du und dazu die heißen Backen. Wo bist du denn nur gewesen?«
»Am Gürzenich, den Vater sehen,« beharrte sie.
»Aber doch nicht bis jetzt, Kind. Das ist doch schon so lange her.«
»Dann sind der Laurenz Terbroich und ich auf der Hohestraße gewesen. Der Laurenz wollt’ mir die schönen Läden zeigen mit den Weihnachtsausstellungen.«
»Herrgott, in dem Gewühl!« Und plötzlich schlang die Frau die Arme um die feingliedrige Kindergestalt.
»Hast du denn gar nicht an deine Mutter gedacht, Carmen; gar nicht an deine Mutter?«
»Du hatt’st ja den ganzen Tag keine Zeit für mich gehabt.«
»Das ist meine Strafe,« murmelte die Frau, strich sich mit der Hand über die Augen und erhob sich.
»Carmen,« sagte sie ruhig, »du wirst das nie wieder tun. Nie mir wieder Sorgen machen. Du bist doch mein großes, vernünftiges Mädchen und weißt, daß die Mutter dann allein ist. Ich will dir heute die Strafe erlassen. Aber nie wieder etwas tun, ohne daß die Mutter davon weiß. Ich hätte doppelt darunter zu leiden. Und nun schnell deinen Kakao. Und dann ins Bett.«
Als die Mutter nach einer Weile mit der dampfenden Tasse aus der Küche hereinkam, saß die Kleine, die Arme aufgestemmt, am Tisch und baumelte mit den Beinen.
»Du, Mutter, ich stand ganz vorn, als der Vater am Gürzenich vorfuhr. Er hat mich erkannt.«
Die Tasse zitterte und klirrte ein wenig, als sie hingesetzt wurde. »Woher willst du das wissen ...?«
»Er hat mir zugenickt und gelacht.«
»Und — gelacht — —?«
»Weil er sich so gefreut hat, mich zu sehen.«
»Und — und gesprochen hat er nicht mit dir?«
»Du, Mutter, er kam ja schon zu spät. Alle Leute waren schon drin im Saal. Hundert Wagen sind vorgefahren. Und die Leute waren so fein wie bei ’ner Hochzeit.«
»Er kam zu spät,« wiederholte die Frau und atmete tief. »Ich wußte ja, daß er keine Zeit mehr gehabt hatte.«
»Und so viele Leute standen vor dem Gürzenich, Mutter. Nur um den Vater zu sehen. Und als er hineinging, riefen sie alle: ›Guten Abend, Herr Doktor Otten!‹ Und da hat er wieder gelacht.«
»Hat er wieder gelacht? So fröhlich war der Vater?«
»›Guten Abend, Herr Doktor Otten,‹ riefen sie alle.«
»Da warst du wohl stolz — —?«
»Er war aber auch der schönste,« und sie aß das letzte Stück Zwieback.
»Du eitler Narr,« sagte die Frau und fuhr dem Kind durch die schwarze Lockenfülle. Ihre Augen sahen in die Weite und trugen wieder den seltsamen Schimmer. — —
»Mutter,« begann die Kleine aufs neue, »das ist aber doch nicht wahr?«
»Was soll nicht wahr sein, Kind ...?«
»Was der Laurenz gesagt hat.«
»Und was hat der Laurenz gesagt?«
»Er hat gefragt, und der Moritz war dabei: ›Ist denn der Herr Doktor Otten überhaupt dein Vater?‹«
Die Frau fuhr zusammen. Ihre Gesichtszüge strafften sich. Sie tat sich Gewalt an, den furchtbaren Schrecken zu bemeistern. »Was — ist das? — Was führt ihr — für Gespräche?«
»Der Laurenz hat gesagt: Künstler hätten nie richtige Frauen und daher auch keine richtigen Kinder.«
»Und da — hast du mit dem ungezogenen Jungen noch gespielt — und bist mit ihm auf die Hohestraße gelaufen?«
»Das war doch nachher. Vorher hab’ ich ihn gekratzt und ihn in die Haare gerissen.«
»Und der Moritz —?«
»Der hat mir geholfen.«
»Da siehst du es,« sagte die Frau und zwang den erregten Atem. »Da siehst du es. Der Moritz ist älter und vernünftiger. Der hat seinen Vater lieb. Und wer seinen Vater lieb hat, der weiß überhaupt gar nichts anderes. Der würde sich schämen, auch nur im Scherz über seinen Vater zu sprechen. Und gar über deinen Vater ...«
»Mutter,« rief die Kleine erschrocken, »ich hab’s ja auch gar nicht getan! Und der Laurenz hat sich nur geärgert, weil ich gesagt hab’, mein Vater wär’ mehr als der seine. Gelt, Mutter, das ist er auch?«
»Ach, du!« stieß die Frau hervor, griff mit beiden Händen den Kopf des Kindes und preßte ihn gegen ihre Brust.
Die Kleine lag ganz ruhig. Sie fühlte sich wohl an der weichen, schwellenden Mutterbrust, in der es so geheimnisvoll klopfte und pochte. Und der kühle Seidenstoff schmeichelte ihrer Wange.
»Wie schön bist du, Mutter. Weshalb hast du dich so schön gemacht?«
»Weil der Vater kommt.«
»Dann mußt du mich aber auch schön machen.«
»O, du liebe Eitelkeit, ich bring’ dich jetzt ins Bett.«
»Wird der Vater denn an mein Bett kommen?«
»Gewiß, gewiß, er wird an dein Bett kommen.«
»Dann mußt du mir aber ein frisches Nachtkleid anziehen. Und die rote Schleife ins Haar!«
»Willst du dann aber auch einschlafen?«
»Wenn ich kann — —.«
»Ich hol’ es dir herunter. Lauf in die Küche und zieh dich aus. Dort ist es wärmer. Ich werde dich schnell noch waschen. Aber ganz schnell, damit der Vater uns nicht überrascht.«
»Ich muß ihr heute den Willen tun,« beruhigte sie sich, als sie in der Giebelstube das neue Nachtkleidchen hervorholte, und eine feine Röte kam und ging auf ihrem Gesicht. »Ich mach’ es ja selbst nicht besser ...«
Carmen stand bereits ausgezogen vor einer kleinen Blechwanne, die sie voll Wasser gefüllt hatte. Die Tropfen spritzten um ihre schlanken, gelenkigen Glieder. »Du brauchst mir nicht zu helfen, Mutter, ich bin schon fertig.«
»Ich reib’ dich ab. Du bist ein Leichtsinn.«
Sie hüllte den schauernden Kinderkörper in ein Badetuch, hob ihr Kleid, als sie auf einem Vorlegeteppich niederkniete, und rieb die Kleine trocken. Durch das Tuch spürte sie bald die Wärme der Glieder. Da warf sie das Tuch beiseite, zog mit einer heftigen Bewegung das zappelnde Kind an sich und bedeckte es mit Küssen.
»Was ist das nur,« schoß es ihr durch den Sinn, »daß man sein Kind so lieb hat? Ist es das Kind selbst? Oder ist es der Vater —?«
»Abmarschiert,« sagte sie und schloß den Knopf des Nachtkleidchens.
»Noch die rote Schleife, Mutter.«
»Schön, auch noch die Schleife.«
»Der Klaus soll mich herauftragen.«
»Kind, jetzt gibst du Ruhe. Du mußt den Abend nicht so ausnutzen.«
»Aber wenn der Klaus mich heraufträgt, schlaf’ ich auch schneller ein.«
»Versprichst du mir das?«
»Ja — — er soll mir nur noch eine Geschichte erzählen.«
Sie ging zur Tür. »Nur damit der Joseph alles in Ordnung findet,« gestand sie sich. Und sie rief in den Hausflur hinab: »Klaus — Klaus, sind Sie noch auf?«
»Wat sall et sinn, jung’ Frau?« scholl es herauf.
»Klaus, die Carmen will sich nur von Ihnen ins Bett bringen lassen.«
»Op der Stell’ kommen ich.«
Der Alte kam steifbeinig die Treppe herauf: »Wo is dat Mamsellchen?«
»Hier!« rief die Kleine und stellte sich in Positur.
»Donnerlütsch,« wunderte sich der Alte und schlug die Hände zusammen, »dat is doch nit uns’ Carmche, dat is doch e Engelche!«
»Gelt, Klaus? Schön?«
»Es ist ein unartiges Engelchen, Klaus, und quält seine Mutter. Bringen Sie sie schnell fort.«
»Na denn allong.«
»Huckepack!« befahl die Kleine, und der Alte bog schmunzelnd den steifen Nacken und ließ sie aufsitzen. Doch plötzlich warf sich das Mädchen so jäh herum, daß der Alte nur mit Mühe die Beine erwischen und an sich drücken konnte.
»Mutter! Gute Nacht, Mutter!« Sie umschlang sie und küßte sie stürmisch. Auf die Augen, auf den Mund, auf die Seide, die sich über ihrer Brust spannte. »Du! Liebe, Liebe, Liebe!« Und aufjauchzend ließ sie sich die Treppe hinauftragen.
»Erzählen!« befahl sie und streckte sich in ihrem Bettchen.
Und der alte Klaus setzte sich geduldig auf den Bettrand und begann: »Es waren einmal ein klein, nackig Engelchen —«
»Das ist doch eine Kleinkindergeschichte. Schäm dich doch, Klaus.«
»— und das klein, nackig Engelchen sagten zu einem alten Mann: Hä sall sich jet schamen. Als das aber der liebe Gott hörten, da sagten der liebe Gott: Pfui Deuwel!«
»Das ist nicht wahr. Der liebe Gott nimmt den Namen des Teufels nicht in den Mund.«
»För gewöhnlich maag dat sing Richtigkeit hann. Äwwer wenn der leewe Gott ens in Wut kütt wegen Ongezogenheiten von singe Menschekinder, dann säht hä dat Schläächteste, wat hä kennt, un dann säht hä: Pfui Deuwel!«
Die Kleine hatte sich den Schluß des pädagogischen Vortrags geschenkt. Sie war eingeschlafen.
Und unten in ihrem Zimmer stand die Hausfrau, erregt noch immer von den ungestümen Liebkosungen des Mädchens, erregter noch von dem, was es gesagt hatte.
»Sie wird es morgen vergessen haben,« murmelte sie. »In ihrem Alter verwischen sich Eindrücke schnell. Aber sie wächst heran — —«
Durch die geöffnete Tür sah sie in das geschmückte Speisezimmer, auf das unbekümmerte Männerbildnis.
Die brautweiße Seide an ihrem Körper knisterte, als sie den Kopf hob.
»Komm bald, Joseph — —« — —
III
Es klingelte leise. Kaum, daß die Glocke anschlug. Der Ton konnte nicht bis zum alten Klaus in die Giebelstube gedrungen sein, und um das Kind durch Abrufung des Alten nicht zu ermuntern, ging Frau Maria Otten selbst, die Türe zu öffnen. Mit abgezogenem Hütchen wartete Moritz Lachner draußen.
»Nun, Moritz — so spät noch?«
»Der Herr Doktor schickt mich —«
»Wir wollen nach oben gehen,« sagte sie. »Es ist kalt an der Haustüre.« Und sie ging voran. Eine Botschaft Josephs mochte sie nicht zwischen Tür und Angel verhandeln.
Moritz Lachner folgte ihr respektvoll. Der Mutter Carmens brachte er heiße Bewunderung entgegen. Und diese Bewunderung war wie eine heilige Verehrung, als er hinter der großen Frauengestalt herschritt, der der weiße Brokatstoff ein so feierliches Ansehen schuf. Nur seine Mutter hatte er so verehrt, die, als sie noch lebte, tagaus, tagein in dem einzigen hellen Zimmer gesessen hatte, das die Trödel- und Maskengarderobelager des väterlichen Geschäftes übrig gelassen hatten, den Blick auf eine Stickerei gerichtet und nur schnell und freudig aufschauend, wenn der Sohn ins Zimmer trat. Seit sie gestorben war, wie eine arme zitternde Zimmerpalme, gehörte seine leidenschaftliche Frauenverehrung der ruhigen, selbstsicheren Frau in Joseph Ottens Haus. Nicht zuletzt, weil es Joseph Ottens Haus war. Alles Eigene, Freie und Kühne lockte seine scheue Seele.
»Der Herr Doktor hat dir einen Auftrag gegeben?« sagte Frau Maria und setzte sich in ihren Arbeitssessel. »Warst du denn im Konzert, Moritz?«
»Ich habe draußen gewartet, bis es aus war.«
»Zwei Stunden in der Kälte? Du bist ein Schwärmer, Moritz.«
Der Knabe freute sich des freundlichen Tons. Er errötete und drehte sein Hütchen.
»Nun?«
»Der Herr Doktor kam wenige Minuten nach den anderen. Der Herr Terbroich war bei ihm und der geistliche Herr, der Herr Professor Koch. Als er mich stehen sah, rief er mich heran. Er hat mich sofort erkannt,« fügte er stolz hinzu. »›Das ist doch des Lachners Moritz,‹ meinte der Herr Doktor, und ich könnte ihm wohl einen Gefallen tun und schnell hierherspringen und bestellen: Der Herr Doktor würde in einem Stündchen hier sein. Er müßte nur eben noch ins Domhotel. Und ich möchte ihm den Hausschlüssel hinbringen.«
Frau Maria hatte ruhig zugehört. Sie nahm den Schlüsselbund vom Tisch und nestelte den Schlüssel los.
»Es war nett von dir, Moritz, daß du dir die Mühe gemacht hast. Warte. Du bekommst ein Glas Portwein, das macht dich wieder warm.«
»Es war keine Mühe,« stotterte der Junge. »Wirklich nicht.«
Ihm wurde glühend heiß, als er den Wein trank. Aber daß es nicht vom Wein kam, das wußte er besser. Er machte eine Verbeugung, bedankte sich und ging mit dem Schlüssel zur Tür. Mit einem Gefühl, als wäre ihm der Schlüssel zum Herzen dieser Leute zum Geschenk gegeben worden.
Sie reichte ihm freundlich die Hand. »Grüß den Herrn Doktor schön.«
»So was!« sagte Frau Maria, als sie das Zuklappen der Haustür vernommen hatte. »Nun läßt er sich auch noch verführen. Ein Stündchen ... Und er hält Wort. Aber« — sie schüttelte den Kopf — »aber sie werden ihn mit einem Stündchen nicht loslassen, sie werden einfach mitkommen, ich weiß das ja von früher ...« Sie zog die Augenbrauen zusammen. Nur einen Augenblick lang, und sie schüttelte die kurze Verstimmung ab. »Es ist ja doch nur die Wiedersehensfreude. Die anderen wollen auch ihr Teil. Der Joseph gehört vielen.«
»Vielen — —?«
Nun lachte sie ganz leise in sich hinein.
»Sie sollen alle kommen.«
Die Hausfrau regte sich in ihr. Sie ging ins Speisezimmer und musterte den Tisch. Zwei Gedecke lagen aus. »Ich werde also verzichten und noch ein drittes Gedeck hinzufügen. Joseph — Terbroich — und Professor Koch.« Sie traf die Anordnungen und war befriedigt, daß die Delikatessen reichten. »Es sind verwöhnte Zungen, die Kölner.«
In der Küche stellte sie noch ein paar Flaschen kalt. Dann lauschte sie hinaus. Der alte Klaus kam von oben.
»Hat es so lange gedauert?« fragte sie mitleidig.
»Ratsch, war sie eingeschlafen,« berichtete der Alte und klappte sich mit dem Handrücken gegen den gähnenden Mund. »Aber et Schlafen sticht an. Ich hann gedrömelt.«
»Gehen Sie schnell zu Bett, Klaus. Der Herr hat sich den Hausschlüssel holen lassen.«
»Dat wor ene kloge Gedanke,« lobte der Alte mit dem Egoismus des Siebzigers. »Zwei Jahr — oder zwei Jahr un eine Dag — dat macht beim Wiedersehen nix aus. Schlaft wohl, Frau.« Und er stapfte zufrieden die Treppe hinunter und suchte sein Lager.
»Nun schläft alles,« dachte Frau Maria, als sie wieder vor ihrem Arbeitstischchen saß. »Nur ich wache im Hause. Und so wird er mich, als was er mich zurückließ, als Wächterin des Hauses, auch bei der Heimkehr wiederfinden.«
Einige Male klapperten noch Schritte Vorübereilender über die Rheingasse. Dann wurde es still. Aber die Frau am Arbeitstischchen ließ sich durch die Stille nicht zu Träumereien verlocken. Sie hatte das Schulkleid des Kindes über den Schoß gebreitet und nähte die zerzausten Schleifen fest.