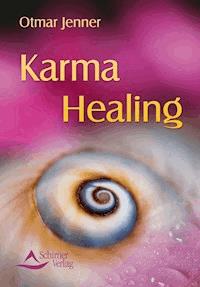Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Golkonda Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Eine einfache Zeitungsmeldung führt den Fotografen Ole Meerzen an die Grenze, nicht nur an seine eigene, sondern auch an die der menschlichen Existenz – und darüber hinaus: In Sevilla soll der älteste lebende Mensch entdeckt worden sein. Auf der Suche nach ihm verirrt sich Meerzen in einem bedrohlichen Labyrinth aus seltsamen Erscheinungen und Zweifeln an der Realität, bis er endlich den alterslos wirkenden Mann und seine ewig junggebliebene Tochter ausfindig machen kann … Ein Science Thriller über die Abgründe menschlicher Geschichte, die dunklen Seiten des Gedächtnisses und die Gefahren der menschlichen Optimierungen. Können wir eine Gesellschaft ohne Tod ertragen?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 830
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Originalausgabe
© 2018 Otmar Jenner
© 2018 dieser Ausgabe Golkonda Verlag GmbH, München ∙ Berlin
Das Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Sämtliche, auch auszugsweise Verwertungen bleiben vorbehalten.
Lektorat: Werner Bauer
Umschlaggestaltung: s.BENeš [www.benswerk.wordpress.com]
Umschlagmotiv: Otmar Jenner
E-Book-Erstellung: Hardy Kettlitz, Berlin
Alle Rechte vorbehalten.
www.golkonda-verlag.de
ISBN 978-3-946503-22-4 (Buch)
ISBN 978-3-946503-23-1 (E-Book)
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von §44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Ansprechpartner für ProduktsicherheitEuropa Verlage GmbHMonika RoleffJohannisplatz 1581667 Mü[email protected]+49 89 18 94 [email protected]
PROLOG
Sie empfinden Schmerz. Sie verfügen über ein Nervensystem und Rezeptoren. Zwar schützt ihr Panzer sie und gibt ihnen Stabilität, doch ist dieser Panzer nach wenigen Tagen ausgebildet und wächst nicht weiter, der Körper darin allerdings schon. Alljährlich wird es ihnen in ihren Panzern zu eng, was schmerzhaft ist. Schließlich so schmerzhaft, dass sie im Frühsommer ein Versteck aufsuchen, sich darin auf die Seite legen, zusammenkrümmen und im Zuge der Häutung ihre Panzer verlassen. Innerhalb weniger Stunden schwellen die gestauchten Körper auf eine neue Größe an und neue Panzer bilden sich, um dann wieder zu eng zu werden, was ihnen erneut Schmerzen bereitet, weshalb sie im folgenden Frühsommer ihr altes oder ein neues Versteck aufsuchen und sich auf die Seite legen für die nächste Häutung.
Bei jeder Häutung wachsen sie um zehn bis zwanzig Prozent, den Großteil davon direkt nach Verlassen des Panzers. Man kann sich also ausrechnen, wie eingezwängt ihr Körper im Panzer war, wie sehr er dadurch Schmerzen erlitten hat und in welchem Ausmaß der Schmerz zu ihrem Leben gehört. Jahr für Jahr. Von Häutung zu Häutung.
Ihr Leben. Es tut ihnen weh.
Ein Dasein als Hummer ist von Natur aus schmerzhaft.
Europäische können eineinhalb Meter lang werden, amerikanische knapp fünfzig Zentimeter länger. Doch Hummer werden nicht nur groß, sondern auch alt, durchschnittlich siebzig Jahre, also ein Menschenalter, nicht selten aber auch über hundert Jahre. Angeblich wurde irgendwann ein hundertvierzig Jahre alter Hummer gefunden, älter als jeder imGUINNESS WORLD RECORDS BUCHverzeichnete älteste Mensch. Dieses alte Tier hatte demnach hundertvierzig qualvolle Zeiten wachsender Stauchungen und nur temporär erlösender Häutungen hinter sich.
EINS
Vor den Pyrenäen rutschte ein Plastikbecher mit Tomatensaft in einer holprigen Linkskurve vom Klapptisch des Nachbarn und landete in dessen Schoß. Kurz darauf fiel ein Rollkoffer einige Reihen weiter vorn aus einem aufspringenden Gepäckfach, verfehlte knapp den Kopf der darunter sitzenden Frau, streifte aber deren Schulter und krachte mit einem Klirren wie von Glas auf den Gang.
»Diese Geschichte fängt ja gut an«, sagte ich leise – und für andere wahrscheinlich unhörbar – zu mir selbst.
War das der angekündigte Tod?
Die vom Koffer gestreifte Frau und einige Kinder noch weiter vorn begannen zu schreien. Mein Nachbar versuchte, den Tomatensaft auf der Hose mit einem Paisley-Schal zu entfernen, verteilte den Saft aber umso mehr und begann darüber fast hysterisch zu kichern. Dann knackten die Lautsprecher, der Copilot meldete, man habe den Kurs ändern müssen, um einer Wetterfront auszuweichen, kein Grund zur Sorge, es werde Turbulenzen geben, man möge daher umgehend die Gurte anlegen. Der Copilot sagte noch mehr, was aber unverständlich für mich war, weil die Lautstärke zu weit aufgedreht war und die Stimme dadurch verzerrt klang.
Meine Hände waren plötzlich feucht. Ein Blick aus den Fenstern auf der linken Flugzeugseite zeigte klaren Himmel, während rechts eine dunkle Wolkenwand zu sehen war. Wir schrammten, so sah es jedenfalls aus, daran entlang. Der Rand sah aus wie eine anthrazitfarbene Plüschdecke, die in unendlich kleine Falten gelegt war. Kurz riss etwas auf, und man konnte in einen Spalt hineinblicken, an dessen Ende für den Bruchteil einer Sekunde das Flackern der Sonne zu sehen war. Danach färbte sich die Wolkenwand blauschwarz. Für einen Moment erinnerte mich die Erscheinung an Obsidian. Einige Herzschläge lang faszinierte mich der Anblick, dann bemerkte ich, dass Schweiß von meinen Händen tropfte und meine Knie bereits vor Angst zitterten.
Warum hatte ich nicht schon vor dem Abflug erkannt, was für eine Unternehmung ich gerade startete?
Der Ausblick aus den Fenstern auf der rechten Flugzeugseite machte offenbar auch anderen Fluggästen Sorgen, denn ich hörte den orchestral anschwellenden Ausdruck von Panik in allen Stimmlagen, während das Flugzeug aus leichten in schwere Turbulenzen geriet, die Tragflächen zu zittern begannen, wobei die Nieten im Rumpf ächzten und ich die wechselvolle Stimmungslage zwischen den Wolken zum Anlass nahm, über die Endlichkeit meines Daseins nachzudenken.
Absurderweise hatte ich meine Kamera mit dem Gepäck aufgegeben, machte stattdessen aber Fotos mit dem iPhone. Man muss das erlebt haben, um zu wissen, wovon die Rede ist. Um mich herum wurde gewürgt und in Tüten erbrochen.
Ziemlich hübsch da vorn. Selbst unter diesen Umständen, dachte er. An der Stirnseite zum Cockpit hatte sich eine der Stewardessen über einen Beutel gebeugt. Wahrscheinlich noch nicht lange beim Kabinenpersonal. Bisher kaum huldigende Zuwendungen älterer Herren. Keine geschenkte Cartier-Uhr, kein Escort-Service an den Stätten der Zwischenstationen. Keine verlorene Seele der Lüfte.
Er wischte die Handflächen an den Hosenbeinen ab und überlegte, warum er sie attraktiv fand. Eine Seitenverkleidung am Fenster rechts vibrierte und klapperte. Warum mussten solche Schrottschwalben nicht am Boden bleiben? Klar wollten Fluggesellschaften sie in der Luft halten. Wirklich unverantwortlich. Er kannte die Anzeichen. Allmählich begann er sich aufzuregen. 337, 347, 367, 397, 457, 467, 487, die Reihe der letzten sieben Edlen bis fünfhundert, die auf Sieben enden. Zwischen 397 und 457 klaffte eine Lücke, die man auch als Loch bezeichnen konnte, als numerischen Orkus. Zu seiner Beruhigung sagte er nun die auf, die mit Eins endeten. Standen vergleichsweise noch verlorener da. Wirklich gutes Gesicht. Und wie sie die dunklen Haare mit der linken Hand von der Tüte fernhielt.
Seine Hände zitterten.
Meine Hände zitterten. Ich schob die rechte in die linke, verschränkte dann die Finger ineinander. Fünfhundert? Keine von den Edlen. Aber eine Zahl wie ein Attentat, ein Aufstand, eine Meuterei, ein undurchsichtiges Komplott. Unterwanderung des Natürlichen. Rebellion gegen die Biologie. Umstürzlerisch für das Verständnis vom Menschen und vom Menschsein. Subversiv und anarchistisch und gärend im Gemüt. 500!
»Geboren am 4. März 1517 in Cádiz, männlich, lebendig, ein medizinisches Wunder.«
Was für ein Blödsinn, hatte ich erst gedacht und mich wirklich geärgert. Das konnte nicht wahr sein. Unmöglich. Eine Falschmeldung – was sonst? Auf Nachrichten gab ich immer weniger, was ich manchmal selbst irritierend fand, doch so war es nun mal. Folge der vergangenen Jahre, inklusive des Abschieds von meinem früheren, geliebten Arbeitsfeld.
»DNA-Analysen lassen auf ein extrem hohes, geradezu biblisches Alter schließen«, las ich in der rechten Seitenspalte. »Falls kein Berechnungsfehler vorliegt, ist von einer bisherigen Lebensspanne von mindestens 490 Jahren auszugehen. Dies deckt sich mit den Darstellungen der betreffenden Person, die behauptet, vor wenigen Wochen 500 Jahre alt geworden zu sein.«
Darunter war ein Mann abgebildet, der nach meiner Wahrnehmung nicht deutlich älter als ich selbst aussah.
»Hmm«, hatte Hannelore von Noretzki gesagt, und ihr Atem war durchs Telefon gerauscht, als ich sie auf die Meldung ansprach. »Merkwürdige Sache, das.«
»Klingt erfunden«, erwiderte ich. Ich hörte ein schabendes Geräusch am anderen Ende der Leitung.
Ach Noretzki, dachte er. Immer noch die alte Geschichte. Wenn sie sich unwohl fühlte, warf sie ihre glatten und sehr dichten blonden, inzwischen entweder nachgetönten oder angegrauten Haare von der einen Seite ihres Kopfes auf die andere. Fast immer streiften ihre Haare dabei die Sprechmuschel. Zu Anfang hatte er sich regelmäßig über das Geräusch gewundert, denn es hatte viele Anlässe für gegenseitige Anrufe gegeben, nicht selten unter Stress. Schließlich verbrachte er aus irgendwelchen Gründen eine längere Zeit in ihrem Büro, während sie immer wieder eilige Telefonate annehmen musste. Und dann sah er es. Sah gewissermaßen das Geräusch, nämlich eine schnelle, hektische Kopfbewegung, die ihren gesamten, im Moment angestauten Unmut von einer Seite auf die andere beförderte und eine tiefere, im Büroalltag sonst kaum sichtbare Seite ihres Naturells erahnen ließ. Die fein auftretende und mit ihren ebenmäßigen Gesichtszügen elegant und auf eine Art sogar gesetzt wirkende Noretzki konnte unter bestimmten Bedingungen sehr ungemütlich werden; ihre kühle und dabei durchaus schöne hanseatische Fassade deutete jedoch zunächst nicht darauf hin. Nach dieser Erkenntnis beschloss er, dem Pfad der Werbung in ihrer Richtung nicht länger zu folgen.
»Die Agenturen haben es gebracht«, sagte sie und klang plötzlich müde dabei.
Also Andalusien, hatte er gedacht und aufgelegt. Und im Kopf diverse Varianten durchgespielt. Er, der auch Ich ist.
Ich beschloss daher, es uns leicht zu machen, und kaufte ihm ein Flugticket.
ZWEI
Ich hielt die Luft an, atmete anschließend durch meinen Schal, nachdem ich ihn mehrfach um Mund und Nase geschlungen hatte. Wurde langsam richtig unappetitlich hier. Saurer Gestank erfüllte die Kabine. Ich reckte den Kopf, um das Elend in vollem Ausmaß zu betrachten. Sogar die stoischen Minen der Flugbegleiter gerieten in Bewegung. Die Stewardess, ja, ein wirklich hübsches Mädchen mit asiatischen Augen und Grübchen über den Mundwinkeln, wie ich bereits beim Boarding bemerkt hatte, sackte bleich in ihrem rotbraunen Iberia-Kostüm an die Schulter des männlichen Flugbegleiters in den gleichen Farben auf dem Nachbarsitz und bohrte die rosa lackierten Fingernägel ihrer rechten Hand in dessen linken Unterarm.
Mit dieser Geste, das musste er sich eingestehen, war er nicht einverstanden. Was besagten die Statistiken noch mal zur Häufigkeit von Flugzeugabstürzen? Und warum ist 8999 eine Edle, und sind 9949 und 10009 auch welche, 9959 und 10019 aber nicht? Vergleichsweise selten sind die auf 9 Endenden sowieso. Ein Skandal auch, dass es nur eine einzige Gerade gibt. Und überhaupt. 8999 Mal null ergibt null, also nichts. Aber 8999 mal eins ergibt 8999. Wenn das keine himmelschreiende Ungerechtigkeit ist. Müsste nicht 8999 Mal nichts zumindest irgendwas ergeben?, konnte er sich ohne größere Mühe richtig darüber ereifern.
Plötzlich hörte das Zittern und Ächzen auf, das Flugzeug stabilisierte sich und der Ausnahmezustand schien vorbei. Die Flugbegleiter sprangen auf, verstauten herausgefallenes Gepäck, sammelten die Tüten mit Erbrochenem ein, redeten beruhigend auf die Kinder und derangierten Erwachsenen ein. Die Asiatin eilte herbei und reichte seinem Nachbarn Papiertücher, um die Soße im Schritt aufzusaugen, wobei er bemerkte, dass sie wahrscheinlich nur zur Hälfte asiatisch war. Denn als sie sich herüber beugte, fielen ihm ihre brünetten Haare kurz ins Gesicht und machten dabei einen eher mittel- bis südeuropäischen Eindruck auf ihn. Aber das lag vielleicht auch an dem olfaktorischen Nachklang von Chanel No 5, der immerhin sekundenlange Ablenkung von dem nicht so flott zu vertreibenden Kotzgestank brachte. Anschließend blätterte er lustlos in einem Männermagazin, wechselte dann zum Bordmagazin, schlug kurz den Veroux auf, las den Anfang von Seite 23: »Der Tod des ausgehenden Mittelalters, das ist auch der zufällige Tod, der Entbehrungstod des armen Mannes, der Unfalltod des Reisenden, erschlagen am Feldrain, ertrunken in einem Fluss, zufällig getroffen vom Blitz. Das ist der Tod als Fluch, ein hässlicher, gemeiner, hinterhältiger Tod, der Angst einflößt und von niemandem willkommen geheißen wird.«
Er schlug das Buch wieder zu und lehnte sich zurück, begleitet von der Hoffnung, sich doch noch zu entspannen.
Gersons Geschichte, das kann ich rückblickend sagen, endete ziemlich verkrampft. Alter Gerson war ein Freund von mir. Er meinte einmal, es existierten eigentlich nur zwei Arten von Typen. Die einen würden mit vierzig schon tot sein, die anderen über hundert Jahre alt werden wollen. Und dazwischen gäbe es: nichts – nur die echten Leichen, gestorben an der demografischen Wahrscheinlichkeit des Ablebens, also die überwiegende Masse, auch Allgemeinheit genannt. In dem Begriff Allgemeinheit verberge sich ja ein maßgeblicher Bestandteil ihres eigentlichen Wesens, nämlich Gemeinheit. Und es sei schon eine echte Gemeinheit – die meisten Menschen wollten entweder schon tot sein oder noch lange nicht, wenn sie tatsächlich stürben.
Ich habe einen Bekannten, der seinen Sohn Sturm genannt hat, angeblich ein in Vergessenheit geratener urdeutscher Name, was ihn in meinen Ohren nicht schöner macht. Allerdings denke ich an Shakespeare, wenn ich ihn höre, und das hat auch sein Gutes. Gerson hieß wirklich Alter mit Vornamen, denn so haben ihn nicht nur die Lehrer in der Schule genannt, sondern, wenn ich mich richtig erinnere, auch seine Eltern, die ihm den Namen ja verpasst hatten, wohl wissend, dass seine Schulkameraden später »Hey, Alter« und andere, weniger freundliche Sachen zu ihm sagen würden, was meinen Freund Alter aber nie ernsthaft zu stören schien. Wahrscheinlich, weil er längst wusste, dass höchstens die anderen alt werden würden, er aber nicht. Denn er hatte beschlossen, ewig jung zu bleiben. Keine Ahnung, ob sein Vorname, der ja seit seiner Kindheit als weitgreifendes Versprechen selbst ungenannt allgegenwärtig war, ihn in seinen Überlegungen bestärkt hatte, denn so eng waren wir auch wieder nicht, jedenfalls ließ er seinem Beschluss eine Tat folgen: Er sprang an einem Montagmorgen um halb zehn mit dem Kopf voran aus dem siebten Stock, gerade 37 Jahre alt, und wurde daher ewig jung zu Grabe getragen, aber seine Eltern waren mit der etwas irreführenden Namensgebung nicht dafür verantwortlich zu machen.
Einige Monate vor seinem … Weggang war ich mit Gerson verabredet gewesen – ohne zu ahnen, dass es das letzte Mal sein würde. »Alle Menschen sterben gewiss«, meinte er lächelnd, »nur die Selbstmörder vielleicht.«
Ich machte daraufhin wahrscheinlich ein so dämliches Gesicht, dass er Mitleid mit mir empfand und sofort weiterredete: »Ich habe Glück gehabt, meine Zahnarztpraxis ist vor einigen Monaten abgesoffen, Wasserrohrbruch, Totalschaden.«
»Abgesoffen, Totalschaden«, wiederholte ich, »aber das ist ja furchtbar, warum hast du mir nicht schon viel früher davon erzählt? Vielleicht hätte ich dir irgendwie helfen können.«
»Ach, war gar nicht so schlimm,« antwortete er. »Habe eine halbe Million von der Versicherung kassiert.«
»Klingt gut«, erwiderte ich, nun froh für meinen Freund.
»Na ja«, sagte er daraufhin und zog die Stirn kraus. »So gut nun auch wieder nicht. Du kennst mich. Bin mit hunderttausend ins Casino und mit fünfzigtausend wieder raus. Eigentlich keine große Sache, aber daraufhin hat sich meine Liebste von mir getrennt.«
»O Mann«, sagte ich. »Ich wusste gar nicht, dass du eine Freundin hast. Erst die Praxis weg, dann das Geld, dann die Dame deines Herzens, das klingt ja echt nicht so toll.«
»Nee«, er grinste, »hab schon ’ne neue.«
»Wie schön für dich«, sagte ich und spürte, wie mein Herz zu klopfen anfing.
»So schön nun auch wieder nicht«, entgegnete er.
»Wieso?«, fragte ich, zunehmend neugierig, was noch kommen würde.
»Sie sagt, sie liebt mich, aber sie hat gleichzeitig ein Verhältnis mit einem anderen Mann, einem Piloten bei der Lufthansa.«
»Oh, das tut mir leid«, sagte ich. »Kann mir vorstellen, dass das sehr verletzend ist für Dich.«
»Das nun auch wieder nicht«, sagte er mit siegesgewissem Blitzen in den Augen. »Er ist sehr viel unterwegs. Und wann immer er weg ist, bin ich bei der Frau.«
»Okay«, sagte ich gedehnt. »Das wiederum klingt ja eigentlich ganz gut.«
»Meine ich doch«, erwiderte er mit einem neuerlichen Grinsen. »Man kann sich auf nichts wirklich verlassen. Nur der Tod ist gewiss.«
»Mensch, Alter«, sagte ich nach einer Weile, leicht verwirrt durch die Wendungen des Gesprächs.
»Was?«, sagte er und blickte mich direkt an.
»Du klingst, als wärst du auf deine alten Tage fast weise geworden.«
»Ich«, sagte er, »habe jedenfalls einen Entschluss gefasst.«
Danach verlief sich das Gespräch ohne erkennbaren Grund. Er verriet mir nicht, was für einen Entschluss er gefasst hatte, vermutlich, so nahm ich an, weil ich es nach seiner Vorstellung ja ohnehin rechtzeitig erfahren würde. Er verabschiedete sich mit einer flüchtigen Umarmung, was er noch nie zuvor getan hatte. Wahrscheinlich hätte ich genauer nachfragen, seine Widerstände überwinden sollen. Eigentlich hätte ich im Verlauf dieses Gesprächs erkennen müssen, wohin Gersons Leben lief oder vielmehr fiel.
Ein früher Tod, das ist mir erst durch Alter Gerson wirklich bewusst geworden, erscheint nicht wenigen Menschen so reizvoll wie das ewige Leben. Mir persönlich war die suizidale Überambitioniertheit mancher Zeitgenossen schon immer ein Rätsel. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht … Träumen Sie nicht auch davon, alt zu werden, womöglich sehr alt, Minimum hundert, also über die Schallgrenze hinweg. Je länger man schon dabei ist, umso lieber möchte man dabei bleiben und die Grenze überwinden. Allein schon aus Sportsgeist. Und weil dann der Bürgermeister zum Geburtstag kommt. Na ja, vielleicht macht er das inzwischen auch nicht mehr. Die Menschen werden ja immer älter, und einhundert ist nicht mehr das, was es noch in den fünfziger, sechziger und siebziger Jahren war, nämlich ein Ereignis von fast aufrührerischer, politischer Dimension, eine gerontologische Individualrevolte.
Schon damals gab es diese Berichte von sehr alten Menschen, vermehrt anzutreffen in sogenannten Blauen Zonen. Etwa in der Stadt Limo Lina in Kalifornien, auf der griechischen Insel Ikaria, dem japanischen Okinawa, der Nicoya-Halbinsel in Costa Rica sowie vierzehn Bergdörfern in der Nähe von Villagrande Strisaili auf Sardinien. Pro hunderttausend Einwohner leben dort einunddreißig über Hundertjährige.
Warum ziehen wir da nicht einfach hin?, werden Sie jetzt wahrscheinlich fragen. Ja, ich habe auch schon darüber nachgedacht. Ist wahrscheinlich gesünder als Berlin, Hamburg oder München, London, New York, Istanbul oder Manchester. Allerdings … Genau – dieselbe Überlegung habe ich dann auch angestellt und die Übersiedelungspläne nach Sardinien wieder aufgegeben.
Heute denke ich noch mal anders – mir immer klarer als ich selbst bewusst werdend und bloß hin und wieder als eine zweite Person existierend in der dritten.
Wie gut, dass er von dem Vorhaben, sich in Sardinien niederzulassen, abgekommen war. Die Halbasiatin schien sich wieder vollständig gefangen zu haben. Sie reichte ihm ein Erfrischungstuch und auf Nachfragen eine kalte Cola dazu. Wie sie so vor ihm stand, spielte er mit dem Gedanken, sie zu fragen, ob sie in Sevilla Zwischenstation machen würde, doch gelang es ihm auch diesmal nicht, diese Überlegung in die Tat umzusetzen. Jedenfalls war er auf dem Weg zum Ältesten der Alten. Man muss in einer Großstadt leben, um eine solche Geschichte zu erfahren, dachte er, verwarf den Gedanken aber sofort wieder, weil die Zeitung ja auch auf dem Land und in Dörfern zu kaufen gewesen war. Er legte den Veroux wieder zur Seite, stöpselte schließlich seine iPhone-Kopfhörer in die Buchse in der Armlehne und hörte auf Kanal 1 das »Concierto De Aranjuez«, in der Interpretation von Miles Davis. Wie oft hatte er »Sketches Of Spain« zu Hause gehört. Nur für »Kind Of Blue« konnte er sich noch mehr begeistern. Als sie dann rund vierzig Minuten später sanft oder vielmehr zart auf der Landebahn in Sevilla aufsetzten, stieß das in ihm vor allem die Erkenntnis andauernder Lebendigkeit an, während Begeisterungsrufe und frenetisches Klatschen die Schlussakkorde des dritten Teils des Concierto übertönten und die halbasiatisch aussehende Stewardess auf Nimmerwiedersehen im Cockpit verschwand.
DREI
Wann auch immer der Tod eintritt – etwa fünf Minuten danach beginnen die biologischen Zerfallsprozesse in einem menschlichen Körper, der dann ein frischer Leichnam ist. Mangels weiterer Sauerstoffzufuhr nach dem Erliegen der Lungenatmung und Erlahmen der Hautatmung beginnen die Zellen des Körpers, sich in der Autolyse von innen nach außen aufzulösen. Ein Prozess der Wandlung setzt ein, in der Wissenschaft vom Tod Metamorphose genannt. Diese Wandlung wird besonders durch den massenhaften Auftritt einer Fliegen-Art vorangetrieben. Es handelt sich um die Leichenbuckelfliege, den Quasimodo unter den Erstverwertern. Conicera tibialis, die »Graberin konischer Röhren«, hat vor vielen Jahrtausenden vor allem eins verlernt: das Fliegen. Trotzdem ist sie zur Stelle, wenn es etwas Verwesendes zu beißen gibt, also praktisch immer und überall. Man muss gar nicht lange auf ihr Erscheinen warten, sie findet sich ganz automatisch mit großer Geschwindigkeit von ganz alleine ein. Hölzerne Särge halten sie nicht auf. Sie bohrt sich einfach konisch durchs Holz, wie sie sich auch durchs Erdreich bohrt, und selbst die kaum verschließbaren Ritzen in Steinsärgen erlauben ihr den Zugang zu den jüngst Verstorbenen. Es sei denn, diese sind Pharaonen, vorsorglich einbalsamiert, und sie ruhen in Steinsarkophagen, deren Fugen mit Harz abgedichtet wurden, in der angenehmen Kühle einer Pyramide. Oder der Zustrom weiterer Nekrophagen wird durch die Verpackung in luftdichten Leichensäcken und sich daran anschließender Unterbringung in fugendichten Zinksärgen aufgehalten, was die Anzahl der hungrigen Mäuler bei der Resteverwertung deutlich begrenzt, aber nicht vollständig auf null halten kann, da jeder Mensch bereits zu Lebzeiten von ihnen besiedelt ist. Diese Art Glöckner – das ist die traurige Botschaft – lebt und gedeiht ständig in uns, und sowie die Totenglocken läuten, wird er aktiv.
Seine Larven können in Dung und Exkrementen existieren, in Pilzen, Pflanzenresten und faulenden Abflussrohren, ideale Bedingungen liefern hingegen verwesende Kadaver jeglicher Art. In Leichnamen können viele Generationen von Buckelfliegen überleben. So lange, bis der letzte Rest von Fleisch von den Knochen gefressen und selbst das Knochenmark vertilgt worden ist. Als Aasfresser überträgt die Buckelfliege zahllose, auch letale Krankheiten, weshalb sie nicht nur die Toten zerlegt, sondern auch Lebenden den Garaus machen kann.
Nach Eintritt des Todes stehen plötzlich die besten Futterreservoirs im Überfluss bereit und das Programm der massenhaften Vermehrung der »Graberin konischer Röhren« beginnt wie auf Autopilot. Nur Kühlkammern vermögen der Bevölkerungsexplosion der wechselwarmen und damit auf passende Umgebungstemperatur angewiesenen Nekrophagen eine frostige Unwirtlichkeit entgegenzusetzen. Umso radikaler vollzieht sich die Metamorphose des Todes in warmer Umgebung, womöglich in den Tropen. Über den Aasgeruch, also den Zersetzungsduft zerfallender Zellen, werden beispielsweise auch Schmeißfliegen angelockt. Deren Weibchen legen ihre Eier in Streifen oder Haufen in der Nähe von noch feuchten, weil sonnenabgewandten, Körperöffnungen. Die schlüpfenden Larven marschieren zu Tausenden in die Öffnungen im Genitalbereich, den Mund, die Augen, Nase, Ohren, um den Buckelfliegen Konkurrenz zu machen und diesen Corpus dann mit geradezu wissenschaftlicher Gründlichkeit und Disziplin zu filetieren und zu skelettieren, bis nur noch das Knochengerüst, am Schädel klebende Haare, die Zähne im Kiefer und lose herumliegende Fingernägel übrig bleiben. Zu bestaunen sind hier die biologisch orchestrierten Mechanismen der Kadaverzersetzung.
Falls einem diese Vorstellung der Humuswerdung eines Leichnams, womöglich des eigenen, nicht behagt, bleiben eigentlich nur zwei Möglichkeiten, wenn man eine dritte, nämlich das Einfrieren, vernachlässigt. Meiner Meinung nach ebenfalls zu vernachlässigen, weil alles Eingefrorene irgendwann ja auch wieder aufgetaut werden muss. Die erste Möglichkeit besteht nun in der Beschleunigung der beschrieben Metamorphose. Für eine sogenannte Himmelsbestattung wird der Leichnam nackt unter freiem Himmel aufgebahrt, damit Raubvögel und andere Tiere ihn fressen – bis heute sehr verbreitet in Tibet. In unseren Breiten wären anstatt der Geier andere Aasfresser wie Tauben, Krähen oder Raben zur Stelle, aber auch Katzen, Mäuse oder Ratten. Überdies sollen christliche Heilige diese Methode der Körperspende bevorzugt haben. Die zweite Möglichkeit ist eine weitere Beschleunigung und zunehmend verbreitet: Kremierung im auf 900 Grad vorgeheizten Muffelofen, einem wärmespeichernden, mit Schamotte ausgekleideten Hochofen, in den der Tote in einem verleimten Holzsarg, also einem Sarg ohne Schrauben und Nägel, geschoben und innerhalb von rund neunzig Minuten zu Asche verkohlt wird. Letzteres hatte die Familie von Gerson, »der Sauberkeit halber«, wie die Mutter mir später bei einer zufälligen Begegnung verraten sollte, gewählt, denn ich selbst hatte zur Bestattung leider nicht kommen können.
Er blieb sitzen, bis die letzten Gäste das Flugzeug verlassen hatten, in der Hoffnung, die Halbasiatin doch noch einmal zu sehen, stolperte dann zum Ausgang, wo ihm der Steward mit einem magenbitteren Grinsen ein Herz aus Schokolade in die Hand legte, und taumelte, so kam es ihm jedenfalls vor, über die Boarding Bridge in die Ankunftshalle, um sein Gepäck, das überraschenderweise schon vor ihm da war, zu greifen und sich dann, immer noch etwas benommen, ins erste Taxi am Stand zu zwängen. Dessen Fahrer hatte noch nichts von einem 500 Jahre alten Sevillano, eigentlich aus Cádiz gebürtig, gehört und kurvte auf Umwegen in die Stadt, weil er ihn offenbar für nicht zurechnungsfähig, sehr wohl aber für zahlungskräftig hielt. Der Flughafen liegt etwas außerhalb, und es gab, das wusste er von früheren Aufenthalten, eine direkte Verbindung ins Zentrum. Doch die nahmen sie nicht, sondern schlängelten sich durch Dörfer und Randbezirke, die er nicht kannte, während er an dem flauen Gefühl im Magen erkannte, dass er langsam Hunger bekam und sehr gern mit der Stewardess zu Abend gegessen hätte.
Kürzlich bin ich auf eine merkwürdige Weise verstorben. Ich befand mich im Urwald, fühlte mich darin wie ausgesetzt. Der Wald war dicht und üppig, so, wie ich ihn von den Philippinen kannte. Aus irgendeinem Grund bewegte ich mich nicht auf dem Boden, sondern im Geäst. Es gab dort oben unter den Wipfeln Pfade, die ohne Unterbrechung von Ast zu Ast führten, weil die Bäume eng genug dafür standen. Ich folgte diesem Dschungel-Höhenwanderweg mit dem geschmeidig sicheren Tritt einer Katze. Doch dann bemerkte ich, dass etwas nicht stimmte. Ich wurde verfolgt. Ich wusste nicht, von wem, nur, dass mir etwas auf den Fersen war. Also beschleunigte ich meine Schritte, genoss dabei sogar die Geschwindigkeit und Sicherheit und hatte fast das Gefühl, zu fliegen und meinem Verfolger oder meinen Verfolgern entkommen zu können. Bis ich die Gefahr plötzlich vor mir spürte. Ich sah rote Augen – bevor ich stürzte. Ich stürzte tief, fiel ins Bodenlose. Der Wald war plötzlich weg. Ich fiel in eine Schlucht, in einen Abgrund, der aber kein Ende nahm, und in dem Moment, als ich dies erkannte, dachte ich im Traum unmittelbar vor dem Erwachen oder während des Erwachens: So ist das also, wenn man stirbt. Ich falle gerade in die Welt des Todes.
Ja, da las ich schon Veroux’ DIE KULTUR DES STERBENS. Ich lebe, das kann ich an dieser Stelle sagen, obwohl schon mehrfach tot geglaubt, grundsätzlich gern und versuche, die Zeit bis zur Ankunft der Maden zu genießen. Ich finde es interessant, Zeit zu überblicken, möglichst viel Zeit in Wahrheit, denn mit jedem Jahr, das denke ich wirklich, wird es spannender. Ich weiß zu schätzen, eine persönliche Geschichte zu haben, die es mir gestattet, Ereignisse in einem Zusammenhang zu sehen. Dieser Tage mache ich mir allerdings etwas Sorgen. Zwar seltener, aber doch mit einer gewissen Regelmäßigkeit denke ich »er« und sage das auch, wenn ich mich selbst als mein Ich meine. Kann in bestimmten Situationen durchaus zu Konfusion führen. Denn immer wieder sage ich aber auch mal »ich«, obwohl er mich denkt.
Als er schon glaubte, sein Gleichgewichtsorgan habe sich endlich von dem Abenteuer in der Luft erholt, kamen sie an einem Marktplatz vorbei, der ihm auch in Erinnerung bleiben würde, weil dort sehr fremdartig aussehende Bäume in einem Halbkreis wuchsen. Die Bäume waren etwa fünfzehn Meter hoch und sahen aus wie überdimensionierte, in die Länge gezogene Brokkoli und hatten Tentakeln ähnelnde Wurzeln. Ihm wurde erneut schlecht. Er wollte den Fahrer schon bitten, anzuhalten, um sich in den Rinnstein zu erbrechen, doch da hatten sie den Kreisel bei der Plaza de España schon hinter sich und stoppten vor seinem Hotel direkt gegenüber der Giralda.
Zu durchgeschüttelt, um zu protestieren, zahlte er den überhöhten Fahrpreis und blieb dann einige Minuten in der kühlen Nacht stehen, um langsam durchzuatmen und sich zu sammeln, bevor er durch einen langen Gang wie durch einen Boarding-Finger ins Hotel trat. Die Damen am Empfang hatten ebenfalls noch nichts von einem Fünfhundertjährigen gehört, der zumindest eine lokale Berühmtheit sein müsste. Er beschloss, sich davon nicht entmutigen zu lassen, und erlebte eine sehr tief durchschlafene und fast traumlos ruhige Nacht. Denn morgens, es muss kurz vorm Aufwachen gewesen sein, sah er sich selbst im Traum zu, sah sich an einem Tisch sitzen, in einem Buch lesen, wahrscheinlich dem Veroux, dachte im Traum aber sehr laut »ich«, während er sich selbst von außen beim Denken beobachtete.
VIER
Als Fotoreporter erlebte ich einige Ereignisse von Weltgeltung sehr direkt mit, etwa den Fall der Mauer oder den Beginn des Jugoslawienkrieges. Klingt wahrscheinlich etwas angeberisch, aber so war es nun mal. So blind wie früher kam ich mir plötzlich nicht mehr vor und empfand eine ungeahnte Steigerung meines Selbstwertes, hielt den tatsächlichen Wissenszuwachs aber bereits damals für zweifelhaft. Eine Zeit lang bildete ich mir trotzdem einiges darauf ein, wie man so sagt, dabei gewesen zu sein. Wäre ich doch schon älter, wünschte ich mir immer wieder auch in diesen Jahren. Hin und wieder wünschte ich mir sogar, sehr viel älter zu sein. Denn Jugend, so glaubte ich, wird überbewertet.
Allerdings, das war mir auch schon aufgefallen, nimmt die Ratlosigkeit mit dem Alter noch zu. Vor allem bei der aktuellen Ereignisbeschleunigung. Das war jedenfalls mein gegenwärtiger Eindruck, denn wann immer ich mit klugen Menschen meines Alters und darüber hinaus zusammensaß und redete und zuhörte und nachfragte, sagten sie: Weiß ich auch nicht, keine Ahnung, wirklich, da weiß ich auch nicht weiter. Die allgemeine Ratlosigkeit krachte einem da ja geradezu ins Gehirn.
Hey, was für ein Morgen! Erwartungsgemäß sonnig, die Temperatur der Jahreszeit entsprechend trotzdem angenehm kühl. Die Blonde an der Rezeption tippte der Dunkelhaarigen an die Schulter, als sie ihn kommen sah. Beide lächelten wie auf Kommando. Aus irgendeinem Grund fühlte er sich plötzlich alt und unattraktiv. Er wollte zurücklächeln, doch gefror ihm das Lächeln auf den Lippen. Er stürmte aus dem Hotel, trank in einer Bar eine Tasse Kaffee, nahm ein Glas Orangensaft dazu, aß ein süßes pappiges Brötchen und schlenderte anschließend durch die Gassen der Altstadt. Weil er weder einen Stadtplan dabei noch Lust hatte, sich von Google auf seinem Handy leiten zu lassen, fand er sich mehrere Male an derselben Straßenkreuzung wieder, obwohl er nicht zum ersten Mal in der Altstadt war.
Wo anfangen zu suchen? Er spürte eine gespannte Erwartung, sprach sich selbst dabei Mut zu und starrte sämtliche männlichen Passanten, die einigermaßen ins Schema passten, direkt und prüfend an, ignorierte die weibliche Begleitung oder einzelne Frauen aber völlig, was für Irritation zu sorgen schien, denn er wurde einige Male unverhohlen ärgerlich angesehen. O Mann, brummte er vor sich hin. Auch von sich selbst verunsichert. Schließlich erreichte er die Plaza del Salvador.
Jugend wird überbewertet, wiederholte er in Gedanken. Und dachte im selben Moment das genaue Gegenteil. Alter ist lästig. Für die Mädchen um die zwanzig wird man zum Opa. Für die über Dreißigjährigen zum Rentner. Mit über fünfzig läuft mit Glück etwas bei Frauen um die vierzig. Ab sechzig sieht es dann richtig finster aus.
Was für ein Quatsch, hatte er gerade eben noch gedacht: Wäre er doch gleich im Alter von dreißig Jahren geboren worden. Bis zwanzig? Verzichtbar. Nein, mit vierzig geboren wäre noch besser, dann hätte er seine Unsicherheiten und die daraus resultierenden Dummheiten als Zwanzig- und Dreißigjähriger womöglich gänzlich ausgelassen.
Ach was, diese Dummheiten und Unsicherheiten waren kostbar. Zwar hatte man als Zwanzigjähriger keine Ahnung vom Sex, aber dafür jede Menge davon.
Heute trauerte er sogar den vielen One-Night-Stands hinterher, die nach eindringlichen Zusammentreffen ausnahmslos mit fahrigen Verabschiedungen um fünf Uhr morgens und hektischen wie verfrorenen Fluchten in die eigene Wohnung endeten.
Mit den Jahren wurde die Suche nach Nähe allerdings erwachsener. Doch wurde sie damit auch schöner?
Er hatte sich an sich selbst gewöhnt. Diese Gewohnheit als Vertrautheit zu bezeichnen oder womöglich Selbstkenntnis zu nennen, würde er besonders in seinem jetzigen Zustand zu hoch gegriffen und anmaßend finden. Manchmal erheiterte ihn das, meistens machte es ihn jedoch wütend. Mehr denn je sah er sich selbst als sein größtes Rätsel und fragte sich, wer er eigentlich war. Das einzige, was er in diesem Zusammenhang für gesichert hielt, war sein Vertrauen darauf, dass es ihm nie langweilig werden würde, sich diese Frage immer wieder neu zu stellen.
Hach, wirklich ärgerlich, auf Altersweisheit war also auch kein Verlass. Warum dann sein Hunger nach mehr, nach mehr Jahren, mehr Erfahrungen, mehr Lebenszeit, einer sehr viel größeren Lebensspanne? Komische Sache, das.
In der Basilika fand eine Hochzeit statt. Das Brautpaar posierte auf der Treppe für den Fotografen. Sie in Weiß, klein, gedrungen, Neigung zu Adipositas, mit einer rosa Schärpe gewissermaßen geschenkverpackt, dazu orangeroten Schuhen und einem irgendwie siegesgewiss wirkenden Lächeln. Der Bräutigam in silbernem Anzug und Krawatte in Pink, also zur Braut passend. Allerdings fehlte der kämpferische Ausdruck in seinem teigigen Gesicht. Und man konnte ahnen, wohin sich die frisch geschlossene Ehe in den nächsten Jahren bewegen würde.
Er dokumentierte das Geschehen mit dem iPhone. An den Tischen vor den zwei, drei offenen Bars hatte sich bereits eine ausgelassene Gesellschaft eingefunden, die allerdings nichts mit dem Gefolge des Brautpaares zu tun hatte, sondern die ganz alltägliche Versammlung hier rund um die Mittagszeit war. Er musste sich etwas überwinden, in das Getriebe einzutauchen, steuerte dann aber auf einen freien Tisch zu und bestellte wie alle anderen ein Bier, obwohl es erst 11 Uhr war. Der Kellner war zu beschäftigt, um für Recherchefragen zur Verfügung zu stehen.
Erlauben Sie mir, dass ich mich vorstelle. Ich heiße Ole Meerzen, bin 54 Jahre alt, etwa fünf Jahre jünger, als meistens vermutet wird, hatte einmal rotblonde Haare, die inzwischen aber vollständig graublond sind, bin laut Pass einsachtzig groß, habe einen Bauch, was mich selbst oft sehr stört, aber ungewöhnlich große blaue Augen mit grünbraunem Rand, die manche Frauen schon als faszinierend beschrieben haben, weshalb ich mich ganz so hässlich nun auch wieder nicht finde und immer wieder sogar Freude am Leben habe, was leider durch eine in der Pubertät diagnostizierte psychische Störung beeinträchtigt wird. Es heißt, ich hätte ein Problem damit, mich als konsistentes Selbst zu erfahren und auch zu sehen und wäre ein Grenzgänger.
Das ist nicht die ganze Wahrheit, denn, um ehrlich zu sein, hatte und habe ich selbst kein Problem damit. Ich bleibe singulär, rede zwar immer wieder in der dritten Person über mich, aber nicht im Plural, wachse auch nicht manisch ins Königliche, um am nächsten Tag zur letzten Laus vorm Weltuntergang zu schrumpfen und in tiefer Depression zu versinken, bin also nicht bipolar im klassischen Sinne, sondern irgendwie, ja, dual, denn mir fällt selbst auf, dass ich immer wieder denke und auch sage »er« oder »der Ole« habe dies oder jenes getan. Er und ich – wir können prima Zwiesprache halten und sind gewissermaßen intern freundschaftlich verbunden, was natürlich auch für Befremden sorgen und auf Unverständnis stoßen kann. Aber im Ernst – wem geht das insgeheim eigentlich nicht so? Jedenfalls ist meine Dualität nur eine von vielen Seltsamkeiten in meinem Leben. Und sicherlich nicht die letzte.
Manchmal vermisse ich Alter Gerson und seine Sonderbarkeiten. So hatte er mir einmal einen Brief gezeigt, den er seiner Mutter geschrieben und mit einer Antwort von ihr auf der Rückseite zurückbekommen hatte. »Liebe Mutter«, begann er den Brief, »wenn Du Deinen Brief lesen wirst, so wirst Du Dich fragen, warum schreibe ich ›Deinen Brief‹ und nicht ›meinen‹? Ganz einfach: Wenn Du laut lesen würdest, worum ich Dich bitte, könntest Du denken, es sei Dein Brief, wenn Du ›meinen‹ liest. Ich möchte aber, dass es genau anders herum ist. Du sollst wissen, dass es mein Brief ist und es auch so klingt, daher schreibe ich ›Dein Brief‹.«
Daraufhin schrieb seine Mutter auf die Rückseite: »Lieber Sohn, danke! Ich wiederum bitte Dich, meinen Brief jetzt leise für Dich zu lesen, damit es keine Verwirrung mit Mein und Dein geben kann. Und nur das Ende dann laut: meine liebe Mutter.«
Noch im Studium hatte Gerson einmal zu mir gemeint, er wolle mit einem Bekannten eine Firma gründen.
»Was für eine Firma denn?«, hatte ich neugierig gefragt.
»Im- und Export«, hatte Gerson erwidert und dabei die Backen aufgeblasen.
»Aber du hast doch gar kein Geld«, hatte ich gesagt, wohl wissend, dass Gerson vollständig blank war, weil er auch mich ständig um Geld anpumpte.
»Macht nichts«, antwortete Gerson und stieß die Luft mit gespitzten Lippen aus. »Er hat das Geld und ich habe das Wissen.«
»Was für ein Wissen meinst du?«, fragte ich weiter.
»Wie man die Rollen tauscht«, antwortete er, »wie man es nämlich anstellt, dass ich das Geld habe und er um dieses Wissen reicher ist.«
Der Gerson. Alters Absenz ließ mich nicht los. Das Gefühl des Verlustes traf mich regelmäßig wie in Wellen. Ich brauchte nur jemanden auf der Straße zu sehen, der ihm ähnlich sah. Oder einen Satz hören, der von ihm stammen könnte. Und schon vermisste ich ihn und war manchmal ganze Tage danach nicht mehr zu gebrauchen.
Erst viel später erfuhr ich, dass bei Gersons Beisetzung ein Rabbiner zugegen gewesen war und seinen Einfluss geltend gemacht hatte, um die Familie zur traditionellen Erdbestattung zu bewegen, denn vor allem bei amerikanischen Juden ging der Trend zunehmend zur modernen Feuerbestattung. Allen voran die israelischen Ultraorthodoxen versuchten dem natürlich entgegenzuwirken. Im Falle Gersons aber ohne Erfolg. Zu jener Zeit geriet mein Leben zunehmend aus den Fugen. Ich kleidete mich schwarz, las, wie bereits erwähnt, Jean Veroux’ DIE KULTUR DES STERBENS, knapp tausend Seiten über die Geschichte des Todes, und erlebte eine andauernde Phase von Depressivität, weil ich immer wieder an Gerson, seinen Humor, sein gar nicht komisches Ende und die auf irritierende Weise eher wachsende denn schwindende schmerzhafte Lücke denken musste, die sein Weggang (oder vielmehr Abflug) bei mir hinterlassen hatte. »Welch wundersame Wendung«, schrieb Veroux im Vorwort, »dass meine Forschung mich zu diesem Thema trieb, welches als Ausgangspunkt das Sterben nahm, um sich dann zwischen Diesseits und Jenseits hin und her zu bewegen, durch die Jahrhunderte und Menschheitsalter, hinausgetrieben aus der Gegenwart des Lebens in die Gegenwärtigkeit des Todes und seiner Kultur und Geschichte.« Das Buch wurde mein ständiger Begleiter. Ich hatte den Tod nun immer in der Tasche.
»Permiso?«, sprach ihn ein Mann um die vierzig an. Auf sein Nicken stellte sich ein Paar an seinen Tisch, gefolgt von einem zweiten. Die Frauen, beide um die dreißig, viel Gold an den Fingern, redeten über den Besuch einer Party. Die Männer über einen Immobilienhandel. Er verstand nicht, ob der Kauf bereits stattgefunden hatte oder noch geplant war, wechselten das Thema aber, bevor er es herausfinden konnte. Daraufhin brummte er »scusi«, grinste, weil er sich ins Italienische verlaufen hatte, zog sein Handy hervor und zeigte der Gruppe am Tisch den Zeitungsausschnitt, den er zur Schonung des Originals abfotografiert hatte.
Der Mann, der ihn angesprochen hatte, warf die Stirn in Falten und wollte wissen, ob er Polizist sei.
»Nein, nein, Journalist«, antwortete er schnell.
»Wer ist das?«, erkundigte der Mann sich weiter und tippte mit dem Finger auf das Display des Handys, während die anderen drei über ihre Arbeit in einer Kanzlei sprachen, bekam aber plötzlich ihre ungeteilte Aufmerksamkeit, als er mit der Erklärung begann – trotz seines leider etwas holprigen Spanisch.
Um es gleich zu sagen: Man vermutete einen Schwindel, glaubte aber, den Mann auf dem Foto schon einmal gesehen zu haben. Sí, in dieser Stadt.
Auf einmal wollte jeder das Foto sehen. Vor Aufregung musste er einige Sekunden lang durchs Menü irren, bis es ihm gelang, den Bildschirm auf Dauerbetrieb zu stellen. Mit einem Hochgefühl ließ er sein Handy schließlich durch die Menge wandern.
Ja, das funktioniert. Diese hier dargestellte Recherche-Methode ist jedem zu empfehlen, der eine Person finden will und glaubhaft versichern kann, dies weder zum Zweck polizeilicher Ermittlungen noch aus anderen unehrenhaften Gründen zu tun. Und Journalismus, obwohl in vielerlei Hinsicht auch zu Recht in Verruf geraten, gehört unter vergleichbaren Umständen meistens nicht dazu.
Aber: Enttäuschung. Nach nur wenigen Minuten war klar, dass wahrscheinlich keiner der Anwesenden Álvarez persönlich kannte, also einen direkten Kontakt herstellen konnte. Trotzdem ein Funke der Hoffnung. Mehrere wollten ihn gesehen haben – beim Speisen in der Markthalle unten am Fluss, in einem Restaurant gar nicht weit von meinem Hotel, beim Spaziergang in den Alcazar-Gärten. Zwei Hinweise waren besonders brauchbar: Eine Frau meinte, ihn zwei-, dreimal in der Calle Antonio Diaz bei der Maestranza gesehen zu haben, eine andere gab an, sie hätte ihn in der Calle Alfalfa aus einem Hauseingang kommen sehen.
»Können Sie sich an die Hausnummer erinnern?«, fragte er, dankbar für den erhaltenen Hinweis. Doch das konnte sie leider nicht. Innerlich fluchend machte er sich auf den Weg.
FÜNF
Fünfhundert? 500! Ein Mensch diesen Alters musste in seinem Leben schon viele Geburtsurkunden gefälscht haben, denn anders wäre wohl nicht zu erklären, warum er erst dieser Tage gefunden worden war. Einhundert, der Eintritt ins Reich der Dreistelligkeit, bisher umweht vom Hauch der Ewigkeit, schien mit seiner Existenz wie zurückgeworfen in die Zeit der Adoleszenz. Die Ältesten der Alten – auf einmal wirkten sie jung verblüht. Doch so weit war ich mit meinen Gedanken noch nicht, als ich an jenem trüben Berliner Morgen in einem Café sitzend Veroux aus der Hand legte und die Zeitung des Tages las.
Vor einigen Tagen hatte ich Johannes Elmang wiedergetroffen, mit 87 angeblich Berlins ältester Partyraver. Elmang stand am U-Bahnhof Kottbusser Tor am Gleis der U1 in Richtung Uhlandstraße und trat wegen der Kälte von einem Bein aufs andere. Wie immer trug er hautenge Röhrenhosen, dazu Schnürstiefel mit Budapester-Nähten und einen dunkelbraunen Ledermantel, allerdings nicht zugeknöpft, weswegen das oliv-grünblau karierte Sakko aus Harris-Tweed, das er darunter trug, sichtbar war, sowie eine pink-blau-schwarz gestreifte Fliege zu einem lila Hemd, kaum verdeckt von einem hellgrauen Schal.
»Ahoi, Elmang«, begrüßte ich ihn. Er nickte anstelle einer Antwort und drehte sich würdevoll einmal um die eigene Achse. Dann fuhr auch schon der Zug ein, und Elmang entschwand in einem Abteil. Weil ich in die Gegenrichtung musste, mein Zug aber erst in einer Minute kam, blieb ich auf seiner Seite des Bahnsteigs stehen, sah, wie er sich setzte und sofort von einer Gruppe junger, hübscher Mädchen angesprochen wurde. Man konnte neidisch werden bei dem Erfolg eines solchen Auftritts. Vor einigen Monaten hatte ihm das eine Einladung für Modeaufnahmen in Japan eingebracht und den Ruf des coolsten Alten aller Zeiten. Elmang ließ sich mehrfach in den Klubs »Burgschein« und »Le Mal« blicken und wurde regelmäßig im »Queen Victoria« beim Tanzen gesehen.
Während der Zug anfuhr, sah ich, wie eines der Mädchen, eine dunkelhaarige Schönheit, Elmang einen Stift und ein Stück Papier reichte, woraufhin er mit sichtlich erfreutem Gesichtsausdruck etwas daraufschrieb – wahrscheinlich eine Widmung und sein Autogramm. Ich gönnte ihm diesen späten Ruhm. Was sollte ich Johannes Elmang sagen, wenn ich ihn das nächste Mal traf? Vielleicht: He, Mann, nach dem jetzigen Stand der Gerontologie bist du gerade mitten in der Pubertät.
Er wandte sich in die Richtung, in der die Alfalfa liegen sollte, musste aber die Abzweigung, die man ihm genannt hatte, verpasst haben, denn er landete in einer ungewöhnlich breit angelegten Sackgasse mit Geschäften zu beiden Seiten. Rechts wies das sehr aufwändig gemalte Bild einer dunklen Schönheit in einem rotweißen Rüschenkleid mit wehenden Haaren und Kastagnetten in beiden Händen auf den Eingang zu einem Geschäft für Folkloreartikel. Der Laden schräg gegenüber wirkte dagegen heruntergekommen und irgendwie abstoßend, hatte aber den eigenartigen Namen »Matteo Perlheims Fantasie-Store«. Erst wollte er sich abwenden, überlegte es sich aber dann anders.
»Sie«, sagte er mit lauter Stimme, während er den Laden betrat und auf den Mann zusteuerte, der genauso mächtig wirkte wie der Schreibtisch, an dem er saß, »Sie müssen Matteo Perlheim sein.«
»Sie sagen es«, antwortete der Mann und hob seinen dicken Kopf mit einer solchen zeitlupenartigen Langsamkeit, dass er das Geschäft wieder verlassen hätte, wenn das Plakat im Rücken des Mannes nicht gewesen wäre.
»I teech yo whatewer yo wont«, stand dort.
»Sie können mir also alles beibringen? Mich lehren, was auch immer ich lernen will?«, fragte er daher den Mann.
»Sí«, brummte der daraufhin.
»Was Sie geschrieben haben, da oben«, er zeigte auf das Plakat, »ist aber falsches Englisch. Wenn Sie es selbst nicht beherrschen, wie könnten Sie mir richtiges beibringen, falls ich das von Ihnen verlangen wollte?«
Der Mann kniff sein linkes Auge zu und blickte den Besucher mit dem rechten an, während er sich mit beiden Händen vom Schreibtisch in eine stehende Haltung wuchtete und dabei mit einem seltsamen Schwanken in der Stimme fragte: »Spüren Sie es?«
»Was meinen Sie?«, erwiderte er, lauter, als er es beabsichtigt hatte.
»Schauen Sie auf die Straße«, kommandierte Kneifauge daraufhin.
Doch konnte er dort draußen beim besten Willen nichts Besonderes entdecken. Eine Möwe pickte am Boden. Eine zweite hockte auf einem Mauervorsprung und sah der ersten zu. Ein trostloser Anblick. »Was meinen Sie?«, wiederholte er ungeduldig.
»Es hat begonnen«, sagte der Mann mit einer ungewöhnlich tiefen und wohlklingenden Stimme. »Die Ankündigung.«
»Verstehe«, sagte er nun, um irgendetwas zu sagen und sein Gegenüber nicht zu verärgern, denn er hatte ja eine Frage, auf die er eine Antwort suchte. Möglich, dass dieser seltsame Mensch in diesem seltsamen Geschäft sie kannte. Oder ihn darin unterrichteten könnte, wie der Älteste am besten zu finden war.
Er wandte sich wieder zu Matteo Perlheim um, der sich mit seinen fetten Armen und der angesammelten Masse menschlichen Phlegmas auf die Tischkante stützte. Doch der Dicke ließ den Kopf auf die Brust sinken und sah vor sich auf den Boden.
Mit seiner Geduld am Ende, wollte er schon den Laden verlassen, als er erneut die Stimme des Inhabers hörte.
»Der Wind atmet, was die Leute noch nicht wissen«, sang der Mann hinter seinem Rücken. »Das ist das revolutionäre Pathos.«
»Was Sie nicht sagen.« Erstaunt blickte er sich nochmals zu dem Mann um. Der stand jetzt vollständig aufrecht, hatte nun sein rechtes Auge zugekniffen und stattdessen das linke aufgerissen. Mit dem linken hatte er einen Blick, der irgendwie lodernd und irre wirkte. »Schauen Sie genau her«, befahl der Mann und hob die linke Hand mit dem ausgestreckten, sehr dicken Zeigefinger. »Schauen Sie auf meinen Finger.« Er begann die Hand vor dem Gesicht des Besuchers zu bewegen. Hin und her. Schneller. Und noch schneller.
Und dann fand er sich draußen auf der Straße wieder. Im ersten Moment hatte er keinen weiteren Gedanken, sondern fühlte sich geradezu umhüllt und durchdrungen von der Verblüffung, plötzlich in der Sackgasse vor dem Laden zu stehen. Der Gedanke klebte an ihm und wollte ihn eine gefühlte Ewigkeit lang nicht loslassen. Doch dann fegte ein Luftzug durch die Gasse und blies auch in seinem Kopf etwas frei – und er dachte einen zweiten Gedanken. Warum hatte er den Ladeninhaber weder nach dem Ältesten gefragt noch ihm den abfotografierten Zeitungsartikel auf dem Handy gezeigt? »Wie dumm ist das denn?«, dachte er laut und versuchte, dies gleichzeitig auch leise zu sagen. Aber es wurde ein stiller Gedanke und ein lautloses Flüstern daraus.
Minutenlang rang er mit sich selbst. Der Laden war inzwischen dunkel. Wahrscheinlich hatte Perlheim das Licht gelöscht und vorzeitig geschlossen. Er nahm sich vor, morgen zu entscheiden, ob er wiederkommen und den Inhaber zur Rede stellen wollte, unterdrückte aufkommenden Ärger, zog schließlich sein Portemonnaie mit dem darin gefalteten Original aus der Hosentasche und entnahm den Ausschnitt. Vielleicht mit dem unbewussten Impuls, die Wahrhaftigkeit des darin Beschriebenen mit den Händen fühlen zu wollen. Anschließend stand er noch einige Minuten an eine Hauswand gelehnt neben dem Geschäft herum und dachte absolut gar nichts. Er, der auch ich ist.
»Geboren am 4. März 1517 in Cádiz, männlich, lebendig, ein medizinisches Wunder.«
Am selben Tag, einem Montag, erfuhr ich aus dem Internet, war Hernández de Córdoba von Kuba aus losgesegelt, um auf der Insel Guanaja vor Honduras Sklaven für die spanische Krone zu fangen. Die Seite mit dem Impressum der Zeitung hatte sich dann auch noch angefunden. Den Chefredakteur kannte ich nicht, dafür seine Stellvertreterin, Hannelore von Noretzki, meine ehemalige Kollegin, die ich einige Wochen lang auch nach der Arbeit getroffen hatte.
»Ah, Meerzen, lange nichts von dir gehört«, hatte Noretzki gesagt, als ich mich vor einigen Wochen schließlich überwunden hatte, sie anzurufen.
»¡Hola, Hanne«, grüßte ich zurück. »Wie läuft’s?«
»In die falsche Richtung.« Stille am anderen Ende der Leitung. »Gestern wurde eine Kollegin nicht weit vom Eingang erstochen. Deshalb und wegen möglicher Anschläge haben sie an der Pforte Kontrollen wie am Flughafen installiert.«
»Die Inghimasi?«
»Wie die Termiten«, erwiderte sie. »Stürzen sich für die Gruppe ins Feuer oder … Bombe, boom, puff, Brücke ins Himmelreich. Hat was Heroisches und Verlorenes zugleich.«
»Schlimm, das«, sagte ich.
»Kapitaler Mist, das«, sagte sie.
Ich hörte es zweimal in der Leitung krachen, bevor sie weitersprach. »Aber, ganz ehrlich, dir kann ich das ja sagen. Diese Stimmung hält mich irgendwie am Leben. Ich habe Angst, mich in Bedeutungslosigkeit und Langeweile aufzulösen.«
Ich verstand nicht so recht, was sie meinte, wollte aber auch nicht unhöflich sein und fragte deshalb weiter: »Und der Verlag?«
»Katastrophe. Die erste Entlassungswelle hat mich verschont, die zweite einige gute Kollegen aus dem Haus geschossen. Otmar Jenner, mit dem du ja auch gearbeitet hast, ist aber schon vorher gegangen. Ja, die Einschläge kommen näher. Vor der dritten Welle haben sie mir einen Auflösungsvertrag angeboten, um die Sache gütlich zu regeln. Ich habe mich geweigert, einen Anwalt genommen und konnte bleiben. Nun, o Wunder, bin ich sogar Stellvertreterin. Aber die guten Jahre sind vorbei. Alte Träume? Begraben. Hey, Meerzen, bist rechtzeitig gegangen.«
»Wahrscheinlich«, sagte ich.
»Spielst du noch?«
»Ja, manchmal mit dem Gedanken, wieder anzufangen.«
Noretzki war früher Bassistin in New-Wave-Bands gewesen, doch nie in derselben wie ich. Unsere frühere Freundschaft, aus der beinahe eine Beziehung geworden wäre, wurde in diesem Telefonat auf eine seltsame Weise reaktiviert. Für Sekunden öffnete sich die Leitung wie ein Kanal und Noretzki kam näher.
Doch genau das wollte er am wenigsten. Deshalb auch sein anfängliches Zögern.
»Hey, alles jammerschade, sowieso«, trompetete er in den Hörer und fragte sich gleichzeitig, was er mit »alles« eigentlich meinte. Sie redeten einige Minuten über alte und neue Zeiten und die Tatsache, dass der Journalismus von heute nur noch ein Schatten dessen sei, was sie beide einst kennengelernt hatten. Er hörte Melancholie in ihrer Stimme, während sie sprachen, einmal sogar den Klang echter Trauer. Der berufliche Ernst von einst, ihre Hingabe an die Sache hatte sich in einer Mischung aus Wehmut und Zynismus aufgelöst. Budgetkürzungen, Einschränkungen, Qualitätseinbußen, Niedergang, interne Querelen, nach außen hin hielt sie aber immer noch die Ehrenfahne hoch. Die Freiheitsstandarte des aufgeklärten Westens – eigentlich zum Kotzen. Wenn er richtig informiert war, hatte Noretzki vor Jahren geheiratet. Kurz nach seiner Kündigung, glaubte er zu wissen. Aus beruflichen Gründen hatte sie keine Kinder bekommen.
»Eigentlich zum Kotzen«, sagte Noretzki.
Nach einem kurzen, daran anschließenden vertiefenden Meinungsaustausch über die disparate Weltlage nannte er sein tatsächliches Anliegen, was sie ein bisschen zu enttäuschen schien. Doch stellte sie ihn zum Leiter des Kulturressorts durch, der ihn wiederum an den zuständigen Redakteur verwies. Beide klangen hektisch wegen der aktuellen Ereignisse, hatten eigentlich keine Zeit für einen Ex-Kollegen. Beide nuschelten die Überzeugung, dass die Meldung keine Falschmeldung, sondern ernst zu nehmen war, was immer das auch heißen mochte.
»Na ja, entweder oder«, sagte er.
Der Redakteur, ein Mensch mit einer leicht zittrigen, aber dabei sehr jungen Telefonstimme, erklärte ihm, er sei selbst so verblüfft wie skeptisch gewesen. Aber die spanische Agentur EFE hätte die Nachricht gebracht, dann auch Reuters und die Deutsche Presseagentur. Und auf die Agenturen sei ja grundsätzlich Verlass.
Da wäre er jetzt nicht so sicher, wollte er erst antworten, doch eine solche Diskussion hatte er ja gerade mit Noretzki gehabt.
Ob er ihm den Namen des Mannes sagen könne, fragte er, denn in der Zeitung hatte nur der Vorname und der erste Buchstabe seines Nachnamens gestanden, Angelo F.
Dabei sei tatsächlich ein Fehler passiert, erwiderte der Redakteur. Der Mann heiße Angelo Francisco Álvarez de Cádiz.
Warum Cádiz?, fragte er.
Weil der Alte dort geboren ist, so der Redakteur. Doch lebe er heute in Sevilla.
Also Andalusien, hatte er gedacht und aufgelegt.
Keines seiner aktuellen Bücher trug journalistische Züge, keines war in Folge einer gründlicher Recherche geschrieben worden, als Fotoreporter hatte er aber hin und wieder auch rechercheintensive Geschichten angenommen. Trotzdem war er seit fast zwei Jahrzehnten nur noch sporadisch als Reporter unterwegs gewesen. Angesichts zunehmender weltgeschichtlicher Brisanz manchmal ein als bedauerlich empfundener Rückgang. Gleichzeitig aber irgendwie passend zu seiner heutigen Lebenssituation. Jedenfalls fühlte er sich, was Vorrecherche anging, ziemlich eingerostet. Er machte es sich daher einfach, verdrängte mögliche Hindernisse, auch jene, die sich aus seinen psychischen Problemen ergaben, und kaufte das besagte Flugticket.
SECHS
Die Bedienung im Café Cos auf der Plaza del Salvador, in das er sich zurückgezogen hatte, um in Ruhe die ersten Erfahrungen seit seiner Ankunft zu überdenken, war von derart ausladender Weiblichkeit, dass er sich in die Sitzecke drückte, sobald sie auf seinen Tisch zusteuerte und mit schriller und zugleich säuselnder Stimme seine Bestellung aufnahm –, um dann anstelle von Kaffee einen schwarzen Tee zu bringen. Er nahm den Tee, bestellte aber sofort noch einen Kaffee, zog dann sein Handy hervor. Im Internet waren zahlreiche Berichte über sehr alte Menschen zu finden, auch Fotos der Ältesten der Alten, und einige davon wirkten wie Außerirdische.
Fünfhundert? Wie war er bloß darauf verfallen, etwas so Unsinniges im Bereich des Möglichen anzusiedeln?
Falschmeldungen entstehen in den letzten Minuten, bevor der Text in die Druckerei abgeschossen wird. In Momenten, in denen der Verantwortliche dafür mal dringend aufs Klo oder eine Kippe rauchen muss. In Momenten also, wenn jemand sich unbeobachtet an ein Terminal setzen kann. Jemand, der da zu diesem Zeitpunkt eigentlich nicht hingehört, aber wiederum auch nicht als auffällig wahrgenommen wird, wenn am nächsten Morgen eine sehr absonderliche und ganz offenbar hanebüchene Nachricht in der gedruckten Ausgabe erscheint und die Nachfragen dazu laut werden. Doch wer ist dieser Jemand genau? Ein Redakteur? Ein Reporter? Ein Grafiker? Tatsächlich kann es jeder sein, die Assistentin des Chefredakteurs ebenso wie der Chefredakteur selbst, solange ihn niemand dabei sieht und er als Urheber auch später nicht ausfindig zu machen ist. Und es kann sehr wohl sein, dass die Person, die sich über den Fehler in der gedruckten Zeitung am lautesten beschwert, genau die ist, die ihn mit voller Absicht auch hineingebracht hat.
So erscheinen die seltsamsten Meldungen auf Nachrichtenseiten. Zum Beispiel kürzlich gelesen: Fünf extrem reiche Familien, die aber in keiner Forbes-Liste oder sonst wo auftauchten, weil sie sich von allem freikaufen könnten, also auch von solchen Listings, hätten angeblich die Weltherrschaft an sich gerissen, um das Unternehmen Menschheit zu führen. Eine Meldung, die er vor einigen Monaten in einem durchaus seriösen Nachrichtenmagazin entdeckte hatte und immer noch aufbewahrte. Oder dass der Homo erectus von Außerirdischen gezeugt worden sei, die den Genpool der Menschheit noch heute regelmäßig mit Aliengenen versorgen würden, beruhend auf den Darstellungen mehrerer Engländerinnen, die medizinisch nachweislich Sex mit Außerirdischen gehabt hätten. Da wäre er wirklich zu gern dabei gewesen.
Die Bedienung war wahrscheinlich auch nicht von dieser Welt. Es brauchte nur wenig, um eine Silhouette vollständig zum Entgleisen zu bringen. Aus sicherer Distanz machte es ihm Spaß, sie zu beobachten. Allerdings war er der einzige Gast. Seine Aufmerksamkeit fiel auf. Also wieder das Handy.
So stieß ich auf Habib Miyan, laut Geburtsurkunde am 20. Mai 1868 in Jaipur, Rajasthan, geboren und gemäß Sterbeurkunde am 19. August 2008 verstorben. Miyan war 1938 aus der indischen Armee mit behördlich ausgestellten Papieren entlassen worden, die seinen Pensionsanspruch dokumentierten und auch sein Geburtsdatum enthielten. Letzteres beruhte, in Indien damals noch üblich, offenbar auf eigenen Angaben. Damit disqualifizierte er sich für einen Eintrag im GUINNESS WORLD RECORDS BUCH, ist vielleicht auch deutlich jünger als behauptet, aber sehr wahrscheinlich der Welt ältester Pensionär, denn niemand hat bisher länger Rente bezogen als er. Und kein Mensch war bisher so lange mobil wie er. Noch 2004 begab er sich auf die Hadsch nach Mekka und war damit der älteste jemals registrierte Pilger.
Möglicherweise doch noch länger mobil als Miyan war der Chinese Li Ching-Yuen. Der berühmte Kung-Fu-Lehrer soll eigenen Angaben zufolge 1736 in der Provinz Sichuan geboren sein. Er überlebte angeblich 14 Ehefrauen und wurde Vater von 200 Kindern. Eine Legende besagt, dass Meister Li im Alter von 130 Jahren in den Bergen einem 500 Jahre alten Eremiten begegnete, der ihn im Baguazhang, den inneren Kampfkünsten, unterwies. Urkundlich belegt, schied Li Ching-Yuen am 6. Mai 1933 aus dem Leben. Damit wäre er 197 Jahre alt geworden. Jedoch existiert ein Dokument der chinesischen Regierung aus dem Jahr 1827: In dem Schriftstück wird ihm zum 150. Geburtstag gratuliert. Demnach wurde er sogar 250 Jahre alt. Chinesische Historiker der Gegenwart bezweifeln allerdings die Echtheit des Dokuments wie auch die persönlichen Angaben von Meister Li.
Der nachweislich und somit zweifelsfrei älteste Mensch der Welt war und ist aber die sehr sympathische Französin Jeanne Calment, am 21. Februar 1875 in Arles geboren, wo sie nach 122 Jahren und 164 Tagen am 4. August 1997 auch als verstorben gemeldet wurde. Bis heute ein ungebrochener Rekord. Jeanne Calment lebte ein ruhiges Leben in Südfrankreich. Fernand, ihr Mann, starb 55 Jahre vor ihr an einer Vergiftung, gefolgt von der gemeinsamen Tochter, die einer Lungenentzündung erlag, woraufhin Jeanne Calment deren hinterbliebenen Sohn, also ihren Enkel großzog, der jedoch bei einem Motoradunfall ums Leben kam. Da war sie 88, musste ihr Leben neu ordnen und verkaufte ihre Wohnung für eine monatliche Leibrente an einen 47-jährigen Rechtsanwalt, der aber mit 77 starb, weshalb dessen Witwe die Zahlungen fortsetzen musste, bis auch sie verstarb. Sehr zum Vorteil von Jeanne Calment, die dank ihrer Langlebigkeit rund das Dreifache des eigentlichen Wertes ihrer Wohnung ausgezahlt bekam. Calment konnte sich noch an die Erbauung des Eiffelturms erinnern und an eine Begegnung mit Vincent van Gogh, den sie als schlecht gekleidet, schmutzig und unhöflich erlebt habe. 1889 muss das gewesen sein, dem Jahr der Fertigstellung des Eiffelturms in einem Geschäft für Malerbedarf in Arles. Calment hatte dort mit 14 Jahren als Verkäuferin ausgeholfen.
Geboren zehn Jahre nach Ende des amerikanischen Bürgerkriegs, gestorben sechs Jahre nach Ende des zweiten Golfkriegs, lebte sie bereits, als Thomas Edison die Glühbirne erfand und die ersten Autos durch Südfrankreich kurvten, überlebte zwei Weltkriege, erlebte die Mondlandung und das Ende des Kalten Krieges. An ihrem 41. Geburtstag begann die Schlacht um Verdun, an ihrem 90. Geburtstag wurde Malcolm X erschossen. Im Jahr der Gründung von Microsoft feierte sie ihren 100. Geburtstag, und noch mit 119 konnte die mittlerweile etwas schwerhörig und auch sehbehindert gewordene alte Dame sehr klar und verständlich von ihrer Begegnung mit van Gogh erzählen – noch immer auf YouTube zu finden. Und das Video sah ich mir natürlich mehrfach an.
Gegen 15 Uhr verebbte das Getriebe auf dem Platz, die meisten Anwesenden verliefen sich. Am Abend, so hieß es, würde die Welle dann wieder hierherschwappen. Es blieben also einige Stunden Zeit. Ein paar Minuten lang stand er auf dem Platz herum und freute sich über vorbeiströmende Schönheit in weiblicher Form, entschied sich aber dann, dem Hinweis auf die Alfalfa zu folgen, weil die Straße nur wenige Häuserblocks entfernt lag.
Das »La Bodega« an der Ecke zur Candilejo hatte schon geöffnet. Er aß Bällchen aus püriertem Stockfisch, Calamares in Olivenöl gebraten, dazu Pincho-Kartoffeln, dann noch zwei Tapas, deren Bestandteile er aber nicht exakt benennen konnte, trank zwei Gläser Rotwein und blickte aus dem Fenster, denn er hatte sich extra so positioniert, dass die Alfalfa gut im Blick lag. Kurz nach seiner Ankunft blieben ein Mann und eine Frau direkt vorm Fenster stehen. Er konnte sie nicht verstehen, jedoch gestikulierte sie ausgesprochen vielsagend. Die Frau machte eine Bewegung mit dem Zeigefinger, als wollte sie dem Mann ein Auge ausstechen. Der Mann wich ihr lachend aus. Daraufhin warf sie den Kopf in den Nacken und trat mit erhobenen Händen einen Schritt auf ihn zu. Es sah es so aus, als würde sie ihn ohrfeigen wollen. Doch der Mann wich ihr erneut aus und beide verschwanden sie aus dem Blickfeld.
Die Szene hatte etwas in ihm zum Vibrieren gebracht. So, als wäre eigentlich er von ihr gemeint gewesen. Agitierte Frauen empfand er als furchterregend.
Die spanische Policia kündigt sich mit einem fallenden Sirenenton an, Krankenwagen eher mit einem läppisch fistelnden »Daddeldat Daddeldat«. Er hörte beides zur gleichen Zeit, sah aber nur den Krankenwagen, der direkt vor dem Bodega-Fenster hielt. Eine Frau habe sich mit ihrem Mann gestritten, berichtete ein neu eingetroffener Gast, woraufhin der Mann einen Herzinfarkt erlitten hätte. Fand er wenig überraschend. Er leerte sein drittes Glas Wein, bezahlte und trat auf die Straße. Sie war leer – bis auf eine kleine Gruppe jüngerer Leute, die einander mit Bierflaschen in den Händen zuprosteten. Die Polizei war inzwischen weggefahren. Die Nachmittagssonne schien durch einen Spalt zwischen den Häusern und warf einen schmalen Strich vor seine Füße. Mit einem Satz sprang er darüber und bog in die vor ihm liegende dunkle Gasse.
Meine Tante Luise ging bis zum Ende ihres 86. Lebensjahres ins Büro, um dort auszuhelfen; die Kollegen hatten sie weit über das Rentenalter hinaus nicht gehen lassen wollen. Und noch mit 106 kochte sie regelmäßig für ihre vierundachtzigjährige »Jüngste« und stapfte dafür mit einem Rollator zu Edeka, um einzukaufen, denn beides wollte sie sich nicht nehmen lassen. Sie war eine von 13.200 Deutschen über hundert und eine von 350.000 weltweit, also Mitglied eines besonderen Klubs.