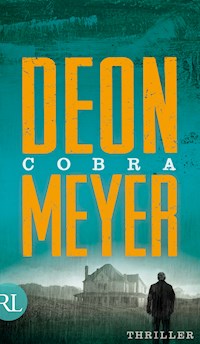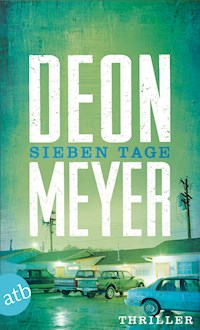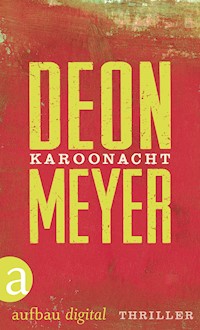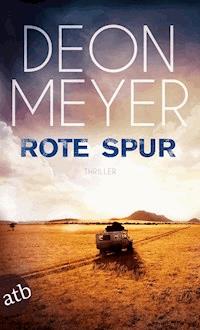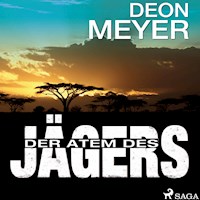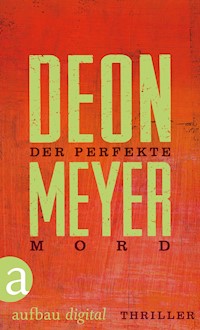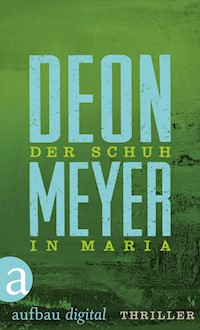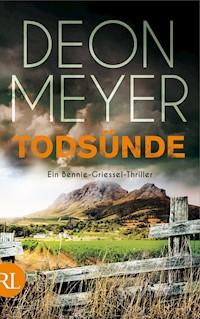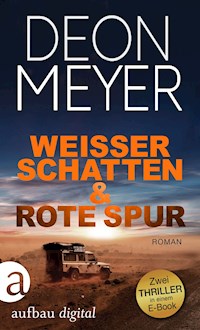9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Benny Griessel Romane
- Sprache: Deutsch
Der Killer von Cape Town.
Bennie Griessel war der beste Mann der Polizei Kapstadts – bis er zu trinken begann. Nun ist er am Ende, seine Frau hat ihn hinausgeworfen. Einzig sein Chef glaubt noch an ihn und übergibt ihm seinen größten Fall: Jemand läuft durch die Stadt und tötet Kinderschänder, die vor Gericht freigekommen sind. In der mysteriösen Christine, die ihr Kind bedroht sieht, findet Griessel eine Verbündete. Und dann nimmt der Fall ungeahnte Dimensionen an ...
„Hochspannend – nicht nur, weil die Handlung atemberaubend ist und weil man sich in die Charaktere verlieben muss, sondern auch, weil es jeden dazu bringt, sein Verständnis von Recht und Gerechtigkeit zu hinterfragen.“ WDR.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 594
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Über das Buch
Der Killer von Cape Town.
Bennie Griessel war der beste Mann der Polizei Kapstadts – bis er zu trinken begann. Nun ist er am Ende, seine Frau hat ihn hinausgeworfen. Einzig sein Chef glaubt noch an ihn und übergibt ihm seinen größten Fall: Jemand läuft durch die Stadt und tötet Kinderschänder, die vor Gericht freigekommen sind. In der mysteriösen Christine, die ihr Kind bedroht sieht, findet Griessel eine Verbündete. Und dann nimmt der Fall ungeahnte Dimensionen an …
»Hochspannend – nicht nur, weil die Handlung atemberaubend ist und weil man sich in die Charaktere verlieben muss, sondern auch, weil es jeden dazu bringt, sein Verständnis von Recht und Gerechtigkeit zu hinterfragen.« WDR.
Über Deon Meyer
Deon Meyer wurde 1958 in Paarl, Südafrika geboren. Seine Romane wurden bisher in 27 Sprachen übersetzt. Er hat auch zahlreiche Drehbücher für Filme und Fernsehserien geschrieben. Deon Meyer lebt in Stellenbosch, in der Nähe von Kapstadt.
Im Aufbau Taschenbuch Verlag liegen seine Thriller »Tod vor Morgengrauen«, »Der traurige Polizist«, »Das Herz des Jägers«, »Der Atem des Jägers«, »Weißer Schatten«, »Dreizehn Stunden«, »Rote Spur«, »Sieben Tage«, »Cobra«, »Icarus« und »Fever« sowie der Storyband »Schwarz. Weiß. Tot« vor.
Zuletzt erschien von ihm bei Rütten & Loening »Die Amerikanerin«.
Mehr zum Autor unter www.deonmeyer.com.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Deon Meyer
Der Atem des Jägers
Roman
Autorisierte Übersetzung aus dem Englischen von Ulrich Hoffmann
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Newsletter
I Christine
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
II Benny
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
III Thobela
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
IV Carla
Kapitel 47
Danksagungen
Impressum
I Christine
1
Bevor der Priester den Pappkarton öffnete, stand die Welt für einen Augenblick still, und sie sah alles mit größerer Klarheit. Der kräftig gebaute Mann mochte etwa vierzig Jahre alt sein und hatte einen karoförmigen Leberfleck auf der Wange, der aussah wie eine zerquetschte Träne von blassem Rosa. Sein Gesicht war kantig und kraftvoll, sein sich lichtendes Haar zurückgekämmt, seine Hände waren groß und rauh wie die eines Boxers. Das Buchregal hinter ihm verwandelte die ganze Wand in ein Mosaik bunter Buchrücken. Es war ein Spätnachmittag im Freistaat, und die Sonne warf einen scharfen Lichtstrahl auf den Schreibtisch, einen magischen Sonnenkegel auf den Pappkarton.
Sie preßte die Hände leicht auf ihre nackten, kühlen Knie. Ihre Handflächen waren feucht, ihr Blick suchte nach der leichtesten Veränderung seines Ausdrucks, aber sie sah nur die Ruhe und vielleicht eine geringe, unterdrückte Neugier darüber, was in der Kiste steckte. Direkt bevor er die Deckel beiseite klappte, versuchte sie sich zu sehen, wie er sie sah – versuchte den Eindruck einzuschätzen, den sie sich zu erwecken bemühte. Die Läden in der Stadt waren keine Hilfe gewesen, sie mußte mit dem arbeiten, was sie hatte. Ihr Haar war lang, glatt und frisch gewaschen, die bunte, ärmellose Bluse vielleicht für den Anlaß ein klein wenig zu eng. Ein weißer Rock, der knapp über ihre Knie rutschte, wenn sie saß. Ihre Beine waren ebenmäßig und schön. Sie trug weiße Sandalen mit kleinen goldenen Schnallen. Ihre Zehennägel waren nicht lackiert, darauf hatte sie geachtet. Nur ein einziger Ring, ein kleiner Goldstreifen an ihrer rechten Hand. Leichtes Make-up, das ein ganz klein wenig die Fülle ihrer Lippen herunterspielte.
Nichts konnte sie verraten. Außer ihren Augen und ihrer Stimme.
Er öffnete die Deckelklappen, eine nach der anderen, und ihr fiel auf, daß sie an der Kante des Sessels saß und sich vorbeugte. Sie wollte sich zurücklehnen, aber nicht jetzt, jetzt wollte sie seine Reaktion sehen.
Die zweite Deckelklappe bog sich zur Seite, die Kiste stand offen.
»Grundgütiger Himmel«, sagte er und erhob sich halb.
Er schaute sie an, schien sie aber nicht zu sehen und wandte sich wieder der Kiste zu. Er langte mit einer seiner großen Pranken hinein, holte etwas heraus, hielt es ins Sonnenlicht. »Grundgütiger Himmel«, wiederholte er, und seine Finger tasteten nach Echtheit.
Sie saß regungslos da. Sie wußte, daß von seiner Reaktion alles abhing. Ihr Herz klopfte, so daß sie es beinahe hören konnte.
Er legte den Gegenstand zurück in die Kiste, zog seine Hände heraus, ließ den Deckel offen stehen. Er setzte sich wieder, nahm einen tiefen Atemzug, als wollte er sich beruhigen, dann schaute er sie an. Was dachte er? Was?
Dann schob er die Kiste zur Seite, als wollte er nicht, daß sie zwischen ihnen stünde.
»Ich habe Sie gestern gesehen. In der Kirche.«
Sie nickte. Sie war da gewesen – um ihn einzuschätzen. Um zu sehen, ob er sie bemerken würde. Aber das war unmöglich gewesen, da sie ohnehin geradezu für Aufruhr gesorgt hatte – eine fremde junge Frau in einer Kleinstadtkirche. Er hatte gut gepredigt, leidenschaftlich, mit Liebe in der Stimme, nicht so dramatisch und förmlich wie die Priester ihrer Jugend. Als sie die Kirche verlassen hatte, war sie sicher, daß es gut gewesen war, hierherzukommen. Aber jetzt war sie nicht mehr so sicher … Er wirkte verärgert.
»Ich …«, sagte sie, suchte in Gedanken nach den richtigen Worten.
Er beugte sich vor. Er wollte eine Erklärung; das konnte sie gut verstehen. Seine Arme und Finger bildeten eine Gerade am Rande seines Schreibtisches, vom Ellenbogen bis zu den verschränkten Fingern, die flach auf dem Tisch lagen. Er trug ein Anzughemd, das am Kragen aufgeknöpft war, hellblau mit schmalen roten Streifen. Seine Ärmel waren hochgekrempelt, das Sonnenlicht schien auf die Haare der Unterarme. Von draußen waren die nachmittäglichen Geräusche eines Wochentags in der Kleinstadt zu hören – die Menschen in Sotho begrüßten sich über die Straße hinweg, der städtische Traktor beschleunigte – duh-duh-duh – zum Lager hin, die Grillen zirpten, ein Hammer traf auf eine Radfelge, und zwei Hunde bellten sinnlos gegen das Gehämmere an.
»Ich muß Ihnen viel erzählen«, sagte sie, und ihre Stimme klang klein und verloren.
Schließlich rührte er sich, öffnete seine Hände.
»Ich weiß kaum, wo ich anfangen soll.«
»Beginnen Sie am Anfang«, sagte er sanft, und sie wollte in seinem Mitgefühl baden.
»Am Anfang.« Sie nickte, und ihre Stimme gewann an Stärke. Ihre Finger griffen nach dem langen blonden Haar, das ihr über die Schulter hing, und schoben es mit einer geübten, rhythmischen Bewegung nach hinten.
2
Für Thobela Mpayipheli begann alles spät an einem Samstagnachmittag an einer Tankstelle in Cathcart.
Pakamile saß hinter ihm, acht Jahre alt, gelangweilt und müde. Der lange Weg von Amersfoort lag hinter ihnen, sieben Stunden Fahrt. Als sie an der Tankstelle hielten, seufzte der Junge. »Noch ganze sechzig Kilometer?«
»Nur noch sechzig Kilometer«, sagte Thobela beruhigend. »Möchtest du etwas Kaltes trinken?«
»Nein, danke«, sagte der Junge und hob die Halbliter-Colaflasche, die zu seinen Füßen gelegen hatte. Sie war noch nicht leer.
Thobela hielt vor den Tanksäulen und stieg aus dem Bakkie. Kein Tankwart in Sicht. Er reckte und streckte sich, ein großer Schwarzer in Jeans, rotem Hemd und Laufschuhen. Er ging um den Wagen herum und überprüfte, daß die Motorräder auf der Ladefläche immer noch fest verzurrt waren – Pakamiles kleine KX 65 und seine große BMW. Sie hatten am Wochenende gelernt, im Gelände zu fahren, ein offizieller Kurs durch Sand und Kies, Wasser, Hügel, Unebenheiten, Bachbetten und Täler. Er hatte gesehen, wie die Selbstsicherheit des Jungen von Stunde zu Stunde zunahm, die Begeisterung glühte heller mit jedem Ruf: »Sieh nur, Thobela, was ich kann!«
Sein Sohn …
Wo war der Tankwart?
An einer weiteren Tanksäule stand noch ein Wagen, ein weißer Polo – der Motor lief, aber es saß niemand im Wagen. Eigenartig. Thobela rief: »Hallo!« Er sah eine Bewegung im Gebäude. Jetzt kamen sie wohl.
Er wandte sich um, wollte die Motorhaube des Bakkies öffnen, schaute zum Horizont im Westen, wo die Sonne unterging … Bald würde es dunkel. Da hörte er den ersten Schuß. Er donnerte durch die Stille des frühen Abends und Thobela zuckte erschrocken zusammen und ging instinktiv in die Knie. »Pakamile!« rief er. »Runter!« Aber seine Worte wurden übertönt durch einen weiteren Schuß und noch einen, und dann sah er sie zur Tür herauslaufen – zwei Männer, Pistolen in Händen, einer trug eine weiße Plastiktüte, sein Blick war wild. Sie entdeckten ihn, schossen. Kugeln klatschten in die Tanksäule, in den Bakkie.
Er schrie, ein tiefes Röhren, dann sprang er hoch, riß die Autotür auf und hechtete hinein; er versuchte den Jungen vor den Kugeln zu schützen. Er spürte den kleinen Körper zittern. »Okay«, sagte er und hörte die Schüsse, das Blei flog über sie hinweg. Er hörte eine Wagentür zuknallen, dann eine weitere, schließlich Reifenquietschen. Er schaute auf – der Polo fuhr zur Straße. Noch ein Schuß. Das Glas einer Werbetafel über ihm zerbarst und prasselte auf den Bakkie herunter. Dann waren sie auf der Straße, der Motor des Volkswagens jaulte, und er murmelte: »Es ist okay, okay«, und er spürte die Feuchtigkeit auf seiner Hand, und Pakamile hatte aufgehört zu zittern, und er sah das Blut auf dem Körper des Jungen und sagte: »Nein, Gott, nein.«
So begann es alles für Thobela Mpayipheli.
Er saß im Zimmer des Jungen auf dem Bett. Der Zettel in seiner Hand war der letzte Beweis.
Im Haus war es grabesstill, zum ersten Mal, seit er zurückdenken konnte. Vor zwei Jahren hatten Pakamile und er die Tür aufgedrückt und das staubige Innere in Augenschein genommen, die leeren Zimmer. Die Glühbirnen hingen schief von der Decke, Küchenschränke waren zerbrochen oder standen offen, aber sie beide sahen bloß die Möglichkeiten, das Versprechen ihres neuen Hauses oberhalb des Cata River, inmitten der grünen Felder, im Hochsommer. Der Junge war durch das Haus gelaufen und hatte Fußabdrücke im Staub hinterlassen. »Das hier ist mein Zimmer, Thobela«, hatte er durch den Flur gerufen. Als er das Elternschlafzimmer erreichte, hatte er beeindruckt über die Größe des Raumes gepfiffen. Denn er kannte bloß ein winziges Vier-Zimmer-Haus in den Townships der Cape Flats.
In jener ersten Nacht hatten sie auf der Veranda geschlafen. Zuerst hatten sie zugeschaut, wie die Sonne hinter Gewitterwolken versank und die Dämmerung über das Land hereinbrach, sie hatten zugesehen, wie die Schatten der großen Bäume neben dem Tor mit der Dunkelheit verschmolzen und die Sterne magisch ihre silbernen Augen am himmlischen Firmament öffneten. Er und der Junge, eng aneinandergedrückt, mit ihren Rücken an der Wand.
»Hier ist es wunderschön, Thobela.«
Tiefe Zufriedenheit lag in Pakamiles Seufzen, und Thobela war unendlich erleichtert, denn erst einen Monat zuvor war die Mutter des Jungen gestorben, und er hatte nicht wissen können, wie er auf die Veränderung der Umstände und der Umgebung reagieren würde.
Sie sprachen über Vieh, das sie kaufen wollten, ein oder zwei Milchkühe, ein paar Hühner (»… und einen Hund, Thobela, bitte, einen großen alten Hund«). Ein Gemüsegarten vor der Hintertür. Luzerne unten am Flußufer. Sie hatten in jener Nacht ihre Träume geträumt, bis Pakamiles Kopf gegen seine Schulter gesunken war und er den Jungen sanft auf die Decke auf den Boden gelegt hatte. Er hatte ihn auf die Stirn geküßt und gesagt: »Gute Nacht, mein Sohn.«
Pakamile war nicht sein eigener Sohn. Er war der Sohn der Frau, die er geliebt hatte, und so war der Junge zu seinem Sohn geworden. Sehr schnell hatte er begonnen, ihn zu lieben wie sein eigen Fleisch und Blut, und in den Monaten nach dem Umzug hatte er mit dem langen Prozeß begonnen, das offiziell zu machen – er hatte Briefe geschrieben, Formulare ausgefüllt und sich befragen lassen. Langsame Bürokraten mit merkwürdigen Ansichten mußten entscheiden, ob er geeignet war, ein Elternteil darzustellen, wo doch die ganze Welt sehen konnte, daß die Verbindung zwischen ihnen unzerbrechlich geworden war. Aber schließlich, nach vierzehn Monaten, waren die offiziellen Unterlagen angekommen, die in langatmiger, umständlicher Behördensprache den Segen für die Adoption gaben.
Und jetzt waren diese gelbweißen Blätter alles, was er noch hatte. Sie und ein Häufchen Erde unter den Pfefferbäumen am Fluß. Und die Worte des Priesters, die ihm helfen sollten: »Gott tut nichts ohne Grund.«
Herr, wie er den Jungen vermißte.
Er konnte nicht begreifen, daß er nie wieder sein Kichern hören würde. Oder seine Schritte im Flur. Niemals langsam, immer eilig, als wäre das Leben zu kurz zum Gehen. Oder wie der Junge seinen Namen von der Haustür aus rief, die Stimme voll Begeisterung über irgendeine Neuentdeckung. Er konnte sich nicht vorstellen, daß er niemals wieder spüren würde, wie sich Pakamiles Arme um ihn schlangen. Das mehr als alles andere – der Kontakt, die vollkommene Akzeptanz, die vorbehaltlose Liebe.
Es war seine Schuld.
Es gab keinen Moment des Tages oder der Nacht, in dem er nicht an die Ereignisse an der Tankstelle dachte und sie voller Selbsthaß wieder und wieder durchging. Er hätte es sofort begreifen müssen, als er den Polo im Leerlauf an der Tanksäule stehen sah. Er hätte schneller reagieren müssen, als er den ersten Schuß hörte, da hätte er sich schon über den Jungen werfen müssen, er hätte ein Schild sein müssen, er hätte die Kugel abbekommen müssen. Er. Es war seine Schuld.
Der Verlust war wie ein schwerer Stein in ihm, eine unerträgliche Last. Was sollte er jetzt tun? Wie konnte er leben? Er konnte sich nicht einmal Morgen vorstellen, weder das Gefühl noch die Möglichkeit an sich. Im Wohnzimmer klingelte das Telefon, aber er wollte nicht aufstehen – er wollte hier bei Pakamiles Sachen bleiben.
Er bewegte sich langsam, war eingezwängt von Gefühlen. Warum konnte er nicht weinen? Das Telefon klingelte. Warum konnte er nicht trauern?
Plötzlich hielt er den Hörer in der Hand und die Stimme fragte: »Mr. Mpayipheli? Wir haben sie, Mr. Mpayipheli. Wir haben sie gefangenengenommen. Wir möchten, daß Sie die Männer identifizieren.«
Später öffnete er den Safe und legte die Unterlagen vorsichtig ganz oben hinein. Darunter seine Feuerwaffen, alle drei: Pakamiles Luftgewehr, die .22er und das Jagdgewehr. Er nahm das Gewehr und ging in die Küche.
Als er die Waffe methodisch und konzentriert reinigte, wurde ihm langsam klar, daß Schuld und Verlust nicht alles waren, was er empfand.
»Ich frage mich, ob er gläubig war«, sagte sie. Der Priester hörte ihr aufmerksam zu. Sein Blick wanderte nicht mehr länger zu der Kiste hinüber.
»Im Gegensatz zu mir.« Diese Referenz auf sich war ungeplant, und sie fragte sich für einen Moment, warum sie es gesagt hatte. »Vielleicht ging er nicht in die Kirche oder so, aber möglicherweise war er gläubig. Und vielleicht konnte er nicht verstehen, warum ihm der Herr erst gab und dann wieder nahm. Erst seine Frau, dann auf der Farm sein Kind. Er dachte, er würde bestraft. Ich frage mich, warum? Warum denken das alle, wenn etwas Schlimmes geschieht? Ich auch. Das ist doch merkwürdig. Ich habe auch nie herausgefunden, wofür ich bestraft wurde.«
»Als Ungläubige?« fragte der Priester.
Sie zuckte mit den Achseln. »Ja. Ist das nicht komisch? Als trügen wir die Schuld in uns. Manchmal frage ich mich, ob wir für die Dinge bestraft werden, die wir in der Zukunft tun werden. Denn meine Sünden kamen erst später, lange nachdem ich bestraft worden war.«
Der Priester schüttelte den Kopf und holte Atem, als wollte er antworten, aber sie wollte jetzt nicht abgelenkt werden, sie wollte nicht den Rhythmus ihrer Geschichte verlieren.
Sie waren unerreichbar. Acht Männer standen hinter einem Einwegspiegel, aber Thobela konnte sich nur auf die beiden konzentrieren, die er so haßte. Sie waren jung und schauten herausfordernd gleichgültig, ihre Münder formten ein rotziges Grinsen, ihr Blick starrte arrogant in Richtung des Spiegels. Einen Augenblick dachte er daran, zu behaupten, daß er keinen von ihnen erkannte, und dann mit dem Jagdgewehr vor der Polizeiwache auf sie zu warten … Aber er war nicht darauf vorbereitet, er hatte die Ausgänge und Straßen nicht beachtet. Er hob seinen Finger wie einen Gewehrlauf und sagte zu dem Superintendent: »Da sind sie, Nummer drei und Nummer fünf.« Er erkannte den Klang seiner eigenen Stimme nicht, es waren die Worte eines Fremden.
»Sind Sie sicher?«
»Todsicher«, sagte er.
»Drei und fünf?«
»Drei und fünf.«
»Das haben wir uns gedacht.«
Sie baten ihn, eine Aussage zu unterschreiben. Mehr konnte er nicht tun. Er ging zu seinem Bakkie, schloß die Tür auf und stieg ein, er war sich des Gewehrs hinter dem Sitz bewußt, dachte an die beiden Männer irgendwo in dem Gebäude. Er saß da und fragte sich, was der Superintendent tun würde, wenn er fragte, ob er kurz mit ihnen allein sein könnte, denn er verspürte den Drang, ihnen eine lange Klinge in die Herzen zu stoßen. Sein Blick ruhte einen Moment auf der Eingangstür der Polizeiwache, dann drehte er den Schlüssel im Zündschloß und fuhr langsam davon.
3
Die Staatsanwältin war eine Xhosa, und ihr Büro war voller blaßgelber Akten, die sie zu bearbeiten hatte. Sie lagen überall herum. Der Schreibtisch war voll davon, die Stapel okkupierten zwei Tische und den Boden, sie mußten wie die Störche zu ihren Sesseln staksen. Sie wirkte deprimiert und ein wenig geistesabwesend, als wäre ihre Aufmerksamkeit verteilt auf die zahllosen Fälle, als wäre die Verantwortung ihrer Aufgabe manchmal zu schwer für sie.
Sie erklärte. Sie war diejenige, die Anklage erheben würde. Sie mußte ihn auf seine Zeugenaussage vorbereiten. Gemeinsam mußten sie den Richter überzeugen, daß die Angeklagten schuldig waren.
Das wäre leicht, sagte er.
Es ist nie leicht, entgegnete sie und rückte ihre große Goldrandbrille mit den Spitzen von Daumen und Zeigefinger zurecht, als könnte sie niemals wirklich gut sitzen. Sie befragte ihn über den Tag, an dem Pakamile gestorben war, wieder und wieder, bis sie alles durch seine Augen sehen konnte. Als sie fertig waren, fragte er, welche Strafe der Richter verhängen würde.
»Falls sie schuldig gesprochen werden?«
»Wenn sie schuldig gesprochen werden«, entgegnete er zuversichtlich.
Sie rückte ihre Brille zurecht und sagte, das könnte man nie vorhersagen. Einer von ihnen, Khoza, war bereits vorbestraft. Aber es war Rampheles erstes Vergehen. Und man dürfte nicht vergessen, daß sie das Kind nicht absichtlich getötet hatten. »Nicht absichtlich?«
»Sie werden aussagen, daß sie das Kind nicht einmal gesehen haben. Nur Sie.«
»Was für eine Strafe werden sie bekommen?«
»Zehn Jahre. Fünfzehn? Das kann ich nicht sagen.«
Er starrte sie einen langen Augenblick lang an.
»So ist das System«, sagte sie und zuckte mit den Achseln, als wollte sie sich entschuldigen.
Am Tag vor der Gerichtsverhandlung fuhr er mit seinem Bakkie nach Umtata, weil er ein paar Krawatten, ein Jackett und schwarze Schuhe kaufen mußte.
In seinen neuen Klamotten stand er vor dem langen Spiegel. Der Verkäufer sagte: »Das sieht phantastisch aus«, aber er erkannte sich nicht im Spiegelbild – das Gesicht war ihm unbekannt, und der Bart, der auf seinen Wangen sproß, seit der Junge gestorben war, bedeckte dicht und grau Kinn und Schläfen. Er sah harmlos aus, weise und unerschütterlich.
Die Augen faszinierten ihn. Waren das seine? Sie reflektierten kein Licht, als wären sie im Inneren leer und tot.
Am späten Nachmittag lag er auf seinem Hotelbett, die Arme hinter dem Kopf verschränkt, regungslos.
Er erinnerte sich: Pakamile im Schuppen hinter dem Haus, er melkte zum ersten Mal eine Kuh, drückte zu fest, hatte es zu eilig. War frustriert, daß die Zitzen nicht auf das Gezappel seiner kleinen Finger reagierten. Und dann war doch noch ein dünner weißer Strahl hervorgeschossen, spritzte auf den Boden des Schuppens, und der Junge jubelte stolz: »Thobela! Sieh nur!«
Das kleine Männchen in der Schuluniform, das jeden Nachmittag auf ihn wartete, Socken auf Halbmast, die Hemdzipfel hingen aus der Hose, der Schulranzen war unnatürlich groß. Die Freude jeden Tag, wenn er vorfuhr. Wenn er auf dem Motorrad kam, schaute Pakamile sich zuerst um, denn er wollte sehen, ob seine Freunde das außerordentliche Ereignis beobachten konnten, diese einzigartige Maschine, mit der nur er das Recht hatte, nach Hause zu fahren.
Manchmal übernachteten seine Freunde bei ihnen; vier, fünf, sechs Jungen, die mit Pakamile über die Farm streiften. »Mein Vater und ich haben das ganze Gemüse selbst gepflanzt.« »Das ist das Motorrad meines Vaters, und das hier ist meins.« »Mein Vater hat all diese Luzerne selbst gepflanzt, Wahnsinn.« Ein Freitagabend … alle im Weihnachtsbett im Wohnzimmer, zusammengequetscht wie Sardinen in der Dose. Das Haus bebte vor Leben. Das Haus war voll. Voll.
Die Leere des Zimmers um ihn herum überwältigte ihn. Die Stille, der Kontrast. Irgendwo in ihm stellte er sich die Frage: Was nun? Er versuchte sie durch Erinnerungen zu ersticken, aber sie hallte trotzdem wider. Er dachte lange darüber nach, aber er wußte, ohne es genau formulieren zu können, daß Miriam und Pakamile sein Leben gewesen waren. Und jetzt war da nichts.
Er erhob sich einmal, um sich zu erleichtern und Wasser zu trinken, dann legte er sich wieder hin. Die Klimaanlage zischte und gurgelte unterhalb des Fensters. Er starrte an die Decke und wartete, daß die Nacht verging und der Prozeß anfing.
Die Angeklagten saßen Seite an Seite: Khoza und Ramphele. Sie schauten ihm in die Augen. Neben ihnen erhob sich der Verteidiger, ein Inder, groß gewachsen und athletisch schlank, elegant in einem modisch schwarzen Anzug und mit lilafarbener Krawatte.
»Mr. Mpayipheli, als die Staatsanwältin Sie fragte, was Ihr Beruf sei, sagten Sie, Sie seien Farmer.«
Er antwortete nicht, denn es war keine Frage.
»Ist das richtig?« Der Inder hatte eine beruhigende Stimme, so intim, als wären sie alte Freunde.
»Allerdings.«
»Aber es ist nicht die ganze Wahrheit, oder?«
»Ich weiß nicht, was …«
»Wie lange sind Sie schon ein sogenannter Farmer, Mr. Mpayipheli?«
»Zwei Jahre.«
»Und welchen Beruf haben sie ausgeübt, bevor Sie Farmer wurden?«
Die Staatsanwältin, die ernste Frau mit der Goldrandbrille, erhob sich. »Einspruch, Euer Ehren. Mr. Mpayiphelis Lebenslauf ist irrelevant für diese Gerichtsverhandlung.«
»Euer Ehren, diese Informationen über den Zeugen sind nicht nur relevant für seine Zuverlässigkeit als Zeuge, sondern auch für sein Verhalten an der Tankstelle. Die Verteidigung hat ernsthafte Zweifel an Mr. Mpayiphelis Bericht über die Ereignisse.«
»Ich erlaube Ihnen, fortzufahren«, sagte der Richter, ein weißer Mann mittleren Alters mit einem Doppelkinn und roter Haut. »Beantworten Sie die Frage, Mr. Mpayipheli.«
»Welchen Beruf haben Sie ausgeübt, bevor Sie Farmer wurden?« wiederholte der Anwalt.
»Ich habe als Aushilfe bei einem Motorradhändler gearbeitet.«
»Wie lange?«
»Zwei Jahre.«
»Und davor?«
Sein Herz begann zu rasen. Er wußte, daß er nicht zögern, nicht unsicher wirken dürfte.
»Ich war Bodyguard.«
»Bodyguard.«
»Ja.«
»Lassen Sie uns noch einen Schritt weiter zurückgehen, Mr. Mpayipheli, bevor wir zu Ihrer Antwort zurückkehren. Was haben Sie getan, bevor Sie, wie Sie sagen, Bodyguard waren?«
Wo hatte der Mann nur diese Informationen her? »Ich war Soldat.«
»Soldat.«
Thobela antwortete nicht. Ihm war heiß in Anzug und Krawatte. Er spürte, wie der Schweiß ihm über den Rücken lief. Der Inder blätterte in den Unterlagen, die vor ihm auf dem Tisch lagen, und zog dann ein paar Papiere heraus. Er ging hinüber zur Staatsanwältin und gab ihr eine Kopie. Dann reichte er eine dem Richter und legte eine vor Thobela.
»Mr. Mpayipheli, wäre es angemessen, zu behaupten, daß Sie zu Euphemismen neigen?«
»Einspruch, Euer Ehren, die Verteidigung versucht, den Zeugen einzuschüchtern, und die Richtung dieser Fragen ist darüber hinaus irrelevant.« Sie hatte sich das Papier angesehen und begann unsicher zu wirken. Ihre Stimme klang schriller.
»Einspruch abgelehnt. Fahren Sie fort.«
»Mr. Mpayipheli, Sie und ich können dieses Spiel den ganzen Tag lang spielen, aber ich habe zu großen Respekt vor diesem Gericht, um das zu tun. Lassen Sie mich Ihnen helfen. Ich habe hier einen Zeitungsbericht« – er hob die Fotokopie in die Luft – »in dem steht, ich zitiere: ›Mpayipheli, ein ehemaliger Umkhonto-We-Sizwe-Soldat, der eine Sonderausbildung in Rußland und in der ehemaligen DDR genoß, stand bis vor kurzem mit Drogenbanden in den Cape Flats in Verbindung …‹ Zitatende. Der Artikel bezieht sich auf einen gewissen Thobela Mpayipheli, der vor zwei Jahren von der Polizei gesucht wurde im Zusammenhang mit, und ich zitiere noch einmal, ›streng vertraulichen geheimdienstlichen Unterlagen‹.«
Bevor die Staatsanwältin aufsprang, warf sie Thobela einen bösen Blick zu, als hätte er sie betrogen. »Euer Ehren, ich muß protestieren. Der Zeuge steht nicht unter Anklage …«
»Mr. Singh, bezwecken Sie etwas mit Ihren Fragen?«
»Allerdings, Euer Ehren. Ich bitte nur noch um einen Augenblick Geduld.«
»Fahren Sie fort.«
»Geht es in diesem Zeitungsartikel um Sie, Mr. Mpayipheli?«
»Ja.«
»Entschuldigen Sie, ich kann Sie nicht hören.«
»Ja.« Lauter.
»Mr. Mpayipheli, ich gehe davon aus, daß Ihr Bericht von den Ereignissen an der Tankstelle genauso ausweichend und euphemistisch ausgefallen ist wie die Beschreibung Ihres Lebenslaufes.«
»Das ist …«
»Sie sind ein ausgezeichnet ausgebildeter Soldat, Sie wurden geschult in Nahkampf, terroristischem Vorgehen und Guerillataktiken.«
»Einspruch, Euer Ehren – das ist keine Frage.«
»Einspruch abgewiesen. Lassen Sie ihn ausreden, Madam.«
Sie setzte sich und schüttelte den Kopf, eine tiefe Stirnfalte bildete sich hinter ihrer Goldrandbrille. »Wie es dem Gericht beliebt«, sagte sie, aber ihr Ton verriet, daß sie das Gegenteil meinte.
»Und dann waren Sie zwei Jahre lang ›Bodyguard‹ für ein Drogenkartell am Kap. Ein Bodyguard. So steht es nicht in der Zeitung …«
Die Staatsanwältin erhob sich, aber der Richter kam ihr zuvor: »Mr. Singh, Sie beanspruchen die Geduld des Gerichts. Wenn Sie ein Plädoyer halten wollen, warten Sie bitte, bis der Zeitpunkt gekommen ist.«
»Ich entschuldige mich ausdrücklich, Euer Ehren, aber es ist eine Beleidigung für die Prinzipien der Gerechtigkeit, daß ein Zeuge unter Eid eine Geschichte erfindet …«
»Mr. Singh, ersparen Sie mir das! Wie lautet Ihre Frage?«
»Wie es dem Gericht beliebt, Eurer Ehren. Mr. Mpayipheli, was war das genaue Ziel ihrer militärischen Ausbildung?«
»Das ist zwanzig Jahre her.«
»Bitte beantworten Sie die Frage.«
»Ich wurde als Gegenspion ausgebildet.«
»Auch in der Benutzung von Feuerwaffen und Explosivstoffen?«
»Ja.«
»Kampf Mann gegen Mann?«
»Ja.«
»Handlungsfähigkeit in Streßsituationen erhalten?«
»Ja.«
»Beseitigung und Flucht.«
»Ja.«
»An der Tankstelle aber haben Sie sich, und ich zitiere, ›hinter die Tanksäule geduckt‹, als Sie die Schüsse hörten?«
»Der Krieg ist zehn Jahre her! Ich war nicht dort, um zu kämpfen, ich wollte nur tanken …«
»Der Krieg war für Sie vor zehn Jahren nicht zu Ende, Mr. Mpayipheli, Sie haben den Krieg in Form Ihrer Ausbildung im Töten in die Cape Flats getragen. Sprechen wir einmal über Ihre Aufgaben als Bodyguard …«
Die Stimme der Staatsanwältin war schrill und flehend. »Euer Ehren, ich erhebe ausdrücklich Einspruch gegen …« In diesem Moment sah Thobela die Gesichter der Angeklagten; sie lachten ihn aus.
»Einspruch stattgegeben. Mr. Singh, es reicht. Sie haben Ihre Sicht der Dinge klargestellt. Haben Sie irgendwelche Fragen über den Ablauf der Ereignisse an der Tankstelle?«
Singhs Schultern sackten herunter, als wäre er verletzt. »Wie es dem Gericht beliebt, Euer Ehren, die habe ich.«
»Dann stellen Sie sie.«
»Mr. Mpayipheli, haben Sie vergessen, daß Sie derjenige waren, der die Angeklagten angegriffen hat, als sie die Tankstelle verließen?«
»Absolut nicht.«
»Sie haben das nicht vergessen?«
»Euer Ehren, die Verteidigung …«
»Mr. Singh!«
»Euer Ehren, der Angeklagte … entschuldigen Sie, der Zeuge weicht der Frage aus.«
»Nein, Mr. Singh, Sie sind derjenige, der den Zeugen bedrängt.«
»Nun gut. Mr. Mpayipheli, Sie sagen, Sie haben die Angeklagten nicht bedroht?«
»Das habe ich nicht.«
»Sie hatten keinen Wagenheber oder etwas Ähnliches …«
»Einspruch, Euer Ehren, der Zeuge hat die Frage bereits beantwortet.«
»Mr. Singh …«
»Ich habe keine weiteren Fragen an diesen Lügner, Euer Ehren …«
4
»Ich denke, er glaubte, er könnte alles in Ordnung bringen. Alles«, sagte sie in dem dämmrigen Zimmer. Die Sonne war hinter den Hügeln der Stadt versunken, und das Licht, das in den Raum drang, war sanfter geworden. So fiel es ihr leichter zu erzählen, dachte sie, und fragte sich, warum.
»Das ist das, was ich am meisten bewundert habe. daß jemand aufgestanden ist und etwas getan hat, wovor wir anderen uns fürchten, auch wenn wir es tun wollen. Ich hatte nie den Mut dazu. Ich war zu verängstigt, um mich zu wehren. Und dann habe ich in der Zeitung von ihm gelesen und begann mich zu fragen: Vielleicht kann ich auch …«
Sie zögerte einen Moment, dann fragte sie mit angehaltenem Atem: »Wissen Sie von Artemis, Hochwürden?«
Zuerst reagierte er nicht, er saß regungslos da, leicht nach vorn gebeugt, fasziniert von der Geschichte, die sie erzählte. Dann zwinkerte er, konzentrierte sich.
»Artemis? Äh, ja …«, sagte er zögernd.
»Über den die Zeitungen geschrieben haben.«
»Die Zeitungen …« Es schien ihm peinlich zu sein. »Manche Dinge gehen an mir vorbei. Jede Woche etwas Neues. Ich bin nicht immer auf dem laufenden.«
Darüber war sie erleichtert. Ihre Rollen hatten sich ein ganz klein wenig verschoben – er war ein Kleinstadt-Priester, sie war weltgewandt, sie wußte Bescheid. Sie streifte die Sandale von einem ihrer Füße und schlug ihn unter, suchte eine bequemere Position im Sessel. »Ich werde Ihnen davon erzählen«, erklärte sie selbstsicherer.
Er nickte.
»Ich war in Schwierigkeiten, als ich das erste Mal von ihm las. Ich war in Kapstadt. Ich war …« Sie zögerte den Bruchteil einer Sekunde und fragte sich, ob es ihn empören würde. »Ich war eine Prostituierte.«
Um halb elf in jener Nacht lag er noch wach auf seinem Hotelbett, als jemand leise an seiner Tür klopfte, entschuldigend. Es war die Staatsanwältin, ihre Augen groß hinter den Brillengläsern.
»Tut mir leid«, sagte sie, aber sie sah bloß müde aus.
»Kommen Sie herein.«
Sie zögerte einen Moment, und er wußte, warum: Er trug nur seine Shorts, sein Körper glänzte vor Schweiß. Er drehte sich um und griff nach seinem T-Shirt, er bedeutete ihr, sich in den einzigen Sessel zu setzen. Er nahm am Fußende des Bettes Platz.
Sie setzte sich auf die Sesselkante; ihre Hände faltete sie in den dunklen Stoff ihres Rocks über den stämmigen Beinen. Sie wirkte angespannt, als wäre sie gekommen, um wichtige Dinge zu besprechen.
»Was ist da heute vor Gericht passiert?« fragte er.
Sie zuckte mit den Achseln.
»Er wollte mir die Schuld geben. Der Inder.«
»Er hat bloß seine Arbeit getan. Das ist alles.«
»Seine Arbeit?«
»Er muß sie verteidigen.«
»Mit Lügen?«
»Vor Gericht gibt es keine Lügen, Mr. Mpayipheli. Bloß verschiedene Versionen der Wahrheit.«
Er schüttelte den Kopf. »Es gibt nur eine Wahrheit.«
»Glauben Sie wirklich? Und welches ist dann diese eine Wahrheit über Sie? Daß Sie Farmer sind? Vater? Soldat? Oder Drogendealer? Ein Flüchtling, der von der Polizei gesucht wird?«
»Das hat alles nichts mit Pakamiles Tod zu tun«, sagte er, und die Wut schlich sich in seine Stimme.
»Als Singh es vor Gericht aufgebracht hat, wurde es Teil seines Todes, Mr. Mpayipheli.«
Wut überflutete ihn, er war unvorstellbar frustriert. »Es heißt immer Mister hier, Mister da, alle sind so höflich und erheben Einspruch und spielen ihre kleinen juristischen Spiele … Und die zwei sitzen da und lachen.«
»Deswegen bin ich hergekommen«, sagte sie. »Um Ihnen zu sagen: Sie sind entkommen.«
Er wußte nicht, wie lange er dasaß und sie anstarrte.
»Einer von ihnen hat einen Polizisten übermannt. In der Zelle, als er ihnen Essen brachte. Er hatte eine Waffe, ein Messer.«
»Übermannt«, sagte er, als schmeckte er das Wort.
»Die Polizei … Sie haben nicht genug Leute. Es sind nicht alle zur Schicht gekommen.«
»Sie sind beide entkommen.«
»Es gibt Straßensperren. Der Stationschef sagt, sie werden nicht weit kommen.«
Die Wut in ihm nahm ein anderes Gesicht an, von dem er nicht wollte, daß sie es bemerkte. »Wo können sie hin?«
Die Staatsanwältin zuckte noch einmal mit den Achseln, als wäre es ihr vollkommen egal. »Wer weiß?«
Als er nicht antwortete, beugte sie sich vor. »Ich wollte es Ihnen sagen. Sie haben das Recht, es zu wissen.«
Sie erhob sich. Er wartete, bis sie an ihm vorbei war, dann stand er auf und folgte ihr bis zur Tür.
Zweifel zeichnete sich auf dem Gesicht des Priesters ab. Er hatte seinen mächtigen Körper zurückgelehnt und den Kopf schräg gelegt, als wartete er darauf, daß sie ihre Aussage bewies, oder vielleicht darauf, daß sie den Satz mit einer Pointe zu Ende brachte.
»Sie glauben mir nicht.«
»Ich finde das … unwahrscheinlich.«
Irgendwo verspürte sie ein Gefühl. Dankbarkeit? Erleichterung? Sie hatte es nicht zeigen wollen, aber ihre Stimme verriet sie. »Mein Szenename war Bibi.«
Seine Stimme war geduldig, als er antwortete. »Ich glaube Ihnen. Aber ich sehe Sie hier vor mir, ich höre Ihnen zu, und ich kann nicht anders, als mich zu fragen: warum. Warum war das notwendig für Sie?«
Es war das zweite Mal, daß sie das gefragt wurde. Normalerweise fragten sie: »Wie?« Für diese Leute hatte sie eine Geschichte, die ihre Erwartungen befriedigte. Die wollte sie auch jetzt erzählen – sie lag ihr auf der Zunge, erprobt, bereit.
Sie atmete ein, um sich zu beruhigen. »Ich könnte Ihnen erzählen, daß ich immer schon sexsüchtig war, eine Nymphomanin«, sagte sie entschlossen.
»Aber das ist nicht die Wahrheit«, sagte er.
»Nein, Hochwürden, das ist es nicht.«
Er nickte, als würde er ihre Antwort gutheißen. »Es wird dunkel«, sagte er, stand auf und schaltete die Stehlampe in der Ecke ein. »Kann ich Ihnen etwas zu trinken anbieten? Kaffee? Tee?«
»Tee wäre schön, vielen Dank.« Sie fragte sich, ob er Zeit brauchte, um sich zu beruhigen.
»Bitte entschuldigen Sie mich einen Moment«, sagte er und öffnete die Tür schräg hinter ihr.
Sie blieb allein und fragte sich, was das Schlimmste war, was er in diesem Raum gehört hatte. Welche Kleinstadt-Skandale? Teenager-Schwangerschaften? Affären? Häusliche Gewalt: Schläge am Freitagabend?
Warum blieb jemand wie er hier? Vielleicht genoß er den Status, denn Ärzte und Priester waren wichtige Menschen in den ländlichen Gebieten, daß wußte sie. Oder vielleicht lief er davon, wie sie? So wie er auch jetzt wieder davongelaufen war, als wäre eine bestimmte Ebene der Wirklichkeit zu viel für ihn geworden.
Er kehrte zurück, schloß die Tür hinter sich. »Meine Frau bringt uns gleich Tee«, sagte er und setzte sich.
Sie wußte nicht, wie sie anfangen sollte. »Habe ich Sie verärgert?«
Er dachte eine Weile darüber nach, bevor er antwortete, als müßte er die Worte erst sammeln. »Was mich ärgert, ist eine Welt – eine Gesellschaft –, die es jemand wie Ihnen erlaubt, die Orientierung zu verlieren.«
»Jeder von uns verliert manchmal die Orientierung.«
»Aber wir werden nicht alle Prostituierte«, sagte er und deutete mit einer großen Geste auf sie, die alles einschloß. »Warum war das notwendig?«
»Sie sind der zweite Mensch, der mich das fragt.«
»Ach?«
»Der andere war ein Polizist in Kapstadt mit zerzaustem Haar.« Sie lächelte, als sie daran zurückdachte. »Griessel – er hatte einen sanften Blick, aber er konnte direkt durch einen hindurchschauen.«
»Haben Sie ihm die Wahrheit gesagt?«
»Beinahe.«
»War er ein … wie nennen Sie sie?«
»Ein Klient?« Sie lächelte.
»Ja.«
»Nein. Er war … bloß … ich weiß auch nicht … verloren?«
»Ich verstehe«, sagte der Priester.
Es klopfte leise an der Tür, und er mußte aufstehen, um das Tablett mit dem Tee entgegenzunehmen.
5
Detective Inspector Benny Griessel öffnete die Augen. Seine Frau stand vor ihm, sie rüttelte ihn mit einer Hand an seiner Schulter und flüsterte drängend: »Benny! Benny, bitte.« Er lag auf dem Wohnzimmersofa, das wußte er. Er mußte hier eingeschlafen sein. Er roch Kaffee; sein Kopf pulsierte schmerzhaft. Der Arm, der unter ihm eingeklemmt lag, war taub, der Blutkreislauf durch sein Körpergewicht abgeschnitten.
»Benny, wir müssen reden.«
Er stöhnte und versuchte, sich aufzusetzen.
»Ich habe dir Kaffee gemacht.«
Er schaute sie an, die tiefen Falten auf ihrem Gesicht. Sie beugte sich immer noch über ihn.
»Wie spät ist es?« Die Worte hatten Mühe, seine Stimmbänder in Schwingung zu versetzen.
»Es ist fünf Uhr morgens, Benny.« Sie setzte sich neben ihn auf das Sofa. »Trink den Kaffee.« Er mußte ihn mit der linken Hand nehmen. Der Becher war heiß an seiner Handfläche.
»Es ist früh«, sagte er.
»Ich muß mit dir reden, bevor die Kinder aufwachen.«
Diese Aussage, zusammen mit dem Ton, in dem sie sie machte, erreichte ihn. Er richtete sich auf und kleckerte Kaffee auf seine Klamotten – immer noch die von gestern. »Was habe ich getan?«
Sie zeigte mit dem Zeigefinger quer durch den Wohnraum. Eine Flasche Jack Daniels stand auf dem Eßtisch, neben seinem unberührten Abendbrotteller. Der Aschenbecher quoll über, und die Scherben eines zerbrochenen Glases lagen neben einem umgestürzten Barhocker am Frühstückstresen.
Er nahm einen Schluck Kaffee, verbrannte sich den Mund, wurde aber den kranken Nachgeschmack der Nacht nicht los. »Tut mir leid«, sagte er.
»Das ist nicht mehr gut genug«, sagte sie.
»Anna …«
»Nein, Benny, es reicht. Ich kann nicht mehr.« Ihre Stimme war ausdruckslos.
»Großer Gott, Anna.« Er streckte die Hand nach ihr aus, sah, wie seine Finger zitterten; er war immer noch betrunken. Als er versuchte, seine Hand auf ihre Schulter zu legen, duckte sie sich unter der Berührung fort, und da bemerkte er die kleine Schwellung ihrer Lippe, die sich bereits dunkel verfärbte.
»Es ist vorbei. Siebzehn Jahre. Das reicht. Mehr kann niemand verlangen.«
»Anna, ich … es ist der Alkohol, du weißt doch, daß ich es nicht so gemeint habe. Bitte, Anna, du weißt doch, das bin nicht ich.«
»Dein Sohn hat dir letzte Nacht vom Stuhl geholfen, Benny. Kannst du dich daran erinnern? Weißt du, was du zu ihm gesagt hast? Kannst du dich erinnern, wie du geflucht hast, bis sich deine Augen verdrehten? Nein, Benny, das kannst du nicht – du kannst dich nie daran erinnern. Weißt du, was er zu dir gesagt hat, dein Sohn? Als du hier lagst, mit offenem Mund und stinkigem Atem? Weißt du das?« Sie stand kurz davor zu weinen, riß sich aber zusammen.
»Was hat er gesagt?«
»Er hat gesagt, er haßt dich.«
Er ließ das einsinken. »Und Carla?«
»Carla hat sich in ihrem Zimmer eingeschlossen.«
»Ich rede mit ihnen, Anna, ich bringe das in Ordnung. Sie wissen, es liegt an der Arbeit. Sie wissen, daß ich nicht so bin …«
»Nein, Benny.«
Er hörte die Endgültigkeit in ihrer Stimme, und sein Herz zog sich zusammen. »Anna, bitte.«
Sie schaute ihn nicht an. Sie fuhr sich mit dem Finger über die Schwellung an der Lippe und sprach nicht in seine Richtung. »Das erzähle ich ihnen jedes Mal: Es liegt an der Arbeit. Er ist ein guter Vater, es ist nur die Arbeit, ihr müßt das verstehen. Aber ich glaube das selbst nicht mehr. Und sie glauben das auch nicht mehr … Denn du bist so, Benny. Du bist es. Es gibt andere Polizisten, die jeden Tag genau dasselbe erleben, aber die betrinken sich nicht. Sie fluchen nicht und schreien nicht und zerbrechen nichts und schlagen nicht ihre Frauen. Es ist vorbei. Endgültig vorbei.«
»Anna, ich höre auf, du weißt, das habe ich schon geschafft. Ich kann das. Du weißt, daß ich das kann.«
»Sechs Wochen lang? Das ist dein Rekord. Sechs Wochen. Meine Kinder brauchen mehr als das. Sie haben mehr als das verdient. Ich habe mehr als das verdient.«
»Unsere Kinder …«
»Ein Säufer kann kein Vater sein.«
Selbstmitleid erfüllte ihn – und Angst. »Ich kann nicht anders, Anna. Ich kann nichts dagegen tun, ich bin schwach, ich brauche dich. Bitte, ich brauche euch alle – ohne euch kann ich nicht weitermachen.«
»Aber wir brauchen dich nicht mehr, Benny.« Sie stand auf, und er sah die beiden Koffer auf dem Boden hinter ihr.
»Das kannst du nicht tun. Dies ist mein Haus.« Er flehte.
»Willst du uns auf die Straße setzen? Entweder du oder wir. Du kannst es dir aussuchen, denn wir werden nicht mehr länger unter einem Dach leben. Du hast sechs Monate, Benny – die gebe ich dir. Sechs Monate, dich zwischen uns und dem Alkohol zu entscheiden. Wenn du trocken bleibst, kannst du zurückkehren, aber dies ist deine letzte Chance. Du kannst die Kinder sonntags sehen, wenn du willst. Du kannst an der Tür klopfen, und wenn du nach Alkohol riechst, schlage ich sie dir vor der Nase zu. Wenn du betrunken bist, brauchst du gar nicht erst herzukommen.«
»Anna …« Er spürte Tränen in sich aufsteigen. Das konnte sie ihm nicht antun, sie wußte ja gar nicht, wie entsetzlich grausam das war.
»Erspar’s mir, Benny, ich kenne all deine Tricks. Soll ich dir deine Koffer raustragen, oder machst du das selbst?«
»Ich muß duschen, ich muß mich waschen, ich kann doch so nicht rausgehen.«
»Dann trage ich sie eben selbst«, sagte sie und nahm in jede Hand einen Koffer.
Auf der Polizeiwache herrschte eine leicht verzweifelte Atmosphäre. Akten lagen in unordentlichen Stapeln, die paar Möbel waren alt, und die überholten Plakate an den Wänden verkündeten hohle Versprechen von Verbrechensprävention. Ein Porträt von Mbeki in einem schmalen, billigen Rahmen hing schief. Die Fliesen auf dem Boden waren farblos grau. Ein kaputter Ventilator stand in einer Ecke, Staub sammelte sich auf dem Metallgitter vor den Flügeln.
In der Luft lag der drückende Geruch des Versagens.
Thobela saß auf einem stahlgrauen Stuhl mit graublauem Bezug, an einer Ecke quoll Schaumstoff heraus. Der Detective stand mit dem Rücken zur Wand. Er schaute seitlich durch ein schmutziges Fenster auf den Parkplatz. Er hatte schmale, herunterhängende Schultern und graue Strähnen in seinem Bärtchen.
»Ich gebe das weiter an die Polizeizentrale in der Provinzhauptstadt. Die speisen es in die nationale Datenbank ein. So läuft das.«
»Eine Datenbank für Flüchtlinge?«
»Kann man so sagen.«
»Wie groß ist diese Datenbank?«
»Groß.«
»Und dann stehen ihre Namen einfach so im Computer?«
Der Detective seufzte. »Nein, Mr. Mpayipheli – die Fotos, das Vorstrafenregister, die Namen und Adressen der Familien und Freunde gehören auch zur Akte. Das alles wird mitgeschickt und weitergegeben. Wir gehen der Sache nach, wenn wir können. Khoza hat Familie am Kap. Rampheles Mutter lebt hier in Umtata. Irgend jemand wird sie treffen und …«
»Fahren Sie nach Kapstadt?«
»Nein. Die Polizei am Kap wird die Untersuchungen weiterführen.«
»Was heißt das, ›die Untersuchungen weiterführen‹?«
»Jemand wird losgehen und fragen, ob Khozas Familie von ihm gehört hat, Mr. Mpayipheli.«
»Und dann sagen die nein und nichts weiter passiert?«
Wieder ein Seufzen, diesmal tiefer. »Es gibt Dinge, die Sie und ich nicht ändern können.«
»Das haben die Schwarzen auch über die Apartheid gesagt.«
»Ich glaube, da gibt es schon einen Unterschied.«
»Sagen Sie mir einfach, wie stehen die Chancen, daß Sie die beiden erwischen?«
Der Detective stieß sich langsam von der Wand ab. Er zog seinen Stuhl unter dem Schreibtisch hervor und setzte sich mit gefalteten Händen. Er sprach langsam, wie jemand, der sehr erschöpft war. »Ich könnte Ihnen sagen, daß die Chancen gut stehen, aber Sie dürfen mich nicht falsch verstehen. Khoza ist vorbestraft – er war bereits im Gefängnis: achtzehn Monate wegen Einbruchs. Dann der bewaffnete Überfall an der Tankstelle, die Schüsse … und jetzt die Flucht. Das ist ein Muster. Eine Spirale. Leute wie er hören nicht auf; ihre Verbrechen werden bloß immer schlimmer. Deswegen stehen die Chancen gut. Ich kann nicht sagen, daß wir sie jetzt erwischen. Ich kann nicht sagen, wann wir sie erwischen. Aber wir werden sie kriegen, denn sie werden sich immer wieder Ärger einhandeln.«
»Was glauben Sie, wie lange dauert das?«
»Das kann ich nicht sagen.«
»Schätzen Sie!«
Der Detective schüttelte den Kopf. »Ich weiß nicht. Neun Monate? Ein Jahr?«
»So lange kann ich nicht warten.«
»Sie haben mein größtes Mitgefühl, Mr. Mpayipheli. Ich verstehe, wie es Ihnen geht. Aber Sie dürfen nicht vergessen, Sie sind nur ein Opfer von vielen. Sehen sie sich nur all diese Akten an! In jeder davon steckt ein Opfer. Und selbst wenn Sie losziehen und mit dem PC reden, macht das keinen Unterschied.«
»Dem PC?«
»Dem Provincial Commissioner, dem Polizeipräsidenten der Provinzhauptstadt.«
»Ich will nicht mit dem Provincial Commissioner reden. Ich rede mit Ihnen.«
»Ich habe Ihnen gesagt, wie es ist.«
Er deutete auf die Unterlagen auf dem Tisch und sagte leise: »Ich möchte eine Kopie der Akte.«
Der Detective reagierte nicht sofort. Eine Stirnfalte bildete sich auf seiner Stirn. Er dachte über die Möglichkeiten nach.
»Das ist nicht erlaubt.«
Thobela nickte, um zu zeigen, daß er verstand. »Wieviel?«
Der Mann betrachtete ihn, schätzte eine Summe und drückte sein Rückgrat durch. »Fünftausend.«
»Das ist zuviel«, sagte Thobela, stand auf und ging in Richtung Tür.
»Drei.«
»Fünfhundert.«
»Es geht um meinen Job. Den riskiere ich nicht für fünfhundert.«
»Keiner wird es je erfahren. Ihr Job ist sicher. Sieben-fünfzig.«
»Tausend«, sagte er hoffnungsvoll.
Thobela wandte sich um. »Tausend. Wie lange brauchen Sie für die Kopie?«
»Ich muß das heute nacht machen. Kommen Sie morgen wieder.«
»Nein. Heute nacht.«
Der Detective schaute ihn an, sein Blick wirkte nicht mehr ganz so erschöpft. »Warum haben Sie es so eilig?«
»Wo können wir uns treffen?«
Die Armut hier war schrecklich. Hütten aus Brettern und verrostetem Blech, der widerwärtige Gestank von Verwesung und Müll. Paralysierende Hitze stieg aus dem Staub auf.
Mrs. Ramphele jagte vier Kinder – zwei Teenager, zwei Kleinkinder – aus der Hütte und bat ihn, sich zu setzen. Drinnen war es sauber, aber heiß, so daß der Schweiß große Kreise auf seinem Hemd bildete. Auf dem Tisch lagen Schulbücher, auf einem wackeligen Regal standen Fotos von Kindern.
Sie glaubte, er wäre von der Polizei, und er tat nichts, um diese Vermutung zu entkräften. Sie entschuldigte sich für ihren Sohn, sie sagte, er wäre nicht immer so gewesen; er wäre ein guter Junge, angestiftet durch Khoza, und wie leicht das hier geschehen könne, wo niemand irgend etwas hatte und es keine Hoffnung gab. Andrew hatte Arbeit gesucht, er war ans Kap gefahren, er hatte die achte Klasse abgeschlossen und dann gesagt, er könnte seine Mutter nicht mehr so hart arbeiten lassen, er würde die Schule später zu Ende bringen. Aber es gab keine Arbeit. Nichts: East London, Uitenhage, Port Elizabeth, Jeffreys Bay, Knysna, George, Mossel Bay, Kapstadt … Zu viel Menschen, zu wenig Arbeit. Manchmal schickte er Geld, sie wußte nicht, woher er es hatte, aber sie hoffte, daß es nicht gestohlen war.
Wußte sie, wohin Andrew jetzt gehen würde? Kannte er Leute am Kap?
Nicht, daß sie wüßte.
War er hiergewesen?
Sie sah ihm in die Augen und sagte nein, und er fragte sich, wieviel von dem, was sie ihm erzählt hatte, der Wahrheit entsprach.
Sie hatten den Grabstein errichtet. Pakamile Nzululwazi. Sohn von Miriam Nzululwazi. Sohn von Thobela Mpayipheli. 1996–2004. Ruhe in Frieden.
Ein schlichter Stein, Granit und Marmor im grünen Gras am Fluß. Er lehnte am Pfefferbaum und dachte daran, daß dies der Lieblingsort des Jungen gewesen war. Er hatte ihn oft durch das Küchenfenster beobachtet, und der Kleine hockte hier auf den Fersen, manchmal schaute er einfach nur dem braunen Wasser zu, das langsam vorbeifloß. Manchmal hielt er einen Stock in Händen, kratzte Muster und Buchstaben in den Sand – und er fragte sich, woran Pakamile dachte. Die Möglichkeit, daß er an seine Mutter dachte, schmerzte ihn sehr, denn daran konnte er nichts ändern, diesen Schmerz konnte er nicht lindern.
Manchmal versuchte er darüber zu sprechen, aber vorsichtig, denn er wollte die alte Wunde nicht wieder aufreißen. Also fragte er: »Wie geht es dir, Pakamile?«, »Macht dir etwas Sorgen?« oder »Bist du glücklich?« Und der Junge entgegnete mit seiner natürlichen Fröhlichkeit, daß alles in Ordnung sei, er sei sehr glücklich, denn er habe ja ihn, Thobela, und die Farm und das Vieh und überhaupt. Aber er hegte dennoch stets den Verdacht, daß dies nicht die ganze Wahrheit war, daß der Junge irgendwo in seinem Kopf einen geheimen Ort barg, an dem er sich ganz allein mit seinem Verlust auseinandersetzte.
Acht Jahre, in denen sein Vater ihn im Stich gelassen und er eine liebende Mutter verloren hatte.
Das konnte doch wohl nicht die Summe eines Lebens sein? Das konnte doch einfach nicht richtig sein? Es mußte einen Himmel geben, irgendwo … Thobela schaute hinauf in das Blau und fragte sich, war Miriam dort, zwischen weiten grünen Hügeln, um Pakamile willkommen zu heißen? Gab es einen Ort, an dem Pakamile mit seinen Freunden spielen konnte? Alle Rassen gemeinsam, ein großes Durcheinander, alle mit demselben Gerechtigkeitssinn? Wasser, an dessen Ufer man ruhen konnte. Und Gott, ein großes schwarzes Wesen, ein König mit einem dichten grauen Bart und weisem Blick, der jedermann mit einer Umarmung und freundlichen Worten im großen Kraal willkommen hieß, aber der schmerzerfüllt über die süßen grünen Ländereien auf der zerbrochenen Erde schaute. Der den Kopf schüttelte, weil niemand etwas unternahm, denn sie waren alle blind seinen Absichten gegenüber. Er hatte sie doch nicht so erschaffen.
Langsam ging er den Abhang hinauf zum Haus, blieb wieder stehen und schaute sich um.
Sein Land, so weit er sehen konnte. Ihm wurde klar, daß er es nicht mehr länger wollte. Die Farm hatte keinen Nutzen mehr für ihn. Er hatte sie für Miriam und Pakamile gekauft. Damals war sie ein Symbol gewesen, ein Traum, ein neues Leben – jetzt war sie nichts als ein Mühlstein, eine Erinnerung an all das Potential, das nicht mehr länger existierte. Was sollte man mit eigenem Grund und Boden, wenn man nichts hatte?
6
Aus der Wohnung im zweiten Stock in Mouille Point konnte man das Meer sehen, wenn man im richtigen Winkel zum Fenster hinausschaute. Die Frau lag im Schlafzimmer und Detective Inspector Benny Griessel stand im Wohnzimmer und betrachtete die Fotos auf dem Piano, als der Mann von der Spurensicherung und der Polizeifotograf hereinkamen.
Der Spurensicherer sagte: »Großer Gott, Benny, siehst du furchtbar aus«, und er antwortete: »Schmeichelei bringt dir gar nichts.«
»Was haben wir hier?«
»Eine Frau in den Vierzigern. Mit dem Kabel des Wasserkochers erwürgt. Keine Einbruchsspuren.«
»Klingt bekannt.«
Griessel nickte. »Gleicher Tathergang.«
»Die dritte.«
»Die dritte«, bestätigte Griessel.
»Scheiße.« Das hieß, es würde keine Fingerabdrücke geben. Alles wäre abgewischt.
»Aber die hier ist noch nicht reif«, sagte der Fotograf.
»Weil ihre Putzfrau am Samstag kommt. Die anderen haben wir erst montags gefunden.«
»Also treibt er’s Freitagnacht.«
»Sieht so aus.«
Als sie sich an ihm vorbei ins Schlafzimmer quetschten, schnupperte der Spurensicherer theatralisch und sagte: »Aber irgendwas riecht übel.« Dann sagte er leise, freundlicher: »Du solltest mal duschen, Benny.«
»Mach einfach deine verdammte Arbeit.«
»Ich sag’s ja nur«, sagte er und ging ins Schlafzimmer. Griessel hörte das Klicken, mit dem die Koffer aufsprangen, und der Spurensicherer sagte zum Fotografen: »Das sind die einzigen Mädchen, die ich heutzutage nackig zu sehen kriege. Leichen.«
»Wenigstens reden die nicht dazwischen«, war die Antwort.
Griessel brauchte keine Dusche. Er brauchte einen Drink. Wo konnte er hin? Wo sollte er heute nacht schlafen? Wo seine Flasche verstecken? Wann würde er seine Kinder wiedersehen? Wie sollte er sich auf seine Arbeit konzentrieren? Es gab einen Schnapsladen in Sea Point, der in einer Stunde aufmachte.
Sechs Monate, dich zwischen uns und dem Alkohol zu entscheiden.
Was glaubte sie, wie er das schaffen sollte? Indem sie ihn hinauswarf? Indem sie noch mehr Druck auf ihn ausübte? Indem sie ihn zur Hölle schickte?
Wenn du trocken bleibst, kannst du zurückkehren, aber dies ist deine letzte Chance.
Er durfte sie nicht verlieren, aber er konnte auch nicht trocken bleiben. Er war am Arsch, komplett am Arsch. Denn wenn er sie nicht hatte, würde er auch nicht aufhören können zu trinken – konnte sie das denn nicht verstehen?
Sein Handy klingelte.
»Griessel.«
»Schon wieder eine, Benny?« Senior Superintendent Matt Joubert. Sein Boß.
»Gleicher Tathergang«, sagte er.
»Irgendwelche guten Nachrichten?«
»Noch nicht. Er ist ganz schön clever, dieser Wichser.«
»Halt mich auf dem laufenden.«
»Mach ich.«
»Benny?«
»Ja, Matt?«
»Alles in Ordnung?«
Schweigen. Joubert konnte er nicht anlügen – zu viel gemeinsame Geschichte.
»Komm und rede mit mir, Benny.«
»Später. Erst mal muß ich hier fertig sein.«
Ihm dämmerte, daß Joubert irgend etwas wußte. Hatte Anna …
Sie meinte es ernst. Diesmal hatte sie sogar Matt Joubert angerufen.
Er fuhr mit dem Motorrad nach Alice, um einen Mann zu besuchen, der Waffen noch von Hand fertigte. So wie es ihre Vorfahren getan hatten.
Im Inneren des kleinen Gebäudes war es dämmrig, und als seine Augen sich an die Beleuchtung gewöhnt hatten, sah er die Assegais durch, die gebündelt in Dosen standen, Schaft nach unten, die glänzenden Klingen nach oben gerichtet.
»Was machen Sie mit so vielen?«
»Sie sind für Menschen mit Tradition«, sagte der Graubart, die Hände beschäftigt damit, aus einem langen Ast einen Schaft zu formen. Das Sandpapier ratschte rhythmisch auf und ab.
»Tradition«, wiederholte er.
»Davon gibt es nicht viele heutzutage. Nicht viele.«
»Warum machen Sie auch lange Speere?«
»Auch sie gehören zu unserer Geschichte.«
Er wandte sich einem Bündel mit kürzerem Schaft zu. Seine Finger strichen über die Klingen – er suchte nach einer bestimmten Form, einem speziellem Gleichgewicht. Er zog einen heraus, prüfte ihn, steckte ihn zurück und nahm einen anderen.
»Was wollen Sie mit einem Assegai?« fragte der alte Mann.
Er antwortete nicht sofort, denn seine Finger hatten den richtigen gefunden. Er lag gut in seiner Hand.
»Ich gehe jagen«, sagte er. Als er aufschaute, sah er große Zufriedenheit im Blick des Graubartes.
»Als ich neun wurde, schenkte meine Mutter mir ein paar Platten zum Geburtstag. Eine Schachtel mit zehn Singles und dazu ein Buch mit Bildern von Prinzessinnen und guten Feen. Darin standen Geschichten, und zu jeder Geschichte gab es mehr als ein Ende – drei oder vier. Ich weiß nicht genau, wie es funktionierte, aber jedes Mal, wenn man sich das anhörte, sprang die Nadel zu einem von mehreren Schlüssen. Eine Frau erzählte die Geschichten. Auf englisch. Wenn das Ende unglücklich war, spielte ich die Geschichte noch einmal, bis sie richtig zu Ende ging.«
Sie war nicht sicher, warum sie das erzählt hatte, und der Priester fragte: »Aber das Leben funktioniert nicht so?«
»Nein«, sagte sie, »Das Leben funktioniert nicht so.«
Er rührte in seinem Tee. Sie saß da mit der Tasse im Schoß, beide Füße nun auf dem Boden, und die Szene schien aus einem Theaterstück zu stammen, das sie ansahen: Die Frau und der Priester tranken Tee in seinem Arbeitszimmer aus feinem weißen Porzellan. Es war so normal. Sie könnte ein Mitglied seiner Gemeinde sein, unschuldig, auf der Suche nach Lebensratschlägen. Vielleicht über eine Beziehung? Mit einem jungen Farmer? Er schaute sie väterlich an, und sie wußte: Er mag mich, er findet mich okay.
»Mein Vater war bei der Armee«, sagte sie.
Er nippte an seinem Tee, um die Temperatur einzuschätzen.
»Er war Offizier. Ich wurde in Upington geboren; damals war er Captain. Meine Mutter war zuerst Hausfrau. Später arbeitete sie in einer Anwaltskanzlei. Manchmal war er lange Zeit weg von zu Hause, aber daran erinnere ich mich nicht wirklich, denn ich war noch klein. Ich bin die Älteste; mein Bruder wurde zwei Jahre nach mir geboren. Gerhard. Christine und Gerhard van Rooyen, die Kinder von Captain Rooies und Mrs. Martie van Rooyen aus Upington. Rooies hieß er bloß wegen seines Nachnamens, so ist das bei der Armee, jeder hat einen Spitznamen. Mein Vater sah gut aus, er hatte schwarzes Haar und grüne Augen – ich habe meine Augen von ihm. Und mein Haar von meiner Mutter, also werde ich wahrscheinlich früh ergrauen, so ist das mit blonden Haaren. Es gibt Fotos von ihrer Hochzeit, da trug sie ihr Haar auch lang. Aber später schnitt sie es ab. Sie sagte, es wäre wegen der Hitze gewesen, aber ich glaube, es war wegen meines Vaters.«
Er schaute sie an, ihren Mund. Hörte er ihr zu, hörte er ihr wirklich zu? Sah er sie so, wie sie war? Würde er sich später erinnern, wenn sie ihren großen Betrug enthüllte? Sie schwieg einen Moment, hob die Tasse an die Lippen, nippte, sagte unsicher: »Es wird lange dauern, Ihnen alles zu erzählen.«
»Zeit gehört zu den Dingen, von denen wir hier viel haben«, sagte er ruhig. »Wir haben viel Zeit.«
Sie deutete zur Tür. »Sie haben eine Familie, und ich …«
»Sie wissen, daß ich hier bin und daß ich meine Arbeit tue.«
»Vielleicht sollte ich morgen wiederkommen.«
»Erzählen Sie Ihre Geschichte, Christine«, sagte er leise. »Legen Sie die Last ab.«
»Sicher?«
»Absolut.«
Sie schaute hinunter auf ihre Tasse. Sie war noch halb voll. Sie hob sie, trank sie aus, stellte sie auf die Untertasse und stellte beides auf das Tablett auf dem Schreibtisch. Sie zog ihr Bein wieder unter sich und legte die Arme über Kreuz. »Ich weiß nicht, wieso es schiefging«, sagte sie. »Wir waren wie alle anderen. Vielleicht nicht ganz, denn mein Vater war ein Soldat, und in der Schule waren wir immer die Armeekinder. Wenn die Flossies, die Soldaten der Transportflugzeuge, losflogen, wußte die ganze Stadt davon – unsere Väter gingen gegen die Kommunisten kämpfen. Dann waren wir etwas Besonderes. Das gefiel mir. Aber die meiste Zeit waren wir wie die anderen. Gerhard und ich gingen zur Schule, und am Nachmittag war unsere Mutter da; wir machten Hausaufgaben und spielten. Am Wochenende gingen wir einkaufen und grillten und machten Besuche und gingen in die Kirche, und im Dezember fuhren wir immer nach Hartenbos, es war wirklich nichts Besonderes an uns. Nichts, was mir aufgefallen wäre, als ich sechs oder acht oder zehn war. Mein Vater war mein Held. Ich erinnere mich noch an seinen Geruch, wenn er am Nachmittag nach Hause kam und mich umarmte. Er nannte mich sein großes Mädchen. Er hatte eine Uniform mit glänzenden Sternen auf der Schulter. Und meine Mutter …«
»Sind Ihre Eltern noch am Leben?« fragte der Priester plötzlich.
»Mein Vater ist tot«, sagte sie. Endgültig, als würde sie dazu nichts mehr sagen.
»Und Ihre Mutter?«
»Es ist lange her, daß ich sie gesehen habe.«
»Ach?«
»Sie lebt in Mossel Bay.«
Er sagte nichts.
»Sie weiß es jetzt. Was für eine Arbeit ich gemacht habe.«
»Aber sie hat es nicht immer gewußt?«
»Nein.«
»Wie hat sie es herausgefunden?«
Sie seufzte. »Das ist Teil der Geschichte.«
»Und Sie glauben, sie lehnt Sie ab? Weil sie es jetzt weiß?«
»Ja. Nein … ich glaube, sie ist auf einem Schuld-Trip.«
»Weil Sie Prostituierte wurden?«
»Ja.«
»Und, ist es ihre Schuld?«
Sie konnte nicht mehr länger stillsitzen. Sie erhob sich, ging hinüber zu der Wand hinter sich, um eine größere Entfernung zwischen ihnen zu schaffen. Dann näherte sie sich der Rückenlehne ihres Sessels und packte sie.
»Vielleicht.«
»Aha?«
Sie ließ den Kopf sinken, ihr Haar bedeckte ihr Gesicht. So blieb sie stehen, ganz still.
»Sie war sehr schön«, sagte sie schließlich, schaute auf und löste ihre Hände von der Sessellehne. Sie ging nach rechts, auf die Bücherregale zu, den Blick auf die Bücher gerichtet, ohne sie zu sehen.
»Sie verbrachten ihre Flitterwochen in Durban. Und die Fotos … sie hätte jeden Mann haben können. Sie hatte eine tolle Figur. Ihr Gesicht … sie war so hübsch, so zerbrechlich. Und sie lachte, auf allen Fotos. Manchmal glaube ich, das war das letzte Mal, daß sie gelacht hat.«
Sie wandte sich dem Priester zu, lehnte sich mit der Schulter gegen das Bücherregal, strich mit einer Hand liebevoll über die Buchrücken. »Es muß schwer gewesen sein für meine Mutter, wenn mein Vater weg war. Sie hat sich nie beklagt. Wenn sie wußte, daß er nach Hause kam, brachte sie das Haus in Ordnung, von oben bis unten. Sie nannte es den Frühjahrsputz. Aber sich selbst nie. Sauber und ordentlich, ja. Aber sie benutzte immer weniger Make-up. Ihre Kleidung wurde unförmiger, langweiliger. Sie schnitt sich das Haar. Sie wissen ja, wie es ist, wenn man jeden Tag mit jemand verbringt – man bemerkt die kleinen Veränderungen nicht.«
Sie legte die Arme wieder über Kreuz, umarmte sich, wappnete sich.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: